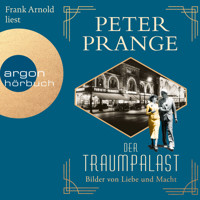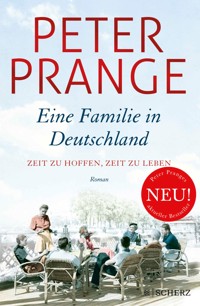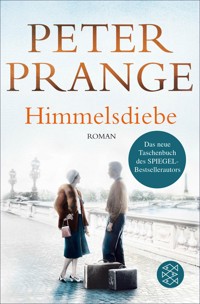8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Traum aus Kristall und Stahl: Peter Pranges mitreißender Bestseller über Fortschritt und Aufbruchsstimmung im viktorianischen London. London, 1851. Emily ist die engste Mitarbeiterin ihres Vaters Joseph Paxton. Gemeinsam bauen sie einen Traum aus Licht, Glas und Stahl: den gigantischen Kristallpalast für die Weltausstellung. Emily ist erfüllt vom Glauben an den Fortschritt. Doch dann trifft sie Victor wieder, den Freund aus Kindertagen. Die beiden verlieben sich – und Victor zeigt ihr seine Welt. Erschüttert sieht sie Hunger, Armut, Krankheit und Tod mitten in London. Emily muss sich entscheiden: für ihrem bewunderten Vater oder für den Mann, den sie liebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
PETER PRANGE
Die Rebellin
Roman
Über dieses Buch
London, 1851. Emily ist die engste Mitarbeiterin ihres Vaters Joseph Paxton. Gemeinsam bauen sie einen Traum aus Licht, Glas und Stahl: den gigantischen Kristallpalast für die Weltausstellung. Emily ist erfüllt vom Glauben an den Fortschritt. Doch dann trifft sie Victor wieder, den Freund aus Kindertagen. Die beiden verlieben sich – und Victor zeigt ihr seine Welt. Erschüttert sieht sie Hunger, Armut, Krankheit und Tod mitten in London. Emily muss sich entscheiden: für ihrem bewunderten Vater oder für den Mann, den sie liebt.
Weitere Titel von Peter Prange:
›Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben.‹
›Unsere wunderbaren Jahre‹
›Das Bernstein-Amulett‹
›Himmelsdiebe‹
›Die Rose der Welt‹
›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹
›Die Philosophin‹
›Die Principessa‹
›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Die Webseite des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2005 by Peter Prange
vertreten durch AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München.
Die Originalausgabe erschien 2005 im Droemer Verlag
unter dem Titel »Miss Emily Paxton«.
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de, München
Coverabbildung: Arcangel Images / Lee Avison und Bridgeman Images, Berlin (Glaspalast)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490514-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
PROLOG — Das Geheimnis des Lebens
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
ERSTES BUCH — Die zweite Schöpfung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
ZWEITES BUCH — Aufbruch ins Paradies
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
DRITTES BUCH — Der babylonische Turmbau
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
VIERTES BUCH — In der Unterwelt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
FÜNFTES BUCH — Der Kristallpalast: Die ganze Welt an einem Ort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
EPILOG — Der Weltenbrand
DICHTUNG UND WAHRHEIT
DANKE
Für Coco Lina, meine Tochter
»… und ich habe dich gezeugt, und es ist nun deine Frage …«
»It was the best of times, it was the worst of times,
It was the age of wisdom, it was the age of foolishness,
It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
It was the season of light, it was the season of darkness,
It was the spring of hope, it was the winter of despair.«
Charles Dickens,
A Tale of two Cities
PROLOGDas Geheimnis des Lebens
1837
1
»Glaubst du, dass es diese Nacht geschieht?«
Emily flüsterte ganz leise, kaum dass sie zu sprechen wagte, als fürchte sie, mit ihren Worten das Wunder zu zerstören, noch bevor es Wirklichkeit wurde. In dem dunklen großen Treibhaus war es so still wie in einer Kirche. Nur ab und zu hörte man, wie ein Tropfen Wasser von einem Blatt in den Teich fiel, während in dem blakenden Licht einer Gaslampe die rings um das Becken wuchernden Pflanzen wie Boten einer anderen Welt aus ihren Schatten traten. Genauso mussten die Nächte im Dschungel sein, dachte Emily, am Amazonas, woher die Riesenpflanze kam, für die ihr Vater das Treibhaus gebaut hatte: Victoria regia, die Königin der Seerosen, die schönste und prachtvollste Blume der Welt. Träge trieb sie im warmen Wasser, jedes ihrer Blätter so groß wie eine Insel, und dazwischen, aufgetaucht aus dem schwarzen Teich wie eine Frucht der Unterwelt, die prall gefüllte Knospe, der Emilys ganze Aufmerksamkeit galt. Rund und glänzend barg sie ihr Inneres, wie ein Geheimnis, das sie niemals preisgeben wollte.
»Vielleicht in dieser Nacht, vielleicht in der nächsten«, erwiderte ihr Vater Joseph Paxton. »Das muss die Natur entscheiden.«
Emily schmiegte sich an ihn, ohne die große dunkle Kapsel eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Ihr Vater hatte ihr ein Wunder versprochen: Hier in Chatsworth, mitten im kalten England, wollte er die Seerose zum Blühen bringen. Das hatte noch kein anderer Gärtner vor ihm geschafft, seit Monaten arbeitete er nur für dieses eine Ziel. Dafür hatte er das Gewächshaus und den Teich gebaut, Heizrohre im Boden verlegt und Gaslampen angebracht, damit die Pflanze, die ein Naturforscher mit einem unaussprechlichen Namen nach Europa gebracht hatte, es so hell und warm hatte wie im tropischen Dschungel und hier, Tausende Meilen vom Amazonas entfernt, ihre ganze Pracht entfaltete. Der Herzog von Devonshire, in dessen Dienst Emilys Vater stand, hatte gesagt, wenn Mr. Paxton das schaffe, sei er ein Zauberer. Doch seit zwei Tagen hatte die Knospe sich nicht mehr gerührt. Die Vorstellung, dass sie sich in dieser Nacht öffnen würde, erschien Emily auf einmal so unwahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass zwischen den Pflanzenblättern ein Krokodil auftauchte.
»Sollen wir vielleicht beten?«, fragte sie.
»Das wird nicht nötig sein«, lachte ihr Vater. »Die Natur wird uns helfen, sie ist auf unserer Seite.«
»Glaubst du? Warum?«
»Ganz einfach. Die Natur will immer nur eins – leben. In jedem Samenkorn, in jeder Blüte, in jedem Blatt.«
»Auch in Victorias Knospe?«
»Auch in Victorias Knospe.«
Emily schaute auf die Pflanze, in der angeblich so geheimnisvolle Kräfte wirkten. Dabei stellte sie sich vor, wie sie selber irgendwann einmal den Amazonas entlangfahren würde, um die Heimat der Seerosen zu erkunden, in einem Einbaum, zusammen mit ihrem Vater. Sie würden Helme und Tropenanzüge tragen, wie die Forscher in ihren Naturkundebüchern, und Cora, der weiße Kakadu, den ihre Eltern ihr zum Geburtstag geschenkt hatten, würde auf ihrer Schulter sitzen und ihnen mit krächzender Stimme den Weg weisen, immer tiefer und tiefer hinein in die grüne, undurchdringliche Finsternis.
»Und was ist«, fragte sie zögernd, »das Leben?«
»Mehr willst du nicht wissen?«, erwiderte ihr Vater. »Wonach du da fragst, mein Liebling, ist das größte Geheimnis, das es überhaupt gibt. Die Menschen haben Jahrtausende lang vergeblich versucht, es zu lösen.«
»Dann weißt du es also auch nicht?«, fragte Emily enttäuscht.
»Doch«, sagte er. »Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, ob du groß genug bist, um es zu verstehen.«
»Wenn du die Antwort weißt«, protestierte sie, »musst du sie mir sagen! Ich bin bestimmt schon groß genug! Ich bin schon fast elf!«
Sie machte sich aus seiner Umarmung frei und blickte ihn an. Wie immer, wenn er nachdachte, ließ er seine mächtigen Wangenkoteletten, die noch buschiger waren als seine schwarzen Augenbrauen, durch die Spitzen seiner Finger gleiten.
»Na, gut«, sagte er endlich, »ich will es versuchen. Aber nur, wenn du mir versprichst, sie keinem anderen zu verraten.«
»Versprochen!«
»Vor allem nicht dem Pfarrer. Und auch nicht dem Lehrer.«
»Ehrenwort!«
Emily wurde immer neugieriger. Was war das für ein Geheimnis, das man vor dem Pfarrer und dem Lehrer geheimhalten musste? Ihr Vater nahm ihre Hände, und während er ihr in die Augen schaute, sagte er, so ernst und eindringlich, wie er sonst nur mit Erwachsenen sprach:
»Alle Lebewesen, ob Tiere oder Pflanzen, haben nur ein Ziel: Sie wollen leben und sich weiterentwickeln. Das ist ihr Sinn und Zweck. Jedes Wesen versucht darum, sich in der Natur so viel Raum und Nahrung zu erobern, wie es dazu braucht.«
Emily schaute auf die Seerose und dachte nach. Als ihr Vater die Pflanze vor drei Monaten in den Teich eingesetzt hatte, waren die Blätter noch kleiner gewesen als die Teller, aus denen sie zum Frühstück ihr Porridge aß, und jetzt waren sie groß wie die Wagenräder an der Kutsche des Herzogs.
»Aber was ist«, fragte sie, »wenn es zu eng wird oder die Nahrung nicht für alle reicht?«
»Dann verdrängen die Großen die Kleinen, die Starken die Schwachen. Denn keine zwei Arten, die sich auf dieselbe Weise ernähren, können in ein und demselben Lebensraum miteinander auskommen. Deshalb ist das Leben ein ewiger Kampf, und nur die Tüchtigsten können darin überleben. Das ist das Gesetz, der Wille des ewigen Schöpfergottes.«
Emily fröstelte trotz der feuchten, schwülen Luft im Treibhaus, während die Worte in der Dunkelheit widerhallten, als hätte nicht ihr Vater sie gesagt, sondern der liebe Gott selbst. Das also war das Geheimnis des Lebens? Sie hatte schon oft gesehen, wie ein Habicht einen kleineren Vogel schlug oder der Fuchs ein Huhn vom Hof raubte, und in einem ihrer Naturkundebücher hatte sie das Bild von einer Gazelle entdeckt, die von einer Riesenschlange zu Tode gewürgt wurde. Aber wirklich verstanden hatte sie die Erklärung ihres Vaters deshalb noch nicht.
»Kann der liebe Gott das wirklich wollen, dass die starken Tiere die schwachen einfach tot machen und auffressen?«
»Ja, Emily, das muss so sein, auch wenn es uns grausam vorkommt. Stell dir die Natur wie einen weise regierten Staat vor, und die starken Tiere darin als die Polizisten oder Soldaten, die nur die Befehle der Regierung befolgen. Ihre Aufgabe ist es, für die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen. Sie hindern die schwachen Tiere daran, sich allzu sehr zu vermehren, und räumen sie fort, bevor sie sich selbst oder anderen Geschöpfen zur Last fallen. Nur so bleibt das Gleichgewicht der Schöpfung bestehen.«
Während Emily versuchte, den Sinn dieser Worte zu erfassen, schien sich der Teich vor ihr in den Kirchplatz von Chatsworth zu verwandeln, und die Pflanzenblätter in ihren Freund Victor und die anderen Dorfjungen, die dort jeden Tag rauften, so lange, bis einer von ihnen am Boden lag und sich nicht mehr wehren konnte.
»Und die Menschen?«, fragte sie. »Kommt es bei ihnen auch nur darauf an, wer am stärksten ist?«
»Ja, mein Liebling. Auch die Menschen wollen nichts anderes als leben und sich weiterentwickeln, immer größer und stärker werden, genauso wie die Tiere und Pflanzen. Dafür arbeiten sie und strengen sich an, dafür erforschen sie ferne Länder und Meere, dafür führen sie Kämpfe und Kriege. Und das Wunderbare daran ist, dass auf diese Weise die herrlichsten Dinge entstehen, die Erfindungen der Menschen genauso wie die Wunder der Natur.«
»Auch durch Kriege?«
»Deshalb brauchst du nicht zu erschrecken«, sagte Paxton, als er Emilys Gesicht sah. »Sicher, Krieg ist etwas Fürchterliches. Und trotzdem ist er nur ein Teil der großen Ordnung, wie Gott sie gewollt hat. Krieg entsteht ja aus ganz natürlichen Regungen des Menschen, aus seinem Willen zu überleben und Streben nach Gewinn, also aus sehr nützlichen Antrieben, die wir täglich brauchen, weil wir uns ohne sie in zahme und träge Wesen verwandeln würden, die an Hunger sterben müssten. Ja«, fügte er hinzu, »auch das gehört zum Geheimnis des Lebens, dass am Ende alles zum Guten beiträgt, sogar so fürchterliche Dinge wie Krieg.«
Die Sätze, die ihr Vater sagte, kamen Emily vor wie schwierige Rechenaufgaben, und um sie zu verstehen, strengte sie ihr Gehirn so sehr an, dass ihr der Kopf davon wehtat. Doch lieber sollte er platzen, als dass sie zugeben würde, noch zu klein dafür zu sein. Kaum aber hatte sie das Gefühl, den Sinn der Worte einigermaßen begriffen zu haben, kam ihr eine neue Frage.
»Warum verbietet Mama mir dann, mit Victor zu spielen?«
»Was hat Victor damit zu tun?«, fragte Paxton verwundert zurück. Doch bevor sie antworten konnte, sprang er auf und trat ans Becken. »Da! Sieh nur! Sie hat sich bewegt!«
Aufgeregt verließ auch Emily ihren Platz. Tatsächlich! Die Knospe zuckte im Wasser, ganz leicht, kaum dass man es mit bloßem Auge erkennen konnte, und doch gab es keinen Zweifel: Irgendetwas im Innern der Kapsel drängte danach, sich aus der Umklammerung zu befreien. Ein Blütenblatt sprang auf, ein zweites, ein drittes, und das reinste, makelloseste Weiß, das Emily je gesehen hatte, quoll hinaus in die Dunkelheit. Vor Ehrfurcht schweigend, Hand in Hand mit ihrem Vater, schaute sie zu, wie sich das Wunder vollzog, die Knospe sich nach und nach öffnete, mal zögernd und tastend, mal rascher, wie von einer inneren Ungeduld beseelt, um sich schließlich in einen Kranz Hunderter Blütenblätter zu ergießen, der sich wie eine strahlend helle Krone vom schwarzen Grund des Teichs abhob.
»Jetzt hast du es selbst gesehen«, flüsterte ihr Vater. »Wenn das Starke das Schwache besiegt, wie das Leben in der Pflanze die Knospe, entsteht Großes und Schönes.«
Emily erwiderte den Druck seiner Hand, so stolz und glücklich wie noch nie in ihrem Leben: Ja, ihr Vater war ein Zauberer, und sie war sein Zauberlehrling. Und während sie da standen, versunken in ihr gemeinsames Schweigen, erhellte draußen, jenseits der gläsernen Wände, ein rosa Schimmer den Himmel, um den neuen Tag anzukündigen.
»Leben!«, krächzte Cora in der Kuppel des Gewächshauses. »Leben! Leben!«
2
Über Chatsworth, dem Jahrhunderte alten Landsitz der Herzöge von Devonshire, wehte die Flagge der englischen Könige, und während aus den Schornsteinen des Küchentrakts weiße Rauchfahnen in den blauen Herbsthimmel aufstiegen, herrschte in den Gängen und Fluren des Schlosses angespannte Betriebsamkeit. Die ganze Dienerschaft war auf den Beinen. In den Küchen wurde auf allen Herden gleichzeitig gekocht, die ältesten und kostbarsten Weine wanderten aus dem Keller hinauf in den prachtvoll geschmückten Festsaal, wo die Tafel für über hundert Gäste mit goldenen Tellern eingedeckt wurde. Denn Queen Victoria, die in diesem Jahr erst den Thron bestiegen hatte, war zu Besuch, zusammen mit Feldmarschall Wellington, dem Bezwinger Napoléons! Mit ihrem halben Hofstaat war sie nach Chatsworth gekommen, um im Gewächshaus des Herzogs die Seerose blühen zu sehen, die ihren königlichen Namen trug.
Vorsichtig spähend, ob draußen Gefahr lauerte, schlich Victor sich aus dem kleinen Cottage am Waldrand, das er zusammen mit seiner Mutter bewohnte. Man hatte allen Kindern im Dorf strengstens verboten, sich an diesem Tag in ihren Lumpen in der Nähe des Schlosses blicken zu lassen. Das war keine leere Warnung: In der Auffahrt waren Wachen aufgestellt, der Förster des Herzogs und ein halbes Dutzend Jäger, dazu Bauern mit aufgepflanzten Knüppeln und Mistgabeln, wie letzten Winter in der Hungersnot, als Captain Swing, der Brandstifter, überall in der Grafschaft die Scheunen und Schober angezündet hatte. Zwischen den Büschen und Bäumen rings um das Hauptgebäude krabbelten Lakaien herum, die in ihren goldbetressten Livreen aus der Ferne wie verkleidete Mistkäfer wirkten, offenbar auf der Suche nach irgendwelchen Störenfrieden, die sich trotz des Verbots hierher wagten, um die Königin zu sehen. Wirkliche Angst aber hatte Victor nur vor Mrs. Paxton, Emilys Mutter. Sie hasste ihn wie die Pest. Wenn die ihn erwischte, musste er sich auf was gefasst machen. Aber sollte Emily darum später behaupten, er sei feige?
Also warf er sich den Jutesack über die Schulter, dessen Inhalt er unter großen Gefahren gesammelt hatte, und machte sich auf den Weg zu dem neuen Treibhaus, das sich am anderen Ende des Parks befand. Dort wollte er Emily überraschen. Emily und die Königin.
Bereits der Weg dorthin führte durch verbotenes Gebiet, vorbei an dunklen Seen, über die einsame Trauerweiden kraftlos ihre Äste sinken ließen, als wären sie schon tot, und durch enge, verwunschene Felsschluchten hindurch, wo es sogar im Sommer nach feuchtem Moos roch und man immer das Gefühl hatte, es könnte einem plötzlich eine Fee oder ein Ritter begegnen. Diesen Teil des Parks, den Mr. Paxton, der Gartenbaumeister des Herzogs und Vater seiner Freundin, angelegt hatte, nannten Victor und Emily das »Paradies«. Hier trafen sie sich heimlich, um Kaulquappen zu fangen, Frösche aufzublasen oder sich einander darin zu messen, wer von ihnen beiden am weitesten den Daumen am Unterarm zurückbiegen konnte. Meistens aber saßen sie einfach nur in der Baumhütte, die sie zusammen in der Krone einer Buche errichtet hatten, und schauten den Garten an. Der Garten war so schön, dass Besucher aus dem ganzen Land nach Chatsworth kamen und Eintritt zahlten, um ihn zu sehen. Für Victor war das kein Wunder, denn Mr. Paxton hatte nicht nur Bäume aus fernen Ländern angepflanzt, die es sonst nirgendwo in England gab, er hatte auch ganze Hügel und Berge versetzt, haushohe Felsbrocken aufeinander getürmt und Wasserfälle angelegt, die sich aus schwindelnder Höhe in die Tiefe stürzten. Wenn Victor sich Gottvater vorstellte, sah er immer das Gesicht von Mr. Paxton vor sich.
Über den Ast einer Ulme kletterte er auf das Dach des Gewächshauses. Auf dem Bauch kroch er dort weiter, langsam und vorsichtig, wie auf einem gerade erst zugefrorenen See. Über dem Wipfel einer Palme, die bis unter das gläserne Dach ragte, hielt er inne. Nur wenige Fuß unter ihm war die königliche Gesellschaft versammelt, zusammen mit dem Herzog und Mr. Paxton. Sie traten gerade an den großen Teich, auf dem die Seerose schwamm.
Als Victor die Königin sah, musste er staunen. Diese kleine runde Frau, die mit ihrer weiß gestärkten Haube und dem bodenlangen Schürzenkleid aussah wie eine junge Wirtschafterin aus dem Schloss, sollte das englische Weltreich regieren? Mit Augen wie ein Kalb schaute sie zu Emilys Vater auf, der mit dem Rücken zu Victor stand und gerade einem uralten, stocksteifen Greis, der offenbar schwerhörig war und sich immer die Hand ans Ohr hielt, irgendwas erklärte. Das musste der Herzog von Wellington sein, der berühmte Feldmarschall. Aber wo war Emily?
Victor schob sich noch ein bisschen weiter vor, doch er konnte seine Freundin nirgends sehen. Hatte sie ihn etwa angelogen, als sie behauptete, sie würde heute der Königin die Seerose zeigen? Oder hatte sie ihrer Mutter verraten, dass er eine Überraschung für sie plante – und musste nun zu Hause bleiben?
Victor schaute zu Mr. Paxton hinüber. Immer, wenn Emilys Vater sich beim Sprechen umdrehte, um auf etwas zu zeigen, sah Victor das Gesicht mit den mächtigen Backenkoteletten und den schwarzen buschigen Augenbrauen. Diesen Mann fürchtete er wie keinen zweiten, und wie keinen zweiten bewunderte er ihn. Der Kutscher des Herzogs hatte ihm erzählt, dass Emilys Vater früher genauso arm gewesen war wie Victor – und was für ein großer Mann war aus ihm geworden! Er war der wichtigste Angestellte des Herzogs, ja sogar dessen Freund. Jeder im Dorf wusste, dass die beiden Männer zusammen durch die halbe Welt gereist waren, nach Rom, nach Athen, nach Konstantinopel, und der Herzog keine Entscheidung traf, ohne sich zuvor mit Mr. Paxton zu beraten. Wenn Victor einen Wunsch im Leben hatte, dann den, eines Tages so zu werden wie Emilys Vater.
Jetzt wandte Mr. Paxton sich zur Tür und winkte jemanden zu sich. Victor hielt den Atem an. Tatsächlich, keine Sekunde später sah er seine Freundin. An der Hand ihrer Mutter betrat sie das Treibhaus, in einem schneeweißen Kleid. Mit erhobenem Kopf, auf dem ihr dunkles Haar zu einem spitzen Turm in die Höhe geflochten war, ging sie auf die Königin zu. Keine zwei Schritt von ihr entfernt blieb sie stehen, dann verneigte sie sich mit einem so tiefen Knicks, dass sie bis auf den Boden sank. Victor vergaß beinahe zu atmen, während er sich an der Glasscheibe die Nase platt drückte. Wie schön Emily in ihrem weißen Kleid aussah, wie eine richtige Prinzessin – viel, viel schöner als die Königin. Er liebte sie, seit er mit ihr der Hündin des Gutsverwalters beim Jungekriegen zugesehen hatte. Sie war das einzige Mädchen im Dorf, das nicht davongelaufen war, als sich Nellys Bauch öffnete und jede Menge Blut und Gedärm und lauter eklige Sachen daraus hervorquollen – ja, sie hatte sogar gefragt, ob es bei Menschen genauso wäre, wenn sie Kinder bekommen. Eigentlich, dachte Victor, müsste die Königin sich vor Emily verneigen, und nicht umgekehrt … Er war so sehr in den Anblick vertieft, dass er fast darüber vergaß, warum er eigentlich hier war.
Mrs. Paxton riss ihn aus seinem Traum. Als hätte sie ihn gerochen, schaute sie plötzlich in die Höhe. Doch zum Glück wurde sie von Emily abgelenkt, die in diesem Augenblick auf einen Wink ihres Vaters ihre Hand los ließ und auf das Seerosenbecken zuging.
Victor zuckte zusammen. Jetzt war es so weit!
Auf einmal pochte ihm das Herz bis zum Hals, und der Sack auf seiner Schulter kam ihm so schwer vor, als wären lauter Steine darin. Sollte er es wirklich wagen? Sein Mund war vor Aufregung ganz trocken, und am liebsten wäre er auf der Stelle wieder vom Dach verschwunden, aber das ging nicht. Er hatte Emily für den Besuch der Königin eine Überraschung versprochen, an die sie sich ihr Lebtag erinnern sollte, und wenn er jetzt kniff, konnte er Emily nie wieder in die Augen schauen, in diese wunderschönen türkisgrünen Augen … Um seine Angst zu überwinden, dachte er an den Lohn, den sie ihm versprochen hatte. Wenn er sich tatsächlich trauen würde, sein Versprechen wahr zu machen, wollte sie ihm einen Kuss dafür geben – einen richtigen, wirklichen Kuss auf den Mund!
Obwohl Victor am ganzen Körper zitterte, kroch er über das Glasdach voran, ohne darauf zu achten, ob man ihn dort unten sah, bis er die Luke über dem Seerosenteich erreichte.
Dann nahm er den Sack von seiner Schulter und öffnete die Schnürung.
3
»Da haben wir ja unser kleines Opfer! Nur Mut, Miss Emily!« Ein feiner Duft wie von reifer Ananas strömte Emily vom Seerosenteich entgegen, als sie unter den Blicken der Königin an den Rand des Beckens trat. Über ein Dutzend Knospen hatten sich in den letzten Nächten geöffnet, um ihr süßliches Aroma zu verströmen, weiße und zartrosa Blütenbüschel, die so groß waren, dass Emily sie nicht mit beiden Händen hätte umfangen können, und die trotzdem wie schwerelos zwischen den grünen Pflanzenblättern im Wasser trieben.
»Wird ihr auch nichts passieren?«, fragte ihre Mutter.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Paxton«, erwiderte der Herzog. »Ihr Mann hat mir sein Wort gegeben.« Noch während er sprach, fasste er Emily unter den Achseln, und ehe sie sich’s versah, hob er sie über den Beckenrand und stellte sie auf eines der riesigen Pflanzenblätter. »Nur ein kleines Experiment.«
Emily wusste, was ihre Aufgabe war, ihr Vater hatte es ihr genau erklärt. Sie sollte der Königin und Feldmarschall Wellington beweisen, dass die Blätter der Pflanze stark genug waren, um einen Menschen zu tragen. Vorsichtig wie eine Ballerina setzte sie ihre Füße auf den schwankenden Grund. Jetzt nur keine falsche Bewegung! Der frisch gestärkte Unterrock, in den ihre Mutter sie am Morgen gesteckt hatte, damit ihr Kleid sich über der Hüfte bauschte, fing auf einmal so heftig an zu kratzen, dass sie es kaum aushielt.
»Da! Ich habe es gewusst!«, rief der Herzog. »Es funktioniert! Sie könnte stundenlang darauf stehen bleiben, ohne dass sie untergeht.«
»Kolossal!«, sagte die Königin. »Gibt es dafür eine Erklärung?«
»Eine Ingenieursleistung der Natur, Majestät«, erwiderte Paxton. »Die Blätter werden auf der Unterseite durch ein sternförmiges Rippengeflecht zusammengehalten. Das macht sie so stark. Sie könnten ein noch viel höheres Gewicht aushalten. Ich denke, bis zu zweihundert Pfund.«
Während ihr Vater sprach, kam es Emily vor, als würden die geheimen Kräfte des Pflanzenblattes durch ihre Füße und Beine hinauf in ihren Körper strömen. Ein jubelndes Glücksgefühl breitete sich in ihr aus. Sie konnte, was kein Mensch sonst konnte – sie konnte auf dem Wasser stehen und wandeln!
»Was zum Teufel macht der Dreckspatz da oben?« Emily schaute hinauf in die Richtung, in die der alte Feldmarschall mit seinem Stock zeigte.
»Victor …«
Über dem Wipfel einer Palme sah sie ihren Freund – er lag bäuchlings auf dem Glasdach, direkt über ihr, das Gesicht in einer offenen Luke, und blickte mit triumphierendem Grinsen auf sie herab. Ihr Herz machte vor Freude einen Sprung. Er hatte sich wirklich getraut! Gleichzeitig erschrak sie zu Tode. Victor hatte sie schon einmal von dort oben überrascht – damals hatte er einen Sack Blindschleichen auf sie herabgeworfen.
»Nein, Victor!«, rief Emily. »Tu’s nicht!«
Zu spät! Victor hatte den Sack bereits geöffnet und begann zu schütteln. Entsetzt schaute sie in die Höhe. Doch was war das? Unzählige Schneeflocken rieselten auf sie herab, riesengroße Flocken, viel größer, als sie in ihrem Leben je gesehen hatte, obwohl doch gar kein Winter war. Plötzlich begriff sie: Nein, das war kein Schnee – das waren Rosenblätter, die Victor auf sie herabstreute, Tausende und Abertausende, vor den Augen der Königin … Der ganze aufgestaute Jubel, die ganze aufgestaute Angst lösten sich in einem jauchzenden Freudenschrei.
Da geschah die Katastrophe. Ein weißes Ungeheuer flatterte krächzend auf sie zu, das große, feste Pflanzenblatt, das sie eben noch so sicher getragen hatte, begann zu schwanken, und ihre Füße kamen auf dem glitschigen Grund ins Rutschen. Im selben Moment verlor sie das Gleichgewicht, sie strauchelte und stolperte, griff in die Luft, um einen Halt zu finden, doch vergeblich.
Ein Aufschrei – dann waren nur noch Wasser und Pflanzen und Algen um sie her, in einer stummen, schleimig grünen Unterwelt, in der die Rufe der Erwachsenen wie aus weiter, weiter Ferne an ihr Ohr drangen, vermischt mit dem Krächzen des Kakadus.
»Leben! Leben!«
Eine Hand packte Emily im Nacken und zog sie in die Höhe. Prustend und triefend tauchte sie aus dem Teich wieder auf. Während ihr Vater sie am Beckenrand absetzte, rief er mit lauter Stimme Befehle, und ein Dutzend Diener rannte davon.
»Rosenblüten«, sagte die Königin. »Eigentlich eine ganz reizende Idee von dem Jungen. Wenn ich mir vorstelle, ein Mann würde das für mich tun … «
»Wirklich reizend«, erwiderte Wellington, »wenn deshalb das Mädchen in den Teich fällt. Wie das Kind aussieht! Wie ein Soldat nach einer verlorenen Schlacht!«
Emily blickte an sich hinab. Erst jetzt wurde sie gewahr, dass ihr neues weißes Kleid von oben bis unten voller grüner Algen war. Wenn das ihre Mutter sah … Doch wo war ihre Mutter?
Als Emily sie entdeckte, stockte ihr der Atem. Ihre Mutter war nicht mehr im Gewächshaus – sie war draußen, auf der anderen Seite der Glaswand, und trieb zwei Lakaien an, die gerade versuchten, Victor von einem Baum herunterzuzerren. Ihr Freund wehrte sich mit Armen und Beinen gegen die Verfolger, schlug und trat nach ihnen, so gut er nur konnte. Emily schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass er ihnen entwischte. Doch es kamen noch mehr Diener angerannt, zu fünft, zu sechst fielen sie über Victor her, packten ihn an den Armen, an den Beinen und schleiften ihn davon.
Bevor Victor hinter einer Hecke verschwand, drehte er noch einmal den Kopf zu Emily herum und schaute sie an, die Augen riesengroß vor Angst und Schmerz und Wut.
4
Nacht war auf das Land herab gesunken, doch die Gärten von Chatsworth erstrahlten in einem Lichtermeer, das weiter als das Auge reichte. Wie ein Märchenschloss funkelte und glitzerte das Seerosenhaus in der Finsternis, und während irgendwo ein unsichtbares Orchester die Nationalhymne anstimmte, ergossen sich die Wasserfälle zwischen den künstlichen Felsengebirgen des Parks im Schein von bengalischem Licht, in dem die herabstürzenden Fluten abwechselnd weiß oder blau oder rot aufschäumten. Tausende von Lampions blinkten in den Bäumen und Hecken, und die Seen und Brunnen spiegelten die Lichter noch einmal so vieler Laternen wider. Eine Kanone wurde vom Jagdturm abgefeuert, dann erbrachen sich Hunderte von Feuergarben prasselnd am Himmel, der in Flammen zu stehen schien. »Hat sich das auch dieser reizende Mr. Paxton ausgedacht?«, fragte die Königin, die das Schauspiel zusammen mit ihrem Hofstaat vom Balkon des Schlosses aus betrachtete.
»Allerdings«, erklärte der Herzog von Devonshire. »Es gibt praktisch nichts, was dieser Mann nicht kann.«
»Ganz erstaunlich für einen Gärtner«, knurrte Feldmarschall Wellington. »Diesen Paxton hätte ich als General gebrauchen können.«
Während die königliche Gesellschaft zusah, wie die Raketen in der Finsternis verglühten, stand Emily im Nachthemd vor dem Spiegel ihres Schlafzimmers und starrte in ihr eigenes Gesicht. Diese verquollenen Augen, diese triefende Nase, dieser zitternde Mund – wie hasste sie das Mädchen, das ihr von der kalten, silbern schimmernden Fläche an der Wand entgegenblickte!
Sie hatte die Vorhänge zugezogen, um nichts zu hören oder zu sehen. Wie immer, wenn sie es nicht mehr aushielt, weil sie etwas Schlimmes getan hatte, das sich nicht mehr rückgängig machen ließ, verzerrte sie ihr Gesicht vor dem Spiegel zu Fratzen, kniff die Augen zusammen, krauste die Nase, stülpte die Lippen auf, um sich selbst nicht mehr erkennen zu müssen in den Zuckungen ihrer Züge. Und doch, je fremder sie sich mit jeder Grimasse wurde, mit denen sie ihrem Spiegelbild näher und näher rückte, als wolle sie es aus der Glasscheibe verjagen, umso unausweichlicher wurde die quälende Gewissheit, dass immer wieder sie es war, die da ihr Gesicht verzog und verzerrte: Emily Paxton, dasselbe Mädchen, das vor wenigen Stunden der Königin die Seerosen gezeigt hatte, dasselbe Mädchen, das die Schuld trug an allem, was danach geschehen war. Noch immer hörte sie die Schreie ihres Freundes, wie er im Hof verprügelt worden war. Noch nie hatte sie jemanden so schreien hören, weder einen Menschen noch ein Tier – nicht einmal die Hündin des Gutsverwalters, die der Pfarrer totgetrampelt hatte, damit die Dorfkinder nicht sahen, wie sie ihre Jungen zur Welt brachte, hatte inmitten ihrer blutigen, quietschenden Welpen so laut geschrien wie Victor, und während Tränen ihre Wangen hinabliefen, sah Emily noch einmal sein Gesicht, wie er sich verzweifelt nach ihr umgedreht hatte, und der Ausdruck darin war entsetzlicher gewesen als die schlimmste Fratze, die sie jetzt vor dem Spiegel zog.
Plötzlich hörte sie Schritte auf dem Flur. Eilig huschte sie zum Bett und warf sich in das dunkle Matratzengebirge, in der verzweifelten Hoffnung, für immer darin zu verschwinden.
Die Tür ging auf, und ihre Mutter stand im Raum.
»Hast du gewusst, was Victor vorhatte?«, fragte sie, mit vor Zorn bebender Stimme. »Er hat nicht nur die Königin zu Tode erschreckt, sondern auch Dutzende Rosenbeete verwüstet. Hast du eine Ahnung, was das kostet? Antworte, wenn ich mit dir spreche!« Sie rüttelte Emily so heftig an der Schulter, dass es schmerzte. »Sag, bist du seine Komplizin?«
Emily schüttelte stumm den Kopf. Sie hatte nicht den Mut, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen. Zu groß und bedrohlich war die dunkle Gestalt, die sich über ihr Bett beugte.
»Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Bis Ostern darfst du weder den Park noch ein Gewächshaus betreten. Und beten musst du von heute an allein.«
Ohne Gutenachtkuss wandte ihre Mutter sich ab.
Draußen leuchtete eine Rakete auf, und all die toten und lebenden Wesen, die Emilys Zimmer bevölkerten, traten aus ihren Schatten hervor: der schwarze, ledrige Schrumpfkopf aus Afrika zwischen zwei über Kreuz hängenden Pfeilen, die aufgespießten Schmetterlinge mit ihren reglosen Flügeln, der ausgestopfte Luchs und die Eule, die Blindschleichen in den Spirituskolben, die sich in der trüben Flüssigkeit immer noch zu winden schienen, und Pythia, Emilys uralte Schildkröte, die mit ihrem Salatblatt im Maul aussah, als wäre sie in ihrem Terrarium für alle Zeit erstarrt. Emily blickte sie hilfesuchend an. Die Schildkröte hatte ihr schon oft geholfen, wenn sie nicht mehr weiter wusste. Wenn sie sich jetzt bewegen würde, bevor sie selbst bis drei gezählt hatte, dann …
Die Schildkröte lugte unter ihrem Panzer hervor, und das Salatblatt fiel aus ihrem Maul.
»Mama!«, rief Emily.
Ihre Mutter, die bereits die Tür geöffnet hatte, blieb stehen und drehte sich um. »Ja, was ist? Möchtest du dich entschuldigen?« Emily schüttelte den Kopf.
»Nun – wie du willst.«
Obwohl ihre Zähne vor Angst aufeinander schlugen, fasste Emily sich ein Herz. »Was tut ihr mit Victor?«, fragte sie.
»Mit Victor?«, erwiderte ihre Mutter. »Dein Vater und ich haben ihn fortgeschickt. Böse Menschen wie er haben hier keinen Platz. Er wird noch diese Nacht Chatsworth verlassen.«
»Aber warum?«, protestierte Emily. »Er hat doch nichts Böses getan! Er ist mein Freund!«
»Nein, das ist er nicht, mein Kind. Victor ist böse, ein Verbrecher, von Geburt an. Du wirst ihn nie mehr Wiedersehen.«
ERSTES BUCHDie zweite Schöpfung
1849
1
Wer London je mit eigenen Augen erblickte, war überwältigt von der unermesslichen Größe der Stadt, die auch dem kaltblütigsten Besucher Ehrfurcht und Bewunderung einflößte. Denn anders als Rom oder Paris war London nicht Hauptstadt eines einzelnen Landes, sondern Hauptstadt der ganzen Welt. Auf einhundertundzwanzig Quadratkilometern ballte sich hier der Erdkreis zusammen, hier lebten an einem einzigen Ort mehr als drei Millionen Menschen, Abkömmlinge aller Völker und Rassen, vereint in pausenloser, unermüdlicher Tätigkeit: ruheloser Schmelztiegel der Menschheit, machtvolle Kapitale des Britischen Empires, ewig summender Umschlagplatz des Welten umspannenden Kolonialreiches – ein einziger gigantischer Basar, wo die Wunder der Zivilisation und des Fortschritts zu bestaunen waren, die das riesige Menschenmahlwerk London fortwährend produzierte.
Wie eine Festung von Recht und Ordnung erhob sich inmitten dieses Getriebes das Coldbath-Fields-Gefängnis, die Korrektionsanstalt der Grafschaft Middlesex. 1794 im Norden der Stadt, unweit von Phoenix Place, auf einem ehemaligen Gräberfeld erbaut, war es von einer mächtigen Backsteinmauer umgeben, die das neun Hektar große Areal vor fremden Blicken abschirmte. Nur eine Glocke, die alle Viertelstunde schrill ertönte, sowie zwei riesige Mühlenflügel, die wie zur immer wiederkehrenden Erinnerung an die langsam, aber sicher mahlenden Mühlen Gottes über der Gefängnismauer in den Himmel aufstiegen, zeugten von der Existenz der eintausenddreihundertachtundachtzig Häftlinge, die hier zur Strafe ihrer Verbrechen und zur Besserung ihres Charakters in Verwahrung gehalten wurden.
»Victor Springfield!«
»Hier, Sir! Jawohl, Sir!«
»Raustreten!«
Ein Schlüssel wurde herumgedreht, ein Riegel zurückgeschoben, und lautlos öffnete sich die schwere Eisentür in den geölten Angeln. Victor schloss kurz die Augen, dann erhob er sich von der Pritsche, setzte sich die Anstaltskappe auf und trat aus der Zelle, um sich zum letzten Mal in den stummen Zug der Häftlinge einzureihen, den Oberaufseher Walker den Gang entlangführte. Während die Männer, die Augen vorschriftsmäßig zu Boden gesenkt, in ihren grauen Uniformen den Zellenflur entlangtrotteten, dröhnten ihre genagelten Stiefel auf dem Stahlboden der Galerie, als wollten sie mit jedem Schritt das Schweigen betonen, das an diesem Ort Tag und Nacht unter den Gefangenen herrschte. Denn jede Form des Kontakts, sei es durch Worte, Gesten oder Blicke, war ihnen strengstens untersagt, auch an diesem Tag, an dem Victor, zusammen mit siebzehn anderen Häftlingen, aus der Korrektionsanstalt entlassen wurde.
Wieder schrillte die Glocke. Es war halb neun Uhr in der Frühe, und in der Tretmühle, dem meistgehassten Ort der ganzen Anstalt, fand gerade der viertelstündliche Schichtwechsel statt, als Walkers Abteilung den Innenhof durchquerte. Die Männer, die während der abgelaufenen Schicht Pause gemacht hatten, erhoben sich von den Ruhebänken, um ihre erschöpften Leidensgenossen abzulösen, mit resignierten, hoffnungslosen Gesichtern. Jeder Häftling, der zu Schwerarbeit verurteilt war, musste täglich fünfzehn Viertelstunden in dieser mechanischen Folterkammer verbringen, die in sechsundneunzig nummerierte, kaum schulterbreite Einzelkammern unterteilt war, eine für jeden Sträfling und jede von der anderen durch hohe Holzwände getrennt, sodass der ganze Apparat, sobald die Männer einer Schicht darin Aufstellung genommen hatten, wie ein gigantisches Pissoir aussah. Die Hände auf einer Haltestange aufgestützt, bewegten sie ihre Beine, als würden sie eine Treppe hinaufsteigen, doch statt durch diese Tätigkeit an Höhe zu gewinnen, ließen sie nur die Stufen des Tretrades hinter sich, ohne sich selbst von der Stelle zu rühren. Schon nach wenigen Minuten quollen ihnen vor Anstrengung die Augen aus den Höhlen, und der Schweiß tropfte ihnen von der Stirn, denn die Last, die sie mit der Kraft ihrer Beine voranbewegten, entsprach ihrem eigenen Körpergewicht, und die Luft in den engen Kammern wurde von der Erhitzung ihrer Leiber in kürzester Zeit so unerträglich heiß, dass sie ihre Beine nur langsam und schleppend hoben wie Pferde vor der Pflugschar in einem tief gefurchten Acker. Doch kein Laut drang über ihre Lippen, all ihre Mühsahl und Qual vollzog sich in jenem unwirklichen Schweigen, das wie das Schweigen Gottes jeden Winkel der Anstalt erfüllte. Denn wer gegen das Sprechverbot verstieß, das die wechselseitige Ansteckung der Gefangenen durch das Gift des zum Bösen verführenden Wortes unterbinden sollte, wurde unausweichlich bestraft, mit Nahrungsentzug, Dunkelarrest und in schweren Fällen auch mit der Peitsche.
»Abteilung rechts schwenkt marsch!«
Walkers Trupp verließ den Hof und trottete durch ein Tor in das Verwaltungsgebäude. Victor warf einen letzten Blick auf den Ort seiner Leiden. Hier hatte er ein Jahr, sieben Monate und zehn Tage verbracht, Strafe für einen einzigen Augenblick, in dem sein Jähzorn über seine Selbstbeherrschung gesiegt hatte. Er hatte ausgerechnet, dass er während seiner Haft genau fünfhunderteinundneunzigtausendsechshundert Schritte in der Tretmühle voreinander gesetzt hatte, achtzig in jeder Schicht, eintausendzweihundert an jedem Tag, abzüglich der Sonntage, die der Andacht und dem Gebet vorbehalten waren. Und all die Kraft und Energie, die er hier im Schweiße seines Angesichts gelassen hatte, die Anstrengung seiner Muskeln und seines Willens, hatte keinem anderen Zweck gedient, als die zwei riesigen Mühlenflügel auf dem Dach des Gebäudes in Gang zu halten, ohne irgendeine Maschine oder sonstige Vorrichtung anzutreiben. Er wusste nicht, was schlimmer war: diese sinnlose, zermürbende Schinderei oder das ewige Schweigen. Jetzt, in der Stunde seiner Entlassung, zählte er jede verfluchte Sekunde, die ihn noch von der Freiheit trennte, während das Knarren der Tretmühle, die schleppenden Schritte der Gefangenen in den Rädern ihn bis in das Gebäude hinein verfolgten, so unerträglich wie die ewige Verdammnis, und er musste seine ganze Beherrschung aufbieten, um Oberaufseher Walker nicht niederzuschlagen, damit er diesen Ort endlich verlassen konnte.
»Abteilung halt!«
In der Eingangshalle, vor dem Büro von Direktor Mayhew, nahm Victor mit den anderen Häftlingen Aufstellung. Gleich darauf trat Mayhew, gefolgt von einem Schreiber, aus der Tür, um die Entlassungen vorzunehmen. Ein Hilfswärter teilte den Männern ihre alten Kleider aus, und während sie diese gegen die grauen Anstaltsuniformen tauschten, drückte der Direktor, ein wegen seiner Frömmigkeit gefürchteter Mann mit straffer, aufrechter Haltung und blank polierter Glatze, seine Hoffnung aus, dass sie nunmehr bessere Menschen seien als diejenigen, die diese Kleider bei Antritt ihrer Haft vor Jahr und Tag hier abgelegt hatten.
»Wofür hat man dich bestraft?«, fragte er einen jungen Maurer, den ersten Häftling in der Reihe, dem sein alter Arbeitsanzug viel zu weit um den mageren Leib schlotterte und dessen Füße in Schuhen ohne Sohlen steckten.
»Ich habe einen Hammel gestohlen, Sir. Ich … ich hatte keine Arbeit und musste sechs Kinder ernähren.«
»Was hat dich zu dem Verbrechen verleitet?«
»Schlechte Gesellschaft, Sir.«
»Nun, du hast hier arbeiten gelernt und wirst in Zukunft fleißig sein. Doch hüte dich, wenn du jetzt wieder deine alten Kleider trägst, auch in deine alten Gewohnheiten zurückzufallen.«
»Gewiss, Sir … Nein, Sir … Danke, Sir …«
Während der Schreiber die Entlassungspapiere ausfertigte, brachte der Maurer die Worte nur stockend hervor, als müsse er das Sprechen nach so langer Zeit des Schweigens erst wieder erlernen. Direktor Mayhew drückte ihm eine Münze in die Hand und ordnete an, ihm ein Paar besohlte Schuhe auszuhändigen. Dann rief der Schreiber den nächsten Häftling auf, einen zwanzig Jahre alten Taschendieb, der mit ebenso schleppender Stimme wie der Maurer zuvor gelobte, sich nie mehr an fremdem Eigentum zu vergreifen.
»Ich will dich hier nicht Wiedersehen«, sagte der Direktor.
»Niemals, Sir … Bei der Seele meiner Mutter, Sir.«
In der Ferne ertönte ein Harmonium, und gleich darauf ein Choral von Männerstimmen. Während in der Anstaltskapelle der morgendliche Gottesdienst begann, trat ein Küchenjunge, der nicht ganz richtig im Kopf war, vor den Direktor, danach ein Bierkutscher und anschließend ein Sattlergeselle. Victor blickte in ihre Gesichter und konnte die Gleichgültigkeit darin nicht fassen. Während ihm selber jedes Wort zur Qual wurde, das Mayhew in seiner korrekten, umständlichen Art mit den Gefangenen wechselte, als wollte er Victors Rückkehr in die Freiheit nur noch weiter hinauszögern, ließ keiner der Männer eine Gemütsregung angesichts der bevorstehenden Entlassung erkennen. Ausdruckslos, die Gesichter so grau wie die Uniformen, die sie bis vor wenigen Minuten noch getragen hatten, starrten sie vor sich hin und antworteten auf die Fragen des Direktors so leise und unbeteiligt, wie sie vor Wochen oder Monaten auf irgendeine Frage der Wärter geantwortet hatten, alle mit denselben willenlosen Mienen, unfähig, Mayhew in die Augen zu sehen – Fleisch gewordene Unterwürfigkeit. Ja, die Haft hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Nicht das Martyrium der körperlichen Arbeit, auch nicht die Tortur des Schweigens war die eigentliche Strafe in dieser Hölle, die als Musteranstalt des modernen Strafvollzugs im Königreich galt. Der wirkliche Zweck, der hier mit nüchterner Beharrlichkeit verfolgt wurde, das hatte Victor in dem Moment erkannt, in dem er die vollkommene Nutzlosigkeit der Tretmühle begriff, bestand allein darin, den Willen der Menschen zu brechen.
»Und du?« Mayhew blickte Victor mit seinen grauen Augen an.
»Warst du schon einmal hier? Oder in einer anderen Strafanstalt?«
»Nein, Sir«, sagte Victor und trat vor. »Keine früheren Vorstrafen, Sir.«
Nur mit Mühe gelang es ihm, den Blick des Direktors zu erwidern. Er hatte oft genug erlebt, wie Mayhew Häftlinge, die beim Gottesdienst miteinander sprachen, in Dunkelarrest sperren ließ, und wer im Schlafraum dabei überrascht wurde, dass er Unzucht mit sich selber trieb, wurde auf Anweisung des Direktors vor den Augen der Mitgefangenen ausgepeitscht.
»Dann gib Acht, dass es bei diesem einen Mal bleibt.« Mayhew blätterte in den Papieren, die der Schreiber ihm reichte. »Wie ich sehe, hast du einem Polizisten den Arm gebrochen? Bei einem Streik in einer Ziegelfabrik?«
»Notwehr, Sir. Ich habe mich nur verteidigt, Sir. Die Polizisten haben die Ziegelmacher niedergeknüppelt und …«
»Du hast dich den Anordnungen deines Brotherrn widersetzt. Man legt dir Widerspenstigkeit und Rädelsführerei zur Last. Was hattest du überhaupt in der Ziegelei zu suchen?« Der Direktor warf einen zweiten Blick in seine Unterlagen. »Hier steht, du bist Drucker von Beruf.«
»Ich musste Geld hinzuverdienen. Meine Mutter war krank, der Arzt nahm zwei Schilling für jeden Besuch, und ich wollte, dass sie ein eigenes Grab bekam.«
»Hinzuverdienen, obwohl du bereits eine Anstellung hattest? Ist dir bewusst, dass du damit anderen Menschen Arbeit und Brot gestohlen hast?« Mayhew schüttelte den Kopf. Dann fragte er:
»Was wirst du tun, wenn du wieder frei bist? Hast du Pläne?« Victor zögerte. Ja, er hatte Pläne, aber sie gingen den Direktor nichts an. Er wollte London verlassen, so bald wie möglich, um nach O’Connorville zu ziehen, Richtung Norden, in die Nähe von Rickmansworth. Dort hatten die Chartisten, die größte Arbeiterbewegung im Land, eine Kommune gegründet, in der jeder Mann, der hundert Pfund besaß, einen Anteil erwerben konnte, um auf eigene Rechnung zu arbeiten, zusammen mit Gleichgesinnten, ohne dass er von irgendwelchen Blutsaugern ausgebeutet wurde. Die Vorstellung, dort einmal zu leben und vielleicht eine eigene Werkstatt zu betreiben, hatte Victor während all der endlosen Tage und Wochen und Monate seiner Haft am Leben erhalten. Laut sagte er nur:
»Ich will versuchen, Arbeit zu finden, Sir.«
»Recht so, sehr brav.« Direktor Mayhew nickte zufrieden, als hätte er soeben ein Stück Streuselkuchen vertilgt. »Immerhin hast du einen Beruf erlernt.«
»Jawohl, Sir.«
»Ich hoffe, du wirst ihn nutzen. Die Buchdruckerkunst ist ein edles Handwerk, das den Menschen läutert und erhebt. Weil es ihn nicht nur anleitet, über die Feinheiten der Sprache, sondern auch über die Reinheit seiner Gedanken und Empfindungen nachzusinnen.«
Der Anblick des rosigen, selbstzufriedenen Streuselkuchengesichts verursachte Victor Übelkeit, und nur mit Hilfe seiner ganzen Willenskraft konnte er den aufsteigenden Jähzorn, der ihm schon einmal zum Verhängnis geworden war, herunterwürgen. Liebend gern hätte er sein Handwerk in den letzten Monaten ausgeübt, er hatte bei dem besten Drucker Londons gelernt und hätte in der Anstaltsdruckerei sinnvollere Arbeit leisten können als in der verfluchten Tretmühle, aber Mayhew persönlich hatte es ihm verwehrt. Nur wer nicht zu Schwerarbeit verurteilt war, so hatte der Direktor beschieden, besaß das Vorrecht, während der Haft in seinem Beruf zu arbeiten. Eine einzige Woche lang hatte Victor in der Werkstatt aushelfen dürfen, als alle Drucker bis auf Mr. Tallis, den Meister, ausgefallen waren und Direktor Mayhew um die Fertigstellung der Gefängnisbibeln bangte.
»Hast du schon eine Anstellung?«, fragte er. »Vielleicht bei deinem altem Lehrherrn?«
Victor schüttelte den Kopf. »Mein Lehrherr ist mit dem Besitzer der Ziegelei verwandt.«
»Nun, dann hat der Mann allen Grund, sich vor dir zu fürchten. Aber wenn du dich aufrichtig bemühst, wirst du schon Arbeit finden. Fleiß und Tugend werden am Ende immer belohnt. Hast du Geld?«
»Nein, Sir.«
»Dann schenke ich dir einen Schilling. Geld ist der beste Freund eines Mannes, der einen neuen Weg beschreitet.« Er gab ihm die Münze, zusammen mit den Entlassungspapieren. Dann schaute er über die Schulter nach dem Schreiber. »Wer ist der Nächste?« Eine halbe Stunde später trat Victor durch das Gefängnistor ins Freie. Wie oft hatte er sich diesen Moment in seiner Zelle ausgemalt, mit welcher Ungeduld hatte er ihn jede Minute während der verfluchten Haft herbeigesehnt – doch jetzt, als er endlich da war, war nichts so, wie er es sich vorgestellt hatte. Kein Panzer fiel von ihm ab, kein Jubel drängte in seiner Brust. Ein Fleischerkarren zuckelte am Tor vorbei, wie wahrscheinlich jeden Morgen, und auf der anderen Straßenseite unterhielten sich zwei Hausfrauen vor einem Gemüseladen mit einem Milchmädchen, ohne Victor die geringste Beachtung zu schenken.
Er schaute sich um. Niemand war da, der auf ihn wartete. Wer auch? Seine Mutter war tot, und seine früheren Kollegen hatten ihn längst vergessen. Obwohl der Mai schon begonnen hatte, war der Himmel von grauen Wolken verhangen. Ein feiner, nasskalter Nieselregen fiel auf die rußigen Dächer der Fabriken, die sich in der Nachbarschaft des Gefängnisses erhoben, und ein böiger Wind kündigte ein Unwetter an. Für eine Sekunde überkam Victor ein so flaues Gefühl, dass er sich fast in seine Zelle zurücksehnte. Wohin sollte er gehen? Die meisten Häftlinge, die mit ihm entlassen worden waren, zogen nach Süden, in Richtung Stadt, einige wenige nach Norden, hinaus aufs Land, die meisten aber in ein Public House gegenüber, um dort mit einem Mädchen oder Freund das Geld zu vertrinken, das sie gerade bekommen hatten.
Mit lautem Knarren schloss sich hinter Victor das Tor der Strafanstalt, ein Riegel wurde vorgeschoben, Eisen knirschte auf Eisen, dann rasselte ein schwerer Schlüssel im Schloss. Erst in diesem Moment begriff er, was passiert war, spürte und empfand es mit jeder Faser seines Leibes: Er war frei! Jetzt endlich fiel der Panzer von ihm ab, hinter dem seine Seele sich verkrochen hatte, um das äußere Gefängnis zu ertragen, und in seiner Brust drängte ein Gefühl empor, dass er kaum noch kannte. Er konnte gehen, wohin er wollte, nach London, nach O’Connorville, nach Amerika, ganz gleich wohin, und kein Oberaufseher Walker, kein Direktor Mayhew würde ihn daran hindern. Tief atmete er die Morgenluft ein, die plötzlich so sauber und frisch schmeckte wie Quellwasser. Den Schilling in der Tasche, hob er seinen Blick. Seit fast zwei Jahren schaute er zum ersten Mal wieder in den offenen Himmel, ohne ein Gitter vor den Augen. Mein Gott, wie sehr hatte er das vermisst! Und als er die beiden Flügel der Tretmühle über der roten Backsteinmauer in die Höhe steigen sah, hatte er nur noch einen Gedanken: Nie wieder würde er an diesen Ort zurückkehren! Lieber würde er verrecken!
»Hier, ich habe eine Adresse für dich.«
Victor drehte sich um. Mr. Tallis, der Meister der Anstaltsdruckerei, stand vor ihm.
»Eine Adresse?«
»Von einer Werkstatt in der Drury Lane.« Tallis reichte ihm einen Zettel. »Jeremy Finch, ein Säufer, der unter dem Pantoffel seiner Frau steht, und außerdem ein brutales Schwein. Er ist wegen seiner Sauferei fast pleite und kann einen guten Mann wie dich dringend brauchen.«
Victor blickte den Meister unschlüssig an. Tallis drückte ihm den Zettel in die Hand. »Melde dich da. Niemand außer Finch wird dir sonst Arbeit geben. Er ist deine einzige Chance.«
2
»Das Gewächshaus platzt aus allen Nähten«, sagte Joseph Paxton.
»Deine eigene Schuld, Papa«, erwiderte Emily. »Du bist einfach ein zu guter Gärtner.«
»Von wegen, mein Fräulein! Schieb ja nicht mir allein die Schuld in die Schuhe. Wer hatte denn die Idee mit dem elektrischen Licht?«
»Schon gut, du alter Schmeichler, eine klitzekleine Mitschuld gebe ich ja zu. Trotzdem, wir müssen etwas unternehmen. Der Platz reicht einfach nicht aus, die Pflanzen können sich nicht mehr entfalten. Die ersten sind uns schon eingegangen.«
»Jetzt reg dich nicht so auf. Ich habe ja schon mit dem Herzog darüber gesprochen.«
»Das verrätst du mir erst jetzt? Und – was hat er gesagt?«
»Er ist mit dem Neubau einverstanden.«
»Aber das ist ja großartig, Papa!«
»Sicher – wenn ich nur wüsste, woher ich die Zeit dafür nehmen soll. Irgendjemand muss die Arbeiten schließlich beaufsichtigen. Aber sag mal, hast du die Zeichnungen für das Magazine fertig? Die müssen allmählich in Druck.«
Wie jeden Sonntagabend saßen Emily und ihr Vater am Seerosenteich, um die Aufgaben der kommenden Woche zu besprechen. Die Errichtung eines neuen, größeren Gewächshauses war dabei schon seit Monaten ein Thema. Emilys Idee, im Winter die Pflanzen täglich morgens und abends zwei Stunden mit Kunstlicht zu bescheinen, damit sie in der fremden Umgebung genauso viel Helligkeit wie in ihrer natürlichen Heimat bekamen, hatte dazu geführt, dass die Seerosen nicht nur immer üppiger wuchsen, sondern sich auch in ungeahnter Weise vermehrten. Das über- und ineinander wuchernde Pflanzenwerk erinnerte inzwischen mehr an einen Dschungel als an eine systematisch gezüchtete Kultur, die den Regeln und Prinzipien moderner Gärtnereikunst gehorchte.
Zwölf Jahre war es nun her, seit es Paxton als erstem Gärtner Europas gelungen war, die Victoria regia zum Blühen zu bringen, und Emily bewahrte noch heute die Zeitungsartikel, die sie stehend auf dem Blatt der Pflanze zeigten, in ihrem Tagebuch auf. Sie war jetzt zweiundzwanzig Jahre alt, und, wenn man den Worten ihrer Mutter glauben sollte, mit ihren hellen, türkisfarbenen Augen und den schwarzen Locken eine junge hübsche Frau. Ihr selber war es allerdings verhasst, als hübsche junge Frau zu gelten – sie hielt ihr Äußeres für ziemlich misslungen. Ihr Körper, den ihre Mutter als wunderbar schlank bezeichnete, erschien ihr, wenn sie sich nackt im Spiegel betrachtete, wie ein rachitisches Knochengerüst, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass je ein Mann sich in dieses Skelett verliebte. Der Mann, der das tun würde, müsste ein Idiot sein.
Nein, Männer interessierten sie nicht – der graue Kittel, den sie im Gewächshaus trug, war mit Abstand ihr liebstes Kostüm, und statt Bälle und Salons zu besuchen, half sie ihrem Vater, die Parkanlagen des Herzogs in Ordnung zu halten. Außerdem betrieb sie, nachdem sie ihre Schulzeit beendet hatte, privat jene Studien der Botanik und Zoologie weiter, die sie bereits als Kind unter Anleitung ihres Vaters begonnen hatte – sie hatten zusammen sogar tierisches Leben erzeugt, kleine Insekten, mit Hilfe einer voltaischen Batterie und kieselsaurem Kali, nach dem berühmten Experiment des Herrn Crosse. Emilys sehnlichster Wunsch wäre es deshalb gewesen, ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse an einem College in Oxford oder Cambridge zu vertiefen, doch da ihr als Frau der Zugang zur Universität verwehrt blieb, war sie auf die Londoner Bibliotheken sowie ihren eigenen Verstand angewiesen. Und natürlich auf ihren Vater.
»Meinst du vielleicht diese hier?«
Sie öffnete ihre Zeichenmappe und holte die Blätter hervor, die sie am Vormittag fertig gestellt hatte, Illustrationen für die nächste Nummer des Magazine of Botany, das ihr Vater herausgab und zu dem sie die Zeichnungen beitrug. Paxton nahm die Blätter und schaute sie der Reihe nach an.
»Wunderbar«, sagte er. »So wie du die Pflanzen zeichnest, tritt einem der ganze Bauplan der Natur entgegen, als wären die Illustrationen ein Text, den man Buchstabe für Buchstabe entziffert. Schade, dass man das im Druck nicht mehr sieht.«
»Vielleicht weiß ich eine Lösung«, sagte Emily. »Mr. Benson, der Buchbinder, hat mir einen Drucker in der Drury Lane empfohlen. Der schafft Illustrationen angeblich in einer solchen Qualität, dass man das Original nicht von der Reproduktion unterscheiden kann. Soll ich da nicht mal fragen?«
»In der Drury Lane? Eine ziemlich üble Gegend.«
»Ach, Papa, ich bin doch kein Kind mehr.«
Sie sah ihn an, aber er war schon wieder in ihre Zeichnungen versunken. »Ich glaube, ich muss mir doch irgendwann eine Brille zulegen«, murmelte er, während er mit zusammengekniffenen Augen die Abbildungen studierte. »Diese Kopfschmerzen machen mich noch verrückt.« Dann klappte er die Mappe zu und erwiderte ihren Blick. »Also gut, probier’s aus. Damit die Leser des Magazine erfahren, was für eine wunderbare Tochter ich habe. Aber keinen Ton davon zu Mama! Versprochen?«
»Versprochen!«
Er gab ihr die Blätter zurück. »Wirklich, Emily, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast das Talent zu etwas ganz Großem.«
»So wie du?«, grinste sie.
»So wie ich«, grinste er zurück. »Wenn du ein Junge wärst, ich wette, du würdest mindestens Universitätsprofessor.«
»Oder Premierminister«, lachte sie. »Aber leider bin ich nur ein Mädchen.«
»Gott sei Dank«, sagte er und gab ihr einen Kuss. Dann wurde er ernst. Umständlich nahm er sein silbernes Zigarettenetui aus der Tasche, ließ den Deckel aufspringen und steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Dann bot er auch ihr eine an. Emily stutzte. Das tat er nur, wenn er sie ins Vertrauen ziehen wollte. Während sie den Rauch tief in ihre Lungen einsog und dabei das erregende Kribbeln genoss, mit dem sich die Wirkung der Zigarette vom Kopf bis zum kleinen Zeh in ihrem Körper ausbreitete, wartete sie darauf, dass ihr Vater zu reden anfing.
»Die Zeitschrift ist nach dir mein liebstes Kind«, sagte er, »doch werde ich in Zukunft kaum noch Zeit haben, mich um sie zu kümmern. Und auch die Gewächshäuser und Gärten werden öfter ohne mich auskommen müssen als bisher.«
»Wieso?«, fragte Emily. »Gibt es Probleme?«
Paxton lachte. »Probleme? Hast du je erlebt, dass dein Vater Probleme hatte? Du kennst doch meine Devise.«
»Ja, ja – wenn es einem richtig schlecht geht und man nur einen Penny in der Tasche hat, muss man sich was Gutes gönnen. Dann sieht die Welt gleich wieder anders aus.«
»Genau!« Er strahlte über das ganze Gesicht, um dann mit der eigentlichen Nachricht herauszurücken. »Der Herzog hat mich den Aktionären der Midland-Eisenbahngesellschaft als Direktor vorgeschlagen. – Ich habe angenommen.«
Emily verschluckte sich fast am Rauch ihrer Zigarette. »Willst du mich auf den Arm nehmen?«
Er schüttelte den Kopf. »Der Eisenbahn gehört die Zukunft, Emily, damit kann man bald mehr Geld verdienen als mit irgendetwas anderem. Das ist meine Chance, eines Tages vielleicht so reich zu werden wie der Herzog.«
»So reich wie der Herzog?«, staunte sie. »Glaubst du wirklich?«
Emily wusste, was Geld für ihren Vater bedeutete: Macht, Unabhängigkeit, Freiheit. Geld, so hatte er ihr schon viele Male erklärt, war in der menschlichen Gesellschaft dasselbe wie Kraft oder Stärke im Reich der Natur – nur wer Geld besaß, könne im Dschungel des Lebens bestehen. Das alles wusste Emily und verstand sogar, warum ihr Vater so dachte. Weil er früher, als er so alt gewesen war wie sie, kaum mehr als das Hemd auf dem Leib besessen hatte.
»Trotzdem, Papa … Du, ein Gärtner, als Eisenbahndirektor?«
»Du meinst, das ist ein Widerspruch? Überhaupt nicht! In Wirklichkeit ist beides eng miteinander verwandt, enger jedenfalls, als du glaubst. Vielleicht kann man es so vergleichen.« Nachdenklich ließ er die Spitzen seiner Koteletten durch die Finger gleiten, während er an seiner Zigarette sog. »Das Eisenbahnnetz, wie es gerade überall in England entsteht, hat eine ähnliche Aufgabe wie das Adernsystem im Blätterwerk unserer Seerosen. So wie die Adern die einzelnen Pflanzenteile mit allen notwendigen Stoffen versorgen, so wird schon bald die Eisenbahn den Austausch von Rohstoffen und Waren zwischen den Städten und Regionen des Landes sichern. Die Menschen müssen nur erst begreifen, was für eine wunderbare Erfindung Mr. Stephenson gemacht hat. Aber wenn das passiert, werden wir eine Revolution erleben, die alles von Grund auf verändert. Darauf würde ich nicht nur meinen Kopf verwetten, sondern sogar mein Vermögen.«
Emily schaute ihren Vater an. Aus seinen Augen leuchtete ein solcher Enthusiasmus, dass er trotz der hohen Stirn, der buschigen Brauen und der inzwischen grau melierten Wangenkoteletten, die ihm fast bis an die Mundwinkel reichten, wie ein junger Mann aussah. Wenn es eine Eigenschaft gab, für die Emily ihn am meisten liebte, dann für diesen Optimismus, der so ansteckend auf sie wirkte wie ein Schnupfen im November oder das Lachen ihres jüngsten Bruders Georgey. Eine Frage aber blieb offen.
»Und was wird mit deiner übrigen Arbeit?«
Paxton nickte. »Die Ernennung bedeutet, dass ich in Zukunft oft unterwegs sein werde. Traust du dir zu, mich hier zu vertreten? Zum Beispiel, wenn wir ein neues Gewächshaus bauen?«
Bevor Emily ihrem Vater eine Antwort geben konnte, ging die Tür auf und ihre Mutter kam herein. Sarah Paxton war gerade aus London zurückgekehrt, wo sie eine Design-Prämierung der Society of Arts besucht hatte; die Preisverleihung hatte kein Geringerer als Prinz Albert durchgeführt, der Ehemann der Königin.
»Um die Arbeit brauchst du dir keine Sorge zu machen«, beantwortete sie an Emilys Stelle die Frage ihres Mannes, während Vater und Tochter eilig ihre Zigaretten in einem Pflanzenkübel verschwinden ließen. »Ich werde mich schon darum kümmern. Übrigens«, wechselte sie dann das Thema, »es gibt interessante Gerüchte. Man plant in London eine riesige Ausstellung, mit Produkten aus der ganzen Welt.«
»Papa hat nicht dich, sondern mich gefragt«, sagte Emily, verärgert darüber, dass ihre Mutter sie wieder einmal so selbstverständlich überging, als wäre sie gar nicht da.
Sarah zuckte die Achseln. »Die einzige wichtige Frage eines Mädchens in deinem Alter ist die Frage nach einem Ehemann. Sagt, hat hier jemand geraucht? Es riecht bei euch ja wie in einem Pub.«
Gegen ihren Willen musste Emily feststellen, wie großartig ihre Mutter aussah. Obwohl Sarah die vierzig um einiges überschritten hatte, war sie immer noch eine sehr schöne Frau. Das volle kastanienbraune Haar, das sie unter ihrem weit geschweiften Hut hochgesteckt hatte, umschmeichelte ihr helles, ebenmäßiges Gesicht, aus dem zwei wache, intelligente Augen blickten, und die geschwungenen Brauen, von denen beim Sprechen sich manchmal die eine leicht ungläubig kräuselte, verliehen ihr jenen Hauch von Unnahbarkeit, weshalb die Männer der Londoner Gesellschaft ihr zu Füßen lagen. Paxton, das wusste Emily nur zu gut, war auf seine Frau noch stolzer als auf seine Seerosen.
Trotzig sagte Emily: »Der einzige Mann, den ich je heiraten würde, ist leider schon vergeben.«
Sie gab ihrem Vater einen Kuss, aber der interessierte sich plötzlich nur noch für seine Frau. »Eine Ausstellung mit Produkten aus der ganzen Welt?«, fragte er. »Was meinst du damit?«
3
»Eine internationale Industrie- und Gewerbeausstellung«, erklärte Henry Cole und wippte auf den Fußballen, um seiner Erscheinung, vor allem aber seiner Rede Nachdruck zu verleihen, »eine exposition universelle, mit den Erzeugnissen der Menschen und Völker aus aller Welt.«
Er machte eine Pause und schaute in die Runde. Soeben hatte er das Thema der geheimen Konferenz benannt, die an diesem Montag, dem 29. Juni 1849, im königlichen Palais von Osborne stattfand. Hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft waren auf sein Betreiben zusammengekommen, um mit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Albert, dem deutschblütigen Ehemann von Queen Victoria, ein Ereignis zu diskutieren, wie die Welt es noch nicht zuvor gesehen hatte.
Er wartete auf eine Reaktion, doch niemand wagte es, den Mund aufzumachen, bevor der Prinzgemahl seine Meinung äußerte. Endlose Sekunden vergingen, bis Albert sich räusperte. »Interessant, durchaus, allerdings«, sagte er dann in seiner zögerlichen, unentschiedenen Art. »Doch offen gestanden, ich weiß nicht recht. Welche Gründe könnten uns veranlassen, eine solche Veranstaltung zu unterstützen?«