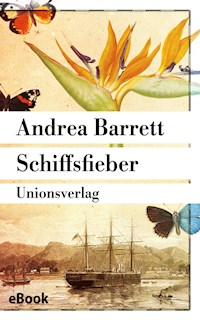12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der eigenbrötlerische Naturforscher Erasmus Wells verbringt seine Tage zwischen verstaubten Exponaten. Als ihm aber die Teilnahme an einer Arktisexpedition angeboten wird, wagt er sich aus seinem Kokon. Stolz werden große Ziele verkündet, doch je tiefer sie in den Norden vordringen, desto bedrohlicher wird die Umgebung. Unaufhaltsam schließt sich der arktische Winter um das Schiff. Die undurchdringliche Polarnacht, die krachende Kälte, die bläulich graue Kargheit des Eises. Wissenschaftliche Neugier weicht der Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und das Leben aller in Gefahr zu bringen. Barrett erzählt vom Forschen und Scheitern, vom Verstehen und Missverstehen einer anderen Kultur und nicht zuletzt von der Bedeutung der Frauen im Schatten der gefeierten Entdecker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Der eigenbrötlerische Erasmus Wells ist Teil einer ehrgeizigen Arktisexpedition. Doch die großen Ziele rücken in immer weitere Ferne, als sich der krachende Winter um das Schiff schließt. Barrett erzählt vom Verstehen und Missverstehen einer anderen Kultur und nicht zuletzt von der Bedeutung der Frauen im Schatten der gefeierten Entdecker.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Andrea Barrett (*1954) wandte sich nach ihrem Studium der Zoologie dem Schreiben zu und wurde seither mehrfach für ihre Werke ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award, dem MacArthur Fellowship und dem Rea Award for the Short Story. Sie lehrt Kreatives Schreiben in Massachusetts.
Zur Webseite von Andrea Barrett.
Karen Nölle (*1950) studierte Anglistik und Germanistik und ist als Autorin, Lektorin, Herausgeberin und Übersetzerin tätig. Sie übersetzt Belletristik aus dem Englischen, u. a. Werke von Andrea Barrett, Annie Dillard, Alice Munro, Patricia Duncker, Barbara Trapido, Doris Lessing und Tony Earley.
Zur Webseite von Karen Nölle.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Andrea Barrett
Die Reise der Narwhal
Roman
Aus dem Englischen von Karen Nölle
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1998 bei W. W. Norton & Company, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 im Claassen Verlag, München.
Originaltitel: The Voyage of The Narwhal
© by Andrea Barrett 1998
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Vogel (Schmarotzerraubmöwe), Pflanze (Vesicaria Arctica), Narwal und Schiff aus Alamy Stock Foto; Rahmen Alamy Vektorgrafik
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31126-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 16:37h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE REISE DER NARWHAL
Erster TeilSeine vielen Listen — Mai 1855Jenseits der Hölle, wo der Frost entsteht — Juni bis Juli 1855Ein Rausch der Entdeckungen — Juli bis August 1855Ein kleiner Umweg — August bis September 1855Zweiter TeilDie überwältigende Mannigfaltigkeit des Eises — Oktober 1855 bis März 1856Wer hört die Fische, wenn sie weinen? — April bis August 1856Die Innersuit, Kobolde der Arktis — August bis Oktober 1856Dritter TeilTudlamik, Fell und Knochen — November 1856 bis März 1857Ein großer Stein, der ihm ins Wasser fiel — April bis August 1857Exemplare eines Eingeborenenstammes — September 1857Ein verhextes Gerippe — Oktober 1857 bis August 1858Anmerkung der Autorin und DanksagungListe der AbbildungenAbbildungsnachweisQuellennachweisMehr über dieses Buch
Über Andrea Barrett
Andrea Barrett: »Ich stelle Fragen, die nicht beantwortet werden können.«
Über Karen Nölle
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Andrea Barrett
Zum Thema Arktis
Zum Thema Abenteuer
Zum Thema USA
Für Carol Houck Smith
Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende. Amazonien, Tibet und Afrika überschwemmen die Buchläden in Form von Reisebüchern, Forschungsberichten und Fotoalben, in denen die Effekthascherei zu sehr vorherrscht, als dass der Leser den Wert der Botschaft, die man mitbringt, würdigen könnte. Statt dass sein kritischer Geist erwacht, gelüstet ihn immer mehr nach dieser Speise, von der er Unmengen vertilgen kann. Heutzutage ist es ein Handwerk, Forschungsreisender zu sein; ein Handwerk, das nicht, wie man meinen könnte, darin besteht, nach vielen Jahren intensiven Studiums bislang unbekannte Tatsachen zu entdecken, sondern eine Vielzahl von Kilometern zu durchrasen und – möglichst farbige – Bilder oder Filme anzusammeln, mit deren Hilfe man mehrere Tage hintereinander einen Saal mit einer Menge von Zuschauern füllen kann, für die sich die Plattitüden und Banalitäten wundersamerweise in Offenbarungen verwandeln, nur weil ihr Autor, statt sie an Ort und Stelle auszusondern, sie durch eine Strecke von zwanzigtausend Kilometern geadelt hat. […] Nie wieder werden uns die Reisen, Zaubertruhen voll traumhafter Versprechen, ihre Schätze unberührt enthüllen. Eine wuchernde, überreizte Zivilisation stört für immer die Stille der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die Düfte der Tropen und die Frische der Lebewesen, tötet unsere Wünsche und verurteilt uns dazu, halb verfaulte Erinnerungen zu sammeln. […] Und so verstehe ich die Leidenschaft für Reiseberichte, ihre Verrücktheit und ihren Betrug. Sie geben uns die Illusion von etwas, das nicht mehr existiert und doch existieren müsste, damit wir der erdrückenden Gewissheit entrinnen, dass zwanzigtausend Jahre Geschichte verspielt sind.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Traurige Tropen (1955)
Erster Teil
Seine vielen Listen
Mai 1855
Vergeblich suche ich mich zu überreden, der Pol sei der Ursprung des Frostes, der Trostlosigkeit. Stets bietet er sich meiner Vorstellung als ein Ort der Schönheit, der Freude an. Dort … gibt es weder Schnee noch Kälte. Sind wir über das stille Meer gefahren, so werden wir an ein Land getragen, dessen wunderbare Beschaffenheit jede bisher entdeckte Gegend auf dem bewohnbaren Planeten übertrifft … Was ist nicht alles zu erwarten in einem Land des ewigen Lichts?
MARY SHELLEY, Frankenstein (1818)
Er stand am Kai und schaute in den Delaware River, auf seinen Schultern brannte die Sonne. Eine milde Brise, der Geruch von Teer und Kupfer. Wenige Meter vor ihm ragte die Narwhal auf, aber er starrte auf ihr Spiegelbild, das zwischen Rumpf und Pfahlwerk eingefangen schien. Die schlingernden Planken, die verbogene Reling, den Ladebaum, der auftauchte und wieder verschwand; merkwürdig, wie das Bild die Oberfläche ausfüllte, ohne das mannigfaltige Leben darunter zu verdecken. Unter dem durchscheinenden Bild konnte er die Welt erkennen, die sein Vater ihn zu sehen gelehrt hatte: die Weißfischschwärme, die Aale und Algen, die sich in den Schlick bohrenden Muscheln; die an Polypen und kleinen Schnecken vorübertreibenden Kieselalgen, die Bandalgen und Insektenlarven. Die Auster, hatte sein Vater einst gesagt, wird vom Tau befruchtet; die schwangere Auster bringt vom Himmel empfangene Perlen hervor. Ist der Tau rein, glänzen die Perlen; ist er trüb, sind die Perlen stumpf. Hoch über ihm, jedoch ebenfalls gespiegelt, zogen lange Wolkenbänder in die eine Richtung, und Möwen segelten in die andere.
Im Wasser lag die Narwhal schwer und dunkel zwischen leichteren Handelsschiffen. Sie alle strebten irgendwelchen Zielen entgegen, dachte Erasmus. England, Afrika, Kalifornien; Felseninseln voller Seehunde; der Küste von Florida. Und doch war unter all diesen Seefahrern keiner, bei dem er sich hätte Rat holen können. Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Wo sollte dieser Berg von Vorräten hin? Beim Anblick eines schlecht geschnürten, wasserdicht verpackten Bündels mit zwölf Plumpuddings kamen ihm fast die Tränen. Jedes Mal, wenn er daranging, im Laderaum Ordnung zu schaffen, trafen weitere Pakete ein. Eine Kiste voll eingelegter Damaszenerpflaumen von einer alten Dame in Conshohocken, die in der Zeitung von der geplanten Reise gelesen hatte und ihren Teil zum Gelingen beitragen wollte. Eine Kiste Brandy von einem Bankier aus Wilmington, ein paar Bände Thackeray von einem Schulmeister aus Doylestown, mengenweise handgestrickte Socken. In seinen Händen stapelten sich die Listen, und keine war ganz abgehakt: Vergiss den Pudding, dachte er. Wo sind die letzten zwei Zentner Pemmikan? Wieso ist die Hälfte des Fleischzwiebacks in derselben Ecke verstaut worden wie die Kerzen und das Lampenöl? Und wo bleiben die noch fehlenden Mitglieder der Crew? In seiner Tasche hatte er eine weitere Liste, mit den Namen der endgültigen Mannschaft:
Zechariah Voorhees: Expeditionsleiter
Amos Tyler: Navigator und Kapitän
Colin Tagliabeau: Erster Offizier
George Francis: Zweiter Offizier
Jan Boerhaave: Arzt
Erasmus D. Wells: Naturforscher
Frederick Schuessele: Koch
Thomas Forbes: Zimmermann
Matrosen: Isaac Bond, Nils Jensen, Robert Carey, Barton DeSouza, Ivan Hruska, Fletcher Lamb, Sean Hamilton
Fünfzehn, wenn man alle zusammenzählte. Captain Tyler und die Herren Tagliabeau und Francis waren erfahrene Walfänger. Dr. Boerhaave hatte in Edinburgh Medizin studiert; Schuessele hatte bei einer New Yorker Postschifflinie als Koch gearbeitet; Forbes war ein Bauernsohn aus Ohio, der noch nie zur See gefahren war, aber die Fertigkeit besaß, alles, was man sich denken konnte, aus ein paar Holzresten zu zaubern. Von den sieben unterschiedlich gut ausgebildeten Matrosen war Bond betrunken zum Dienst erschienen, und Hruska und Hamilton hatten sich noch gar nicht gemeldet.
Ihre Kameraden warteten unten im Laderaum, wo keiner sie sah, auf Befehle – warteten, wie Erasmus befürchtete, darauf, dass er versagte. Er hatte mit seinen vierzig Lebensjahren bereits mehrmals versagt; als blutjunger Bursche hatte er an einer Reise teilgenommen, die so spektakulär gescheitert war, dass die ganze Nation darüber lachte. Seitdem hatte er im Leben fast nichts zuwege gebracht. Er hatte keine Frau, keine Kinder, keine wirklich guten Freunde; eine Schwester in schwierigen Lebensumständen. Doch jetzt stand er hier: vor diesem Berg von Sachen und vor einer zweiten Chance.
Noch immer unschlüssig auf die Plumpuddings starrend, hörte er ein Lachen. Er blickte auf und sah Zeke in der Takelage hängen wie eine Flagge. Zwischen seinen langen Armen leuchtete ein goldener Haarschopf; als er lachte, blitzten seine Zähne auf. Er war sechsundzwanzig, und Erasmus fühlte sich neben ihm wie ein Fossil. Zeke war der Dreh- und Angelpunkt dieses Unternehmens. Der Briggschoner, auf dem sie sich gerade einrichteten, hatte vormals zur Postschiffflotte von Zekes Familie gehört; mit Geldern aus dem väterlichen Vermögen hatte Zeke, damit das Schiff dem Eis standhielt, die Seitenwände mit eichenen Planken verstärken, den Bug mit Eisenplatten panzern und geteerten Filz zwischen die doppelten Decksplanken legen lassen. Als Befehlshaber der Expedition – und daher, wie Erasmus sich vergegenwärtigte, sein Vorgesetzter – hatte Zeke Erasmus dazu ausersehen, sich der Ausrüstung und der Vorräte anzunehmen, die ihn jetzt in so verwirrender Vielzahl umgaben.
Wo sollte das ganze Zeug hin? Gepökeltes Rind- und Schweinefleisch und Malz in Fässern, Messer und Nadeln für Tauschgeschäfte mit den Eskimos, Gewehre und Munition, Kohlen und Holz, Zelte und Gaskocher und wollene Kleidung, Büffelfelle, eine Bibliothek, Bretter genug, um im Notfall behelfsmäßig das ganze Deck zu überdachen. Und die Alkohol-Thermometer. Die vier Chronometer, die Mikroskope und die komplette Ausrüstung für die Präparation der gefundenen Pflanzen und Tierarten: Weingeist, Mull, vornummerierte Etiketten und Flaschen, Arsenseife zur Konservierung von Vogelhäuten, Kampfer und Pillendosen zur Konservierung von Insekten, Seziermesser, Uhrengläser, Stecknadeln, Bindfaden, Glasröhren und Siegelwachs, Pfropfen und eingelegte Blasen, Hirnlöffel und Lötrohre und feine Bohrer für Eier, ein Schleppnetz … Unmengen von Zeug.
Erasmus strich mit einer Hand über die Wolfsfelle, die sein jüngster Bruder aus den Bergen im fernen Utah geschickt hatte. Im Augenblick hätte er alles darum gegeben, sich ein Stündchen mit Copernicus zu unterhalten, der wusste, was es hieß, einem Leben den Rücken zu kehren. Doch Copernicus war fort, wieder einmal fort, und die Wolfsfelle waren zwar hübsch, aber wo sollten sie hin? Die Schlitten, eigens von Zeke entworfene Konstruktionen, waren zwei Wochen zu spät fertig geworden und passten nicht in die Ecke, die Erasmus für sie vorgesehen hatte; auch mit etlichen wissenschaftlichen Geräten wusste er nicht, wohin. Die Kajüte war bis auf den letzten Winkel vollgestopft, und sie waren noch immer nicht untergebracht.
Oben auf der Narwhal nahm Zeke seine Füße vom Stag, hielt sich noch einen Moment mit einer Hand fest und ließ sich dann leichtfüßig aufs Deck fallen. Bald darauf gesellte er sich zu Erasmus und dem Durcheinander auf dem Kai, rückte den Theodolit beiseite und entdeckte darunter eine Kiste mit Zwiebeln. »Die sehen gut aus«, sagte er. »Haben wir genug?«
Als sie zum aberen Male die Proviantlisten durchgingen, kam Mr Tagliabeau mit der Nachricht zu ihnen, dass der Koch verschwunden sei. Er sei zuletzt vor zwei Tagen gesehen worden, berichtete Mr Tagliabeau, in Begleitung einer rothaarigen Frau, die schon eine Weile den Hafen unsicher mache.
Die Hände tief in den Zwiebeln vergraben, lachte Zeke nur laut auf. »Das Flittchen habe ich auch gesehen«, sagte er. »Der blitzte es nur so aus den Augen! Aber dass ausgerechnet Schuessele sie abgeschleppt hat, mit seinem ungeheuren Bart …«
Der Wind fegte eine von Erasmus’ Listen davon und wirbelte sie zwischen den Masten empor. »In drei Tagen legen wir ab!«, rief er mit einer Dramatik, derer er sich später mit großer Verlegenheit erinnerte. »In drei Tagen. Wo sollen wir so schnell einen neuen Koch finden?«
»Kein Grund zur Aufregung«, beschwichtigte ihn Zeke. »Die Welt ist voller Köche. Mr Tagliabeau, wenn Sie so gut sein wollen, eine kleine Runde durch die Schenken am Hafen zu drehen und einen anzuheuern …«
»Wunderbar«, sagte Erasmus. »Bringen Sie uns möglichst einen Kriminellen oder einen Trunkenbold.«
Es wäre womöglich zum Streit gekommen, wäre nicht im gleichen Moment eine Schar junger Männer in lincolngrünen Röcken über den Kai auf sie zugesprungen, mit weißen Pantalons und langen schwarzen Straußenfedern an den Strohhüten. Die Vereinigung der Bogenschützen, Toxophiliten genannt. Bei ihrem Anblick stöhnte Erasmus innerlich auf. Einst, vor langer Zeit, hatte auch er dieser Vereinigung angehört; damals war ihm die Sache durchaus reizvoll erschienen. Die Idee, den alten Sport des Bogenschießens neu zu beleben, die Pfeile zu schwingen, die sie von den ersten märchenhaften Fahrten in die weiten Ebenen des Mittleren Westens mitgebracht hatten – als Junge hatte er an einem Jagdtreffen mit zweitausend Besuchern teilgenommen. Doch nach der Forschungsexpedition hatte er jedes Interesse an Vergnügungen dieser Art verloren und seine Verbindung zu den Bogenschützen einschlafen lassen. Mittlerweile war Zeke jedoch einer der tonangebenden jungen Männer im Verein.
»Voorhees!«, riefen die Toxies. Ringsum blickten die Mannschaften der anderen Schiffe auf. »Voorhees! Voorhees!«
Die Toxophiliten ließen Zeke dreimal hochleben, nahmen ihn in ihre Mitte und zogen ihn den Kai hinunter. Erasmus wurde mit höflichem, aber wortlosem Nicken begrüßt. Er lauschte den humorigen Reden, in denen sie Zeke mit einem Indianerhäuptling verglichen, der zur Büffeljagd aufbrach. Ein junger Mann mit roten Haaren überreichte Zeke einen Kelch; ein schmächtiger Bursche verehrte ihm einen schwarzen Gürtel, von dem eine Schmierbüchse und eine Troddel herabhingen. Zeke nahm die Gaben mit einem Lächeln und einem Händedruck entgegen, wobei er jedem der Männer namentlich dankte, und trug dabei jene Haltung zur Schau, in der Erasmus’ Schwester seine natürliche Autorität zu erkennen meinte.
Doch was hatte Zeke wirklich vorzuweisen? Fast gar nichts, dachte Erasmus, während er sich die Schmierbüchse besah. Er war ein paar Jahre mit den Schiffen der Postschiffflotte seines Vaters auf der Strecke von Philadelphia nach Dublin und Hull gesegelt, um die Meeresströme und die Tierwelt des Atlantiks zu erforschen, obwohl er, wie er Erasmus gestanden hatte, häufig zu seekrank gewesen war, um zu arbeiten. Alles, was er darüber hinaus wusste, hatte er aus Büchern. Als Kind hatte er sich in Erasmus’ Familie eingeschmeichelt, begünstigt durch die Freundschaft ihrer beider Väter und sein Interesse an der Naturgeschichte. Mittlerweile waren sie zudem durch Lavinia aneinander gebunden. Doch dass Erasmus sich nun in Zekes Schatten stellen und unter dem unerprobten Kommando dieses jungen Mannes zu einer Expedition in die Arktis aufbrechen sollte – wieder einmal kam es ihm unfasslich vor, dass er sich zu diesem Schritt entschlossen hatte.
Als hätte Zeke gehört, was Erasmus dachte, bahnte er sich den Weg aus dem Kreis der grün berockten Männer, ergriff seinen Arm und zog ihn in ihre Mitte. »Ohne Erasmus Darwin Wells wäre diese Reise undenkbar«, rief er. »Ein dreifaches Hoch auf den naturkundlichen Leiter unserer Expedition, meine rechte Hand!«
Erasmus stieg die Röte ins Gesicht. War es das, was er wollte? Verehrung mit einem Schuss Geringschätzung; als wollte Zeke ihm nacheifern, ohne seine Fehler zu wiederholen. Doch er schob den Gedanken beiseite, denn er wusste, er hatte es genau dieser Art von missgünstiger Zurückhaltung zu verdanken, dass er in seiner Lebensmitte so allein dastand. Als die Toxies ihm ihren grün-goldenen Stander präsentierten, ergriff er das Ende mit dem Bild des munteren Bogenschützen und lächelte Zeke zu. Zeke hielt eine kurze Dankesrede; Erasmus hielt eine noch kürzere und erwähnte mit keinem Wort, dass er die Gründer des Vereins gekannt und das Bogenschießen bereits gelernt hatte, als einige der vor ihm Stehenden noch Kinder waren. Während Erasmus sprach, sah er, dass Captain Tyler über der Reling der Narwhal hing und neugierig in ihre Richtung schaute. Sein Gesicht, fand er, war so groß und rosig wie ein Schinken.
Die Toxies nahmen ihren Abschied, Zeke kletterte wieder an Bord der Narwhal, und Erasmus fand sich abermals allein. Er faltete den Stander zusammen und legte ihn zwischen die Wolfsfelle. Dann wandte er sich erneut der Verstauung der Schlitten zu. Sollten sie alle in einer Reihe hintereinander in die Mitte des Laderaums? Oder aufgestapelt vorne in den Bug? Er arbeitete eine Stunde lang still vor sich hin und schob seine Sorgen von sich, indem er wiederholt seine Listen durchging und Erledigtes abhakte. Mr Tagliabeau unterbrach seine Tätigkeit, als er in Begleitung eines dunkelhaarigen, blauäugigen Jungen mit frischer Gesichtsfarbe zurückkehrte.
»Ned Kynd«, sagte Mr Tagliabeau. »Zwanzig Jahre alt.« Zeke sprang auf den Kai hinab, um ihn in Augenschein zu nehmen. Mr Tagliabeau stellte die Männer einander vor und endete mit den Worten: »Ned möchte an unserer Expedition teilnehmen.«
Zeke, den es zu seinen Lebensmittelvorräten zurückzuziehen schien, sah den jungen Burschen forschend an. »Du hast schon als Koch gearbeitet?«
»In drei Anstellungen«, sagte Ned schüchtern. Als er aufzählte, wo – sämtlich in der rauen Hafengegend –, vernahm Erasmus seinen schweren irischen Akzent.
»Und bist du schon zur See gefahren?«, fragte Zeke.
Ned wurde rot. »Erst einmal, Sir. Bei meiner Überfahrt.«
»Aber dir gefällt das Meer?«
»Die … Umstände meiner Überfahrt waren nicht so, dass man sie hätte genießen können. Aber ich glaube, es hätte mir gefallen, wenn ich Arbeit und Essen und einen Platz zum Schlafen gehabt hätte. Ich war sehr gern an Deck. Ich finde es schön, die Vögel und Fische zu beobachten.«
»Du müsstest für fünfzehn Männer kochen«, sagte Erasmus. »Kannst du das?«
»Ich möchte nicht prahlen, aber ich habe schon so manchen Abend für drei-, viermal so viele gekocht. Ich war eine Weile in einem Holzfällerlager in den Adirondacks, bevor ich mich hierher in die Stadt durchgeschlagen habe. Holzfäller sind hungrige Männer.«
Zeke legte Erasmus eine Hand auf die Schultern. »Wenn er Holzfäller satt kriegt, dann kriegt er uns allemal satt.«
»Du müsstest im Vorschiff logieren«, sagte Erasmus. »Mit den Matrosen zusammen. Da kann es ziemlich rau zugehen.«
»Nicht rauer als bei den Holzfällern, denke ich.«
»Also abgemacht«, sagte Zeke. »Herzlich willkommen. Schaff deine Sachen herbei und nimm Abschied, in drei Tagen geht es los.« Und damit entfernte er sich mit großen federnden Schritten über den Kai.
So kam es, dass Ned, in aller Schnelle als Ersatz für Schuessele angeheuert, zum Teilnehmer der Expedition wurde. Später dachte Erasmus oft daran zurück, wie wenig es gebraucht hätte, damit Ned einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Wenn Mr Tagliabeau ihm nicht unter der Markise des Schiffsausrüsters begegnet wäre; wenn er ein paar Minuten eher erschienen wäre und die Straußenfederhüte der Toxies ihn abgeschreckt hätten; wenn er ein paar Minuten später gekommen wäre und Zeke nicht mehr angetroffen hätte, um die Anstellung perfekt zu machen. Ein kleiner Zufall hätte gereicht.
In dieser Nacht fand Erasmus wieder keinen Schlaf. In der Repositur, dem kleinen naturkundlichen Pavillon seiner Familie, erhob er sich schließlich aus seinem Bett und ging grübelnd im Zimmer auf und ab. Seit zwölf Jahren kampierte er hier nun schon, in einer Welt, die auf Vitrinenschränke voll toter Tiere, Schachteln mit Samen und Ablagen voll Fossilien reduziert war, durch deren Fenster von Zeit zu Zeit Sonnenstrahlen eindrangen wie Botschaften von einem anderen Stern. Gerahmte Stiche mit den Bildnissen namhafter Naturforscher lehnten schräg in den Bücherregalen und sahen gütig zu, wie er sich über die Arbeit beugte, die keine war und nirgendwo hinführte. Wer konnte ein solches Leben verstehen? Und wie kam es, dass er sich nun endlich entschlossen hatte, es hinter sich zu lassen?
Am anderen Ende des Gartens stand groß und dunkel das Haus, in dem er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr geschlafen hatte. Dort trug alles die Handschrift seines Vaters, von den geschnitzten Farnen über der Haustür bis hin zu den Namen seiner Kinder. Er hieß Erasmus Darwin nach dem englischen Naturforscher, dem Großvater des jungen Mannes, der mit der Beagle die Welt umsegelte; seine Brüder hießen nach Kopernikus, Linnäus und Alexander von Humboldt. Vier Jungen, die zu ihrem Vater emporgeschaut hatten wie Nestlinge, die hungrig auf einen Wurm warteten. Von Beruf Kupferstecher und Drucker, hatte Frank Wells nebenbei mit großer Leidenschaft naturkundliche Forschungen betrieben und eine enge Freundschaft mit den Peales und den Bartrams gepflegt, mit Thomas Nuttall und Thomas Say, dem Vogelkundler Audubon und dem Sonderling Rafinesque, der bis zu seinem Tod in einer Mansarde in der Stadt gelebt hatte.
An Sommerabenden hatte Mr Wells seinen Söhnen unten am Fluss aus der Naturalis historia von Plinius vorgelesen. Plinius der Ältere sei an seiner wissenschaftlichen Neugier gestorben, erzählte er; er sei, als er verweilte, um sich den Rauch und die Lava des ausbrechenden Vesuvs anzuschauen, an den giftigen Dämpfen erstickt. Doch vorher habe er eine einzigartige Sammlung von Beobachtungen zusammengetragen, die er für Fakten hielt. Sie seien teils richtig, teils falsch – doch selbst die Irrtümer seien nützlich, durch die Schönheit seiner Ausdrucksweise und weil man an seinen Beispielen so gut ablesen könne, wie Menschen sich Begriffe machen, voneinander und von der Welt um sie herum. Mal auf und ab schreitend, mal auf einem Grasbüschel sitzend, hatte der Vater seinen Söhnen Plinius’ Beschreibungen der merkwürdigen Völker vorgetragen, die in unbekannten Regionen lebten. Ein Nomadenvolk, das nach Art der Schlangen mit bandförmigen Füßen versehen sei. Ein Menschenschlag, der in den Wäldern lebe und verkehrte Fußsohlen habe und an jedem Fuß acht Zehen. Eine Art Menschen, Monokoler geheißen, die nur ein Bein hätten und eine außerordentliche Behändigkeit im Springen aufwiesen; sie hießen auch Schattenfüßler, weil sie sich bei größerer Hitze rückwärts auf den Boden legten und sich mit dem Schatten ihrer Füße schützten. Geschichten, keine wissenschaftlichen Fakten, aber als Zugang zum Nachdenken über die Vielfältigkeit und Wandelbarkeit der menschlichen Natur dennoch von unschätzbarem Wert. Wie leicht könnte es sein, hatte er gesagt, dass es uns gar nicht gäbe. Wie leicht könnten wir uns in etwas völlig anderes verwandeln.
Aus diesen alten Geschichten, erzählte er, lasse sich einiges über Klatsch und Fantasie und die Gefahren lernen, die darin lägen, die Welt nicht aus erster Hand zu beobachten. Doch obwohl er ein leidenschaftlicher Sammler von Berichten über Forschungsreisen war, hatte er selbst kaum Reisen unternommen; Erasmus hatte nie erfahren, was sein Vater am liebsten einmal selbst gesehen hätte. Als Gegenstück zu Plinius hatte er seinen Söhnen die lebendige Wissenschaft seiner Freunde geboten. Diese hatten ihm geholfen, die Repositur einzurichten, und Erasmus wie seine Brüder mit ihren Reiseberichten in den Bann gezogen. Als Lavinia geboren wurde, hatten sie ihr den Namen ihrer sterbenden Mutter gegeben und ihren Freund mithilfe von Knochen und Federn von seinem Kummer abzulenken versucht.
Jetzt schritt Erasmus auf den Spuren dieser Männer über die gebohnerten Holzdielen. Er blieb vor einem hölzernen Kasten voller Schubladen mit fossilen Zähnen stehen. Die dritte Lade hatte einen doppelten Boden, von dem nur er wusste; in dem Geheimfach unter den Backenzähnen befand sich ein schwarzer knöchelhoher Frauenstiefel. Von seiner Mutter; früher hatte er ein ganzes Paar besessen. Er hatte die Stiefel, die sie am häufigsten getragen hatte, stibitzt, bevor die Dienstboten ihre Kleider aussortiert und an die Armen gegeben hatten. Die ersten Jahre hatte er sie in seinem Zimmer versteckt und dann und wann hervorgeholt, um mit seinen Händen über die Knöpfchen zu gleiten wie andere Jungen über die Perlen ihrer Rosenkränze. Später, kurz vor dem Aufbruch zu seiner unglücklichen ersten Reise, hatte er Lavinia den linken Stiefel geschenkt, nachdem er ihr das Versprechen abgenommen hatte, niemandem etwas davon zu verraten. Diesen hier hatte er vergraben. War er immer so klein gewesen? Die Sohle war kaum länger als seine Hand, das Leder war rissig, die Knöpfe lose. Wo Lavinias war, wusste er nicht.
Als sein Vater vor vier Jahren gestorben war, hatte er das Haus, die Repositur und ein kleines Einkommen geerbt sowie die Auflage, bis zu Lavinias etwaiger Heirat für sie zu sorgen. Was seiner Ansicht nach hieß, dass er alle Pflichten, aber keinerlei Freiheiten geerbt hatte, ja nicht einmal die solide Arbeit. War es seine Schuld, dass er nicht gewusst hatte, was er anfangen sollte? Der Familienbetrieb war an seine mittleren Brüder gegangen, die sich in der Stadt in zwei nebeneinanderliegenden Häusern niedergelassen hatten, von denen sie zu Fuß zur Arbeit gehen konnten: zwei Monde, die einen Planeten umkreisten, dem er kein Interesse abgewinnen konnte. Copernicus dagegen war, sobald er seinen Anteil ausgezahlt bekommen hatte, in den unbesiedelten Westen gereist. Dort bei den Indianern malte er Büffeljagden und weite, offene Landschaften, während sich Erasmus und Lavinia, allein zurückgelassen, in seiner Abwesenheit eng aneinanderlehnten.
Copernicus schickte Gemälde heim, von denen einige bereits in der Kunsthalle ausgestellt worden waren. Und von Zeit zu Zeit – wenn er daran dachte, wenn er den Kopf frei hatte – schickte er Tütchen mit Samen von irgendwelchen Pflanzen, die ihm ins Auge gefallen waren. Zufällige Funde, die für Erasmus zur Hauptbeschäftigung geworden waren. Erasmus hatte sie untersucht, klassifiziert, etikettiert, katalogisiert und in seine Listen aufgenommen. Er sortierte sie in hohe Kommoden mit winzigen Schubladen ein, zu den Samen, die die Freunde seines Vaters aus China und Yucatan und von den Malaiischen Inseln mitgebracht hatten, und zu denen, die er aus den Sammlungen der Forschungsexpedition hinübergerettet oder besser gesagt, gestohlen hatte. Wenn seine Augen überanstrengt waren und seine Haut von der Zimmerluft fahl geworden war, zog er sich in den hinteren Teil des Gartens zurück, zwischen Haus und Fluss, oder hinter die Repositur, wo er einige Proben einpflanzte und sich sorgsam sämtliche Charakteristiken der Sämlinge notierte.
Doch das war jetzt alles vorbei. Er legte den Stiefel an seinen Platz zurück und ging wieder ins Bett. In Afrika, hatte sein Vater gesagt, lebt ein Volk von Menschen, die keinen Nacken und die Augen auf den Schultern haben. Er konnte immer noch nicht schlafen, hinter seinen Lidern tanzten weiter die Listen. Leute aus Germantown und vom Wissahickon River schickten ihm Socken und Marmelade und träumten von dieser Expedition. Reisende zweiter Hand, die schliefen, während er wachte, und sich klischeehaft exotische Länder vorgaukelten. Lavinia hatte Freundinnen, für die Darwins Feuerland und Cooks Tahiti mit Parrys Iglulik und d’Urvilles Antarktis zu einem Ort verschmolzen, an dem Eisklippen an weite Steppen grenzten, wo Tonga-Wilde auf die Pirsch gingen, um Straußen nachzustellen, die Kamele jagten. Solche Leute schickten ein halbes Dutzend Kerzen in braunem Packpapier, doch da sie Nord und Süd nicht auseinanderhalten konnten, siedelten sie Pinguine und Eskimos in ein und derselben Eiswüste an, während sie dem Eismeer einen Kontinent andichteten.
Keiner von ihnen hatte eine Vorstellung davon, wie sehr eine solche Reise durch Stumpfsinn und Schinderei geprägt war. Nicht nur während der Planungs-, Einkaufs- und Verladephase, sondern auch während der langen Monate, in denen man untätig an Deck herumsaß, in den langen Zeiten, wenn nichts geschah, außer dass sich die Bindungen an die Heimat unmerklich lösten und einem das eigene Leben fremd wurde. Von seiner Angst und den im Geiste geführten Listen aller Dinge, vor denen er sich fürchtete, wusste niemand. Lauter lächerliche, unwürdige Ängste. Dass seine Koje zu kurz oder zu schmal oder zu feucht oder zu zugig war, seine Kameraden schnarchten oder wühlten oder stöhnten; dass ihn die Sehnsucht nach Frauen umtrieb; dass er nie Schlaf fand. Wenn er nicht schlief, würde er leicht aufbrausen; wenn er aufbrauste, würde er sich Zeke gegenüber im Ton vergreifen und ihn sich zum Feind machen. Dass sein Magen gegen die derbe Kost rebellierte und Dyspepsie seine Denkfähigkeit beeinträchtigen könnte; was wäre, wenn er das Denken verlernte? Dass er kalte Hände bekam. Sie waren ohnedies immer kalt. Dass er eine wertvolle Probe kaputt machte oder sich selbst schnitt. Dass er Gelenk- und Rückenschmerzen bekam, dass der Kaffee ausging, von dem er abhängig war; dass der Mast bei Sturm brechen, ein Wal das Schiff rammen könnte. Dass sie sich verirrten, nichts fanden, scheiterten.
Er gab alle Versuche, Schlaf zu finden, auf, zündete eine Kerze an und nahm sein Tagebuch zur Hand. Auf seiner ersten Reise war es sein treuer, manchmal einziger Gefährte gewesen, doch in dieser Nacht enttäuschte es ihn. Feder, Tintenfass, Worte auf weißem Papier; ein Tintenfleck an seinem Daumen. Es gelang ihm nicht, die Szene am Kai klar wiederzugeben. Er überflog seinen ersten verworrenen Versuch und fügte dann hinzu: Warum ist es so schwer, einfach das einzufangen, was war? Das alte Problem, die Dinge sowohl in ihrer Abfolge als auch in ihrer Gleichzeitigkeit darstellen zu wollen. Wenn ich die Szene malte, würde ich sie so darstellen, als geschehe alles zur gleichen Zeit, sodass alle Menschen und Dinge auf einmal zu sehen wären, vom Grund des Flusses bis zu den Wolken. Doch wenn ich sie mit Worten beschreibe, folgt ein Ding aufs andere, und alles ist nur durch mein eigenes Augenpaar gesehen, von meiner einen Stimme geprägt. Ich wünschte, ich könnte die Szene so darstellen, als würde sie durch viele Augen gesehen, indem ich meine eingeschränkte Perspektive so ausweitete, dass erst mehrere und schließlich viele Blickwinkel entstünden und damit das ganze Bild, nicht nur meine eigene Sicht. Als wäre ich nicht da. Der Fluss aus der Sicht der Fische, das Schiff aus der Sicht der Männer, Zeke aus der Sicht von Ned Kynd, die Toxies aus Captain Tylers Sicht: alles in einem, sodass ein anderer diese Stunden gleichsam selbst erleben könnte.
Gereizt legte er seine Feder weg. Nicht einmal hier, dachte er, nicht einmal auf diesen Seiten, die allein für seine eigenen Augen gedacht waren, war er ehrlich. Er hatte nichts von dem großspurigen Herumstolzieren des ersten Offiziers erwähnt, vom erschreckenden Anblick seiner eigenen Hände, die zwischen den Zwiebeln plötzlich genauso ausgesehen hatten wie die seines Vaters; und von dem Gefühl, dass sie alle irgendwie posierten. Voreinander oder vielleicht vor den grün berockten Jünglingen. Er rieb über den Tintenfleck am Daumen. Es stimmte auch nicht, jedenfalls nicht ganz, dass er die Szene darstellen wollte, als wäre er nicht dabei. Er wollte durchaus, dass sein Blickwinkel zählte, ohne dass dies im Widerspruch zu dem Wunsch stand, unsichtbar zu bleiben. So was Verlogenes, dachte er. Obwohl er sich in erster Linie selbst belog. Er lebte in einer Wolke. Draußen pulsierte und strömte das Leben, aber er war abgeschnitten; die Menschen liebten und trauerten ohne ihn. Wann hatte sich die Wolke auf ihn gelegt?
Sie waren immer noch nicht zur Abfahrt bereit. Am Nachmittag des nächsten Tages verbannte Captain Tyler Zeke und Erasmus von Bord, während die Männer die Schotten im Laderaum herausrissen und an anderer Stelle wieder aufbauten. Die Schlitten hatten doch nicht gepasst, egal wie man sie drehte und wendete; das Holz nahm mehr Platz ein als geplant, und es hatte sich herausgestellt, dass die Maße auf Zekes Skizze nicht stimmten. In Erasmus’ Brust tickte eine Uhr: eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei Tage. Später durften sie nicht fahren, eigentlich war es bereits jetzt zu spät, der arktische Sommer war kurz, und die Zeitungsreporter und Geldgeber der Expedition waren für Donnerstag zu ihrem Abschied bestellt. Hatte er genug Socken? Die richtigen Karten, genug Bleistifte?
Er platzte förmlich vor Unruhe und saß hier zu Hause fest, mit Zeke und Lavinia und ihrer Freundin Alexandra Copeland. Sie arbeiteten alle vier im großen Salon. Überall waren Land- und Seekarten ausgebreitet. Er stand ohne Erklärung auf und lief in die Repositur, um diese von oben bis unten nach Scoresbys Buch über das Eis der Arktis abzusuchen.
Er rollte die Leiter an den Regalen entlang; das Buch war verschwunden, ohne dass er sich daran erinnern konnte, es eingepackt zu haben. Ihm war der Gedanke unerträglich, den anderen zu erklären, warum es ihm plötzlich so wichtig erschien. Die Grimasse, mit der Alexandra seine Flucht begleitet hatte, war ihm unangenehm. Doch es war seine Idee gewesen, sie ins Haus zu holen – er konnte Lavinia nicht allein zurücklassen, nur mit den Dienstboten als einziger Gesellschaft, und zu Linnaeus oder Humboldt hatte sie nicht gehen wollen. »Eine Gefährtin«, hatte er vorgeschlagen, »die bereit wäre, für ein bescheidenes Entgelt bei freier Kost und Logis mit in unserem Haus zu wohnen.«
Lavinia hatte sich für Alexandra entschieden, die sich bereitwillig zwei Zimmer im Obergeschoss zuteilen ließ. Als Linnaeus und Humboldt ihr in einer unerwarteten Geste der Großzügigkeit anboten, die Stiche, die sie für ein Entomologiebuch druckten, per Hand zu kolorieren, nahm Alexandra auch dies an und richtete sich häuslich ein. Nun war ihr nirgends mehr zu entkommen, manchmal folgte sie ihm sogar bis in die Repositur. Aber Lavinia tut sie gut, ermahnte er sich. Sie hatte eine wundervolle Art, Lavinia in ihre Arbeit einzubeziehen. Er holte tief Luft und machte sich auf den Weg zurück in den Salon.
An der Tür blieb er stehen und betrachtete seine Schwester, die mit gerunzelter Stirn konzentriert zwischen dem Originalgemälde über ihrem Schreibtisch und dem Stich, den sie mit Alexandras Hilfe kolorierte, hin und her schaute. So vertieft war sie nie gewesen, wenn sie ihm mit seinen Pflanzensamen half. Es waren Stiche von vier tropischen Käfern. Die Sonne schien auf die Pinsel, die Wassergläser und die Rüschenschürzen, die so dicht mit Gold und Rostbraun und Blau besprenkelt waren, dass es fast aussah, als wären die Käfer von den Stichen auf die Beine der Frauen übergesprungen. »Hat einer von euch meinen Scoresby gesehen?«, fragte er.
»Ich habe oben darin gelesen«, sagte Alexandra. Sie tupfte ihren Pinsel auf das Blatt und hinterließ drei winzige goldene Punkte. »Ich wusste nicht, dass Sie ihn brauchen.«
Erasmus sagte, seine Torheit eingestehend: »Ich habe eigentlich keinen Platz mehr dafür.«
»Ich gehe ihn holen.« Als Alexandra ihren Pinsel hinlegte und sich auf den Weg machte, ließ Lavinia Tee kommen und beugte sich über den Tisch, auf dem Erasmus und Zeke ihre Papiere ausgebreitet hatten: viel zu nahe an Zekes Schulter, wie Erasmus fand. Als zöge der Duft seiner Haut sie an, als fehlte ihr das geistige Vermögen, der fast übertriebenen Schönheit zu widerstehen, nach der sich die Frauen auf der Straße umdrehten, und die andere Männer vor Neid erblassen ließ. Es schmerzte ihn, sehen zu müssen, wie ihre physische Sehnsucht sie verriet. Er fand sie entzückend mit ihren weit auseinanderstehenden nussbraunen Augen und dem runden Kinn, auf dem jetzt ein charmanter blauer Farbfleck prangte. Doch er vermutete, dass sie in den Augen anderer – vielleicht sogar Zekes – kaum mehr als leidlich hübsch war. Sie schien sich dessen bewusst zu sein, wie sie sich ebenfalls bewusst war, dass sie bei den ernsten jungen Damen, die einmal im Monat zusammenkamen, um über Goethe und Swedenborg und Fourier zu diskutieren, eher wegen ihres Feingefühls als wegen ihres Scharfsinns geschätzt wurde. Die jungen Damen hatten nach und nach geheiratet und waren diesen Treffen ferngeblieben, bis nur noch sie und Alexandra übrig waren. Als er einmal seine Vorbehalte gegen Zeke zum Ausdruck gebracht hatte, hatte sie entgegnet: »Ich weiß, dass ich ihn mehr liebe, als er mich liebt. Das stört mich nicht.« Daraufhin war sie so heftig errötet, dass er sie am liebsten auf den Arm genommen und im Zimmer hin und her getragen hätte wie früher, wenn sie als kleines Kind Trost gebraucht hatte.
Während Lavinia mit dem Zeigefinger ihre geplante Route nachzeichnete, an den Inseln Nord Devon, Cornwallis und Beechey vorbei, wo man Franklins Winterlager gefunden hatte, und von dort aus in einem Bogen nach Süden an der Halbinsel Boothia und King-William-Land entlang, ging es Erasmus durch den Kopf, dass topografische Karten nur zwei Dinge zeigen, Wasser und Land. Jemand, der noch nie gereist war, konnte den Eindruck gewinnen, dass ihre Reise durch die Arktis eine einfache Sache wäre. Sich nach rechts oder links wenden, gen Norden oder Süden, an dieser Landspitze oder jener Bucht vorbei. Er und Zeke wussten es aus den Berichten ihrer Vorgänger besser. Eis, ob als feste Masse oder bewegliche Schollen, erschien und verschwand mit beständiger Unregelmäßigkeit; ein Meeresarm konnte in einem Jahr offen, im nächsten mit undurchdringlichem Eis verstopft sein. Lavinia, die von alledem nichts wusste, zeichnete die Route rückwärts nach und stellte zufrieden fest: »Es ist gar nicht so weit. Ihr werdet vor Oktober wieder da sein.«
»Das hoffe ich«, sagte Zeke. »Aber du darfst dir keine Sorgen machen, wenn wir bis dahin nicht zurück sind – viele Expeditionen müssen überwintern. Wir haben für volle achtzehn Monate Proviant an Bord, falls wir im Eis stecken bleiben.«
Während Lavinia noch auf die trügerische Karte starrte, kehrte Alexandra mit Erasmus’ Buch zurück und stellte die Frage, die womöglich auch Lavinia bewegte: »Ich habe mich schon das ganze Frühjahr gefragt – wenn Sie diese Route nehmen, auf der Sie, wie Sie sagen, unweigerlich an die Stätten kommen, an denen es Spuren von Franklin und seinen Männern geben müsste, wie können Sie dann gleichzeitig nach einer offenen Passage im Polarmeer suchen? De Haven und Penny berichten, dass der Jones-Sund von einer Eisbarriere verschlossen war, als sie dort ankamen.« Sie strich sich ihre farbverschmierte Schürze glatt. »Ross musste feststellen, dass die Barrow-Straße größtenteils zugefroren war und der Peel-Sund ebenfalls. Selbst wenn es Ihnen gelingt, weiter in das Gebiet vorzudringen, das Rae erkundet hat, liegt es doch südlich der großen Wasserstraßen, wie wollen Sie dann gleichzeitig nach Norden vorstoßen?«
Erasmus hob überrascht das Haupt. Seit Monaten quälte ihn das gleiche Problem, doch er hatte es immer wieder beiseitegeschoben; Zeke hatte nach jenem Abend, an dem der jetzige Plan erstmals Gestalt angenommen hatte, nie wieder seinen Wunsch geäußert, ein offenes Polarmeer zu finden. Es war an Lavinias sechsundzwanzigstem Geburtstag gewesen, vorigen November; Alexandra hatte sich an jenem Abend ebenfalls unter den Gästen befunden, obwohl Erasmus kaum auf sie geachtet hatte. Er war voller Hoffnung gewesen, dass Lavinia nun endlich das bekommen sollte, wonach sie sich am meisten sehnte.
Er hatte keine Ausgaben gescheut, hatte die Fenster der Repositur mit frischem Grün geschmückt und Kerzen auf die Fensterbänke gestellt, den Seziertisch scheuern und mit steifem Leinen verhüllen lassen, damit heiße Brötchen, ein Prager Schinken, ein Truthahn und ein Lachs in Aspik darauf aufgebaut werden konnten. Lavinia hatte die ersten drei Männer, die sie umworben hatten, abgewiesen – zu langweilig, hatte ihr Urteil gelautet. Zu schwach, nicht klug genug. Während ihre Freundinnen heirateten und ihre ersten Kinder zur Welt brachten, hatte sie sich um Zeke bemüht und ihn schließlich irgendwie für sich gewonnen. Erasmus hatte während ihres langen Ringens erst um sie gebangt, sich dann für sie gefreut und anschließend wieder gebangt: Woran niemand anderer schuld war als er selbst. Zeke hatte um ihre Hand angehalten, ohne sich auf Einzelheiten festzulegen, und Erasmus hatte es nicht über sich gebracht, ihn zu drängen. Sein Vater hätte es besser gemacht, dachte er. Sein Vater hätte nicht zugelassen, dass Lavinia sich für eine unbestimmte Zeit band. Der Schaden war nicht mehr gutzumachen, aber Erasmus hatte insgeheim gehofft, dass Zeke die Feier zum Anlass nehmen würde, einen Hochzeitstermin zu verkünden.
In dem schmeichelnden Licht der Kerzen wirkte Lavinia selbst wie eine Kerze, so strahlend in ihrem weißen, mit blauen Schleifen verzierten Seidenkleid. Sie erstarrte förmlich, als Zeke, gerade wie Erasmus gehofft hatte, die Gesellschaft um Ruhe bat und sagte: »Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen!«
Erasmus hatte erleichtert aufgeseufzt und nicht gemerkt, dass Lavinia verstört wirkte. Zeke stützte sich mit einem Ellbogen auf eine Vitrine mit einem Paradiesvogel. »Sie haben alle die Nachricht vernommen, die John Rae Anfang des Monats verkündet hat«, sagte er. Er reckte das Kinn, warf sich in die Brust und fuhr mit einer Hand weit durch die Luft. »Ich zweifle nicht, dass Sie, das Schicksal der Franklinexpedition betreffend, die gleiche Trauer empfinden wie ich, aber auch die gleiche Erleichterung darüber, dass es endlich Neuigkeiten gibt, und seien sie noch so lückenhaft und möglicherweise mit Irrtümern behaftet.«
Er verbreitete sich weiter über das tragische Verschwinden Franklins und seiner Mannschaft, über die vielen Rettungsversuche, und erging sich in einer detaillierten Aufzählung der Dinge, die Rae entdeckt hatte – lauter alte Hüte für Erasmus, der sämtliche Zeitungsberichte verfolgt hatte. Seine Gäste lauschten mit dem Glas in der Hand, darunter etliche Frauen, die Zeke mit dem gleichen Interesse zugehört hätten, wenn er chinesische Anbauprodukte aufgezählt hätte; ganz gleich welchem Thema, glaubte Erasmus, sofern sie dadurch die Gelegenheit bekamen, ihn ungestraft anzuschauen. Doch seine Schwester war die Frau, die Zeke gewählt hatte. »Vielleicht sind Sie wie ich der Ansicht«, fuhr Zeke fort, »dass sich jetzt, da man den Unglücksort kennt, jemand auf die Suche nach möglichen Überlebenden machen sollte.«
An diesem Punkt machte einer der Gäste einen Schritt zur Seite, sodass Erasmus Lavinias Gesicht sehen konnte. Sie wirkte genauso verblüfft wie er.
»Es ist mir gelungen, die Unterstützung einer Reihe unserer führenden Kaufleute für ein solches Vorhaben zu gewinnen«, sagte Zeke. »Unser wackerer Dr. Kane hat in der falschen Gegend nach Franklin gesucht, und obwohl wir uns alle um ihn sorgen – und ich der Erste wäre, der sich auf die Suche nach ihm machen würde, wenn nicht bereits eine Hilfsexpedition vor dem Abmarsch stände –, ist es an der Zeit, mehr zu unternehmen. Ich habe vor, im kommenden Frühjahr aufzubrechen, um in der Gegend südlich des Lancaster-Sunds nach Franklin zu suchen. Während meines Aufenthaltes dort will ich die Region erkunden und mich des Weiteren bemühen, die Forschungen über die mögliche Existenz eines offenen Polarmeeres voranzutreiben.«
Die ganze Gesellschaft hatte ihn hochleben lassen. Erasmus hatte seinen Mund zu einem Lächeln verzogen und gehofft, dass ihm niemand die Überraschung anmerkte. Welche Kaufleute, wann, wie … wussten alle außer ihm längst Bescheid? Selbst Lavinia, die ihr Wissen vielleicht vor ihm verborgen hatte – doch nein, ihr Lächeln war genauso gezwungen wie seines. Zeke musste seine Vorbereitungen heimlich getroffen und es sich zum Vergnügen gemacht haben, seinen Plan erst zu verkünden, als die Sache perfekt war.
Als die Gratulationen und die ersten aufgeregten Fragen danach, wohin Zekes Reise führen sollte, abebbten, ergriff Zeke Lavinias Hände. Sie strahlte, als wäre seine Ankündigung das ideale Geburtstagsgeschenk, und als einer der Gäste sich ans Klavier setzte und zu spielen begann, führten Zeke und sie den ersten Tanz an.
Erasmus ging nach draußen, um eine Zigarre zu rauchen und den Sturm in seinem Innern zu beruhigen. Wie er dasaß und dem in der stillen Nachtluft aufsteigenden Qualm nachsah, trat Zeke mit zwei Gläsern und einer Flasche hinzu. Jetzt sei es Zeit, Fragen zu stellen, dachte Erasmus. Väterliche Fragen, auch wenn ihm die Rolle noch fremd war: Was Zekes Vorhaben für die Verlobung bedeute, ob er Lavinia vor seinem Aufbruch heiraten werde – oder sie bis zu seiner Rückkehr von dem Eheversprechen entbinden wolle.
Zeke lehnte sich an eine der kannelierten Verandasäulen, schenkte ein und steckte sich ebenfalls eine Zigarre an. Erasmus setzte zum Sprechen an, und Zeke sagte: »Erasmus – du musst mitkommen. Wann wirst du je wieder eine solche Chance bekommen?«
Erasmus verschluckte sich und hustete so, dass er sich krümmte. Ihm waren schon so viele Expeditionen entgangen – war dies diejenige, auf die er gewartet hatte? Selbst Elisha Kent Kane hatte ihn verschmäht und war mit einer Crew von Männern aus Philadelphia gesegelt, die jünger, aber keineswegs klüger waren als er. Vielleicht spürte Zeke seine Enttäuschung und das Maß seiner verletzten Eitelkeit.
»Du bist der ideale Mann für diese Reise«, sagte er. »Wo sollte ich sonst jemanden finden, der sich so gut mit der Naturgeschichte der arktischen Regionen auskennt? Oder der so vertraut ist mit den Beschwernissen einer solchen Reise?«
Die Vorstellung, im Dienste eines Mannes zu fahren, der so viel jünger war als er, war grotesk, doch er hatte den Eindruck, dass Zeke nicht einen Untergebenen suchte, sondern einen Partner. Gewiss würde Zeke ihn nicht um Hilfe angehen, wenn er ihn nicht als gleichrangig oder sogar als Autoritätsperson empfände?
Erasmus sagte: »Nett von dir, an mich zu denken. Aber du hättest mich eher fragen können – ich habe Verpflichtungen hier und natürlich meine Arbeit …«
Zeke sprang auf den Rasen hinunter. »Ja!«, rief er. »Natürlich ist es eine Zumutung. Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dich zu fragen, wenn deine Arbeit nicht von so unschätzbarem Wert wäre … gerade darum bist du der richtige Mann. Ich wollte dich nicht behelligen, bis ich die Finanzierung unter Dach und Fach habe. Denk nur, was wir alles sehen werden!«
Irgendwo in den eisigen Gewässern saßen Franklin und seine Mannen mit der Erebus und der Terror womöglich noch fest. Selbst wenn sie nicht zu finden waren, gab es eine Fülle neuer Tier- und Pflanzenarten, ja neuer Länder zu entdecken. Diesmal wäre er frei, dachte Erasmus, es würde keine lästige Marinedisziplin geben, die seine Forschungsarbeit behinderte, er würde Eindrücke vom Norden bekommen, die seine flüchtigen antarktischen Erlebnisse ergänzten, ja weit übertrafen; er würde naturkundliche Entdeckungen machen, die sich unter Umständen als außerordentlich bedeutend erwiesen. Seine Gedanken wanderten zu seiner Schwester, die in ihrem weißen Kleid, das sich im Gehen bauschte wie der Blütenstand einer Katalpa, soeben auf die Veranda trat.
»Du solltest hineingehen«, sagte sie zu Zeke. »Alle Gäste brennen darauf, mit dir zu reden.«
Er sprang die Stufen hinauf, und sie schob ihn in den Raum. Dann drehte sie sich mit wogenden Röcken zu Erasmus um: »Wirst du mitfahren?«
Sie hatte also gelauscht. Wieder einmal. Schon als kleines Mädchen hatte sie gelauscht, als wäre es die einzige Methode, sich über ihre Brüder auf dem Laufenden zu halten.
»Bitte? Du musst mit ihm fahren.«
Er hatte seine eigenen Gründe, dachte Erasmus. Zum Mitfahren oder Hierbleiben. »Hat er es vor dir geheim gehalten?«
»Es ging nicht anders, er sagt, er musste erst …«
»Gibt dir das nicht zu denken?«
»Als ob du mir je etwas erzählst«, sagte sie. »Woher nimmst du das Recht, ihn zu kritisieren? Vor allem seit Vaters Tod. Seitdem bläst du nur noch Trübsal und sortierst deine Samen – glaubst du, mir ist entgangen, dass du oft bis elf im Bett liegst? Weil Linnaeus und Humboldt dich in der Gravieranstalt nicht brauchen. Weil du nach Sarah Louise nie wieder eine Frau gefunden hast, die du liebst.«
Sarah Louise, dachte er. Immer noch hatte er bei dem bloßen Klang ihres Namens das Gefühl, einen Stein verschluckt zu haben. Ein dumpfer Schmerz, der ihn nie ganz verließ. Lavinia wusste das.
»Copernicus ist auch nicht verheiratet«, fuhr sie fort, »aber den sieht man nicht Trübsal blasen, der vertut sein Leben nicht wie … Ich brauche dich.«
Er wurde von Schuldgefühlen und Zärtlichkeit gewürgt. Als sie Kinder waren, war er mit seinen Brüdern manchmal in den Wald gelaufen und erst viele Stunden später wiedergekommen, nur um Lavinia dann an einem Fenster vorzufinden, wo sie mit einem ungeöffneten Buch auf dem Schoß wartete. Er war derjenige gewesen, zu dem sie aufblickte, derjenige, der ihr die Schuhe zugebunden und ihr das Lesen beigebracht hatte. Manchmal, wenn die anderen Jungen nicht da waren und ihm bewusst wurde, dass ihre Geburt nicht nur ihn die Mutter gekostet hatte, sondern dass sie überhaupt nie eine Mutter gehabt hatte, waren sie einander sehr nahegekommen. Doch immer waren die Brüder bald hereingetollt, und er hatte sie wieder verlassen. Hin und her, der Älteste und die Jüngste. Er hatte sie oft genug im Stich gelassen.
Sie zog ihn hinein, in eine Ecke hinter einer Vitrine voll ausgestopfter Finken. »Er ist der Mann, den ich liebe«, sagte sie heftig. »Verstehst du das? Weißt du noch, wie das ist? Was ist, wenn ihm etwas zustößt? Du musst an meiner Stelle auf ihn aufpassen.«
»Lavinia«, sagte er. Ihre Hände pressten sich in seinen linken Arm. Als Zeke einmal das Schiffsunglück geschildert hatte, durch das er zum Lokalhelden geworden war, hatte Erasmus sie hinterher weinend im Garten gefunden. Nicht aus nachträglicher Furcht um Zeke, nicht aus Hysterie – sondern, wie sie ihm mühselig erklärt hatte, vor Sehnsucht. Vor grenzenlosem Sehnen nach Zeke. Als er versucht hatte, sie daran zu erinnern, dass Zeke neben seinen Tugenden auch Fehler besäße, war ihre Antwort gewesen: »Das weiß ich, natürlich weiß ich das. Aber das ändert nichts. Entscheidend ist, was ich empfinde, wenn er meine Hand berührt oder wenn wir tanzen und ich die Haut an seinem Hals rieche.« Die Gewalt ihrer Gefühle hatte ihn peinlich berührt.
»Du weißt, es bedeutet, dass du noch länger warten musst«, sagte er. »Hat er einen Termin genannt?« Seine Schuld, dachte er abermals. Warum hatte er Zeke nicht selbst gefragt?
»Nicht direkt. Aber nach seiner Rückkehr wird er zur Ruhe kommen wollen, das weiß ich.«
Natürlich wollte er, dass sie Zeke heiratete, nicht nur, um seine Verpflichtungen abzugeben, sondern auch, weil er sie glücklich sehen wollte. Oder? Sie hatte sich erst um ihren Vater gekümmert, dann um ihn. »Bist du dir seiner Gefühle für dich sicher?«
»Er liebt mich«, entgegnete sie leidenschaftlich. »Auf seine Art – das weiß ich gewiss.«
An diesem Punkt hatte er entsetzliche Kopfschmerzen bekommen, sodass der Rest des Festes wie in einem Nebel verschwamm. Und obwohl ihm bis heute nicht klar war, was ihn dazu bewogen hatte, war er hier an diesem Tisch gelandet und bei Alexandras gezielten Fragen; und es war eine Tatsache, dass er in zwei Tagen in Gesellschaft eines jungen Mannes gen Norden segeln würde, den er seit vielen Jahren kannte, ohne dass er sich allerdings vorstellen konnte, von ihm Befehle entgegenzunehmen.
Eines der Hausmädchen brachte den Tee: Agnes? Ellen? Für die Dienstboten war Lavinia zuständig; solange die Mahlzeiten rechtzeitig auf den Tisch kamen, nahm Erasmus keine Notiz davon, wer die Arbeit erledigte. Er glaubte, dass sie es nicht merkten, obwohl Lavinia ihm bisweilen Vorhaltungen machte, und er einmal sogar mit angehört hatte, wie das Küchenpersonal sich über den »Samenheini« unterhielt und in unbändiges Gelächter ausbrach. Jetzt wich er dem Blick des jungen Mädchens mit dem Tablett aus und holte Luft, gespannt darauf, was Zeke zum offenen Polarmeer sagen würde.
»Sie lesen viel«, sagte Zeke zu Alexandra. Falls er überrascht war, dass sie seine Bemerkung von dem Fest im Kopf behalten hatte, ließ er sich nichts anmerken. »Das ist mir aufgefallen. Daher wissen Sie sicher, dass es Gegenden gibt, in denen einige Wasserstraßen Jahr um Jahr den ganzen Winter offen sind, und zwar jeweils an den gleichen Stellen. Die Russen nennen sie Polynyas. Inglefield fand im Smith-Sund offenes Wasser vor. Man hat in Kanada Vögel gesehen, die nach Norden ziehen. Unter der Oberfläche fließt eine warme Strömung nordwärts, das haben bereits mehrere Forscher beobachtet – angenommen, sie führte jenseits des Eisriegels in ein gemäßigtes, eisfreies Meer, das den Nordpol umgibt?«
»Gut, angenommen«, sagte Alexandra. Ihre rechte Hand vollführte einen Bogen in der Luft, als hielte sie noch immer einen Pinsel.
»Auch Dr. Kane hat bei seinem Aufbruch gesagt, er wolle, soweit möglich, nach Zeichen suchen, die auf dieses Phänomen deuten«, fuhr Zeke fort. »Auch von daher ist mein Wunsch also nicht abwegig.«
Wie oft hatte Erasmus seit dem Fest in den Kontoren reicher Männer gesessen, während Zeke ihren Plan für die Suche nach Franklin vortrug. In der Kajüte der Narwhal hing ein Porträt Franklins in Galauniform – Franklin, Franklin, hatte Zeke gesagt, wenn er die Männer um Geld anging. Dass er sich auf diesen Aspekt der Reise konzentrierte, war einleuchtend – wie stolz die Kaufleute waren, einen Beitrag zu einem so guten Zweck zu leisten! Sie sahen, dachte Erasmus, in Zeke einen jungen Mann, dem alles gelingen konnte. Den Mann, der sie selbst gern gewesen wären, den Mann, als den sie ihre Söhne gern gesehen hätten. Andere Expeditionen mochten gescheitert sein, doch Zeke würde erfolgreich sein.
»Es ist eine Theorie«, sagte Zeke gerade zu Alexandra. »Eine interessante Theorie. In der Arktis ist weder vorherzusagen, wie weit man im Eis vordringen kann, noch mit welcher Geschwindigkeit, und längst nicht immer, in welche Richtung. Mein Plan ist, dieser Route zu folgen und nach Franklin zu suchen. Doch sollten die Bedingungen unerwartet günstig sein – sollte beispielsweise eine der nördlichen Wasserstraßen offen sein –, werden wir möglicherweise die Gelegenheit ergreifen, sie zu erforschen.«
»Möglicherweise«, sagte Alexandra. »Daher haben Sie für achtzehn Monate Proviant eingelagert?«
»Sicherheitshalber«, erwiderte Zeke. Er strich sich über die Augenbrauen, um die borstigen goldenen Büschel zu glätten, vielleicht in dem Bewusstsein, dass Lavinia die Geste aufmerksam verfolgte. Vielleicht aber auch, dachte Erasmus, ein wenig ärgerlich, dass Alexandra nicht hinsah. Sie war eine durch und durch vernünftige Person und schien gegen Zekes Charme immun.
Lavinia riss ihren Blick von Zekes Hand los und sagte: »Ich sehe auf den Karten keinen Punkt, an dem ihr euch nach Norden wenden könntet.«
»Nur wenn er dazu gezwungen wäre«, erwiderte Alexandra. »Nachdem er so viel Geld für die Suche nach Franklin beschafft hat, wäre es doch nicht rechtens, bewusst in eine andere Richtung zu fahren.«
Zeke sah sie unverwandt an, und sie schaute genauso unverwandt zurück.
»Die Karten sagen uns nie alles, was wir wissen wollen«, sagte er und fügte, an Lavinia gewandt, hinzu: »Das ist einer der Gründe für unsere Reise.«
Später wurde Erasmus klar, dass ihm, sosehr er auch auf Zekes Gesten und die Reaktionen der beiden Frauen geachtet hatte, dennoch einiges entgangen war. Die Sonne ging unter, man machte Licht, und sie aßen köstlichen Schokoladenkuchen; die Karten verlockten ihn zum Träumen von Ruhm. Vom eigenen Ruhm, von den eigenen Sehnsüchten. Vielleicht würden sie Überlebende von Franklins Expedition finden, oder falls nicht, zumindest bessere Belege für das, was geschehen war, als Raes entmutigenden Bericht. Und mit ein wenig Glück würden sie auch anderes finden: allerlei unbekannte Exemplare, nicht nur von Pflanzen, auch von Algen, Fischen, Vögeln – er würde ein Buch schreiben. Er würde seine Funde skizzieren und beschreiben; er hatte Talent, nach der Natur zu zeichnen und die charakteristischen Merkmale herauszuholen, wie es nur geübten Beobachtern gelang. Copernicus, der so gut mit Farben und Licht umgehen konnte, könnte nach seinen Zeichnungen Bilder malen, Linnaeus und Humboldt würden die Stiche anfertigen. In gemeinsamer Arbeit würde ein schönes Werk entstehen. Jahrelang hatte er sich vor dem Hintergrund seiner Enttäuschungen vorgemacht, er hätte keinen Ehrgeiz – doch er war ehrgeizig, durchaus. Und es war ein unfassliches Glück, an dieser Reise teilnehmen zu können. Ein Sturm der Erregung trübte ihm den Blick.
»Und Sie, Erasmus«, sagte Alexandra. »Was halten Sie von alledem?«
»Im Polargebiet muss man flexibel sein«, antwortete er, »das stimmt. Man muss die Gelegenheiten nutzen, wie sie sich bieten.«
Er sah auf das Buch hinunter, das sie ihm überlassen hatte. Er würde es doch mitnehmen. Dieses eine Büchlein konnte man doch wohl noch unterbringen? »Zeke und ich werden schauen, was wir finden, und uns entsprechend entscheiden.«
In jener Nacht schrieb Alexandra in ihr Tagebuch: Es liegt nicht an Lavinia, dass ihre Brüder sie unterschätzen. Ich weiß, dass sie anders sein wird, sobald die Männer weg und wir unter uns sind; in Zekes Gegenwart versagt ihr Verstand. Ich freue mich darauf, ungezwungen mit ihr allein zu sein. Dieses Haus ist so schön, so geräumig – was würden wohl meine Eltern denken, wenn sie mich in den beiden herrlichen Zimmern sähen, die ich jetzt mein Eigen nenne? Aus dem Fenster über meinem Bett schaue ich auf eine Gruppe von Zwergbäumen. Meine Bettwäsche wird einmal die Woche gewechselt, und nicht von mir, sondern von einem dienstbaren Geist. Und das Malen gefällt mir sehr, es ist so viel befriedigender als Näharbeit. So viel besser bezahlt. Unter dem Futter meines Nähkörbchens steckt schon eine stattliche Summe Geldes. Bald werde ich mir ein paar eigene Bücher kaufen können, fast eine Verschwendung, wo ich doch die Regale in der Repositur durchstöbern kann, wenn die Männer erst fort sind … Ich kann es kaum erwarten, sie in See stechen zu sehen. Wie gern würde ich mir den Luxus erlauben, dort draußen schlafen zu können, wie Erasmus.
Ob ihm wohl bewusst ist, dass er immer mit dem Fuß wippt, wenn Zeke spricht? Ich frage mich, wie Erasmus wohl als kleiner Junge war. Bevor er so erstarrt ist; als er das Kinn noch nicht so tief im Kragen vergrub und mit der rechten Hand die linke so heftig knetete, dass man fürchtet, er könne sich die Knochen brechen. Lavinia sagt, als sie ein Mädchen war, hat er Käfer und Nachtfalter geliebt und Späße mit den Gouvernanten getrieben, die nacheinander für ihre Erziehung zuständig waren. Mir ist es unvorstellbar, dass er mit jemandem Späße treibt.
Die Narwhal lief am 28. Mai aus. Bis zur letzten Minute herrschte ein solcher Trubel, dass es Erasmus schien, als wäre alles wirklich Wichtige noch unerledigt und als hätte er nichts von dem gesagt, was er hatte sagen wollen. Er und Zeke standen in ihren neuen grauen Uniformen an Deck und winkten mit ihren Taschentüchern. Über ihnen flatterte das Banner der Toxophiliten im Wind, dehnte sich klatschend in die Länge, fiel in sich zusammen, dehnte sich klatschend wieder aus. Seeschwalben hingen bewegungslos in den hohen Luftströmungen, und Erasmus hatte das Gefühl, als hinge er ebenfalls zwischen zwei Welten.
Die Angehörigen der Crewmitglieder standen in Grüppchen dicht am Ufer, hinter ihnen die jubelnden Toxies in ihren grünen Uniformen. Zekes und Erasmus’ Verwandte und Freunde standen in getrennten Häuflein über den Kai verstreut. Der Wind, der über den Fluss fegte, bauschte ihre Kleider zu großen bunten Flecken auf. Alexandra hatte ihre ganze Familie mitgebracht – ihre Schwestern Emily und Jane, ihren Bruder Browning sowie dessen Frau und ihren kleinen Sohn. Sie standen so dicht zusammengedrängt, als könnten sie sich nicht einmal hier, im Freien, aus der Beengtheit des winzigen Hauses lösen, das sie seit dem Tod ihrer Eltern bewohnten. Sie waren klein, adrett, und wirkten doch irgendwie streitbar; sie waren Abolitionisten, ernsthafte junge Leute. Wiewohl in den Farben der Spatzen und Tauben gekleidet, ähnelten sie doch eher einer Sägekauz-Familie, dachte Erasmus. Browning hielt eine Bibel in den Händen.
Später berichtete Alexandra in ihrem Tagebuch von der Auseinandersetzung, die sie mit Browning über die von ihm verlesenen Verse gehabt hatte. Später fertigte sie eine Skizze von Erasmus an, wie er während dieser letzten Minuten seine lange, schmale Nase in den Wind hielt und nervös ein Stag umklammerte, die ergrauenden Locken unter einer Mütze, mit der er seltsam jungenhaft wirkte. Doch jetzt stand sie nur schweigend da und beobachtete ihn dabei, wie er seinerseits alle anderen beobachtete. Im öligen Wasser wirbelten und tanzten Hobelspäne rund um die Pfähle.
Zur Linken von Alexandra und ihrer Familie stand eine Gruppe Angestellter aus der Gravieranstalt mit einigen Vertretern der Voorhees’schen Postschifflinie; wiederum ein Stück weiter Linnaeus und Humboldt, drall und glänzend wie Biber, und – bei beiden eingehakt – Lavinia, die, in wirbelnden Blau- und Grüntönen übertrieben herausgeputzt, wie eine Forelle in der Sonne schimmerte. Ganz vorne am Kai stand, wie es sich wegen ihrer Rolle bei der Ausrichtung der Expedition geziemte, Zekes Familie. Sein Vater weltmännisch und stolz, mit schweren Augenbrauen und einem noch vollen rötlichen Haarschopf, den der Wind zerzauste, dass die luchsartigen Haarbüschel in seinen Ohren zum Vorschein kamen. Die Mutter, einer verstorbenen Tante zu Ehren in Schwarz gehüllt, weinte. Kein Wunder, dachte Erasmus, sie war berühmt dafür, wie sie ihren einzigen Sohn verzärtelte. Zu ihren beiden Seiten standen Zekes Schwestern Violet und Laurel, schön gekleidet, augenscheinlich voller Verachtung für die ihnen angetrauten Kaufmänner, die nicht mit auf die Reise nach Norden gingen.