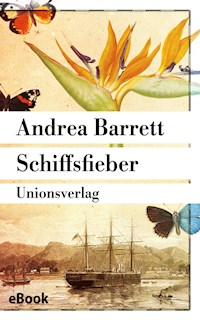
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Mendel streift durch seine Erbsenpflanzung, ein verwunschener Ort, in dem er das Geheimnis der Erblehre lüften wird und doch bald selbst nicht mehr daran glaubt. Zwei Frauen stellen sich gegen zähe Vorurteile und zweifeln die Lehrmeinungen an. Der alte Carl von Linné hat der Natur eine taxonomische Ordnung übergestreift, doch der Name seiner Tochter entschwindet im Nebel. Das heisere Gezänk nistender Möwen, nachtschwarze Jaguare, Vögel ohne Füße und der Zauber der Chemie befeuern die glühende Faszination an der Natur, den Drang, forschend die Welt zu erfassen. Andrea Barrett erzählt vom versteckten Preis hinter umwälzenden Erkenntnissen, von brennenden Zweifeln und dem, was bleibt, wenn es still wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Das heisere Gezänk nistender Möwen, Vögel ohne Füße und nachtschwarze Jaguare befeuern den Drang, forschend die Welt zu durchdringen. Doch ob Mendel oder Linné, immer wieder locken falsche Fährten, vergehen Chancen. Einfühlsam erzählt Barrett von revolutionären Erkenntnissen, brennenden Zweifeln und der Frage, was bleibt, wenn es still wird.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Andrea Barrett (*1954) wandte sich nach ihrem Studium der Zoologie dem Schreiben zu und wurde seither mehrfach für ihre Werke ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award, dem MacArthur Fellowship und dem Rea Award for the Short Story. Sie lehrt Kreatives Schreiben in Massachusetts.
Zur Webseite von Andrea Barrett.
Karen Nölle (*1950) studierte Anglistik und Germanistik und ist als Autorin, Lektorin, Herausgeberin und Übersetzerin tätig. Sie übersetzt Belletristik aus dem Englischen, u. a. Werke von Andrea Barrett, Annie Dillard, Alice Munro, Patricia Duncker, Barbara Trapido, Doris Lessing und Tony Earley.
Zur Webseite von Karen Nölle.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Andrea Barrett
Schiffsfieber
Aus dem Englischen von Karen Nölle
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1996 bei W. W. Norton & Company, New York, USA
Dei deutsche Erstausgabe erschien 2000 bei Econ Ullstein List Verlag, München
Originaltitel: Ship fever and other stories
© by Andrea Barrett 1996
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Schiff - Lakeview Images (Alamy Stock); Blume, Falter - Public Domain, Natural History Museum, London
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31127-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 05:23h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SCHIFFSFIEBER
HabichtskrautDer englische SchülerIn der GezeitenzoneSeltener VogelHöhenkollerParadiesvögelFeuer – 1853Wechselfieber – 1855Theorien – 1862SchwesternbandeDie FamiliengeschichteAlchimieDas Gespräch mit SukyDer weiße HundSchiffsfieber1 – 27. Januar 18472 – Die Insel sah anfangs so aus: flach und …3 – 2. Juni 1847. Das Wetter ist nach wie …4 – Auf seiner zweiten Fahrt mit der St …5 – Bei seiner Rückkehr aus der Stadt erkannte Nora …6 – Nora wollte die Insel verlassen, aber irgendwie schien …Danksagung und QuellenMehr über dieses Buch
Über Andrea Barrett
Andrea Barrett: »Ich stelle Fragen, die nicht beantwortet werden können.«
Über Karen Nölle
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Andrea Barrett
Zum Thema USA
Zum Thema Meer
Für Wendy Weil
Habichtskraut
Dreißig Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung, stellte mein Mann sich jedes Jahr im Herbst vor sein Genetikseminar für Fortgeschrittene und teilte Kopien von Mendels berühmtem Aufsatz über die Kreuzung von Gartenerbsen aus. Die Abhandlung sei von mustergültiger Klarheit, erklärte Richard seinen Studenten. Der Inbegriff dessen, wonach die Wissenschaft strebe.
Richard schritt vor der Tafel auf und ab und sprach frei und ungezwungen. Er war wie der Evolutionsforscher Robert Chambers mit einem sechsten Finger geboren und war sich seiner linken Hand mit der Operationsnarbe aus Kindertagen, als man ihm den überzähligen Finger entfernt hatte, immer noch unangenehm bewusst. Deshalb benutzte er, obwohl er mit ausladenden Gesten sprach, stets nur die rechte Hand und ließ die linke in der Hosentasche. Von der Rückseite des Raumes, wo ich jedes Jahr im Herbst saß, um mir diese Vorlesung anzuhören, konnte ich die Studenten beobachten.
Nachdem Richard die Abhandlung ausgeteilt hatte, erzählte er zunächst Gregor Mendels Lebensgeschichte in der konventionellen Form. Mendel, berichtete er, sei in einem Dörfchen im äußersten Nordwesten von Mähren aufgewachsen, das damals noch zum Habsburgischen Reich gehörte und später zur Tschechoslowakei. Mit einundzwanzig Jahren, als armer, bildungshungriger Mann, trat er in der Hauptstadt Brünn, dem heutigen Brno, in ein Augustinerkloster ein. Er absolvierte ein naturwissenschaftliches Studium und unterrichtete nach dem Examen an einer Oberschule der Stadt. 1856, im Alter von vierunddreißig Jahren, nahm er seine Versuche über Pflanzenhybriden auf, indem er Gartenerbsen künstlich befruchtete. Als Labor diente ihm ein kleines Beet an der Klostermauer.
Im Laufe der folgenden acht Jahre führte Mendel Hunderte von Experimenten mit Tausenden von Pflanzen durch und verfolgte die Muster, nach denen ihre Merkmale durch die Generationen weitergereicht wurden. Hochwüchsige und kleine Pflanzen mit weißen und lila Blüten; runzlige oder glatte Samen; Schoten, die sich um die Erbsen wölbten oder diese eng umhüllten. Er machte detaillierte Aufzeichnungen zu allen Kreuzungen und verwendete diese als Grundlage für die Abhandlung, welche die Studenten nun in Händen hielten. An einem klaren, kalten Abend des Jahres 1865 verlas er den ersten Teil dieser Abhandlung vor dem Kollegium des Naturforschenden Vereines zu Brünn, in dem er ebenfalls Mitglied war. Ungefähr vierzig Männer saßen im Publikum, einige wenige professionelle Wissenschaftler und zahlreiche engagierte Amateure. Mendel las eine Stunde lang, er beschrieb seine Experimente und die konstanten Muster der in seinen Hybriden auftretenden Merkmale. Einen Monat später, bei dem darauffolgenden Treffen des Kollegiums, stellte er die Theorie vor, die er zur Erklärung seiner Entdeckungen formuliert hatte.
Dort, in jenem kleinen überfüllten Raum, wurde die wissenschaftliche Genetik geboren, sagte mein Mann. Mendel habe nichts von Chromosomen oder Genen oder der DNS gewusst, aber er habe die Prinzipien entdeckt, mit deren Hilfe die Suche nach diesen Dingen möglich wurde.
»Hat man ihm applaudiert?«, pflegte Richard an diesem Punkt zu fragen. »Hat er jubelnde Zustimmung geerntet oder auch nur leisen Protest?« Eine rhetorische Frage; die Studenten wussten, dass er keine Antwort wollte.
»Nein, weder noch. Das Protokoll der Veranstaltung zeigt, dass keine Fragen gestellt wurden und es zu keiner Diskussion kam. Nicht ein Einziger unter den Anwesenden erkannte die Bedeutung dessen, was Mendel vorgestellt hatte. Als die Abhandlung ein Jahr darauf gedruckt wurde, fand sie keinerlei Echo.«
Die Studenten senkten ihre Blicke auf die ausgehändigten Aufsätze, und Richard kam rasch zum Ende seiner Erzählung, indem er schilderte, wie Mendel ins Kloster zurückkehrte und sich mit anderen Dingen beschäftigte. Er unterrichtete weiter und machte weitere Versuchsreihen; er züchtete Wein und Obstbäume und alle möglichen Blumen, und er hielt Bienen. Schließlich wurde er zum Prior seines Klosters gewählt, sodass er bis zu seinem Tod gänzlich von den Verwaltungsaufgaben in Anspruch genommen wurde. Erst 1900 wurde seine Abhandlung wieder entdeckt, und eine neue Generation von Wissenschaftlern erkannte endlich die Bedeutung seiner Arbeit.
Wenn Richard an diesen Punkt seines Vortrags kam, suchte er stets lächelnd meinen Blick hinten im Raum. Er wusste, dass ich wusste, was die Studenten am Ende des Semesters erwartete. Nachdem sie die Abhandlung gelesen und die Laborstunden überstanden hatten, in denen sie an in Reagenzgläsern gezüchteten Fruchtfliegen die Gesetze der Mendelschen Erblehre nachvollzogen, würde Richard ihnen die andere Geschichte von Mendel erzählen. Die Geschichte, die er durch mich kannte und die davon handelt, wie Mendel von einem herablassenden Wissenschaftlerkollegen und den Hybridformen des Habichtskrauts in die Irre geleitet wurde. Die Geschichte, in der seine Wissenschaft nicht nur ohne Anerkennung bleibt, sondern obendrein durch Einsamkeit und Sehnsucht verfälscht wird.
Ich hatte einen Grund, der Vorlesung jeden Herbst beizuwohnen, einen Grund, der sich nicht ausschließlich aus Pflichtbewusstsein und Eheweiblichkeit erklärt: Richard ist nicht derjenige, durch den Mendel in mein Leben getreten ist.
Als ich ein Kind war, zu Anfang der Weltwirtschaftskrise, arbeitete mein Großvater Anton Vaculik in einer Gärtnerei in Niskayuna nicht weit von Schenectady, wo Richard und ich bis heute wohnen. Es war nicht die einzige Arbeit, die mein Großvater gehabt hatte, aber es war die Stelle, die ihm von allen am meisten behagte. Er hatte Mähren 1891 verlassen und war mit seiner schwangeren Frau nach Bremen gereist. Von dort war er mit dem Schiff nach New York gefahren und mit einem weiteren Schiff nach Albany. Er hatte vorgehabt, bis in eine der großen tschechischen Ansiedlungen in Minnesota oder Wisconsin weiterzureisen, doch als meine Mutter sechs Wochen zu früh geboren wurde, ließ er sich stattdessen mit seiner Familie hier nieder. In der Gegend lebten ebenfalls einige tschechische Einwanderer, und einer von ihnen stellte meinen Großvater in seiner kleinen Fabrik zur Herstellung von Perlmuttknöpfen für Damenblusen ein.
Später, als er besser Englisch konnte, fand er die Stelle, in der er sich so wohlfühlte. Dort blieb er dreißig Jahre; er war so geschickt im Züchten von Pflanzen und Veredeln von Bäumen, dass die Besitzer der Gärtnerei ihn noch eine ganze Weile als Teilzeitkraft weiter beschäftigten, nachdem er schon längst das Pensionsalter überschritten hatte. Er hieß bei allen in der Gärtnerei nur Tony, wie es für amerikanische Ohren vertraut war. Bei mir hieß er Tati, als Abkürzung von tatínek, dem tschechischen Wort für Papa, mit dem meine Mutter ihn rief. Ich wurde nach ihm Antonia getauft.
Wir mussten nie hungern, als ich klein war; es ging uns besser als vielen anderen, aber unser tägliches Leben war überall von Sparsamkeit bestimmt. Meine Mutter nahm Näharbeiten an, änderte Jacken und flickte Hosen; beim Bügeln hob sie die Aufschläge bis zuletzt auf, wenn das Eisen schon abkühlte, nachdem es ausgestöpselt war. Meinem Vater hatte man im Elektrizitätswerk den Lohn gekürzt, und meine älteren Brüder versuchten, zum Unterhalt beizutragen, indem sie sich allerlei kleine Arbeiten suchten. Ich war das einzige Familienmitglied, das nichts zu tun hatte, deshalb überließ mich meine Mutter an den Wochenenden und im Sommer manchmal Tati. Ich liebte es, für ihn arbeiten zu dürfen.
In der Gärtnerei standen ganze Felder voller Obstbäume, Pfirsich- und Apfel- und Birnbäume, und lange niedrige Gewächshäuser voller Sämlinge. Ich heftete mich an Tatis Fersen und half ihm beim Umpflanzen oder bei der Arbeit mit seinem scharfen sichelförmigen Messer und dem Baumwachs. Ich setzte mich neben ihn auf einen hohen Holzhocker und hielt seine Pinzette oder das Glas mit vergälltem Spiritus, wenn er Blumen die Staubgefäße abnahm. Er erzählte, während er arbeitete, und so erfuhr ich von seiner ersten Zeit in Amerika.
Nur wenn sein neuer Chef auf der Bildfläche erschien, verstummte Tati regelmäßig, und sein Lächeln verflog. Der ehemalige Obergärtner Sheldon Hardy war unser Freund gewesen: Er war ungefähr so alt wie Tati und hatte jahrelang Seite an Seite mit ihm gearbeitet, Stecklinge gesetzt und Obstbäume veredelt. Doch 1931, in dem Jahr, als ich zehn war, erlitt Mr Hardy einen Herzinfarkt und zog zu seiner Tochter nach Ithaca. Kurz darauf wurde Otto Leiniger eingestellt und raubte uns fortan täglich einen Teil der Freude an unserer Arbeit.
Leiniger muss Ende fünfzig gewesen sein. Er beeilte sich sogleich, Tati zu erklären, dass er ein Magisterdiplom von einer Universität im Westen besitze. Und sein weißer Kittel sowie die Bücher in seinem Büro zeigten deutlich, dass er sich für einen Gelehrten hielt. Dort saß er hinter einem großen Eichenschreibtisch und verfasste mit einem eleganten Füllfederhalter, der einmal bessere Zeiten gesehen hatte, Listen mit Aufgaben für Tati. Leiniger war vorher der Direktor einer Baumschule gewesen. Diese Listen heftete er mit Reißzwecken an die Treibhaustische, wo sie sich in der feuchten Luft aufrollten wie Hobelspäne, und wenn wir in die Arbeit vertieft waren, kam er ins Treibhaus geschlendert und lungerte in unserer Nähe herum. Er beschwerte sich nicht über meine Anwesenheit, aber er behandelte Tati wie einen einfachen Arbeiter. Eines Tages erwischte er mich allein in einem Treibhaus voll kleiner Begonien, die wir aus Stecklingen gezogen hatten.
Tati hatte eine Brause auf eine Gießkanne gesetzt, die klein genug war, dass ich gut mit ihr umgehen konnte, und ich bewässerte gerade die Pflänzchen. Es war sehr warm unter dem Glasdach. Ich trug Shorts und ein altes weißes Hemd von Tati ohne etwas anderes darunter als meine feuchte Haut; ich war gerade zehn. Wie an beiden Seitenwänden stand auch in der Mitte des Treibhauses auf ganzer Länge ein Pflanztisch. Auf der einen Seite dieses Tisches stand ich auf einer umgedrehten Kiste, weit vorgebeugt, um auch an die Pflanzen auf der anderen Seite zu kommen. Als ich aufblickte, stand Leiniger mir gegenüber. Sein Gesicht war rund und feist, mit dunklen Säcken unter den Augen.
»Du bist ein liebes Kind«, sagte er. »Schön hilfst du deinem Großpapa.« Tati war im Gewächshaus nebenan, um sich frisch ausgepflanzte Fuchsien anzusehen.
»Ich bin gern hier«, sagte ich zu Leiniger. Die Pflänzchen unter meinen Händen waren Rexbegonien, die nicht der Blüten wegen, sondern um der prächtigen gekräuselten Blätter willen gezogen wurden. Ich hatte Tati dabei geholfen, die Mutterblätter im feuchten Sand festzustecken und später die an den Rippen wurzelnden jungen Triebe umzupflanzen.
Leiniger deutete auf die Begonienreihe vor ihm, die gesamte Tischbreite von mir entfernt. »Die sehen ein bisschen trocken aus«, sagte er. »Die hier.«
Ich wollte nicht um den Tisch herumgehen und mich neben ihn stellen. »Du kannst von da aus drankommen«, sagte er. »Beug dich nur ein bisschen weiter vor.«
Ich stellte mich auf Zehenspitzen und lehnte mich mit weit vorgestreckter Gießkanne quer über den Tisch, um die am weitesten entfernten Pflanzen zu gießen. Leiniger schwitzte. »So ist es recht«, sagte er mit belegter Stimme. »Beug dich zu mir herüber.«
Tatis altes weißes Hemd stand am Hals ab und fiel lose nach vorn, als ich mich bückte. Ich reckte den Arm und goss die Begonien. Als ich mich aufrichtete, sah ich, dass Leiniger im Gesicht hochrot war und sich gegen den hölzernen Tisch presste.
»Hier«, sagte er mit einer zittrigen Geste in Richtung einer anderen Gruppe von Pflanzen zu seiner Rechten. »Die hier, die sind auch ganz trocken.«
Ich hatte Angst vor ihm, aber ich wollte auch meine Arbeit gut machen und Tati keinen Ärger bereiten, indem ich irgendwie nachlässig war. Ich beugte mich mit der Gießkanne vor. Diesmal griff Leiniger mit seinen dicken Fingern nach meinem Unterarm. »Nicht die«, sagte er und lenkte meine Hand näher zur Tischkante hin, gegen die er sich noch immer presste. »Die hier, die sind ganz trocken.«
In dem Moment, als die Gießkanne seinen Kittel berührte, kam Tati herein. Ich kann mir rückblickend vorstellen, wie die Szene auf ihn gewirkt haben muss. Ich über den schmalen Tisch gebeugt, auf äußersten Zehenspitzen, das weiße Hemd unter mir wie ein Laken über den Begonien; Leiniger mit rotem Gesicht, schweißüberströmt, sich an der hölzernen Tischkante reibend. Während seine Hand, seine schuldige Hand, mich näher zog. Ich ließ die Gießkanne fallen, als Tati meinen Namen rief.
Wer weiß, was Leiniger im Schilde führte? Für Tati muss es ausgesehen haben, als wollte er mich über die Begonien an sich ziehen. Aber Leiniger war nur ein einsamer alter Mann, und mir kommt es, heute gesehen, vor, als suchte er nur den Blick in den Hemdausschnitt und das bisschen Kontakt mit der Haut an der Innenseite meines Arms. Wäre Tati nicht in diesem Moment in das Treibhaus gekommen, wäre womöglich gar nichts weiter passiert.
Doch Tati las das Schlimmstmögliche in die Situation. Er sah die feiste Hand an meinem Arm und den Blick, der auf meiner kindlichen Brust ruhte. Er hatte ein kleines Gartenmesser in der Hand. Als er meinen Namen rief und ich die Gießkanne fallen ließ, verstärkte Leiniger seinen Griff an meinem Arm. Ich versuchte, mich loszureißen, und Tati rannte auf ihn zu und stieß ihm sein Messer in den Handrücken.
»Nêmecky!«, rief er. »Prase!«
Leiniger ließ einen Schrei los und stolperte rückwärts über den Betonblock, auf den ich mich immer stellte, um die hängenden Pflanzen zu gießen. Der Block traf ihn gerade unterhalb der Kniekehlen, sodass er langsam und schwer zu Boden ging, die eine Hand auf der Wunde an der anderen, einen ungläubigen Ausdruck im Gesicht. Tati streckte bereits die Arme aus, um ihn aufzufangen, als Leiniger mit dem Kopf gegen ein Heizungsrohr knallte.
Natürlich ist das nicht die Geschichte, die ich Richard erzählte. Als wir uns kennenlernten, unmittelbar nach dem Krieg, arbeitete ich in demselben Elektrizitätswerk, das einst meinen Vater beschäftigt hatte, und Richard stand kurz vor dem Abschluss seiner Doktorarbeit. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich mein Studium am Junior College abgebrochen; Richard hatte sein Doktorandenprogramm vorübergehend unterbrochen, um sich der Navy anzuschließen, für die er drei Jahre lang tropische Pilze erforschte. Wir waren beide von dem Gefühl besessen, verlorene Zeit wettmachen zu müssen. Während der kurzen Zeit, in der wir umeinander warben, erzählte ich Richard nur die Dinge, mit denen ich seine Liebe zu gewinnen hoffte.
Als wir zum zweiten Mal miteinander ausgingen, erzählte ich ihm bei Kaffee und italienischem Gebäck, dass mein Großvater mir als Kind ein wenig darüber beigebracht hatte, wie man Pflanzen züchtete, und dass ich mich sehr für Genetik interessierte. »Tati lebte eine Zeit lang mit bei uns, als ich klein war«, sagte ich. »Er ist oft mit mir durch die Wiesen um Niskayuna gelaufen und hat mir von Gregor Mendel erzählt. Ich kann immer noch Stempel und Staubgefäße unterscheiden.«
»Mendel ist mein Held«, sagte Richard. »Er war für mich schon immer das Ideal eines Wissenschaftlers. Ich bin noch nicht vielen Frauen begegnet, die seine Arbeit kennen.«
»Ich weiß eine ganze Menge über ihn«, entgegnete ich. »Von Tati – du würdest staunen.« Ich sagte nicht, dass Tati und ich uns über Mendel unterhielten, weil wir es nicht ertrugen, von dem zu reden, was wir beide verloren hatten.
Tati schlief in den Monaten vor der Gerichtsverhandlung in meinem Zimmer; er wurde unter der Bedingung auf Kaution freigelassen, dass er nicht in seinem kleinen Haus in Rensselaer wohnte, sondern bei uns. Ich schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer, und Leiniger lag bewusstlos in Schenectady in der Klinik. Tati und ich hielten uns still im Hintergrund. Keiner schien mit uns reden zu wollen. Meine Brüder blieben so viel als möglich von zu Hause fern, und mein Vater machte Überstunden. Meine Mutter war da, aber sie war von dem Vorgefallenen so verstört, dass sie es kaum über sich brachte, ein Wort an mich oder Tati zu richten. Das Äußerste, wozu sie sich durchringen konnte, war, mich ein paar Tage nach Tatis Eintreffen beiseitezunehmen und zu sagen: »Das mit Leiniger ist nicht deine Schuld. Das, was zwischen den beiden Männern ist, ist eine Geschichte aus der alten Heimat.«
Ich musste mich zu ihr auf die Veranda setzen, wo sie Pilze umdrehte, die sie im Wald gesammelt und auf Drahtnetzen zum Trocknen ausgebreitet hatte. Rot, gelb, lila, ledrig braun. Einige Stücke waren trockener als andere. Während sie sprach, ging sie von Netz zu Netz und drehte die federleichten Schnipsel um.
»Welche Heimat?«, fragte ich. »Wovon sprichst du?«
»Tati ist Tscheche«, sagte meine Mutter. »Wie ich. Mr Leiniger ist aus einer deutschen Familie, aus einem Teil von Mähren, in dem nur Deutsche wohnen. Tati und Mr Leiniger können sich aus Gründen nicht leiden, die auf alte Zeiten in den tschechischen Provinzen zurückgehen.«
»Dann bin ich auch tschechisch?«, sagte ich. »Dies ist passiert, weil ich tschechisch bin?«
»Du bist amerikanisch«, sagte meine Mutter. »Zuerst amerikanisch. Aber Tati hasst die Deutschen. Er und Leiniger hätten einen Grund gefunden, sich zu streiten, auch wenn du gar nicht da gewesen wärst.« Sie erzählte mir ein wenig von der Geschichte Mährens, damit ich verstand, wie lange sich die Tschechen und die Deutschen schon Feind waren. Und sie berichtete, wie begeistert Tati im Ersten Weltkrieg war, als die tschechischen und slowakischen Einwanderer in ihren Reihen Geld sammelten, um der Gründung eines unabhängigen tschechoslowakischen Staates auf die Beine zu helfen. Als sie ein Kind war, hatten sich Tati und ihre Mutter über Tatis Spenden gezankt und über die Versammlungen, an denen er teilnahm.
Doch mir erschien das alles nicht wichtig. Im Treibhaus hatte ein Polizist Tati gefragt, was vorgefallen war, und Tati hatte zur Antwort gegeben: »Ich habe ihm das Messer in die Hand gerammt. Aber alles Weitere war ein Unfall – er ist über den Block da gestolpert und gestürzt.«
»Warum?«, hatte der Polizist gefragt. »Warum haben Sie das getan?«
»Meine Enkeltochter«, hatte Tati gesagt. »Er hat … sie angefasst.«
Der Polizist hatte mein Kinn in die Hand genommen und mich streng angesehen. »Stimmt das?«, hatte er gefragt. Und ich nickte stumm, mit dem Gefühl, zugleich zutiefst schuldig und sehr wichtig zu sein. Und jetzt machte mir meine Mutter weis, dass ich unwichtig war.
»Muss ich die Deutschen hassen?«, fragte ich.
Ein paar Jahre später, als Tati tot war und ich auf die Highschool ging und Hitler die Tschechoslowakei zerschlagen hatte, wurde meine Mutter lauthals deutschfeindlich. Doch damals sagte sie lediglich: »Nein. Mr Leiniger hätte dich nicht belästigen dürfen, aber er ist nur ein einzelner Mann. Es ist nicht richtig, jeden zu hassen, der einen deutschen Nachnamen hat.«
»Macht Tati das?«
»Manchmal.«
Ich berichtete meiner Mutter, mit welchen Worten Tati Leiniger angeschrien hatte, und ahmte die fremden Laute, so gut ich konnte, nach. Meine Mutter wurde rot. »Nêmecky heißt deutsch«, sagte sie widerstrebend. »Prase heißt Schwein. Du darfst nie jemandem erzählen, dass du deinen Großvater so was hast sagen hören.«
Von diesem Gespräch sagte ich Tati nichts. Den ganzen Herbst hindurch, vor allem aber nach Leinigers Tod, erwartete mich Tati täglich nach der Schule auf der Veranda, den knorrigen Spazierstock in der Hand und die Mütze auf dem Kopf. Meine Mutter ließ ihn nicht allein aus dem Haus gehen, aber sie fand selten Zeit, ihn zu begleiten; meine Brüder hatten keine Lust. Und so wartete Tati jeden Nachmittag auf mich wie ein rastloser Hund.
Wenn wir durch die Wiesen und Wälder hinter unserem Haus liefen, redeten wir nicht über das, was im Treibhaus vorgefallen war. Tati nannte mir die Namen der Farne und Moose und Blumen, an denen wir vorbeikamen. Er zeigte mir die verschiedenen Habichtskrautarten – Kanadisches Habichtskraut, Geflecktes Habichtskraut, Waldhabichtskraut. Gemeines Habichtskraut, das sich auf brachliegenden Feldern ausbreitete. Langstielige Pflanzen mit einer Blätterrosette über dem Boden und kleinen Blütenständen, die an Löwenzahn erinnern. Nachdem Tati sie mir einmal gezeigt hatte, sah ich sie überall.
»Hieracium«, sagte Tati. »Das ist ihr richtiger Name. Er ist abgeleitet vom griechischen Wort für Habicht. Der Saft aus den Stängeln bewirkt angeblich, dass man sehr scharf sehen kann.« Es sei ein Unkraut, erklärte er. Es wachse überall, wo der Boden zu karg sei, als dass andere Pflanzen dort gediehen. Sie seien verwandt mit Astern, Margeriten und Dahlien – lauter Blumen, die ich aus der Gärtnerei kannte –, aber auch mit Disteln und Kletten. Ich solle mir ihr Aussehen einprägen, sagte er. Sie seien wichtig. Er habe mit eigenen Augen zugesehen, wie das Habichtskraut Gregor Mendels Leben ruinierte.
Bis heute will mir das unmöglich scheinen: Wie kann ich jemanden gekannt haben, der alt genug war, Mendel zu kennen? Und doch war es so: Tati wuchs am Stadtrand von Brno auf, der Stadt, in der Mendel den größten Teil seines Lebens verbrachte. 1866, als sie sich zum ersten Mal begegneten, herrschte Cholera in Brno, und preußische Soldaten zogen durch die Stadt, nach dem Ende eines kurzen, verheerenden Krieges. Damals war Tati zehn, und solche Dinge interessierten ihn nicht. Er kletterte eines Nachmittags übermütig auf die weiße Mauer des Augustinerklosters St. Thomas. Oben angekommen, erblickte er einen untersetzten, kurzbeinigen Mann, der durch eine Brille zu ihm aufsah.
»Er sah dem Onkel meiner Mutter ähnlich«, sagte Tati. »Entfernt ähnlich.«
Mendel streckte ihm eine Hand entgegen und half Tati, von der Mauer zu springen. Um ihn herum standen Obstbäume und wilde Weinstöcke; in der Ferne sah er einen Uhrturm und ein lang gestrecktes, niedriges Gebäude. Dort, wo Tati gelandet war, wuchsen Erbsen. Nicht Abertausende von Erbsen wie am Höhepunkt von Mendels Experimenten, aber immer noch Hunderte von Pflanzen, die an Reisern und gespannten Fäden emporrankten.
Es sei ein verwunschener Ort gewesen, sagte Tati. Mendel zeigte ihm den zahmen Fuchs, den er tagsüber an die Leine legte, aber nachts frei laufen ließ, die Igel und die Hamster und die Mäuse, die er hielt, die Bienenkörbe und die Käfige voller Vögel. Die beiden, der Junge und der Mann mittleren Alters, wurden Freunde. Mendel weihte Tati in die meisten seiner gärtnerischen Geheimnisse ein und verschaffte ihm später ein Stipendium für die Schule, an der er Lehrer war. Doch Tati meinte, das erste Jahr ihrer Freundschaft, vor den Experimenten mit dem Habichtskraut, sei das schönste gewesen. Seite an Seite hätten Mendel und er Erbsenblüten geöffnet und mit einem Kamelhaarpinsel Pollen übertragen.
Am letzten Tag des Jahres 1866 schrieb Mendel seinen ersten Brief an Carl Nägeli in München, einen hoch angesehenen, einflussreichen Botaniker, der sich mit Kreuzungsverfahren beschäftigte. In der Hoffnung, Nägeli könnte ihm dabei behilflich sein, seiner Theorie die verdiente Anerkennung zu verschaffen, legte er dem Brief eine Kopie seiner Abhandlung über die Erbsen bei. Außerdem berichtete er in dem Brief jedoch, dass er mit einigen Versuchen an Habichtskraut begonnen habe, von denen er hoffe, dass sie seine Untersuchungsergebnisse mit den Erbsen bestätigen würden.
Nägeli war für seine Untersuchungen des Habichtskrauts bekannt, und Tati glaubte, Mendel habe es nur erwähnt, um Nägelis Interesse an seiner Arbeit zu gewinnen. Nägelis Antwort ließ Monate auf sich warten, und als er schließlich schrieb, erwähnte er die Erbsen nur ganz nebenbei. Doch mit dem Habichtskraut experimentierte er selbst, und er schlug Mendel vor, sich diesem doch ebenfalls zuzuwenden. Der verzweifelt nach Anerkennung lechzende Mendel hörte auf, über Erbsen zu schreiben, und widmete sich stattdessen fortan dem Habichtskraut.
»Oh, dieser Nägeli!«, sagte Tati. »Monat für Monat, Jahr für Jahr sah ich mit an, wie Mendel seine langen geduldigen Briefe verfasste und entweder gar keine Antwort oder eine säumige Antwort bekam, oder eine Antwort, die überhaupt nicht auf die angesprochenen Themen einging. Jedes Mal, wenn Nägeli schrieb, ging es ausschließlich um das Habichtskraut. Als ich später erfuhr, warum Mendels Experimente mit dem Kraut nicht gelungen waren, hätte ich heulen können.«
Die Experimente, die bei den Erbsen solch schlüssige Ergebnisse erzielt hatten, führten beim Habichtskraut, das außerordentlich schwer zu kreuzen war, ins reine Chaos. Ein Experiment nach dem anderen schlug fehl; Jahre der Arbeit waren vergebens. Das unerklärliche Verhalten des Habichtskrauts zerstörte Mendels Glauben daran, dass die Vererbungsgesetze, wie er sie an den Erbsen erarbeitet hatte, universelle Gültigkeit besitzen könnten. 1873 gab Mendel vollends auf. Das Habichtskraut und Nägeli hatten ihn überzeugt, dass seine Arbeit sinnlos war.
Es sei Pech gewesen, meinte Tati. Pech, dass er auf die Idee verfallen sei, Nägeli um Unterstützung anzugehen, und dass er sich von diesem auf das Habichtskraut habe lenken lassen. Mendels Versuchsmethode sei einwandfrei gewesen, und seine Erbschaftsgesetze seien vollkommen richtig formuliert. Er habe nicht wissen können – noch Jahre habe es niemand gewusst –, dass Habichtskraut sich nicht auf berechenbare Weise kreuzen lasse, weil es häufig unbefruchtete Samen bildete. »Parthenogenese«, sagte Tati – ein langes, sperriges Wort, das ich kaum über die Zunge brachte. Es klingt mir immer noch wie eine Krankheit. »Die Pflanzen, die aus den auf diese Weise gebildeten Samen sprießen, sind exakte Abbilder der Mutterpflanze, genau wie die Begonien, die wir aus Blattablegern ziehen.«
Mendel wandte sich von der Wissenschaft ab und verbrachte seine letzten Jahre nach seiner Wahl zum Prior damit, sich mit der Regierung um die Steuerlast zu streiten, die seinem Kloster auferlegt war. Er überwarf sich mit seinen Klosterbrüdern; er wurde bitter und einsam. Einige der Mönche glaubten, er sei wahnsinnig geworden. In seinen Gemächern rauchte er schwere Zigarren und starrte an die Decke, an die er Szenen mit Heiligen und Obstbäumen, Bienenkörben und wissenschaftlichem Gerät gemalt hatte. Wenn Tati ihn besuchte, kam er im Gespräch vom Hundertsten ins Tausendste.
1884 im Januar starb Mendel am Epiphaniasabend, noch immer im Unklaren über den Wert seiner wissenschaftlichen Arbeit. Im selben Jahr, lange nachdem ihr Briefwechsel eingeschlafen war, veröffentlichte Nägeli ein dickes Buch, in dem er sein gesamtes Lebenswerk zusammenfasste. Obwohl ein großer Teil seiner Ansichten und Beobachtungen sich wie eine Wiedergabe von Mendels Arbeit mit den Erbsen las, würdigte Nägeli weder Mendels Namen noch seine Abhandlung einer Erwähnung.
Dies war die Geschichte, die ich Richard erzählte. Auf diese Weise aus dem Zusammenhang gerissen und des Anlasses beraubt, aus dem sie erzählt wurde, geriet sie zu einer Geschichte über die Anfänge von Richards wissenschaftlicher Disziplin. Ich wusste, dass Richard gutes Geld gegeben hätte, um sie zu hören, aber ich schenkte sie ihm einfach.
»Und dein Großvater hat das alles miterlebt?«, fragte er. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns schon besser; wir saßen an einem Flussufer, tranken Manhattans, die Richard gemixt hatte, und taten uns an dem kalten würzigen Rinderbraten gütlich, dem marinierten Gemüse und der Zitronentorte, die ich in einem Korb mitgebracht hatte. Richard wusste meine Kochkunst außerordentlich zu schätzen. Auch mich mochte er, für meinen Geschmack allerdings noch nicht genug; ich konnte es nicht erwarten, dass er um meine Hand anhielt, aber er hatte noch immer nichts gesagt. »Dein Großvater hat die Briefe gesehen«, sagte er. »Er hat miterlebt, wie Mendel Daten für Nägeli zusammenstellte. Das ist erstaunlich. Das ist sehr bemerkenswert. Unglaublich, was du alles weißt.«
Ich deutete an, dass dies noch nicht alles war. Was hatte ich ihm noch zu bieten? Mittlerweile scheint mir, ich hatte fast alles: Jugend und Gesundheit und ein liebevolles Wesen; den Wunsch, eine Familie zu gründen. Doch damals war ich über Gebühr von Richards Bildung beeindruckt.
»Mehr?«, fragte er.
»Ich habe noch einige Papiere«, sagte ich. »Von Tati.«
Natürlich durfte ich nicht in den Gerichtssaal, dafür war ich zu klein. Nachdem Leiniger gestorben war, wurde der Termin für die Verhandlung vorverlegt. Ich bekam nicht zu sehen, wie Tati neben dem Anwalt saß, den mein Vater für ihn genommen hatte; ich habe weder einen Richter noch eine Jury gesehen und nie erfahren, ob meine Aussage für Tati vielleicht eine Hilfe gewesen wäre. Ich erfuhr damals vor Urzeiten nicht einmal, ob das Gericht die Zeugenaussage eines Kindes akzeptiert hätte, denn Tati starb am Abend vor dem ersten Verhandlungstag.
Er starb an einem Schlaganfall, sagte meine Mutter. Sie hörte ein lautes unverständliches Rufen, und als sie in das Zimmer lief, das einst meines gewesen war, fand sie Tati vornübergekippt auf dem Bett, mit hängendem Kopf und dunkelrotem, geschwollenem Gesicht. Von da an, nach Tatis Beerdigung, ging ich nach der Schule nicht mehr durch Wald und Felder spazieren. Ich machte meine Hausaufgaben am Küchentisch und half anschließend meiner Mutter im Haus. Und am Wochenende ging ich nicht mehr in die Gärtnerei.
Da nie eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hatte, erfuhr niemand im Ort von der Rolle, die ich bei Leinigers Tod gespielt hatte. Alle glaubten, es habe einen Streit zwischen zwei alten Männern gegeben, und dann einen Unfall. Niemand suchte die Schuld bei mir oder meiner Familie. Ich konnte weiter zur Schule gehen, ohne dass die Leute mit dem Finger auf mich zeigten oder über mich redeten. Ich verdrängte alle Gedanken an Tati, die Gärtnerei und Leiniger, Mendel und Nägeli und das Verhalten des Habichtskrauts. Als der Krieg kam, verschloss ich die Ohren vor dem Geschimpfe meiner Mutter. Nach dem Tod meines Vaters zog sie zu einem meiner verheirateten Brüder, und ich zog allein in eine kleine Wohnung. Ich liebte meine Arbeit in der Fabrik; ich fühlte mich sehr unabhängig.
Erst als der Krieg vorbei war und ich Richard kennenlernte, kramte ich die Geschichte mit dem Habichtskraut wieder hervor. Richards Familie lebte schon seit Generationen in den USA und schien keine Vorgeschichte zu haben; das war einer der Aspekte, die mich anzogen. Nach dem Picknick am Fluss war ich freilich ebenfalls ganz sicher, dass meine Anziehungskraft für ihn sich zum Teil aus der Tatsache erklärte, dass ich eine so enge Verbindung zu anderen Orten und Zeiten hatte. Ich gab Richard die vergilbten Blätter zu lesen, die Tati mir in einem Umschlag hinterlassen hatte.
Dies ist der Entwurf eines von Mendels Briefen an Nägeli hatte Tati auf einen Zettel geschrieben, den er an das Manuskript geheftet hatte. Er hat ihn mir einmal gezeigt, als er traurig war. Später schenkte er ihn mir. Jetzt sollst du ihn haben.
Richards Stimme zitterte, als er die Worte vorlas. Er blätterte Mendels Brief langsam durch und las mir hier und da eine Zeile laut vor. Es war ein früher Brief, vielleicht gar der erste. Er handelte ausschließlich von Erbsen.
Richard sagte: »Ich kann nicht glauben, dass ich dies in Händen halte.«
»Ich könnte ihn dir schenken«, sagte ich. Der Gedanke erschien mir absolut folgerichtig. Mendel hatte den Brief Tati gegeben, dem einzigen Freund seiner letzten Jahre; dann hatte Tati ihn an mich weitergereicht, als er mich nicht mehr selbst beschützen konnte. Jetzt schien es mir passend, ihn an den Mann weiterzugeben, den ich heiraten wollte.
»Mir?«, fragte Richard. »Du willst ihn mir schenken?«
»Er sollte jemandem gehören, der ihn zu schätzen weiß.«
Richard hütete Tatis Brief wie einen Schatz. Wir heirateten, wir zogen nach Schenectady, Richard bekam eine gute Stelle am College dort, und unsere beiden Töchter wurden geboren. Während beider Schwangerschaften befürchtete Richard, dass unsere Kinder seine Hexadaktylie geerbt haben könnten, doch Annie und Joan kamen beide mit der vorschriftsmäßigen Zahl von Fingern und Zehen auf die Welt. Ich blieb mit ihnen zu Hause, zunächst in der Wohnung in der Union Street und später nach Richards Beförderung in dem hübschen alten Haus auf dem Collegegelände, in dem wir zur Miete wohnten. Richard schrieb Aufsätze und saß in Gremien; ich gab einmal im Monat ein Dinner für die Kollegen seines Fachbereichs; einmal in der Woche ein Kaffeestündchen für besonders bevorzugte Studenten, im Sommer Picknicks für die Jahrestreffen der Ehemaligen. Ich bewies ein gutes Händchen für derlei Veranstaltungen: Sie waren eine Aufgabe, wenn auch eine unbezahlte, und es wurde von mir erwartet, dass ich sie erfüllte.
Unsere Töchter wurden erwachsen und zogen fort. Und dann, mit beinahe fünfzig, nachdem Richard Professor auf Lebenszeit geworden war, eine Reihe Preise bekommen hatte und fast unerträglich selbstzufrieden geworden war, kam eine Zeit von knapp einem Jahr, in der die Welt für mich grau und öde wurde.
Ich kann mir immer noch nicht erklären, was damals mit mir geschah. Mein Arzt meinte, es seien die Hormone, der Beginn meiner Wechseljahre. Meine Töchter, die gerade begonnen hatten, die Frauenbewegung zu entdecken, meinten, ich erstickte am jahrelangen Hausfrauendasein und bräuchte einen Beruf. Annie, unsere Älteste, druckste ein Weilchen herum und fragte mich dann schließlich, ob ihr Vater und ich noch immer im gleichen Bett schliefen; ich bestätigte dies, ohne jedoch den Mut zu finden, ihr zu sagen, dass wir darin wirklich nur noch schliefen. Richard meinte, ich bräuchte Bewegung, und empfahl tägliche Spaziergänge im botanischen Garten des College, in dem viele exotische Bäume aus allen Winkeln der Erde wuchsen.
Er war mit sich selbst beschäftigt, aber nicht völlig abgekapselt; es fiel ihm nicht leicht, mich leiden zu sehen. Vermutlich wollte er auch einfach die Frau wiederhaben, die seinen Haushalt jahrelang so hervorragend in Schuss gehalten hatte. Doch ich brachte überhaupt nichts mehr zuwege. Ich war nur ständig von dem Bewusstsein gequält, dass ich mich alt fühlte und dass alles seinen Reiz verloren hatte. Tagelang lehnte ich mit einem Plaid über den Beinen auf dem Fenstersitz in unserem Schlafzimmer und sah zu, wie die Studenten auf dem Platz vor der Bibliothek zusammenströmten, durcheinanderliefen und wieder auseinanderströmten.
Das war 1970, als die Studenten sich über Nacht von netten Jungen in ungehobelte Männer mit Bärten und langen Haaren zu verwandeln schienen. Jede Woche bescherte neue Proteste und Sprechchöre, Aufmärsche und Demonstrationen, Bettlaken, die wie Banner aus den Wohnheimfenstern hingen. Die jungen Burschen, die früher im blauen Sakko und mit gebügelten Hosen zu uns zum Tee erschienen waren, trugen Westen mit langen Fransen und löcherige Jeans. Und als ich im Herbst Richards Genetikvorlesung besuchte, um mir den ersten seiner beiden Mendelvorträge anzuhören, sah ich, dass die Studenten aus dem Fenster guckten, während er sprach, oder mit den Stühlen kippelten und die Füße auf den Tisch legten: offen gelangweilt, aufsässig. Ein von glatten blonden Haarmassen umhülltes Mädchen – es saßen Mädchen in der Vorlesung, das College nahm neuerdings weibliche Studenten auf – unterbrach Richard mitten im Satz und sagte: »Aber welche Relevanz soll das haben? Wissenschaft in der Hand der Technokraten ist immer destruktiv.«
Richard würdigte sie keiner Antwort, sondern brachte seinen Vortrag möglichst schnell zu Ende und verließ den Raum, ohne mich anzusehen. Auf seine zweite Mendelvorlesung verzichtete er in dem Semester ganz. Die Studenten hatten größtenteils die Teilnahme an den Labors verweigert, da es keinen Grund gebe, harmlose Fruchtfliegen sterben zu lassen, nur um eine Theorie zu bestätigen, die von aller Welt bereits als zutreffend anerkannt war. Richard meinte, sie hätten es nicht verdient, vom Habichtskraut zu erfahren. Sie seien so schmutzig, so destruktiv, dass er Angst um Mendels kostbaren Brief habe.
Ich war erleichtert, sagte dies aber nicht; ich verspürte keinen Drang, meinen Platz am Fenster zu verlassen, und keinen Wunsch, die Geschichte abermals von Richard erzählt zu hören. Meiner Ansicht nach erzählte er sie nicht gut. Er brachte die Daten durcheinander, verkürzte die Zeiten, identifizierte sich zu sehr mit Mendel und zeichnete Nägeli zu schwarz als Bösen. Mir war mittlerweile klar geworden, dass er sich gern für einen zweiten Mendel hielt, für genauso verkannt und unverstanden. Mir dagegen kam er mehr wie ein zweiter Nägeli vor. Ich hatte erlebt, wie er sich jüngeren Wissenschaftlern, die sich zu etablieren suchten, gegenüber wenig großzügig verhalten hatte. Ich hatte mit angesehen, wie er jedes Jahr nicht etwa den intelligentesten oder originellsten Studenten zu seinem Begünstigten machte, sondern den gefälligsten, der ihm am meisten schmeichelte.
In jenem Jahr schienen alle Studenten zu mutieren, daher gab es keinen bevorzugten, keinen servilen, gut gekleideten Jungen, der sonntags bei uns zu Abend aß oder mittwochs nach dem Seminar zur Cocktailstunde bei uns erschien. Wenn ich auf meinem Fenstersitz lehnte und vor mich hin Umschläge beschriftete, die ich mit Nachdrucken von Richards Aufsätzen füllte, merkte ich kaum, dass das Haus leerer war als sonst. Doch nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, erhob ich mich von Richards Seite und bettete mich auf das Sofa im Wohnzimmer, wo ich stundenlang zwischen Traum und Panik schwebte. Dann hörte ich Tatis Stimme, wie sie mir von Mendel erzählte. Ich hörte den am Habichtskraut verzweifelnden Mendel, wie er dem kleinen aufmerksamen Jungen, der im Garten neben einem Fuchs saß, einen Briefentwurf nach dem anderen vorlas. Sehr geehrter Herr Professor, Exzellenz, ich bitte ergebenst, Ihnen die folgenden Versuchsergebnisse unterbreiten zu dürfen … Wie unterwürfig Mendel in seinen Anreden gewesen war und doch wie sicher in seiner Wissenschaft. Wie gut er zu Tati gewesen war.
In manchen Nächten verwirrte sich mein Geist. Mendel und Nägeli, Mendel und Tati; Tati und Leiniger, Tati und ich. Männerpaare, die einander hassten, und Freundespaare, die Papiere weiterreichten. Ein Junge, den ich beim Beschneiden von Sträuchern im Collegegarten beobachtete, wurde zu dem Kind Tati, das über eine weiße Mauer kletterte. Einmal, als ich einnickte, träumte ich von Leinigers Frau. Ich hatte sie nur einmal gesehen; sie war zu Tatis Beerdigung gekommen. Sie stand in einem braunen Kleid mit einem Streumuster aus kleinen weißen Blättern hinten in der Kirche, und als meine Familie nach dem Gottesdienst ging, wandte sie das Gesicht ab.
Im Juni dieses Jahres kam gleich nach den Entlassungsfeierlichkeiten Sebastian Dunitz aus seinem Frankfurter Labor zu uns ans College. Richard und er hatten korrespondiert und gemeinsame Forschungsinteressen entdeckt; Richard hatte dafür gesorgt, dass Sebastian für ein Jahr an seinem Lehrstuhl zu Gast sein konnte. Den Sommer über sollte er mit Richard gemeinsam an einem Forschungsprojekt arbeiten und ihm danach im Winter- und im Sommersemester als sein Assistent in den Laborkursen einen Teil der Lehre abnehmen. Er wohnte bei uns, in Annies ehemaligem Zimmer, aber er machte wenig Mühe. Er erledigte seine Wäsche und kochte seine Mahlzeiten selbst, außer wenn wir ihn einluden, mit uns zu essen.
Richard mochte Sebastian sofort. Er war jung, intelligent und hervorragend ausgebildet; obwohl er sich mehr für Speziation und evolutionäre Beziehungen interessierte als für die von Richard gelehrte klassische mendelsche Genetik, zeigte er Richard gegenüber stets Respekt. Binnen eines Monats nach seiner Ankunft berichtete mir Richard bereits, dass sein Schützling mit ein wenig Glück wohl auf eine Dauerstelle hoffen könne. Binnen eines Monats nach seiner Ankunft hatte ich mich von meinem Fenstersitz erhoben, kleidete mich wieder farbenfroh, hatte das Haus vom Keller bis zum Dachboden geputzt und arbeitete im Garten. Es war schön, Gesellschaft zu haben.
Am vierten Juli lud Richard Sebastian zu einem abendlichen Picknick mit uns ein. Während die Mädchen heranwuchsen, hatten wir jedes Jahr an diesem Tag ein Picknick gemacht; wir hatten die Tradition eigentlich aufgegeben, doch Richard meinte, wir könnten Sebastian damit eine Freude bereiten. Ich briet morgens vor der ärgsten Hitze ein Hähnchen; ich legte Tomaten in eine Vinaigrette und hackte frisches Basilikum, ich machte Kartoffelsalat und buk einen Schokoladenkuchen. In der Abenddämmerung nahmen Richard und ich eine Decke, unseren Picknickkorb und unseren ausländischen Gast und wanderten auf eine Hügelkuppe über dem Collegegelände. In der Ferne hörten wir die Blaskapelle, die vor dem Feuerwerk spielte.
»Wunderschön ist es hier«, sagte Sebastian. »Wundervolles Essen, ein wunderschöner Abend. Sie sind beide sehr nett zu mir.«
Richard hatte ein Windlicht auf unsere Decke gestellt, und in dem dämmerigen Schein schimmerte Sebastians Haarschopf wie ein Helm. Wir sprachen alle drei tüchtig dem lieblichen Weißwein zu, den Sebastian beigesteuert hatte. Richard lehnte sich nach hinten auf die Ellbogen, räusperte sich und hob zu sprechen an. Was er sagte, überraschte mich.
»Wussten Sie«, sagte er zu Sebastian, »dass ich einen echten Entwurf eines Briefes besitze, den Gregor Mendel an den Botaniker Nägeli schrieb? Meine liebe Antonia hat ihn mir geschenkt.«
Sebastian blickte von mir zu Richard und wieder zu mir. »Wie kommen Sie an so etwas?«, fragte er. »Wo …?«
Richard setzte zum Erzählen an, aber ich konnte es nicht ertragen, die Geschichte noch einmal in seiner verfälschten Version zu hören. »Mein Großvater hat ihn mir geschenkt«, unterbrach ich. »Er hat Mendel gekannt, als er ein kleiner Junge war.« Und ohne Richard Gelegenheit zu geben, das Wort wieder zu ergreifen, ohne mich im Geringsten um die Verletzung und Verwirrung zu scheren, die ihm, wie ich wusste, im Gesicht stehen musste, erzählte ich Sebastian die ganze Geschichte über die Hybridformen des Habichtskrauts. Ich erzählte alles nach und nach, in Gänze, ohne Auslassungen. In der tiefer werdenden Dunkelheit unterstrich ich meine Worte mit Gesten und tat mein Möglichstes, um Sebastian die Mauer und den Uhrturm und die Gärten und Bienenkörbe, Mendels Gesicht und Tatis bloße Füße anschaulich zu machen. Und als ich fertig war, als meine Worte in der Luft hingen und Sebastian anerkennend murmelte, tat ich etwas, was ich noch nie zuvor getan hatte, weil Richard nicht darauf gekommen war, die Frage zu stellen, die Sebastian nun stellte.
»Wieso hat Ihr Großvater Ihnen das erzählt?«, fragte er. »Es ist doch eher eine ungewöhnliche Geschichte für ein kleines Mädchen.«
»Damit wir ein Thema hatten, über das wir reden konnten«, sagte ich. »Wir haben in dem Herbst, als ich zehn war, viel Zeit zusammen verbracht. Er hatte einen Mann umgebracht – ohne Absicht, aber der Mann war trotzdem tot. Er wohnte bei uns, während wir auf die Verhandlung warteten.«
Über uns öffneten sich die ersten Feuerwerksraketen zu roten und goldenen und grünen Blütenschauern. »Antonia«, begann Richard, fing sich jedoch sogleich wieder. Er wollte nicht vor Sebastian zugeben, dass dies etwas war, was die Frau, mit der er seit fünfundzwanzig Jahren verheiratet war, ihm noch nie erzählt hatte. Im Licht der weißen Sternenfontäne über uns sah ich, wie er mich anstarrte, doch er sagte nur: »Eine erstaunliche Geschichte, nicht wahr? Früher habe ich sie jedes Jahr meinen Genetikstudenten erzählt, aber letzten Herbst verlief alles so chaotisch, dass ich sie weggelassen habe. Es war klar, dass sie sie nicht zu würdigen wissen würden.«
»Es wird vieles anders«, sagte Sebastian. »Die Welt verändert sich.« Er fragte mich nicht danach, wie es sich zugetragen hatte, dass mein Großvater jemanden umgebracht hatte.
Das Feuerwerk steigerte sich, bis alle Raketen auf einmal in die Luft zu gehen schienen; dann gab es einen letzten Knall, und alles wurde still und dunkel. Mir war bewusst, dass ich unhöflich gewesen war. Ich hatte Richard um eine seiner liebsten Freuden gebracht, nur weil ich die Geschichte einmal gut erzählt hören wollte.
Wir sammelten unsere Decke und den Korb ein und gingen still nach Hause. Das Haus war finster und leer. Im Wohnzimmer schaltete ich eine einzige Lampe ein und begab mich gleich in die Küche, um Kaffee zu kochen. Als ich mit dem Tablett hereinkam, unterhielten sich die Männer leise über ihre Arbeit. »Ich glaube, was wir hier haben, ist ein sogenannter Rassenkreis«, sagte Sebastian, wobei er sich zu mir umdrehte, um mich in die Gesprächsrunde aufzunehmen. In seiner kurzen Zeit bei uns hatte er mir immer das Kompliment gemacht, davon auszugehen, dass ich mich mit seiner und Richards Arbeit auskannte. »Damit bezeichnen wir in Deutschland das Phänomen, dass eine Spezies, die über ein großes Gebiet verbreitet ist, in eine Kette von Unterarten zerfällt, welche sich jeweils leicht von ihren Nachbararten unterscheiden. Die benachbarten Unterarten können sich untereinander kreuzen. Doch die Unterarten an den beiden Enden der Kette können sich so stark unterscheiden, dass sie es nicht können. In der Population, die Richard und ich derzeit untersuchen …«
»Ich bin sehr müde«, sagte Richard unvermittelt. »Wenn Sie mich entschuldigen, werde ich schlafen gehen.«
»Keinen Kaffee mehr?«, fragte ich.
Er sah einen Fleck eben hinter meiner Schulter an, wie immer, wenn er ärgerlich war. »Nein. Kommst du auch?«
»Bald«, sagte ich.
Sebastian stand auf und setzte sich in dem gedämpft erleuchteten Zimmer direkt in den Sessel neben meinem. »Geht es Richard nicht gut?«, fragte er. »Ist irgendetwas nicht in Ordnung?«
»Ihm fehlt nichts. Er ist nur müde. Er hat einen harten Tag hinter sich.«
»Das war eine hübsche Geschichte, die Sie da erzählt haben. Als ich Student war, erwähnten unsere Professoren Nägeli nie, es sei denn, um ihn als Lamarckisten abzutun. Sie sprangen immer von Mendels Abhandlung über die Erbsen direkt zu ihrer späteren Wiederentdeckung. Nägelis Schüler Correns und Hugo de Vries – kennen Sie die Geschichte von de Vries und den Nachtkerzen?«
Ich schüttelte den Kopf. Wir saßen am dunklen Ende des Wohnzimmers in der Nähe der Treppe und weit von den Fenstern entfernt. Gelegentlich hörte man noch eine verspätete Feuerwerksrakete.
»Nein? Die wird Ihnen gefallen.«
Doch bevor er mir seine Anekdote erzählen konnte, beugte ich mich zu ihm hinüber und legte ihm eine Hand auf den Unterarm. Seine Haut war weich wie eine Blume. »Erzählen Sie mir keine Geschichten aus der Wissenschaft mehr«, sagte ich. »Erzählen Sie mir von sich.«
Es entstand eine Pause. Dann entzog mir Sebastian unvermittelt seinen Arm und stand auf. »Bitte«, sagte er. »Sie sind eine attraktive Frau, immer noch. Und ich fühle mich geschmeichelt. Aber es ist unmöglich, irgendetwas zwischen uns.« Sein gewöhnlich kaum merklicher Akzent wurde bei diesen Worten deutlicher.
Ich war dankbar, dass die Dunkelheit mein Erröten verbarg. »Sie verstehen mich falsch«, sagte ich. »Ich wollte nicht …«
»Es muss Ihnen nicht peinlich sein«, sagte er. »Ich habe gesehen, wie Sie mich anschauen, wenn Sie glauben, dass ich es nicht merke. Ich fühle mich geschmeichelt.«
Mir kam ein Wort von früher in den Sinn, ein Wort, das ich vergessen zu haben glaubte. »Prase«, murmelte ich.
»Wie bitte?«, sagte er. Dann hörte ich ein Geräusch auf der Treppe hinter mir, und eine Hand legte sich schwer auf meine Schulter. Ich ergriff sie und spürte den Knoten, wo Richards überzähliger Finger einst gewesen war.
»Antonia«, sagte Richard. Seine Stimme war ganz sanft. »Es ist so spät – willst du nicht mit ins Bett kommen?« Zu Sebastian sagte er kein Wort; oben in unserem stillen Zimmer machte er mir weder Vorwürfe für irgendetwas, noch drängte er mich dazu, ihm die rätselhafte Ergänzung der Geschichte über meinen Großvater zu erklären. Ich weiß nicht, was er später zu Sebastian sagte oder was er mit dem Dekan arrangierte. Aber zwei Tage später zog Sebastian in ein freies Zimmer im Studentenheim, und noch vor dem Ende des Sommers war er fort.
Nêmecky, prase; geheime Wörter. Ich habe Tatis Sprache sonst fast ganz vergessen – er und Leiniger sind beide mittlerweile über sechzig Jahre tot. Sebastian Dunitz lehrt wieder in Frankfurt, wo er außerordentlich berühmt geworden ist. Heute studieren die Studenten Moleküle, lassen Modelle über ihre Computerbildschirme wirbeln und fügen die Gene eines Lebewesens in die Genketten eines anderen. Die Wissenschaft von der Genetik hat sich von Grund auf verändert, und Richard ist von allen vergessen. Manchmal frage ich mich, wo wir unser Leben verlegt haben.
Natürlich unterrichtet Richard nicht mehr. Das College hat ihn mit fünfundsechzig in den Ruhestand versetzt, seinen Protesten zum Trotz. Heute kramen sie ihn nur noch zu Einweihungen, Abschlussfeiern und Fachbereichsfesten hervor, zusammen mit den anderen emeritierten Professoren, die in der Bibliothek und den Gängen herumgeistern. Ohne seine Vorlesungen hat er kein Publikum für seine geliebten Geschichten. Zum Ersatz greift er sich nachts auf Partys, wenn sie ihrem traurigen, trüben Ende entgegengehen und er schon zu viel getrunken hat, Leute, die ihm zuhören. Junge Assistenten, die zu sehr um ihre Stellen besorgt sind, um Unhöflichkeit zu riskieren, wenden Richard ihre Ohren zu wie Blumen. Er bannt sie mit einer knotigen Hand auf einem Ärmel oder einem Knie fest, solange er redet.
Als ich ihm schließlich eines Tages erzählte, was am Ende mit Tati geschehen war, erzählte ich ihm eigentlich gar nichts. Zwei alte Männer hätten sich gestritten, sagte ich. Ein Einwanderer und ein Sohn eines Einwanderers, über irgendwelche Pflanzen. Doch Richard beschloss, dass Tati und Leiniger eine Neuauflage von Mendel und Nägeli waren; Tati habe sich doch sicher mit Mendel identifiziert und Leiniger als einen zweiten Nägeli wahrgenommen? Obwohl er noch immer nichts von meiner Rolle bei dem Unfall weiß, hat es ihm die Analogie, die er zwischen den beiden Männern sieht, ermöglicht, seine Geschichte einfühlender zu erzählen, ausgewogener. Wenn er spricht, schaut er quer durch den Raum und lächelt mir zu. Ich nicke und erwidere sein Lächeln, und denke dabei an Annie, deren erster Sohn mit sechs Zehen an jedem Fuß geboren wurde.
Sebastian schickte mir in dem Sommer, nachdem er von uns fortgegangen war, einen Brief, in dem er die Geschichte zu Ende erzählte, die er damals am vierten Juli begonnen hatte. Der junge niederländische Botaniker Hugo de Vries, schrieb er, verbrachte seine Sommer damit, über Land zu gehen und neue Spezies zu suchen. Eines Tages entdeckte er in der Nähe von Hilversum einen verlassenen Kartoffelacker, der eigentümlich in der Sonne leuchtete. Unweit davon in einem Park hatte man ein Beet mit Nachtkerzen bepflanzt; deren Samen hatten sich auf dem Acker verteilt, wo die Pflanzen nun einen mannshohen Dschungel bildeten. Von 1886 bis 1888 machte de Vries mit diesen Pflanzen Tausende von Kreuzungsversuchen und Aufzeichnungen über die Beständigkeit von Mutationen. Während seiner Suche nach einer Möglichkeit, seine Ergebnisse zu erklären, stieß er auf Mendels Abhandlung und stellte fest, dass Mendel seine Theorien allesamt vorweggenommen hatte. Gartenerbsen und Nachtkerzen, Nachtkerzen und Gartenerbsen, beide vererbten ihre Eigenarten munter von einer Generation zur nächsten.
Diesen Brief habe ich immer noch, wie Richard immer noch den Mendelbrief hütet. Manchmal frage ich mich, was Tati von dieser Fortsetzung seiner Geschichte gehalten hätte. Nicht von der Geschichte über Hugo de Vries, die er wahrscheinlich gekannt hat, sondern von der Art, wie sie in einem blauen Luftpostumschlag zu mir kam, von einem Wissenschaftler, der sich freundlich zeigen wollte. Ich denke an Tati, wenn ich mir Sebastian vorstelle, wie er seine Antwort an mich verfasst.





























