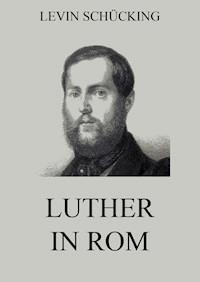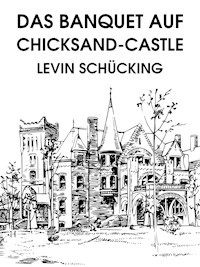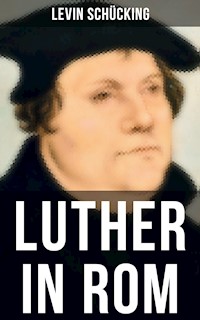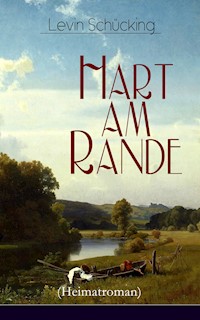Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Die Rheider Burg' von Levin Schücking wird die Geschichte von der jungen Adelheid erzählt, die nach dem Tod ihres Vaters gezwungen ist, die altehrwürdige Rheider Burg zu übernehmen. Schückings literarischer Stil zeichnet sich durch seine detaillierten Beschreibungen der ländlichen Landschaften und der Charaktere aus, die dem Leser ein intensives Eintauchen in die Handlung ermöglichen. Das Werk wird dem literarischen Realismus zugeordnet und ist sowohl für seine romantischen als auch sozialkritischen Elemente bekannt. Im Kontext der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts hebt sich Schückings Werk durch seine präzise Darstellung des ländlichen Lebens hervor. Levin Schücking, selbst ein gebürtiger Westfale, konnte aus erster Hand die Atmosphäre und Kultur der Region einfangen, was sein Werk authentisch und fesselnd macht. Als Schriftsteller und Literaturwissenschaftler war er ein Meister im Erzählen von spannenden Geschichten, die tiefgreifende soziale und psychologische Themen behandeln. 'Die Rheider Burg' ist ein Buch, das Leser ansprechen wird, die sich für deutsche Literaturgeschichte, ländliche Kultur und die Darstellung von starken, weiblichen Charakteren interessieren. Mit seiner eindrucksvollen Beschreibung der Rheider Burg und der fesselnden Handlung erweckt Schücking eine vergangene Zeit zum Leben und bietet Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Rheider Burg
Books
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Erstes Kapitel Der Rheider Hammer
Diejenigen unserer Leser, welche einen längern Aufenthalt in der alten heiligen dreigekrönten Stadt Köln am Rhein gemacht haben, unterließen sicherlich nicht, einen oder den andern ihrer freien Tage zu Ausflügen auf das Gebiet zu benutzen, welches sich diesseits, auf dem rechten Ufer des schönen deutschen Stromes ausdehnt. Von der Höhe des die weitgedehnte Ebene im Osten umschließenden Hügelzugs herab hat sie Schloß Bensberg gelockt, das man allabendlich in Köln mit seinen purpurn flammenden Fensterreihen weithin über das Land leuchten sieht. Sie haben diese Schöpfung der schönen und anmutigen Kurfürstin Anna von der Pfalz, der Tochter Cosimos des Dritten von Toskana, besucht, die hier sich eine Villa gründete, wo sie beim Anblick des zu ihren Füßen liegenden Landes, des fernabziehenden Stromes und der hochragenden Stadt sich in Erinnerungen an ihr schönes, villenübersätes Arnotal und die Zauberstadt Florenz erging, aus der die Tochter der Medicis so weit entführt war, hierher in den kalten Norden ihres belgischen Herzogtums.
Oder sie haben sich in Höhenzüge hineingewagt, welche den östlichen Horizont Kölns schließen; sie haben die merkwürdige Talschlucht aufgesucht, wo in tiefer Gebirgseinsamkeit, umringt von Wiesenmatten und schattigem Gehölz, die ein schmaler, hastig über Steingeröll daherschießender Bach durchschlängelt, sich plötzlich und überraschend der schöne Dom von Altenberge vor dem Wanderer erhebt – die prächtige gotische Grabeskirche der alten Grafen und Herzoge von Berg, der verkleinerte Maßstab für die große Kölner Kathedrale.
Jedenfalls haben diejenigen unserer Leser, von denen wir reden, ein Stück des bergischen Landes gesehen und stimmen uns, während ihre Augen über diese Zeilen fliegen, mit freundlichem Kopfnicken bei, wenn wir sagen, daß es ein hübsches und sehenswertes Land ist; sie glauben uns auch, wenn wir hinzusetzen, daß es bewohnt wird von einem braven, betriebsamen Volke, welches sich in nationaler Besonderheit scharf von den linksrheinischen Stämmen unterscheidet; daß es reich ist an ererbten Überlieferungen und Gebräuchen und treu an den Sagen und Geschichten hängt, welche sich auch hier zumeist an die alten Schlösser, Klöster und Burgen oder Edelhöfe knüpfen ... wie ein letzter Rest von angestammten Privilegien, nachdem die andern Herrenrechte und feudalistischen Auszeichnungen den Weg alles Fleisches gegangen sind.
Namentlich schön, und wie man es nennt, »romantisch« ist im alten Lande der Berge das schmale waldreiche Tal, welches die Wupper durchströmt. Dieser Fluß entspringt in den Gebirgen des Süderlandes oder des Herzogtums Westfalen, wo man ihn Wipper nennt, und durchzieht das dichtbewohnte und wegen seines Gewerbefleißes merkwürdige Tal von Barmen und Elberfeld; und nachdem er hier unzählige Mühlen und Räder getrieben, unter eben so unzählbaren Brücken und Stegen sich durchgedrängt und endlich eine nicht minder unzählbare Anzahl von Bleichen, Färbereien und Fabrikkanälen mit dem nötigen Wasser versehen hat, nimmt er müdegehetzt mit einem Schwunge nach Südwesten Reißaus vor all dem industriellen Lärm. Er sucht die schwere Arbeitsnot und die tausend Hemmnisse, die der listige Fleiß der Menschen ihm bereitete, und die hundertfältigen Plackereien, mit denen man ihn heimsuchte, in der stillen, schattigen Einsamkeit der Gehölze und Bergschluchten zu vergessen, die ihn tröstend empfangen und geleiten, bis er in das offene Rheintal eintritt und sich dann endlich mit dem mächtigen Strome vereint.
In jenen Bergschluchten, deren Wände mit dichtem Buchen-, Eichen- und anderm Laubholz bestanden sind, herrscht nun freilich Ruhe, Kühlung und Frieden. Aber der kleine Fluß hat sich dennoch vergebene Hoffnungen gemacht, wenn er wähnte, er würde hier seinen Verfolgern für immer entronnen sein. Da, wo die Talenge sich erweitert, wo Raum zu grünen, leise anschwellenden Matten zu kleinen Ansiedlungen gegeben ist, da erheben sich die Dächer zerstreuter Gehöfte, die oft den ganzen schmalen Raum zwischen dem das Tal aufwärts ziehenden Fahrwege und dem Flußufer füllen; Gehöfte, deren Eigentümer dann nicht selten heimtückisch genug große Schwungräder in den Fluß hineingestellt haben, in der stillschweigenden Voraussetzung, daß er im Vorübergehen ihnen den Gefallen tun würde, sie umzudrehen. Und in der Tat, so unbescheiden dieses Verlangen sein mag, gestellt an einen unglücklichen Fluß, der unlängst durch Barmen und Elberfeld lief und dort dem einen seine schmutzige Wolle wusch, dem andern seine Garnstränge bleichen half, dem dritten die roten, blauen und grünen Laugen seiner Färbereibottiche wegspülte – unser gefälliges Gewässer täuscht keine dieser egoistischen Voraussetzungen. Aber er tut es mit Zorn und Ingrimm, und indem er sich auf die Räder stürzt, welche man ihm in sein reines kiesiges Bett gebaut hat, erhebt er dabei ein Brausen, Rauschen und Schäumen, das hinreichend andeutet, mit welchen Gefühlen tiefer Entrüstung er abermals die Arbeit auf sich nimmt; und noch eine lange Strecke weit kollert und schäumt er dann zornig weiter, wenn er die schweren Mühlräder hinter sich hat.
Eins dieser Werke oder Gehöfte, das ein sehr sauberes blank angestrichenes und stattliches Vordergebäude und sehr schwarze, rußige, das Ufer entlang gestellte Hintergebäude zeigt, ist der Rheider »Osemund«-Hammer.
Dieses Werk war vor etwa einem halben Jahrhundert das bedeutendste im Tale; es hatte sich die schönste und malerischste Strecke, welche der Fluß durchströmt, ausgesucht, um sie mit seinem Räderrauschen und dem Getöse seiner Hämmer zu erfüllen, und hatte weit über ein Jahrhundert lang bereits mit seinem »Osemund«- oder seinen Rohstahlprodukten die »Drahtrollen« der Nachbarschaft versorgt. Und seit über hundert Jahren hatten damals von Vater auf Sohn die Ritterhausen auf dem Werke wie Erbherren gesessen, und wie feudalistische Erbherren hatten sie über eine Schar wenn nicht reisiger, doch jedenfalls rußiger und auch riesiger Knechte geboten, Menschen von breitschulterigem Wuchs, in deren gewaltigen Fäusten die lange Eisenstange, welche sie schwangen, sicherlich eine nicht minder gefährliche Waffe war, als die Hellebarde in der Hand des ritterlichen Knappen oder Landsknechts. Zur Osemund-Schmiederei nämlich gehörten die allerkräftigsten Leute. Niemand anders war einer Arbeit gewachsen, welche darin bestand, mit der gewaltigen Anlaufstange auf dem Herde zu arbeiten, das Eisen im Feuer vor dem Winde hin und her zu drehen, das geschmolzene Metall an der Stange aufzuwickeln und unter den Hammer zu bringen. Um solche Männer dem Gewerbe zu erhalten, waren deshalb ehemals auch die Osemundschmiede »kantonfrei«, das heißt, sie waren der Militärpflicht nicht unterworfen.
Von solchen Gesellen umgeben hatten also die Ritterhausen mit einer gewissen Erbweisheit fleißig und betriebsam ihr Besitztum ausgebeutet, alle günstigen Verhältnisse wohl benutzt, alle ungünstigen geschickt und wohlvorbereitet bekämpft; und so kam es, daß sie wohlhabende Leute geworden. Man sah das dem Hammer auch schon von fern an. Das Haus, lang, einstöckig, über einem massiven Kellergeschoß von Fachwerk erbaut, zeigte eine glänzende Fensterreihe und an allem Holzwerke frisch blanke Farben. Die lange Vorderseite war dem Wege zugekehrt, der durch das Tal führte, aber durch einen großen Rasenplatz, auf dem einzelne uralte Linden und Buchen sich erhoben, von diesem Wege getrennt. Die Bäume ersetzten dem Hause zugleich die Jalousien, sie gaben ihm hinreichenden Schatten vor den Strahlen der Abendsonne, welche allein diese Hauptfront trafen. Die Nebenfront des Hauses rechts zeigte eine Glastür, welche über fünf oder sechs Stufen hinab in einen großen, reich mit Obstbäumen und Gesträuchen besetzten und am untern Ende in ein schattiges Boskett sich verlaufenden Garten führte. Die Hammergebäude erblickte man nicht von dem Standpunkte, von welchem aus wir das Gehöfte betrachten, das heißt von dem vorüberziehenden Wege her; sie bargen sich mit ihren geschwärzten Dächern und rußigen Essen hinter dem Wohnhause. Aber der Rauch ihrer Kohlenfeuer wirbelte qualmig an der steil ansteigenden, grünen und buschigen Bergseite empor, welche jenseits des Flusses das Tal schloß.
Eine weite Aussicht hatte man von der Nebenseite des Hauses aus, wenn man sich auf die Schwelle der Gartentür über der erwähnten Treppe stellte. Hier blickte man über die Wipfel der Obstbäume fort, den Windungen des Flusses, der sich durch Grasmatten schlängelte, nach, bis ein vorspringender Berg, der dem Gewässer in den Weg trat, das Tal so dicht abschloß, daß es schien, es gäbe gar keinen Ausweg daraus, und wer sich einmal in diesen freundlichen Erdwinkel verloren, der sei für immer gefangen darin, wenn er nicht etwa den Mut habe, die steilen Bergseiten hinan durch das Gestrüpp sich einen Weg zu bahnen und so zu entkommen aus dem stillen Reiche Pans und der Najaden der Wupper.
Jener Berg, welcher mit abschüssiger felsiger Wand in den Fluß vortrat und das Gewässer zwang, sich erst rechts zu schlagen und dann wieder links gewandt einen Durchgang zu suchen, trug, ungefähr anderthalbhundert Fuß hoch über dem Wasserspiegel, ein Bauwerk, welches einen von den Hammergebäuden durchaus verschiedenen Charakter zeigte. Waren diese einstöckig und aus Fachwerk errichtet, so erhob sich der Bau auf der Berghöhe desto stattlicher in zwei oder drei Stockwerken – es war in der Tat schwer zu sagen, in wie vielen, denn die Fenster waren unregelmäßig und symmetrielos angebracht und wie von reiner Willkür in das alte schwere Mauerwerk gebrochen. Ein breiter Erker, der auf schweren Kragsteinen ruhte, trat aus dieser stattlichen Mauerfront hervor, und an den Ecken erhob sich an der einen Seite ein viereckiger Turm, bis zu der Höhe des übrigen Gebäudes von Bruchsteinen und sodann, noch ein Stockwerk höher, von Fachwerk aufgeführt. An der andern Ecke, dem viereckigen Turm zum Seitenstück, stieg ein schlankes rundes Türmlein empor, zu schmal, als daß es für einen andern Zweck als etwa um das Gehäuse einer Wendelstiege zu bilden errichtet sein konnte. So war das Ganze, wie es stolz ans der Bergesstirn erhöht dastand und seine hohen Essen, seine spitzen Dächer und Wetterhähne unten im Flusse spiegelte, ein bedeutsamer, malerischer Punkt, ein Point de Vue, der dem ganzen Tale Leben und Charakter gab und die Blicke jedes Wanderers auf sich zog.
Ob der Edelhof da droben, die Rheider Burg genannt, so anziehend für die Blicke der Bewohner des Hammers sich darstellte wie für die der Fremden, deren Weg durch das Tal führte, ist eine andere Frage. Die laute bürgerliche Industrieanlage mit ihren reichgewordenen Besitzern und der alte stille Herrensitz mit seinen augenscheinlich zerfallenen Mauern lagen sich zu nahe, um nicht in mancherlei Berührungen gekommen zu sein. Diese Berührungen waren in der Tat nicht ausgeblieben, und sie waren nicht immer freundlicher Natur gewesen.
Ein wechselseitiges juristisches Verhältnis, welches die beiden Sitze aneinander knüpfte, war namentlich die Grundlage zu einer erbitterten Stimmung der beiderseitigen Bewohner in den letzten zwanzig Jahren gewesen, welche den Ereignissen vorausgehen, die wir hier mit unserer dem Leser bekannten Wahrheitstreue berichten wollen; und die Reibungen zwischen Hammer und Burg hatten damit geendet, daß der Hammer in der Tat »Hammer« geblieben, die Burg aber »Amboß« geworden und von Schlägen getroffen war, denen zufolge sie heute leer und verödet stand.
Aber bevor wir die Verhältnisse und die Tatsachen ins Auge fassen, sehen wir uns nach den Menschen um, die jetzt den Hammer bewohnen.
Die Glastür an der Nebenseite des Hammergebäudes steht geöffnet und läßt die frische, reine Luft eines Herbsttages, der sonnig glänzend über dem Tale liegt, einströmen in einen Gartensalon von anständiger Größe, in welchem eine gewisse bürgerliche Eleganz herrscht. Die Wände sind bedeckt mit einer grün und lila gestreiften Tapete, unten mit Holzgetäfel überkleidet, und man hat den guten Geschmack gehabt, dieses Holzgetäfel sowie die Türen, die Fensterrahmen und die Blendläden unbesudelt zu lassen mit dem entstellenden Oelanstrich, den die Mode des Tages eingeführt hat; alles zeigt die ursprüngliche reine braune Naturfarbe des Eichenholzes. Ueber dem Kamin hängt ein schön gemaltes Bild in Form eines Medaillons, das zwei Profilköpfe übereinander, einen männlichen und einen weiblichen darstellt. Das männliche Haupt ist das des im Lande der Berge unvergeßlichen Kurfürsten Johann Wilhelm; es zeigt seine geistreichen, markierten Züge, seine klugen großen Augen, die dicke aufgeworfene Unterlippe, über welche die dem guten Herrn eigentümlichen großen Zähne, welche das Volk des Kurfürsten Hauer nannte, hervorschauen. Ein kleiner schwarzer Schnauzbart ziert die Oberlippe, über Scheitel und Nacken aber fließt die mächtige Allongeperücke herab, welche der Maler braun und ungepudert gelassen hat, sicherlich, damit das Profil seiner Gemahlin sich auf diesem Hintergrunde desto besser absetzte. Dieses Profil ist von großer Schönheit; es hat etwas klassisch Edles, und auf den ersten Blick erkennt man darin die Tochter des Südens; die Stirn ist hoch, die Nase fein gebogen und der Mund von einer seltenen Lieblichkeit, wie umspielt von den Genien der Heiterkeit und der Güte; stark gezeichnet und dunkel aber sind die Brauen und ebenso dunkel die ausdrucksvollen lebhaften Augen der italienischen Fürstin.
Noch andere Bilder hingen in dem Gartensalon, Frauen und Männer verschiedenen Alters und verschiedener Zeiten darstellend. Die Frauen waren meist im Reifrock dargestellt und blickten lächelnd, über eine schöne Rose oder eine Orangenblüte fort, den Beschauer an; die Männer in roten Mänteln oder in bequemen, malerisch drapierten Schlafröcken von feinen Stoffen – es lag darin eine kleine Kriegslist, welche auf eine gewisse erbliche Eitelkeit in der Familie Ritterhausen deutet. Denn wären sie Edelleute gewesen, die würdigen hier im Bildnisse verewigten Herren, so würden sie sich ohne Zweifel haben malen lassen in voller Puderfrisur, im seidenen oder samtenen Bratenrock und darunter mit einem Brustharnisch statt der Weste. Denn wo du, mein geneigter Leser, Bilder von Männern findest, die bei seidenen oder brokatenen Röcken, bei spitzenbesetzten Halsbinden und Manschetten eiserne Westen tragen, so kannst du mit Sicherheit aussprechen, daß derartige Bilder Edelleute darstellen. Da nun aber die alten Ritterhausen, die einst als nachgeborene jüngere Brüder der Hammerbesitzer studiert hatten und in den Staatsdienst getreten waren, es wohl zu Hofräten, Hofkammerräten und Amtskellnern, nicht aber zum Adelsbrief gebracht, so hatten sich diejenigen, welche nicht den roten Doktormantel tragen konnten, in Schlafröcken abkonterfeien lassen – bei einem Mann im Schlafrock ist es nicht zu verwundern, daß er keine eiserne Weste trägt!
Außer der offenstehenden Glastür hat das Gemach noch ein Fenster, ebenfalls mit der Aussicht auf den Garten und darüberhin auf die alte hochthronende Rheider Burg. Vor diesem Fenster sitzt oder besser liegt, in einem bequemen Lehnstuhl ausgestreckt, ein hochgewachsener, breitschulteriger Mann, dessen Gestalt jedoch auffallend mit seinen Zügen kontrastiert; denn diese Züge sind tief gegraben und wie von Schmerzen ausgeprägt. Zwischen den dichten Brauen, welche tiefliegende, dunkle Augen beschatten, ist eine mächtige Falte eingeschnitten, die, wenn sie sich finster zusammenzieht, dem ganzen Gesicht einen drohenden bösen Ausdruck gibt. Die einzelnen borstengleichen Haare, welche ergraut aus den Brauen hervorspringen, die kleinen Finnen in dem braunen, etwas fahlen Gesicht tragen nicht dazu bei, dies Antlitz anziehender zu machen. Denn obwohl Nase, Mund und das breite, energisch vortretende Kinn wohlgestaltet und sehr männlich ausgebildet sind, so wird sich doch niemand finden, der behauptet, daß dieser Mann, Johann Wilderich Ritterhausen, der Besitzer des Hammers, ein anziehendes und gewinnendes Aeußere habe.
Freilich wäre es auch sehr unbillig, milde, heitere und wohlwollende Züge zu verlangen von jemand, der so leidend ist wie er. Er trägt die Füße, trotz des warmen Wetters, dicht umhüllt und läßt sie auf einen vor ihm stehenden Taburett ruhen. Zuweilen gleitet über sein Gesicht ein Zucken, das auf einen plötzlichen grausamen Schmerz deutet. Man braucht kein Arzt zu sein, um wahrzunehmen, daß hier das böseste aller Uebel, die Hyäne Gicht waltet.
Ritterhausen gegenüber sitzt seine Tochter, ein junges Mädchen in einem grün und weiß gestreiften Kleide von einfachem Schnitt, das ihre schöne Gestalt nach der Mode der Zeit – ich habe vergessen, dir zu sagen, lieber Leser, daß wir im Jahre des Heils 1807 stehen – knapp umschließt. Sie beugt das von hängenden braunen Locken umrahmte Gesicht über Papiere und ein dickes Buch, welche vor ihr auf dem runden Tisch liegen.
Nachdem sie eine Zeitlang Notizen in das Buch eingetragen, dabei bald das eine, bald das andere Papier genommen und verglichen hat, wirft sie die Feder weg, und indem sie sich in das Sofa, auf dem sie ruht, zurücklehnt, erhalten wir Gelegenheit, ihre Züge zu betrachten.
Diese Züge sind so auffallend wohlgebildet, wie das Antlitz des Hammerbesitzers auffallend düster und uneinnehmend ist. Sie haben etwas von der südlichen Schönheit des lieblichen Frauenantlitzes über dem Kamin, das wir vorhin schilderten – dieselbe Regelmäßigkeit, dieselbe edle Stirn, dasselbe Feuer der großen dunkeln Augen; nur daß ein gewisser schwärmerischer Glanz in ihnen ist, der sie zu charakteristisch deutschen Frauenaugen macht. Die Farbe des Gesichts ist ein feines gedämpftes Inkarnat, mehr gleichmäßig verbreitet, als daß man hätte sagen können, es sei zu Rosen auf den Wangen aufgeblüht; »Rosenwangen« und »milchweißen Teint« hat das junge Mädchen nicht, aber sie ist nur desto schöner, ihre Erscheinung nur desto ungewöhnlicher darum; ihre Züge bilden kein ausdrucksloses Aquarellgesicht, sie haben Charakter und Geist.
Eine Zeitlang heftet sie jetzt ihre Augen mit großem, festem Blick auf ihren Vater, dem das unbequem zu sein scheint, denn er wendet seine rastlos beweglichen Augen von ihr ab, bald hierhin und dorthin und sagt endlich: »Was siehst du mich an, Sibylle, was hast du?«
Sibylle wacht wie aus Gedanken auf.
»Ich dachte nur, Vater ...«
»Wenn du denkst, so jag’ mir deine Gedanken nicht so ins Gesicht, du weißt, daß mir das nicht lieb und angenehm ist!«
Sibylle wendet ihre Blicke wieder ihrem Buche zu. Dann sagt sie: »Also das Geld, die dreitausend Taler, die uns zurückbezahlt sind, soll ich dem Solinger auf seine angebotene Hypothek herleihen, Vater?«
»Mach’s wie du willst. Der Mann ist in großer Not darum. Woher soll er’s sonst nehmen!«
»Freilich, andere Leute denken eben, wie wir auch denken sollten. Es ist nicht klug, sich auf Hypotheken zu verlassen, solange man nicht weiß, welches Gesetz und welches Recht über Hypotheken gelten wird. Die Franzosen werfen alles um, und niemand kann voraussehen, wie gesichert sein Kapital ist, wenn sie einmal unser gutes altes bergisches Recht ganz ausgekehrt haben.«
»Du bist ein weises Huhn,« versetzte Johann Wilderich Ritterhausen mit einem anmutigen Lächeln.
»Sie müssen mir dennoch recht geben, Vater. Es ist sicherer, das Geld zu behalten.«
»Und zu vergraben,« fällt der Hammerbesitzer ein – »vielleicht schlägt es im Keller aus wie überwinterte Kartoffeln und trägt Früchte statt der Zinsen!«
»Der Zinsen bedürfen wir nicht; aber es kann ein Augenblick kommen, wo wir dringend bares Geld und zwar viel bares Geld bedürfen!«
Der Hammerbesitzer zuckte die Achseln.
»Es kann solch ein Augenblick kommen,« sagte er; »unser gnädigster Großherzog, Herr Joachim Murat, der schon daheim in Lahors, in seines Vaters Wirtschaft, nicht guttun wollte, hat hier zu wirtschaften begonnen, daß es nicht ausbleiben kann: es wird der Tag kommen, wo er nach barem Gelde lechzt wie ein dürstender Hirsch nach Wasser!«
»Und wo seine Domänen wohlfeil werden!« sagte, das junge Mädchen halblaut, aber mit einem gewissen bittern Ausdruck.
Johann Wilderich Ritterhausen fuhr sich mit der flachen Hand über das Gesicht; darauf ließ er, wie matt und abgespannt, die Hand wieder auf die Lehne seines Sessels zurücksinken.
»Ja, ja,« fuhr er dann fort, »und darauf hätte ich so ungefähr alles erreicht, was ich gewollt habe auf dieser schönen Welt, und« – ein Zucken des Schmerzes flog eben über seine Züge und unterbrach ihn – »und dann werden wir merkwürdig glücklich sein – ein Paar höchst glückliche Leute. Sibylle! Meinst du nicht auch?«
»Sie sagen das so spöttisch bitter, als ob es nicht Ihr Ernst wäre, Vater,« versetzte Sibylle, nachdem sie eine Weile ihren Vater fixiert hatte. »Ob wir merkwürdig glücklich sein werden, wenn wir die Rheider Burg gekauft haben und ihre Eigentümer sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß das alte Schloß, mit allem, was dazu gehört, unser werden muß; und weshalb es unser werden muß, das wissen auch Sie zu gut, als daß wir davon zu reden brauchten.«
»Ach Gott,« antwortete Johann Wilderich Ritterhausen verdrießlich, »es muß unser werden ... Das sagst du, damit ich in meinem Marterstuhl einen Gedanken habe, mit dem ich mir die langweiligen Tage vertreibe und über dem ich brüte, damit ich nicht verrückt werde vor Pein und Ungeduld; es ist der Knochen, dem man einem Hunde zum Benagen hinwirft, damit er was zu tun habe und nicht belle und beiße. Nun, ich tue dir den Gefallen und arbeite mit allen Zähnen daran. Meinethalb aber mag der Teufel noch heute nacht die ganze Rheider Burg holen, die sämtliche Umgegend dazu, und wenn der Rheider Hammer dann nachbröckelte in das große Loch hinein, das dadurch entstände – wahrhaftig, ich hätte auch nichts dagegen!«
Und damit schloß der Hammerbesitzer die Augen und legte den Kopf, als ob er schlafen wolle, in seinen Armsessel zurück.
Das junge Mädchen ordnete schweigend und ohne sich durch diesen Ausbruch des Unmuts, der ihr nichts Ungewöhnliches haben mochte, stören zu lassen, ihre Papiere, und nachdem sie noch einige Notizen in das große Buch eingetragen, schlug sie es zu. Als sie aufblickte, nahm sie wahr, daß ihr Vater die Augen wieder geöffnet hatte und mit seinen Blicken ihren Bewegungen folgte.
»Unser Lenneper Schuldner,« sagte Sibylle jetzt, »hat seinen Wechsel nicht in Schutz genommen. Er gibt als Grund des Protestes vor, unsere letzte Sendung Rohstahl sei nicht akkordmäßig gewesen.«
»Er ist ein Lügner,« antwortete Ritterhausen mürrisch, »Wenn er nicht zahlen kann, schiebt er’s auf unsere Ware und macht sie schlecht.«
»So will ich ihn einklagen lassen und ohne weiteres Personalarrest beantragen,« sagte Sibylle mit einer so kaltblutigen Ruhe, wie es die eines Advokaten oder Gerichtsvollziehers bei solchen Vorkommnissen ist.
Dann erhob sie sich und ging in ein Nebenzimmer. Gleich darauf kehrte sie daraus zurück, einen leichten weißen Schal um die Schultern geschlagen und einen Strohhut mit herabhängenden weißen Bändern auf ihren braunen Locken. Dieser einfache Kopfputz stand ihr außerordentlich gut. Der kranke Vater im Lehnsessel, der gleichgültig und gallig schien gegen die ganze übrige Welt, konnte sich dem Zauber nicht entziehen, den die eigentümliche Schönheit dieser schlanken elastischen Gestalt, diese ernsten und gedankenvollen Züge auf ihn übten. Er folgte mit seinen Blicken allen ihren Bewegungen und sagte dann freundlichem Tons: »Bleib’ nicht zu lange, Sibylle!«
Sie brachte eine Schelle und stellte sie neben dem Vater auf die Fensterbank, damit sie ihm zur Hand sei, während er allein war.
»Ich geh’ durch den Hammer und mache dann einen kurzen Spaziergang,« sagte sie, »In einer kleinen Stunde bin ich zurück.«
»Laß den Hund von der Kette und nimm ihn mit dir!«
Sibylle nickte ihrem Vater zu, und ohne weitern Abschied trat sie durch die Glastür und stieg die Stufen, die in den Garten führten, hinab.
Zweites Kapitel Die Rheider Burg
Zehn Minuten später schritt Sibylle Ritterhausen über einen schmalen hölzernen Steg, der über den Fluß führte, dem andern Ufer der Wupper zu. Ein schöner großer Hund, eine dunkelgelbe Dogge mit schwarzem Kreuz über den Schultern und schwarzen Füßen, trabte vor ihr her. Als sie am jenseitigen Ufer angekommen war, folgte sie eine Strecke, weit talabwärts dem Flusse; dann schlug sie einen Fußsteig ein, der zur Linken die Bergseite hinanklomm, durch das Gehölz, das die steile Wand bedeckte. Zuweilen, wenn das Gehölz sich lichtete, an Stellen, wo der Fels nackt zutage trat und auf denen nur das Farnkraut, die Erika oder die Heidelbeere fortkam, oder wo das Holz verkrüppelt sich dicht am Grunde hielt, blieb sie stehen und benutzte den freien Ausblick, der sich ihr bot, um ihr Auge sinnend über den Fluß, das Hammergehöfte und das Tal dahinter schweifen zu lassen, das in all den schönen Farben des Herbstes prangte. Die Dogge legte sich dann eine Weile ruhig zu ihren Füßen hin; und nach einer Pause erhob sie sich wieder und lief, ohne daß ihre Herrin ihr ein Zeichen gegeben, weiter, als ob sie genau die Zeit kenne, wie lange Sibylle zu solchen Rasten und Ausschauen an diesen Punkten zu verweilen pflege. In der Tat folgte Sibylle jedesmal ihrem treuen Begleiter auf dem Fuße.
Sie war auf diese Weise beinahe bis an den Rand der Höhe gekommen, welche sie erreichen wollte, als die Dogge stehen blieb, ihre Rückenhaare sträubte und dann in langen Sätzen knurrend voraussprang. Gleich darauf hörte Sibylle oben den Hund anschlagen und eilte nun, ihn durch ihren Zuruf beschwichtigend, rascher voran.
Sie kam an ein altes, gitterloses Tor, dessen zwei Steinpfeiler, von dem Gebüsch dicht umschattet und in ewiger Feuchtigkeit gehalten, ihrem völligen Ruin nicht mehr fern schienen. Der Kalk, mit dem sie beworfen gewesen, war zum größten Teile abgefallen; Moos, Flechten und Steinbrech wucherten in den entblößten Fugen. Ueber den Pfeilern von einem zum andern schwang sich ein künstlich geschmiedeter eiserner Bogen mit allerlei Arabesken, die ein ovalrundes, in der Mitte prangendes Wappen umgaben. Die Gitter, wie gesagt, waren fort; aber wer sich das alte Eisenwerk zunutze gemacht, hatte dadurch die »Rheider Burg« ihren etwa anrückenden Feinden nicht bedenklicher bloßgestellt, als sie ohnehin schon war; denn die Mauer, die sich hier oben, am Rande des Plateaus, auf welchem der alte Edelhof stand, nach rechts hinzog, war stellenweise ausgebrochen oder eingefallen und also sehr leicht zu übersteigen! an den Torpfeiler zur Linken schloß sich nur eine Wallhecke an, welche sich im dichten Gebüsch verlief.
Auf einem Haufen ausgefallener Bruchsteine zur Seite des Pfeilers rechts saß ein Mann in blauem Kittel, einen weißen Strohhut auf dem Kopfe. Sein blondes, ungekräuseltes Haar war länger gewachsen, als es Sitte unter dem Landvolk der Gegend war; der Mann hatte es hinter die Ohren zurückgestrichen, und während so die Schläfen frei wurden und ein seines blaues Geäder unter der auffallend weißen Haut zeigten, bekam das Gesicht dadurch etwas Absonderliches, das sich in hohem Grade steigerte, wenn man auf des Mannes Augen den Blick wandte. Diese waren vom hellsten blauen Wasser und dennoch glänzend, und, wie sie so in Heller Feuchtigkeit zu schwimmen schienen, demantenartig blitzend. Sonst waren die Züge die eines Bauern, die Nase breit, die Lippen schmal und blau, das Kinn sehr zurückspringend, wie es gewöhnlich bei Menschen gefunden wird, die schwachen Charakters sind, oder deren Mangel an geistiger Energie sie der fortwährenden tyrannischen Herrschaft ihrer sinnlichen Triebe preisgibt.
Neben dem Manne, an den Steinhaufen gelehnt, stand eine von einem schmutzigen Lederfutteral bedeckte Geige.
Als das junge Mädchen ihn erreicht hatte, saß die Dogge fünf Schritte weit von demselben ruhig da. Der Fremde blickte ihr fest ins Auge, und der Hund schien sich zu scheuen vor diesem Blick. Er hatte noch immer das Rückenhaar gesträubt, er stieß auch von Zeit zu Zeit einen knurrenden Ton aus – aber seine Blicke wichen den Blicken des Fremden aus, und als Sibylle herankam, barg er sich hinter seiner Herrin.
»Guten Tag, Berend,« sagte das junge Mädchen, als sie den Mann erreicht hatte, »laßt Ihr Euch einmal wieder in der Gegend sehen?«
Der Mann lüftete seinen Strohhut, ohne sich jedoch zu erheben.
»Ihr seid lange geblieben, Mamsell Ritterhausen,« versetzte er. »Ich wartete auf Euch.«
»Auf mich? Und wie wußtet Ihr, daß ich heute hierher kommen würde, Berend?«
Die wasserblauen Augen des Mannes glänzten heller auf von einem eigentümlichen Lächeln.
»Ich wußte, daß Ihr kommen würdet, nach Eurem Eigen zu schauen!«
»Nach meinem Eigen? Was versteht Ihr darunter, Berend?«
»Darunter versteh’ ich die Rheider Burg; es ist kein Winkel und kein Eckchen in dem alten Hause, von dem Ihr nicht mit Euern Gedanken längst Besitz genommen hättet, Mamsell Sibylle. Aus Tür und Tor habt Ihr die drei Späne geschnitten und auf dem Herde habt Ihr Feuer angemacht, alles in Euern Gedanken, heißt das, wie eine rechte neue Herrschaft.«
Sibylle zuckte die Achseln.
»Ihr irrt Euch, Berend,« antwortete sie kaltblütig. »Es ist wahr, daß mein Vater einmal daran gedacht hat, die Rheider Burg anzukaufen. Es war dazumal, als er den Prozeß mit dem seligen Huckarde gehabt hatte und der alte Herr plötzlich ein so schreckliches Ende nahm ...«
»Ich weiß es,« sagte Berend, »er wollte sie kaufen dazumal ...«
»Er dachte daran,« fiel Sibylle ein, »damit solche Streitigkeiten zwischen Hammer und Burg nie wiederkommen könnten. Da aber die Landesherrschaft die Burg an sich nahm, ist diese jetzt in sichern und festen Händen, und was den Prozeß angeht, so ist der auch tot und kann nie wieder aufleben. Wie sollten wir noch daran denken, die Burg zu kaufen!«
»Nun,« versetzte Berend mit eigentümlich listigem Zwinkern der Augen, »daß Euer Vater dazumal sie nicht bekam, das war desto besser für ihn. Wer weiß, was die Leute gesagt hätten!«
»Und was hätten sie sagen sollen, die Leute?«
»Wir wollen die Toten und geschehene Dinge ruhen lassen, Mamsell Sibylle. Was aber kommen soll, das wird kommen. Ihr habt recht, daß Ihr’s nicht jedem ersten besten in die Ohren hängt, was Ihr vorhabt. Es gehören schöne Waldungen zum Hause; unten die langen zweischürigen Wiesen sind auch was wert, und die Ackerländereien bringen ihre fünf Taler Pacht der Scheffel.«
Sibylle Ritterhausen zuckte abermals die Achseln
»Ist das alles, was Ihr mir sagen wolltet – habt Ihr deshalb auf mich gewartet, Berend?« sagte sie, sich zum Weitergehen wendend.
»Nein, Mamsell Sibylle,« antwortete der Mann mit einem pfiffigen Augenblinzeln. »Ich weiß es, daß es Euch nicht um die Pacht und nicht um die Wiesen zu tun ist, wenn Ihr Euer Auge gerichtet haltet auf die Rheider Burg wie ein Falke auf ein Wasserhuhn, das noch im dicken Schilfe steckt, aber einmal doch daraus hervorkommen wird – und dann wird der Falke bei der Hand sein! Ja, ja, Ihr sollt sie auch haben, die Burg – denkt daran, daß Spielberend es Euch gesagt hat; aber es ist eine Leiche im Haus, die muß erst hinaus.«
»Eine Leiche? Ist das nun Euer Ernst, Spielberend, oder wollt Ihr mich ängstigen mit Euern Schauergeschichten?«
»Euch ängstigen? Wie sollte ich Euch ängstigen wollen? Seid Ihr so schreckhafter Natur, daß man Euch mit Lügen angst machen könnte? Es ist auch nichts dabei, weshalb Ihr erschrecken solltet. Die Leiche, die hinausgetragen werden muß, ehe die Rheider Burg Euer Eigen wird, geht Sibylle Ritterhausen nichts an.«
»Ist es der alte Claus?« sagte da« Mädchen, das offenbar stutzig geworden war, flüsternd.
Spielberend schüttelte den Kopf, »Die alte Hauseule, der Claus? der ist es nicht. Es sind große Wappen an dem Sarge.«
Sibylle erblaßte und fuhr mit der Hand zum Herzen.
»Habt Ihr die Wappen gesehen, Berend?« fragte sie, wie in höchster Spannung.
»Ich habe sie gesehen; es waren große Wappen mit einer roten Krone darüber.«
»Mit einer roten Krone?« fragte das junge Mädchen, erleichtert aufatmend. »Rote Kronen tragen nur Fürsten.«
»Das weiß ich nicht. Ihr mögt recht haben oder nicht... Ich weiß nur, was ich gesehen habe.«
Sibylle Ritterhausen schaute den Spielmann eine Zeitlang nachdenklich an.
»Ihr seid ein schlimmer Geselle, Spielberend,« sagte sie dann. »Es ist wahr, daß Ihr...«
»Mehr könnt als Brot essen, wollt Ihr sagen, Mamsell,« fiel der Mann ein, Sibylle mit einem schlauen Seitenblick streifend, und dann wieder, wie gewöhnlich, unsteten Blickes ihr Auge vermeidend.
»Aber,« fuhr Sibylle fort, »es ist auch ebenso wahr, daß Ihr lügen könnt wie der Lügenschuster Matthias, Euer guter Freund, und darum weiß man nie, ob man Euch trauen soll oder nicht. Was Ihr jetzt sagt, lautet nun vollends so wie eine von Euern Aufschneidereien. Auf der Rheider Burg lebt niemand als der alte Hausmeister Claus, und wenn sie einst den hinaustragen, die Füße voran, so werden sie keine Wappen mit Fürstenkronen an seinen Sarg heften!«
Spielberend lächelte wieder.
»Wer weiß es! In Düsseldorf ist auch ein Mann, der ist nicht besserer Leute Kind wie der alte Claus Fettzünsler; ein Schenkwirtssohn, hab’ ich mir sagen lassen. Und doch, wenn er begraben wird, so soll einer die roten und goldenen Kronen sehen, die sie an seinen Sarg machen werden!«
»Habt Ihr das etwa auch gesehen, Spielberend?«
»Nein, das habe ich nicht gesehen, Mamsell Sibylle – ich weiß nichts davon! Er hat ein gutes Leben dort, im Schlosse unserer alten Herzoge; und wenn Frau Jakobäa von Baden, die da spuken geht, ihm nicht etwa den Hals umdreht – sie muß es ja an sich selber gelernt haben, wie man’s macht – dann wird er ans Sterben noch lange nicht denken!«
»Ihr seid eigentlich ein greulicher Mensch, Spielberend,« sagte das junge Mädchen, sich auf einen Baumstamm niedersetzend, der dem Mauerstück, auf welchem der Spielmann saß, gegenüberlag – »man hat kaum eine Viertelstunde mit Euch geredet und Ihr habt jedesmal schon so viel von Sterben, Leichen und Särgen vorgebracht, daß einem ganz schaurig zumute wird!«
Spielberend antwortete nicht. Er griff nach seiner Geige, riß die Hülle herab und spielte mit großer Gewandtheit ein paar Läufe darauf, ein Stück aus einer lustigen Tanzmelodie; mit einem schreienden, kreischenden, tief disharmonischen Tone hörte er plötzlich auf.
»Nun ist’s fort!« sagte er dann. »Darum bin ich ein Spielmann geworden. Wer Augen hat wie ich, der muß sich danach einrichten, daß ihm das Leben ein Spaß wird, und daß, wo er geht und steht, um ihn herum fröhliche Kameraden kommen. Ja, es ist ein gutes, freisames Handwerk, ein wandernder Spielmann sein. Man weiß doch, daß man lebt. Hat nicht Kind noch Kegel. Heute hier und morgen dort. Wo man kommt, da ist Kirmes. Und die Lebsucht ist gut im Land der Berge. Gar manche lange Nacht bringt man flott herum. Habe ich die Geige am Hals und den Fiedelbogen in der Hand und um mich her das lustige Hallo – dann sitze ich fest, und ich bin stärker als die sind, die mich heraus haben wollen vor die Tür, an den Kreuzweg, auf die Heide. Mögen sie locken und rufen wie sie wollen, draußen im Mondschein – Sie bekommen mich nicht! Ich weiß es schon, was da vorgeht draußen; was daherkommt den Dorfweg entlang, mit einem schwarzen Kreuz voran und einer Reihe schwarzer Leute hinterher. Sie wollen mich heraus haben, daß ich’s sehen soll. Ich meine, ich habe die Nachtmär auf der Brust liegen, von Unruhe und schwerem Atem. Aber ich tu’s nicht. Ich tu’s partout nicht. Ich bleibe sitzen wie angeleimt auf der Bühn’ und streiche die alte Geige, daß die Gläser klirren; daß die Bauernjungen stampfen und die Dirnen kreischen vor Vergnügen; ich streiche, bis ich umfalle vor Müdigkeit in dem Staub und dem Qualm der Talgkerzen und der Hitze, und dann, dann ist’s vorüber. Ja, Mamsell Sibyllchen, so ist’s! Und darum: Vivat, es lebe die Geige!«
Sibylle sah mit großen Augen den Menschen an, der wie ein verkörpertes dunkles Rätsel vor ihr dasaß. So nahe es lag, seine Reden als aberwitzige Possen zu betrachten, so war sie doch weit entfernt davon, sie so aufzufassen. Dafür stand Spielberends Ruf als der eines Vorgeschichtensehers im ganzen Lande viel zu fest. Spielberend ist eine populäre Gestalt, deren Andenken noch heute beim bergischen Volke lebt. Er ist der große Prophet der bergischen Lande, von dem noch heute die Großmütter ihren Enkeln erzählen. Freilich war er nebenbei ein Spielmann, ein Dorfmusikant, ein Schnurrant. Man wußte, er erzählte mehr, als er verantworten konnte, und er beutete listig den Glauben an seine Geschichten aus. Aber auf der andern Seite stand es felsenfest, daß er in einem hohen Grade von Ausbildung die Gabe des zweiten Gesichts habe. Er sah Todesfälle, Leichenbegängnisse, Feuersbrünste, Truppenmärsche vorher, und hundert Beispiele zählte man auf, wo sich buchstäblich erfüllt hatte, was Berend vorhergesagt. Und so kam es, daß sein übriges Wesen, sein Vagabundentum, seine Lügen ihn dem Volke nur desto merkwürdiger und anziehender machten.
Sibylle fuhr mit der Hand über das Gesicht, als ob sie den unheimlichen Eindruck verwischen wolle, den all dies Gerede auf sie gemacht hatte. Dann sagte sie: »Nun hört auf mit Euern tollen Geschichten, die mich grauen machen, hier in dem einsamen Busch. Was wolltet Ihr eigentlich von mir?«
»Ich wollte Euch um etwas gebeten haben. Ich habe einen Gesellen für Euch, einen derben Burschen, der Arbeit auf Euerm Hammer nehmen will.«
»Und wer ist das?«
»Ein armer Teufel, den die Franzosen zum Soldaten gepreßt haben und der ihnen durchgegangen ist!«
»Ein Deserteur?«
Spielberend nickte.
»Den können wir nicht brauchen!«
»Wenn er in Euerm Hammer mit der langen Stange neben dem Frischfeuer steht, nackt bis auf den Gürtel und schwarz wie der König aus dem Mohrenlande – dann kennt ihn keiner mehr, und Ihr braucht, kommt Frage nach ihm, nur zu sagen, das ist der Xaver Meyer oder der Franz Müller, der schon seit Monden im Hammer arbeitet!«
»Nein,« sagte Sibylle streng und entschieden, »daraus wird nichts.«
»Aber wenn sie ihn fangen, schießen sie ihn tot; und ich glaubte, es wäre Euch ein Vergnügen, wie jedem andern guten Patrioten, ihnen einen Streich zu spielen.«
»Es geht nicht, Bebend,« sagte das junge Mädchen. »Die Hammergesellen wissen, was sie uns wert sind und tragen den Kopf hoch. Die dienen nicht zusammen mit einem hergelaufenen Menschen. Und wenn das nicht wäre, wie kann ich so viel aufs Spiel setzen, um eines fremden Deserteurs willen? Die Gesetze sind furchtbar streng dawider. Schlagt es Euch aus dem Kopfe. Wo ist er?«
»Wollt Ihr mit ihm reden? Er ist in der Nähe, – Johannes!« rief Spielberend zurückgewendet.
Sibylle folgte mit den Blicken der Richtung, nach welcher hin Berend bei diesem Rufe das Gesicht gewendet hatte, und sie sah, wie sich etwa dreißig Schritte weit von ihr, hinter der Hecke, die sich in das Gehölz verlief, ein Kopf, der mit einer blauen rotumsäumten Militärmütze bedeckt war, erhob, und wie dann eine Gestalt über diese Hecke kletterte, die rasch auf sie zugeschritten kam.
Sibylle faßte nach dem Halsband ihrer Dogge, um das aufspringende und laut anschlagende Tier zurückzuhalten. Der Fremde war unterdes herangetreten und legte die Hand an seine Mütze.
Der Mann hatte ein auffallendes Aeußere. Er war mittlerer Größe, hatte eine breite, Kraft und Gewandtheit ankündende Gestalt, und einen ungewöhnlich kleinen schmalen Kopf auf den mächtig ausgebildeten Schultern. Das graue Auge zeigte eine eigentümliche reiherartige Schärfe. Die Mütze mit dem roten Rande war das einzige Militärische an seiner Kleidung. Diese bestand aus einer schwarzen Manchesterjacke, langen Tuchbeinkleidern von derselben Farbe und einer dunkelgrünen Weste von Serge oder einem ähnlichen Wollstoff. Um den niedergeschlagenen Hemdkragen trug er ein schwarzes Seidentuch – die ganze Erscheinung war etwa die eines ehrsamen Handwerkers im Sonntagsstaat.
»Ihr seid den Franzosen fortgelaufen?« fragte Sibylle zu dem Fremden aufschauend, der mit einer für einen Unglücklichen und Hilfesuchenden auffallenden Dreistigkeit seine scharfen Augen auf das junge Mädchen heftete.
»Das bin ich.« sagte er.
»Und weshalb?«
»Es war gerade Zeit für mich!«
»Zeit für Euch? Das soll heißen, Ihr habt Euch mit etwas vergangen und nahmt vor der Strafe Reißaus.«
»Wenn Ihr mir helfen wollt, wie der Spielmann dort meint, daß Ihr tun würdet, will ich Euch die Geschichte schon erzählen,« antwortete der Deserteur, »Sonst könnt Ihr’s nicht verlangen.«
»Ob ich Euch helfen will? Nun, vielleicht will ich Euch einen guten Rat geben, wenn Ihr’s verdient. Um das zu wissen, muß ich Eure Geschichte kennen. Wie heißt Ihr?«
»Johannes.«
»Und dann?«