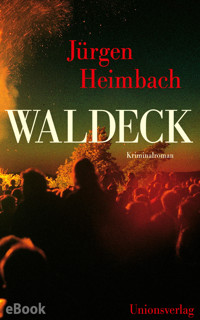Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Arnolt Streich ist nicht gerade ein Menschenfreund. Vom Wirtschaftswunder vergessen, verbringt der ehemalige Fremdenlegionär seine Tage als Wachmann über ein paar schäbige, von zwielichtigen Typen gemietete Garagen in einer zugigen Wohnung, raucht eine Morris nach der anderen und flüchtet sich in die tröstliche Stimme von Édith Piaf. Beim täglichen Bier um die Ecke erfährt er von einem tödlichen Anschlag mitten in der Stadt. Das Opfer: Georg Puchert, ein Waffenhändler, der die algerische Befreiungsfront FNL im Kampf um die Unabhängigkeit mit Waffen versorgt hat. Gleichzeitig beginnen düstere Gestalten, nach Streich zu fragen. Der kann die Machenschaften hinter den verschlossenen Garagentoren nicht länger ignorieren und stößt auf Vorgänge, die besser im Verborgenen geblieben wären.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Der ehemalige Fremdenlegionär Streich verbringt seine Tage als Wachmann schäbiger Garagen. Was darin geschieht, interessiert ihn nicht. Als aber ein Waffenhändler, der die algerische Befreiungsfront beliefert, ermordet wird, kann er die Machenschaften nicht mehr ignorieren und stößt auf Vorgänge, die besser im Verborgenen geblieben wären.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jürgen Heimbach (*1961) studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Germanistik und Philosophie und arbeitet als Redakteur für 3sat. Sein Werk umfasst Romane, Jugendbücher und Kurzgeschichten. Sein Roman Die Rote Hand wurde 2020 mit dem Glauser-Preis für den besten Kriminalroman ausgezeichnet.
Zur Webseite von Jürgen Heimbach.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jürgen Heimbach
Die Rote Hand
Kriminalroman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 im Verlag weissbooks.w, Frankfurt.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Mr Xerty (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31100-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 04:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE ROTE HAND
Die Kugel …RoutineDer ArtikelDas FotoAlte KameradenDer GewinnEin StoßDie AnzeigeDie BlumeDer AuftragDer VerratStrafarbeitRacheengelEiner von unsDas AttentatBlickeFolterKleine MädchenFragewundenAbdrückeInformationenDas VersteckNom de GuerreVerbrennungenEin hübscher JungeDomicile du jazzSchüsseUmzügeWartenAusgeknocktFluchtreflexPartnerHinterzimmergeschäftEinträgeAbschiedZieleinlauf… die KugelEpilogNachwortDanksagungAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Jürgen Heimbach
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jürgen Heimbach
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Geschichte
Für Tanja,die immer an dieses Buch geglaubt hat
Einer muss immer bezahlen,sonst kommt nichts ins Gleichgewicht
(Aus dem Film Mörderische Stillevon Friedemann Fromm)
Die Kugel …
Fasziniert starrt er in das Mündungsfeuer. »Halt den Kopf unten, du Rindvieh!«, schreit der Feldwebel und zieht ihn an der Uniform zurück in den Schützengraben. Die Kugel fliegt über ihn hinweg, begleitet den schnellen Vorstoß, durchschlägt nur wenige Tage später seinen Oberschenkel, ohne den Knochen zu treffen, und verschafft ihm ein paar Tage Aufenthalt in einem Lazarett nahe Berlin. Eine Verwundung, der noch viele folgen werden. Sie schwirrt weiter über endlose Steppen, in denen der aufgewirbelte Staub ihm Hals und Lungen besetzt und ihn schwer atmen lässt, verfehlt ihn im tiefen Schlamm Russlands, der jeden Meter zu einer Tortur macht, streift schnee- und eisbedeckte Landschaften, deren Kälte ihn fast die Zehen kostet, fliegt über Flüsse, durch zerstörte Kirchen und Häuser, vorbei an ausgebrannten Panzern, über die Körper der von Granaten zerfetzten Kameraden und die Leichen von gemeuchelten Zivilisten, durchschlägt die breiten Farnblätter auf der Krim, zerreißt die Rinde eines Olivenbaums in Griechenland, hinter dem er in Deckung liegt, und streift seinen Oberarm am Ufer eines Kanals in Frankreich.
Sie durchbohrt das Holz der Bambushütte, in der er für wenige Stunden Ruhe gefunden hat, rast über die versumpfte Flusslandschaft, in der er bis zum Hals im Wasser steht, saust an seinem Kopf vorbei, als er sich nach irgendeinem Tier bückt, und fliegt weiter in die Stadt, wo er die wenigen freien Tage mit seiner Geliebten verbringt. Er tritt auf den schmalen Balkon, betrachtet die aufgehende Sonne, zündet die erste Zigarette des Tages an, da zersplittert sie das Fenster, zerfetzt Hoas Hals, durchschlägt die rückwärtige Wand, um ihn am Hafen, nur wenige Tage vor seiner Ausschiffung, nicht lange vor der offiziellen Niederlage, erneut aufzusuchen, als er sich bei einem Trupp Soldaten aufhält, die auf ihren Seesäcken sitzen, dösen und schlafen. Nur er steht aufrecht, blickt zurück. Sie streift seinen Arm, reißt den Stoff seiner Uniform unterhalb der Schulter auseinander und einen Fetzen seiner Haut mit sich, er spürt die Wärme des Bluts, das langsam seinen Arm hinunterfließt. Die Überfahrt ohne Kugel, sie kommt ihm trostlos vor, er vermisst seine Begleiterin. Dann, schon nach wenigen Schritten über den heißen Wüstensand, ist sie wieder da, rauscht über ihn hinweg, als er seine Gamaschen fester schnürt. Sie jagt weiter ins Gebirge, wo er wochenlang in kleinen Einheiten Jagd auf den Feind macht, wie Wild getrieben, über Bergketten, unter Felsklippen, hinter tonnenschweren Gesteinsmonolithen. Nur knapp verfehlt ihn ein Querschläger, der weiter dicht über die dürren Gräser der Wüstenausläufer schießt, vorbei an den ärmlichen Hütten und den eng beieinanderstehenden Häusern bis zum Hafen, wo er am Wasser steht, zusammen mit seinen Kameraden. Sie verschwindet über dem leichten Wellenschlag im Blau …
Routine
Arnolt Streich stand am Fenster und blickte durch das feucht-matte Glas in die Dämmerung. Die provisorisch an den Wänden befestigten Laternen tauchten die Ansammlung heruntergekommener Garagen und Lagerhallen in ein diffuses Licht. In den Pfützen, die sich nach den Regengüssen der vergangenen Tage in den Vertiefungen der Schotterwege gebildet hatten, brachen sich die Lichtstrahlen und tanzten unruhig auf der vom Wind bewegten Wasseroberfläche.
Gerade hatte er seinen letzten Rundgang für diesen Tag abgeschlossen und alle Türen und Tore des ehemaligen Tankstellengeländes kontrolliert, das nach dem Krieg mehr und mehr verfallen war und nun ein trostloses Bild abgab. Nicht mehr lange nach den Plänen von Karlheinz Bommel, der das ganze Areal erworben hatte, um hier Wohnungen zu errichten. Noch allerdings fehlte ihm das nötige Geld, deshalb hatte er einen der Lagerräume an eine Tischlerei vermietet und in zwei oder drei der Garagen waren Autos untergestellt, der Rest war schon so marode, dass sie kaum mehr genutzt werden konnten.
Streich blickte auf den Abrisskalender neben dem Fenster. Er zeigte den 4. März 1959 an, und der war verlaufen wie die meisten Tage in dem einen Jahr, seit er wieder in Deutschland lebte und dieses Gelände als Hausmeister und Wachmann für Bommel beaufsichtigte, der ihn dafür mehr schlecht als recht entlohnte und in der feuchten, zugigen Wohnung über der kleinen Halle neben der Einfahrt wohnen ließ. Kontrollgänge, Leibesübungen, der Gang zum Wasserhäuschen. Mehr war nicht. Der Kalenderspruch unter dem Datum klang für Streich wie Hohn: »Glücklich ist, wer nicht vergisst, was durchaus zu ändern ist.«
Anfangs hatte er das Gelände noch erkundet, hatte Karten angelegt, darauf die Räumlichkeiten verzeichnet, ein Zeitvertreib, mehr nicht, dennoch hatte Bommel ungehalten reagiert, als er davon Wind bekommen hatte, und ihn angeschnauzt, dass er ihn fürs Kontrollieren und nicht für so eine Kleckserei bezahle.
Streich riss das Blatt vom Kalender, zerknüllte das Papier in seiner Faust und warf es hinter sich, um gleich darauf wieder seine alte Haltung einzunehmen. Gerade und aufrecht am Fenster, den Blick nach draußen gerichtet, die kantigen Gesichtszüge starr, nur seine Augen wanderten aufmerksam hin und her. Lärm von Kindern, die verbotenerweise zwischen den Garagen spielten, drang zu ihm herauf. Sie mussten in den letzten Minuten gekommen sein, bei seinem Rundgang hatte er sie nicht gesehen. Ihr Geschrei übertönte die Kratzgeräusche der Nadel, die in der Auslaufrille der Schallplatte ihre endlosen Runden drehte.
Arbeit und Wohnung verdankte Streich einem früheren Kameraden, der den Kontakt zu Bommel hergestellt hatte. Die Arbeit war nicht die, die Streich sich erhofft hatte, und Bommel kein Mensch, für den er Sympathie empfand, doch schon beim Grenzübertritt an einem kalten Aprilmontag im letzten Jahr hatte man ihn deutlich spüren lassen, dass auf einen wie ihn niemand wartete. Trotz Wirtschaftswunder und Wir-sind-wieder-wer war offenbar niemand bereit, ihm ordentliche und anständig bezahlte Arbeit zu geben. Er hatte den Kameraden, die ihm genau das vorausgesagt hatten, nicht geglaubt. Oder nicht glauben wollen.
Streich löste sich aus seiner Starre und ging zur Spüle, wo er in ein schon benutztes Glas den Rest aus der Wermutflasche füllte und ihn mit einem Schluck hinunterkippte. Auf dem Rückweg zum Fenster legte er die Nadel an den Anfang der Platte. Eine Bewegung, schon Hunderte, Tausende Mal durchgeführt. Er besaß nur diese eine Platte, brauchte keine andere. Eigentlich nur dieses eine Lied, das letzte darauf. Die getragenen Akkorde, dann die Stimme von Édith Piaf. Zart und rau zugleich. Er kannte jede Zeile, jeden Buchstaben, jeden Hauch. Verstand das Begehren in ihrer Stimme so gut.
Il avait de grands yeux très clairs
Où parfois passaient des éclairs
Comme au ciel passent des orages.
Il était plein de tatouages
Que j’ai jamais très bien compris.
Son cou portait: »Pas vu, pas pris.«
Sur son cœur on lisait: »Personne.«
Sur son bras droit un mot: »Raisonne«.
Gedankenverloren hörte er eine Weile zu, trat dann wieder ans Fenster. Der Kinderlärm war nun gedämpft, ein Rauschen unter der Musik. Er wartete. Auf Bommel. Sein Geld. Er hatte versprochen, an diesem Abend zu kommen, um ihm den noch ausstehenden Lohn zu bringen. Streich schloss seine Augen, lauschte der Musik, bis die Bilder kamen, wie immer am ersten Mittwoch im Monat. Ein Ritual wie eine Beichte oder die Bitte um Nachsicht für den Verrat … Er ballte seine Fäuste.
Die schweren Schritte, die sich die Treppe hinaufbewegten, verrieten ihn. Bommel, der sich mühsam nach oben keuchte.
Ohne hinzuschauen, fingerte Streich eine Morris aus der Zigarettenschachtel auf dem morschen Fensterbrett, steckte sie an, inhalierte tief und blickte weiter auf den Hof. Lauschte, zählte … vier, fünf, sechs … bis eine Faust gegen die Holztür krachte.
»Streich, mach auf!«, dröhnte von draußen eine herrische Stimme.
Er wartete, zählte weiter … sieben, acht, neun, zehn … Es klopfte erneut, zwei Schläge … elf, zwölf, dreizehn … Streich nahm noch einen Zug, drückte die angerauchte Zigarette auf der Fensterbank aus.
Während Édith Piaf unbeeindruckt weitersang,
J’rêvais pourtant que le destin
Me ramèn’rait un beau matin
drehte sich Streich um, war mit wenigen Schritten an der Tür, riss sie auf.
Der Mann draußen stand mit erhobener Faust vor ihm.
»Was soll das, Streich!«, blaffte Bommel, schwer atmend, irritiert durch die Musik.
Inzwischen einhundertdreißig, schätzte Streich. Bei jeder Begegnung kam es ihm vor, als ob der Mann mindestens ein Kilo zugelegt hätte. Wirtschaftswunder, so sah das also aus. »Wirtschaftswunder«, die Kameraden hatten dieses Wort immer mit einer gewissen Ehrfurcht ausgesprochen. »Wenn wir erst wieder daheim sind« … Daheim, er lachte innerlich.
»Hörst du nicht den Krach da unten? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Und was ist das für ein Gekrächze? Franzackengejammer!«
Bommel versuchte, an ihm vorbei ins Innere zu schauen. Streich blieb unbeweglich stehen, lauschte den letzten Worten der Piaf:
Mon légionnaire!
Y avait du soleil sur son front
Qui mettait dans ses cheveux blonds
De la …
Bommel wagte nicht, in das langgezogene lumière und das Verklingen des letzten Tons hineinzusprechen.
… lumière!
»Wenn ich nicht zufällig vorbeigekommen wäre, könnten die Gören machen, was sie wollen. Die haben da nichts zu suchen. Und wenn was passiert …?!«
Streich schwieg weiter. Einen wie Bommel regte so etwas mehr auf als jedes Wort.
»Was ist, Streich, die Sprache verloren?«
Statt einer Antwort streckte Streich seine rechte Hand aus. Bommel sah ihn erst verständnislos an, um dann aus der Außentasche seiner Jacke einen Briefumschlag zu ziehen.
»Erst die Kinder da unten. Und das um die Uhrzeit. Haben die keine Eltern?!«
Streich schüttelte sanft den Kopf. »Es ist der vierte März.«
»Na und? Erst die …«
Streichs Hand schoss vor und entriss Bommel den Umschlag.
»He, was soll das?!«
Ohne auf sein Gegenüber zu achten, öffnete Streich den Umschlag, nahm die Scheine heraus und zählte. Die Bewegungen seines linken Arms hatten dabei etwas Unbeholfenes. Bommel ließ ihn nicht aus den Augen.
»Das reicht nicht.«
»Wie?«, fragte der dicke Mann entrüstet.
»Da fehlen zwanzig Mark.«
»Hast eben nicht genügend gearbeitet. Wie jetzt!« Er deutete mit seinem Kopf auf das Fenster. Wie verabredet schrien die Kinder in diesem Moment besonders laut.
Streich streckte seine freie Hand abermals vor, fixierte Bommel, der diesem Blick nur wenige Sekunden standhielt, aber keine Anstalten machte, ihm das geforderte Geld zu geben.
»Ohne mich«, Bommel machte eine raumgreifende Armbewegung, »würdest du auf der Straße sitzen. Ich sage, was gemacht wird, sonst fliegst du hier raus. Es gibt genügend arme Schlucker, die sonst was dafür geben würden, deine Arbeit zu machen.« Überdeutlich sog er Luft ein. »Hast du schon wieder gesoffen? Nicht während der Arbeit, habe ich gesagt!«
Streich machte einen kleinen Schritt auf Bommel zu, dem die Überlegung anzusehen war, ob Streich auf ihn losgehen würde.
»Erst das Geld, dann gehe ich runter.«
Bommel zögerte noch einige Sekunden, griff dann aber doch in seine Tasche und hielt Streich den geforderten Zwanzigmarkschein entgegen.
Bedächtig steckte er ihn in den Umschlag zu dem anderen Geld, schob ihn in seine Hosentasche und nahm eine Jacke vom Haken neben der noch offen stehenden Wohnungstür.
»Dann mal los!« Behäbig wuchtete Bommel seinen Körper um die eigene Achse, umfasste den Handlauf und wackelte langsam die Treppe hinunter. »Und kauf dir mal einen anständigen Plattenspieler. Nicht so ein Drecksding von anno Tobak«, stieß er dabei, abgehackt und kaum verständlich, aus.
Streich wartete oben, bis er im Hof verschwunden war, nahm die Nadel aus der Auslaufrille, schloss die Wohnungstür, dann folgte er Bommel leise und geschmeidig. Der stand in der Einfahrt zu dem Garagenhof, die Arme in die Hüften gestemmt, seine Konturen hoben sich deutlich gegen das Licht einer Straßenlaterne ab. Ein Tor auf das Gelände gab es nicht mehr, es war so brüchig gewesen, dass Streich es als eine seiner ersten Amtshandlungen auseinandernehmen musste. Die Reste lagen immer noch neben der Einfahrt.
Er ging dem Kinderlärm nach, stolperte dabei über einen Stein, fluchte, kickte ihn weg. In flachem Bogen schepperte er gegen ein Holztor. Auf einer Freifläche zwischen zwei Garagenreihen entdeckte er die Kinder, eine Gruppe Jungs, zwölf oder dreizehn Jahre alt, die sich im Halbkreis um eine weitere Person aufgestellt hatten, die sich mit dem Rücken gegen das Wrack eines ausgebrannten Autos drückte.
Sie riefen durcheinander, versuchten sich in der Lautstärke zu übertreffen, die Anwürfe galten der umringten Person, einem Mädchen, wie Streich nun erkannte. Mit einem Küchenmesser hielt sie sich die Angreifer vom Leib.
»Polackin!«, hämmerten sie ihr entgegen. Eine Stimme stach besonders heraus, fordernd, aggressiv: »Polackenbastard! Polackenbraut!«
Gebannt starrte er auf die Szene. Die Kasbah, drei oder vier Fellaghas um eine Frau, fast noch ein Mädchen, die dunklen Haare offen, sie zischen ihr Worte zu, die er nicht versteht, sie sieht zu ihm herüber, da tritt einer der jungen Burschen vor, eine schnelle Bewegung, ein Schnitt, ein stummer Schrei, das Mädchen steht sekundenlang mit aufgerissenen Augen da, starrt ihn an, bevor sie zur Seite kippt. Die Männer folgen ihrem Blick, sehen ihn, seine Uniform, die Maschinenpistole, warten, überlegen. Er entsichert die Waffe, dann sind sie weg. Einer lacht. So laut, dass er es noch lange hört.
Die Kinder waren so mit sich und ihrem Schreien beschäftigt, dass ihn einer der Jungs erst wahrnahm, als er direkt hinter ihnen stand. Der Junge starrte ihn an, zwei, drei Sekunden, dann brüllte er eine Warnung, alle rannten los, nur er blieb stehen. Er musterte Streich, machte einen Schritt auf das Mädchen zu, spuckte ihr ins Gesicht. Dabei lachte er kurz. Dann lief auch er davon. Das Mädchen sah Streich in die Augen, herausfordernd, wie damals das Mädchen in der Kasbah, wischte sich mit einer schnellen Bewegung die Spucke von der Wange, warf ihre dunklen Zöpfe zurück und rannte ebenfalls los, das Messer in der Hand.
Streich folgte ihr. An der Einfahrt stand noch immer Bommel. Als ihre Blicke sich trafen, nickte er gnädig und wandte sich ab, um kurz darauf umständlich in eine beige Mercedes-Limousine zu steigen.
Der ungeplante Zwischenfall hatte ihn Zeit gekostet. Doch immerhin hatte er jetzt das Geld. Schnell zog er sich in der karg eingerichteten Küche aus und wusch mit einem groben Lappen ausgiebig seinen Körper. Er schäumte Wangen, Kinn und Hals ein, wartete einige Sekunden, nahm das Rasiermesser aus dem Lederetui, stellte sich nah vor den kleinen, runden Spiegel über dem Spülbecken, kniff die Augen zusammen und streckte seinen Kopf vor. Er sah einen knapp vierzigjährigen Mann, die Gesichtszüge älter, verlebter, einen gleichgültigen, erwartungslosen Blick aus dunklen Augen, deren Sehkraft von Jahr zu Jahr nachließ. Er begann, sich nach einem genau festgelegten Ablauf zu rasieren. Anschließend betrachtete er im Spiegel sein linkes Schulterblatt, die welke, verschrumpelte Haut, das an einigen Stellen durchscheinende schwarze Fleisch, schmierte sich eine Creme darauf und verrieb sie mit gleichmäßigen Bewegungen, um danach umständlich einen Verband mit zwei langen Pflastern zu fixieren.
Nachdem er sich angezogen hatte, stellte er sich erneut vor den Spiegel. Ein fremder Mann blickte ihn nun an, in Anzug und weißem Hemd. Allein die millimeterkurz geschnittenen Haare waren ihm vertraut. Er nahm eine kleine Flasche aus der Schublade unter dem Küchentisch, ließ zwei Tropfen auf seine Handinnenfläche fallen und verteilte sie auf Wangen und Hals.
Streich sah auf seine Uhr. Er war spät dran.
Der Artikel
Alfons »Ali« Ferch hatte große Geschicklichkeit darin entwickelt, nicht nur das Fehlen seines linken Armes zu kaschieren, sondern auch fast alle Tätigkeiten, für die andere Menschen beide Arme und Hände benötigen, mit einer zu bewerkstelligen. Ob das Binden seiner Schuhe, das Zubereiten seines Frühstücks oder das Zusammenschnüren der am Tag nicht verkauften Zeitungen und Zeitschriften zu gut tragbaren Bündeln, er brauchte dazu kaum mehr Zeit als ein Gesunder. Und ohne seinen fehlenden Arm, den ihm ein russischer Granatsplitter ein Jahr vor Kriegsende nahe Minsk abgetrennt hatte, womit für ihn der Fronteinsatz Geschichte war, hätte er auch nicht die Konzession zum Betreiben seines Wasserhäuschens erhalten. Kriegsversehrte hatten bevorzugt diese begehrten Arbeitsplätze bekommen, die zwar einen langen Tag bedeuteten, dafür aber ein sicheres, wenn auch mäßiges Einkommen, das Ali sich zudem mit der einen oder anderen »Gefälligkeit«, wie er es nannte, aufbesserte.
Streich war seit einem Jahr Kunde in seiner »Hütte«. Er kam zwei, drei Mal die Woche, versorgte sich mit Zigaretten und Bier, dann und wann mit Schnaps oder Wermut, blieb ansonsten aber wortkarg. Mit der Zeit hatte Ali mitbekommen, dass Streich am ersten Mittwoch des Monats pünktlich um neunzehn Uhr bei ihm vorbeikam, besser gekleidet als gewöhnlich, frisch rasiert und nach Parfüm duftend, um eine Zigarre zu kaufen. Wohin er so zurechtgemacht ging, darüber hatte Streich nie ein Wort verloren. Und Ali hatte nie danach gefragt.
Heute allerdings war er über die Zeit. Ali begann, die nicht verkauften Tageszeitungen zu bündeln. Morgens früh legte der Auslieferungsfahrer die neuen Zeitungen neben die Tür an der Rückseite und nahm die alten mit.
Ali, der seinen Kopf stets mit einer grauen Schiebermütze bedeckte, warf einen Blick durch das Ausgabefenster nach draußen. Der rote Rudi war noch da, Stehkunde, ein Politischer, dem sie unter Hitler übel mitgespielt hatten und der seitdem hinkte und auf einem Auge nichts mehr sah, ein wahrer Hefkopp, wie sie hier die Vieltrinker nannten. Jeden Tag gegen zwei kam er in sein »Wohnzimmer«, wie er sagte, und ging um acht, verlässlich wie das Amen in der Kirche, mit der er schon lange nichts mehr am Hut hatte. Auf der anderen Seite waren noch zwei von denen, die stundenlang stumm beisammenstanden, unterbrochen nur von einem gelegentlichen »Prost!«.
Ali hatte das vorletzte Bündel mit einer Hand zusammengeschnürt und wollte gerade die letzten Zeitungen von der hölzernen Ablage nehmen, die sich von der Front um beide Ecken zog, da stand Streich plötzlich vor ihm, in eine der Zeitungen vertieft. Er betrachtete konzentriert das Foto auf der Titelseite.
»In Frankfurt«, erklärte Ali aufrichtig entrüstet und schob seine Mütze ein kleines Stück nach hinten. »Einfach weggebombt. Mitten in der Stadt. Wie in Amerika.«
Streich erwiderte nichts, sah nicht einmal auf, überflog den Artikel in der Neuen Presse, hielt ihn nahe vor seine Augen.
Ali beobachtete ihn beim Lesen. »Brauchst du ’ne Brille?«
Streich knurrte etwas Unverständliches.
»Ein Waffenhändler. Muss man sich mal vorstellen! Einfach in die Luft gejagt.«
Nun blickte Streich doch kurz auf, nickte beiläufig und besah sich noch einmal das Foto, auf dem die linke Seite eines Mercedes abgelichtet war, der Kotflügel abgerissen, die Fahrertür in der Angel hängend, eine Decke verhüllte den Fahrersitz, der hintere Reifen platt. Der Wagen war das gleiche Modell, wie es Bommel fuhr, auch die Farbe schien Streich ähnlich zu sein. Zumindest sah es auf der Schwarz-Weiß-Abbildung so aus. In diesem Wagen explodierte die Bombe, war es untertitelt.
»In der Guiollettstraße«, plapperte Ali weiter. Ihn störte es nicht, dass Streich noch immer schwieg und nicht auf seine Erklärungen reagierte. »Georg Puchert soll der heißen.« Er nahm jetzt die restlichen Zeitungen von der Auslage, wartete, bis ihm Streich das Exemplar mit dem Foto reichte, und legte sie auf den anderen Stapel.
Zurück an der Ausgabe hielt er die Zigarre für Streich in der Hand. Der kramte in seiner Hosentasche, zählte ein paar Münzen ab und legte sie auf die Auslage.
Ali steckte das Geld ein und beugte sich ein Stück vor. Der rote Rudi stand noch immer abseits und stützte sich mit einer Hand am Kiosk ab. Ali senkte seine Stimme. »Ich habe wieder Ware. Morris. Eine Stange, wie immer?«
»Morgen«, antwortete Streich lakonisch, steckte die Zigarre in die Innentasche seines Jacketts und wollte losgehen.
»Moment!«, hielt ihn Ali auf, was er noch nie gemacht hatte. Er sah noch einmal nach dem Politischen und den beiden anderen Männern, dann sagte er leise: »Da waren Leute, die haben nach dir gefragt.«
»Nach mir?« Ein klein wenig Interesse lag nun in Streichs Stimme.
»Deinen Namen haben die nicht genannt, aber die Beschreibung passt auf dich. Wollten wissen, wo du wohnst. Was du so machst …«
»Polizei?«
Ali schüttelte den Kopf. »Glaub ich nicht. Sahen die nicht nach aus.«
Plötzlich stand der rote Rudi neben Streich. »Ein Bier, Ali!« Dabei wedelte er ungeduldig mit seiner leeren Flasche. »Ein letztes.« Er machte eine Pause. »Für heute.«
Ali reichte ihm eine Flasche und wartete, bis der rote Rudi sich wieder in seine Ecke zurückgezogen hatte.
»Wie sahen die aus?«
»Die nach dir gefragt haben?« Ali überlegte. »Waren zwei. Dunkle Anzüge. Kräftig. Sehr ernst. Der eine eher groß. Der andere blieb im Hintergrund. Hatte so eine Narbe im Gesicht.« Er deutete die Stelle auf seiner Wange an. »Hast du Ärger?«
Streich zuckte mit den Schultern. »Was hast du denen gesagt?«
»Ich? Nichts habe ich denen gesagt. Wie käme ich dazu? Nur, dass die Beschreibung auf mindestens zehn meiner Kunden passt.« Er grinste verschwörerisch.
»Und die sind dann einfach so wieder gegangen?«
»Einfach so«, bestätigte Ali und ließ Streich dabei nicht aus den Augen, hoffte wohl auf eine verräterische Mimik. Doch da konnte er bei Streich lange warten.
Das Foto
Gesine Kreutzer, die sich stets als Gilla vorstellte, sodass kaum jemand ihren Taufnamen wusste, saß auf dem Rand ihres französischen Betts und blickte zum Wecker auf dem Nachttisch. Das rote Licht hatte sie schon vor einer Weile ausgeschaltet, sie wusste ja, dass er das nicht mochte. Wie er viele Eigenheiten hatte, die sie nicht infrage stellte und deren Ursprung sie nicht kannte. Das stand ihr auch nicht zu, aber sie wusste aus ihrer inzwischen mehrjährigen Berufserfahrung, dass Streich zu den besseren Kunden zählte. Weniger in finanzieller Hinsicht, obwohl er nie versucht hatte, den Preis runterzuhandeln. Aber er hatte sie nie schlecht behandelt, nicht mit Problemen behelligt, wie das so viele andere Freier taten, sei es, dass sie Absolution suchten, weil zu Hause die Ehefrau auf sie wartete, sei es, dass es einsame Kerle waren, denen letztlich mehr am Reden als am Bumsen lag. Viele Kriegsheimkehrer waren darunter, arme Teufel, lange in Gefangenschaft gewesen, die, endlich daheim, feststellen mussten, dass die Familie tot oder die Frau schon mit einem anderen Mann verheiratet war. Oder die sich nicht mehr ins Zivilleben einfinden konnten, zum Fremdkörper in ihrer Familie geworden waren und bei denen früher oder später die Ehe zerbrach. Wie sie selbst zerbrachen. Strandgut des Krieges. Wer nicht blind war, konnte sie auch jetzt, vierzehn Jahre danach, noch überall sehen.
Streich war Soldat, das spürte sie, das roch sie, Soldaten, egal wie lange sie es schon nicht mehr waren, hatten einen bestimmten Geruch. In seinem lagen Härte und Verschlossenheit, wie bei den anderen, und doch noch etwas anderes. Sie konnte es nicht benennen, und ihn darauf anzusprechen, wagte sie nicht. So, wie es war und wie sie sich begegneten, jeden ersten Mittwoch im Monat, pünktlich um acht, war es gut. Er hatte sie auch nie, wie es viele andere Freier taten, gefragt, warum sie ihre Haare nicht färbte. Blond zum Beispiel. Wie die Nitribitt. Oder eine Perücke trug. Sie lachte dann, behauptete, eine Hexe zu sein, und fuhr sich mit beiden Händen durch ihre dicken, schulterlangen dunkelroten Haare. Meistens war die Sache damit erledigt.
Inzwischen war er zehn Minuten über die Zeit. Gilla machte sich Sorgen. Hatte Drei-Finger-Diether es doch nicht nur bei der Warnung an sie belassen, wegen der Sache vor vier Wochen? Warum hatte Streich sich da auch eingemischt?
Unruhig sah sie nochmals zum Wecker hinüber. Eine Viertelstunde zu spät. Wie lange sollte sie noch warten? Seit er sie vor einem Jahr zum ersten Mal besucht hatte, hatte er jeden Termin pünktlich wahrgenommen.
Unschlüssig stand sie auf. In dem Spiegel an der Wand inspizierte sie ihr Gesicht, die kleinen Fältchen, die sich seit einiger Zeit an ihren Augen zeigten. Krähenfüße, wie eine Kollegin sie vor ein paar Tagen genannt hatte. Mit einem Hauch Verachtung, aber Gilla war nicht verletzt gewesen. Früher oder später traf es sie alle, und junges Aussehen war nicht alles, auch nicht in ihrem Beruf. Mit Schaudern dachte sie an die Nitribitt, die Bilder in der Zeitung vor zwei Jahren. Vierundzwanzig war die. Jung. Schön. Blond. Aber wer hoch fliegt …
Sie hatte gerade die Puderquaste in die Hand genommen, als es klopfte. Zweimal kurz, dreimal lang. Streich!
Schnell legte sie die Quaste zur Seite und trippelte zum Bett, rief wie immer »Ist offen!«, da öffnete er bereits die Tür, nickte ihr zu. Sie lächelte. Musste nicht spielen.
»Guten Abend!«, begrüßte sie ihn.
»Entschuldigung«, erwiderte er ernst wie immer, »mir ist was dazwischengekommen.«
»Ich habe mir schon Sorgen gemacht«, antwortete sie im Aufstehen und versuchte, ihren Worten einen ironischen Tonfall zu geben.
Er reagierte mit einer kurzen Handbewegung.
Sie stellte sich hinter ihn und nahm ihm das Jackett ab, wie sie es immer machte. »Gut riechst du«, sagte sie, während sie es auf dem Stuhl neben der Tür ablegte.
Ihre Begegnungen liefen stets gleich ab, sie tauschten Belanglosigkeiten aus, sie zog ihm Hemd und Unterhemd aus, achtete dabei darauf, dass er die linke Schulter nicht allzu sehr verrenken musste, und streichelte wie beiläufig über die Stelle, die Streich in seiner Küche mit dem Verband bedeckt hatte.
»Das musst du wegen mir nicht machen. Das macht mir nichts aus«, sagte Gilla. Sie log, und er wusste das. Bei ihrer ersten Begegnung war sie beim Anblick der verbrannten Haut erschrocken, weil in ihrem Kopf mit einem Mal die Bilder aus dem Krieg aufflackerten. Bilder von den Nächten im Keller während der Bombenangriffe, von dem Einschlag ganz in der Nähe und den Menschen, die wie Fackeln durch die Straßen irrten und schrien. Sie hatte in einem Krankenhaus helfen müssen, in das die Verletzten und Verbrannten eingeliefert wurden. Den Geruch würde sie nie vergessen, er hatte sich in ihre Nase hineingefressen. Und als sie dann das erste Mal die Verbrennung an Streichs Schulter sah, war da sofort wieder dieser Geruch von verbranntem Fleisch, wie damals. Sie hatte keine Ahnung, ob er mitbekommen hatte, wie sehr sie den Würgereiz unterdrücken musste, aber seitdem trug er bei jedem Besuch diesen Verband.
Nackt legte sich Streich aufs Bett und sah Gilla beim Ausziehen zu. Da Streich nie viel sprach, musste sie seine Vorlieben nach und nach erraten. Doch dieser Moment gehörte eindeutig dazu, und die Erregung, die es in ihm auslöste, war nicht zu übersehen. Sie mochte seinen noch straffen und muskulösen Körper. Die meisten ihrer Kunden waren stolz auf ihre »Wohlstandsbäuche«, wie sie es nannten, sichtbares Zeichen, dass sie es zu etwas gebracht hatten.
Beim Sex hielt Streich seine Augen geschlossen. Sie hätte gerne gewusst, an was er dabei dachte, wen er sich vorstellte, welcher Film hinter seinen Lidern ablief. Denn Gilla schien es auch an diesem Tag wieder so, als leide er mehr, als dass er Lust verspürte. Sein Stöhnen hatte etwas Schmerzvolles. Dabei könnte er ein guter Liebhaber sein, hatte sie schon beim ersten Mal gedacht.
Danach lagen sie noch nebeneinander, wie immer, sie rauchte zwei Zigaretten, er seine Zigarre. Sie mochte den Geruch nicht, aber bei ihm machte sie eine Ausnahme. Sie würde lange lüften, wenn er gegangen war.
»Drei-Finger-Diether hat dich gesucht«, bemerkte Gilla, nachdem Streich ihr die zweite Zigarette angezündet hatte.
Nur seine Augen bewegten sich zu ihr.
»Drei-Finger-Diether«, wiederholte sie nach zwei weiteren Zügen an ihrer Zigarette. »Er mag es nicht, wenn jemand seine Arbeit übernimmt.«
»Idiot!«, spuckte Streich aus.
»Ich soll dir sagen, dass du dich nicht in seine Angelegenheiten einmischen sollst. Er beschützt seine Mädchen.«
Streich paffte gleichgültig an der Zigarre.
Beim letzten Besuch im Bordell waren aus einem anderen Zimmer auf dem Gang laute Schreie zu hören gewesen, ein Freier hatte sein Mädchen geprügelt. Streich hatte schnell seine Hose übergestreift und war dann rübergegangen, um den Kerl mit zwei Schlägen ruhigzustellen. Zurück bei Gilla hatte er nicht mehr auf das Gejammer des Freiers und das Gezeter des Mädchens geachtet, nur noch einmal an seiner Zigarre gezogen, sich angezogen und war dann gegangen. Draußen auf der Straße hatte er sich ein paar Meter weiter in den Schatten eines Hauseingangs gestellt, sich eine Morris angesteckt und wurde so Zeuge, wie der Kerl wenig später herauskam und zu einem parkenden Wagen lief. Ihm folgte ein zweiter Mann, der sich umsah, bis er den startenden Motor hörte, doch er schaffte es nur noch zu einem Tritt gegen den hinteren Kotflügel und ein paar hinterhergeschickten Flüchen. Streich hatte er nicht bemerkt. Der wusste sich unsichtbar zu machen.
»Pass auf!« Aufrichtige Sorge lag in Gillas Worten.
Streich drückte den Rest der Zigarre im Aschenbecher auf dem Nachttisch aus. Beim Anziehen trat er versehentlich seinen rechten Schuh unter das Bett.
Gilla machte Anstalten, sich niederzuknien, doch Streich war schneller, legte sich auf den Bauch, robbte ein Stück vor, streckte seinen rechten Arm in den schmalen Spalt zwischen Bettgestell und Boden, fuhr hin und her und bekam dann statt des Schuhs einen Bilderrahmen zu fassen.
Ohne Absicht warf er einen Blick auf das Bild darin. Darauf war Gilla zu sehen, einige Jahre jünger, aber eindeutig zu erkennen, und vor ihr, auf einem Tisch, hockte ein kleines Kind, nicht älter als zwei oder drei Jahre, auf dessen Schultern sie beide Hände gelegt hatte. Die Zärtlichkeit, die diese Geste ausstrahlte, war nicht zu übersehen.
Gilla beobachtete ihn unruhig, machte zwei schnelle Schritte auf ihn zu und riss ihm den Rahmen aus der Hand. Streich, zu überrascht, um gleich zu reagieren, sah sie verwundert an, als sie sich wegdrehte und das Bild gegen ihre Brust drückte.
»Was ist …? Entschuldigung«, stammelte Streich, leiser, als er für gewöhnlich sprach.
Ohne sich umzudrehen, das Bild noch immer am Körper, sagte Gilla nur: »Meine Nichte«, und legte den Rahmen mit dem Bild nach unten auf die Ablage am Waschbecken. Dann drehte sie sich hastig um, nahm Streichs Jackett vom Stuhl und half ihm beim Anziehen.
»Was ist mit dem Kind?« Streich fragte und wollte gleich abwiegeln.
Sie wich seinem Blick aus und zögerte einen Moment. »Marlene … tot«, antwortete Gilla. »Noch keine drei. Ich selbst kann keine Kinder bekommen.« Sie schwiegen. »Meine Schwester ist gestorben. Ich habe die Kleine bei mir …« Tränen stiegen ihr in die Augen. Schnell eilte sie zur Tür und hielt sie Streich auf, noch immer, ohne ihn anzuschauen.
Das Treppenhaus war schwach beleuchtet, das wenige Licht wurde von den dunklen Tapeten aufgesaugt. Drei-Finger-Diether hatte er da schon wieder vergessen, nicht aber die letzten Minuten in Gillas Zimmer. Sie hatten etwas zwischen ihnen verändert.
Alte Kameraden
Die Straßen im Bahnhofsviertel waren um diese Uhrzeit noch gut besucht. Man flanierte, blieb vor den Auslagen der Geschäfte stehen. Ein Kürschner, Pelze im Schaufenster, ein Juwelier, seine Uhren und Ringe während der Nacht sicher im Tresor verwahrt, wie ein Schild mit feiner Schrift verriet. Fotos warben während der Nacht für die wertvollen Stücke, ein modern und kühl eingerichteter Friseursalon zog mit einem chrombeladenen Motorroller die Aufmerksamkeit auf sich. Bei seinem letzten Besuch in der Stadt, im Herbst 1944, kurz bevor er an die Front zurückmusste und bald darauf in Gefangenschaft geriet, war hier nachts nichts zu sehen. Die Verdunklungsanordnung verbot jedes Licht nach der Dämmerung. Dabei war die Stadt schon zerstört. Streich konnte auch nach einem Jahr in Frankfurt diese so verschiedenen Bilder nicht zusammenbringen. Kaum etwas erinnerte noch an den Krieg. Wie auch die Menschen redeten, als habe es nie einen Krieg gegeben. Und deshalb auch mit einem wie ihm nichts zu tun haben wollten.
Er steckte sich eine Zigarette an und ließ sich vom Strom der Passanten zwischen den vom Krieg verschonten Gründerzeitbauten weiter in Richtung Bahnhof mittreiben. Ein Volkswagen versperrte eine Ausfahrt, der Mann im Ford Taunus, den das behinderte, hupte. Eine Stimme rief: »Tolles Weihnachtsgeschenk!« Jemand anderes lachte.
Nach dem Besuch bei Gilla ging Streich zu Franz Jung. Der betrieb in einer Seitenstraße hinter dem Bahnhof einen Boxclub. Ihm hatte er die Arbeit bei Bommel zu verdanken. Warum der Dickwanst das gemacht hatte, verriet Jung ihm nicht, Streich nahm an, dass Bommel einige Leichen im Keller liegen hatte, von denen Jung wusste.
Hinter dem Bahnhof wurde es ruhiger, hier standen noch immer zerstörte und ausgebrannte Häuser. Es roch feucht und nach Urin. Streich steckte sich eine weitere Morris an und drehte sich zum Anzünden gegen eine Wand. Plötzlich stand jemand vor ihm, versperrte ihm den Weg.
»Tschuldigung!«
Ein Nuscheln, kaum verständlich. Streich glaubte an einen Überfall, packte die Person am Kragen, drückte sie gegen die Mauer des Bahnhofgebäudes und zog sie dann ein Stück mit sich zur Seite, in den Schein einer Straßenlaterne. Ein dürres Kerlchen starrte ihn ängstlich an. Streich kannte das Gesicht, konnte es aber nicht zuordnen.
»Franz schickt mich«, erklärte das Kerlchen eingeschüchtert. »Ich soll Ihnen sagen, dass Sie heute nicht in den Club kommen sollen.«
Streich blickte sich um. Ein Pärchen hastete an ihnen vorbei, warf nur einen kurzen Blick auf sie, wollte in keinen Ärger hineingezogen werden. Man hörte ja so einiges von der Bahnhofsgegend.
Er ließ den Jungen los. Auf neunzehn oder zwanzig schätzte er ihn, ein Fliegengewicht. Höchstens Bantam.
»Wie heißt du?«
»Alle sagen Max zu mir.«
Streich nickte. Max ging einen Schritt zur Seite, aus dem Lichtschein der Laterne heraus.
»Also!«, forderte Streich ihn auf, doch Max blickte ihn verständnislos an. »Warum soll ich nicht kommen?« Streich klang streng.
»Zwei Männer waren da, in dunklen Anzügen. Die haben nach Ihnen gefragt.«
»Was wollten die?« Streich warf seine aufgerauchte Zigarette auf den Boden, nahm gleich wieder die Packung aus der Tasche, klopfte gegen den Boden, hielt Max die herausgerutschte Kippe entgegen.
Fast erschrocken lehnte der ab. »Bin Sportler.«
Streich kommentierte das nicht, zündete seine Zigarette an, inhalierte tief.
»Also!«
»Ich weiß es nicht. Franz hat mir gesagt, dass ich hier auf Sie warten soll. Sie kommen doch immer hier vorbei. Am ersten Mittwoch, hat er gesagt. Und ich soll Ihnen sagen, dass da diese Männer waren.«
Streich überlegte einen Moment, zog an seiner Morris.
»Haben die einen Namen genannt?« Streich wusste die Antwort, dennoch war es besser, die Frage zu stellen. Eine Erfahrung aus unzähligen Verhören.
»Nein. Davon hat Franz nichts gesagt. Nur, dass die einen Akzent hatten.«
»Einen Akzent?«
Max nickte schnell, sagte aber nichts. Mit einer ungeduldigen Handbewegung forderte Streich ihn auf, konkreter zu werden.
»Französisch.« Er zögerte. »Vielleicht.«
Streich überlegte. Das passte nicht. Warum sollten die Schläger mit französischem Akzent engagieren, um das Geld einzutreiben?
»Sind die noch da?«
In dem Moment entdeckte Streich den Schatten, hinter einem Auto, vielleicht dreißig Meter entfernt. Er stieß Max zur Seite, warf die Kippe weg und rannte los. Der Schatten löste sich vom Auto, öffnete die hintere Tür und sprang hinein. Mit einem Ruck setzte sich der Wagen in Bewegung. Das Nummernschild konnte er nicht erkennen, nur, dass es ein Citroën war. Einer dieser Wagen, über die alle redeten. Er überlegte. DS. Ein französisches Auto, was hatte das zu bedeuten? Holte ihn seine Vergangenheit ein?
Die beiden Männer saßen in Franz Jungs kleinem, engem Büro. An der Wand Fotos und Auszeichnungen, in den Regalen Pokale. Streich bezweifelte, dass die alle redlich erworben waren. Ein Schreibtisch, schon arg verschlissen, drei Stühle. Ein Sofa, zwei Sessel, braun, durchgesessen. Eine nackte Glühbirne über ihnen spendete ein wenig Licht.
Jung war kleiner als Streich, gedrungener, trug eine Plauze vor sich her. Sein rundes Gesicht verlieh ihm etwas von einer Bulldogge.
Streich stand nahe vor der Wand und betrachtete eines der Bilder. Es zeigte eine Gruppe Soldaten, um eine Metallliege stehend, die meisten hatten eine Zigarette im Mundwinkel und ein Képi auf dem Kopf.
»Brauchst du eine Brille?«, fragte Jung, der einen blauen Sportanzug trug. Er lehnte mit seinem Hintern an der Schreibtischkante und beobachtete seinen Bekannten mit wachen Augen.
»Blödsinn!«, gab Streich gallig zurück. »Hast ja immer noch dieses Bild da hängen.«
»Ja, und? Was passiert ist, ist passiert. Und schon lange her. Es war alles in allem eine gute Zeit. Und wenn du nicht …«
»Lass das!« Streich drehte sich ruckartig um. »Das ist vorbei!«
»Wenn du meinst. Max, die Flasche!«, rief Jung. »Und Gläser.«
Max brachte eine Flasche mit grünlicher Flüssigkeit und schenkte ihnen ein. Streich bedankte sich bei ihm, wofür ihn der Junge freudig anlächelte.
»Zum Wohl!« Jung hob sein Glas, Streich stieß seines dagegen. »Chin-chin!«
Er behielt die Flüssigkeit lange im Mund, genoss.
»Absinth«, sagte er schließlich, nachdem er heruntergeschluckt hatte. »Wie lange habe ich keinen mehr getrunken.«
Jung lächelte und schenkte ihm nach. »Verstehe! Max war scheinbar nicht überzeugend genug. Aber ich hätte es wissen müssen. Die sind noch nicht lange weg.«
»Zwei Männer?«, fragte Streich.
Jung nickte. »Kräftig. Einer mit einer Narbe im Gesicht. Nicht zu übersehen. Und«, er nahm einen Schluck, ließ sich Zeit, »bewaffnet. Als der eine sich vorbeugte, konnte ich den Knauf im Schulterholster sehen.«
Streich nahm ebenfalls einen Schluck.
»Wollten wissen, was du so machst, wo du wohnst … Kontakte …«
Streich dachte kurz nach. Bommel wollte ihn anmelden, nach dem Einzug in die Wohnung. Hatte er wohl nicht gemacht. Wahrscheinlich um Geld zu sparen.
»Der Junge, der mich …«
»Max«, unterbrach ihn Jung.
»Ja, der hat was von französischem Akzent gesagt …«
»Oui.«
»Bekannte?«
Jung schüttelte seinen Kopf. »Keine von uns. Anderes Kaliber. Geheimdienst vielleicht.«
»Und sie haben nicht gesagt, was sie wollen?«
»Nein. Aber wenn du meine Einschätzung hören willst: Sei auf der Hut. Die sind gefährlich.«
Streich musste lächeln. »Das aus deinem Mund?! Du kennst doch unseren Wahlspruch: Légionnaire, démerde-toi!«
Jung blieb ernst, ging nicht darauf ein. »Dafür habe ich ein Gespür. Die spaßen nicht. Hast du was ausgefressen?«
Streich schüttelte den Kopf.
»Sei vorsichtig!« Mit dieser Aufforderung füllte Jung erneut die Gläser.
»Hast du Geldprobleme?«
Streich zuckte mit der Schulter.
»Hast du?« Jung ließ ihn nicht aus den Augen. »Die Pferde?«, fragte er, nachdem Streich weiter schwieg.
Der nickte nur.
»Wie viel?«
»Um die tausend«, antwortete Streich widerwillig.
Jung machte eine Geste des Erstaunens. »Tausend!? Mein lieber Herr Gesangsverein.«
»Pech gehabt.«
»Und von wem hast du das Geld?«
»Großmann!«
Jung pfiff durch die Zähne. »Mit dem ist nicht gut Kirschen essen.« Er fasste sich ans Ohrläppchen, dachte nach, Streich schwieg.
»Da kann ich dir nicht helfen, ich habe selbst nichts auf der Pfanne«, sagte er schließlich.
»Damit werde ich fertig. Irgendwas wird mir schon einfallen«, erwiderte Streich, klang dabei aber nicht überzeugend.
»Wenn du Hilfe brauchst … Ich meine, kein Geld … Wir beide sind ein gutes Team … Oder wenn ich dir einen kleinen Helfer besorgen kann …« Er lachte und formte mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand eine Pistole.
Streich ging nicht darauf ein. »Ich werde das klären«, stellte er kategorisch fest.
Jung nickte und schenkte ihre Gläser wieder voll.
In den Morgenstunden wankten sie in den Trainingsraum, in dem es wie immer nach einer Mischung aus Schweiß, Feuchtigkeit und Nikotin roch. Ein schwieriges Klima für sportlichen Erfolg.