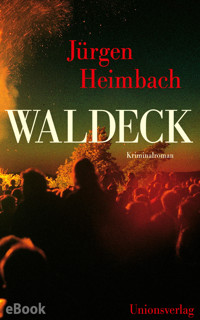
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Silvia will ausbrechen aus der biederen Welt ihres Vaters, in der sie nichts erwartet als die immer gleichen miefigen Tapeten. Als sie in seinen Unterlagen eine erschütternde Entdeckung macht, muss sie endgültig verschwinden. Es zieht sie auf das Waldeck-Festival, wo eine junge Generation mit Gitarren und Folksongs aufbegehrt: gegen den Starrsinn der Alten und die verbohrten Strukturen der Nachkriegszeit. Währenddessen wittert der in Ungnade gefallene Journalist Ferdinand Broich endlich eine neue Story: Eine Frau will einen ehemaligen SS-Arzt auf der Straße erkannt haben. Doch als Broich die Zeugin wenige Tage später aufsuchen will, ist die bereits tot. Eine gefährliche Suche nach der Wahrheit beginnt, in einem Deutschland, dessen dunkle Vergangenheit noch bedrohlich nahe ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Als Silvia in den Unterlagen ihres Vaters eine erschütternde Entdeckung macht, flieht sie auf das Waldeck-Festival, in das Aufbegehren einer neuen Generation gegen den Starrsinn der Nachkriegszeit. Gleichzeitig heftet sich der Journalist Ferdinand Broich auf die Fersen eines ehemaligen SS-Arztes. Eine gefährliche Suche nach der Wahrheit beginnt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jürgen Heimbach (*1961) studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Germanistik und Philosophie und arbeitet als Redakteur für 3sat. Sein Werk umfasst Romane, Jugendbücher und Kurzgeschichten. Sein Roman Die Rote Hand wurde 2020 mit dem Glauser-Preis für den besten Kriminalroman ausgezeichnet.
Zur Webseite von Jürgen Heimbach.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Englische Broschur, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jürgen Heimbach
Waldeck
Kriminalroman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: www.newsserver.at (Photocase)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31138-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 12.03.2024, 12:07h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
WALDECK
Burg Waldeck, 16. Mai 19648. Mai 19649. Mai 196410. Mai 196411. Mai 196412. Mai 196413. Mai 196414. Mai 196415. Mai 196416. Mai 1964Später im Jahr 1964NachwortNachweiseDankMehr über dieses Buch
Über Jürgen Heimbach
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jürgen Heimbach
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Geschichte
Für Tizian und Giovanna
Von Herzen Dank an Tom Schroeder
Für die wenigen, jedoch intensiven Momente
Tot sind unsre Lieder,
unsre alten Lieder.
Lehrer haben sie zerbissen,
Kurzbehoste sie verklampft,
braune Horden totgeschrien,
Stiefel in den Dreck gestampft
FRANZ JOSEF DEGENHARDT
»Die alten Lieder«
»Etonnez nous!«
DIETHART KREBS
in seiner Rede zur Eröffnung des ersten Waldeck-Festivals, Pfingsten 1964
Burg Waldeck, 16. Mai 1964
Die Nachmittagssonne stand schon tief über dem Gelände oberhalb der Burgruine Waldeck und betonte die Schönheit des Ortes. Das Grün der großen Wiese, die bewaldeten Berge ringsum, talabwärts die Reste der Burg, von der nur ein paar Mauern und der Turm zwischen den Baumwipfeln herausragten.
Die jungen Menschen, die auf der Wiese saßen und in kleinen Gruppen diskutierten, musizierten, rauchten oder vor einer der Bühnen den Sängerinnen und Sängern lauschten, genossen nach den kühleren Vortagen die wärmende Kraft der Strahlen. Für viele von ihnen fühlten sich diese Tage wie ein Aufbruch an, raus aus dem Leben der Eltern in ihr eigenes, ein besseres, das sie selbst bestimmen und gestalten wollten.
Edgar Winter hatte für diese Gammler, ihre Ideen und Sehnsüchte, ihre Diskussionen und ihre Musik nur Verachtung übrig. Aber er hatte seine Gefühle gut im Griff, dachte an das, was ihn hierhergeführt hatte, wen er suchte, vor allem, was er in seinen Besitz bringen musste. Die Blicke, die ihn in seinem fremd wirkenden Anzug und der Krawatte begleiteten und ihn wie ein Relikt aus einer anderen Zeit wirken ließen, ignorierte er.
Die Musik konnte er nicht ignorieren. Zeilen wie
Gestern Abend, plötzlich im Gewühl
Kam abhanden mir mein Nationalgefühl
die so und ähnlich überall gesungen wurden, fraßen sich gegen seinen Willen in ihm fest.
Gestern hatte er erfahren, dass sein altes Leben nicht mehr existierte. Er hatte schon mehrmals neu beginnen müssen, aber es hatte immer Konstanten gegeben. Seinen Beruf als Polizist, die Kollegen, auf die er sich verlassen konnte, vor allem seine Frau. Aber jetzt war nichts mehr davon übrig. Fünfhundert Kilometer von diesem Ort im Hunsrück, von dieser Wiese und der Burgruine entfernt war es erloschen.
Sein Suchen hatte ihn vor eine kleine, etwas abseits gelegene Bühne im Hang geführt, wo er einige Momente zuhörte, sich dann zurückzog. Er setzte sich auf einen Holzstumpf, vor sich die immer wieder applaudierenden, manche Stellen mitsingenden Zuhörer, von ihnen verdeckt die Sängerin.
Ihre Stimme zog ihn gegen seinen Willen an.
Dabei achtete er gar nicht so genau auf den Text, nur Fetzen davon drangen in sein Bewusstsein. Black and White, Namen amerikanischer Orte, Birmingham, Alabama, oder Briefträger und Eisenbahnzug.
Es war die Klarheit, die Unbedingtheit in der Stimme der Sängerin, die ihn lockten, die ihm für diesen Moment so etwas wie Trost spendeten und vergessen ließen, was in den letzten Tagen geschehen war.
Er hatte seine Augen geschlossen, um sich der Stimme zu überlassen.
Es war ihm, als singe sie nur für ihn.
Und er starb ganz allein
Und er bleibt nicht allein!
Als das Publikum zu applaudieren begann, öffnete er die Augen. Und da stand sie, nicht weit von ihm. Sie erschrak. Nicht vor ihm, ihn hatte sie nicht angeschaut. Ihr Blick richtete sich auf ein Paar, das etwas abseits saß und sich hemmungslos küsste. Aufgeregt sprach sie mit einer jungen Frau neben sich, kurz nur, was Winter dennoch nicht entging. Dann sah er, wie sie sich abrupt umdrehte und davonrannte, die Stufen hinauf zur Wiese.
Winter erhob sich. Er hatte sie gefunden.
8. Mai 1964
Durch die große Eingangshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs drängten sich die Menschen dem Feierabend entgegen. Eine kühle Feuchtigkeit vom Regen der vergangenen Tage lag in der Luft und beschleunigte ihre Schritte. Wie konturlose Schemen nahm Ferdinand Broich sie durch die beschlagene Glastür der Telefonzelle wahr.
»Wie? Er ist nicht im Büro? Er hat mir ausrichten lassen, dass ich ihn heute Nachmittag anrufen soll!«
Er kniff die Lippen zusammen und verfluchte alle Zeitungsredakteure dieser Welt. Er kam sich wie ein Bittsteller vor.
»Wann ist er denn zu erreichen?«
Er wurde lauter. »Das können Sie nicht sagen? Sie müssen doch wissen, wann Ihr Chef zu sprechen ist … Wir haben vereinbart … Ich habe die Geschichte …« Er drückte den Hörer noch fester an sein Ohr. »Hallo? … Hallo?«
Er lauschte noch einen Moment in den Hörer, dann knallte er ihn wütend auf die Gabel.
Frustriert verließ Ferdinand die Telefonzelle. Seit fünf Jahren schlug er sich als Journalist durch. Freischaffend. Mehr schlecht als recht. Doch nun war es nur noch schlecht, nachdem man ihn, dessen war er sich inzwischen sicher, aufs Kreuz gelegt hatte. Zu Beginn seiner journalistischen Arbeit hatte er über die Machenschaften einer französischen Geheimorganisation namens »Die Rote Hand« geschrieben, die Unterstützer der algerischen Befreiungsbewegung einschüchterte, bedrohte und nötigenfalls auch ermordete. Nachdem dieser Krieg 1962 zu Ende war, begann er über ehemalige Nazigrößen zu recherchieren, die heute unbehelligt in Deutschland lebten. Politiker, Wirtschaftskapitäne, wie man die Herren nannte, Ärzte, Juristen, Hochschullehrer. Freunde hatte er sich damit nicht gemacht. Unlängst hatte er einen Regierungsrat beschuldigt, als Marinerichter noch in den letzten Kriegstagen Todesurteile verhängt zu haben. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Seine Reputation war dahin, und in den Redaktionen ging man auf Distanz zu ihm. Die Unterlagen, die ihm zugespielt worden waren, waren gefälscht und er überzeugt, Opfer einer Intrige geworden zu sein, um ihn und seine Arbeit zu diskreditieren.
In Frankfurt hatte er daraufhin nicht einmal mehr eine Akkreditierung für den Prozess gegen Wachmannschaften des Konzentrationslagers Auschwitz bekommen. Wie ein Gnadenbrot erschien ihm der Auftrag des Chefredakteurs einer Frankfurter Tageszeitung, ein Porträt über Kurt Oeser zu schreiben, einen jungen Pfarrer, der in der Ostermarschbewegung engagiert war. Weil er so gut wie pleite war, hatte Ferdinand den Auftrag angenommen, bis heute jedoch noch keine Zeile zu Papier gebracht. Hinzu kam, dass er vor zwei Wochen die Kündigung für seine Wohnung erhalten hatte. In vier Wochen musste er ausziehen. Ohne Nachweis eines regelmäßigen Einkommens würde er keine neue Bleibe finden und auf der Straße stehen.
Doch jetzt gab es Hoffnung auf einen Neuanfang. Eine Frau aus München, Überlebende des Holocaust, wie sie sagte, hatte ihn angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie einen Zahnarzt aus Lublin-Majdanek erkannt habe, der in der Stadt lebe und unter neuem Namen praktiziere. Sie wolle, dass Ferdinand dem nachgehe, darüber schreibe und es öffentlich mache.
Zweimal hatte er mit der Frau telefoniert, sie bestand darauf, dass er zu ihr nach München kam. Ferdinand hatte aus der Sache mit dem Regierungsrat gelernt und sich an einen Historiker und Anwalt gewandt, dessen Namen ihm im Zusammenhang mit den Gerichtsverhandlungen um die Wiedergutmachung von Opfern der Nationalsozialisten aufgefallen war.
Der Mann hatte ein Lokal in Sachsenhausen als Treffpunkt vorgeschlagen.
Jetzt saß er in seinem Wagen, einem Renault Dauphine, den er einem Kollegen abgekauft hatte, als es ihm finanziell noch besser ging. Er kauerte hinter dem Lenkrad und starrte auf den Eingang des Lokals auf der anderen Straßenseite. Vor fünf Jahren war er schon einmal hier gewesen. Mit dem ehemaligen Fremdenlegionär Arnolt Streich hatte er überlegt, wie sie ein kleines Mädchen vor den Nachstellungen der »Roten Hand« schützen konnten, weil sie Zeugin eines Anschlags geworden war. Das Mädchen konnten sie retten, aber Streich war anschließend tot, erschossen, und auch er hatte einen Schuss ins Bein abbekommen. Es kam Ferdinand wie gestern vor, die Erinnerung an diesen Menschen war noch völlig klar, an den schweigsamen Mann, der in mehreren Kriegen gekämpft, der Menschen getötet hatte. Seitdem hatte Ferdinand Albträume, die stets damit endeten, dass ihm jemand ins Gesicht schoss.
Als er das Lokal endlich betrat, empfing ihn lautes Gerede, dichter Zigarettenqualm und dröhnende Musik. »Rote Lippen soll man küssen« dröhnte es aus der Musikbox, die schräg gegenüber dem Eingang stand und von einer Gruppe junger Männer und Frauen umlagert wurde. So laut und voll war es hier vor fünf Jahren nicht gewesen. Er fragte sich, ob er am richtigen Treffpunkt war. Der lange Tresen links von der Musikbox war dicht besetzt. Am hinteren Ende saß ein korpulenter Mann, der eine große, fast quadratische Hornbrille trug, das dichte Haar war zurückgekämmt. Er nickte Ferdinand zu.
»Dr. Martin Rudnik?« Er schätzte den Mann auf etwa sechzig Jahre. »Ferdinand Broich«, stellte er sich vor. »Entschuldigung, der Verkehr.«
Dr. Rudnik griff nach dem Glas, das vor ihm auf dem Tresen stand, und gab Ferdinand mit dem Kopf ein Zeichen, ihm zu folgen. Wie ein Wellenbrecher schob der Mann seinen massigen Körper durch die zwischen den Tischen stehenden Menschen hindurch. Ferdinand folgte knapp hinter ihm. Ein Paar bewegte sich rhythmisch auf engstem Raum zu Tanze mit mir in den Morgen.
Neben der Tür zu den Toiletten fanden sie einen freien Tisch.
Dr. Rudnik bemerkte Ferdinands Blick. »Würde Sie hier in dem Lokal jemand vermuten?«, fragte er und nahm Platz.
Der Wirt, ein kantiger Kerl mit Ringerohren, stand am Nebentisch und sah jetzt zu ihnen herüber. »Wie immer Stöffsche, Herr Doktor?«
»Gerne!« Dr. Rudnik blickte Ferdinand, der sich ihm gegenüber niedergelassen hatte, fragend an.
»Für mich ein Pils«, sagte er an den Wirt gewandt. »Das können Sie trinken?« Ferdinand verzog angewidert das Gesicht.
»Habe ich mit der Muttermilch aufgesogen«, erwiderte Dr. Rudnik.
»Werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich hab’s versucht, als ich nach Frankfurt kam, aber nein, es geht einfach nicht«, entgegnete Ferdinand, wartete, bis der Wirt mit dem Bier und dem Apfelwein zurückkam, und prostete seinem Gegenüber mit einer kaum merklichen Geste zu.
»Es läuft bei Ihnen nicht gut?« Obwohl Dr. Rudnik es wie eine Frage hatte klingen lassen, war es eine Feststellung. Er blickte dabei kurz auf Ferdinands blaues Jackett.
»Ja, habe schon bessere Zeiten gehabt.« Er strich sich übers Revers.
»Die Sache mit dem Regierungsrat?«
Ferdinand nickte. »Ex-Marinerichter. Ja. Spricht sich wohl rum.«
»Natürlich«, erwiderte der Anwalt knapp. Er nahm sein Glas, leerte es in einem Zug, gab dem Wirt ein Zeichen. »Ich habe Ihre Artikel mit großem Interesse gelesen. Warum sind Sie nicht schon früher zu mir gekommen? Dann wäre das mit dem Regierungsrat nicht passiert.«
Ferdinand nahm nun auch einen Schluck. »Eine Falle, da bin ich mir inzwischen sicher.«
Dr. Rudnik verzog seinen Mund. »Eine effiziente Art, Sie zum Schweigen zu bringen. Fürwahr.« Er lachte.
Ferdinand wusste nicht, was er von dem Mann halten sollte.
Der Wirt kam mit dem nächsten Glas Apfelwein, stellte einen Aschenbecher auf den Tisch, was Dr. Rudnik zum Anlass nahm, ein silbernes Zigarettenetui aus seiner Jacketttasche zu nehmen. Er hielt es Ferdinand entgegen. Der lehnte ab.
»Am Telefon haben Sie von einer Majdanek-Überlebenden gesprochen, die Sie kontaktiert hat«, kam Dr. Rudnik nun direkt auf den Grund ihres Treffens zu sprechen.
»Ja«, bestätigte Ferdinand. »Vor ein paar Tagen. Die Frau stellte sich als Ruth Lachmann vor. Sie war in Auschwitz und Majdanek und in anderen Konzentrationslagern. Wohnt in München und hat einen gewissen Gernot Tromnau wiedererkannt. Haben Sie den Namen schon mal gehört?«, fragte er.
Dr. Rudnik ging nicht auf die Frage ein, stattdessen zündete er sich eine Zigarette an und inhalierte tief. »Mich würde zunächst interessieren, wie der Kontakt zustande kam.«
»Frau Lachmann hat meinen Namen aus der Presse.«
»Ich meine«, konkretisierte Dr. Rudnik seine Frage, »warum Sie.« Er hob kurz die Augenbrauen. »Ohne despektierlich sein zu wollen. Sie hätte sich auch an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei wenden können.«
»Sie fürchtet, dass von deren Seite kein Interesse vorhanden ist, dem nachzugehen. Sie glaubt, wenn die Presse darüber berichtet, wird sich automatisch die Staatsanwaltschaft einschalten.«
»Ihr Misstrauen ist verständlich!«, kommentierte Dr. Rudnik und leerte sein Glas erneut in einem Zug.
Ferdinand wunderte sich, wie schnell der Mann trank. »Dieser Tromnau lebt ganz unbehelligt in München und führt dort seit fast zwanzig Jahren eine Praxis.«
»Und Sie?« Dr. Rudnik hob sein Glas über den Kopf, gab dem Wirt damit das Zeichen für ein weiteres. »Ja, Sie, Herr Broich. Was erhoffen Sie sich?«
Ferdinand spürte den durchdringenden Blick hinter seiner Brille. »Frau Lachmann Gerechtigkeit zukommen zu lassen und …«
»Und?«
»Ich will wieder arbeiten, Artikel schreiben, neue Aufträge.« Er ließ sich einen Moment Zeit. »Ich muss sehen, wo ich bleibe …«
»Finden Sie nicht, dass das ein zynischer Gedanke ist …«
Der Journalist schaute verständnislos auf sein Gegenüber.
»Frau Lachmann ist KZ-Überlebende …«
Ferdinand nickte. Beide schwiegen sie einen Moment, griffen nach ihren Gläsern, tranken.
»Ich kann mir im Moment keinen Idealismus leisten«, erklärte Ferdinand. »Ich bin mit meiner Miete im Rückstand, und in vier Wochen muss ich aus meiner Wohnung raus. Ich will arbeiten. Da mögen Sie es zynisch nennen, aber für mich ist es auch eine Frage des …«, er brach ab.
»Des Überlebens?«, ergänzte Dr. Rudnik. Ferdinand zeigte sich überrascht, denn er hatte mit einem Vorwurf gerechnet. »Sie sind ehrlich, Broich. Eine gesunde Portion Egoismus schadet nie. Wenn der nicht zum Schaden der anderen ist. Nun erzählen Sie, was Sie wissen. Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen kann.«
»Frau Lachmann hat diesen Gernot Tromnau in München auf der Straße erkannt. Er hat, sagt sie, als Zahnarzt im Lager gearbeitet, hat dort an der Rampe Selektionen vorgenommen und soll auch zwei abgestürzte britische Piloten erschossen haben, vor den Augen der Gefangenen.«
»Gernot Tromnau. Unter diesem Namen lebt der Mann in München?«
Ferdinand schüttelte den Kopf und trank einen Schluck. »Nein, er nennt …«
Ein korpulenter Mann drängte sich an ihnen vorbei zur Toilette und blickte sie neugierig an. Ferdinand wartete, bis der Mann hinter der Tür verschwunden war, und vergewisserte sich, dass sie fest zugezogen war. »Schuld war, nur der Bossa Nova«, schallte es jetzt quer durch den Raum bis zu ihnen hinüber. Einige der Gäste sangen mit. Es wurde laut, und Ferdinand und Dr. Rudnik rückten dichter zusammen, um sich besser zu verstehen.
»Er nennt sich jetzt«, Ferdinand sah sich noch einmal um, »er nennt sich jetzt Ulrich Fischer und hat eine Praxis in der Stadt. Frau Lachmann hat mir die Adresse genannt. Auch seine Privatadresse. Sie hat ihn bis vor sein Haus verfolgt.«
»Die Frau ist ganz sicher, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt?«
»Ja. Sie ist sich ganz sicher. Diese Augen und diesen Blick werde sie nie vergessen.«
Einen Moment schwiegen die beiden Männer.
»Ich brauche Informationen. Über Ruth Lachmann und über Tromnau«, sagte Ferdinand, nachdem der Wirt Dr. Rudnik einen weiteren Apfelwein gebracht hatte. Jemand hatte die Musik noch lauter gedreht, sodass sie nun noch enger zusammenrücken mussten.
»Ich schaue, was ich herausbekommen kann.«
»Kommen Sie an die alten Akten heran?«
Dr. Rudnik trank noch einen Schluck, bevor er antwortete. »Abwarten. Das kann dauern. Wenn sie noch vorhanden sind. Sie wissen ja sicher, dass die SS und andere NS-Organisationen bei Kriegsende versucht haben, so viele Akten wie möglich zu vernichten. Was ihnen aber zum Glück nicht ganz gelungen ist.«
»Ich weiß auch«, sprach Ferdinand weiter, »dass viele nach dem Krieg neue Identitäten angenommen haben. Aber Tromnau brauchte neben einem Ausweis auch eine Approbation auf seinen neuen Namen.«
Dr. Rudnik lachte kurz auf, war sofort wieder ernst, leerte aber, bevor er antwortete, sein Glas, um gleich ein weiteres zu bestellen. Ferdinand erkannte keinerlei Anzeichen von Trunkenheit bei dem Mann, der jetzt seine Weste aufknöpfte und die Krawatte lockerte.
»Mit einem neuen Ausweis war alles Weitere eine Kleinigkeit. Außerdem waren alle doch schlimmstenfalls Mitläufer. Nicht wenige sehen sich als die eigentlichen Opfer.«
Ferdinand nickte. »Ja, es ist dennoch immer wieder ernüchternd. Aber vielleicht ändert der Prozess etwas.«
Dr. Rudnik zog wieder die Augenbrauen hoch. »Ein Wunder, dass er überhaupt stattfindet.« Er schüttelte den Kopf und trank das nächste Glas aus, kaum dass der Wirt es ihm auf den Tisch gestellt hatte. Dann blickte er zu Ferdinand hinüber, dessen Glas nun auch leer war. Der machte eine ablehnende Geste, doch Dr. Rudnik beschied anders. »Klar, bringen Sie dem Mann noch so einen Schierlingsbecher. Der will es ja nicht anders.« Er lachte kurz, fuhr mit ernstem Gesicht fort. »Was haben Sie jetzt vor?«
»Ich werde morgen nach München fahren.«
»Frau Lachmann treffen?«
»Ja. Und ich werde mir diesen Tromnau alias Fischer anschauen.«
»Broich«, sagte der Anwalt, machte eine Pause, bevor er weitersprach. »Ich will Sie warnen. Diese Menschen haben viel zu verlieren. Sie haben gezeigt, dass ihnen Menschenleben nichts bedeuten. Auch als Ärzte nicht.«
Ferdinand nickte. »Ich werde aufpassen!«
»Hoffentlich reicht das!« Dr. Rudnik nippte dieses Mal nur kurz an seinem Glas. »Hat die Frau außer Ihnen noch jemandem von Tromnau erzählt?«
Ferdinand schüttelte den Kopf. »Nein, nur mir. Das hat sie betont.«
Einige der Gäste sangen den Refrain von Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut laut mit.
»Was wissen Sie über die Rolle von Zahnärzten in den Lagern?«, hakte Rudnik nach.
»Ich habe die letzten Tage recherchiert«, erklärte Ferdinand. »Was ich bislang weiß, ist, dass jedes KZ eine zahnärztliche Station hatte, die dem Standortarzt unterstellt war. Wobei die Zahnärzte recht selbstständig agieren konnten. Es gab in jedem Lager einen Zahnarzt der SS, in den großen sogar mehrere.«
»Sie behandelten nur das Lagerpersonal?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete Ferdinand, während der Anwalt die letzte Zigarette aus der Schachtel klopfte. Er hob den Kopf und orderte beim Wirt neben dem nächsten Apfelwein eine neue Schachtel.
»Aber ich weiß«, sprach er dann weiter, »dass die Zahnärzte für die Entfernung und das Sammeln von Zahngold zuständig waren.«
Dr. Rudnik inhalierte tief, dachte einen Moment nach. »Ich denke, dass der Mann sich am meisten vor einer Anklage wegen der Erschießung der britischen Piloten fürchten würde.« Er zog wieder an seiner Zigarette. »Zu Recht übrigens. Die Briten kennen da nichts. Deshalb, wie ich Ihnen schon sagte, Herr Broich, der Mann hat viel zu verlieren: seinen Beruf, seine Reputation, seine Freiheit. Möglicherweise sogar sein Leben. Er hat jetzt zwanzig Jahre unbehelligt gelebt, ich nehme an, in Wohlstand, und das soll auch noch die nächsten zwanzig Jahre so sein. Ich sage es ihnen noch einmal: Passen Sie auf sich auf, wenn Sie nach München fahren!«
Der Anwalt drückte die Zigarette aus. Connie Francis sang Barcarole in der Nacht, ein Paar tanzte sich durch die Leute zur Toilette, wo es sich mit einem Kuss trennte.
»Der Krieg und die Ermordung der Juden sind noch keine zwanzig Jahre her.« Dr. Rudnik blickte den beiden hinterher. »Was ich noch wissen möchte, Herr Broich …?«
Ferdinand sah Dr. Rudnik aufmerksam an.
»Warum interessieren Sie diese Geschichten? Ich nehme an …«, er betrachtete Ferdinand kurz, »dass Sie nicht eingezogen worden sind. Wie alt sind Sie …?«
Der Journalist ließ sich einen Moment Zeit mit der Antwort, bevor er »fünfunddreißig« antwortete.
Der Wirt, der am Nachbartisch stand, sah kurz zu ihnen herüber. Der Anwalt gab ihm ein Zeichen, noch ein Bier und einen weiteren Apfelwein zu bringen. Ferdinand wollte schon wieder Einspruch erheben, aber der Wirt war schon auf dem Weg zum Tresen.
»Schon gut, Herr Broich. Die Rechnung geht auf mich. Also, warum interessieren Sie diese Geschichten? Ich habe mich vor unserem Treffen über Sie informiert, um zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Was ich gelesen habe, hat Hand und Fuß. Aber was ist Ihr Antrieb? Dass sie jetzt ausgerechnet über die alten Nazis schreiben wollen.«
Ferdinand dachte einen Moment nach, Dr. Rudnik sah ihn weiterhin direkt an.
»Mein Vater war Offizier bei der Wehrmacht. Hat mir ständig von den soldatischen Tugenden erzählt. Vor allem von der sauberen Wehrmacht. Bis ich nach seinem Tod Bilder in seinem Nachlass entdeckt habe, die eine andere Geschichte erzählen. Dass er an Erschießungen beteiligt war. Bilder, auf denen er sich neben getöteten Zivilisten hat ablichten lassen. Und es ist vor allem …«, er schluckte, griff nach seinem Glas, bemerkte, dass es leer war.
Dr. Rudnik unterbrach ihn nicht.
»Dieser Blick. Wie er in die Kamera schaut. Stolz. Überheblich. Ich weiß es nicht. War es Mordlust, die sich darin zeigte? Keine Ahnung. Vielleicht ging es auch nur um das Gefühl von Macht. Macht zu haben über Leben und Tod.«
Der Wirt brachte die Getränke. Ferdinand griff gleich nach seinem Glas, nahm einen großen Schluck.
»Was hat Ihr Vater nach dem Krieg gemacht?«
»Gelitten hat er.«
Dr. Rudnik lachte böse. »Ja, das können sie gut. Leiden!«
»Er hat meine Mutter und mich tyrannisiert. Es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer.«
»Sie haben sich gelöst?«
Ferdinand überlegte kurz. »So gut es ging. Ich brauchte vor ein paar Jahren tatsächlich noch einmal seine Hilfe. Wenn er gewusst hätte, wem er da hilft, würde er sich heute noch im Grab umdrehen. Meine kleine Rache.«
»Er hat Ihnen nichts hinterlassen?« Dr. Rudnik sah sein Gegenüber aufmerksam an. »Ich frage wegen Ihrer finanziellen Situation.«
»Schwierig«, antwortete Ferdinand erst nach einer kurzen Pause, sprach aber nicht weiter. Dr. Rudnik hakte nicht nach.
»Und Ihre Mutter?«
»Sie hat das nicht mehr ausgehalten.«
Dr. Rudnik nickte, als Zeichen, dass er verstand.
Sie sprachen noch eine halbe Stunde miteinander, dann bezahlte der Anwalt die Rechnung. Ferdinand protestierte, aber Dr. Rudnik wies ihn zurecht. »Sie brauchen Ihr Geld jetzt anderweitig. Wenn ich Ihnen nochmals den Ratschlag geben darf: Passen Sie auf sich auf!«
Der Wirt kam mit der Rechnung, und Rudnik hinterließ ihm ein großzügiges Trinkgeld.
»Männer wie dieser Tromnau können gefährlich werden. Und Männer wie diesen Tromnau gibt es viele.« Er kramte in seiner Tasche, schob dann eine Visitenkarte über den Tisch. »Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben.«
Ferdinand nickte, steckte die Karte in seine Jacketttasche und stand auf. Erstaunt nahm er wahr, dass Dr. Rudnik sitzen blieb.
»Broich, direkte Frage, ehrliche Antwort: Brauchen Sie Geld für Ihre Fahrt nach München?«
Er antwortete nicht sofort, setzte sich wieder.
»Keine falsche Scham. Sie geben es mir zurück, wenn Sie wieder flüssig sind. Keine Eile damit.«
Ohne Ferdinands Reaktion abzuwarten, nahm er ein paar Scheine aus seinem Portemonnaie und schob sie verdeckt von seiner Handfläche zu ihm herüber.
Während Freddie Quinn Junge, komm bald wieder sang, quetschten sie sich zwischen den Wirtshausgästen hindurch zum Ausgang, wo sie sich voneinander verabschiedeten.
Auf dem Weg zu seiner Wohnung überlegte Ferdinand, warum er Dr. Rudnik nicht erzählt hatte, dass sein Vater das, was von seinem Vermögen, das er nach dem Krieg mit Immobilien gemacht hatte, übrig geblieben war, Organisationen wie dem »Verband deutscher Soldaten« und dem »Stahlhelm – Kampfbund für Europa« vermacht hatte. Vielleicht war es die Scham darüber, dass er auf das Geld gehofft hatte. Wo er doch seinen Vater und das, was er getan hatte, so sehr verachtete.
Er fand einen Parkplatz nicht weit von seiner Wohnung entfernt, doch er verspürte nur wenig Lust, schon nach Hause zu gehen.
Um die Ecke war ein Lokal. Kühle Jazzmusik umfing ihn, als er eintrat.
*
Die Übelkeit war schon die ganze Fahrt über da, nur mit Mühe hielt Mine sie unter Kontrolle. Seit zwei Wochen war das Teil ihres täglichen Lebens. Bisher hatte niemand etwas mitbekommen, hatte niemand sie gesehen, wenn sie sich übergeben musste. Im Stall, hinter dem Haus, auf dem Feld. »Blass bist du«, hatte ihr Bruder Albrecht festgestellt, als sie vor zwei Tagen zusammen auf dem Hänger standen und die Säcke mit der Saat abluden. Sie hatte ihn nicht angeschaut, »Hab was Falsches gegessen« vor sich hin gemurmelt. Damit war es gut. Dann war sie vom Hänger gesprungen, hinter einen Busch gerannt, hatte sich übergeben. »Na, Kleinmädchenblase«, hatte Albrecht gelästert, als sie wieder auf dem Hänger stand, und gelacht.
Jetzt saß Mine neben ihrem Onkel Gerd in dessen Hanomag und starrte durch die Frontscheibe nach draußen. Ihr Onkel durfte auf keinen Fall etwas von ihrer Übelkeit mitbekommen. Seit sie aus ihrem kleinen Hunsrückdorf bei Emmelshausen aufgebrochen waren, rauchte er unentwegt. In Kastellaun wollten sie neue Rohre kaufen, weil die alten im letzten Winter so gelitten hatten, dass sie sicher bald bersten würden. Mines ältere Brüder waren an diesem Tag nicht abkömmlich, der eine auf dem Hof, der andere in der Firma, für die er arbeitete. Mine konnte anpacken. Weil sie es von klein auf musste.
»Pass nur auf, dass das Mädchen sich nichts verrenkt!«, hatte ihr Vater seinen Bruder gewarnt. »In einer Woche beim Turnfest muss sie gesund sein.«
Mine war die beste Turnerin im Verein, und alle erwarteten von ihr, dass sie beim Kreisturnfest den Sieg für ihr Dorf holte. Wie in den beiden letzten Jahren. Außer ihr wusste niemand, dass sie in diesem Jahr nicht teilnehmen konnte, und schon seit einiger Zeit überlegte sie fieberhaft, wie sie das anstellen könnte.
»Keine Sorge!«, hatte Onkel Gerd gebrummelt. Alle im Dorf wussten, dass ihm der Turnverein ziemlich egal war.
Niemand machte ihm deshalb Vorwürfe. »Das mit Hans und Karl, das hat er nie verwunden«, hatte ihr Vater Georg einmal gesagt. Hans und Karl waren Onkel Gerds gefallene Söhne. In den letzten Kriegstagen waren sie noch eingezogen worden und bei einem Tieffliegerangriff ums Leben gekommen. Jeden Sonntag nach der Messe ging er auf den Friedhof. Die ersten Jahre war er mit seiner Frau gekommen, seitdem die krank war und ihr das Gehen immer schwerer fiel, kam er meistens allein. Niemand regte sich über die vielen Zigarettenstummel auf, die er am Grab zurückließ. Der Friedhofsgärtner, ein alter Witwer und Kriegsversehrter, der sich seine karge Rente aufbesserte, kehrte sie am Montagmorgen regelmäßig zusammen und entsorgte sie in der Mülltonne am Eingang des Friedhofs.
Je näher der Sonntag und damit der Friedhofsbesuch rückten, desto einsilbiger wurde Gerd und rauchte noch mehr.
Der Hof, auf dem die Rohre gelagert waren, lag am anderen Ende der kleinen Stadt.
Mine hatte sich auf den Ausflug mit ihrem Onkel gefreut.
»Sie ist aus der Art geschlagen«, tuschelten die Leute und hielten sich dabei nicht einmal die Hand vor den Mund. Mine las viel, und sie wäre gerne auf die Handelsschule gegangen, aber das hatte ihr der Vater nicht erlaubt und dabei Unterstützung von der Mutter erhalten. Was sollte ein Mädchen auf der Handelsschule? Es gab ja schon einen Mann, der sie heiraten wollte. Zumindest wollten das die anderen. Rüdiger Behrendt. Er arbeitete in der Rheinböller Hütte, in der Eisengusswaren, Grabkreuze, Brunnentröge, Öfen, Herde, Haushaltswaren und einiges andere hergestellt wurden. Der größte Arbeitgeber in der weiteren Umgebung, und Rüdiger arbeitete in der Buchhaltung. Ein krisenfester Arbeitsplatz, bei dem er sich die Hände nicht schmutzig machte, manchmal sogar dienstlich nach Koblenz, Mainz oder Köln fahren musste und ordentlich verdiente. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Turnwettbewerb vor fast einem Jahr, sie waren ein paar Mal miteinander ausgegangen, er war bei ihrer Familie zu Besuch gewesen, sehr zur Freude des Vaters, der in ihm eine gute Partie sah. Albrecht, Mines ältester Bruder, würde den Hof übernehmen, und Walter, der Zweitgeborene, arbeitete in einer Ziegelei. Mine hatte zwei Möglichkeiten. Sie konnte heiraten und eine eigene Familie gründen oder ihr Leben als bessere Magd bei ihrem Bruder auf dem Hof verbringen. Um die elfjährige Renate, das Nesthäkchen, machte sich noch niemand Gedanken.
Onkel Gerd lenkte den kleinen Transporter durch die Straßen des Städtchens. Sehnsüchtig blickte Mine durch die Seitenscheibe nach draußen. Es war warm, und sie hatte das Fenster heruntergekurbelt. Die Übelkeit machte sich gerade nicht bemerkbar.
»Du magst die Stadt, was?«, fragte Onkel Gerd, ohne die junge Frau neben sich anzuschauen. Es waren praktisch die ersten Worte, die er heute sprach. Mine wunderte sich nicht. Es war Freitag, noch zwei Tage bis zum Besuch des Grabs seiner beiden Söhne.
Deshalb antwortete sie auch nicht, sah weiter nach draußen. Gleich würde er kommen, der kleine Laden, in dem man Lottoscheine kaufen konnte. Manfred, ein Junge, der in ihrer Klasse gewesen war, hatte erzählt, dass sein Vater dort einmal mehr als fünftausend D-Mark gewonnen habe. Auf einmal. Aber Manfred war als Aufschneider bekannt. Mine faszinierte etwas anderes an dem kleinen Geschäft. Es gab dort Bücher. Nicht viele, aber man konnte alles bestellen. Wenn sie früher mit ihren Brüdern unterwegs war, war sie immer wieder heimlich in den Laden geschlichen. Während die Brüder irgendwelchen Baustoff kauften, hatte sie sich unter einem Vorwand davongemacht und die bestellten Bücher abgeholt, sie schnell in ihrer Tasche verstaut und die Inhaberin des kleinen Ladens gebeten, niemandem etwas davon zu sagen. Wenn sie mit Onkel Gerd zu Besorgungen in Kastellaun war, machte sie es genauso. Umso erstaunter war sie, als der Onkel vor einem halben Jahr selbst in den Laden ging und sie aufforderte, im Wagen auf ihn zu warten. Das Päckchen, das er aus dem Laden trug, verstaute er eilig hinten auf der Ladenfläche. Bei der nächsten Tour mit ihm ließ sie sich nicht davon abbringen, mit hineinzugehen, was ihrem Onkel sehr unangenehm war. Während er mit Frau Morgenthal, der Besitzerin, im Hinterzimmer verschwand, schlich sie im Laden umher. Mine hatte schon den Verdacht, dass ihr Onkel etwas mit der Frau hätte, aber die kam plötzlich in den Laden zurück, reichte ihr schnell das beim letzten Besuch bestellte Buch und verschwand wieder im Hinterzimmer. So kam sie hinter Onkel Gerds Geheimnis. Und sie verriet ihm ihres. Was die Dinge einfacher machte.
Gemeinsam stiegen sie jetzt in den Hanomag und fuhren los. Gleich würde das Reisebüro kommen, ein kleiner Laden. Mine liebte die Plakate im Schaufenster. Berge, hinter denen die Sonne hervorlugte, die Nordsee mit ihren großen Wellen, die sich an einer Kaimauer brachen, die große Theaterruine in Rom. Das wollte sie alles sehen. Die vielen Orte, von denen sie in den Büchern gelesen hatte.
Eine Baugrube, die mit einem Absperrgitter gesichert war, zwang Onkel Gerd zum Langsamfahren.
Dann hatten sie den Hof der Firma mit den Baustoffen erreicht. Onkel Gerd fuhr den Hanomag rückwärts an die Rampe, auf der die Rohre gelagert waren.
Er nickte ihr zu. Sie wusste, was das bedeutete. Sie sollte schon mit dem Aufladen beginnen, während er im Büro die Rechnung beglich.
»Na, Mine«, begrüßte sie der Vorarbeiter, den alle Siggi nannten, »musst du wieder alles alleine machen?«
Er sah sie begehrlich an, und sie wusste das. Evi, ihre beste Freundin, sagte immerzu, dass sie die Schönste sei. Nicht nur im Dorf, sondern im ganzen Kreis. Nicht ganz neidlos, wie es Mine manchmal schien. Die beste Turnerin war sie sowieso. Aber das machte ihr im Moment so große Probleme. Dass sie ein Geheimnis hatte, das sie mit niemandem teilen konnte. Nicht einmal mit Evi.
»Bist bald stärker als deine Brüder, bei dem, was du schleppen musst.« Er lachte.
Sie sah zur Seite und arbeitete noch schneller. Dabei fürchtete Siggi sich vor Mines Brüdern und würde ihr deshalb nie zu nahe kommen. Einmal hatte er es versucht und nicht bemerkt, dass Albrecht im Wagen saß. Albrecht hatte Kraft wie ein Stier, alle fürchteten ihn, und es reichte, dass er kurz aus dem Wagen stieg und Siggi fest in die Augen blickte.
»Lass gut sein!« Siggi begann, die Rohre auf die Ladefläche zu schieben. Zum ersten Mal war sie ihm richtig dankbar für seine Hilfe.
»Du musst dich schonen fürs Tanzturnier!«, erklärte er. Mine sah an seinem enttäuschten Gesichtsausdruck, dass er sich zumindest ein dankbares Lächeln von ihr erwartet hätte, doch er hatte sie nur wieder an die Veranstaltung erinnert, an der sie nicht teilnehmen konnte.
Siggi war gerade fertig, als Onkel Gerd mit einer Zigarette zwischen den Lippen aus dem Büro kam. Er stieg in die Fahrerkabine und startete den Motor. Mine nickte Siggi kurz zu und lief zur Beifahrertür. Onkel Gerd hatte schon den Gang eingelegt.
Kaum waren sie wieder auf der Landstraße, räusperte sich Onkel Gerd. Nicht so ein normales Räuspern, wenn man sich verschluckt hat oder einfach das Gefühl, dass einem etwas im Hals steckt, was da nicht hingehört. Nein, es war eines, mit dem man sich selbst Mut machen will, um etwas Unangenehmes anzusprechen. Aber er begann nicht sofort. Immerhin hatte er sich keine neue Zigarette angezündet. Ihre Übelkeit war stärker geworden, und sie fürchtete, dass der Geruch des Nikotins sie zum Erbrechen bringen würde.
Onkel Gerd räusperte sich ein weiteres Mal. Nun wusste sie, dass es etwas Ernstes war. Sie war sogar sicher, dass er schon seit ihrer Abfahrt auf den Moment wartete, es endlich loszuwerden. Mit einem Mal überkam sie die Furcht, dass er ihr Geheimnis kannte oder zumindest ahnte und sie darauf ansprechen wollte. Wenn er es wusste, dann wussten es vielleicht auch alle andern in der Familie. Und dann?
»Opa Albrecht«, begann er, nutzte aber ein Bremsmanöver vor einer Kurve zu einer Pause, als wollte er seine Worte noch einmal abwägen. Am Ende der Kurve beschleunigte er den Wagen. »Du weißt, warum er nie zu deinem Geburtstag kommt?«
Mine zuckte mit den Schultern. Tatsächlich hatte sie sich nie Gedanken darüber gemacht. Schon Gedanken, aber keine, die sie belasteten. Opa Albrecht war ein Kauz, wie manche im Dorf sagten. Aufbrausend konnte er sein, er hatte eine laute Stimme, viele fürchteten ihn. Es war eben einfach so, dass er die Mädchen und Frauen in der Familie nicht beachtete. Mit Ausnahme seiner Frau, die Oma Rita. Aber die war schon so lange tot, dass Mine sich kaum an sie erinnern konnte. Sie hatte immer gedacht, dass er nicht zu ihrem Geburtstag kam und ihr nicht gratulierte, weil er das bei Frauen grundsätzlich nicht machte. Dabei wusste sie es besser. Natürlich machte er es bei den anderen. Aber eben auf seine Weise. Grummelig, im Vorbeigehen.
Mine wusste nicht, ob er ihre Reaktion mitbekommen hatte. Noch nie hatte sie deswegen jemand angesprochen. Dass Onkel Gerd das jetzt machte, war sehr seltsam. Auch weil ihr Onkel immer Streit mit Opa Albrecht hatte. Meist ging es um Politik.
Heute war ihr Geburtstag, und am Abend würden sie alle zusammensitzen und ein wenig feiern. Wie immer ohne Opa Albrecht. Ihre Mutter würde ihr Lieblingsgericht kochen. Auch ihr Onkel Gerd würde vorbeischauen. Ob seine Frau Margarete mitkäme, hing von ihrem Gesundheitszustand ab. Dabei hatte sie kein richtiges körperliches Gebrechen. Ihr Leben war schwarz, sagte Onkel Gerd, und alle in der Familie stimmten ihm bei. Evi wäre mit von der Partie. Und Otto Schunk, ihr Trainer. Der gehörte fast zur Familie. Aber Opa Albrecht nicht.
»Du weißt, welcher Tag heute ist, Wilhelmine?«
Bei ihrem vollständigen Namen wurde sie nur gerufen, wenn etwas Ernstes anstand. Renate, ihre kleine Schwester, machte sich manchmal einen Spaß daraus, sie so zu nennen. Sie fand, dass das kein Mädchenname war.
Onkel Gerd starrte weiter geradeaus, während er sprach.
»Mein Geburtstag …«, antwortete Mine.
»Ja«, bestätigte er so gedehnt, als hätte das kleine Wort fünf As. »Aber …«, nun steckte er sich doch eine Zigarette an. »Das Datum …«
»Der achte Mai. Da habe ich immer Geburtstag.« Sie lachte gequält, weil sie nicht wusste, worauf Onkel Gerd hinauswollte.
»Und …«, er nahm einen tiefen Zug, »was war am achten Mai?«
Sie wollte schon sagen, dass sie da geboren worden war. Vor neunzehn Jahren. Heute vor neunzehn Jahren. Noch zwei Jahre, dann war sie großjährig. Dann durfte sie wählen. Hatte ihr Evi gesagt. Zu Hause wollte niemand etwas davon wissen.
»Ich habe noch nie gewählt«, hatte ihre Mutter gesagt, als sie sie darauf angesprochen und gefragt hatte, wie das geht.
Mine verkniff sich die Antwort. Onkel Gerd würde sie nicht witzig finden. Er kam ihr zuvor. »Das Kriegsende. Die Kapitulation.« Er zog so tief an der Zigarette, dass sie das Knistern beim Verbrennen des Tabaks hören konnte.
»Dass du an dem Tag geboren bist … Für Opa Albrecht ist das eine Katastrophe.«
Sie dachte einen Moment nach. »War er ein Nazi?«
Sie sagte das sehr zögerlich. Das war ein Thema, über das in ihrer Familie nicht gesprochen wurde. Nur in den Streitereien mit Onkel Gerd kam das manchmal zur Sprache. Aber da wurde sie meistens rausgeschickt. Der Krieg war weit weg, sie alle hatten was geschafft. Die Städte waren wieder aufgebaut worden, und sie mussten nur aufpassen, dass die Kommunisten ihnen nicht alles kaputt machten oder wegnahmen.
»Der Tag war für ihn eine Katastrophe«, wiederholte Onkel Gerd. »Für mich ist es das Gegenteil.« Er schwieg für ein paar Sekunden. »Du bist ein guter Mensch, Mine«, sagte er mit einem Mal, so leise, dass Mine nicht sicher war, dass sie ihn richtig verstanden hatte. »Du musst weg. Du bist zu gut für hier.« Er machte eine Pause, sprach dann mehr zu sich. »Heute wird er vielleicht kommen.«
»Warum?«, fragte Mine unsicher, aber Onkel Gerd schwieg und rauchte.
Auf halber Strecke bog er in ein Feld ein. Mine kannte das schon. Seit Onkel Gerd im letzten Herbst hier eine alte Münze gefunden hatte, war er davon überzeugt, dass in der Erde unter diesem Feld ein Schatz lag. Anfangs hatten alle gelacht, als er behauptete, dass es sich um ein Geldstück aus römischer Zeit handelte, aber er war so überzeugt von seinem Fund, dass er nach Mainz gefahren war, wo er das Geldstück von Spezialisten untersuchen ließ. Zur Überraschung aller handelte es sich tatsächlich um eine römische Münze. Es wurden Archäologen zur Fundstelle geschickt, aber die fanden nach längerer Suche keine weiteren Geldstücke und waren schließlich überzeugt, dass Onkel Gerds Fund ein Zufall gewesen war.
An den wollte er nicht glauben, und so machte er sich jedes Mal, wenn er hier vorbeikam, auf Schatzsuche. Über einen Bekannten, den er noch aus seiner Schulzeit kannte und der während des Krieges Unteroffizier bei den Pionieren gewesen war, hoffte er, an ein Minensuchgerät zu gelangen.
Zweimal schon hatten Männer aus dem Dorf sich den Spaß gemacht, bei einem Schmied in einem Nachbardorf alte Blechstücke so bearbeiten zu lassen, dass sie wie alte Münzen aussahen. Aber auch nachdem er den Betrug bemerkt und den Spott und das Gelächter der anderen über sich hatte ergehen lassen, machte er weiter und fand tatsächlich hin und wieder ein altes Geldstück. Er würde niemandem davon erzählen, sondern sich selbst informieren. Onkel Gerd war kein Leser. Für so etwas war keine Zeit. Aber für die Münzen war er bereit, einige Grundsätze über den Haufen zu werfen. Also besorgte er sich Bücher.
Natürlich hatte er bald herausgefunden, warum Mine ihn so gern nach Kastellaun begleitete. Bald bestellte er selbst Bücher, die sich mit römischen Münzen und römischer Geschichte beschäftigten. Mine war die Einzige, die von dieser seiner Leidenschaft wusste. Er wusste, dass sie das für sich behalten würde.
Während er das Feld absuchte, Quadratmeter für Quadratmeter, Furche für Furche, saß Mine auf dem Beifahrersitz und las. Ab und zu blickte sie auf und beobachtete ihren Onkel bei seinem Tun.
Eine Stunde lang lief er systematisch seine Strecke ab, rechte den Boden, bückte sich, ließ Erdkrumen durch seine Finger gleiten, ging weiter, bückte sich, hob neue Erde auf, ließ sich auch nicht von dem Lärm der Düsenjäger, die zweimal über sie hinwegflogen, stören. Wie sie sich schon lange nicht mehr davon stören ließen, weil sie so oft und manchmal auch sehr tief flogen, dass es zur Gewohnheit geworden war.
An diesem Tag war er erfolglos. Er würde wiederkommen.
»Mine, komm ins Haus und hilf mir beim Vorbereiten!« Ihre Mutter stand schon in der Tür zum Wohnhaus, als Mine und der Onkel in den Hof fuhren, und winkte sie zu sich. Doch Mine tat, als hätte sie nichts gehört, und lief zur Straße und ums Dorf herum zu dem kleinen Denkmal an dem Feldweg zum Wald, das für den Heiligen Andreas errichtet worden war.
Dort blieb sie einen Moment stehen, bekreuzigte sich und ging dann auf die hintere Seite. Sie sah sich nochmals um, dann bückte sie sich und schob ihre rechte Hand in einen schmalen Spalt unten am Sockel. Suchte rechts, dann links. Nichts. Wieder keine Nachricht.
Enttäuscht stand sie auf, rieb sich den Staub von den Händen, trat kurz und wütend auf und ging zurück zum Hof.
»Hast du mich nicht gehört?«, schimpfte ihre Mutter, als sie in die Küche trat. Ihre kleine Schwester Renate stand auf einem Holzklotz und rieb auf einer Holzplatte die Kartoffeln für den Döppekoochen.
»Aua!«, schrie sie auf.
Mutter und Mine schauten zu ihr herüber. Sie reckte ihren Zeigefinger in die Luft, die Spitze blutrot. Ein Tropfen fiel auf die geriebenen Kartoffeln.
»Wasch das ab!«, blaffte sie die Mutter an, »sonst brauch ich keine Wurst mehr da reinmachen.«
Trotzig schob Renate den Finger in den Mund und leckte ihn ab.
Die Mutter hatte sich schon wieder Mine zugewandt. »Geh die Kuh füttern!«, forderte sie ihre Tochter auf. »Und zieh dich dann ordentlich an. Du musst noch den Tisch decken.«
Mit einem Nicken verließ Mine die Küche. Was für eine ungerechte Welt. Evi hatte ihr erzählt, dass sie an ihrem Geburtstag nichts machen musste. Alle kümmerten sich um sie. Erst wenn das Essen fertig und der Tisch gedeckt war, durfte sie in die Küche kommen.
Beim Gang über den Hof kam die Übelkeit wieder. Sie blieb kurz stehen, atmete tief durch, bis der Würgereiz verflogen war. Keine Nachricht, schoss es ihr durch den Kopf, wieder keine Nachricht. Dabei hatte er doch gesagt, dass er heute wiederkäme. Wie gerne hätte sie sich an ihrem Geburtstag von ihm in den Arm nehmen lassen. Ihre Nase an seinen Hals gedrückt, um sich wieder daran zu erinnern, wie gut er roch.
Der Duft des Döppekoochens zog schon durchs ganze Haus. Das war das Schönste an ihrem Geburtstag, der große Berg der geriebenen und im Ofen gegarten Kartoffeln mit der festen Kruste. An ihrem Geburtstag schoben alle ihr die Kruste auf den Teller. Vor zwei Jahren hatte sie so viel und so schnell gegessen, dass ihr noch lange danach schlecht gewesen war und ihr Bauch wehtat.
Schnell wusch sie sich und zog ein frisches Kleid an, dann ging sie in die Küche. Die Mutter suchte gerade das Besteck in einer Schublade zusammen, das sie ihr gleich reichte.
Eine halbe Stunde später saßen sie alle an dem großen Tisch. Ihr Vater an dem einen Kopfende, ihm gegenüber Opa Albrecht, wie immer mit griesgrämigem Gesicht. Er würdigte seine Enkelin mit keinem Blick. Dazwischen auf der einen langen Seite ihre beiden Brüder und Onkel Gerd, auf der anderen sie selbst in der Mitte. Rechts von ihr hatten Renate und ihre Mutter Hella Platz genommen, links ihre Freundin Evi, die mit einem großen, in blaues Papier eingeschlagenem Geschenk gekommen war. Ein Platz neben den Brüdern war noch frei für Otto Schunk, der den Vater hatte wissen lassen, dass er versuchen würde zu kommen.
Mine hoffte, dass er es nicht schaffte, denn sonst würden sie nur über das Kreisturnfest sprechen und ihr Vorhaltungen machen, dass sie nicht so viel essen solle. In den Jahren davor war ihr das recht gewesen, sie war der Mittelpunkt, alle hatten sie für ihre turnerischen Fähigkeiten bewundert, aber in diesem Jahr wollte sie nichts davon wissen. Ab morgen spätestens musste sie sich etwas einfallen lassen, einen guten Grund, warum sie nicht teilnahm. Krankheit vortäuschen ging nicht, dafür hatte ihre Mutter einen untrüglichen Blick.
Mine hatte keinen großen Appetit und aß nur ein kleines Stück von ihrem geliebten Döppekoochen. Was sofort allen auffiel und falsch interpretiert wurde.
»Richtig so!«, rief Albrecht aus, und der Vater stimmte zu. »Damit wir allen Nachbardörfern mal wieder zeigen, wo der Hammer hängt.« Sie lachten und stießen mit den Flaschen an.
»Ist doch nix für Mädchen!«, schimpfte der Opa in der Ecke. »Da halb nackig rumhopsen. Soll heiraten und Kinder kriegen!«
Mine verschluckte sich, und wieder verstanden das alle falsch.
Ihre Mutter strich ihr über die Schulter. »Mach dir nichts draus, den änderst du nicht mehr. Und am Ende ist er auch stolz, wenn du gewinnst. Kann es halt nicht zeigen, der alte Sturkopf.«
Um neun Uhr, Walter hatte schon den zweiten Kasten Bier aus dem kühlen Keller in die Küche geschleppt, hörten sie das Knirschen von Reifen auf dem Kies vor dem Haus. Nun kam Otto Schenk doch noch, blieb in der Tür stehen, schaute in die Runde.
»Komm, Otto, setz dich!« Ihr Vater deutete auf den Platz neben Renate.
Otto klopfte mit der einen Hand dreimal auf den Tisch, in der anderen hielt er ein in grünes Geschenkpapier eingeschlagenes Päckchen, der Farbe des Turnvereins. Er blieb stehen und blickte zu Mine hinüber. »Herzlichen Glückwunsch, meine liebe Mine.« Mit feierlicher Stimme reichte er ihr das Geschenk über den Tisch.
Sie bedankte sich artig und machte Anstalten, das Päckchen hinter sich zu legen, fing sich dafür aber erboste Blicke ein.
»Du musst es schon aufmachen!«, forderte ihre Mutter. Renate stimmte ihr zu. »Ja, aufmachen! Du musst das aufmachen!«
Langsam streifte Mine das Band ab und wickelte das Päckchen aus dem Geschenkpapier. Auf dem Karton war ein Mädchen im Sporttrikot abgebildet. »Vielen Dank!« Mine lächelte Otto kurz an.
»Ganz aufmachen!« Renate klatschte in die Hände.
Alle am Tisch sahen Mine erwartungsvoll an, nur Opa Albrecht trank aus seiner Bierflasche und rülpste.
Mine hob den Deckel an, nahm ein grünes Trikot heraus und hielt es hoch, sodass alle es sehen konnten.
»Die Frau Lehr hat das Vereinslogo schon draufgenäht.«
»Sehr schön.« »Geschmackvoll«, riefen alle am Tisch durcheinander und klatschten. »Jetzt ist Gewinnen absolute Pflicht!«, sagte der Vater.
Mine schaute auf das schmal geschnittene Trikot. Früher hätte sie problemlos hineingepasst, vor einigen Wochen sogar noch, aber jetzt … Alle würden es sehen. Sie konnte nicht am Wettbewerb teilnehmen. Ihr wurde wieder übel.
»Aber«, hob Otto seine Stimme in einer Art, die alle verstummen ließ, »Mine, du musst jetzt wieder zum Training kommen. Zweimal hast du diese Woche gefehlt. Ich weiß, dass auf dem Hof viel Arbeit zu tun ist …«
»Wie?«, unterbrach ihn der Vater. »Sie hat nicht gearbeitet. Du hast doch gesagt, dass du zum Training gehst.« Seine Stimme hatte einen bösen Unterton, doch Otto entschärfte die Situation. »Verziehen und vergessen«, beschwichtigte er, »aber ab morgen kommst du wieder regelmäßig zum Training.«
Die Mutter kam ihren Gastgeberpflichten nach. »Otto, ein Stück von dem Döppekoochen? Mine hat dir ja zum Glück noch was übrig gelassen.«
Alle lachten. Die Stimmung war wieder entspannt.
»Aber nur ein kleines«, bat Otto. »Wir haben im Turnverein zusammengesessen und alles für den Wettbewerb besprochen. Da gab es schon was.«
Die Mutter ließ sich nicht beirren und türmte eine große Portion auf Ottos Teller. Walter öffnete eine Bierflasche und reichte sie ihm. »Dass noch so viel übrig ist«, staunte Otto und blickte anerkennend zu Mine. »Disziplin ist das Wichtigste für Sportler. Für erfolgreiche Sportler.« Er hob seine Bierflasche und sprach einen Toast aus. »Auf Mine und ihren Sieg am Samstag. Hoch soll sie leben!«
»Hoch, hoch!«, riefen alle am Tisch, bis auf Mine und Opa. Onkel Gerd, dem das Turnier egal war, machte eher pflichtschuldig mit.
Dann sprachen alle durcheinander, vor allem über das Turnfest, und keiner nahm wahr, dass Mine immer ruhiger wurde. Ihr war aufgefallen, dass ihr Vater immer wieder auf die Uhr schaute und Opa Albrecht genervt fragende Blicke auf seinen Sohn richtete.
Es war schon zehn Uhr, als von draußen wieder das Knirschen von Reifen auf dem Kies zu vernehmen war und eine Autotür zuschlug. Dann klopfte es an der Tür. Aber der späte Gast wartete die Antwort gar nicht erst ab, sondern kam mit schnellen Schritten in die Küche.
»Guten Abend zusammen!«, rief Rüdiger Behrendt, der einen Strauß roter Rosen in der Hand hielt. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine hellblaue Krawatte. Rüdiger war groß und schlank und hatte seine blonden Haare nach hinten gekämmt.
»Rote Rosen, wie schön«, rief die Mutter aus und stand auf, um eine Vase zu holen.
»Rückt mal zusammen!«, forderte der Vater Mine und Evi auf.
»Ein schönes Paar«, witzelte Walter und erntete von Mine einen bösen Blick.
Rüdiger, die Rosen vor der Brust, blieb neben Mine stehen. Alle Blicke waren erst auf ihn, dann auf das Mädchen gerichtet. Sie überkam eine Ahnung und spürte, wie die Übelkeit wieder in ihr aufstieg.
»Steh doch mal auf, Mine!«, forderte sie der Vater auf. Jetzt wurde ihr richtig schlecht.
Schließlich erhob sie sich. »Wilhelmine Karges, ich möchte mich heute mit dir verloben!« Rüdiger reichte ihr die Blumen, griff mit der freien Hand in seine Jacketttasche und nestelte umständlich ein kleines Etui heraus. Mine wurde schwarz vor Augen, sie schaffte es gerade noch, die Hand nach den Blumen auszustrecken, dann knickten ihr die Beine weg. Darum war der Opa in diesem Jahr zu ihrem Geburtstagsessen gekommen, war ihr letzter Gedanke. Und dass alle es gewusst hatten, alle eingeweiht waren, nur sie nicht.
Am schnellsten reagierte Evi, die ihre Freundin noch auffangen konnte, bevor sie auf den Boden fiel.
9. Mai 1964
Ferdinand zog die Schlafzimmertür zu, seine Schuhe und sein Jackett hatte er in der Hand. Unsicher und noch leicht benommen tastete er sich durch den Flur. Ein Geräusch aus dem Schlafzimmer ließ ihn innehalten, ein leises Husten. Er wartete, überlegte. Wie war er hierhergekommen? Das Lokal. Jazzmusik. Dann, am Tresen, das Gespräch, ein Bier und noch ein weiteres und …
Er zog die Wohnungstür hinter sich zu und stieg die Treppe hinab. Er musste sich mit einer Hand am Geländer abstützen. Zwei Stockwerke hatte er geschafft, als oben eine Tür aufging.
»Ferdinand?« Nicht laut, noch unsicher. Ein Räuspern. Nun sicherer. »Ferdinand? Bist du noch da?«
Er schwieg, wartete an die Wand gedrückt. Als er eine Tür ins Schloss fallen hörte, setzte er seinen Weg nach unten fort, hockte sich im Parterre auf die unterste Stufe, schlüpfte in seine Schuhe und versuchte sich an den Namen der Frau zu erinnern, deren Wohnung er gerade verlassen hatte. Er schloss die Augen. Keine Chance. Vielleicht später. Gerade als er sich erhob, ging die Tür neben ihm auf.
Eine Frau in grauem Kittel blickte ihn verwundert an, schüttelte den Kopf, drückte ihre Tür schnell wieder zu.





























