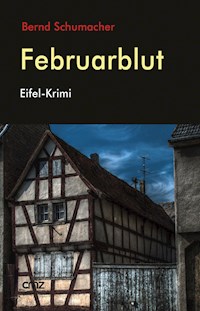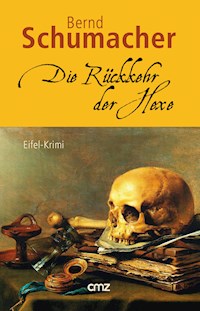
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Achtzehn Jahre nach der letzten Hexenprozesswelle erschüttern 1654 grauenhafte Morde die kleine Voreifelstadt Rheinbach. Der scharfsinnige Dominikanerpater Philipus von der Velde, ein entschiedener Gegner der Hexenverfolgung, wird aus Köln entsandt, um die Verbrechen aufzuklären. Schnell ist eine Schuldige gefunden, die der Hexerei verdächtigte Wirtswitwe Appolonia Simons. Sie wird angeklagt - der Tod auf dem Scheiterhaufen droht. Doch die Suche nach dem wahren Mörder wird zu einem Wettlauf mit der Zeit. Schumacher zeichnet ohne den Einsatz expliziter Folter- und Gewaltszenen das genaue Bild einer Kleinstadt zur Zeit der Hexenverfolgungen des 17. Jahrhunderts, verpackt in eine spannende Handlung, die den Leser bis zum Schluß gefangen hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoreninfo
Bernd Schumacher, Jahrgang 1952, ist verheiratet und lebt in Rheinbach. Er ist seit 1981 Lehrer am Staatlichen Berufskolleg Glas Keramik Gestaltung des Landes NRW Rheinbach. Seit über dreißig Jahren ist er außerdem Frontmann der Rheinbacher Rockgruppe »Tiebreaker«. »Die Rückkehr der Hexe« ist sein vierter Roman.
Haupttitel
Bernd Schumacher
Die Rückkehr der Hexe
Eifel-Krimi
Zweite überarbeitete Auflage
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zweite überarbeitete Auflage
© 2014, 2015 by CMZ-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-9126-26, Fax 02226-9126-27, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagbild:Pieter Claesz (1596/97–1660), Vanitas-Stilleben, 1630;Öl auf Leinwand, 39,5 × 56 cm; Mauritshuis, Den Haag
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:rübiarts, Reiskirchen
ISBN Paperback 978-3-87062-151-3ISBN epub 978-3-87062-267-1ISBN mobi 978-3-87062-268-8
20150117
www.cmz.de
www.schumacher-rheinbach.de
Inhalt
Dramatis Personae
Prolog
Drei Monate zuvor
Köln, Kurkölnisches Hofgericht
Burg Lüftelberg
Sonntag, 16. August, Anno Domini 1654
Montag, 17. August, Anno Domini 1654
Dienstag, 18. August, Anno Domini 1654
Mittwoch, 19. August, Anno Domini 1654
Donnerstag, 20. August, Anno Domini 1654
Freitag, 21. August, Anno Domini 1654
Samstag, 22. August, Anno Domini 1654
Sonntag, 23. August, Anno Domini 1654
Montag, 24. August, Anno Domini 1654
Epilog
Nachwort
Motto
Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommenDer Augenblick ist meinUnd nehm’ ich den in achtSo ist der meinDer Jahr und Ewigkeit gemacht.
Andreas Gryphius (1616–1664)
Dramatis Personae
Rheinbach
Engelbert Schnehagen – Bürgermeister
Reinhold Billig – sein Stellvertreter
Anton Stotzheim – Vicarius, Pfarrer von St. Gregorius
Heinrich – sein Hausknecht und Küster
Wienand Hartmann* – ehemaliger Pfarrer
Doktor Andreas Schweigel* – ehemaliger Vogt, als Zauberer 1636 hingerichtet
Appolonia Simons geb. Schweigel – Witwe, Wirtin und Schweigels Tochter
Severin und Siglinde – ihre Kinder
Franziska Schulte – ihre Magd
Catharina Hamecher – Kräuterfrau und Heilerin
Franz Tondorff – Handwerker
Gisela Tondorff – seine Frau
Walter Fischenich – Handwerker
Walter Eick* – Turmwächter
Burg Lüftelberg, Flerzheim, Meckenheim
Heinrich Degenhardt Schall von Bell* – Amtmann, Burgherr
Johannes von Wartenberg – Burgverwalter und Falkner, Sohn des Bonner Hofrats
Mathias Reimberg – Pferdeknecht und rechte Hand des Verwalters
Doktor Adalbert Wiemann – Medicus
Hermann Kramer – Bürgermeister von Meckenheim
Jakob Schnitzler – Meckenheimer Bauer
Gertrud Strom – Schwester des Schultheißen Augustin Strom †
Margarethe Winssen – Frau des Meckenheimer Schultheißen
Benediktiner Propstei, Remagen
Abt Willibert Weinsberg* – Vorsteher des Klosters
Pater Misericordius – Mönch und Leiter des Hospitals
Martin Koch* – ehemaliger Rheinbacher Gerichtsdiener
Kurfürstlicher Gerichtshof, Köln
Johann Gelenius* – Gerichtsvorsitzender und Hofrat
Ferdinand Schlebusch – sein Sekretarius
Kurfürstlicher Gerichtshof, Bonn
Wilhelm von Wartenberg* – Propst des Cassiusstifts
Doktor Kaspar Liblar* – Hexencommissarius
Dominikanerkloster Heilig Kreuz, Köln
Prior Hubertus von Nideke* – Vorsteher des Klosters
Pater Atanasius Gebour – Mönch und Bibliothekar
Pater Philipus van der Velde – Mönch und kurfürstlicher Ermittler
Pater Rufus Seydensticker– Mönch und Leiter des Hospitals
Hexentribunal Rheinbach (1636)
Doktor Jan Möden* – Hexencommissarius
Bartholomäus Winssen* – Meckenheimer Schultheiß
Augustin Strom* – Lüftelberger u. Flerzheimer Schultheiß
Dietrich Halfmann* – vermögender Landwirt
Melchior Steinbach* – Gerichts- und Amtsschreiber
Jan Thyn* – Kaufmann
Die mit einem Stern* versehenen Personen sind historisch nachweisbar.
Prolog
Köln, Dominikanerkloster Heilig Kreuz, 16. November, Anno Domini 1654. Pater Atanasius bemühte sich, so leise wie möglich zu sein. Er wollte keinen seiner Mitbrüder in der ohnehin schon kurzen Nachtruhe stören. Schon bald würde sie die Glocke zum Angelusgebet aus dem Schlaf reißen. Trotzdem konnte er es nicht vermeiden, dass seine Schritte an den kahlen Wänden des langen Flures des Dormitoriums widerhallten. Er musste sich beeilen, wenn er seinem heftigen Harndrang noch rechtzeitig Erleichterung verschaffen wollte. Auch die Kräutermischung, die er sich im Hospital des Klosters gegen das »Alte-Männer-Leiden« besorgt hatte, verfehlte in der letzten Zeit ihre Wirkung. Wie schon vielen seiner älteren Mitbrüder würde auch ihm wohl zukünftig nichts anderes übrig bleiben, als nachts einen Eimer mit auf die Zelle zu nehmen, wenn er sich den Ausflug zur weit entfernten Latrinenanlage ersparen wollte.
Trotz seiner Eile hielt er plötzlich inne. Er hatte etwas Ungewöhnliches gehört, das aus einer der Klosterzellen zu seiner Linken zu kommen schien. Unruhig untersuchte er die nächstgelegenen Klausen. Als er die Quelle des Geräuschs gefunden hatte, legte er neugierig sein Ohr an die Zellentür und lauschte. Konsterniert zuckte er zusammen. Er konnte es zunächst nicht glauben. Deutlich meinte er gehört zu haben, wie Lederriemen auf nacktes Fleisch klatschten, begleitet von einem monotonen, gebetsartigen Sprechgesang. Noch einmal ging er nahe mit seinem Kopf an die Tür. Dann hatte Pater Atanasius keine Zweifel mehr: einer seiner Klosterbrüder vollführte den Akt der Selbstkasteiung. Er hatte noch nie davon gehört, dass dies jemals im Kloster Heilig Kreuz geschehen war, zumal diese Art von Selbstzüchtigung von den Ordensoberen abgelehnt wurde. Er überlegte, wer die Zelle bewohnte. Dann fiel es ihm wieder ein: Es war Bruder Philipus. Bedächtig nickte er mit dem Kopf. Allmählich konnte er sich einen Reim darauf machen. Bei dem ansonsten so ruhigen und besonnenen Mitbruder war eine gravierende Veränderung eingetreten, nachdem er von seiner Ermittlungsreise in die Eifel zurückgekehrt war. Sollte er seinen Mitbruder am nächsten Tag auf seine Probleme ansprechen oder gleich Prior Hubertus zu Rate ziehen? Sein Harndrang meldete sich wieder mit unvermittelter Härte. Pater Atanasius rannte zum rettenden Abort.
Wieder klatschen die nassen Lederriemen auf den geschundenen Rücken des knienden Paters. Der Dominikanermönch war in eine meditative Verzückung geraten, so dass er die Schmerzen nicht mehr spürte. Seine verklärten Augen hafteten an dem schlichten Holzkreuz, das an der kahlen Wand seiner Klosterzelle hing. Unaufhörlich verließen die gleichen Sätze seine Lippen in einem liturgischen Gesang. »Oh Herr, verzeihe mir, dass ich an Deiner unendlichen Gnade und Güte gezweifelt habe und … gib mir weiterhin die Kraft, Dir gemäß den Statuten der heiligen Mutter Kirche zu dienen … und banne die Gedanken der Fleischeslust aus meinem sündigen Körper!«
Seit sechs Tagen wiederholte er diese Prozedur jede Nacht. Sie schien ihm der einzige Ausweg aus seinem Gewissenskonflikt und seiner Seelenpein zu sein. Jetzt war er mit seiner Kraft am Ende. Ein schwarzer Schleier legte sich über seine Augen. Langsam neigte sich sein Oberkörper nach vorne. Pater Philipus bekam nicht mehr mit, wie sein Kopf hart auf die Steinfliesen seiner Zelle aufschlug.
Drei Monate zuvor
Rheinbach am Rand der Eifel, 10. August, Anno Domini 1654. Noch einmal drehte sich Franz Tondorff um und schaute auf seine Heimatstadt. Wegen der einsetzenden Dunkelheit war sie nur schemenhaft zu erkennen. Er beobachtete die blauschwarzen Wolken am Horizont, aus denen ab und zu immer noch bedrohlich einige Blitze zuckten. Erleichtert verfolgte er, wie die Gewitterfront über die Dörfer Flerzheim und Lüftelberg abzog. Bald würde sie den Rhein erreicht haben. Einerseits hatten alle Einwohner Rheinbachs eine Abkühlung herbeigesehnt, denn die Eifel glich nach der dreiwöchigen Hitzeperiode einem Glutofen, was vor allen Dingen die anstehende Ernteeinfuhr auf den Feldern zu einer Qual machen würde. Anderseits barg ein heftiges Gewitter immer die Gefahr eines Stadtbrandes. Aus diesem Grunde hatte Bürgermeister Schnehagen schon in der Frühe alle Männer angewiesen, sich für solch einen Fall bereitzuhalten, während die Frauen in der Kirche St. Gregorius unter der Anleitung des Vicarius durch eifrige Gebete Gottes Beistand vor dem nahenden Unwetter erflehten. Gottlob hatte Rheinbach das Unwetter ohne Schaden überstanden.
Franz Tondorff nutzte die allgemeine Erleichterung in der Bevölkerung, sich heimlich in der Dämmerung durch das Voigtstor aus der Stadt zu schleichen, um im nahen Stadtwald nach seinen Kaninchenfallen zu schauen. Obwohl Wilderei strengstens verboten war und drastische Strafen nach sich ziehen konnte, mussten etliche Männer Rheinbachs dieses Risiko eingehen, wenn sie ihre Familie ernähren wollten. Sein Beruf als Strohdecker bot Franz Tondorff nur ein bescheidenes Auskommen. Er spürte die nasse Schnauze seines Schäferhundes an seiner rechten Hand. Der Hund hatte panische Angst vor Gewittern und suchte bei jedem Donnergrollen die Nähe seines Herrn.
»Ist ja gut, Tilly!«, beruhige Tondorff das unruhige Tier und strich ihm über den Kopf. »Das Wetter kann uns nichts mehr anhaben.« Er hatte seinen Hund nach dem berühmten kaiserlichen Feldherrn benannt, dem in den katholischen Landesteilen auch nach der Beendigung des Dreißigjährigen Krieges große Verehrung entgegengebracht wurde. Trotz der Furcht des Hundes hatte seine Frau nach den fürchterlichen Todesfällen, die sich in den letzten Tagen in der Umgebung Rheinbachs zugetragen hatten, darauf bestanden, dass er nicht ohne seine Begleitung am Abend die Sicherheit der Stadtmauer verließ.
Franz Tondorff hatte jetzt den Waldrand erreicht und durchquerte in geduckter Haltung das hohe Buschwerk, das den Wald zu den bewirtschafteten Feldern abgrenzte. Die Blätter der Büsche, die den Gewitterregen gierig aufgesogen hatten, benetzten seine Kleider. Aber nach der Schwüle des Tages empfand Tondorff dies als angenehme Abkühlung. Etwas mulmig war ihm allerdings zu Mute, als er den Nebel sah, der nach dem Regen wie eine Wand zwischen den Bäumen des Mischwaldes emporstieg. Franz Tondorff besiegte seine Furcht und tauchte in die Nebelwand ein. Er wusste, dass er sich beeilen musste, wenn er seine Fallen noch vor der Dunkelheit finden wollte. Vorsichtig tastete er sich durch das Unterholz des Waldes, das knackend unter seinen Füßen nachgab, und orientierte sich an einigen markanten Bäumen, an die er sich durch das häufige Aufsuchen seiner Fallen erinnerte. Ab und zu blieb er lauschend stehen und achtete darauf, dass Tilly in seiner Nähe blieb. Die befremdlichen Geräusche im nächtlichen Wald waren ihm trotzem unheimlich. Als er an ein kleines Rinnsal kam, das sich seinen Weg über den Waldboden suchte, wusste er, dass er auf dem richtigen Weg war. In wenigen Schritten musste er den Kaninchenbau, vor dem er seine Schlingfalle ausgelegt hatte, erreicht haben. Nachdem er den Wasserlauf mit einem Sprung überquert hatte, hielt er an. Plötzlich überfiel ihn ein eigenartiges Gefühl, das ihm Angst machte. Instinktiv suchte seine Hand nach seinem Hund, der ebenfalls stehengeblieben war und witternd seinen Kopf aufgerichtet hatte. Eine bedrohliche Ruhe hatte sich über den Wald gelegt. Tondorff schaute in die Wipfel der Bäume, denn er meinte ein sonderbares Pfeifen und Rauschen in der Luft zu hören. Auch Tilly schien es bemerkt zu haben, denn aus seiner Kehle drang ein grollendes Knurren.
Wenige Augenblicke später zerrissen laute Schreie die Stille des Waldes. Sie waren so grässlich, dass Tondorff auf die Knie ging und seine Ohren zuhielt. Als er, am ganzen Leibe zitternd, nach einer Weile die schützenden Hände wegnahm, hörte er die Schreie noch immer. In panischer Angst rappelte er sich auf und stolperte gehetzt davon. Seine Flucht war so kopflos, dass er einige Male strauchelte, bevor er endlich den Waldrand erreichte. Er hastete noch einige Schritte auf das Feld hinaus, bevor er völlig entkräftet zu Boden fiel.
Nach einiger Zeit hob er den Kopf und blickte nach Rheinbach. In der Zwischenzeit war es so dunkel geworden, dass er die Umrisse seines Heimatortes in der Ferne nur erahnen konnte.
»Nur noch einen kurzen Augenblick zu Atem kommen, Tilly«, sagte Franz Tondorff keuchend, »und dann nichts wie weg von hier!« Torkelnd kam er wieder auf die Beine, als er merkte, dass sein Hund nicht in seiner Nähe war. Seine Augen suchten die Umgebung ab. »Tilly«, rief er mit unterdrückter Stimme, »wo bist du? Komm zu mir!«
Tondorff wartete einige Augenblicke angespannt. Aber sein Hund war wie vom Erdboden verschwunden. Vorsichtig schlich er an den Waldrand zurück und rief immer wieder in den Wald hinein. Aber Tilly meldete sich nicht. Fünf bange Minuten wartete er noch. Dann drehte er sich um und trat schweren Herzens den Heimweg nach Rheinbach an. Doch schon nach wenigen Schritten plagte ihn sein Gewissen, und er blieb stehen. Ihm fiel es schwer, seinen treuen Gefährten so einfach im Stich zu lassen. Einige Momente kämpfte er noch mit sich. Doch dann erwies sich die Liebe zu seinem Hund größer als die Angst vor den entsetzlichen Geschehnissen im Wald. Tondorffs Blick ging zum Himmel. Dann faltete er seine Hände.
»Lieber Gott, ich lege mein Leben vertrauensvoll in Deine Hände«, betete er, »beschütze mich vor den Dämonen des Waldes!«
Er atmete noch einmal kräftig durch. Dann machte er sich auf den Weg. Als er die Büsche am Waldrand durchquerte, stellte er mit Erleichterung fest, dass der Himmel wolkenlos war, so dass die Sterne und die Sichel des Mondes ihm ein wenig Sicht verschafften. Außerdem hatten sich die Nebelbänke zwischen den Bäumen durch die klare Luft gelichtet. Obwohl er sich stetig Mut zusprach, klopfte ihm das Herz bis zum Hals. Noch einmal verharrte er und lauschte in die Dunkelheit. Gottlob … die furchtbaren Schreie waren nicht mehr zu hören. Dann schlich er im Schutz der Bäume in den Wald hinein. Als er die Stelle erreicht hatte, an der er Tilly das letzte Mal gesehen hatte, blieb er stehen. Angestrengt suchten seine Augen die Umgebung ab. Da hörte er plötzlich lautes Gebell.
Ihm fiel ein Stein vom Herzen. Es war Tilly. Wieder nahm er allen Mut zusammen und hastete in die Richtung, aus der er seinen Hund gehört hatte. Bald erreichte er eine kleine Lichtung, auf der er trotz des diffusen Lichtes seinen Hund erkennen konnte. Aufgeregt lief Tilly hin und her.
Als Tondorff näher kam, sah er, dass der Hund winselnd um eine Gestalt herumlief, die am Boden lag. Mit vorsichtigen Schritten bewegte sich Tondorff auf sie zu. Als er nahe genug war, erschrak er. Es war die alte Cath, seine Nachbarin, die er anhand ihrer Kleidung erkannt hatte. Er beugte sich über sie und zuckte zusammen. Der Körper der alten Frau war mit blutenden Wunden übersät.
Franz Tondorff entfuhr ein heiserer Schrei. Das Gesicht der alten Cath war nicht mehr zu erkennen. Ihre Augen waren aus ihren Höhlen verschwunden, der Rest nur noch eine blutige Masse.
Die Frau bewegte sich.
»Cath!«, rief Tondorff ängstlich. »Was ist?«
Die alte Frau öffnete ihre blutigen Lippen. »Hinweg mit euch … ihr Dämonen der Hölle«, krächzte sie wie von Sinnen, »seid ihr noch immer da?« Sie richtete ihren Kopf ein wenig auf und versuchte etwas zu sagen. Aber sie brachte nur noch unverständliche Laute hervor. Mit einem Röcheln sank ihr Kopf wieder nach hinten.
»Cath … Cath …«, flüsterte Franz Tondorff verzweifelt, »sprich mit mir … was ist passiert?« Als er merkte, dass seine Nachbarin ihm nicht mehr antworten würde, nahm er ihre Hand und sagte: »Halte durch! Ich hole Hilfe!«
Köln, Kurkölnisches Hofgericht
14. August, Anno Domini 1654. Das wummernde Dröhnen der Glocken des Kölner Doms ließ die Scheiben des Raumes vibrieren. Der Vorsitzende des Kölner Hofgerichts schaute nach draußen. Er konnte sich immer noch nicht satt sehen an den mächtigen Türmen dieses prächtigen Kirchenbaus, auf den jeder Kölner Stolz war. Sehnlichst hatte er die Glockenklänge erwartet, kündeten sie doch von zwölf Uhr und der Zeit, in einem der nahen Brauhäuser das Mittagessen einnehmen zu können. Dafür war dort schon seit Jahren für ihn und seine Gerichtsmitglieder eigens ein abgetrennter Raum reserviert.
Er knöpfte sich die Hose zu, denn er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, während der Arbeit am Schreibtisch die beiden obersten Knöpfe seiner Beinkleider zu öffnen, damit ihn sein mächtiger Bauch nicht so sehr drückte. Mühsam erhob er sich.
»So, Ferdinand«, sagte er zu seinem Sekretarius, »das wäre geschafft. Ich meine, jetzt haben wir uns eine gute Portion Hämmchen mit Sauerkraut verdient!«
»Noch nicht ganz«, druckste Ferdinand Schlebusch herum. Er wusste, wie ungehalten sein Vorgesetzter reagieren konnte, wenn er hungrig war. »Da ist heute Morgen noch eine Eingabe aus der Eifel hereingeflattert.« Er hob ein Schriftstück hoch und wedelte damit durch die Luft.
»Von wem ist sie?«, fragte Johann Gelenius missmutig und nahm wieder Platz.
»Von Amtmann Schall von Bell!«
»Und … was will er?«
Der Sekretarius setzte sich noch einmal die Brille auf die Nase und las sich das Schreiben durch. »Er meint, in Rheinbach gingen wieder Hexen und Zauberer um, und das Volk verlange nach einem Hexencommissarius.«
Gelenius verzog das Gesicht. »Was ist genau passiert?«
Noch einmal schaute Ferdinand Schlebusch in den entsprechenden Passus des Schriftstückes. »Wenn ich den Brief richtig verstehe, sind dort wohl in den letzten Tagen mehrere Morde begangen worden!«
Johann Gelenius überlegte. Dann schlug er mit beiden Händen auf den Schreibtisch. »Hört das denn nie auf, dass das dumme Volk gleich hinter jedem Verbrechen und allen anderen Ungereimtheiten Hexenwerk vermutet? Da sind wir froh, dass wir endlich die lodernden Scheiterhaufen aus fast ganz Kurköln verbannt haben, da schreit das einfältige Gesindel schon wieder nach einem Hexencommissarius!« Der Hofrat stierte auf den Schreibtisch.
»Können wir denn nicht vielleicht«, nuschelte der Sekretarius durch seine schlechten Zähne, »den Dominikaner dorthin schicken?«
Der Hofrat schaute auf. Dann erhellte sich seine Miene. »Schlebusch!«, polterte er los. »Manchmal sind Sie doch zu was zu gebrauchen! Es gefällt mir zwar nicht, den klugen Kopf nicht mehr in Köln zu wissen, aber für einige Tage können wir ihn entbehren.« Gelenius stand wieder auf und drängte seinen übergewichtigen Körper am Schreibtisch vorbei. »Lassen Sie nach Pater Philipus schicken und machen Sie die Papiere fertig!«, sagte er und nahm seinen Hut von der Garderobe. »Ich werde sie gleich nach dem Mittagsmahl unterschreiben.« Dann verließ er das Zimmer.
Missmutig blieb Ferdinand Schlebusch zurück. Hätte er doch nur seinen Mund gehalten. Jetzt war er um die verdiente Mittagspause gebracht.
Burg Lüftelberg
15. August, Anno Domini 1654. Der Dominikanerpater trieb Aphrodite noch einmal mit einem kräftigen Schenkeldruck an, als er das stattliche Burghaus vor sich liegen sah. Auch wenn der Ritt von Köln in die Eifel anstrengend gewesen war, hatte er ihn doch genossen.
Noch gestern Abend hatte er sich in die Stallungen des kurfürstlichen Palastes begeben, um sich ein Pferd für seine Reise auszusuchen. Es war Liebe auf den ersten Blick, als er die Schimmelstute sah. Als sie ihre Nüstern an seinen Körper rieb, wusste er, dass ihre Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Es war schon einige Zeit her, seit er das letzte Mal auf einem Pferd gesessen hatte. Mit etwas Wehmut erinnerte er sich daran, dass er in seiner Jugend auf dem Landsitz seiner Familie viele Stunden in den Pferdeställen verbracht hatte. Sein Vater war als Marstall des Bischofs von Kleve ein Angehöriger des Niederadels gewesen und hatte sehr darauf geachtet, dass seine drei Söhne eine gute militärische Ausbildung genossen, zu der vor allen Dingen Reiten und Fechten gehörte. Ihm war schließlich als Jüngstem der Brüder nur die Laufbahn eines Geistlichen geblieben.
Sein Blick schweifte über das Burghaus hinweg zu einer Kirche am Rande des Dorfes. Pater Philipus lächelte. Er wusste, dass in ihr die Gebeine der heiligen Lüfthildis verehrt wurden. Nicht nur wegen seines Gespräches mit dem Hausherrn der Burg, dem Amtmann Schall von Bell, sondern auch wegen der Heiligen hatte sich der Pater entschlossen, zunächst Lüftelberg aufzusuchen, bevor er weiter nach Rheinbach ritt. Er wollte unbedingt an ihrem Grab beten und ihre Hilfe erflehen, bevor er seine Untersuchungen aufnahm.
Als er über die Felder in Richtung Burg ritt, beobachtete er, wie die Bauern des Dorfes das Sommergetreide einbrachten. Mit Genugtuung stellte er fest, dass die Ernte nach den schrecklichen Hungersnöten, die noch vor einigen Jahren das Rheinland heimgesucht hatten, dieses Mal üppig ausfiel. Er parierte Aphrodite vom leichten Trab in den Schritt, als er das Burgtor passierte. Im Innenhof hielt er an und betrachtete zunächst das Anwesen. Bewundernd stellte er fest, dass sich sowohl das Herrenhaus als auch die angrenzenden Wirtschaftsgebäude in einem äußerst gepflegten Zustand befanden.
Als er vom Pferd glitt und seine vom langen Ritt steif gewordenen Glieder reckte, bemerkte er eine Person, die mit federnden Schritten aus einem der Ställe auf ihn zu kam. Pater Philipus schätzte den Mann, dessen drahtige Figur ganz in Leder gekleidet war, in seinem Alter. An seinem rechten Arm trug er eine lederne Schutzmanschette. Er erinnerte sich, dass sie Falkner zum Schutz vor den Krallen der Raubvögel anlegten.
»Willkommen auf Burg Lüftelberg!«, sagte der Mann und lächelte freundlich. »Ich nehme an, Sie sind der Hexencommissarius, auf den der Amtmann schon so sehnsüchtig wartet!«
Der Mönch stutzte. Dann lächelte er und reichte dem Mann die Hand. »Nein, nein«, sagte er, »mein Name ist Pater Philipus van der Velde. Ich komme aus dem Dominikanerkloster Heilig Kreuz in Köln.«
»Dann sind Sie also nicht wegen der schrecklichen Vorfälle hier in der Gegend?«, fragte sein Gegenüber und schüttelte herzlich die dargebotene Hand.
»Doch, doch«, entgegnete der Pater, »aus diesem Grund hat man mich hierhin geschickt. Und … mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Oh, entschuldigen Sie. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt«, der junge Mann deutete eine leichte Verbeugung an, »Johannes von Wartenberg. Ich bin der Verwalter der Gutsherrschaft!«
»Mein Respekt«, sagte der Pater und ließ seinen Blick noch einmal anerkennend über das Anwesen schweifen. »Sie scheinen Ihre Arbeit zu verstehen – alles ist in einem tadellosen Zustand!«
»Danke für die freundlichen Worte«, erwiderte von Wartenberg. »Es ist zwar sehr viel Arbeit. Aber ich mache sie gerne.« Mit einem Wink zum Herrenhaus fuhr er fort: »Kommen Sie! Ich bringe Sie jetzt zum Amtmann. Außerdem brauchen Sie bestimmt eine Stärkung!«
»Danke«, erwiderte Pater Philipus bescheiden und klopfte sich den Reisestaub aus der Kutte. »Es wäre mir schon recht, wenn ich etwas zu trinken haben könnte. Zuvor muß jedoch mein Pferd versorgt werden.«
»Natürlich«, antwortete von Wartenberg, »ich gehe einmal kurz in den Stall hinüber und schaue, ob sich jemand darum kümmern kann.« Der Burgverwalter lief über den Hof und verschwand in einem der Gebäude. Kurz darauf erschien er in Begleitung eines älteren, aber drahtigen Mannes. »Das ist Mathias Reimberg, meine rechte Hand, und der erfahrenste Pferdeknecht auf Gottes weitem Erdenrund!« Johannes klopfte seinem Begleiter auf die Schulter.
»Da hat Aphrodite ja Glück gehabt«, entgegnete der Pater und reichte dem Knecht die Hand.
»Ein schönes Tier, das Sie da haben«, stellte der Pferdekenner anerkennend fest und klopfte der Stute auf den Rücken. Dann nahm er die Zügel und zog Aphrodite hinter sich her. Brav folgte sie dem Pferdeknecht in den Stall.
Die beiden Männer sahen den beiden nach. Dann stiegen sie die Treppe zum Herrenhaus hoch.
»Bemerkenswert, dass Sie den weiten Weg von Köln geritten sind!«, sagte von Wartenberg bewundernd. »Es ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Mönch zu Pferd daherkommt.«
»Ich bin nicht immer Geistlicher gewesen«, entgegnete der Pater forsch und folgte dem Gutsverwalter durch die mächtige Eingangstür ins Haus. »In meiner Jugend habe ich viel Zeit auf dem Pferderücken verbracht. Ich habe den Ritt hierhin genossen!«
Von Wartenberg steuerte durch den sparsam möblierten Eingangsbereich auf eine mit Ornamenten verzierte Flügeltür zu. Kurz bevor er sie erreicht hatte, öffnete sie sich, und es erschien eine üppige Magd mit einem weißen Kopftuch. In ihren Händen trug sie einen Eimer. Sie schloß die Tür hinter sich. »Na, Margarethe, wie ist denn die Laune des gnädigen Herrn?«, fragte er.
Die Magd verdrehte die Augen. »Sie wissen doch, wie seine Stimmung ist, wenn ihn das Zipperlein plagt.«
»Schlimmer als gestern kann die Gicht doch wohl nicht sein!«, erwiderte der Verwalter lächelnd.
»Sie werden’s schon sehen«, flüsterte die Magd, denn von Wartenberg hatte die Tür wieder geöffnet. Er gab dem Dominikanerpater mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass er ihm folgen sollte.
Als Pater Philipus das große, saalartige Zimmer betrat, zog ihn zunächst die Wandbekleidung mit dunklem Holztafelwerk, welche den Raum wie einen altertümlichen Rittersaal aussehen ließ, in seinen Bann. Dann schweifte sein Blick zu einem großen Eichentisch am hinteren Ende des Saals, an dem ein fülliger, kahlköpfiger Mann in einem weißen, mit Rüschen besetzten Seidenhemd saß. Seine Hosen hatte er bis zu den Knien hochgekrempelt, weil seine Beine in einem Waschzuber standen. »Margarethe!«, brüllte er der Magd hinterher, »vergiss ja nicht, nach dem Doktor zu schicken, dass er mich heute Abend zur Ader lässt!«
Noch einmal erschien der Kopf der Magd in der Tür. »Nein, mein Herr. Ich werde es schon nicht vergessen«, rief sie und zog die Tür hinter sich zu.
Erst jetzt nahm der alte Amtmann mit seinen wässrigen Augen den Gast zur Kenntnis. Eingehend musterte er den Dominikaner. Dann grummelte er unfreundlich: »Na, Johannes, was bringst du mir denn da für ein Pfäfflein?«
»Das ist Pater Philipus von den Dominikanern in Köln, Herr Amtmann!«, antwortete der Verwalter.
»Und was will er?«
»Man hat ihn geschickt, um die Vorfälle hier in der Gegend zu untersuchen!«
»Vorfälle!«, brauste der Amtmann auf und bewegte dabei seine Füße mit schmerzverzerrtem Gesicht im heißen Wasser. »Das sind keine Vorfälle. Das ist ausgemachtes Hexenwerk! Wen schickt mir der Gelenius vom Hofgericht denn da? Die Sache braucht einen juristisch ausgebildeten Hexenkommissar!« Einen Moment holte er Luft. Dann stand er auf und schrie mit puterrotem Kopf weiter. »Der Teufel und seine Kumpanen massakrieren hier einen nach dem anderen auf entsetzlichste Weise, so dass sich kein Mensch mehr abends aus dem Hause traut, und was schickt mir da Kurköln? Einen Mönch! Hätte ich doch bloß nicht auf Schnehagen gehört und beim Hofgericht in Bonn nachgefragt!«
Pater Philipus war ganz ruhig geblieben. Er wartete, bis sich der Tobende wieder hingesetzt hatte. Dann sagte er mit leiser Stimme. »Vielleicht lesen Sie zunächst einmal das Empfehlungsschreiben des Hofgerichtsvorsitzenden, bevor Sie sich weiter ereifern, Herr Schall von Bell!« Der Dominikanerpater zog das Schreiben aus der Kutte und legte es auf den Tisch.
Widerstrebend nahm der Amtmann das Schriftstück auf. Dann griff er mit seinen fleischigen Fingern nach seiner Brille und setzte sie auf. Mit düsterer Miene überflog er das Schreiben. »Ein scharfsinniger Kopf sollen Sie also sein«, sagte Schall von Bell mit einem spöttischen Unterton. »Als einen ausgezeichneten Logiker beschreibt Gelenius Sie hier.« Er hob den Kopf und schaute den Mönch durchdringend an. »Wie und wo haben Sie diese Fähigkeiten denn schon bewiesen?«
»Mir ist es gelungen, schon mehrere Todesfälle in Köln aufzuklären«, entgegnete der Pater. »Zunächst in unserem Kloster. Später hat mich das Hofgericht auf Empfehlung meines Priors auch zu anderen Verbrechen hinzugezogen.«
»Verbrechen im Kloster? Gibt es sowas auch?«, fragte der Amtmann amüsiert. »Nennen Sie mir ein Beispiel!«
»Eigentlich sollte diese Geschichte hinter den Klostermauern bleiben. Aber da sie in Köln durch die Indiskretion meiner Mitbrüder schon jeder kennt, erzähle ich sie Ihnen: Es ging um einen Eifersuchtsmord wegen einer widernatürlichen Liebesbeziehung zwischen meinen Mitbrüdern.«
»Ha! Sagte ich es doch!«, brüllte der Amtmann und schlug sich vor Vergnügen auf den Oberschenkel. »Die hinter den Klostermauern, die treiben es am Schlimmsten!«
Der Mönch schaute zur Seite und tat so, als hätte er die Bemerkung überhört.
»Aber nein, Pater Philipus!«, polterte Schall von Bell wieder los. »Hier bei uns ist die Sachlage ganz klar. Da brauchen wir keinen Ermittler. Diese Taten können nur Ausgeburten der Hölle ausgeführt haben. Ich habe die Opfer selber gesehen. Kein normaler Mensch ist in der Lage, jemand auf so bestialische Weise umzubringen!«
»Sie glauben gar nicht, wozu der normale Mensch in der Lage ist«, widersprach der Dominikanermönch gelassen. »Schauen Sie doch nur an, wozu er im Dreißigjährigen Krieg im Stande war!«
Der Amtmann ließ sich nicht umstimmen und schüttelte den Kopf. »Glauben Sie mir! Ich weiß Bescheid«, fuhr er fort. »Wir hatten das letzte Mal vor achtzehn Jahren mit solchem Teufelsgezücht hier in der Gegend zu tun. Nachdem wir reichlich davon verbrannt hatten, prophezeite mir der damalige Hexencommissarius Jan Möden, dass sich die Brut in Rheinbach versteckt halte und nur darauf warte, wieder loszuschlagen! Er hat leider recht behalten!«
»Ich sage ja nicht, dass es nicht so sein kann«, versuchte Pater Philipus den Amtmann zu beschwichtigen. »Vielleicht hat der Teufel wirklich seine Hand im Spiel. Aber lassen Sie mich die Sache erst einmal untersuchen, bevor wir nach dem Hexencommissarius rufen!«
Schall von Bell überlegte einen Moment. Dann nahm er einen seiner Füße aus dem Zuber und massierte ihn. »Ich weiß zwar nicht, warum die Herren in Köln sich so davor scheuen, die Teufelsbrut zu verbrennen«, sagte er mit schmerzverzerrtem Gesicht, »aber meinetwegen. Meinen Segen haben Sie. Untersuchen Sie die Sache!«
Der Dominikanerpater war froh, dass er das Gespräch jetzt auf eine sachliche Ebene gelenkt hatte. »Um wie viele Todesopfer handelt es sich mittlerweile?«, fragte er.
Schall von Bell sah hilfesuchend seinen Verwalter an. »Mit der alten Frau aus Rheinbach, die vor fünf Tagen zu Tode gekommen ist …«
»… sind es jetzt vier«, half Johannes von Wartenberg dem Amtmann auf die Sprünge.
»Sehen Sie! Es gibt nichts, was Johannes nicht weiß«, lobte der Burgherr seinen Verwalter. »Aber nähere Auskünfte über die Todesfälle können nur Bürgermeister Schnehagen und der Vicarius Stotzheim in Rheinbach geben! Ich nehme an, Sie werden im Pfarrhaus übernachten?«
Pater Philipus nickte.
Der Amtmann gab zu verstehen, dass er das Gespräch beenden wollte. »Johannes, geleite den Pater nach draußen und sorge dafür, dass die Küche ihn anständig verköstigt, bevor er weiter nach Rheinbach reist!«
Der Verwalter machte eine leichte Verbeugung und verließ mit dem Mönch den Raum.
»Übrigens, Johannes«, rief Schall von Bell seinem Verwalter hinterher, »zeige unserem Gast auch unsere Falkenzucht!« Die Art und Weise, wie der Amtmann das sagte, verriet, dass sie wohl sein ganzer Stolz war.
Pater Philipus war von der Anmut und Schönheit der Vögel begeistert. Mit leuchtenden Augen schaute er in das Gehege, in dem die Vögel majestätisch auf ihren Holzpfosten saßen. »Wie viele Jagdvögel haben Sie insgesamt?«, fragte er Johannes.
»Fünf!«, antwortete der Falkner. »Hier in diesem Käfig befinden sich die drei kleineren Greifvögel! Zwei Habichte und …«
»… ein Wanderfalke!«, beendete der Dominikanerpater den Satz.
»Sie scheinen sich ja auszukennen«, zeigte sich der Falkner überrascht.
»Neben den Pferdeställen meines Vaters gab es eine Falknerei, die ich in meiner Kindheit oft besucht habe. Daher weiß ich ein wenig darüber Bescheid.«
»Dann kommen Sie einmal mit zum nächsten Gehege! Da werden Sie staunen!«, sagte Johannes geheimnisvoll.
Der Pater folgte ihm. Als sie es erreichten und Pater Philipus hineinsah, war er überrascht. »Ein weißer Gerfalke!«, sagte er bewundernd.
»So ist es«, flüsterte der Verwalter und fuhr mit Pathos in der Stimme fort: »›Falco rusticanus‹, die weltweit größte Falkenart. Sein Name ist Omar. Er stammt aus der Zucht des Emirs von Tunis und ist ein Geschenk an den Kurfürsten. Dieser hat ihn seinerzeit dem Amtmann zum Abrichten übergeben.«
Die Augen des Mönchs konnten sich gar nicht von dem wunderschönen Tier lösen, als er schon von Johannes aufgefordert wurde weiterzugehen. »Schauen Sie erst einmal dorthin!«, sagte der Falkner stolz und deutete auf die linke Seite des Geheges.
»Das glaube ich nicht!«, entfuhr es Philipus.
»Doch, Sie sehen richtig!«, sagte Johannes. »›Aquila chryseatos‹, ein Steinadler. Der König aller Greifvögel!«
Als das mächtige Tier die beiden Männer sah, wurde es unruhig. Es ließ ein lautes Krächzen vernehmen, machte einige Trippelschritte mit seinen Krallen auf der hölzernen Plattform und spannte seine Flügel auf.
»Wie sind seine Maße?«, wollte der Mönch wissen, wobei ihn die dunkelbraunen Vogelaugen durchbohrend anstarrten.
»Es ist ein Weibchen, und sie heißt Amalie. Sie hat eine Körperlänge von über zwei Ellen, und ihre Flügelspannweite beträgt nahezu fünf.«
Pater Philipus hatte einmal gehört, dass dieser mächtige Vogel in den Alpen sogar Steinböcke und Wölfe erbeutete. Als er die riesigen Krallen und die Größe des spitz nach unten gebogenen Schnabels sah, konnte er das verstehen. »Nehmen Sie ihn auch mit auf die Jagd?«, fragte der Dominikaner.
»Natürlich. Ich nehme alle Tiere mit. Sie sorgen für eine abwechslungsreiche Küche.«
»Das glaube ich Ihnen gerne«, antwortete der Pater lächelnd und dachte an das köstliche Wildkaninchen, das man ihm eben in der Küche serviert hatte.
»Der Amtmann ist wegen seiner Gebrechen leider nicht mehr in der Lage, seiner großen Jagdleidenschaft nachzukommen. Wie wäre es? Haben Sie nicht einmal Lust, mich auf der Falkenjagd zu begleiten?«
»Wenn es meine Zeit hier erlaubt, komme ich gerne noch einmal auf Ihr Angebot zurück«, sagte Pater Philipus ausweichend. Er bewunderte die stolzen Tiere zwar, aber an einer blutigen Tierhatz war ihm nichts gelegen.
Eine halbe Stunde später befanden sich die beiden Männer im Hof der Burganlage und verabschiedeten sich voneinander. Pater Philipus hatte schon sein Pferd bestiegen.
»Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Untersuchung in Rheinbach!«, sagte Johannes von Wartenberg und reichte dem Dominikanerpater die Reisetasche auf das Pferd.
»Herzlichen Dank! Aber ich möchte noch am Grab der heiligen Lüfthildis beten, bevor ich mich auf den Weg mache«, sagte der Mönch und befestigte die Tasche mit einem Lederriemen am Sattel.
Der Verwalter überlegte einen Moment. »Warten Sie!«, sagte er. »Ich hole mein Pferd und begleite Sie. Auch ich gehe täglich zur Kirche und verrichte bei der Heiligen mein Gebet!«
»Es wäre mir eine Ehre«, antwortete der Pater erfreut.
Als er wenige Minuten später neben dem Burgverwalter am Grabe der Heiligen kniete und ihn aus den Augenwinkeln beten sah, wusste er, dass Johannes von Wartenberg nicht nur ein äußerst fähiger Verwalter und Falkner, sondern auch ein frommer und gottesfürchtiger Mann war.
Es war schon später Nachmittag, als der Gesandte des kurkölnischen Hofrats am östlichen Rheinbacher Stadttor anlangte und den Torwächter um Einlass bat. Von dem etwas höher gelegenen Lüftelberg hatte er sich auf seinem Ritt nach Rheinbach einen guten Überblick über sein Reiseziel verschaffen können. Schon von weitem konnte er sehen, dass der Ort ringsum von reich angebauten Feldern und Obstplantagen umgeben war. Hinter ihm, in südlicher Richtung, erhoben sich die ersten Eifelhöhen mit ihren mächtigen Eichen- und Buchenbeständen. Auch im Dominikanerkloster hatte er schon einige Informationen über den Ort, in dem er seine Untersuchungen anstellen sollte, eingeholt. Einige Mitbrüder kannten die kleine Stadt von früheren Inspektionsreisen. Dabei hatte Pater Philipus erfahren, dass der unter Kurkölner Kontrolle stehende Ort nicht durch den Dreißigjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen war. Daher konnte er durch eine gut florierende Landwirtschaft, Handel, blühendes Tuchhandwerk und Gerbereiwesen zu einigem Vermögen kommen. Somit waren die Stadtväter auch in der Lage gewesen, Rheinbach durch den Ausbau der Befestigungen zu einer wehrhaften Stadt zu machen, die durch einen breiten Wassergraben und hohe Mauern umschlossen war. Davon konnte sich Pater Philipus nun mit eigenen Augen überzeugen, als er sich seinem Ziel näherte. Er zählte nicht weniger als sieben Wehrtürme; dazu kamen noch die beiden Türme der Burg, die der Ort an seinem südöstlichen Ende in seinen Mauern beherbergte. Außerdem fiel dem Pater sogleich auf, dass Rheinbach mit zwei Kirchen gesegnet war, denn zwei Kirchtürme überragten die Häuser und waren schon aus der Ferne zu erkennen.
»Wer da?«, erklang eine barsche Stimme aus der obersten Fensterluke über dem mit einem Fallgitter verschlossenen Stadttor.
Der Dominikanermönch blinzelte angespannt gegen die untergehende Sonne nach oben. Dann formte er mit den Händen einen Trichter und rief laut: »Pater Philipus vom Kloster Heilig Kreuz in Köln bittet um Einlass!«
Kurz darauf erschien das Gesicht des Torwächters, das den Dominikaner an ein Wiesel erinnerte, im Turmfenster. »Und was sucht ein Mönch zu Pferd um diese Uhrzeit vor den Toren Rheinbachs?«, schallte es von oben herunter.
»Ich bin Gesandter des Kurkölnischen Hofgerichts und soll die Todesfälle in dieser Gegend untersuchen.«
»Aha, endlich! Der Hexencommissarius! Warten Sie!«
»Ich bin nicht der …«, Pater Philipus wollte das Missverständnis klarstellen. Doch er sah, dass der Wächter schon den Kopf aus der Luke gezogen hatte. Kurze Zeit später wurde das Fallgitter mit knarrenden Geräuschen nach oben gezogen. Der Pater stieg vom Pferd, schritt durch das Tor und führte Aphrodite hinter sich her.
Auf der anderen Seite wurden sie bereits vom Torwächter erwartet, der in großer Eile die Treppen des Turmes hinabgestiegen sein musste. Seine Landsknechtkleidung und zahlreiche Narben im Gesicht verrieten, dass er einem der vielen Söldnerheere des Dreißigjährigen Krieges entstammte und wohl in Rheinbach eine Anstellung in der Stadtwache gefunden hatte. Als Ausdruck seiner Autorität hielt er eine Hellebarde in der rechten Hand. »Es ist gut, dass Sie dem Höllenspuk hier endlich ein Ende bereiten«, sagte er und stützte sich dabei auf seine Waffe. »Seit dem grässlichen Tod der alten Cath traut sich keiner mehr aus der Stadt!«
»Ist das auch der Grund, warum die Tore schon so früh geschlossen sind?«, wollte der Pater wissen.
»Bürgermeister Schnehagen hat es so angeordnet«, antwortete der Kriegsveteran, »obwohl die Morde alle außerhalb der Stadt passiert sind. Er meinte: Sicher ist sicher!«
»Da hat er recht, euer Bürgermeister«, lächelte der Dominikanermönch. »Können Sie mir sagen, wo ich das Haus des Vicarius finde?«
»Aber natürlich!« Der Torwächter deutete in Richtung Stadtmitte. »Der Pfarrer wohnt genau gegenüber der Kirche St. Gregorius. Sie können das Haus nicht verfehlen!«
»Ich danke Ihnen, Herr …?« Der Pater schaute den Wächter fragend an.
»Eick, Walter Eick!«, stellte sich der alte Soldat mit einer Verbeugung vor.
»Ich nehme an, wir werden uns in den nächsten Tagen noch des Öfteren sehen«, sagte Pater Philipus und zog sein Pferd stadteinwärts hinter sich her.
»Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen, wenn Sie die Stadt durch dieses Tor verlassen wollen!«, lachte der alte Landsknecht dem Geistlichen hinterher.
Kurze Zeit später hörte Philipus, wie das Fallgitter des Stadttors wieder herabrasselte.
Als der Dominikaner die Straße, die die beiden Haupttore Rheinbachs verband, an der Fachwerkfront der angrenzenden Häuser vorbei in Richtung Kirche hinaufging, fiel ihm auf, dass eine gespenstische Ruhe herrschte. Niemand befand sich auf der Straße. Nur die Geräusche der arbeitenden Menschen aus den Hinterhöfen der Häuser bewiesen, dass Rheinbach bewohnt war. Die Vorfälle in den letzten Tagen schienen eine lähmende Angst in der Bevölkerung hervorgerufen zu haben. Pater Philipus wusste genau, wie beeinflussbar der kleinmütige Geist der Menschen auf dem Lande bei der Vorstellung war, dass bei solchen Dingen Teufelskunst und Hexerei die Hand im Spiel haben. Gerade als der Pater die Kirche erreicht hatte, schlug die Turmglocke wie zu seiner Begrüßung sieben Mal.
Im Kirchenschiff von St. Gregorius wurde gesungen. Vicarius Stotzheim schien mit einem Lied gerade die Abendandacht zu beenden. So blieb Philipus stehen und band die Stute an einem der Eisenringe fest, die an der Straßenseite eines jeden Hauses angebracht waren, um das Pfarrhaus näher zu betrachten. Es überraschte ihn, dass das imposante dreistöckige Fachwerkhaus das größte auf Rheinbachs Hauptstraße war. Das mächtige Tor zur Linken des Anwesens bewies, dass sich dahinter ein Innenhof mit einer Reihe von Wirtschaftsgebäuden befinden musste. Er schüttelte den Kopf, als er an seine winzige Klosterzelle in Köln dachte, in der er seinen Dienst im Namen des Herrn verrichtete.
Die Tür des Hauptportals der Kirche ging auf, und die Besucher der Andacht strömten hinaus. Es waren in der Mehrheit Frauen, die mit ernsten Mienen die Kirchentreppe hinunterstiegen. Es dauerte nicht lange, und auf der Treppe erschien eine schlanke, große Gestalt mit vollem schwarzem Haar im Priesterhabit, die sich noch angeregt mit einer Kirchenbesucherin unterhielt. Trotz des Kopftuchs konnte Pater Philipus erkennen, dass sie langes blondes Haar und ein hübsches Gesicht hatte. Die beiden beendeten ihr Gespräch und schüttelten sich die Hände.
Der Priester setzte sich sein Barett auf den Kopf und ging die Treppe hinunter auf das Pfarrhaus zu, während die Frau die Straße in entgegengesetzter Richtung hinuntereilte.
»Vicarius Stotzheim?«, rief der Dominikaner zum Rheinbacher Pfarrer hinüber.
Der Priester war so in Gedanken, dass er Reiter und Pferd auf der anderen Straßenseite noch nicht bemerkt hatte und regelrecht erschrak, als er seinen Namen hörte. Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte den Mönch eine Weile an. »Sie müssen Pater Philipus van der Velde von Heilig Kreuz in Köln sein«, sagte er schließlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dabei entblößte er sein Gebiss, in dem schon einige Zahnlücken zu erkennen waren. »Dem Herrn sei Dank!«, fuhr er fort und ging auf den Dominikaner zu. »Da sind Sie ja endlich! Ich habe Sie schon früher erwartet.« Freudig reichte er dem Besucher die Hand. »Dem Schreiben des kurkölnischen Hofgerichts war zu entnehmen, dass Sie schon in aller Frühe in Köln aufbrechen wollten!«
»Das bin ich auch«, entgegnete der Pater, »aber ich habe noch einen Abstecher zum Amtmann Schall in Lüftelberg gemacht.«
»Kommen Sie!«, sagte der Vicarius und fasste den Dominikaner an die Schulter. »Davon müssen Sie mir unbedingt erzählen! Aber lassen Sie uns zunächst einmal ins Haus gehen.«
Als sie die Pfarrei erreicht hatten, holte er einen großen Schlüssel aus der Tasche seiner Soutane. Er wollte das große Hoftor aufschließen, als es schon von innen durch eine kleine Gestalt in grauer Arbeitskleidung geöffnet wurde, deren krummer Rücken in einem Buckel endete.
»Heinrich!«, begrüßte der Pfarrer den Türöffner. »Hast du uns gehört? Ich habe einen Gast mitgebracht!«
Aber der Bucklige schaute nur unsicher zur Seite und wich den Blicken des Paters aus. Wortlos riss er dem Dominikaner die Zügel aus der Hand, löste die Reisetasche vom Sattel und übergab sie dem verdutzten Gast. Dann drehte er sich um und zog das Pferd über den Hof hinter sich her.
Der Vicarius wartete, bis er in der Scheune verschwunden war. »Machen Sie sich nichts draus!«, sagte er. »Heinrich ist etwas seltsam. Er hatte eine schwere Kindheit. Aber glauben Sie mir: Wenn er sich erst an Sie gewöhnt hat, wird er Sie in sein Herz schließen.«
Wollen wir es hoffen, dachte Philipus und folgte dem Priester in das Pfarrhaus.
Eine halbe Stunde später saßen die beiden Geistlichen in einer kleinen Laube, die sich im Garten hinter den Stallungen des Anwesens befand. Wegen des schönen Spätsommerabends hatten sie sich entschlossen, ihre Abendmahlzeit im Freien einzunehmen. Pater Philipus war von der Großzügigkeit des Fremdenzimmers und der Herberge so angetan, dass er sich die Frage an seinen Gastgeber nicht verkneifen konnte, ob alle Landpfarrer so komfortable Pfarrhäuser zur Verfügung gestellt bekamen.
»Oh nein, wo denken Sie hin!«, lachte der Vicarius laut auf. »Das ist in Rheinbach reiner Zufall. Das Anwesen gehörte einem angesehenen und vermögenden Bürger Rheinbachs, der Opfer der letzten Hexenverfolgung wurde.«
Das Thema schien dem Rheinbacher Pfarrer nicht genehm zu sein. Nervös nahm er seine Pfeife vom Tisch und versuchte mit hektischen Griffen, Tabak in den Pfeifenkopf zu stopfen. »Es ist anschließend durch eine Schenkung an die Kirche geraten«, fuhr er mit leiser Stimme fort.
»Sieh an! Wovon unsere Mutter Kirche nicht alles profitiert!«, entgegnete der Pater mit einem ironischen Unterton.