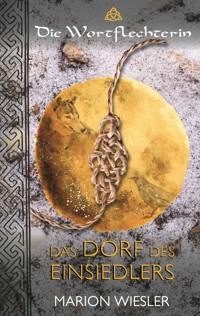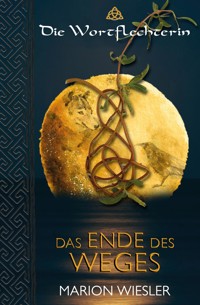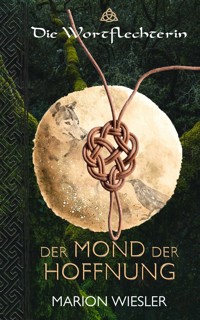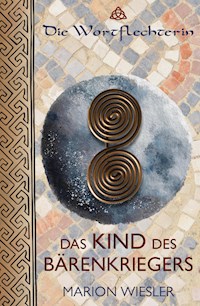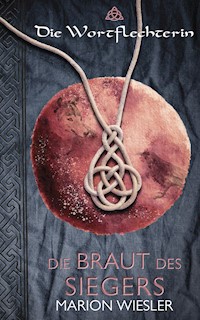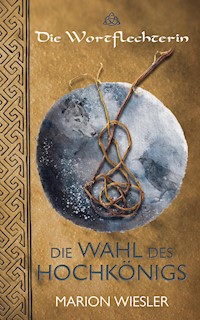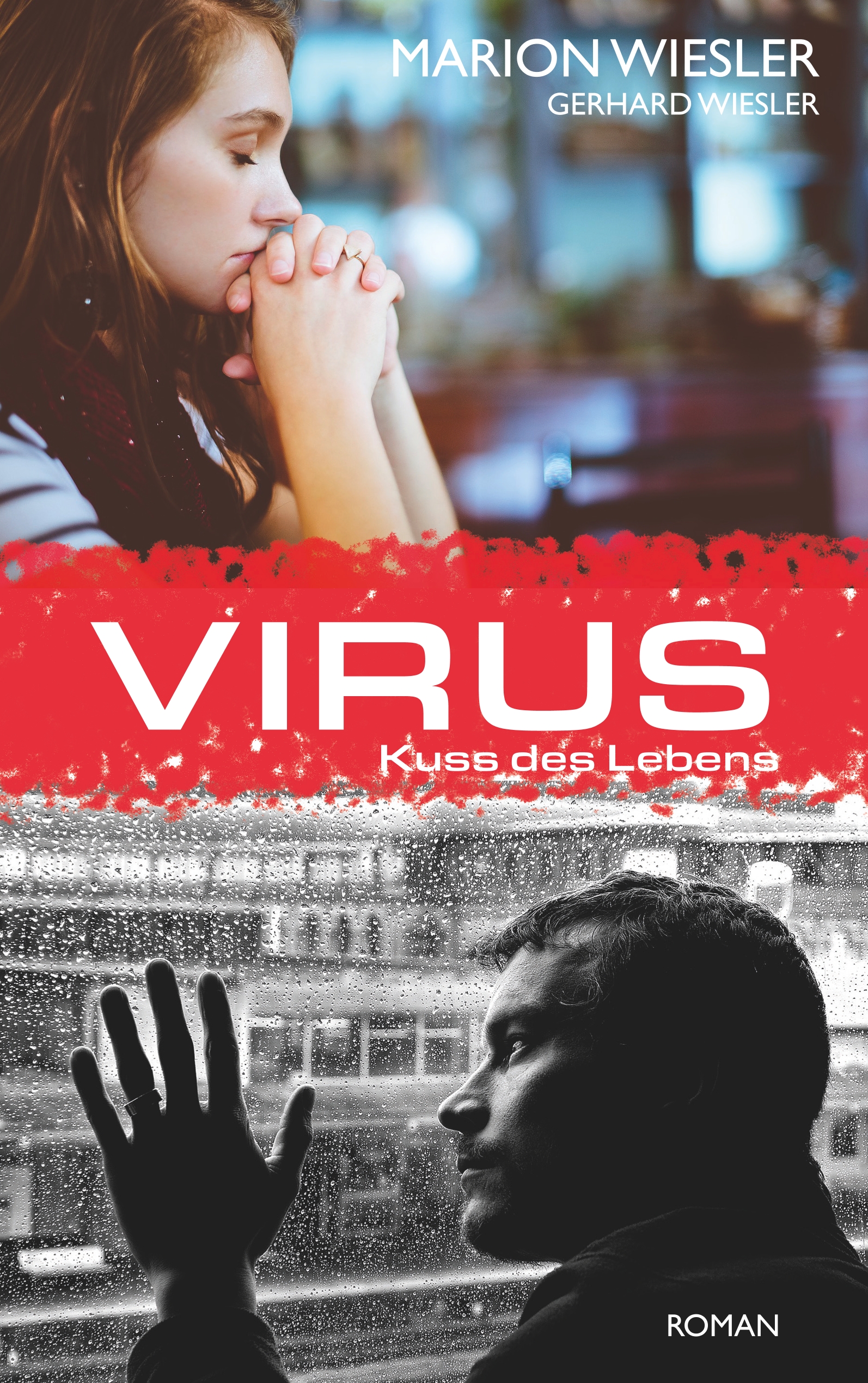Die Schattenseherin
Band 1
Marion Wiesler
Pragantia Books
Copyright © 2025 Marion Wiesler
Copyright © 2025 Marion Wiesler All rights reservedPragantia BooksElz 678182 Puch bei Weizwww.marionwiesler.atCover: Jannike TantonLektorat: Susanne Gebhart-SiebertAlle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin und Herausgeberin wiedergegeben werden.Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.ISBN ebook: 978-3-903560-28-4
Leben, Tod und Schatten – zwischen hier und der Anderswelt geschehen die schönsten Abenteuer.
Am Schlachtfeld
Sie drängten sich um mich, wie jede Nacht. Von Ruhm hatte ich geträumt, von einem raschen Sieg. Von Baldrams anerkennenden Blicken.
Aber nicht davon.
Hunger, ohne Lust, etwas zu essen. Der Lärm, der nie aufhörte. Ruhelose Nächte, während die anderen Kriegerinnen im Zelt erschöpft schliefen. Wie ich wünschte, ich könnte aufwachen. Könnte aus Alpträumen hochschrecken, wie Suna es getan hatte, in den ersten Tagen der Schlacht. Doch Suna war nun unter jenen, die mich wach hielten. Und sie alle waren kein Traum. Sie waren auch um mich, wenn die Sonne aufging. Wenn wir am Feuer saßen und warteten. Schweigend ich, zu erschöpft für Worte. Klagend sie, jammernd, mich bedrängend, seit sie gemerkt hatten, dass ich sie sehen konnte.
Wodans Warzen, mussten sie denn nie schlafen? Was meinten sie denn, das ich tun könnte? Das Band lösen, das sie noch hier hielt? Wie denn? Ich konnte sie nicht ins Leben zurückholen, konnte ihnen hier auch nicht helfen, in die Anderswelt weiterzuziehen. Wie sollte ich ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, wenn ich nicht einmal meine eigenen stillen konnte? Nach Schlaf. Nach einer sättigenden Mahlzeit. Nach Stille.
Und ich würde mich hüten, jemandem von ihnen zu erzählen. Ruhmreich sei es, im Kampf zu fallen, wurde uns von Kindheit an erklärt, doch jene, die sich um mich scharten, sie hatten nichts Ruhmreiches an sich. Wenn diese erbärmliche Verzweiflung Ruhm darstellte, konnte ich gerne darauf verzichten.
Jemandem vom Leid der Toten zu erzählen, würde mein Ansehen als Kriegerin sehr rasch zerstören. Als Verräterin unserer Sache könnte man mich bezeichnen, als eine, die versuchte, den Kampfesmut zu schmälern. Als Schwächling, der schon in seiner ersten größeren Schlacht zusammenbrach. Ich war durchaus schnell mit meiner Zunge, aber ich war nicht so dumm.
Außerdem – sollte ich den Frauen, Müttern und Schwestern, die in den Lagerzelten am entferntesten Rande des Schlachtfelds auf unseren Sieg hofften, erzählen, dass ihr Mann, Sohn oder Bruder, der für sie und das Überleben des Stammes in den Tod gegangen war, nicht soeben in der Anderswelt ein neues, ruhmreiches Leben begann, sondern verzweifelt umherirrte, seinen abgehackten Arm oder sein Bein suchte, sich mühte, sich das Schwert aus dem Leib zu ziehen?
Sie trauerten auch so schon genug.
Wenigstens versprach der heutige Morgen warm und sonnig zu werden, ein Lichtblick nach der kalten Nacht. Vielleicht wandelte sich heute ja auch das Geschick und diese Kämpfe nahmen ein Ende und wir hätten endlich Gelegenheit, unsere Toten mit den nötigen Riten der Göttermänner zu bestatten. Für manche von ihnen wäre es bis dahin vielleicht zu spät, den Weg in die Anderswelt noch einzuschlagen. Sie würden diese Wiesen auf ewig besiedeln, auch wenn längst der zertrampelte, blutgetränkte Boden des Schlachtfelds sich wieder in fruchtbare Felder und Weiden verwandelt hätte.
Aber es gab Hoffnung. Einige unserer Männer hatten das Heiligtum jenes Ortes gestohlen, den wir erobern wollten. Untergehen oder sich andere Landstriche zu eigen machen, wo unser Stamm gedeihen konnte, etwas anderes gab es nicht, nachdem wir von den Turonen und Markomannen aus unserer Heimat jenseits des Danubius vertrieben worden waren.
Baldram hatte nicht damit gerechnet, dass Voccio inzwischen Herr über fast alle Stämme südlich des Flusses war und sofort seinen Ziehsohn mit einer großen Schar an Kriegern schicken würde. Dass wir nicht nur gegen die Einwohner des Ortes, sondern gegen ein ganzes Heer kämpfen mussten. Auch wenn er es gewusst hätte, es gab keinen anderen Weg für uns.
Aber nun hatten wir die hölzerne Göttinnenstatue Ovilavias. Und Baldram sagte, auf diese Weise hätten die Römer im Westen schon viele Stämme besiegt. Wenn man ihnen ihr Heiligtum nahm, den Schutz ihrer Gottheit, dann verloren die Menschen all ihren Kampfesmut und ergaben sich. Zaghafter Siegesglauben regte sich in dieser Morgendämmerung wieder an den Lagerfeuern. Doch reichte es, wenn die Bewohner Ovilavias sich ergaben? Würden Voccios Männer nicht dennoch weiterkämpfen? Es war schließlich nicht ihre Gottheit, die nun in Baldrams Zelt am Boden lag.
Im ganzen Lager herrschte angespannte Stille. Wir saßen rund um die Feuer, schärften und ölten die Schwerter, starrten über das Schlachtfeld zu Voccios Lager hinüber. Nichts regte sich noch dort. Die Sonne begann gerade erst, über die Erdenkante zu klettern. Wer wusste, ob sie in Ovilavia überhaupt schon den Diebstahl bemerkt hatten.
Von Zeit zu Zeit machte einer der Krieger einen lahmen Scherz, von Zeit zu Zeit fluchte eine der Wachen lautstark, die bei den Leichenhaufen am Lagerrand versuchten, die Krähen davon abzuhalten, nach den Toten zu pecken.
Ich wollte nur noch schlafen. Starrte auf das trockene Brot in meiner Hand und bemühte mich, das Wehklagen der Toten um mich herum nicht zu beachten. Es fiel mir inzwischen schwer, ihre Stimmen von denen der Lebenden zu unterscheiden.
Plötzlich jedoch entstand Unruhe an den Feuern. Es hieß, ein Weib wäre ins Lager gekommen, unbewaffnet und alleine. Eine Botin aus Ovilavia? Oder von Voccio?
Die Gerüchte und Vermutungen über dieses Weib waren eine willkommene Ablenkung in der Anspannung des Morgens und übertönten sogar zeitweise die Stimmen der Toten.
Nun sei sie in Baldrams Zelt, hieß es nach einer Weile. Vielleicht war sie tatsächlich das Zeichen unseres Sieges oder zumindest für beginnende Verhandlungen? Hoffnung schien aufzukeimen wie die ersten Blätter des Beinwells im Frühling.
Ich ging zu den Pferden hinüber. Das Gerede und all die wilden Vermutungen der anderen hatten mich unruhig gemacht. Warum begab sich ein junges Weib unbewaffnet und alleine in ein Lager voller Krieger? Sie war keine Kriegerin, ihrem Gewand und ihrer zarten Gestalt nach, sagten jene, die sie gesehen hatten. Bedeutete sie Sieg, Untergang oder Frieden? Ich wollte nicht darüber nachdenken. Striegelte stattdessen die Pferde, die hier bei den Zelten und nicht hinten auf der Weide standen. Baldrams Hengst, mir vertraut wie mein eigenes Pferd. Die Pferde seiner beiden höchsten Krieger. Unruhig waren sie die letzten Tage gewesen, dem Geruch von Verwesung und Blut ausgesetzt. Doch langsam schienen sie abzustumpfen.
War es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass man die Fremde nun gefesselt und geknebelt an einen Pfahl neben den Pferden band? Sie war tatsächlich zart und dünn, doch sie trug ihren Kopf hoch erhoben trotz des Knebels, den man ihr in den Mund geschoben hatte. Ihr Anblick bewegte etwas in mir, das ich nicht deuten konnte. Baldram stand vor seinem Zelt und beobachtete, wie der Krieger sie festband. Sein Blick fand mich, durchdringend, kalt. Ich zog mich zu den Feuern zurück. Seit ich nicht mehr als sein Bursche galt, schätzte er es nicht, wenn ich mich um sein Pferd kümmerte.
Die Neugier trieb viele in ihre Nähe, sie genauer zu sehen. Die Toten drängten sich wieder an mich, bestürmten mich, ihre Qualen zu beenden. Ich war zu müde für Hoffnung auf Frieden und Verhandlungen und hatte auch keine für dieses Weib. Ich kannte Baldram zu gut. Was ihm nicht zu Nutzen war, war ihm so viel wert wie der Dreck unter seinen Fingernägeln. Wer auch immer sie war, er würde sie hinrichten. Eine tote Stimme mehr.
Und trotzdem schien die Sonne und vertrieb die Kälte des Morgens. Bald wäre es Mittag. Daheim als Kind wäre nun die Zeit gewesen, wo Mutter mich aus dem Stall oder von der Pferdekoppel zu sich gerufen hätte, um ihr bei den letzten Handgriffen beim Kochen zu helfen, um mit ihr gemeinsam die Gesten der Hausherrin zu vollführen, die die Speisen segneten. Es wäre jene Zeit gewesen, wo ich nicht meines Vaters Sohn, sondern meiner Mutter Tochter sein durfte. Die Erinnerung daran durchfuhr mich unerwartet, brennend und schmerzhaft, nach all den Jahren fern unserer Hütte, fern des Duftes meiner Mutter, ihr Haar einst so rot wie jenes der Fremden am Pfahl.
Baldram und einige der hohen Krieger hatten die Fremde nun in ihre Mitte genommen und schritten auf das Schlachtfeld. Von der anderen Seite kamen Männer Voccios. Es würde Verhandlungen geben! Die Fremde musste wohl eine bedeutende Rolle spielen. Vielleicht war sie sogar bedeutender als die gestohlene Göttinnenstatue. Wir starrten gespannt auf die Gruppe Krieger, die einander gegenüber standen, zu weit weg, als dass wir Einzelheiten erkennen könnten.
»Wird Voccios Ziehsohn sich uns ergeben?«, fragte jemand hinter mir.
»Eher wird er wohl uns Bedingungen stellen, unter denen er bereit ist, die Kämpfe einzustellen«, sagte ein anderer.
»Geh!«, flüsterte eine Stimme in mein Ohr. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass es Suna war. Meine einzige Freundin unter den Kriegerinnen, schon seit jenem Tag, da aufflog, dass ich kein Junge war. Suna, die vor zwei Tagen in der morgendlichen Schlacht gefallen war. Suna, die nicht aufhörte, mich zum Gehen überreden zu wollen, seit sie entdeckt hatte, dass ich sie sehen konnte. Suna, die ich vermisste wie den Schlaf und das freudige Lachen.
Ich schüttelte den Kopf. Gehen! Welch wahnwitziger Vorschlag! Meinen Stamm verlassen, mich feige von der Schlacht davonschleichen. Odins Hoden, wie konnte sie, die meine Freundin gewesen war, so etwas verlangen? Baldram würde mich schon für den Gedanken daran umbringen und ich selbst die Schmach, meinen Stamm zu verlassen, nicht ertragen.
Als die Krieger zurückkehrten, das Weib immer noch in ihrer Mitte, ihr Kopf hoch erhoben trotz des Knebels und der Fesseln, drängten sich alle um die kleine Gruppe, um die Neuigkeiten der Verhandlungen zu erfahren.
Es dauerte nicht lange und es hieß, man würde die Fremde einem Urteil der Götter unterziehen.
Erneut stand Suna hinter mir, während ich unseren Kriegern zusah, die Kohlen für einen Feuerlauf herantrugen.
»Geh!«, sagte Suna. »Geh, solange sie nicht hersehen. Du musst gehen! Du darfst nicht hier am Schlachtfeld sterben!«
Ich zuckte die Schultern. Viele waren gefallen, warum sollte ich nicht auch mein Leben hier beenden und vielleicht gar mit Suna in der Anderswelt ein neues beginnen?
»Geh!«, wiederholte sie. »Ich bin erst bereit, weiterzuziehen, wenn ich dich in Sicherheit weiß.«
Ich beachtete sie nicht, hatte den Blick auf die Fremde gerichtet. Ich fühlte deren Stärke. Fühlte ihre Haltung in mir, die Kraft, die sie zu durchströmen schien wie Feuer. Bei Wodan, woher nahm sie diese? Sie war alleine. Gefesselt und geknebelt, in den Händen von Feinden, die ihr die dünnen Schuhe von den Füßen rissen, die voller Gier waren, sie leiden zu sehen. Wie konnte ein Mensch, wie konnte ein Weib, so in sich ruhen? Sie war keine Kriegerin, nur ein einfaches Weib, das war klar zu erkennen. Und doch solche Kraft! Ich sah sie über die Kohlen gehen, ruhigen Schrittes, erhobenen Hauptes. Das Gegröle der Krieger war verstummt, geifernde Hoffnung auf ihren Schmerz erfüllte die Gesichter aller. Auch jenes Baldrams. Seine funkelnden Augen, die nur darauf warteten, dass sie stürzte, sich in glühender Pein wand. Doch sie ging, Schritt für Schritt. Und sie sang. Sie sang ein Lied, während ihre Füße über glühende Kohlen schritten! Ein Lied ohne Worte, doch von solcher Kraft, von solcher Wärme, dass es mich durch und durch erfüllte, wie eine Umarmung meiner Mutter, wie die Kraft eines wilden Hengstes, der mit mir über weite Wiesen galoppierte.
Kein Gedanke war mehr in meinem Kopf. Nur dieses Gefühl, diese Kraft dieser Frau, deren Leben in Baldrams Hand lag und die mir wie eine Göttin schien.
»Geh«, sagte Suna erneut.
Und ich ging.
Der Klang des Liedes erfüllte mich bei jedem Schritt, schob mich weiter.
Ich zog mich aus der Gruppe der Umstehenden zurück. Legte mein Schwert ab. Ging an den Lagerfeuern der Krieger vorbei. Weg von den Zelten, in denen unsere Frauen und Kinder auf ein neues Leben hofften. Selbst weg von der Weide, auf der mein Pferd graste. Vorbei an dem Haufen Leichen, für die die Hoffnung, hier sesshaft zu werden, sich anders erfüllt hatte als erwartet.
Niemand hielt mich auf. Alle starrten auf die Fremde, die über die Kohlen schritt.
Das kurze Stück über eine Wiese, ehe eine Böschung und die tiefe Rinne eines Bächleins mich vor den Blicken der anderen verbargen. Niemand hatte mir Beachtung geschenkt, niemand hatte mich gesehen.
Mein Kopf so leer und mir doch so bewusst meiner Umgebung. Die niedergetrampelten Grashalme, die jeden Versuch, sich wieder aufzurichten, aufgegeben hatten. Die feuchte Kühle des Erdreichs, in das so viele von uns gebettet werden würden. Der Schlamm, der in den letzten Tagen vom Boden auf meine wollenen Braccae gekrochen war, bis hinauf zu meinen Knien.
Wie im Traum ging ich weiter, gebückt, die Füße im kalten Wasser des Baches, der so voller Leben, so voller Kraft, so voller Hoffnung war im Gegensatz zu der Erde rund um unsere Feuer.
Meines Vaters Sohn war ich gewesen, wild und arbeitsam. Meiner Mutter Tochter, folgsam und versteckt. Dann Baldrams Geheimnis. Kriegerbursche und angehende Kriegerin. Alles davon schien mir wie eine Maske und ich fragte mich, sollte ich heute noch auf den Haufen der Gefallenen gebettet werden, als was würde ich in der Anderswelt erwachen? Wer war ich, jenseits dessen, was die anderen aus mir gemacht hatten?
Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Sah nur diese Frau vor mir – an dem Pfahl, geknebelt aufs Schlachtfeld gehend, auf den Kohlen, ihre zarte Gestalt, ihr rot leuchtendes Haar. Wer auch immer sie war, sie war alleine hierher gekommen. Unbewaffnet. Sich ihrer selbst so sicher. Für sie vielleicht der Weg in den Tod, aber für mich wie ein Zeichen der Götter.
Wurzeln und Laub unter meinen dünnen Sohlen. Die Stimmen der Toten in weiter Ferne, gebunden an den Ort ihres Todes. Ganz leicht wurde es unter meinem Brustbein, weil ich ihrer gequälten Verwirrung nicht mehr ausgeliefert war.
Ich beugte mich über das Bächlein, trank das eiskalte Wasser, belebend und wohltuend.
Wie friedlich es hier war. Kein Lärm außer dem Gurgeln des Wassers und dem Gezwitscher zweier Vögel, die sich irgendwo im Geäst unterhielten. Kaum vorstellbar, dass nur wenige Mannlängen entfernt Krieger seit Tagen Blut vergossen.
Ich wandte mich um und sah zu den Zelten zurück.
Eine Enge erfasste meine Kehle. Wie ein Erwachen war es. Das Gegenteil des Erwachens aus einem Alptraum, wo man froh war, dass die Welt, in die man zurückkehrte, nicht so grauenvoll war wie jene der Traumgespinste. Hier war das Schöne der Traum des Vogelgezwitschers, des gurgelnden Baches; der Blick in meine wahre Welt der Schrecken.
Jäh wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Ich hatte meinen Stamm verlassen. Mich wegen des Anblicks einer fremden Frau dazu verleiten lassen, alle Sicherheit hinter mir zu lassen. Ohne Stamm zu sein, alleine – es war eine der höchsten Strafen, die ein Stamm über Verbrecher verhängte. Wodans Warzen, ich hatte mich von einem Lied einhüllen lassen wie eine Fliege im Spinnennetz!
Noch könnte ich zurück. Noch hatte vielleicht niemand mein Verschwinden bemerkt oder ich könnte es mit einer Ausrede überdecken. Es war uns verboten, das Lager zu verlassen, aber ich konnte bestimmt behaupten, einfach am anderen Ende, bei den Frauen oder den Pferden gewesen zu sein …
Gleich. Gleich würde ich mich auf den Rückweg machen. Nur ganz kurz noch wollte ich die Stille genießen. Ganz kurz Kraft schöpfen an diesem Ort, der so nahe dem Schlachtfeld doch so unberührt von seinen Gräueln lag.
Ich setzte mich ins Laub und sah in das kahle Geäst hinauf. Ein paar Tage noch, dann würden die Haseln und Weiden in Blüte stehen, nahrhafte kleine Haselschlangen, die dann von den Zweigen hängen würden, fellweiche Weidenknospen. Den Büschen und Bäumen war es gleich, dass nebenan Schlachten tobten. Nur das Gras und die zarten Keime des Wintergetreides auf den Äckern, sie konnten sich nicht wehren gegen den Ansturm an Pferdehufen und Menschenfüßen.
Ich versuchte, die beiden Vögel ausfindig zu machen, die sich irgendwo über mir unterhielten. Vogel sein, das wäre wohl die größte Freiheit. Mit der Kraft der eigenen Flügel sich über alles erheben können, allem entfliehen können, in Bereiche, wo kein Mensch je hinkam.
Weich war das Laub auf der Böschung.
So herrlich ruhig war es hier.
So tröstlich das Vogelgezwitscher.
Als ich wieder erwachte, schien der Mond, kalt und gnadenlos. Wodans Warzen! Verfluchte Müdigkeit! Unmöglich, dass man meine Abwesenheit noch nicht bemerkt hatte. Meine einzige Hoffnung war, dass die Kriegerinnen, mit denen ich das Zelt teilte, annahmen, dass Baldram mich hatte zu sich rufen lassen, wie er es öfter tat. Hatte er es tatsächlich getan … dann war jede Hoffnung umsonst.
Ich musste zurück. Rasch und unauffällig. Klamm und feucht war mein Gewand, so klamm wie mir das Herz in der Brust klopfte. Gebt ihr Götter, dass Baldram nicht nach mir verlangt hat!
Ich schlich zurück, so rasch es mir möglich war. Noch brannten einige der Feuer, noch schliefen nicht alle. Ich konnte nicht warten, bis das Lager zur Ruhe käme, denn es kam nie völlig zur Ruhe. Es hatte keine Schlacht gegeben heute. Die Wachen würden nicht erschöpft sein. Keine Möglichkeit, auf jener Seite ins Lager zu gelangen, die sich dem Schlachtfeld zuwandte. Keine Möglichkeit auch, mich dort am Lager vorbei zu schleichen, um von der Seite Ovilavias hinein zu gelangen, wo dichtes Gebüsch mir vielleicht die nötige Deckung gäbe.
Es blieb nur der Weg in Richtung des Danubius, wo die Zelte der Frauen standen, weit vom Schlachtfeld entfernt. Ich kroch dorthin, bewegte mich langsam und vorsichtig, um im Mondenlicht nicht entdeckt zu werden. Als es nicht mehr weit war, als ich nur noch wenige Mannlängen hinter mich bringen musste, um zwischen den ersten Zelten verschwinden zu können, schlugen die Hunde an. Bald mischten sich die aufgeschreckten Stimmen von Frauen darunter, aber auch jene von Männern. Ich zog mich eilig zurück, schweißgebadet. Wie hatte ich die Hunde vergessen können, die zu unseren Bauern gehörten wie die Pferde zu uns Kriegern.
Einen Weg wusste ich noch. Zwischen den Leichenhaufen hindurch. Ich musste nur langsam sein, so langsam, dass den Wachen die Bewegung nicht auffiele. Dass sie meinten, es sei nur ein Leichnam, dessen Körper ein wenig von dem Haufen hinabrutschte.
Der Gestank war unerträglich, der süßliche Geruch der Verwesung klebte sich in meine Nase, auf meinen Gaumen, auf meine Haut. Der Mond wanderte schnell im Vergleich zu mir. Handbreit für Handbreit schob ich mich vorwärts. Mein Blick stets auf die Wache gerichtet, die zwischen den Haufen auf und ab ging, Mund und Nase mit einem Tuch bedeckt.
Bald hätte ich es geschafft. Nur noch ein bisschen durchhalten. Nur nicht zu früh aufspringen und davonlaufen. Ich schob mich weiter, sah plötzlich Füße vor mir aus dem Nichts auftauchen. Viele Füße. Schlammige, blutige Schuhe, nackte Füße. Allen voran die Füße einer Frau. Ich erstarrte, hob vorsichtig den Kopf. Da standen sie, die Toten, und versperrten mir den Weg. Ausnahmsweise schweigend. Nur Suna an ihrer Spitze sprach.
»Geh«, sagte sie. »Geh!«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich bin tot, wenn ich gehe«, flüsterte ich.
»Du bist tot, wenn du zurückkehrst«, sagte Suna. »Das will keiner von uns. Du kannst uns sehen. Du musst leben, um welchen wie uns helfen zu können.«
Ich fühlte Tränen gegen meine Augen drücken. »Du solltest nicht mehr hier sein, Suna. Du musst gehen, du solltest in der Anderswelt sein, nicht hier.« Dann könnte sie mir nicht den Weg versperren. Dann würde sie einfach glücklich sein, geborgen in den Armen einer neuen Mutter.
»Ich kann nicht gehen«, sagte sie. »Ich kann erst in die Anderswelt, wenn ich weiß, dass du fern von Baldram bist. Er ist irgendwann noch dein Tod.«
Ich schüttelte den Kopf. Sie konnte es nicht verlangen. Sie konnte nicht verlangen, dass ich meinen Stamm verließ. Sie war meine Freundin, meine einzige Freundin.
Aufspringen wollte ich, alles daransetzen, durch diese Kette an Toten hindurchzulaufen, auf die Gefahr hin, dass der Wächter mich entdeckte. Es brauchte dann nur eine Ausrede. Dass ich gemeint hätte, Bewegung im Haufen der Leichen gesehen zu haben. Vor mir, das waren Tote, körperlos, egal, wie menschlich sie noch wirkten. Und doch waren sie wie eine Wand. Jene, die die Toten nicht sehen konnten, sie gingen durch sie hindurch, sie spürten es nicht einmal. Einmal hatte ich das auch versucht. War von jenem alten Mann abgeprallt, als wäre ich gegen einen Baum gelaufen. Konnte ich es wagen? Nein, besser, ich schob mich langsam vorwärts, versuchte, mich behutsam durch ihre Reihen hindurchzuschieben.
»Geh«, sagten sie nun alle, ständig wiederholt wie der Herzschlag in meiner Brust. »Geh. Geh. Geh.«
Und kein Durchkommen. Wie eine Wand, wie eine Palisade, die ein Dorf umgibt. Undurchdringlich.
Bald würde der Morgen dämmern. Keine Möglichkeit dann mehr, ungesehen ins Lager zu kommen. Aber auch keine Möglichkeit mehr, ungesehen zu verschwinden.
Quälend langsam schob ich mich wieder zurück, die Toten mir Schritt für Schritt folgend, mich beinahe vor sich her treibend, wenn auch so langsam wie das Tor einer Palisade, wenn ein Mann alleine versuchte es zu schließen.
Als ich erneut das kurze Wiesenstück erreicht hatte, eilte ich zurück in die Deckung der Böschung des Baches. Einen letzten Blick warf ich zurück, sah, wie Suna sich auflöste, meinte gar, dass sie noch die Hand zum Gruß hob.
Ich begann zu laufen, tief über das Wasser gebeugt, und hörte nicht auf zu laufen, bis ich inmitten des Waldes erschöpft zusammenbrach.
Alleine
Wodans Warzen! Verfluchtes Weib mit den roten Haaren!« Mein Atem ging immer noch stoßweise, Schweiß rann meine Haut hinab. Meine Augen ruhten auf dem braun gesprenkelten Laub des vorigen Herbstes, meine Hände pressten sich in meine Oberschenkel, um mir Halt zu geben. Ich wagte nicht, mich zu setzen, wagte nicht, meiner Erschöpfung erneut nachzugeben, stand nur vorgebeugt da, um kurz ein wenig Kraft zu sammeln.
»Beim Gestank aller Eber dieses Waldes, beim Gestank aller Leichen in unsrem Lager, wie konnte ich nur! Ein Lied, ein dämliches Lied, und ich verlasse das Lager! Oh, Suna, Suna, ich hasse dich, ich hasse dich …« Wut, ja Wut brauchte es nun. Und doch kamen nur Tränen. Ich weinte um Suna. Ich weinte um mich, dass der Rotz auf das Laub tropfte.
Ich hatte meinen Stamm verlassen. Zurückzukehren wäre der schnellere Tod gewesen. Nun gab es kein Zurück mehr. Meine einzige Rettung war Weitergehen. Weit, weit weitergehen.
Niemand, bei Odins Hoden, niemand durfte je herausfinden, dass ich Suebin war. Er würde es sonst erfahren, irgendwie würde Baldram es erfahren. Mochten es die Ameisen sein oder die Adler, jemand würde es ihm verraten, und dann käme er, mich zurückzuholen. Um mich zu töten. Vor allen. Langsam, quälend. Das konnte er nicht verzeihen. Niemandem. Auch mir nicht. Mir schon gar nicht. Ich verzieh es mir selbst nicht.
Und niemand, niemand durfte je erfahren, dass ich Kriegerin war. Nichts schändlicher, als seinen Stamm in einer Schlacht aus Feigheit verlassen zu haben. Ja, denn so würden sie es sehen, als Feigheit. Was konnten sie auch schon vom verfluchten Lied dieser von allen Dämonen der Sümpfe geschickten Frau verstehen. Kein Stamm achtete einen Krieger, der in einer Schlacht geflohen war, keiner.
Ich könnte mich wohl gleich hierher legen und warten, dass sie mich fanden. Ich sank in die Knie, rollte mich im Laub zusammen. Warum nur? Warum hatte Suna verhindert, dass ich zurückkehrte? Irgendwie hätte ich es doch gewiss geschafft, irgendeine Ausrede wäre mir noch eingefallen … Außer, Baldram hatte bereits nach mir geschickt, zu ihm zu kommen für jene Nacht … Es gab keine Ausrede, die seiner Wut standhalten konnte.
Meine Nase war zugeschwollen vom Weinen und doch roch ich den feuchten Duft des Bodens, herb und würzig, Duft alter Eichenblätter. Bäume meiner Heimat. Bäume, die ich nie gemocht hatte. Ihre Früchte Futter für die Schweine, ihr Schatten wohltuend im Sommer, und doch, jeder Wald, ob Eiche, Buche oder Esche, ein Ort des Versteckens, ein Ort der Hindernisse.
Vergraben im Laub sah ich weite Wiesen vor mir, unendliche Flächen, auf denen riesige Herden von Pferden galoppierten. Bilder aus Geschichten, die meine Muttermutter mir erzählt hatte, von den Gebieten unserer Urahnen, die einst weit in Richtung des Sonnenaufgangs gelebt hatten. Hier, im Schatten der Bäume liegend, meinte ich, die Wärme der Sonne zu spüren, die Kühle des Windes, die Kraft der Pferde. Frei waren diese Tiere, so unendlich frei. In ihrem wilden Lauf ungehindert von Bäumen und Bergen und Stammesgesetzen.
Immer hatte ich davon geträumt, diese weiten Wiesen eines Tages zu sehen, doch jedes Jahr brachte uns weiter in Richtung des Sonnenuntergangs. Und jetzt, jetzt lag ich da, inmitten eines dichten Waldes, keine Spur von Kraft in mir …
Aber immerhin, frei war ich nun. So konnte man es auch sehen. Frei. Frei zu tun, was ich wollte. Frei zu gehen, wohin ich wollte. Frei, alleine und einsam umzukommen, wenn ich nicht vorsichtig war …
Nun, alles Weinen und Fluchen würde mir nichts nützen. Mochte Suna glücklich sein in der Anderswelt. Mochte die verfluchte Fremde doch noch von Baldrams Hand sterben oder ihm entkommen.
Ich würde es Baldrams Häschern nicht einfach machen, mich zu finden. Würde mich nicht hier auf den Boden legen und warten, dass sie meiner Spur folgten und mich zurück schleiften. Ich würde überleben, meinen Weg finden und eines Tages vielleicht sogar die Herden der Pferde des Sonnenaufgangs sehen. Weiter also.
Als es Mittag wurde, sah ich ein kleines Gehöft in der Ferne. Mein Magen knurrte laut, mein Herz klopfte immer noch aufgeregt.
Neben dem Gehöft floss in Bach und ich sah ein Mädchen von dort zu den Häusern eilen, hörte die Stimme einer Frau nach ihr rufen. Sollte ich es wagen, mich blicken zu lassen? Würden sie sofort erkennen, dass ich von der Schlacht kam, die keinen halben Tag entfernt tobte? Gewiss. Meine Braccae waren mit Schlamm bespritzt, meine Camisia an den Ärmeln mit braungetrocknetem Blut, in meinem Gesicht die blaue Bemalung der Krieger. Wahrscheinlich würde mich auch der Klang meiner Worte verraten, mochten wir auch die gleiche Sprache sprechen. Ich zögerte. Da erblickte ich am Bach, wo das Mädchen hergekommen war, etwas Helles. Kleidung. Ein Blick zum Gehöft, dort war niemand mehr zu sehen. Dann ein rascher Weg zu dem Busch, auf dem etwas zum Trocknen ausgebreitet war. Frauengewand. Eine lange Camisia in einem weichen Braun, ein Peplos in einem Karomuster.
Meine Finger zitterten, als ich die Kleidung nahm und eilig den Bach entlang davonlief. So hungrig ich war, mich in einem gestohlenen Gewand an jenem Hof zu zeigen, wo ich es entwendet hatte, wäre wohl doch zu frech.
Als ich mich weit genug entfernt fühlte, hielt ich in einem Wäldchen an. Nass war die Kleidung noch. Frisch gewaschen, sauber und gut riechend. Ich schlüpfte aus meinen dreckigen Braccae und der Camisia. Ich wusch mich in einem eisigen Bach, wusch die grob gemalten Striche von meinen Wangen, versuchte auch, das Blut und den Dreck aus meinem Gewand zu schrubben. Dann löste ich den Haarknoten, den ich wie alle Krieger meines Stammes seitlich am Kopf gebunden hatte, wusch mein Haar, flocht es zu einem schlichten Zopf, der zwischen meine Schulterblätter fiel, braunglänzend wie eine Blindschleiche.
Die Sonne schien durch das noch kahle Geäst der Bäume und ich breitete alles in der frühlingshaften Wärme aus. Nackt saß ich da, kaute an ein paar zarten Trieben einer Buche und starrte auf die Gewandteile. Kriegergewand hier, wie es auch die Männer trugen. Frauengewand dort, wie ich es in meinem Leben nur dann hatte tragen dürfen, wenn Vater weg war. Als Mann wäre ich unterwegs sicherer. Aber ich wollte nicht mehr Iorco sein, der Sohn des Pferdezüchters, und auch nicht Iorca, die Kriegerin.
Die Götter hatten mir Frauengewand zurechtgelegt. Würden sie wollen, dass ich Iorca bliebe, hätte das Mädchen die Braccae ihres Herrn gewaschen.
Meine Finger strichen über die grobe Wolle des Peplos. Es war kein Übergewand einer Hochgeborenen, eher das einer Bäuerin oder Magd. Schmal geschnitten, sparsam bemessene Stoffbahnen, nicht die üppige Weite, in der die Reichen ihre Stoffe webten. Die Camisia war am Saum bereits etwas abgewetzt, doch ihre Ärmel waren lang. Sie würden die Schrammen und die beiden Narben auf meinen Unterarmen verbergen, die von meinem Leben als Kriegerin zeugten.
Sohn war ich gewesen, Stalljunge, Bursche und später Kriegerin, kaum unterscheidbarer von den Kriegern als ein männlicher Dachs von einem weiblichen.
Nun würde ich Magd werden, dies war, was dieses Gewand mir riet. Das Gewand und meine Fähigkeiten im Umgang mit Tieren. Ich würde mich auf einem Hof im Stall verdingen, verborgen von den Blicken der Welt, eingebettet in den Duft meiner Kindheit von Heu und Vieh.
Warm klang der Name in meinem Kopf, den meine Mutter mir gegeben hatte. Cateia.
Ich schlüpfte in das noch feuchte Frauengewand. Übte mich in vorsichtigen Schritten, wie ein Weib zu gehen, das ihr Leben auf einem Hof und nicht kämpfend verbrachte. Dachte an meine Mutter und wie sie sich bewegt hatte, fühlte ihre Bewegungen in mir.
Mein altes Gewand rollte ich zu einem Bündel. Kurz überlegte ich, es zu verbrennen, um keine Spuren zu hinterlassen. Doch ein Teil von mir hing daran. Vor allem an den Beinkleidern, in denen es sich so viel besser bewegen ließ als in der langen Camisia. Vielleicht war es mir eines Tages noch von Nutzen. Und wenn es nur als warmes Untergewand war.
Mit Glück fand ich vor Sonnenuntergang noch einen Hof. Wenn nicht, würde ich eben erneut im Freien übernachten.
Ein Hof
Den Rest des Tages ging ich durch einen großen Wald, immer querwaldein, in der Richtung des Sonnenuntergangs. Ich hatte mir mit meinem Messer einen langen Stab abgeschnitten, einen gerade gewachsenen Haselstecken, dessen Dicke angenehm in meiner Hand lag und der gut geeignet war, mich beim Gehen durch das unwegsame Dickicht zu unterstützen und mir im Notfall auch als Waffe zu dienen. Er gab mir ein Gefühl der Sicherheit, auch wenn ich damit wohl nicht ein wütendes Wildschwein besiegen könnte. Ich vermisste mein Schwert, das ich im Lager zurückgelassen hatte. Aber wahrscheinlich war es besser so. Eine Magd mit einem Schwert? Das würde schnell die Runde machen und war genau etwas, nach dem Baldram lauschen würde.
Mit jedem Schritt fühlte ich mich besser. So still war es hier. Kein Schwerterklirren, kein Gestöhne der Verletzten, keine Stimmen der Toten. Nur hier und da das Hämmern eines Spechts, das Rascheln einer Maus im Laub, der Gesang des Windes. Stimmen der Götter, die mir Frieden versprachen.
Als der Abend zu dämmern begann, traf ich auf einen schmalen Weg. Nicht breit genug für einen Ochsenkarren, bestenfalls ein Fußweg oder vielleicht mit Pferden genutzt. Wo mochte er hinführen? Vielleicht lag tief im Wald eine Heilige Lichtung, zu der die Menschen an den Festtagen hingingen? Oder die Hütte einer weisen Frau, die man um Rat fragte? In welcher Richtung sollte ich dem Pfad folgen, wo nahm er seinen Anfang?
Ich entschied mich, nach rechts auf ihn abzubiegen. Als ich vom Schlachtfeld bei Ovilavia gen Sonnenuntergang geflohen war, lag der Danubius zu meiner Rechten, in der Entfernung kaum sichtbar. Sollte der Fluss nicht einen Knick gemacht haben, so waren meine Aussichten auf eine Siedlung dort wahrscheinlich größer.
Ehe ich jedoch auf den Weg einbog, zog ich mein altes Gewand unter die Frauenkleidung. Es war zwar nicht wärmer, denn meine Braccae und die Camisia waren immer noch feucht, aber es sähe wohl eigenartig aus, wenn man einem Weib mit einem Bündel Männerkleidung in der Hand begegnete.
Es dauerte erstaunlich kurz, bis der Wald zu einem Ende kam und ich hinter einigen Feldern eine Palisade entdeckte. Ein großes Gehöft, vielleicht gar eine Siedlung. Ich hielt inne, überlegte mein Vorgehen.
Ich kehrte zurück zu der Gangart der Frauen, mit kleineren Schritten und leichterem Tritt. Fuhr mir mit den Händen durch die Haare, um sie zu zerzausen. Auf den Feldern war niemand zu sehen und so senkte ich erst kurz vor dem Tor in der Palisade den Kopf, ließ die Schultern vorfallen. Durch die Öffnung sah ich ein älteres Weib aus einem der Gebäude treten. Ein Weib war gut. Weiber waren mitleidiger als Männer.
Wenn ich etwas von Baldram gelernt hatte, dann, dass es wichtig war zu wissen, mit welchem Verhalten man am meisten erreichen würde. Wie man den Feind täuschte, in Sicherheit wiegte. Manchmal war es besser, Stärke vorzutäuschen, manchmal Schwäche. In so manchem Übungskampf hatte ich schon einen der Männer besiegt, weil ich kurz das schwache Weib durchscheinen ließ. Es verwirrte sie immer – so sehr sie die Schwäche nutzen wollten, es gab immer diesen einen Augenblick, ehe sie losstürmten, da sie in mir ihre Tochter, ihre Mutter oder ihre Geliebte vor sich sahen, die sie schützen wollten, nicht zerstören. Und genau in diesem Moment setzte ich dann meinen Angriff…
Stärke war in meiner jetzigen Lage nicht der sinnvolle Weg. Nicht, wenn ich ein friedliches, ruhiges Leben auf einem Hof anstrebte. Ein Leben als Cateia und nicht als Iorca.
Ich hielt mich am Tor fest, sank in die Knie, keuchend, als wäre ich lange gelaufen.
Ein Hund bellte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Frau mich bemerkt hatte und die beiden hölzernen Eimer abstellte, um zu mir zu eilen.
»Krieg«, stammelte ich keuchend. »Unser Hof …«
Nur nicht zu klar sprechen, nur nicht zu viele Worte machen.
»Bei den Göttern, Kind! Wo kommst du her? Gab es einen Überfall? Hier?«
Sie beugte sich zu mir, legte mir ihre Hand auf die Schulter.
Ich hob den Kopf, schüttelte ihn mit aufgerissenen Augen.
»Ovilavia«, stammelte ich. Ich wollte noch mehr von ihrer Sprechweise hören, ehe ich es wagte, mehr als einzelne Worte herauszustoßen.
Sie half mir auf, wandte aber den Kopf den Häusern zu.
»Vailos!«, rief sie. »Beruro! Rasch, kommt! Rasch!« Ihre Stimme überschlug sich fast.
Ich stützte mich mit einer Hand an das Tor, als könnte ich alleine kaum stehen. Immer noch ließ ich meinen Atem fliegen, es drohte, mich schwindlig zu machen. Nicht übertreiben. Etwas Schwindel und Übelkeit waren gut, aber mein Verstand musste klar bleiben.
Türen öffneten sich und mehr Menschen als die beiden Gerufenen kamen heraus. Der Hund, der gebellt hatte, stürmte herbei, ein zotteliges Vieh.
»Was ist geschehen?«, wurde gerufen.
»Eine Fremde!«, rief jemand.
Bald drängten sie sich um mich. Bauern und Knechte, ja, aber einer der Männer wirkte zu edel, um ein schlichter Bauer zu sein. Seine Camisia hatte golddurchwebte Borten, um den Hals trug er einen dicken, goldenen Reif, wie ich ihn auch an einigen der Krieger gesehen hatte, gegen die ich in den letzten Tagen gekämpft hatte.
Hinten bei der Türe des großen Hauses, aus dem er getreten war, sah ich zwei Frauen stehen, eine etwas ältere und eine junge.
»Herr, sie sagt, es gibt Krieg, bei Ovilavia«, sagte die Alte, die mich am Ellbogen hielt. »Sie muss wohl bis hierher geflohen sein, das arme Ding.«
»Natürlich gibt es Krieg dort«, sagte der mit dem goldenen Halsreif. »Hast du vergessen? Das hat uns gestern doch schon der Tuchhändler erzählt, als er hier war.«
»Aber wenn sie bis hierher flieht! Sind wir noch in Sicherheit, Oheim?«, fragte ein junger Bursche.
»Bringt sie ins Haus, gebt ihr zu trinken und zu essen«, antwortete er stattdessen. Dann beugte er sich zu mir, nickte. Auf seinem buschigen Schnurrbart glänzte ein Schweißtropfen. »Du bist hier in Sicherheit.«
Man führte mich in das große Haus, wo die beiden Frauen mich an den Armen nahmen, als fürchteten sie, ich würde jeden Augenblick zusammenbrechen.
Prächtig sah es drinnen aus, ein großer Raum mit einer Feuergrube in der Mitte, um die Felle von allen möglichen Tieren lagen. An der Feuerstelle saß eine blasse Frau, an einen der hölzernen Steher gelehnt, die das Dach trugen, und hielt ein in Tücher gewickeltes Bündel in ihren Armen. In Regalen den Wänden entlang standen getöpferte Schüsseln, bronzene Schalen, glänzende Becher, Birkendosen und kleine Holzkisten. Hocker und Bänke zwischen den Regalen, keine schlichten, zusammengezimmerten Möbelstücke, sondern mit kunstvoll geschnitzten Beinen und Lehnen. Dies war ein reicher Bauer, kein Zweifel, ein Händler vielleicht oder gar ein Göttermann?
Sie brachten mir eine große Schale mit Wasser, dass ich Füße und Hände waschen konnte. Das Leinen des Tuches, das sie mir zum Abtrocknen reichten, war fein gewebt. Ich bemühte mich, sie nicht sehen zu lassen, dass ich unter meinem Kleid Braccae trug. Bald saß ich mit einem Becher starkem Bier in der Hand auf einem Wolfsfell am Feuer, über dem eine Magd gerade noch Wasser in den Kessel füllte, in dem ein duftender Eintopf köchelte. Mein Magen knurrte.
Die beiden Frauen schwiegen, vor allem die Jüngere jedoch beobachtete mich neugierig.
Als ich den Becher halb geleert hatte, trat der Mann mit dem Halsreif ein, hinter ihm drei weitere Männer.
Eilig erhob sich die blasse Frau am Feuer und wurde von der Jüngeren behutsam durch eine Türe am hinteren Ende des Hauses in einen Raum dahinter geführt. Es war wohl nicht gestattet, dass Männer eine junge Mutter in der ersten Zeit nach der Geburt sahen.
Die Magd reichte mir eine Schüssel mit Eintopf, die ich dankbar annahm. Aufmerksam wurde ich von den Männern beobachtet, die sich ebenfalls am Feuer niedergelassen hatten.
»Habt Dank«, murmelte ich, bemüht, mich an den Klang der hiesigen Stimmen anzupassen. Ich widerstand dem Drang, die Gesten meiner Mutter zu machen, um das Essen zu segnen. Wünschte, das die anderen auch aßen, damit ich sehen konnte, welche Gesten hier üblich waren.
Sie warteten, bis ich einige Bissen gemacht hatte. Die Jüngere kam zurück, setzte sich mit der Älteren auf eine der Bänke an der Wand.
»Du kommst also aus Ovilavia«, sagte der Mann mit dem Halsreif schließlich.
Ich nickte.
»Steht es schlimm?«, fragte er.
Ich nickte erneut, senkte den Blick.
»Haben die Barbaren Ovilavia eingenommen?«, fragte nun ein anderer, jüngerer, der ebenfalls eine fein gewebte Camisia mit einer edlen Borte trug.
»Weiß ich nicht«, sagte ich. »Noch nicht, als ich floh. Aber unser Hof …«
»Zu welchem Hof gehörst du?«, fragte einer, dessen Stimme wie ein leeres Fass klang. »Kennen einige rund um Ovilavia, tauschen Waren mit ihnen.«
Wodans Warzen. Da hatte mir meine Kriegerinnen-Ehre eines ausgewischt. Niemand würde eine Magd großartig verurteilen, weil sie während eines Krieges floh, aber ich hatte nicht einfach dabei bleiben können, dass ich aus Ovilavia kam, das noch nicht eingenommen war, weil es für eine Kriegerin sehr wohl eine Schande war zu fliehen …
Ich schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte auf.
Die ältere Frau auf der Bank erhob ihre Stimme. »Nun lasst sie doch. Das arme Ding ist ja völlig erschöpft.«
»Aber man muss doch wissen …«, hörte ich einen sagen.
Ich hob meinen Blick aus meinen Händen heraus, zog die Nase hoch. Gib ihnen, was sie hören müssen, dann hast du deine Ruhe. »Als ich floh … Ovilavia war noch nicht eingenommen, aber seit einem viertel Mond tobten Kämpfe. Ich bin geflohen, als bewaffnete Reiter kamen … ich hatte solche Angst … Voccio hat ein Heer geschickt und sie kämpfen gegen Baldram, den Sueben. So viele Tote!« So viele Tote, die unbegraben liegen und schreien und jammern. »Sie haben … sie haben die Göttinnenstatue aus Ovilavia gestohlen …«
Ein erschrockenes Einatmen ringsum. Aufregung, die sich in durcheinandergeworfenen Lauten Luft machte.
»Ovilavia ist verloren«, sagte der älteste Mann.
»Voccio wird verhandeln«, sagte der mit dem Halsreif. »Er ist feige, wie wir wissen. Er wird nicht kämpfen, wenn die Sueben die Göttin haben.«
»Und was dann?«, fragte der, der bis jetzt geschwiegen hatte. »Dann müssen wir uns mit diesen Wilden herumschlagen!«
Sie sahen alle nun mich an, als wäre ich schuld an der Lage.
»Sie kann im Stall schlafen«, sagte der mit dem Halsreif. »Wir müssen uns besprechen.«
Es war zu meiner Überraschung die jüngere Frau, die mich zum Stall führte, nicht die Magd. Sie wies mir die Leiter zum Heuboden und kletterte hinter mir nach.
Müde ließ ich mich in das getrocknete Gras des Vorjahres fallen, gab mich noch müder, als ich war. Warum war die junge Frau, deren Peplos mit kunstvollen Borten verziert war und in deren Haar ein wertvoller goldglänzender Kamm steckte, mit mir gekommen statt der Magd?
Sie blieb neben dem Heuhaufen stehen. Es war inzwischen dunkel geworden und nur der dünne Sichelmond, der durch das lockere Weidengeflecht der Giebelwand drang, ließ noch Schemen und Formen erkennen.
»Hast du Krieger gesehen?«, fragte sie plötzlich.
»Ja.«
»Auch welche von den Wilden von jenseits des Danubius?«
Wilde? Meinte sie uns Sueben?
»Ja.«
»Wie sehen sie aus? Sind sie wirklich missgestaltete Wesen mit Fratzen und Klauen, wie man erzählt?«
Missgestaltete Wesen mit Fratzen und Klauen? War es das, was sie sich wünschte, um sich ein wenig fürchten zu können in ihrem hübschen Kleidchen?
»Oh, sie sind angsteinflößend! Ich habe ihren Anführer gesehen, diesen Baldram … Augen wie Feuer, Zähne wie ein Wolf. Hände wie Suppenkessel so groß …«
Ich verbiss mir ein Grinsen. Wie gut, dass sie im Dunkel mein Gesicht nicht sehen konnte. Und wie gut, dass Baldram mich nicht hören konnte. Er war ein gutaussehender Mann und legte Wert auf sein Äußeres.
»Und einen sah ich, der war groß wie ein Berg!« Ja, wir alle nannten ihn auch Berg, ich konnte mich nicht einmal an seinen richtigen Namen erinnern. Groß und stark war er, aber nicht der Hellste und mit einem weichen Herzen.
Sie kniete sich nun neben mich, fasste nach meinen Händen. »Meine Mutter wird nicht zulassen, dass Ovilavia fällt«, sagte sie. »Auch wenn Voccio, dieser elende Schwächling, verhandeln mag, meine Mutter wird diesen Baldram zurück über den Danubius jagen!«
»Wieso, ist sie noch größer als ein Berg?«, entschlüpfte es mir. Kein Weib könnte Baldram je besiegen.
Zum Glück lachte die junge Frau über diese Bemerkung. »Nein, obwohl sie wahrlich eine stattliche Erscheinung ist! Aber sie ist mächtig! Hätte Voccio nicht zu einer hinterhältigen List gegriffen und sie verflucht, so wäre sie Herrin über alle Stämme Noricums geworden.«
»Dann ist sie also nicht das dünne Weib mit dem grauen Haar, das neben dir auf der Bank saß?«
Erneut lachte die junge Frau. »Nein, das ist das Weib des Sohnes des Mutterbruders meiner Mutter. Ich bin nur zu Besuch, weil ihre Tochter ein Kind geboren hat und Mutter mich mit Gaben für das Neugeborene geschickt hat.«
»Tructa!«, rief eine Stimme vom Haus her.
»Ich muss zurück«, sagte die junge Frau. »Du musst dir keine Sorgen machen. Bestimmt kannst du als Magd hier bei Vailos am Hof bleiben.«
»Während du mit deiner stattlichen Mutter die Sueben über den Danubius jagst«, sagte ich.
Und schon wieder lachte sie.
»Das schafft Mutter ganz alleine. Morgen musst du mir dann noch mehr erzählen! Ich will alles über diese Wilden wissen! Wie aufregend!«
Sie tastete sich im Dunkel nach der Leiter und verschwand in den Stall hinunter.
Ich lauschte ihren Schritten nach. Horchte auf die Geräusche der Kühe unter mir, die genüsslich wiederkäuten.
Ein Schwein grunzte.
Ich schloss die Augen.
Die erste Nacht in meinem neuen Leben.
Besuch der Herrin
Seit einem Mond war Hys nun wieder zurück im Haus seiner Eltern. Der Anlass war ein trauriger und doch genoss er es, wieder an der alten Feuerstelle zu sitzen. Es war eine beschwerliche Reise gewesen, durch die Berge im Winter, unterwegs hatte er beinahe gewünscht, der Bote aus Mertiacum hätte mit dem Überbringen der Nachricht vom Tod seiner Eltern bis zum Frühjahr gewartet. Aber es war schon gut, dass er nun hier war, um sich um seine beiden Schwestern zu kümmern. Und Vaters Arbeit fortzuführen. Die Götter hatten es so entschieden.
Er hob den Blick von dem Armreif, den er polierte. Samera, wie immer am Webstuhl beschäftigt, erzählte ihm, was die Nachbarn ihr heute berichtet hatten, als sie einander trafen. Belangloses Geschwätz über die bevorstehende Aussaat, die Rückenschmerzen der Nachbarin und die Ratten, die im Getreidespeicher gefangen worden waren. Wohltuend, weil es ihm ein Gefühl von Zugehörigkeit gab und Sameras Stimme immer schon einen angenehmen Klang gehabt hatte, dem er gerne lauschte, auch wenn sie manchmal zum Nörgeln neigte.
Louerna warf eine Bemerkung ein, kicherte selbst über das, was sie gesagt hatte. Sie strahlte ihn an. Seit er zurück war, folgte sie ihm auf Schritt und Tritt, wollte alles hören über seine lange Reise, über die Stämme, bei denen er gewesen war. Er fragte sich, was die Eltern ihr über ihn erzählt hatten, dass sie ihn gar so verherrlichte, nur weil er vier Jahre in der Fremde gewesen war. Samera war eine junge Frau geworden, während er in Massilia und Bragnreica gewesen war, Louerna ein junges Mädchen. Die Jahre seines Wegseins änderten nichts an den Banden des Blutes, die sie miteinander verbanden. Es war, als wäre er nie fort gewesen, nur dass Vater und Mutter nicht bei ihnen an der Feuerstelle saßen.
Zu seiner Überraschung klopfte es an der Türe und als Louerna öffnete, stand Atesmerta davor. Sie hatte ihn nicht zu sich rufen lassen. Hatte nicht einfach in der Großen Halle mit ihm gesprochen. Nein, dort hatte sie ihn an den Abenden zumeist nicht einmal mit einem Nicken bedacht.
Und nun stand sie spätabends hier in seiner Werkstatt, sie, die Rigana, die Herrin. Er fühlte sich geehrt. Sie war immer ein mächtiges Weib gewesen, auch körperlich stark und füllig. Mit einem eisernen Willen, dem man sich besser nicht entgegensetzte. Doch sie hatte sich während seiner Abwesenheit verändert. Was einst pralle Fülle gewesen war, hing nun wie nasse Säcke. Wo früher funkelnde Zielgerichtetheit aus ihren Augen leuchtete, lag nun ein bitterer Zug um ihre Lippen. Er hatte schlimme Gerüchte gehört, seit er wieder in Mertiacum war. Doch er gab nichts auf Gerüchte. So oder so war es eine hohe Ehre, dass sie ihn aufsuchte.
Er bot der Herrin einen Platz auf der Bank beim Feuer an. Louerna eilte, eine weiche Decke über das Holz zu breiten, Samera holte einen der bronzenen Becher aus dem Regal, um der Rigana etwas von dem wertvollen Wein anzubieten.
»Ich möchte mit dir alleine reden«, sagte Atesmerta und machte keine Anstalten, sich zu setzen. »Ungestört.«
Hys deutete seinen Schwestern mit dem Kopf. Louerna verbeugte sich vor Atesmerta und lief hinaus, Samera drückte ihm noch den Becher mit Wein in die Hand, ehe auch sie hastig das Haus verließ und die Türe hinter sich schloss.
Er hatte noch nie unter vier Augen mit der Herrscherin gesprochen. Sein Vater oft, er hatte bei Atesmerta und davor bereits bei deren Vater in hohem Ansehen gestanden. Hys selbst war bei seinem Weggang gerade einmal zehn-und-acht Jahre alt gewesen, gerade erst in dem Alter, da jemand wie die Rigana bereit wäre, ihm als vollwertigen Mitglied ihres Stammes Beachtung zu schenken. Doch jetzt war er zurück und bei aller Trauer um die Eltern freute Hys sich, nun den Platz des Vaters einzunehmen. Goldschmied der bedeutendsten Rigana am Danubius. Wahrscheinlich war sie gekommen, um sich für die Kette zu bedanken, die er für sie gearbeitet hatte. Nein, dafür hätte sie nicht seine Schwestern hinausgeschickt. Er war gespannt, was sie von ihm wollte.
Erneut bot er mit einer Geste die Bank am Feuer an.
»Bitte, nimm Platz.« Seine Stimme war rau und tief wie immer, doch so ganz konnte er ein leichtes Beben in ihr nicht verbergen. Er fühlte eine kribbelnde Aufregung in sich. Die Rigana, die sein Vater zutiefst verehrt hatte, saß an seiner Feuerstelle, wollte mit ihm alleine sprechen.
Vater wäre stolz.
Hys hoffte, er würde vor Aufregung diesen Besuch nicht verderben, indem er etwas sagte, das der Rigana missfiel. Vater hatte immer gewusst, wie mit ihren Launen umzugehen. Aber Vater war anders gewesen als Hys. Hys saß am liebsten alleine an seiner Werkbank. Mit Gold und Korallen und Bernstein konnte er gut reden. Die verstand er auch ohne Worte. Jede noch so kleine Missstimmung im Metall, in den Steinen, sprach zu ihm. Bei Menschen war er da nie so sicher, ob er all diese kleinen Regungen, wie ein kurzes Zucken um die Lippen, eine Anspannung bei den Augen, eine Bewegung der Finger, richtig deutete. Vater hatte mit Menschen und Metallen gleich gut umgehen können.
Atesmerta setzte sich nun und nahm auch den Wein. Sie verzog die Lippen ein wenig, nachdem sie einen Schluck getrunken hatte, und er war sich nicht sicher, ob dieses ganz leise schmatzende Geräusch ein Geräusch des Genusses oder doch des Unmuts gewesen war. Er beschloss, es für eines des Genusses zu halten. Es war guter Wein, noch aus den Vorräten seines Vaters.
Die Rigana ließ ihre Augen durch den Raum schweifen und schwieg. Hys wusste nicht, ob er etwas sagen sollte. Ob sie erwartete, dass er etwas sagte oder schwieg, bis sie sprach.
»Er war ein guter Mann, dein Vater«, begann sie unvermittelt.
»Ja«, sagte Hys. »Ich hoffe, ihm zumindest in der Handwerkskunst nichts nachzustehen.«
Die Rigana ließ ein leises Lachen hören, dass ihre immer noch üppige Oberweite zittern ließ. »Er hat dich ausgebildet und zu anderen Goldschmieden geschickt, um noch mehr zu lernen. Ich bin sicher, du wirst Schmuck zu meinem Gefallen erzeugen wie er.«
»Ich danke für dein Vertrauen«, sagte Hys.
Atesmerta sah zu ihm hoch, ihre Lippen zuckten. »Setz dich. Ich habe keine Lust, mir einen steifen Hals zu holen.«
»Verzeih.« Mit einem Nicken nahm er auf einem der Hocker Platz. Er strich sich mit den Fingern über das Kinn, merkte, dass er heute vergessen hatte, sich zu rasieren. Nun, im zuckenden Licht des Feuers würde Atesmerta es hoffentlich nicht merken. Er sah ihr offen ins Gesicht, fragte sich, ob die Gerüchte wahr waren, die er seit seiner Ankunft gehört hatte. Aber hauptsächlich betrachtete er ihre fülligen blonden Haare und dachte sich, wie gut sich ein goldener Reif in ihnen machen würde, besetzt mit roten Korallen. Er hatte schon ein Bild dazu im Kopf, vielleicht konnte er ihr solch ein Schmuckstück schmackhaft machen.
»Du warst lange weg«, sagte Atesmerta.
»Vier Jahre.«
»Und nun liegen deine Schwestern in deiner Verantwortung. Du wirst einen Mann für Samera finden müssen, Louerna vor den ersten Freiern schützen müssen. Du musst für sie sorgen.«
»Ja.« Er schmunzelte leicht. »Wobei sie eigentlich für mich sorgen. Ohne die beiden würde ich durchaus manchmal darauf vergessen, etwas zu essen, wenn ich in meine Arbeit vertieft bin. Sie sind beide wunderbare Schwestern und es ist mir keine Last, mich um sie zu kümmern. Ich bin sehr froh, sie bei mir zu haben und wieder hier zu sein.«
»Das ist schön zu hören«, sagte Atesmerta. »Und schön zu sehen, dass sie dir wichtig sind. Ich hatte Sorge, was aus ihnen wird, nachdem eure Eltern dem Fieber zum Opfer fielen.«
»Es ehrt uns, dass du dir Sorgen um sie machst.«
Atesmerta machte eine wegwerfende Handbewegung, nahm erneut einen Schluck Wein und betrachtete Hys über den Rand des Bechers hinweg. Er lächelte. Langsam würde sie wohl zum Grund ihres Besuches kommen. Vielleicht hatte Vater ja an einem Schmuckstück gearbeitet, das er nun fertigstellen sollte? Vielleicht – er wagte kaum, es zu denken. Hatte Atesmerta denn nicht eine Tochter im heiratsfähigen Alter? Und war nicht erst in den letzten Tagen ein Abgesandter der Ambisonten in Mertiacum gewesen, um über ein Bündnis zu sprechen, wie es hieß? Vielleicht bat sie ihn darum, den Brautschmuck herzustellen, deshalb auch unter vier Augen, falls die Vermählung noch nicht allgemein bekannt war … Oder falls es des prächtigen Schmucks als Beweis der Würdigkeit der Braut für eine Ehe bedurfte … Samera hatte doch etwas davon erzählt, dass die Ambisonten angeblich Bedingungen gestellt hatten. Zumindest hatte sie dies gehört, von irgendeinem Nachbarn.
»Ich habe große Pläne mit dir«, sagte die Rigana. »Große Pläne mit einem großen Mann.«
Er verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. Ja, er war nicht klein, aber unter den Kriegern gab es andere, die nicht nur groß und schlank, sondern groß und breitschultrig waren wie ein Stier. Er neigte dazu, von all der sitzenden Arbeit mit dem feinen Goldschmuck etwas gebeugt zu stehen.
»Ja, große Pläne«, wiederholte Atesmerta. »Aber erzähle erst, du warst im Massilia und in Bragnreica?«
Sie wusste also, dass er in Bragnreica gewesen war. Nun, er würde sich bemühen, sie nicht allzu genau wissen zu lassen, wann er dort gewesen war. Seine Jahre in der Fremde waren bereichernd gewesen und er redete durchaus gerne darüber. Er erzählte von seiner Zeit in Gallia Cisalpina, bei einem römischen Goldschmied in Massilia, dieser unglaublichen Stadt voller Menschen aus allen Himmelsrichtungen.
»Ich habe dort viel über die Goldschmiedekunst der Römer und Hellenen gelernt und wage zu sagen, dass ich ihrem Können kaum nachstehe.«
»Schön und gut, aber du warst auch in Bragnreica, unerwarteter Weise, habe ich von deinem Vater gehört.«
»Ja.« Hys' Schultern spannten sich an. »Aber nicht so lange wie in Massilia. Ein Händler erzählte mir, dass der Goldschmied in Bragnreica gerne die römisch und hellenisch beeinflusste Kunst der Gallier erlernen würde und ich wiederum fand es bereichernd, über die Goldschmiederei der römisch beeinflussten Noriker zu lernen.«
Atesmerta unterbrach ihn. »Ja, ja, schon gut. Wie lange warst du in Bragnreica?«
»Ein Jahr vielleicht, wenn auch nicht durchgehend, denn der Goldschmied und ich reisten im Sommer auch für längere Zeit, um einen Auftrag für einen reichen Römer auszuführen. Eine spannende Erfahrung, der Geschmack der Römer hier ist doch anders als jener der Römer in Gallien.«
»Deswegen also sind wir einander nicht begegnet, als Voccio alle Stammesführer zu sich rief.« Ihre Stimme klang freundlich, aber Hys fürchtete, dass dies täuschen könnte.
»Ja. Ich … ich habe davon gehört. Wie er zum Magosreix wurde, zum Herrn über elf Stämme.« Er verschwieg, dass er sehr wohl zu jener Zeit in Bragnreica gewesen war. Balucux hatte ihm zugeredet, sich nicht bei seiner Rigana zu melden, der Goldschmied hatte wohl Sorge gehabt, sie könne ihn sonst mit sich zurück nach Mertiacum nehmen. Und gut war diese Entscheidung gewesen.
Atesmerta schnaubte und ihr Gesicht verwandelte sich vom höflichen Lächeln zu einer angeekelten Miene. »Das kann ich mir vorstellen, was du da gehört hast. Lügengeschichten. Geschichten, die ihn als den großen Helden, den Retter hinstellen, wo er seine Herrschaft nur mit Hinterlist erlangt hat. Indem er einen Fluch auf jene sprechen ließ, die ihm nicht blindlings die Treue schworen, sondern wagten, seine Berufung als Reix über alle anzuzweifeln.«
Hys schwieg.
Atesmerta verzog ihre Lippen zu einem angespannten Lächeln. »Du bist ihm gewiss oft begegnet, dem großen Voccio. Das lässt er sich nicht entgehen, so einen geschickten Goldschmied.«
Hys schüttelte den Kopf. »Balucux war sein Goldschmied, ich nur dessen Gehilfe. Balucux sprach mit Voccio und dessen Weib, ich nicht.« Das stimmte nicht völlig. Weder das mit dem Gehilfen noch das mit den Gesprächen. Aber er hatte ein ungutes Gefühl im Magen. Atesmerta musste mit diesen Fragen etwas bezwecken, und er fürchtete inzwischen, dass sie nicht gekommen war, ihn zu loben, sondern wenig erfreut war, wie lange er in Bragnreica geblieben war.
»Hm«, machte die Rigana und schien nachzudenken, während sie noch einen Schluck Wein nahm. »Aber du bist mit allen Gegebenheiten in Bragnreica vertraut?«
Hys nickte. Es war eine prächtige Duron, in der der Magosreix lebte, und Hys hatte sich sehr wohlgefühlt dort.
»Das wird reichen. Wie ich sagte, ich habe Großes mit dir vor. An dir wird es liegen, Noricum und all die Stämme von der ungerechten Herrschaft Voccios zu befreien. Gerade eben kämpfen seine Männer drei Tagesritte von hier gegen Eindringlinge von jenseits des Danubius und wir kennen ihn, feige wie er ist, wird er verhandeln lassen, anstatt die Sueben zu vernichten. Wird ihnen gestatten, sich hier anzusiedeln, weil er sich davon Einnahmen erhofft. Und wir müssen uns dann mit ihnen herumschlagen, während er gemütlich weit entfernt in Bragnreica hockt und seine Reichtümer zählt. Nicht einmal jetzt, wo Ovilavia ums nackte Überleben kämpft, ist er selbst gekommen, hat nur seinen eitlen Ziehsohn geschickt. Voccio hat seine Herrschaft ungerechtfertigt erlangt und du wirst es sein, der als unser Held uns davon befreit.«
Das ungute Gefühl in seinem Magen wurde stärker, kroch bis in seinen Mund hinauf. Selten wurde jemand Held genannt, der noch am Leben war.
Atesmerta sah ihn abwartend an, doch er sagte nichts.
Sie seufzte. »Du fragst, wieso dir diese Ehre zuteil wird? Weil ich an dich glaube. Weil ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, in dir fließt das Blut deines Vaters, der mir treu ergeben war und den ich sehr geschätzt habe. Du wirst nicht mitansehen, wie deine Schwestern von den Sueben entführt werden, wie sie geschändet und misshandelt werden von diesen Wilden, denen Voccio unser Land zur Verfügung stellen wird. Du wirst nicht wollen, dass deine eigenen Kinder – die du gewiss bald haben wirst, denn ein so kluger und ansehnlicher Mann wie du wird doch nicht unverheiratet bleiben – dass also deine Kinder Hunger leiden, weil die Sueben unsere Felder zerstören, uns in Knechtschaft zwingen. Dies muss verhindert werden. Und dies lässt sich bewerkstelligen, wenn Voccio nicht mehr Magosreix ist, denn dann werden sich die Stämme wieder mir zuwenden, nachdem er sie gegen uns aufgehetzt hat. Der Feigling hat damals geschworen, meinem Stamm keinerlei Hilfe zukommen zu lassen, sollten wir in Not geraten, denn er weiß genau, dass wir es sind, die hier am Danubius die schwerste Aufgabe haben, alle Stämme zu verteidigen. Er ist einfach zu feige, uns in diesem Kampf zu unterstützen, denn er weiß, dass ich keine bin, die verhandelt und unseren Feinden erlaubt, uns auszuhungern und unsere Frauen zu schänden. Doch Voccio scheut den Kampf, ein unwürdiger Herrscher. Aber du, du hast die Gabe und die Fähigkeit, deine Schwestern zu retten, alle unseres Stammes zu retten.«
Hys schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, wenn uns dies bevorsteht, aber ich wüsste nicht, wie ich hier helfen könnte.«
»Du ahnst es nicht?«
»Nein«, sagte Hys. »Ich glaube nicht, dass ein paar goldene Ketten und Armreifen unseren Stamm retten können, und etwas anderes als Schmuck herstellen kann ich nicht.«
Ihre Augen wurden schmal, der Zug um ihre Lippen hart. »Nun, es wird dir ein Leichtes sein. Du kennst Bragnreica, du bist mit den Menschen dort vertraut. Keiner meiner Männer, die vorigen Sommer mit mir dort waren, kann sich in der Duron blicken lassen. Aber du, du hast es ja geschafft, dass Voccio dich nicht aus der Duron und seinem Reich verstoßen hat, wie mich und alle anderen unseres Stammes.« Ihre Stimme war nun scharf. Dies war kein Lob, dies war ein Vorwurf.
Ein Vorwurf, den Hys durchaus verstand. Nach dem Anschlag auf Voccios Leben hatte man Atesmerta und all ihre Krieger entwaffnet und aus dem Reich geleitet, ihnen jegliche Rückkehr verboten. Er hätte wohl mit ihnen gehen sollen, doch er war erschüttert über Atesmertas Tat gewesen – einen Giftmord an ihrem Gastgeber zu planen, das Gastrecht mit Füßen zu treten, das war eine Tat, dem niedrigsten Verbrecher nicht würdig. Und er war so begierig gewesen, weiter mit Balucux arbeiten zu können, dass er sich Voccio zu Füßen geworfen, ihn um Gnade angefleht hatte und um die Erlaubnis, in Bragnreica zu bleiben. Voreilig angefleht hatte möglicherweise, denn vielleicht war es dem Reix gar nicht bewusst gewesen, dass dieser Goldschmied, der da aus Massilia gekommen war, eigentlich aus Mertiacum stammte. Dass er bleiben durfte, lag aber nicht an Voccio, sondern an dessen Weib, der Rigana, Nessa. Sie hatte ihren Mann gescholten, dass er töricht wäre, solch einen hervorragenden Handwerker hinauszuwerfen.
Hys schwieg, zwang sich, so zu tun, als bemerke er die Anklage in Atesmertas Worten nicht.
»Ich war nicht erfreut darüber, als ich davon hörte«, fuhr die Rigana fort. »Aber nun scheint es, dass uns deine … mangelnde Stammestreue vielleicht von Vorteil ist und du wieder gutmachen kannst, was du deinem Vater mit deinem Dortbleiben an Schande bereitet hast. Es hat ihn sehr getroffen … wusste er doch, dass du in Bragnreica warst – und doch bist du nicht zurückgekehrt, nachdem man deine Rigana, seine geliebte Herrin, verflucht und verstoßen hat. Ich will dir zugutehalten, dass du zu jenem Zeitpunkt, wie du sagtest, nicht in der Duron warst, aber ich erwarte nun doch, dass du deine Treue mir gegenüber beweist. Kein anderer meiner Männer kennt die Gegebenheiten in Bragnreica wie du. Du wirst deinen Freund, den Goldschmied, besuchen, und dich an Voccio heranschleichen. Es braucht nur einen wohlgeführten Stich mit einem Messer und der Feigling kann sich nicht mehr in die Belange unseres Stammes einmischen. Und du, du bist unser Held, sollst mit Reichtümern und Ehren überschüttet werden, dass deine Schwestern sich die höchsten Herrscher aller Reiche als Ehemänner aussuchen können.«
Hys erhob sich. Sein Magen war zu einem schweren, kalten Klumpen geworden. Was sie verlangte, war Selbstmord. Was sie verlangte, würde bedeuten, dass er ebenso hinterhältig und niederträchtig wie sie handelte.
»Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Atesmerta, aber du hast den Falschen. Ich bin Goldschmied. Kein Krieger. Ich erschaffe Schönes, nicht den Tod.«