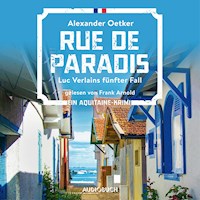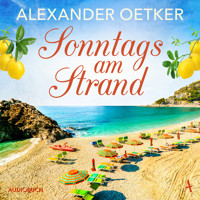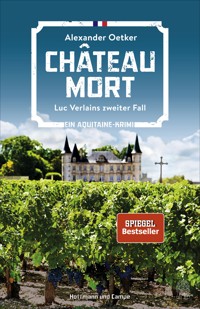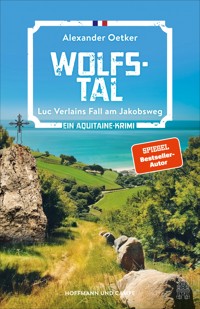9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Banküberfall mit Geiselnahme in Brandenburg, eine Kindesentführung in Berlin – zwei Verbrechen, eine heiße Spur. An einem brütend heißen Sommertag wird in Berlin-Wedding ein kleines Mädchen entführt. Zur gleichen Zeit ereignet sich im brandenburgischen Rheinsberg in einer kleinen Bankfiliale ein Überfall mit Geiselnahme. Zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber im Verborgenen zusammenhängen. Als an diesem Morgen bei Linh-Thi Schmidt, Deutsch-Vietnamesin und Polizeioberkommissarin in Rheinsberg, und ihrem Ehemann Adam Schmidt, Kriminalhauptkommissar der Berliner Polizei, die Diensthandys klingeln, ahnen sie noch nicht, was ihnen bevorsteht: ein Tag, der sie beide an ihre Grenzen bringt und Erinnerungen weckt an jene alte Schuld, die Adam und Linh-Thi zusammengeführt hat und seither verfolgt. Der erste Fall für das deutsch-vietnamesische Ermittlerpaar, meisterhaft erzählt vom neuen Krimi-Erfolgsduo, SPIEGEL-Bestsellerautor Alexander Oetker und Ti Linh Nguyen! Thi Linh Nguyen, 1991 im vietnamesischen Bac Ninh geboren, kam mit drei Monaten nach Deutschland und wuchs in Berlin-Marzahn auf. Dieser Krimi ist ihr Debüt. Alexander Oetker, geboren 1982 in Berlin, ist Bestsellerautor französischer Kriminalromane und Preisträger der DELIA für den besten Liebesroman 2022. Er hat Thi Linh Nguyen unterstützt, ihre Geschichte in diesem Krimi zu erzählen. Düster, rau und hochspannend – »Die Schuld, die uns verfolgt« ist der perfekte Krimi für Fans von Wolfgang Schorlaus Dengler-Reihe und der Serien »Im Angesicht des Verbrechens« und »4 Blocks«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Schuld, die uns verfolgt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung:
Covermotiv:
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
25 Jahre früher – 1997
6
7
8
25 Jahre früher – 1997
9
10
11
12
25 Jahre früher – 1997
13
14
15
16
17
18
25 Jahre früher – 1997
19
20
21
22
23
25 Jahre früher – 1997
24
25
25 Jahre früher – 1997
26
27
28
29
25 Jahre früher – 1997
30
31
32
33
34
35
36
37
17 Jahre früher – 2005
38
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
»Stefanie, siehst du nach den Kleinen? Ich habe noch ein Elterngespräch in der Cafeteria.«
»Klar, mach du dir mal wieder ’n lockeren Morgen.«
Gitta zog eine Augenbraue hoch, dann mussten sie beide fürchterlich lachen. Wenn Irene, ihre strenge Chefin, im Urlaub war, so wie diese Woche, dann konnten Gitta und sie die Dinge ein bisschen leichter nehmen.
Gitta, die stellvertretende Kitaleiterin, verschwand im Inneren des Sechzigerjahre-Betonklotzes und zog die Tür hinter sich zu. Stefanie sah ihr nach. Um sie herum lärmten die Kinder auf dem kleinen Spielplatz, der im Hof der Kita lag – Rutsche, Sandkasten, eine Tellerschaukel, um die sich immer alle stritten.
Ein Elterngespräch um halb acht Uhr morgens. Das konnte ja nur Ärger bedeuten. Wahrscheinlich wollte sich mal wieder eine Mutter beschweren, weil die Erzieherinnen ihre kleine Kröte nicht richtig gewickelt hatten. »Die Kacka war schon ganz fest«, sagten die Mütter dann mit gestrengem Blick, so als hätten die Mitarbeiterinnen der Kita einen Kot-Radar, der anzeigte, welcher ihrer dreißig Schützlinge die Buttermilch beim Mittagessen nicht gut vertragen hatte.
Und es wurde immer schlimmer. Nicht mit den Kindern, nein. Die waren wie die Kinder vor zwanzig Jahren auch: Sie wollten spielen, kuscheln, sich manchmal langweilen, viel lachen und sich gegenseitig Bausteine auf den Kopf hauen. Nur die Eltern wurden immer anstrengender. Mittlerweile hatten sie mehr Anmeldungen fürs vegetarische Mittagessen als fürs normale. »Nein, Theresa möchte die Bolognese mit Rindfleisch nicht mehr essen. Sie hat auch zu Hause entschieden, dass sie nur noch ein Ei pro Woche isst und die Hafermilch bevorzugt, und Fleisch bitte gar nicht mehr.«
Na klar hatte Theresa das alleine entschieden. Mit zweieinhalb Jahren.
Oder all die Halal-Kinder, die statt der Teewurst nur den Zucchiniaufstrich aufs Knäcke haben durften. Oder die Kinder, die nur koscher aßen und für deren Essen im Catering ein eigener Topf verwendet wurde, oder die … Ach, sie wusste doch auch nicht. Manchmal schüttelte sie noch abends den Kopf über den ganzen Wahnsinn.
»Carla, Ivy, Susi, streitet euch nicht um das Bobbycar, wechselt euch bitte ab«, rief sie. »Und Chris, zieh deine Jacke wieder an.«
Noch war die Luft kühl, doch der Tag sollte richtig heiß werden, hatten sie in den Sechs-Uhr-Nachrichten beim Berliner Rundfunk gesagt. Das erste Frühstück war gerade durch, die ersten Kinder versorgt, jene, deren Eltern früh zur Arbeit mussten und selbst keine Zeit für eine ordentliche Mahlzeit in der Früh hatten. Nachher, kurz vor dem Morgenkreis um neun, brachten die Eltern mit den einträglicheren Berufen ihre Kinder – die Anwälte oder Ärzte und die Väter mit Projekten, die irgendwas mit Film, Werbung oder ähnlichem Quatsch machten.
Früher waren die Kinder alle vor acht gekommen, doch seit der Kitaplatz- und Erziehermangel in der Stadt noch größer geworden war, mussten auch Hipster-Eltern wohl oder übel auf die Betreuungsplätze im Wedding ausweichen.
Bis zum zweiten Frühstück war freies Spielen im Garten angesagt, dann war Morgenkreis, und anschließend würde sie alle Kinder eincremen müssen, bevor die Sonne richtig rauskam. Das sollten die Eltern eigentlich schon zu Hause machen, aber wenn sie sich darauf verließ, hatte sie gegen Mittag ein paar kirschrote Racker durch den Garten flitzen.
Stefanie schnupperte einmal durch die Luft. Das war besser als jeder Kot-Radar. »Jerôme, hast du die Windel voll?«
Sie hob den kleinen Jungen mit den dichten schwarzen Locken hoch und roch an seinem Po. »Halleluja …«, entfuhr es ihr. »Na, dann wollen wir mal. Kinder, gleich machen wir zweites Frühstück. Alle schön hiergeblieben.«
Den kleinen Jerôme auf dem Arm, ging sie durch die Glastür ins Haus und legte das Kind vorsichtig auf die Wickelkommode. Der Kleine summte ein Lied.
»Gleich singen wir Meine Hände sind verschwunden, gleich geht’s los, ja?« Jerôme gluckste vor Freude. Sie wischte ihm den Po sauber und trocknete ihn ab, dann nahm sie eine neue Windel, schmierte reichlich von der Pflegecreme, die sich die Eltern wünschten, weil er so schnell wund wurde, auf sein Hinterteil und machte den Body wieder zu.
»So, Abmarsch«, sagte sie und hob den kleinen Jungen von der Wickelkommode. Er flitzte los wie ein Derwisch. Sie blickte kurz zur Cafeteria, in der Gitta lachend mit einer Mutter stand. Na, das schien doch kein Problemgespräch zu sein. Immerhin etwas. Sie trat durch die Glastür wieder hinaus in den Garten und sah, dass die Kinder schon im Kreis neben dem Sandkasten saßen. »Na, ihr seid ja lieb! So, dann kommt hier mal der Kasper.« Sie hob die kleine bunte Figur mit dem gelben Haar an. »Guten Morgen, liebe Kinder«, sagte sie mit verstellter Stimme in die Runde. Doch dann stutzte sie.
»War Emily nicht eben schon hier?« Es war eine rhetorische Frage, denn sie war sich ganz sicher: Eben hatte Emily noch mit den anderen Kindern gespielt. »Carla, ist Emily reingegangen? Ist sie drinnen pullern?«
Das kleine braunhaarige Mädchen sah sie ratlos an.
Stefanie stand wieder auf und ging hinein. Sie war noch ruhig, na klar, das hier war Routine. Sie blickte um die Ecke in die Garderobe, wo die Sonnenhüte und die Badehosen der Kinder hingen. Sie ging weiter und öffnete die Tür zu den Toiletten, hoffnungsvoll und doch schon mit einem leichten Anflug von Panik. Auch hier war das Kind nicht. Keine Emily, niemand.
Sie ging wieder hinaus. Spürte ihren Atem, merkte, wie ihr Herz ein wenig schneller schlug. Der Weg zum Zaun kam ihr lang vor. Sie blickte hinüber, nach links, nach rechts. Die Autos auf der Brunnenstraße rasten auf vier Spuren vorbei. Sie drehte sich wieder um, bemerkte die Blicke der Kinder auf sich. Auch sie spürten, dass etwas vor sich ging.
»Sagt mal, wo ist Emily? Habt ihr sie gesehen?«, fragte sie in die Runde und bemühte sich, ihre Stimme nicht zu laut werden zu lassen. Es misslang, sie klang fürchterlich schrill.
»Die ist abgeholt.« Der kleine Cornelius sah sie mit großen Augen an.
Sie machte einen Schritt auf ihn zu, fasste ihn am Arm. »Was erzählst du denn? Ihre Mama hat sie doch vorhin erst gebracht. Wer hat sie abgeholt?«
»Ein Mann, ein großer Mann.«
»Wo war ein großer Mann?«
Cornelius zeigte zum Zaun. »Er hat gewinke. Sie ist zu ihn gegangen.«
»Und dann? Was war …?«
»Er hat Emily hochgehoben.«
Ihr Herz setzte aus, sie war sich ganz sicher, dass sie jeden Moment umkippen würde. Doch sie blieb stehen. Ihr Puls schlug im Hals, in den Armen, in ihren Ohren rauschte es. Sie rannte zur Glastür.
»Gitta! Gitta, komm mal!«
»Gleich …«, ertönte die helle Stimme ihrer Kollegin aus der Cafeteria.
»Nein, jetzt!«, rief sie. »Emily ist verschwunden.«
2
Ihr Blick flirrte, die Schatten tanzten, bis alles verschwamm. Sie wischte sich über die Augen, weil der Schweiß darin brannte. Sie konnte ihren Fuß nicht ruhig auf der Kupplung lassen, sie nahm ihn nach links, auf die kleine Leiste im Fußraum, trat darauf herum, bis sie plötzlich bremsen musste, weil ihre Hände so zitterten, dass sie zu weit nach rechts geraten war. Die Reifen knirschten auf dem Kies des schmalen Seitenstreifens. Verdammt!
Sie lenkte den Wagen zurück auf die Fahrbahn, sah in den Rückspiegel. Kein anderes Auto weit und breit. Nur diese Weite. Rechts der blühende Raps wie ein gelbes Meer und über allem diese verfluchte Sonne, die die Landschaft so sorglos aussehen ließ, aber alles Schwindel. Sie kam sich verarscht vor von all dem Schönen ringsum, von der Sonne, von ihrem ganzen Leben. Am Wochenende, wenn sie Zeit hatte, dann goss es in Strömen, und heute, da sie hätte arbeiten müssen, brannte die Sonne vom Himmel.
Doch nun musste sie nicht mehr arbeiten. Alles war anders.
Zwei Windräder im Feld. Die Rotorblätter flappten, und ihre Schatten flappten zeitgleich über die Erde. Dann endete das Feld, und Dunkelheit fiel auf den Wagen, der Wald begann, der endlose Kiefernwald. Unwillkürlich trat sie wieder auf die Bremse. Sie hatte erst vor vier Monaten in der Dämmerung ein kleines Wildschwein angefahren. Sie war kurz ausgestiegen und hatte in die offenen Augen des Tieres gesehen, das gar nicht wimmerte, wie sie es gedacht hätte, sondern ganz ruhig und schicksalsergeben dalag.
Sie war wieder eingestiegen, hatte zurückgesetzt und war dann im großen Bogen um das sterbende Tier herumgefahren. Was hätte sie schon machen können? Doch jetzt dachte sie jede Nacht an die leeren Augen und das leise, röchelnde Atmen des Tiers.
Die Seitenpoller rasten vorbei, hundert Meter, noch mal hundert Meter. Und wenn noch tausend von ihnen vorbeifliegen würden – wie sollte sie eine Lösung finden?
Sie hasste das alles. Diesen Wald, diese Einsamkeit. Ihr beschissenes Leben.
Verdammt, der Schweiß lief ihr Gesicht hinab und brannte. Sie konnte kaum noch die Straße sehen, weil Tränen ihren Blick verschmierten. Sie fasste sich wieder in die Augen, dabei wusste sie, dass es alles nur noch schlimmer machen würde. Aber so war es immer bei ihr: Sie wusste, wie es enden würde, und machte trotzdem immer genau den gleichen Scheiß.
Ihr Atem ging flach. Sie verspürte den Drang, rechts ranzufahren und zu kotzen, aber sie konnte nicht, weil ihr die Angst die Kehle zuschnürte. Nur in Bewegung bleiben, nur in Bewegung bleiben.
Hörte dieser verdammte Wald denn nie auf?
Der Motor brummte, sie spürte die Kraft des Wagens, im Radio dudelte irgendein Song, das Beste der Achtziger, Neunziger und der verfluchten Zweitausender, sie dachte, sie hätte es längst ausgestellt.
Ihr war übel, so übel. Während ihr Kopf glühte, schien in ihrem Bauch ein riesiger Eisklumpen zu stecken. Die Kälte kroch ihr durch den ganzen Körper, den Rücken hinab, sie schüttelte sich, als wäre ein unsichtbarer Geist hinter ihr. Sie lenkte nach rechts, sie musste jetzt doch ranfahren. Im selben Moment sah sie die Lichtung, dort vorne, das kleine gelbe Schild, viereckig, sie hielt das Lenkrad umklammert, blieb auf der Straße, gerade so. Sie kam näher, Flecken-Zechlin stand da, sie wusste es, und dennoch war es für sie, als erblickte sie es zum ersten Mal.
Die Reifen schlugen hart auf dem Kopfsteinpflaster auf, sodass sie im Wagen einen Satz auf ihrem Sitz machte. Dann spürte sie, wie sie ganz ruhig wurde. Wie sie auf einmal wusste, was zu tun war. Etwas in ihrer Kehle löste sich, ein Kloß, sie spürte, wie das Adrenalin anstieg, und in dem Rhythmus, mit dem es durch ihre Adern pulsierte, kehrten ihre Lebensgeister zurück. Und ihre Wut. Die Angst pulsierte immer noch, klar, aber die Wut war jetzt stärker, größer, wie ein Herbststurm nach einem langen Sommer.
Sie fuhr durch das Dorf, betrachtete die kleinen, niedrigen Häuser mit dem grauen Putz, zwischendrin stand auch immer mal wieder eine Stadtvilla, die sich diese Leute gebaut hatten, die ohnehin nie da waren, weil sie ja arbeiten mussten, um das Geld für diesen schönen Schein ranzuschaffen.
In der Mitte des Dorfes, an der Kreuzung, von der es links ab nach Wittstock ging, stand auf der rechten Seite das Haus, zu dem sie wollte. Zwei Geschosse, oben war eine Wohnung. Sie schien schon länger leer zu stehen. Die Gardinen sahen speckig aus, jemand hatte Fensterbilder an die staubigen Scheiben geklebt. Es gab ihr einen Stich. Unten aber war das verhangene Schaufenster und die Tür. Mit dem S darüber. Ein rotes S mit rotem Punkt.
Sie hielt in einiger Entfernung und trank einen Schluck aus ihrer Plastikflasche mit diesem komischen Wasser mit Kirschgeschmack, das sie sich angewöhnt hatte, weil sie von Red Bull wegkommen wollte. Beim ersten Mal hatte es schrecklich geschmeckt, aber jetzt war sie süchtig danach. Sie schraubte die Flasche zu und beugte sich hinüber zum Handschuhfach. Es klickte, und dann lag da die Knarre, schwarz und glänzend. Ihr Schutz, den sie noch nie gebraucht hatte. Bis heute. Als hätte sie geahnt, dass dieser Tag kommen würde.
Sie steckte die Pistole unter ihrem T-Shirt in den Hosenbund, was überflüssig war, weil ohnehin niemand auf der Hauptstraße unterwegs war. Dann stieg sie aus und trat auf den Bürgersteig, der aus losen Feldsteinen zusammengesetzt war. Sie spürte die Huckel unter ihren Füßen. Endlich spürte sie wieder etwas. Hier und jetzt. Hier und jetzt.
Sie fasste sich an den Kopf. Sie war echt zu dämlich. Mühsam kletterte sie wieder in den Transporter. Noch einmal das Handschuhfach. Sie hatte die schwarze Strumpfmaske vorhin nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Der Kollege trug sie immer unter dem Helm, wenn er mit dem Motorrad zur Arbeit fuhr. Er musste sie vergessen haben. Sie nahm sie an sich und stieg wieder aus. Die Hauptstraße war menschenleer.
Sie betrat das Gebäude durch die Glastür, es gab den Gong, der einen Besucher ankündigte, dann schloss sich die Tür hinter ihr.
Wäre in diesem Moment jemand auf der Friedensstraße von Flecken-Zechlin entlanggegangen, hätte er zuerst einen Schuss gehört und dann einen Schrei, der die vor Hitze trägen Vögel in den Bäumen aufscheuchte.
3
»Sie wollen das Junge Konto eröffnen?«
Die Frau mit den hellrot gefärbten Haaren nickte heftig. Frau, dachte Tina Kaminske. Das stimmte doch gar nicht. Hinter dem Tresen stand ein Mädchen, ein hochschwangeres Mädchen genauer gesagt, das sie mit einer Mischung aus unsicherem Stolz und schlecht verstecktem Zweifel ansah.
Hinter ihr stand ein Mann mit verschwitztem T-Shirt, zerrissener Jeans und einem tief in die Stirn gezogenen Basecap, der blass aussah und dessen unreine Haut ihr einen Schauder über den Rücken jagte. Sie kannte beide vom Sehen, der Kerl machte irgendwas bei der Gemeinde und war älter, als er aussah. Die Teeniemutter war aus einer der kleinen Siedlungen im Wald, die aus drei Häusern und einer Bushaltestelle bestanden. Schon vor acht oder neun Jahren hätte Tina Kaminske auf genau diesen Fortgang der Ereignisse gewettet, damals war das Mädchen höchstens zehn und lief rauchend im Arm eines Jungen durchs Dorf.
»Haben Sie denn einen Termin?«, fragte Tina Kaminske. Sie siezte, wen sie nicht genau kannte, schließlich war sie Bankkauffrau.
Diesmal flogen die hellroten Haare von links nach rechts.
Einen Termin!, dachte Sarah Krämer. Sie hatte es Benny doch gesagt. Sie hätten einen Termin gebraucht. Da kann man sich nicht einfach morgens entscheiden und herkommen. Andererseits: Das hier war eine Sparkasse, und sie brauchte ein Konto. Wofür sollte sie denn einen Termin brauchen? Sollte die Tante am Empfang ihr doch gleich sagen, dass sie Mädels ohne Job und mit Baby im Bauch kein Konto gaben – dann könnte sie sich den ganzen Quatsch sparen. Aber sie brauchte nun mal ein Konto, schon fürs Kindergeld, was sie bald kriegen würde. Dann gleich zweimal. Für sich selbst. Und für den Wurm in ihrem Bauch. Benny sei Dank.
Wie sie es hasste, wenn man sie so musterte, wie diese Frau hinter dem Schalter es tat. Da lag alles drin in diesem Blick: Die Frau schaute so, als hätte sie die Klugheit mit Löffeln gefressen, als könnte sie sich über sie erheben. Teeniemutter, pah!, dachte die bestimmt. Hinzu kam das Wissen, dass dieses künftige Konto stets so gut wie leer sein würde, bei null oder knapp darüber – und zwar nur deshalb, weil die Sparkasse einer jungen arbeitslosen Mutter nie im Leben einen Dispo einräumen würde. Und dann war da noch Mitleid in diesem Blick. Mitleid. Das war das Schlimmste.
»Hm, unser Filialleiter telefoniert noch. Er ist nur zweimal die Woche hier, wissen Sie? Und er kümmert sich persönlich um die Kontoeröffnungen. Aber wenn er fertig ist, dann frage ich, ob er Sie zwischenschiebt, in Ordnung? Wollen Sie sich so lange dort hinsetzen? Gibt zwar nur einen Stuhl, aber Ihr Freund kann ja stehen.«
Sarah wandte sich um und erblickte den Holzstuhl in der Ecke neben der Tür. Auf einmal fand sie die Frau gar nicht mehr so schlimm.
»Sie brauchen sich nicht so viel Mühe geben beim Unterschreiben, Frau Müller. Ich sehe doch, dass Sie es sind. Nachname reicht.«
Tina Kaminske lächelte die alte Frau an, die am Nachbarschalter damit beschäftigt war, Formulare auszufüllen. Sie musste sich zusammenreißen, um der Dame nicht den Stift aus den zittrigen Fingern zu nehmen, mit dem sie, auf ihren Rollator gestützt, ihren vollen Namen schrieb, so ordentlich, wie sie glaubte, dass es in einer Bank nötig war. Dabei war Henriette Müller einundneunzig Jahre alt und würde sicher nicht versuchen, die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin zu betrügen – dessen war sich Tina Kaminske absolut sicher. Sie hatte Frau Müller schon durchs Dorf spazieren sehen, als sie selbst noch als kleines Mädchen auf ihrem Klapprad herumgefahren war.
»Darf ich die Überweisung schon haben? Danke …« Sie nahm das Formular entgegen. Zwanzig Euro für Vier Pfoten las sie, wieder einmal eine alte Dame, der die Fotos von den traurig blickenden Hunden auf den Werbebroschüren so zugesetzt hatten, dass sie ihr Geld dafür einsetzte, den Tieren zu helfen.
»Und dann würde ich noch siebzig Euro mitnehmen«, sagte Henriette Müller. »Können Sie es etwas kleiner machen?«
»Natürlich, Frau Müller«, sagte Tina Kaminske und tippte auf der Tastatur des Computers herum. »Ein Zwanziger und der Rest in Zehnern?«
»Genau, junge Frau.«
Siebzig Euro. Jede Woche am Montag hob Henriette Müller genau siebzig Euro ab. Damit würde sie über die Woche kommen. Das passte genau für den Einkauf im Nahkauf: zwei Packungen Toastbrot, drei Gurken, ein Stück Butter, zweimal H-Milch, eine Dose Königsberger Klopse, eine kleine Flasche Eierlikör, ein bisschen Aufschnitt aus der Frischetheke und das Thüringer Pflaumenmus, das sie seit 1970 aß. Nach der Wende hatte sie es nur einmal gegen das von Zentis ausgetauscht, aber das hatte ihr gar nicht geschmeckt. Viel zu süß, keine Stückchen. Leer gegessen hatte sie das Glas trotzdem.
Das Mittagessen brachte der Fahrer vom Menüservice. Mehr gab es eigentlich nicht zu bezahlen. Bis auf die fünf Euro, die sie der Pflegerin zusteckte, die immer am Donnerstag kam, um einmal durchzusaugen und das Bad zu wischen. Die verdiente so wenig Geld, die freute sich über jeden Euro. Henriette Müller hingegen hatte mehr, als sie zum Leben brauchte – ihre eigene Rente und die Witwenrente für ihren Gerhard, der vor vierundzwanzig Jahren gestorben war. Als Vorarbeiter in einer Leiterfabrik hatte er immer gut verdient. Seine Kriegsversehrtenrente bekam sie auch noch. Viel mehr Geld, als sie brauchte, so war es. Wenn sie doch nur etwas damit anzufangen wüsste.
Eine Stimme riss sie aus ihren Gedanken und ließ sie zusammenzucken, obwohl sie eigentlich schwer hörte. Aber dieses dumme Weib hörte sie. »Guten Morgen, liebe Frau Kaminske! Oh, und guten Morgen, liebe Frau Müller.«
Henriette Müller drehte sich nicht um und sah erst auf, als die Dame in dem dunkelblauen Kostüm neben ihr stand und zu ihr herunterschaute. Dame – pah, so sah die sich sicher selbst, in diesem Designerfummel! Und dazu auch noch eine riesige Sonnenbrille, die sie sich in ihr auftoupiertes, aber viel zu dünnes Haar gesteckt hatte. Eine Dame war die ganz und gar nicht!
Henriette Müller kannte sie noch als picklige Teenagerin, die sich vor der Wende immer aufgespielt hatte, weil ihr Vater der Bürgermeister gewesen war und der finsterste Stasi-Knecht, den es im ganzen Ruppiner Land gegeben hatte. Nach der Wende war seine Macht schneller weg gewesen, als er BRD sagen konnte. Das hatten zumindest alle im Dorf gedacht. Doch es war anders gekommen. Er hatte sich nur gut geduckt und gewartet, bis die Entstasifizierungswelle über ihn hinweggerollt war. Als niemand mehr darüber sprach, hatte er so viel Geld und neue Weggefährten eingesammelt, dass er einfach weitermachen konnte wie vorher. Bis ihn ein Herzinfarkt am Steuer an eine alte Kastanie gesemmelt hatte. Die arme Kastanie.
Schon eine Woche später hatte seine Tochter seinen Posten übernommen. Nun war Janine Kukrowski die Ortsteilbürgermeisterin von Flecken-Zechlin.
»Morgen, Frau Kukrowski! Ich mache nur noch Frau Müllers Überweisungen fertig, dann bin ich gleich für Sie da, in Ordnung?«
»Ja, lassen Sie sich Zeit«, antwortete die Ortsteilbürgermeisterin, aber in ihrer Stimme schwang noch eine andere Aussage mit: Aber nicht zu viel. Schließlich bin ich eine Frau mit Terminen, während die Alte nur noch eine Empfängerin sozialer Leistungen ist.
Tina Kaminske konnte die Kukrowski auf den Tod nicht ausstehen. Gewählt hatte sie sie trotzdem vor zwei Jahren, schon zum dritten Mal. Stand ja kein anderer auf dem Zettel. Wer wollte diesen undankbaren Job auch machen? Kaum Geld und dafür stundenlange Sitzungen, ständig Streit mit den Gemeindevertretern und dazu noch diese schrecklichen Bürgersprechstunden. Das konnte man nur aushalten, wenn man einen Mann hatte, der gut verdiente. Dann ließ sich entspannt Hof halten in dem winzigen Rathaus gegenüber der Kirche und nach Feierabend im riesigen Audi Q 5 durch die Ortsteile juckeln.
»Ach, ich hab mich verschrieben«, sagte Henriette Müller und stöhnte.
»Lassen Sie mich sehen, das geht bestimmt.«
»Nein, nein, ich mache es noch mal«, antwortete die alte Dame in einem Ton, der Tina Kaminske befahl, sich wirklich nicht einzumischen.
»Gut, dann, Frau Kukrowski, was kann ich für Sie tun?«
»Ich würde gern den Chef sprechen.«
»In welcher Sache?«
»Das muss ich mit ihm besprechen, wie gesagt.«
»In Ordnung. Haben Sie einen Termin?«
»Er wird wohl Zeit haben«, antwortete die Bürgermeisterin schnippisch.
Tina Kaminske sah auf den Bildschirm ihres Rechners, als stünde dort eine schlagfertige Antwort. Dann blickte sie mit einem Lächeln wieder auf. »Nun, dann müssen Sie sich etwas gedulden. Diese Dame dort möchte ein Konto eröffnen – und sie hat einen Termin.«
Janine Kukrowski blickte sich genervt um, sah die schwangere Jugendliche und murrte etwas in sich hinein, das wie »unerhört« klang.
Tina Kaminske tauschte einen Blick mit Sarah Krämer aus, ein Zeichen leisen Einverständnisses, als die Türglocke erneut anschlug.
4
Es war, als hätten sich alle Köpfe gleichzeitig zum Eingang gewandt. Vielleicht, weil von draußen ein Schwall drückend warmer Luft in die Sparkasse wehte. Vielleicht war es auch die unheilvolle Energie, die in diesem Moment in den stickigen Raum gespült wurde. Jedenfalls sahen sie alle auf und erblickten die Person mit der schwarzen Strumpfmaske, und alle bis auf die sehr alterskurzsichtige Frau Müller sahen auch das schwarze, glänzende Etwas, das die maskierte Person in der Hand hielt.
Tina Kaminske schoss ein Gedanke durch den Kopf: »Ach du Scheiße!« Nein, sie hatte es nicht gedacht, sie hatte es sogar gesagt. Nicht schon wieder!, das dachte sie gleich darauf.
Und dann ging auch noch die Nebentür auf, der Filialleiter trat pfeifend in den Hauptraum. Eine weibliche Stimme rief: »Legt euch auf den Boden, mit dem Bauch zuerst! Du auch, Oma. Das ist ein Überfall.«
Es gab im Leben eines Sparkassen-Filialleiters nur wenige Dinge, die man fürchten musste: Eine zu genaue Kontrolle des Finanzamtes, weil immer irgendein Schlamper die verschiedenen Steuersätze nicht genau in den PC eingab. Oder einen Stresstest von der europäischen Finanzaufsicht, der am Ende sogar noch in der winzigsten Filiale im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu spüren war, weil auf einmal nicht genug Eigenkapital vorhanden war, um auch noch dem allerletzten Tischler ohne Businessplan und mit Altschulden einen Kredit zu geben.
Der Albtraum jedes Sparkassen-Filialleiters aber war ein sonniger Morgen, an dem irgendjemand mit Strumpfmaske überm Kopf die Bank stürmte und allen befahl, sich auf den Boden zu legen.
Ihm, Björn Seelinger, war das noch nie passiert, was insofern kein Wunder war, weil er bislang nur in solchen Filialen gearbeitet hatte, in denen sich nicht mal am Monatsersten ein Überfall lohnte.
Nein, er war kein Held, ganz und gar nicht, und er wollte auch keiner sein. Als er im Türrahmen stehen blieb und die maskierte Frau sah, die ihn aus ihren dunklen Augen bedrohlich anfunkelte, da wäre er am liebsten im Erdboden versunken. Er war neunundzwanzig Jahre alt, Herrgott, er wollte doch nicht hier sterben, in diesem Kaff, so weit weg von zu Hause! Panisch blickte er sich nach weiteren Bankräubern um, aber da war nur sie. Er sah, wie sich die Kaminske auf den Boden legte, neben ihr lag eine schwangere Frau auf der Seite; er sah, wie die Räuberin mit der Waffe herumfuchtelte. Ihr Mund bewegte sich, aber er hörte sie nicht. Es war alles wie hinter einem Vorhang.
Er war kein Held, und doch handelte er. Es war, als wäre er im Autopilot-Modus: Direkt unter dem Lichtschalter war der Alarmknopf. Björn Seelinger wusste es, weil er die beiden Schalter schon fünfmal verwechselt und jedes Mal einen Anschiss vom Regionalleiter bekommen hatte für den Fehlalarm. Unter dem Lichtschalter jedenfalls befand sich der Alarmknopf, und ihm schien, als würde eine unsichtbare Kraft seine Hand heben.
»Hinlegen, du Kasper!«, schrie sie und spürte, wie die schweißnasse Maske an ihrem Gesicht klebte. Doch als sie sah, dass sich seine Hand zum Schalter hob, wusste sie schon, dass es zu spät war, dass sie sich wieder zu blöd angestellt hatte, und die Pistole in ihrer Hand zitterte.
Der Typ mit dem grauen Anzug und der roten Krawatte schaute ihr nicht ins Gesicht, er konnte nur die Waffe ansehen, und dann klickte es. Er hatte den Alarm gedrückt – und nichts geschah.
Keine Sirene, wie sie es sich ausgemalt hatte, keine Gitter, die automatisch runtergelassen wurden.
Und doch war alles zu spät, denn sie zuckte trotzdem zusammen, und in diesem Moment löste sich der Schuss. Es knallte ohrenbetäubend, und der Typ im Anzug schrie auf und brach zusammen, und nun war nicht mehr nur seine Krawatte rot.
5
»Caro, nun komm schon, es gibt Frühstück!«
Linh-Thi Schmidt ließ ihrer Tochter gerne die zehn ungestörten Minuten am Morgen, zwischen Dusche und Klamottenauswahl, aber jetzt waren schon zwanzig Minuten verstrichen. Ein typischer Montag. Außerdem war sie nicht umsonst um sieben Uhr aufgestanden. Sie war stolz, dass sie sich durchgesetzt hatte und sie an zwei Tagen in der Woche vietnamesisches Frühstück aßen.
Wenigstens war Adam schon am Frühstückstisch, na ja, er saß zumindest auf seinem Stuhl. Richtig da aber war er nicht, bemerkte sie mit einem Blick in sein Gesicht, das abwesend wirkte, abwesend und verschlossen. Als wäre Adam tief in Gedanken versunken.
»Deutschlandfunk, die Presseschau. Zu der angekündigten Sozialreform findet die Stuttgarter Zeitung, die Kanzlerin betreibe Klientelpolitik …«
Für Adam war die Weltlage mittlerweile nur noch wie ein nicht enden wollender Verkehrsunfall. Er wollte nichts mehr davon wissen und konnte trotzdem nicht abschalten. Nicht wegsehen. Die Nachrichten am Morgen waren für ihn ein Ritual geworden, eine innere Bestätigung dafür, wie verkommen die Welt war.
»Morgen!«, murmelte Caro, während sie sich auf ihren Stuhl fallen ließ, die Augen auf das iPhone gerichtet.
Das Smartphone, ein Fehler zum elften Geburtstag, schwerwiegend, aber unvermeidlich. Ihre Klassenkameraden waren Carolin circa ein Jahr voraus gewesen, was die unnötige Unterstützung des Apple-Konzerns im Silicon Valley betraf.
»Guten Morgen, Liebste!«, sagte Linh-Thi und gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange, welchen diese nicht mal richtig abwehrte, weil die Timeline bei Instagram allzu vollgeladen war mit den neuesten Wie-mache-ich-mein-Fitnessprogramm-und-ziehe-mir-währenddessen-die-Augenbrauen-nach-Tutorials.
Linh-Thi ging zum Herd und nahm die große Kelle, dann füllte sie aus zwei Töpfen die Bestandteile der Frühstücks-Pho zusammen: die Brühe, für die sie am Vorabend ein Huhn, Markknochen und Rinderbrust aufgesetzt hatte, und die Nudeln mit Ingwer und Sojasprossen, die sie heute früh frisch gekocht hatte. Sie gab noch etwas Koriander und geriebenes Zitronengras darauf und stellte die dampfenden Schüsseln vor Carolin und Adam auf den Tisch.
»Mhmm«, murmelte Carolin, und sogar Adam schloss für einen Moment die Augen, als er sich ganz nah über den Dampf beugte und den Duft inhalierte.
»Na, seht ihr, hat doch gar nicht so lange gedauert, bis ihr euch dran gewöhnt habt.«
Sie hatte ein Jahr diskutieren müssen, um ihren Mann und ihre Tochter von den Vorteilen der herzhaften warmen Frühstücksvariationen aus Fernost zu überzeugen. Carolin war allzu deutsch aufgewachsen, und auch Adams Familie hatte in der schlesischen Heimat höchstens mal eine mit Fett durchzogene Bratwurst und Ei als warmes Frühstück akzeptiert. Doch Linh konnte keinen Toast mit Marmelade mehr sehen – zumindest nicht jeden Morgen.
»Ist heute der Mathetest?«
»Nee, Frau Krüger hat uns bei WhatsApp geschrieben, dass sie krank ist. Wir schreiben erst Donnerstag.«
»Schon wieder krank?« Adam runzelte die Stirn. »Ach ja, ist ja Montag.«
Die Mathelehrerin war bekannt dafür, dass sie vor und nach Wochenenden und an Brückentagen oft vom Eintagefieber heimgesucht wurde. Dass sie den Schülern ihre Krankmeldung aber per WhatsApp mitteilte, darüber würde er wohl nie hinwegkommen. Schöne neue Welt.
»Okay, aber vergiss nicht, dass du heute Nachmittag Schwimmen hast, ja?«
»Jaa-aa, ich weiß.«
Linh musste grinsen, als sie sah, wie Caro sich, tief über die Schüssel gebeugt, mit den Stäbchen eine weitere Ladung Nudeln in den Mund schob.
»Ist superlecker«, sagte Adam und gab noch etwas von der Chilisoße auf sein Essen. »Sag mal, musst du gleich los? Ich würde gern noch etwas mit dir besprechen.«
Sie sah seinen Blick, die hellblauen Augen, die immer ein wenig feucht aussahen, und verstand. »Hm, ich fahre heute mit Brombowski die Hochstände ab, nachsehen, ob alles bereit ist für die Herbstjagden. Im August sind wir weg, und im September werden wir nicht mehr dazu kommen. Dafür kann ich aber auch ein wenig später los. Steht bei dir heute nichts an?«
»Nee, alles entspannt. Die Pitoli hat Bereitschaft.«
Also ein verlängerter Morgen. Er hatte so große Lust auf sie, dass er es kaum erwarten konnte, bis Caro in die Schule ging. Keine Frage, er liebte seine Tochter, auch wenn die Teenager-Manieren gerade richtig durchschlugen. Aber heute wünschte er sich, dass sie sofort das Haus verließ.
Vorhin, als er noch mit geschlossenen Augen in der blau-weiß gestreiften Bettwäsche gelegen und nach Linh gegriffen hatte, um sie an sich zu ziehen und dann total verschlafenen Sex mit ihr zu haben, musste er feststellen, dass das Bett auf ihrer Seite leer war. Richtig, es war Montag. Linh kochte.
Nun saß sie ihm gegenüber, sie trug zu ihrer Schlafshorts nur ein weißes Unterhemd, und er sah ihre kleinen Brüste, die sich durch den dünnen Stoff abzeichneten, und ihre dunkle Haut. Ihr Lächeln lockte ihn schon jetzt. Ja, das würde ein guter Morgen werden.
Das leise Klingeln kam aus dem Schlafzimmer. Linh-Thi bemerkte es als Erste. Ihr Blick suchte Adam, der es noch nicht wahrgenommen hatte, weil er gerade den letzten Kommentar der Presseschau hörte. Doch dann drang das sonore Dauerklingeln auch in seine Wirklichkeit. Er sah sie an und zog eine Augenbraue hoch.
»Zu früh, um gut zu sein«, sagte er, stand auf und ging rasch ins Schlafzimmer.
»KHK Schmidt?«
»Ich bin es.« Sandra Pitolis Stimme tonlos.
»Ja?« Er hätte gerne »Moin, was gibt’s denn?« gefragt, aber sie klang zu erschrocken, obwohl sie eigentlich nicht zu erschrecken war. Das konnte nur eines bedeuten.
»Ein Kind ist verschwunden. Kita in der Brunnenstraße.« Kurze Pause, er hörte sie atmen. »Sie ist zwei.«
»Sieben Minuten«, sagte er. »Danke!« Dann legte er auf.
Aus der Küche drang das laute, melodische Klingeln von Linh-This Diensthandy an sein Ohr. Sie hob sofort ab.
Adam zog sich an, nahm die dunkle Anzughose und das schwarze Hemd aus dem Schrank. Die Lederschuhe durften es nicht sein, an so einem Tag würde er viele Kilometer zurücklegen. Seine Turnschuhe standen im Flur.
Als er in die Küche trat, telefonierte Linh noch immer.
»Was ist mit den Kräften aus Oranienburg?«, fragte Linh, während sie gedanklich alle Optionen durchging.
»Es gab ’nen großen Unfall aufm Berliner Ring. Sattelschlepper gegen Kleinwagen. Und die zwei Kripoeinheiten aus Neuruppin sind im Sondertraining in Potsdam.«
»Ach, komm, wirklich?«
»Wie mir scheint, sind wir beide erst mal auf uns allein gestellt. Aber ick fahr erst mal gucken, vielleicht is’ ja auch nüscht. Du weißt ja, wenn die mit ihre nervösen Finger auf den stillen Alarm drücken …« Brombowski war wirklich durch nichts zu erschüttern. Seine Stimme kam so tief und brandenburgisch aus dem Hörer, als stünde er neben ihr.
»Aber möglich wär’s. Monatserster, da haben die mehr Reserven.«
»Hab ick auch schon jedacht, aber keene Sorge, falls was is: Ick hab schon Alarm geschlagen. Die kommen alle, dauert halt nur.«
»Na, nach Flecken dauert’s eh. Ich mach mich auf den Weg.«
»Ein Montagmorgen, wie er im Buche steht.«
»Bis gleich, Klaus!«
Sie legte auf und sah Adam an, der blass und starr vor ihr stand. Er hatte das schwarze Hemd an. Es durchfuhr sie.
»Was hast du?«, fragte sie und griff nach ihrer Kaffeetasse, weil sie irgendwas in der Hand halten wollte.
»Verschwundenes Kind. Du?«
»Stiller Alarm in einer Sparkasse. Brombowski ist auf dem Weg und sieht mal nach.«
»Oh, na hoffentlich ist das nichts Ernstes.«
»Kind geht vor. Du fährst. Ich bleib noch ’ne Minute mit Caro hier, und dann mach ich auch los.«
»Bis nachher, Schöne!«
»Bis heute Abend! Hoffentlich.«
Er öffnete den kleinen Tresor im Flur und blieb für einige Sekunden reglos davor stehen.
»Hey, Adam!« Er sah sie an, als hätte sie ihn aus einem tiefen Traum geholt. »Kriegst du das hin?«
Es schien, als müsste er überlegen, dann nickte er und murmelte: »Ja …« Schließlich nahm er das Holster mit der Pistole darin, schnallte es um und verließ die Wohnung. Noch Minuten nachdem sie ins Schloss gefallen war, konnte Linh-Thi Schmidt den Blick nicht von der Tür abwenden, durch die ihr Mann gerade verschwunden war.
25 Jahre früher – 1997
Als sie noch jünger gewesen war, viel jünger als jetzt, da hatte sie oft stundenlang hier oben am Fenster gestanden und auf die Lichter unter sich gesehen. Auf die Lichter und auf die Bewegungen der Figuren und Fahrzeuge, die nur Ameisengröße hatten, wenn überhaupt. Alles sah aus wie eine Spielzeugwelt. Aus dem 17. Stock des Hochhauses in der Rhinstraße 21 sah die Welt aus wie ein aus Playmobil erbauter Ort. Die gelben Straßenbahnen der Linie 27 – eine fuhr in Richtung Endstation, eine in Richtung Innenstadt – begegneten sich gerade wie zwei Raupen. Daneben rasten die kleinen Autos vorbei wie Matchbox-Wagen, rot, blau, grau und schwarz; wenn’s ganz bunt wurde, auch mal gelb oder pink. Sie stellte sich dann vor, wie die Fahrerin wohl aussah, die in so einem pinken Auto saß. Sie beobachtete die Fußgänger, die viel langsamer waren als die Fahrzeuge, aber von ihren Wegen abweichen konnten, weil sie weder die Straße noch die Schienen nutzen mussten – und doch taten sie es nicht, sie blieben brav auf den Bürgersteigen. Niemand schlug sich in die Büsche oder sprang oder rannte auf einmal los, wie sie es wohl gemacht hätte, wenn sie jetzt dort unten gewesen wäre. Sie gingen einfach brav im Schneckentempo ihrer Wege. Ganz anders als früher, in ihrer Playmobilwelt, mit der sie spielte, wenn sie mal nicht aus dem Fenster sah. Bei ihr rannten die Playmobilfiguren oft, sie sprangen wild herum, sie machten verrückte Sachen. Linhs Playmobilmenschen waren nicht sehr deutsch. In ihrer Spielzeugwelt lächelten auch alle. Die Müllfahrer, der Doktor in der Krankenstation, sogar die Polizisten. In ihrem echten Leben lächelten die Polizisten nie.
Das Sonnenlicht lief gerade wie ein gelbes Meer in die Häuserschluchten vor ihr, kam von rechts neben dem spitzen Fernsehturm, der alle drei Sekunden rot blinkte. Mama hatte es gut mit ihr gemeint, weil sie ihr und ihrem Bruder dieses Zimmer überlassen hatte, mit Blick auf Berlins Zentrum. Das Zimmer von Mama und Papa hingegen ging nach hinten raus, von dort sah man nur noch mehr Hochhäuser, hinter denen irgendwann die eintönigen Felder und Wälder begannen.
Sie aber, Linh-Thi, hatte immer auf den Fernsehturm schauen können, auf das Rote Rathaus, auf das Nikolaiviertel und die Kuppel des Berliner Doms. Sie hatte alle diese Gebäude benennen können, in bestem Deutsch natürlich, und dann hatte sie es Mama vorgesprochen, und Mama hatte versucht, die Wörter zu wiederholen, bis sie beide lachen mussten, weil Mama es so komisch gesagt hatte.
Alle fünf oder sechs Minuten war da auch ein Flugzeug. Je nachdem, wie der Wind an diesem Tag stand, setzte es gerade zur Landung auf dem Flughafen Tegel an oder schraubte sich hoch in die Luft, immer an ihrem Fenster vorbei, bevor es in eine scharfe Kurve ging. Entweder entfernte das Flugzeug sich in Richtung Westen, oder es flog über sie hinweg, genau über ihr Haus, dann bildete sie sich ein, es würde den Weg nach Hause einschlagen.
Nach Hause. Was wusste sie schon von ihrem Zuhause? Nur den Namen. Vietnam. Dort gewesen war sie noch nie. Zumindest konnte sie sich nicht erinnern. Sie war drei Monate alt, als ihre Mutter mit ihr und ihrem Bruder hergekommen war, dem Vater hinterher, der schon seit acht Jahren in Deutschland arbeitete und nur kurz nach Hause gekommen war, um sie zu zeugen, so schien es ihr heute.
Damals hatten Mama, Duc und sie nach der Ankunft in ein Heim gemusst. Zwei Jahre lang waren sie dortgeblieben, was für eine unvorstellbar lange Zeit. Hatten sich mit zwölf Leuten ein Zimmer geteilt, drei vietnamesische Familien, insgesamt sechs Kinder. Deshalb hatte Linh das gar nicht schlimm gefunden, auch wenn ihr die genauen Erinnerungen fehlten, sie war damals schließlich noch sehr klein gewesen. Sie erinnerte sich nur daran, dass es immer laut gewesen war, laut und fröhlich oder zumindest laut, und das war schön, weil sie niemals allein war.
Als sie dann in diese Wohnung gezogen waren, Rhinstraße 21, 17. Stock, war sie oft allein gewesen. Ihr Bruder Duc war viel älter als sie, er trieb sich draußen mit Freunden rum. Mama musste viel arbeiten, und Papa musste noch mehr arbeiten. Das sagte er zumindest immer, aber sie glaubte nicht, dass es wirklich stimmte. Doch wer würde Papa schon widersprechen? Mama sah jedenfalls immer erschöpfter aus als Papa, wenn sie am Abend heimkam, und Papa roch manchmal nach Schnaps. Mama roch nie nach Schnaps. Mama roch immer nach Plastik.
Bereits als Vierjährige hatte sie die Nachmittage nach der Kita allein zu Hause verbracht und war auch allein, als sie mit sieben Jahren, den Schlüssel an einem Band um den Hals, aus dem Hort nach Hause kam. Dann hatte sie entweder stundenlang am Fenster gestanden oder mit ihren Playmobilfiguren gespielt.
Irgendwann hatte sie entschieden, dass sie nicht mehr allein sein wollte. Da hatte sie sich im Hort einfach so viele Freunde gesucht, wie sie haben wollte, und hatte sich draußen herumgetrieben. Es war ihr nie schwergefallen, Freunde zu finden. Anderen zu gefallen. Sie war immer freundlich, das hatte sie von Mama gelernt.
Heute, sechs Jahre später, konnte sie den Moment am Fenster richtig genießen. Weil sie nicht mehr wartete, bis Mama oder Papa nach Hause kamen. Sondern weil sie endlich mal Zeit für sich hatte. Ganz kurz nur, bevor sie sich der nächsten Aufgabe widmen musste. Sie hatte zehn Minuten zum Einfach-mal-nur-Linh-Sein-und-aus-dem-Fenster-Sehen.
Jetzt war sie schon groß, kein Kind mehr, sondern ein erwachsenes Mitglied der Familie. Und ihre Familie arbeitete. Immer. Viel. Für einen Zweck: Geld. Geld anhäufen. Damit das größte Problem, die größte Sorge, endete: Armut.
Ende der Leseprobe