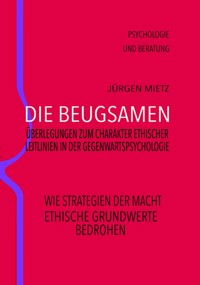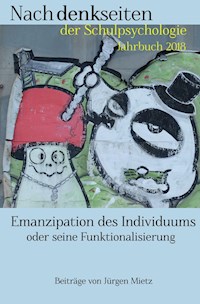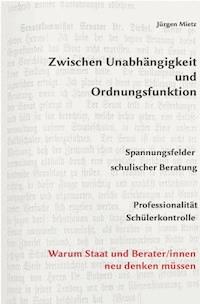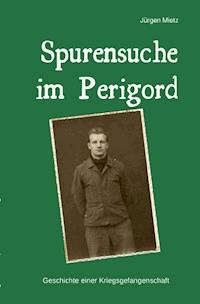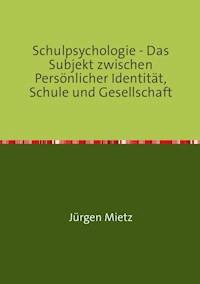Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der Autor setzt sich mit der Tradition der so genannten Schülerhilfe in Hamburg auseinander. Schülerhilfe bedeutete Schülerkontrolle, Schülerfürsorge und schulpsychologischer Dienst. Die daraus sich ergebenden Aufgaben bis hin zur Lehrerberatung und Supervision sind teilweise widersprüchlich und konkurrierend (gewesen). Beratungssettings und der Rahmen für Beratung sind in manchen Fällen wenig eindeutig und kohärent. Für Identitätsbildung und Entwicklung einer Beratungskultur können Irritationen und Hindernisse auftreten. Die traditionell starke Orientierung im Sinne einer Schülerforsorge erschwert die Umsetzung systemischer Ansätze, also solcher Ansätze, die im Lehrerhandeln mit seinen subjektiven Voraussetzungen wesentliche Entwicklungsressourcen für die Mitglieder der Schule sehen. Im Jahr 2000 ging die Schülerhilfe in den Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen (ReBuS) auf. Seit 2012 setzen sie ihre Arbeit als Beratungsabteilungen in einer neuen Organisation, den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBz), fort. Tradition und neue Aufgaben formen und formieren die Beratungspraxis - teilweise mit beunruhigenden Folgen, sofern Beratung als Möglichkeit der Aufklärung und des vertieften Verstehens gelten soll. Als Weg zu Einsichten in die eigene Lebensgeschichte und zu ihrer mündigen Gestaltung. Der Autor möchte dazu anregen, die Funktion und Bedeutung von Organisationsveränderungen zu hinterfragen. Zudem warnt er vor den Folgen eines Beratungsverständnisses, das sich als Steuerung versteht und sich im Korsett einer zweckrationalen Organisation mit ihren emanzipatorischen Anteilen aufgibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schülerhilfe in Hamburgund ihre Nachfolgeorganisationen
Wege und Varianten der Schulberatung
Jürgen Mietz
Mai 2015
ISBN 978-3-7375-5469-5
“Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den Kantischen Ausdruck verwenden darf, die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.”
Theodor W. Adorno
Dieses Zitat fand ich zufällig (?) kurz vor der Fertigstellung meines Textes. Es trifft recht gut, was Zweck von Beratung sein könnte: Kraft zur Reflexion, Selbstbestimmung, Urteils- und Widerstandsfähigkeit.
1 Einleitung
Die folgende Darstellung ist Teilergebnis einer Veranstaltung des »Landesverbandes Schulpsychologie NRW«. Es ging um einen Vergleich der schulpsychologischen Entwicklungen in NRW mit jenen in Hamburg. In NRW und in anderen Bundesländern wie auch in der Hamburger Selbstdarstellung war das Hamburger Modell der ReBuS (Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen) häufig als nachahmenswert charakterisiert worden, unter anderem in Gutachten von Klaus Klemm und Ulf Preuß-Lausitz1. Bemerkenswert schien den Befürwortern die Zusammenlegung unterschiedlicher Funktionen und Professionen in einer Organisation. Wo Betrachter sich von der Menge der Schulformen, der Hürden bei Übergängen, der bürokratischen Abgrenzungen abgestoßen fühlen, mochte ihnen das ReBuS-Modell als elegante Überwindung solcher Untiefen erscheinen. Tatsächlich hatten sich beide Gutachter mit ReBuS unkritisch und nur summarisch befasst. Unter anderem Interventionen des Landesverbandes Schulpsychologie NRW dürfte es zu verdanken sein, dass das Modell bisher nicht in NRW eingeführt wurde.
Besonders attraktiv am ReBuS-Konzept dürfte für Pädagogen und Sonderpädagogen das Versprechen auf individualisierte Förderung und sozialpädagogische Betreuung von Kindern sein. Hilfe für das Kind ist wesentlich Hilfe unmittelbar am Kind – im pädagogischen Gedankengang einleuchtend. Darüber hinaus war es immer Aufgabe der Schülerhilfe, der ReBuS und ihrer jüngsten Nachfolgerin der ReBBz (regionale Bildungs- und Beratungszentren), Schulpflichtverletzungen zu verfolgen, zu dokumentieren und zu bearbeiten.
Dieser Aufgabenmix wirft aus beratungstheoretischer Sicht Fragen auf. Die Beratungseinrichtung ist einerseits schulnah parteilich und »aufsichtsaffin«. Andererseits soll Beratung modern systemisch konzipiert, also Schule und Lehrerschaft problem- und lösungsrelevant einbeziehen. Das Qualifikationsprofil und die Ausrichtung der Hilfe am Kind lassen in der Praxis nur einen (paradoxen) halbierten systemischen Ansatz zu. Der in der deutschen Schulpsychologie in Gang gekommene »Paradigmenwechsel der Schulpsychologie« als Erweiterung des Blicks über das symptomtragende Kind hinaus auf Schule und Lehrer vollzog sich in Hamburg auf besondere Weise mehrfach gebrochen.
In meiner Darstellung benutze ich Quellen der Sektion Schulpsychologie des BDP, ältere Ausgaben der Hamburger Lehrerzeitung der GEW und Zeitzeugenaussagen. Meine 5 jährige Erfahrung als Schulpsychologe in ReBuS und ReBBz bemühte ich mich zu objektivieren, was nicht vollständig gelungen sein mag. Bedauerlicherweise sind in den mir zugänglichen Bibliotheken Konzepte der Schulbehörde, die Veränderungen der Organisationsform begründeten, nicht angezeigt worden. Falls Leserinnen und Leser mit Dokumenten aushelfen können, bin ich für solche Hinweise dankbar.
2 Geschichte der Schülerhilfe
Die Hamburger Schülerhilfe galt in der westdeutschen und später gesamtdeutschen schulpsychologischen Debatte als Mutter der Schulberatung2. Erhielt die Organisation auch »erst« 1953 die Bezeichnung »Schülerhilfe«, so lässt ihre Vorgeschichte einige Annahmen über Selbstverständnisse von Beratung und Hilfe in der Hamburger Schulbehörde zu. Zieht man diese Geschichte in Betracht, lässt sich einerseits feststellen, dass es über die Jahrzehnte hinweg einige organisatorische Veränderungen gibt - hier sind vermutlich die Regionalisierung, wie auch die organisatorische Zusammenführung mit Schule vor allen anderen zu nennen –, andererseits gibt es frappierende Kontinuitäten, die dem Aufbau einer zeitgemäßen Beratungsorganisation mit einer Kultur der Beratung im Wege stehen. Für andere Bundesländer stellt sich damit die Frage, ob es sinnvoll für sie ist, sich am Hamburger Modell zu orientieren. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel NRW, können auf andere Traditionen und Zugänge zu Problemlösungen verweisen. Ebenfalls zeigt Schleswig-Holstsein eine viel versprechende schulpsychologische Orientierung3.
Es gibt einen Bericht von Walter Bärsch4, der erste Eindrücke in die »DNA« der Schülerhilfe ermöglicht. Er gibt darüber hinaus Hinweise auf andere Modelle, etwa das hessische5, das für Hamburg eine gewisse Bedeutung erhalten sollte.
Walter Bärsch macht in der Einleitung seines Berichts einige Anmerkungen zu den Motiven, eine Schulpsychologie zu »gründen«. Er geht von einem Wunsch der Lehrer aus. Diese wollten Hilfen für Schüler auf empirischer Grundlage bekommen6, in Abgrenzung zu einer idealistischen Pädagogik7, etwa eines Herbart. Für unsere Fragestellung scheint interessant, dass die Vorläuferinstitution, aus der die Schülerhilfe hervorging, nach Bärsch »nur mit großer Toleranz als schulpsychologisch« bezeichnet werden konnte.
Tatsächlich war sie als »Dienststelle Schülerkontrolle« 1931 gegründet worden, die mit polizeilichen, repressiven Mitteln die Einhaltung der Berufsschulpflicht durchzusetzen hatte (nach einem Gesetz von 1919). Sie hatte aufsichtliche Aufgaben: Befreiung vom Schulbesuch, Beurlaubung, die Zuführung von Schülern, Erstellung von Strafanträgen. Seit 1938 hatte sie den Status einer Ortspolizeibehörde, mit dem Untertitel: »Abteilung Schulpolizei«. Es sei dann eine Beruhigung eingetreten, nach 1945 seien die Probleme in Zusammenhang mit den Wirren und Verunsicherungen der Nachkriegszeit jedoch auf andere Weise wieder aufgetreten.
Dabei hätten sich laut Bärsch die Vorzeichen nach 1945 allerdings deutlich geändert. Viele verantwortliche Männer der Schulbehörde entstammten nach Bärsch der Reformschulbewegung. Es wurde nun auf eine sozialpädagogische und pädagogische Betreuung der Jugendlichen wert gelegt. Bärsch zitiert aus einem Schreiben: » ... soll die Schülerkontrolle in Zukunft ihre Aufmerksamkeit besonders auf soziale und pflegerische Maßnahmen zum Wohl der gesamten schulpflichtigen Jugend richten.« Bärsch versteht das als »Umwandlung der ''Schülerkontrolle'' in eine sozialpädagogische Dienststelle«. Dieser Teil der Schülerhilfe hieß nach Bärsch noch 1973 »Schulpflegerischer Dienst« (für Schulschwänzer, werdende Mütter, so wie für Beurlaubungen von Schülern des 9. Schuljahres).
1948 war die Bezeichnung »Schulpolizei« abgeschafft worden. Eine sozialpädagogische Orientierung sollte Leitlinie werden. Zu dieser Zeit wurde auch Dr. Hans Kirchhoff Mitarbeiter der Schülerhilfe8. Er forcierte, die sozialen und psychischen Hintergründe für Lern- und Verhaltensprobleme aufzuhellen. Bärsch sieht in Kirchhoff den »Begründer der Abteilung, die wir jetzt in der Schülerhilfe den ''schulpsychologischen Dienst'' nennen.«