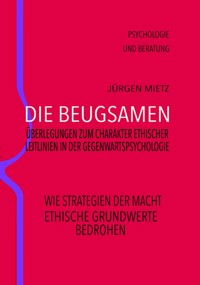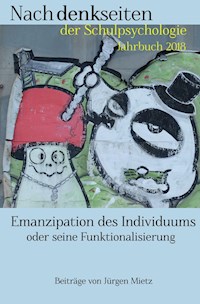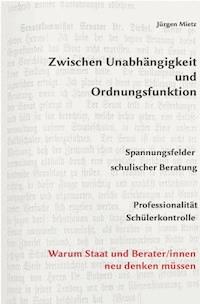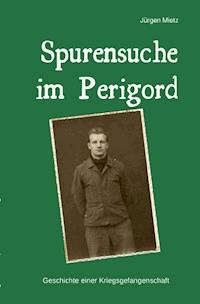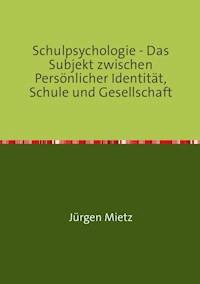Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo die (Ver-) Messung von Menschen und ihre Klassifizierung in den Vordergrund rücken, droht ein Verlust an Individualisierung, Subjektorientierung und Räumen der Reflexion. Hans Lämmermann, der als erster Schulpsychologe Deutschlands gilt, verfolgte und entwickelte ein quantitative , messende Schulpsychologie. Sie passte zu den Sortieraufgaben des deutschen Schulsystems und hatte damit eine eigene Rationalität. Lämmermann war von der Güte seiner Instrumente so überzeugt, dass er seine Erfahrungen dem NS-Regime für ihre Auslesezwecke anbot. Die dem Anschein nach mit den Prinzipien der Weimarer Republik und des NS-Regimes kompatible schulpsychologische Konzeption wirft Fragen nach den ethischen Grundlagen der Schulpsychologie und ihrer Konzepte auf. Gibt es überdauernde psychische und gesellschaftliche Strukturen, die den humanistischen Anspruch von Psychologie und Beratung korrumpieren können und sie Herrschaftsinteressen ausliefern? Schulpsychologie heute sieht sich mit Ansprüchen aus Politik und Verwaltung nach Optimierung und Effizienz konfrontiert. Unabhängigkeit und ergebnisoffene Beratung, wie auch Subjektorientierung und Förderung der Urteilsbildung geraten als Ziele in die Bredouille und machen einer Logik des "Hineinprozessierens" in vorgegebene Strukturen Platz. Mit der Untersuchung des Wirkens von Hans Lämmermanns weist der Autor auf die Notwendigkeit von Selbstreflexion und Organisationsreflexion hin, die nicht ohne Verortung in die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit auskommen können. Zumindest dann, wenn die Psychologinnen und Psychologen nicht ihre Ansprüche aufgeben wollen, Diener'innen des Humanen sein zu wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor ist Diplom-Psychologe. Bis 2014 arbeitete er als Schulpsychologe und Supervisor.
Texte: © Copyright bei Jürgen Mietz, 2016 und 2021 Umschlaggestaltung Jürgen Mietz. Fotos aus Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landgericht-frankfurt-2010-ffm-081.jpg. Dontworry, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0>, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gauss_dichtefunktion.svg
StefanPohl, CC0, via Wikimedia Commons
Verlag: Jürgen Mietz, [email protected] Druck epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Gewissensfragen der Schulpsychologie
Welche Ethik braucht sie in Zeiten von Daueroptimierung und Standardisierung? Jürgen [email protected] 2016 Überarbeitet und geringfügig erweitert 2021
Vorbemerkungen
Davon, dass Hans Lämmermann als Gründungsvater der Schulpsychologie angesehen werden könnte, hörte ich zum ersten Mal 2015. Damals befasste ich mich damit, auf welche Weise ethische Fragen in der Schulpsychologie eine Rolle spielen. Ich stieß auf Hans Lämmermann. Ich erfuhr, dass er schon einmal Gegenstand des Versuchs einer Traditionsbildung und einer Selbstbesinnung gewesen war. 1997, 75 Jahre nach dem Beginn des Wirkens von Hans Lämmermann, befasste sich die Sektion Schulpsychologie des BDP mit der Person und ihrem Wirken. Was dabei herauskam war, dass Hans Lämmermann kaum zur Identifikationsfigur des jungen Fachgebiets der Schulpsychologie taugte. Wenngleich der Versuch, sich einer zweifelhaften Vergangenheit zu stellen, ehrenvoll war, und sich einige interessante Fragen ergaben, dürften sich die Versuche einer Traditionsbildung oder Aufarbeitung des Jahres 1997 mehr oder weniger spurlos im Sand des schulpsychologischen Alltagsbetriebs verloren haben.
Ich selbst war erst 2015 auf die Bemühungen der Sektion Schulpsychologie im BDP gestoßen. Mir schien die vermeintliche Grundsteinlegung der Schulpsychologie 1921 – und was daraus folgte – so interessant und Gegenwartsfragen berührend, dass ich einen Aufsatz[Fußnote 1] anfertigte. Ich erweiterte das Thema noch ein wenig um Fragen, die sich sowohl mit der Anfälligkeit der Psychologie für herrschaftliche institutionelle Interessen, als auch mit den Möglichkeiten alternativer Ansätze befassten. Der Artikel blieb weitgehend ohne Resonanz. Bis auf eine Ausnahme: Eine Kollegin in Bayern hatte ihn gelesen und mich eingeladen, einen Artikel für die Loseblatt-Sammlung des Handbuchs der Schulberatung[Fußnote 2] zu schreiben. Ich fühlte mich geehrt und begann aufs Neue. Ich nutzte die Gelegenheit, um auf ethische Dilemmata schulpsychologischer Praxis hinzuweisen. Der inzwischen „100jährige Lämmermann“ war noch einmal Ausgangspunkt für Überlegungen, die sich nun mehr mit Gegenwartsfragen der Schulpsychologie befassten.
Nun bietet das Motto des Kongresses der Sektion – dafür verdient sie Dank und Anerkennung – ein weiteres Mal Gelegenheit, sich mit Geschichte und Identität der Schulpsychologie, mit ihren Orientierungen und Fehlorientierungen zu befassen. Ohne Zweifel wird man erkennen, dass es Entwicklungslinien aus der Gründungszeit bis in die Gegenwart gibt. Wie immer, bietet Geschichte Gelegenheit zur Reflexion, dazu, sich den Voraussetzungen des eigenen Fachs zu nähern. Vielleicht auch, eine Orientierung für die Gegenwart zu gewinnen.
Meinen ursprünglichen Artikel des Jahres 2015/2016 habe ich leicht überarbeitet und hoffentlich verbessert. Er beginnt auf der nächsten Seite.
Februar 2021
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
1 Gründung und kurze Geschichte der Schulpsychologie – Auslese
Personen und Träger des Mannheimer Schulmodells
Verbessertes Leben durch Bildung
Institutionalisierte Logik der Klassifizierung und Auslese
Das Ende des Mannheimer Modells und der Schulpsychologie
2 Hans Lämmermanns Schulpsychologie: Diagnostik und Selektion
Naturwissenschaftliche vs. geisteswissenschaftliche Psychologie
Abwahl subjektorientierter Ansätze
Lämmermann kennt die Schwächen seines Konzepts – und ignoriert sie
3 Hans Lämmermann und die Nationalsozialisten
4 Hans Lämmermann und die Versuche seiner Kollaboration mit dem NS-Regime
5 Ethische Grundlagen in der Gegenwart
6 Verdinglichung und Entfremdung – Vermutungen über einen Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart
7 Ansätze zu einer Vervollständigung der Schulpsychologie
Schulpsychologie und Beratung der Post-Nazismus Epoche
Hinweise zu erweiternden Konzepten
Nachträgliche Überlegungen zu Wegen und Abwegen der Schulpsychologie
Ausweitung totalitärer Forderungen
Gesellschaftsblindheit
Modernisierungsforderungen
Resilienz und Emotionsregulation
1 Gründung und kurze Geschichte der Schulpsychologie – Auslese
1997 feierte die Sektion Schulpsychologie des Berufsverbandes deutscher Psychologen und Psychologinnen (BDP) das 75 jährige Bestehen der Schulpsychologie in Deutschland. 1922 hatte zum ersten Mal in Deutschland ein Schulpsychologe, Hans Lämmermann, seinen Dienst angetreten, und zwar in Mannheim. Der Start der deutschen Schulpsychologie ist in hohem Maße eine Geschichte des Hans Lämmermann. Offenbar fasziniert von den Möglichkeiten der Testpsychologie und der gruppenbezogenen Experimentalstatistik entwickelte er ein methodisch elaboriertes Programm der Untersuchung der Leistungsfähigkeit von Schülern und Schülerinnen. Die Ergebnisse dienten dazu, sie zu klassifizieren und unterschiedlichen Leistungsniveaus zuzuordnen.
Das Mannheimer Schulmodell zeichnete sich durch äußere Differenzierung und vergleichsweise kleine Klassen aus, im Gegensatz zum bis dahin geltenden Schulsystem, welches 80 Prozent der Kinder besuchten, von denen aber nur ein Drittel den Volksschulabschluss schaffte.
Personen und Träger des Mannheimer Schulmodells
Zentrale Personen für die Errichtung des Mannheimer Modells waren:
• Anton Sickinger, Stadtschulrat und SPD-Mitglied. Wenngleich ursprünglich Lehrer an einem Gymnasium, wurde er als Leiter des Volksschulrektorats in Mannheim berufen.
• Es war Otto Beck, Oberbürgermeister, den Nationalliberalen nahestehend[Fußnote 3], der mit Anton Sickinger die Stelle eines Stadtschulrats besetzte. Beck war ein Reformer und setzte viele weitere Projekte in Gang.
• Julius Moses, Arzt mit vielseitigem sozialem, sozialmedizinischem und sozialpolitischem Engagement. Laut Hans Lämmermann »Leiter der Beratungsstelle für Schwererziehbare (Psychopathenfürsorge)«; aktiv in der jüdischen Gemeinde, Mitglied der Gesellschaft für Heilpädagogik, erster hauptamtlicher Schularzt Deutschlands. 1933 entzogen die Nationalsozialisten ihm seine Approbation. Er emigrierte nach Palästina und beteiligte sich am Aufbau des dortigen Gesundheitswesens. (Wikipedia)
• Peters, Professor für Pädagogik und Psychologie an der Handelshochschule, der die Notwendigkeit der Schulpsychologie begründet hatte, wurde 1933 aus dem Dienst gedrängt (Wikipedia) .
Verbessertes Leben durch Bildung
Angesichts einer Bildungssituation, die für die breiten Massen eher Verwahrung denn Entwicklung bedeutete, dürfte die Schaffung eines mehrgliedrigen Schulsystems mit Gelegenheiten und Orten eines Bildungsaufstiegs und kultureller Betätigung im städtischen Umfeld eine fundamentale Verbesserung gewesen sein[Fußnote 4].
In den Anfangsjahren des Modells, 1901 wurde es gegründet, war es sicherlich auch eine Reaktion auf den Bedarf der Industrie an ausgebildeten, für den industriellen Prozess geformten Arbeitskräften. In den 1920er Jahren dürfte das gesamte Schulwesen von der neuen Weimarer Verfassung (als ein Ergebnis der Novemberrevolution 2018) profitiert haben. Kommunistische, sozialistische, liberale Kräfte versuchten, auch mit einem erneuerten Schulwesen, Wind unter die demokratischen Flügel zu bekommen. Die Befreiung von Kirche und Ständestaat und die Schaffung einer Schule für alle waren auch in der Lehrerschaft verbreitete Ziele. Andererseits waren monarchistische, militaristische und konservative Kräfte nicht bereit, klein beizugeben.
Die politisch-ökonomischen Verhältnisse waren instabil. Erfolgreiche Bildung und Ausbildung, Verbesserung der Lebensverhältnisse waren durchaus von hohem Rang für eine Sicherung der jungen Weimarer Republik.
Bei allem Interesse an einer Demokratisierung der Verhältnisse mochte das Bürgertum nicht auf Privilegien und Nutzung der Startchancen in der Konkurrenz mit der gestärkten Arbeiterklasse verzichten. Das Bildungswesen sollte ihres bleiben. Das Konzept Ausschluss und Zugehörigkeit in Gestalt eines vielgliedrigen Schulsystems blieb erhalten. Die Website der Stadt Mannheim setzt dem Stadtschulrat ein Denkmal und zitiert ihn mit den Worten
»Nicht allen das Gleiche, sondern jedem das Angemessene.«[Fußnote 5]
Damit habe er die individuelle Förderung eingeführt, feiert die Stadt ihren Sohn. Teil dieser Vorstellung von Förderung war die Schaffung von Zügen für die schwachen Schüler, zum einen
»Die eigentlichen Hilfsschulen – für Kinder mit wirklichen geistigen Defiziten.«
Zum anderen: