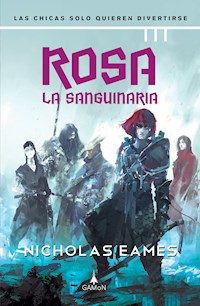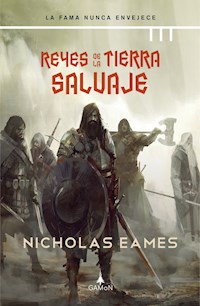13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Könige der Finsternis
- Sprache: Deutsch
Tam Hashford hat genug von ihrem langweiligen Dasein als Schankmaid in ihrem kleinen Dorf und von der fast schon erstickenden Fürsorge ihres alleinstehenden Vaters. Sie träumt von einem Leben voller Abenteuer und Gefahren, einem Leben wie es die Söldnertruppen führen. Als eines Tages Fable, die Truppe der legendären »blutigen« Rose, im Dorf Station macht, ergreift Tam ihre Chance: Sie heuert bei Fable als Bardin an und geht mit ihren großen Idolen auf Tour. Noch hat Tam keine Ahnung, dass Rose auf einer hochriskanten Mission in den Norden ist. Einer Mission, an deren Ende Ruhm und Ehre warten – oder der Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Tam Hashford hat genug von ihrem eintönigen Leben in Ardburg, genug von ihrer langweiligen Arbeit im Eckstein, der Dorftaverne, und vor allem hat sie genug von der fast schon erstickenden Fürsorge ihres Vaters, dem es am liebsten wäre, seine Tochter würde nie auch nur einen Fuß vor die Türe setzen. Tam hingegen träumt von einem Leben voller Abenteuer und Gefahren, einem Leben wie es die Söldnertruppen führen. Als eines Tages die Fabel, die Truppe der legendären »blutigen« Rose, in Ardburg Station macht, ergreift Tam ihre Chance: Sie heuert als Bardin bei der Fabel an und geht mit ihren großen Idolen auf Tour. Und zunächst verläuft ihre Reise auch genauso, wie Tam es sich vorgestellt hat: Tagsüber kämpfen die Söldner in den Arenen des Landes gegen die unglaublichsten Ungeheuer, und nachts wird gefeiert, bis alle unter den Stühlen liegen. Sogar die ein oder andere Romanze wartet am Wegesrand auf Tam, und sie ist glücklicher als je zuvor. Doch sie hat keine Ahnung, dass Rose sich auf einer hochriskanten Mission in die eisigen Weiten des Nordens befindet. Einer Mission, die das reinste Selbstmordkommando ist …
Der Autor
Nicholas Eames wurde in Wingham, Ontario geboren. Er besuchte das College für Theaterkünste, gab das Schauspielen aber auf, um Fantasy-Romane zu schreiben. Sein Debütroman Könige der Finsternis wurde von dem Magazin Phantastik Couch zum Buch des Jahres gekürt. Er lebt in Ontario, Kanada.
Mehr über Autor und Werk erfahren Sie auf:
www.nicholaseames.com
NICHOLAS EAMES
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Siefener
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
BLOODY ROSE
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 05/2020
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2018 by Nicholas Eames
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstraße 28, 81673 München
Karten: Tim Paul Illustrations
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25865-8V002
www.heyne.de
Für meinen Bruder Tyler.
Wenn dieses Buch deiner würdig ist,
dann nur deshalb, weil es dein Werk ist.
1
DER MARKTDER UNGEHEUER
Ihre Mutter pflegte zu behaupten, Tam habe ein wyldes Herz. »Das bedeutet, dass du eine Träumerin bist«, hatte sie zu ihrer Tochter gesagt. »Eine Wanderin, so wie ich auch.«
»Das heißt, dass du vorsichtig sein solltest«, hatte ihr Vater hinzugefügt. »Ein wyldes Herz braucht einen klugen Kopf, der es besänftigt, und dazu noch einen starken Arm, der es beschützt.«
Ihre Mutter hatte darüber gelächelt. »Du bist mein starker Arm, Tuck. Und Bran ist mein kluger Kopf.«
»Branigan? Du weißt, dass ich ihn gernhabe, Lil, aber dein Bruder würde sogar gelben Schnee verschlingen, wenn du ihm sagst, dass er wie Whiskey schmeckt.«
In Tams Erinnerung klang das Lachen ihrer Mutter wie Musik. Hatte ihr Vater überhaupt gelacht? Vermutlich nicht. Tuck Hashford hatte nie viel für Gelächter übriggehabt. Jedenfalls nicht in der Zeit, bevor das wylde Herz seiner Frau sie getötet hatte, und erst recht nicht danach.
»Mädchen! He, Mädchen!«
Tam blinzelte. Ein Händler mit einem Backenbart und einem vergilbten Haarkranz betrachtete sie abschätzig.
»Ein bisschen jung für eine Viehtreiberin, oder?«
Sie richtete sich auf, als würde sie älter wirken, wenn sie größer war. »Na und?«
»Also …« Er kratzte sich an einer schorfigen Stelle auf seinem kahlen Kopf. »Was führt dich zum Markt der Ungeheuer? Bist du mit einer Truppe hier?«
Tam war keine Söldnerin. Sie war nicht einmal in der Lage, für ihr eigenes Leben zu kämpfen. Zwar mochte sie im Bogenschießen ganz geschickt sein, aber das konnte jeder lernen, der zwei Arme und einen Pfeil zur Verfügung hatte. Außerdem hatte Tuck Hashford eine eiserne Regel aufgestellt, wenn es darum ging, ob sich seine einzige Tochter einer Gruppe von Söldnern anschließen sollte oder nicht: »Auf keinen Fall, verdammt!«
»Ja«, log sie. »Ich bin mit einer Truppe hier.«
Argwöhnisch beäugte der Mann das dürre, große Mädchen, das ohne jede Waffe vor ihm stand. »Ach ja? Wie heißt sie denn?«
»Rattensalat.«
»Rattensalat?« Das Gesicht des Mannes wurde so hell wie ein Bordell bei Sonnenuntergang. »Das ist aber ein verdammt guter Name für eine Söldnertruppe! Kämpft ihr morgen in der Arena?«
»Natürlich.« Schon wieder eine Lüge. Aber Lügen waren vergleichbar mit einem Becher Kaskar-Whiskey, wie ihr Onkel Bran zu sagen pflegte: Wenn du mal einen hattest, möchtest du gleich ein ganzes Dutzend haben. »Ich bin hier, weil ich mich entscheiden will, wogegen ich kämpfe.«
»Du bist eine zupackende Frau, was? Die meisten Truppen schicken ihre Bucher vor, damit sie die Einzelheiten aushandeln.« Der Händler nickte anerkennend. »Mir gefällt dein Schneid! Du brauchst dich nicht weiter umzusehen. Ich habe eine Bestie im Bestand, von der die Menge bestimmt begeistert ist und die den Rattensalat auf die Zunge eines jeden Barden zwischen hier und dem Sommersuk zaubern wird!« Der Mann schlurfte zu einem Käfig, der mit einem Tuch abgedeckt war, und zog dieses mit großer Geste herunter. »Aufgepasst! Der furchterregende Basilisk!«
Tam hatte noch nie einen Basilisken gesehen, aber sie wusste einiges über dieses Geschöpf und konnte daher mit Sicherheit sagen, dass das Wesen in dem Käfig kein Basilisk war.
Das Wesen in diesem Käfig war ein Hühnchen.
»Ein Hühnchen?« Der Händler wirkte beleidigt, als Tam ihm das sagte. »Mädchen, bist du blind? Sieh doch nur, wie groß es ist!«
Es handelte sich zweifellos um ein großes Hühnchen. Seine Federn waren mit schwarzer Farbe besudelt, und der Schnabel wies Blutflecke auf, durch die es wohl wild aussehen sollte. Aber Tam war nicht überzeugt. »Ein Basilisk kann mit einem einzigen Blick Fleisch in Stein verwandeln«, betonte sie.
Der Kaufmann grinste wie ein Jäger, der seine Beute geradewegs in die Falle gelockt hatte. »Nur wenn er es will, Mädel! Jede Biene kann stechen, nicht wahr? Aber sie stechen nur zu, wenn sie wütend sind. Ein Stinktier stinkt immer, doch es versprüht seinen besonderen Duft bloß dann, wenn du es aufschreckst! Aber sieh dir das hier an!« Er griff in den Käfig und zog eine große Steinskulptur heraus, die entfernt an ein Eichhörnchen erinnerte. Tam beschloss, nicht auf den Preis hinzuweisen, der mit Kreide auf die Unterseite geschrieben worden war. »Er hat heute schon ein Opfer gefordert! Sieh mal her, der …«
»Bwok«, sagte das Hühnchen – es schien über die Entführung seines einzigen Freundes aufgebracht zu sein.
Peinliches Schweigen breitete sich zwischen Tam und dem Händler aus.
»Ich sollte jetzt gehen«, sagte sie.
»Möge Glifs Gnade mit dir sein«, erwiderte er knapp und warf das Tuch wieder über den Käfig des Hühnchens.
Tam drang tiefer in den Markt der Ungeheuer ein, der früher einmal Badsteinstraße geheißen hatte – das war, bevor die Arenen überall im Norden wie Pilze aus dem Boden geschossen waren und die Schuppenhändler hier ihre Geschäfte angesiedelt hatten. Es war eine breite und gerade Straße, wie fast alle Straßen in Ardburg, und sie war zu beiden Seiten von hölzernen Pferchen, Eisenkäfigen und Unterständen gesäumt, die mit Stacheldraht geschützt waren. Meistens war es hier nicht besonders voll, aber morgen fanden in der Arena Kämpfe statt, und einige der größten und berühmtesten Söldnertruppen Granduals waren bereits in die Stadt gekommen.
Tuck Hashford hatte eine weitere Regel für seine einzige Tochter aufgestellt, wenn es um den Markt der Ungeheuer oder die Arena oder die Söldner im Allgemeinen ging: »Wegbleiben, verdammt!«
Trotzdem nahm Tam häufig diesen Weg zur Arbeit – nicht weil er kürzer war, sondern weil er etwas in ihr in Gang setzte. Der Weg ängstigte sie. Und er erregte sie. Er erinnerte sie an die Geschichten, die ihre Mutter ihr früher erzählt hatte – Geschichten über wagemutige Reisen, wilde Abenteuer, erschreckende Bestien und tapfere Helden. Das waren solche wie ihr Vater und Onkel Bran.
Und da Tam vermutlich ihr gesamtes Leben damit verbringen würde, hier in dem winterlich kalten Ardburg Getränke auszuschenken und die Laute zu spielen, war ein Gang über den Markt der Ungeheuer das einzige Abenteuer, das in ihrer Reichweite lag.
»Sieh her!«, rief eine stark tätowierte Narmeeri-Frau, als Tam an ihr vorbeiging. »Willst du Oger haben? Ich hab Oger im Angebot! Frisch von den Bergen Westquells! So wild wie möglich!«
»Mantikooooooore!«, rief ein Nordmann mit geschorenem Haupt und wilden Narben, die sein Gesicht verunstalteten. »Mantikooooooooore!« Tatsächlich befand sich ein lebendiger Mantikor hinter ihm. Die fledermausartigen Schwingen waren mit Ketten zusammengebunden, der stachelbewehrte Schwanz steckte in einem Ledersack. Über das Löwenmaul war ein Korb gestülpt, doch trotz alldem wirkte das Geschöpf noch immer einigermaßen bedrohlich.
»Wargen aus dem Winterwald!«, verkündete ein anderer Händler, dessen Stimme sich über einen Chor aus dunklem Knurren erhob. »Im Wyld geboren, auf dem Hof herangezogen!«
»Kobolde!«, brüllte eine alte Dame auf einem Wagen mit einem Eisengeländer. »Kauft eure Kobolde hier bei mir! Eine Hofmark für jeden, oder zehn für ein Dutzend!«
Tam spähte in den Käfig, auf dem die alte Frau stand. Er war voller schmutziger kleiner Kreaturen, die allesamt dürr und unterernährt wirkten. Sie bezweifelte, dass ein Dutzend von ihnen einer halbwegs ordentlichen Söldnertruppe etwas einbringen konnte.
»He!«, rief die Frau zu ihr herunter. »Das hier ist kein Kleiderladen, Mädchen. Kauf einen verdammten Kobold, oder troll dich!«
Tam versuchte sich vorzustellen, was ihr Vater wohl sagen würde, wenn sie mit einem kleinen Kobold im Schlepptau nach Hause kam. Unwillkürlich musste sie grinsen. »Auf keinen Fall, verdammt«, murmelte sie.
Sie ging weiter und bahnte sich einen Weg zwischen den Buchern und den örtlichen Viehtreibern hindurch, die mit den Händlern und den wilden Jägern aus Kaskar feilschten. Sie bemühte sich, die verschiedenen Ungeheuer und die Kaufleute, die sie feilboten, nicht allzu offen anzustarren. Hier gab es schlaksige Trolle, deren abgeschnittene Gliedmaßen mit Silber überzogen waren, damit sie nicht nachwuchsen, und dort war ein massiger, muskulöser Ettin, dem einer der beiden Köpfe fehlte. Sie kam an einer schlangenhäuptigen Gorgone vorbei, deren Hals durch eine Kette mit der Wand hinter ihr verbunden war, und an einem schwarzen Pferd, das jemandem, der dumm genug war, seine Zähne untersuchen zu wollen, Feuer ins Gesicht spuckte.
»Tam!«
»Felber!« Sie stapfte zum Stand ihres Freundes hinüber. Felber war ein Inselbewohner von der Seidenküste; seine Haut war bronzefarben gebräunt, und für seine Art war er ziemlich groß. Als sie sich zum ersten Mal begegnet waren, hatte sie angemerkt, dass »Felber« – in manchen Gegenden war das die Bezeichnung für einen Weidenbaum – ein seltsamer Name für einen Kerl von seiner Größe sei. Aber er hatte erwidert, eine Weide werfe einen breiten Schatten um sich herum – was durchaus Sinn ergab.
Felbers schwarze Locken tanzten, als er den Kopf schüttelte. »Nimmst du wieder die Abkürzung über den Markt der Ungeheuer? Was wird wohl der alte Tuck dazu sagen, wenn er das erfährt?«
»Ich glaube, wir beide kennen die Antwort«, sagte sie mit einem Grinsen. »Wie läuft das Geschäft?«
»Großartig!« Er deutete auf seine Waren: eine Anzahl geflügelter Schlangen in Weidenkörben, die sich hinter ihm befanden. »Bald wird jeder Haushalt in Ardburg seinen eigenen Zanto besitzen! Sie geben ausgezeichnete Schmusetiere ab und sind kinderlieb – nur dürfen die Kinder nichts dagegen haben, dass ihnen hin und wieder ätzende Säure ins Gesicht gespuckt wird. Außerdem ertragen diese Tierchen die Kälte hier oben nicht und werden vermutlich innerhalb eines Monats sterben. Beim nächsten Mal bringe ich Hummer mit. Hummer könnte ich hier ganz leicht verkaufen.«
Tam nickte, auch wenn sie nicht wusste, was für eine Art von Ungeheuer ein Hummer war.
Felber spielte mit einer der vielen Ketten, die er um den Hals trug. »He, hast du die Neuigkeit schon gehört? Anscheinend gibt es noch eine Horde. Nördlich von Felsmoor, in der Winterwüste. Fünfzigtausend Ungeheuer sind wild entschlossen, in Grandual einzufallen. Es heißt, ihr Anführer sei ein Riese namens …«
»Brontide«, beendete Tam den Satz. »Ich weiß. Hast du etwa vergessen, dass ich in einer Taverne arbeite? Da kenne ich natürlich jedes Gerücht. Wusstest du übrigens, dass die Sultana von Narmeer in Wirklichkeit ein Junge ist, der eine Frauenmaske trägt?«
»Das kann nicht stimmen.«
»Oder dass eine Näherin, die in Rutherfurt ihren Mann getötet hat, die Winterkönigin zu sein behauptet?«
»Das bezweifle ich aber wirklich.«
»Und wie ist es mit dem, der …«
Der Lärm fröhlichen Jubels unterbrach sie. Beide drehten sich um und bemerkten einen Aufruhr an der nächsten Straßenkreuzung. Tam grinste über beide Ohren. »Anscheinend ist die gute Laune in die Stadt gekommen«, sagte Felber. Tam warf ihm einen sehnsüchtigen Blick zu, und der Inselmann seufzte theatralisch. »Geh«, sagte er zu ihr. »Grüß die Blutige Rose von mir.«
Tam schenkte ihrem Freund ein Lächeln, dann schoss sie davon. Sie umrundete einen zotteligen Yethik und schlüpfte zwischen einem brüllenden Jäger und einem keifenden Viehtreiber hindurch, kurz bevor der Jäger dem Viehtreiber einen Schlag versetzte, der diesen auf den Boden schickte. Sie erreichte die nächste Straße, als sich der erste Streitwagen näherte, und bahnte sich einen Weg nach vorn zur ersten Reihe der Zuschauer.
»He, pass doch auf, wo du hin…« Ein Junge ihres Alters mit einer Adlernase und glattem, blondem Haar wandelte seinen missbilligenden Blick rasch in etwas um, das er vermutlich für ein bezauberndes Lächeln hielt. »Ah, tut mir leid. Ein hübsches Mädchen wie du darf natürlich überall stehen.«
Bäh, dachte sie. »Danke«, sagte sie dann aber und wählte statt eines übertriebenen Augenrollens ein falsches strahlendes Lächeln.
»Bist du hergekommen, um die Söldner zu sehen?«, fragte er.
Nein, ich bin hergekommen, um den Pferdemist zu sehen, Dummkopf. »Allerdings«, antwortete sie.
»Ich auch«, sagte er und klopfte auf die Laute, die über seiner Schulter hing. »Ich bin ein Barde.«
»Oh? Bei welcher Truppe?«
»Na ja, ich hab noch keine«, gab er abwehrend zurück. »Aber das ist nur eine Frage der Zeit.«
Sie nickte abgelenkt, denn der Zug kam näher heran. Der massive Kriegswagen war größer als das ganze Haus, das Tam mit ihrem Vater teilte. Er war mit Leder bedeckt und wurde von zwei wolligen weißen Mammuts gezogen, an deren Stoßzähnen Wimpel befestigt waren. Die Söldner, denen der Wagen gehörte, umstanden einen kräftigen Belagerungsturm, der sich auf dem Wagen erhob, und winkten mit ihren Waffen der Menge auf beiden Seiten der Straße zu.
»Riesentod«, sagte der Junge neben ihr, als ob die Lieblingssöhne des Nordens noch einer Vorstellung bedurften. Die Söldner – allesamt große, bärtige Kaskaren – waren Stammgäste in der Taverne, in der Tam arbeitete, und ihr Anführer winkte ihr zu, als der Zug an ihr vorbeikam. Der selbsternannte Barde sah sie verblüfft an. »Du kennst Alkain Tor?«
Tam bemühte sich, seinen Tonfall zu überhören, und zuckte mit den Schultern. »Klar.«
Der Junge runzelte die Stirn, sagte aber kein Wort mehr.
Als Nächstes kamen etwa hundert Söldner zu Pferd und zu Fuß, und Tam sah einige Truppen, die zu den Stammgästen im Eckstein zählten: Die Schmiede, den Schwarzen Pudding, die Furunkel und die Nachtmähre, bei der allerdings zwei Mitglieder fehlten, deren Platz ein Arachnier eingenommen hatte.
»Gesindel«, höhnte der Junge. Dann war er aber still und schien darauf zu warten, dass Tam ihn nach dem Grund für seine Meinung fragte. Als sie dies nicht tat, fuhr er trotzdem fort: »Die meisten dieser weniger bekannten Söldnertruppen werden heute Abend in Gildenhäusern und privaten Arenen gegen Ungeheuerabschaum kämpfen. Aber die größeren Truppen, zum Beispiel Riesentod oder die Fabel, die werden morgen vor Tausenden in der Schlucht antreten.«
»In der Schlucht?«, fragte Tam. Sie wusste genau, was die Schlucht war, aber wenn dieser Angeber unbedingt reden musste, dann wollte sie wenigstens das Thema bestimmen.
»Das ist die Arena von Ardburg«, tönte der Junge, während die Karawane der Söldner vorbeizog, »aber sie ist nicht besonders beeindruckend. Keine richtige Arena, so wie die im Süden. Weißt du, ich bin im letzten Sommer in Fünfhof gewesen. Die neue Arena dort ist die größte auf der ganzen Welt. Sie nennen sie …«
»Seht nur!«, rief jemand und ersparte Tam die Mühe, ihrem neuen Freund die Faust in die Kehle zu rammen, damit er endlich verstummte. »Da sind sie! Die Söldner der Fabel!«
Als Nächstes kam ein Kriegswagen, der von acht großen Pferden in gewaltigen Bronzeharnischen gezogen wurde. Er glich einer wahren Festung, die auf sechzehn Steinrädern ruhte; vor den Fenstern lagen Eisenplatten, und an den Seiten hingen Vorhänge aus stachelbesetzten Ketten herab. Das Dach war von Zinnen aus angerostetem Eisen umgeben, und an allen vier Ecken erhoben sich Türme mit Armbruststellungen.
Aus den Augenwinkeln sah Tam, wie sich der Junge aufrichtete und in die Brust warf, als wäre er ein Ochsenfrosch, der zum Brunstruf ansetzt.
»Das ist die Rebellenschanze«, sagte Tam, bevor der Idiot ihr etwas sagen konnte, was sie bereits wusste. »Sie gehört Fabel, die erst seit viereinhalb Jahren besteht, inzwischen aber wohl die berühmteste Söldnertruppe auf der ganzen Welt ist. Weißt du«, fuhr sie fort, während jedes ihrer Worte vor Herablassung troff, »die meisten Söldner kämpfen nur in den Arenen. Sie reisen von Stadt zu Stadt und nehmen alles, was die örtlichen Viehtreiber ihnen bieten können. Das ist ausgezeichnet, denn so erhalten alle eine Bezahlung: die Viehtreiber, die Bucher, die Verwalter der Arenen – und manchmal sogar die Söldner selbst.«
Der Junge staunte. »Ich w…«
»Aber Fabel«, schnitt ihm Tam das Wort ab, »also, die machen es auf die althergebrachte Weise. Sie gehen offenbar auch auf Tournee, aber sie nehmen außerdem Aufträge an, an die sich die anderen Truppen niemals heranwagen würden. Sie haben Riesen gejagt und Piratenflotten niedergebrannt. Sie haben Sandschlunde in Dumidia getötet und einmal sogar einen Firbolg-König hier in Kaskar abgeschlachtet.«
Sie deutete auf einen Nordmann, der einen Brustkorb hatte, so gewaltig wie ein Fass, und zwischen zwei Zinnen hockte. Sein verfilztes braunes Haar bedeckte den größten Teil seines Gesichts. »Das ist Brune. Er ist so etwas wie eine örtliche Legende. Ein Vargyr.«
»Ein Vargyr …?«
»Wir nennen sie Schamanen«, erklärte Tam. »Er kann sich nach Belieben in einen großen Bären verwandeln. Siehst du da drüben die Frau in Schwarz, deren eine Kopfhälfte kahl geschoren ist und die überall Tätowierungen hat? Sie ist eine Zauberin – eigentlich eine Beschwörerin. Ihr Name lautet Cura, aber alle nennen sie nur die Tintenhexe. Und siehst du den Druin Freiwolk? Das ist der große Mann dort mit dem grünen Haar und den Ohren, die wie die eines Hasen aussehen. Es heißt, er sei der Letzte seiner Art und habe noch nie eine Wette abgeschlossen, die er nicht gewonnen hat. Sein Schwert Madrigal kann durch Stahl schneiden, als wäre es Seide.«
Das Gesicht des Jungen hatte eine ausgesprochen befriedigende scharlachrote Färbung angenommen. »Also gut, hör mir zu«, sagte er, aber Tam hatte nicht die geringste Lust dazu.
»Und das da …« – sie deutete auf die Frau, die mit einem Fuß auf der Zinne über ihnen stand – »… ist die Blutige Rose. Sie ist die Anführerin der Fabel, die Retterin der Stadt Castia und vermutlich die gefährlichste Frau diesseits des Herzwyld.«
Als der Schatten des Wagens auf sie fiel, verstummte Tam. Sie hatte die Blutige Rose noch nie gesehen, aber sie kannte jede Geschichte über diese Frau, hatte jedes Lied über sie gehört und das Bild der Kriegerin auf etlichen Plakaten in der Stadt erblickt, auch wenn Kreide und Kohlestift der wahren Gestalt kaum gerecht wurden.
Die Frontfrau der Fabel trug eine Rüstung aus matten schwarzen Blechstücken, die mit Rot durchsetzt waren; nur ihre Handschuhe schimmerten wie neuer Stahl. Sie waren von den Druin geschmiedet worden (zumindest wurde das in den Liedern behauptet) und passten zu den Krummschwertern – Distel und Dorn –, die sie an jeder Hüfte in Futteralen trug. Ihre Haare waren blutrot gefärbt und auf der Höhe ihres kantigen Kinns abgeschnitten.
Die Hälfte der Mädchen in der Stadt trug den gleichen Haarschnitt und die gleiche Farbe. Sogar Tam hatte sich einmal einen Sack mit Färberbohnen gekauft, die eine dunkelrote Farbe abgaben, wenn sie in Wasser getaucht wurden. Aber ihr Vater hatte erraten, was sie vorhatte, und von ihr verlangt, in seiner Gegenwart eine Bohne nach der anderen zu essen. Sie hatten wie Limonen mit einer Zimtrinde geschmeckt, und danach waren ihre Zunge, ihre Lippen und Zähne so rot gewesen, als ob sie einem Reh die Kehle herausgebissen hätte. Doch ihre Haare waren genauso langweilig braun geblieben wie zuvor.
Die Söldner waren vorübergezogen, und Tam blinzelte wie eine Träumerin, die von den schräg stehenden Strahlen der Nachmittagssonne geweckt wurde.
Der Junge neben ihr hatte endlich seine Stimme wiedergefunden, aber er räusperte sich, bevor er etwas zu sagen wagte. »Hui, du weißt wirklich eine ganze Menge, was? Willst du, äh, mit mir was im Eckstein trinken?«
»Im Eckstein …«
»Ja, es ist gleich …«
Tam war schon verschwunden; sie lief so schnell, wie ihre Beine sie trugen. Sie kam nicht nur hoffnungslos zu spät zur Arbeit, sondern ihr Vater hatte auch noch eine weitere Regel, wenn es darum ging, dass seine Tochter von einem fremden Jungen zum Trinken eingeladen wurde.
Das war ihr aber sehr recht, denn sie mochte Mädchen sowieso lieber.
2
DAS ECKSTEIN
Es gab vier Personen, die zu jeder Zeit im Eckstein anzutreffen waren.
Die erste war Tera, der die Taverne gehörte. Sie war selbst eine Söldnerin gewesen, bevor sie ihren einen Arm verloren hatte. »Verdammt, ich habe ihn nicht verloren!«, sagte sie jedes Mal, wenn sie gefragt wurde, wie das passiert war. »Ein Grottenschrat hat ihn mir abgerissen und an einem Spieß gebraten, während ich zugesehen habe! Ich weiß auch genau, wo der Arm jetzt ist: im Innern seines verdammten Kadavers!« Sie war eine große, breite Frau, die ihre verbliebene Hand dazu einsetzte, die Taverne mit eiserner Faust zu regieren. Wenn sie nicht gerade das Küchenpersonal beschimpfte oder die Bedienung heruntermachte, verbrachte sie ihre Abende damit, Kämpfe zu unterbinden – oft indem sie drohte, sich daran zu beteiligen – oder mit den älteren Söldnern Geschichten auszutauschen.
Ihr Gemahl Edwick war ebenfalls ständig anwesend. Er war der Barde einer Truppe gewesen, die sich die Vorhut nannte, aber inzwischen hatte er sich zur Ruhe gesetzt. Jeden Abend stieg er auf die Bühne und erzählte von den Heldentaten seiner früheren Truppe, und er schien jedes Lied und jede Geschichte über sie zu kennen. Ed war das Gegenteil seiner Frau: von eher schmächtigem Wuchs und so fröhlich wie ein Kind auf einem Ponyrücken. Er war mit Tams Mutter eng befreundet gewesen, und trotz Tuck Hashfords Regel, nach der seine Tochter weder ein Instrument spielen noch mit Musikern Umgang pflegen sollte, gab der alte Barde Tam nach der Arbeit oft Unterricht im Lautenspiel.
Der Nächste war Tiamax, der ebenfalls ein Mitglied der Vorhut gewesen war. Er war ein Arachnier, und das bedeutete, dass er acht Augen – von denen aber zwei fehlten, deren Höhlen mit Augenklappen bedeckt waren – und sechs Hände hatte, mit denen er wunderbar Getränke mischen und einschenken konnte. Daher gab er einen ausgezeichneten Barmixer ab. Edwick zufolge musste er früher auch ein prächtiger Kämpfer gewesen sein.
Und schließlich gehörte zum Inventar des Eckstein noch ihr Onkel Bran. In seiner Jugend war Branigan ein berühmter Söldner gewesen, ein sagenhafter Trinker und ein berüchtigter Schurke. Doch jetzt, fast zehn Jahre nach dem allzu frühen Tod seiner Schwester und der darauffolgenden Auflösung seiner alten Truppe war er … nun, er war noch immer ein Dieb, noch immer ein Trunkenbold und ein noch üblerer Schurke, und inzwischen hatte er das Spielen zu der Liste seiner Laster hinzugefügt.
Er und Tams Vater hatten im vergangenen Jahrzehnt nur wenig miteinander gesprochen. Der eine hatte in Lily Hashford eine Schwester verloren, der andere seine Frau, und die Trauer hatte sie auf sehr unterschiedliche Wege geführt.
»Tam!«, rief ihr Onkel, und zwar herab von der Galerie im ersten Stock unmittelbar über der Theke. »Sei ein liebes Mädchen und bring mir ein kleines Schlückchen, ja?«
Tam stellte die leeren Gefäße, die sie von den Tischen eingesammelt hatte, auf den fleckigen hölzernen Tresen. Heute Abend war in der Taverne mehr los als gewöhnlich. Söldner und solche, die sich in ihrem Glanz sonnen wollten, drängten sich auf den Bänken hinter ihr. In drei Kaminen loderten Feuer, zwei Kämpfe wurden gerade ausgetragen, und ein hemdloser Barde schlug so wild auf eine Trommel ein, als ob sie ihm Geld schuldete.
»Onkel Bran braucht noch einen Whiskey«, sagte sie zu Tiamax.
»Ach, wirklich?« Der Arachnier nahm die Becher und spülte sie mit vier Händen aus, während er mit den beiden verbliebenen einen hölzernen Krug öffnete und etwas Duftendes, Rosenfarbenes in ein langstieliges Glas goss.
»Was ist das?«, fragte die Frau, für die er das Getränk eingeschenkt hatte.
»Rosé.«
»Rosé?« Sie roch daran. »Scheint mir eher Katzenpisse zu sein.«
»Dann bestell doch beim nächsten Mal ein verdammtes Bier«, sagte Tiamax. Die Beißwerkzeuge, die aus seinem weißen Stoppelkinn sprossen, zuckten vor Verärgerung. Eines von ihnen war in der Mitte abgebrochen, sodass das Geräusch, das sie verursachten, nur ein dumpfes Klicken statt des melodischen Kratzens war, das andere Wesen seiner Art hervorbrachten. Die Frau schnüffelte noch einmal und schlenderte davon, während der Arachnier mit einem Handtuch drei Becher gleichzeitig abtrocknete. »Ich frage mich, womit dein Onkel Bran für diesen Whiskey bezahlen will.«
»Sag ihm, er soll es auf meinen Deckel schreiben!«, ertönte Brans Stimme von der Galerie über ihnen.
Sie schenkte Tiamax ein knappes Lächeln. »Er sagt, du sollst es auf seinen Deckel schreiben.«
»Ah, ja! Der unerschöpfliche Deckel des Branigan Fay!« Verzweifelt warf Tiamax alle sechs Arme gleichzeitig in die Höhe. »Ich befürchte aber, dass er seinen Kredit bereits bis zum Letzten ausgeschöpft hat.«
»Wer sagt das?«, wollte die körperlose Stimme ihres Onkels wissen.
»Tera sagt das.«
»Sag diesem Bastard-Brüter, dass ich das mit Tera regeln werde!«, rief Bran. »Außerdem hab ich hier oben gerade eine prächtige Glückssträhne!«
Tam seufzte. »Onkel Bran sagt …«
»Bastard-Brüter?« Die Beißwerkzeuge des Barmixers klickten erneut, und Tam bemerkte ein bösartiges Glitzern in seinen Facettenaugen. »Noch ein Whiskey!«, rief er. »Er kommt sofort hoch!« Er wählte einen Becher aus dem Regal hinter ihm und griff mit einem seiner segmentierten Arme nach einer Flasche auf dem obersten Bord. Sie war mit Ruß und dichten Spinnweben überzogen. Als Tiamax den Korken herauszog, löste er sich in seiner Hand auf.
»Was ist das denn?«, fragte Tam.
»Oh, das ist Whiskey. Oder so was Ähnliches wie Whiskey. Wir haben sechs Kisten davon im Keller der Steinwälzer-Festung gefunden, als die Wilden Männer uns dort festgesetzt hatten.«
Wie jeder ehemalige Söldner, den Tam kannte – natürlich außer ihrem Vater –, ließ sich Tiamax selten die Gelegenheit entgehen, eine Geschichte aus seiner abenteuerlichen Zeit zu erzählen.
»Wir haben versucht, es zu trinken«, sagte der Arachnier, »aber nicht einmal Matty konnte es in sich behalten, und so haben wir es zu Bomben verarbeitet.« Die Flüssigkeit tröpfelte wie Honig aus der Flaschenöffnung, aber sie sah aus und roch wie ungeklärtes Abwasser. »Hier. Sag deinem Onkel, der Becher geht aufs Haus – ein Geschenk von diesem Bastard-Brüter.«
Tam beäugte den Becher misstrauisch. »Kannst du mir versprechen, dass er davon nicht sterben wird?«
»Er wird mit ziemlicher Sicherheit nicht sterben.« Der Barmixer legte sich eine dürre Hand auf die Brust. »Ich schwöre es bei meinem Cephalothorax.«
»Bei deinem Zeffallo…«
Tera stürmte durch die Küchentür und schwang einen soßenfleckigen Holzlöffel, als wäre er eine blutige Keule.
»Ihr da!« Sie streckte ihre behelfsmäßige Waffe zwei stämmigen Söldnern entgegen, die auf der Binsenmatte vor einem der Kamine miteinander rangen. »Könnt ihr dieses verdammte Schild nicht lesen?« Da ihr der zweite Arm fehlte, mit dem sie darauf hätte zeigen können, nahm Tera ihren Löffel, um damit die Aufmerksamkeit der beiden Männer auf das gravierte Holzschild über der Theke zu lenken, und ließ sich sogar dazu herab, ihnen vorzulesen, was darauf stand. »Keine Kämpfe vor Mitternacht! Das hier ist ein ehrenwertes Haus und keine götterverdammte Ringergrube!«
Sie schritt auf die Kämpfer zu, und die Gäste wichen vor ihr zurück wie vor einem Felsbrocken, der ins Tal donnert.
»Danke, Max.« Tam nahm den Becher entgegen und lief hinter der Besitzerin der Taverne her. Sie nutzte die Schneise, die Tera geschlagen hatte, und durchquerte den halben Schankraum, bevor sie sich in die Menge stürzen musste. In der Zwischenzeit hatte Tera den einen Kämpfer zu einem Ball zusammengetreten und drosch mit dem Löffel auf den Hintern des anderen ein.
Tam rutschte aus, fing sich wieder und bewegte sich seitwärts zur Treppe, die auf die Galerie führte. Dabei schnappte sie die Gespräche im Raum auf wie ein Straßenkind, das auf dem Marktplatz die Kunden bestiehlt. Ein Trio von Händlern unterhielt sich über den frühen Frost, der den größten Teil von Kaskars Ernte vernichtet hatte. Sie waren reich geworden, indem sie Vorräte aus Fünfhof importiert hatten. Einer von ihnen scherzte, dafür sollten sie der Winterkönigin einen Tribut entrichten, was dem Nordmann zu seiner Rechten ein herzliches Lachen entlockte, während der Narmeeri links von ihm aufkeuchte und den Kreis des Sommerherrn auf seine Brust zeichnete.
Viele unterhielten sich darüber, wer morgen in der Schlucht kämpfen würde und, was vielleicht noch wichtiger war, wogegen sie kämpfen würden. Sie hörte, dass die Fabel vorgeschlagen hatte, die örtlichen Viehtreiber sollten es entscheiden, und es lief das Gerücht um, dass sie etwas ganz Besonderes auf Lager hatten.
Viele Gespräche drehten sich um die Horden der Ungeheuer, die sich nördlich von Felsmoor versammelt hatten. Man nannte sie die Winterhorde, und jeder – vom Kämpfer bis zum Bauern – hatte eine andere Vorstellung von ihren Absichten.
»Rache!«, sagte ein Söldner mit etwas Schwarzem, Gummiartigem im Mund, auf dem er herumkaute. »Ganz offensichtlich! Sie sind noch immer wütend, weil sie vor sechs Jahren in Castia einen Tritt in den Hintern bekommen haben! Sie werden es im nächsten Sommer wieder versuchen, lasst es euch gesagt sein!«
»Sie werden Castia nicht angreifen«, sagte eine Frau mit einer weißen Spinnentätowierung, die den größten Teil ihres Gesichts bedeckte. »Es ist viel zu weit entfernt und zu gut befestigt. Wenn ihr mich fragt: Es ist Ardburg, das sich Sorgen machen muss. Die Lords der Marken sollten ihre Männer bereit und ihre Äxte noch bereiter halten!«
»Dieser Brontide-Knabe …«, sagte Lufane nachdenklich. Er war der Kapitän eines Luftschiffs, der davon lebte, dass er Adlige über die Reifschild-Berge flog. »Es heißt, er hegt einen mächtigen Groll gegen uns.«
»Gegen uns?«, fragte Spinnengesicht.
»Gegen jeden. Insbesondere gegen Menschen.« Der Kapitän trank den Rest seines Weins und streckte den Becher Tan entgegen, als sie gerade vorbeikam. »Brontide zufolge sind wir die Ungeheuer. Vor ein paar Jahren hat er einen Trupp über die Berge angeführt und jede Arena, die er finden konnte, in Schutt und Asche gelegt.«
Der erste Söldner grinste und zeigte dabei seine schwarzen Zähne. »Ein Riese, der uns als Ungeheuer bezeichnet? Aber es ist wohl nicht wichtig, was er denkt, oder? Übermorgen wird jede Truppe im Norden nach Felsmoor unterwegs sein, auf der Suche nach Ruhm und einer Gelegenheit, sich einen Namen zu machen. Die Winterhorde wird nur noch ein Haufen Knochen im Dreck sein, wenn der Frühling kommt«, sagte er gerade, als Tam weiterging, »aber die Barden werden für den Rest ihres Lebens davon krächzen.«
Sie umrundete die Bühne. Der Trommler war zum Ende gekommen, und nun saß Edwick dort auf einem Schemel und hatte sich seine Laute auf den Schoß gelegt. Er zwinkerte ihr kurz zu, bevor er mit Hohlbergs Belagerung begann, was den Jubel der Zecher hervorrief. Sie liebten Schlachtenlieder und ganz besonders solche, in denen die Helden ihren Feinden zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen waren.
Tam hörte die Stimme des alten Mannes sehr gern. Sie klang verwittert und zwitschernd und wirkte dabei so angenehm wie ein Paar weicher Lederstiefel. Edwick hatte Tam nicht nur das Lautespielen beigebracht, sondern ihr auch Gesangsstunden gegeben, und seine Meinung von ihren stimmlichen Fähigkeiten hatte von »Vorsicht, du zerbrichst alle Gläser« bis zu »wenigstens werden sie dich nicht von der Bühne schleifen« gereicht, und es hatte sehr lange gedauert, bis er endlich gesagt hatte: »Nicht schlecht. Gar nicht schlecht.«
Das war ein guter Abend gewesen. Tam war nach Hause zurückgekehrt und hatte sich gewünscht, ihre Freude mit ihrem Vater zu teilen, aber Tuck Hashford war nicht besonders begeistert gewesen. Er wollte nicht, dass seine Tochter sang oder die Laute spielte oder den übertreibenden Geschichten von Barden im Ruhestand lauschte. Wenn da nicht der Lohn gewesen wäre, den sie nach Hause brachte, und die Tatsache, dass Tuck – seit seine Frau gestorben war – Schwierigkeiten hatte, eine Arbeit zu behalten, hätte er Tam vermutlich nicht einmal in die Nähe des Eckstein gelassen.
Bran warf ihr einen Blick zu, als sie sich ihm näherte. »Tam!« Er schlug mit der Handfläche auf den Tisch, zerstreute dabei die Münzen und kippte die hölzernen Figuren auf dem Tetrea-Brett vor ihm um. Sein Gegner, ein Mann mit einer aufgesetzten Kapuze, der Tam den Rücken zugedreht hatte, seufzte, und ihr Onkel unternahm den schwachen Versuch, seine Unschuld zu beteuern. »O je, ich habe die Steine durcheinandergebracht, das wollt ich nicht. Sagen wir, es steht unentschieden, ja, Wolk?«
»Ist es unentschieden, wenn der eine gerade gewinnt und der andere betrügt, weil er nicht verlieren will?«
Bran zuckte mit den Schultern. »Jeder von uns beiden hätte gewinnen können.«
»Ich stand ganz offensichtlich unmittelbar vor dem Sieg«, sagte sein Gegner. »Brune? Kannst du mir das bestätigen?«
Brune?
Tam hielt inne und riss den Mund auf wie ein kleiner Vogel unter einem baumelnden Wurm. Natürlich, der Mann, der links von ihrem Onkel saß, war Brune. Wie in Brune, der verdammte Schamane der Fabel. Ob er nun eine Legende war oder nicht, der Vargyr sah genauso aus wie die meisten anderen Nordmänner. Er war groß und breitschultrig und hatte zotteliges, braunes Haar, unter dem die Tatsache fast verschwand, dass Brune eigentlich keinen besonders beeindruckenden Anblick bot. Die Brauen waren buschig und wild, die Nase war stark gebogen, und zwischen seinen beiden Vorderzähnen klaffte ein fingerbreiter Spalt.
»Ich hab nicht aufgepasst«, gab der Schamane zu. »Tut mir leid.«
Tams Gedanken taumelten noch umher, und sie versuchte das zu begreifen, was ihre Augen ihr gerade mitteilten. Wenn das Brune ist, dachte sie, dann könnte dieser Mann in dem Mantel … derjenige, den Bran Wolk genannt hat …
Die Gestalt drehte sich um, schob die Kapuze zurück und enthüllte lange Ohren, die dicht an dem grünlich-goldenen Haar anlagen. Tam nahm jedoch diese Ohren und das raubtierartige Grinsen des Druins kaum wahr. Sie war ganz von seinem Blick hingerissen. Halbmonde vor einem Farbenspiel, wie die Facetten eines Smaragds, durch den Kerzenschein fällt.
»Hallo, Tam.«
Er kennt meinen Namen! Woher kennt er meinen Namen? Hatte ihr Onkel ihn vorhin genannt? Vermutlich. Bestimmt. Ja. Tam zitterte; der Steinwälzer-Whiskey warf winzige Wellen in ihrer bebenden Hand.
»Branigan hat uns alles über dich erzählt«, sagte der Druin. »Er meint, du kannst gut singen und bist geradezu ein Wunderkind, was das Lautespielen angeht.«
»Er trinkt«, sagte Tam.
Der Schamane lachte und spuckte dabei einen Mundvoll Bier über den Tisch und das Tetrea-Brett. »Er trinkt.« Brune kicherte. »Das ist ein Klassiker.«
Freiwolk holte eine weiße Mondsteinmünze hervor und betrachtete die eine Seite eingehend. »Brune und ich, wir sind Söldner. Wir gehören zu einer Truppe, die sich Fabel nennt. Ich nehme an, du hast schon von uns gehört?«
»Ich … äh …«
»Das hat sie«, kam Bran ihr zu Hilfe. »Natürlich hat sie das. Stimmt doch, oder, Tam?«
»Richtig«, brachte Tam heraus. Sie fühlte sich, als würde sie über einen zugefrorenen See wandeln und plötzlich spüren, dass das Eis unter ihr ächzte und brach.
»Nun«, sagte Freiwolk, »zufällig brauchen wir gerade einen Barden oder eine Bardin. Wenn wir Bran glauben können, bist du genau das, was wir suchen. Vorausgesetzt natürlich, dass du bereit bist, dir die Stiefel ein wenig schmutzig zu machen.«
»Die Stiefel schmutzig machen?«, fragte Tam und betrachtete mit dem inneren Auge die Risse in dem Eis, auf dem sie stand. Onkel Bran, was hast du getan?
»Er meint damit, dass du bereit zum Reisen sein musst.« Seine Stimme klang belegt, und in seinen Augen zeigte sich ein Glanz, der nichts mit dem Alkohol zu tun hatte. Zumindest glaubte sie es. »Ein richtiges Abenteuer, Tam.«
»Ah.« Freiwolks Stuhlbeine scharrten über den Boden. Die Münze in seiner Hand verschwand, während er auf etwas hinter ihr zeigte. »Da ist unsere Anführerin höchstpersönlich. Tam«, sagte er, als sie sich umdrehte und feststellen musste, dass eine lebende Legende nur eine Armeslänge von ihr entfernt stand, »das ist Rose.«
Für Tams Knie reichte es nun.
Als sie unter ihr nachgaben, sprang Bran von seinem Stuhl auf. Er konnte ihr gerade noch den Becher aus der Hand nehmen, bevor sie zusammenbrach. »Das war knapp«, hörte sie ihn sagen, während die Bodendielen auf sie zuschossen.
»Sie ist zu jung«, sagte jemand. Es war die Stimme einer Frau. Harsch. »Wie alt ist sie? Sechzehn?«
»Siebzehn.« Das war ihr Onkel. »Glaube ich. Zumindest wird sie bald siebzehn.«
»Nicht gerade widerstandsfähig«, brummte die Frau. Rose. Sie musste es sein.
Tam blinzelte, das grelle Fackellicht fiel ihr in die Augen, und da beschloss sie, noch ein wenig liegen zu bleiben.
»Und wie alt warst du, als du zum ersten Mal ein Schwert in die Hand genommen hast?«, fragte Freiwolk. Sie konnte das ironische Grinsen des Druins vor sich sehen. »Und als du diesen Zyklopen getötet hast?«
Ein Seufzen. »Ja, aber das hier?« Eine Rüstung klirrte. »Sie ist bei meinem Anblick ohnmächtig geworden. Was wird sie wohl tun, wenn es zu Blutvergießen kommt?«
»Sie wird es schaffen«, sagte ihr Onkel. »Schließlich ist sie Tucks und Lilys Tochter.«
»Tuck Hashford?« Brune klang beeindruckt. »Es heißt, er sei völlig angstfrei gewesen. Und in uns allen steckt ein Teil unserer Väter. Bei mir ist das jedenfalls so – die Götter wissen das.«
»Und ein Teil unserer Mütter«, sagte eine Frau, die Tam nicht kannte. »Will sie denn überhaupt mitgehen? Habt ihr sie gefragt?«
Ich will, sagte eine Stimme in Tams Kopf.
»Ich will«, krächzte sie. Sie setzte sich auf – und bedauerte es sofort. Der Lärm im Schankraum des Eckstein kreischte in ihrem Schädel wie ein Boot voller Katzen. Die vier Mitglieder der Fabel standen um sie herum. Bran kniete neben ihr. »Ich will mitgehen«, beharrte sie. »Wo … äh … wohin gehen wir eigentlich?«
»Irgendwohin, wo es kalt ist«, sagte sie Frau, die nicht Rose war. Sie war Cura, die Tintenhexe, und sie sah Tam an, als wäre diese nur Dreck an ihren Stiefeln.
Während Rose schlank war, aber kräftige Muskeln hatte, war Cura spindeldürr und drahtig. Sie trug ein langes, tief herabhängendes Hemd, das an den Hüften hoch eingeschnitten war, und dazu schwarze Lederstiefel mit mehr Riemen als an der Zwangsjacke eines Verrückten. Ihr feines, schwarzes Haar war so lang, dass sie es zusammenbinden konnte, aber an den Seiten hatte sie es zu Stoppeln geschoren. Knochenringe steckten in ihren Ohren, ein weiterer durchstach die linke Braue, und in der Nase trug sie einen Knopf. Ihre Haut war blass wie Porzellan und mit Tätowierungen übersät. Tams Blicke wurden besonders von einem Meeresungeheuer angezogen, das auf Curas Schenkel prangte und dessen schlangenartige Tentakel sich unter dem Hemdsaum hervorwanden.
Die Tintenhexe bemerkte ihr Starren und zupfte einladend an ihrem Hemd. »Hast du so etwas jemals aus der Nähe betrachtet?« Ihr schelmischer Tonfall deutete an, dass sie nicht die Kreatur auf ihrem Bein meinte.
Tam sah weg und hoffte, man werde das plötzliche Erröten ihrem Ohnmachtsanfall zuschreiben. »Zieht ihr in den Kampf gegen die Winterhorde?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete Rose. »Wir beenden zuerst unsere Tournee, und danach haben wir einen Auftrag in Düstermarsch zu erledigen.«
»Unseren letzten Auftrag«, sagte Freiwolk und tauschte einen bedeutungsschweren Blick mit seinen Gefährtinnen und Gefährten aus. »Ein letzter Auftritt, bevor wir Schluss machen.«
Bei diesen Worten horchte Branigan auf, doch bevor er oder Tam eine Frage stellen konnten, warf Rose ein: »Ich sollte dich warnen. Das, wogegen wir kämpfen werden, könnte genauso gefährlich sein wie die Horde. Vielleicht sogar noch gefährlicher.«
Für Tam gab es nichts Schlimmeres als die Aussicht, niemals ihr Zuhause zu verlassen und in Ardburg festzusitzen, bis ihre Träume erfroren und ihr wyldes Herz in seinem Käfig verdorrte. Sie warf ihrem Onkel einen kurzen Blick zu. Er nickte aufmunternd. Sie wollte Freiwolk sagen, dass es ihr gleichgültig war, ob sie gegen die Horde oder etwas noch Schrecklicheres kämpfen würden, oder ob sie sich geradewegs in die Hölle der Frostmutter stürzten. Sie würde auf jeden Fall mitgehen.
»Ein Lied«, sagte Rose.
Branigan hob den Blick. »Wie bitte?«
»Sie soll auf die Bühne gehen.« Rose steckte sich eine kurze Pfeife zwischen die Lippen und suchte unter ihrer Rüstung nach etwas, womit sie den Tabak anzünden konnte. Schließlich gab sie auf und nahm dazu die Kerze vom Tisch neben sich. »Such dir ein Lied aus und spiele es. Überzeuge mich davon, dass du das richtige Mädchen für diese Aufgabe bist. Wenn mir gefällt, was ich höre, wirst du die neue Bardin der Fabel sein. Wenn nicht …« Sie atmete langsam aus. »Wie heißt du noch mal?«
»Tam.«
»Nun, in diesem Fall wird es mich freuen, dich kennengelernt zu haben, Tam.«
3
EIN LIED
Gegen Mitternacht klapperte ein Zug aus miteinander verbundenen Wagen durch Ardburg, die von kräftigen Kaskar-Ponys gezogen wurden. Es kostete nichts, in einem der Wagen mitzufahren, die den Betrunkenen und Nachtschwärmern einen langen Fußmarsch bei meist unfreundlichem Wetter ersparten. Tam stieg vor dem Eckstein zu und wählte einen Wagen, von dem sie geglaubt hatte, er sei leer. Aber das war er nicht. Auf der Sitzbank ihr gegenüber lag ein schlafender Stadtwächter. Sein Helm lag umgekippt in seinem Schoß, und aus dem Gestank schloss Tam, dass er voller Erbrochenem war. Trotz der Kälte öffnete sie die Fensterläden, und sobald sich die Wagen wieder in Bewegung setzten, roch es nicht mehr ganz so streng.
Für gewöhnlich schlief die Stadt zu dieser nächtlichen Stunde, aber da am kommenden Tag die Kämpfe stattfinden sollten, war auf den Straßen noch einiges los. Licht und Lärm flossen aus jeder Herberge, und Musik erklang aus jeder Taverne. Besonders in den Bordellen ging es geschäftiger zu als üblich, und durch die vorgezogenen Gardinen drangen Schreie der Lust oder des Schmerzes; manchmal mischten sie sich.
Sie sah zwei Priestergestalten in schwarzen Roben, die den niederrieselnden Schnee mit hohlen Händen auffingen. »Die Winterkönigin kommt!«, rief die eine Gestalt, eine Frau mit kahl geschorenem Kopf. Das war eigentlich nichts Neues. Ihren Schülern zufolge erschien die Winterkönigin – und die Ewige Königin, die angeblich ihre Rückkehr begleitete – andauernd. Tam vermutete, dass die Priester und Priesterinnen genauso überrascht sein würden wie alle anderen, falls sie tatsächlich einmal beschließen sollte zu erscheinen.
Schließlich ließen sie das Chaos hinter sich. Tam saß allein mit ihren Gedanken und mit dem schnarchenden Soldaten da, dem sie die Frage stellte, die sie seit ihrem Aufbruch vom Eckstein beschäftigte.
»Was zur Hölle ist gerade passiert?«
Tam näherte sich der Bühne. Sie hatte nicht einmal ein Instrument. Was war das für eine Bardin, die nicht einmal ein eignes Instrument besaß?
Du bist keine Bardin, rief sie sich in Erinnerung. Du bist ein Mädchen, das sich jetzt gleich vor zweihundert Leuten zum Narren machen will – und auch vor der Blutigen Rose.
Ein rascher Blick hoch zur Galerie sagte ihr, dass Rose zusah. Sie zog noch immer an der Pfeife, die sie vorhin entzündet hatte. Freiwolk war neben ihr, und Brune und Cura standen weiter hinten am Geländer. Die Nachricht, dass die Fabel eine neue Bardin vorspielen ließ, hatte sich wie ein Lauffeuer im Schankraum verbreitet. Nun, da der Aufruhr allmählich verebbte, sollte Tam auf die Bühne steigen und ein Lied singen, das ihr Leben möglicherweise für immer veränderte – oder auch nicht.
Tera und Tiamax sahen hinter der Theke zu. Der Arachnier winkte ihr mit drei Händen zu und rief durch den Lärm: »Das schaffst du!«
Bran scheuchte Zecher von dem Tisch fort, der der Bühne am nächsten stand, während Edwick …
»Hier.« Der alte Barde drückte ihr seine Laute in die Hände. »Sie gehört jetzt dir.«
»Nein, das kann ich nicht annehmen«, wandte sie ein. Die Laute, die der Barde als Rote Dreizehn bezeichnete, war das Instrument, auf dem Tam zu spielen gelernt hatte. Es war Eds ganzer Stolz. Er besaß diese Laute schon so lange, wie Tam zurückdenken konnte, und sie wusste von keinem anderen Instrument, auf dem er je gespielt hätte.
»Nimm sie«, beharrte er. »Vertrau ihr. Weißt du, welches Lied du spielen wirst?«
Tam kannte hundert Lieder, aber in diesem Augenblick konnte sie sich an kein einziges davon erinnern. Sie schüttelte den Kopf.
»Also dann, viel Glück.« Edwick nahm auf einem Stuhl neben Bran Platz, und plötzlich wurde es sehr still in der Taverne.
Tam umarmte ihre geborgte Laute, betrat die Bühne und ging zu dem leeren Schemel. Die Dielen knarrten erstaunlich laut unter ihren Füßen. Ihre Gedanken rasten umher, und sie versuchte sich verzweifelt an ein Lied zu erinnern – an irgendein Lied –, das Rose vielleicht gefallen mochte.
Und dann fiel es ihr ein: Castia. Es war wild und erregend und würde die Zuhörer garantiert auf ihre Seite bringen. Es handelte sich um eine Kurzfassung der Schlacht von Castia, bei der Granduals Söldner den Herzog von Endland und dessen Herzwyld-Horde besiegt hatten. Das Lied bestand aus nur sieben Versen und einem Instrumentalsolo, von dem Tam verzweifelt hoffte, dass sie es noch beherrschte.
Das Beste daran war, dass es Roses Vater, den Goldenen Gabe, als den größten Helden von Fünfhof darstellte, ohne dass dazu erwähnt werden musste, dass er den gesamten Herzwyld der Breite nach durchquert hatte, um seine Tochter vor dem beinahe sicheren Tod zu retten, oder dass Gabe und seine Genossen auf dem Weg dorthin die Fäule ausgerottet, einen Drachen getötet und die Hälfte von Fünfhof vernichtet hatten. Der letzte Vers war Rose gewidmet, die am Ende die in der Stadt Eingeschlossenen zum Sieg geführt hatte.
Castia war genau das Richtige.
Sie holte tief Luft, wartete darauf, dass es noch stiller wurde, so wie Edwick es ihr beigebracht hatte, und dann …
»Pfft! Was zur Hölle ist denn das hier?« Branigan war aufgesprungen, nachdem er von seinem Whiskey genippt und ihn sich auf den Schoß gespuckt hatte. »Was beim kalten Herzen der Hölle hast du in meinen Becher gefüllt, Max? Lampenöl? Pisse? Bei den Göttern, ist das etwa Brüterpisse?« Er schnüffelte daran und nahm tatsächlich einen weiteren Schluck. »Das ist ja schrecklich!« Edwick zog ihn wieder auf seinen Stuhl herunter und zischte ihm zu, er solle den Mund halten. »Entschuldigung«, sagte er in den Raum hinein. »Entschuldigung, Tam. Mach weiter, Liebes.«
Tam holte noch einmal Luft. Sie wartete erneut, bis völlige Stille einsetzte, dann zupfte sie die ersten Akkorde von Castia.
Jubel stieg unter den Zuhörern auf. Ein breites, mächtiges Grinsen legte sich über Branigans Gesicht, und Edwick nickte. Als Tam zur Galerie hochschaute, bemerkte sie aber, dass Rose nicht begeistert wirkte. Sie klopfte ihre Pfeife auf dem Geländer aus und sagte leise etwas zu Freiwolk. Der Schamane, Brune, schob sich die langen Haare zur Seite. Er sah Tam in die Augen und schüttelte den Kopf so sanft, dass es fast – fast – nicht zu bemerken war.
Sie hielt inne. Die ersten Töne des Liedes zitterten in der Luft. Ein verwirrtes Murmeln erhob sich und hinterließ ein Schweigen der Verblüffung.
»Darf ich noch einmal neu anfangen?«, rief sie zu Rose hinauf.
Die Söldnerin kniff die Augen zusammen. »Wenn du willst.«
Tam schloss die Augen und bemerkte, dass ihre Hände zitterten und ihr Fuß nervös auf die Bodendiele unter ihr klopfte. Sie hörte das Schlagen ihres eigenen Herzens, spürte das Pochen des Blutes in den Adern und sah, wie ihr Traum, Ardburg in Begleitung der Fabel zu verlassen, an der Tür stand und bereits den Mantel gegen die Kälte draußen enger um sich zog.
Tam dachte an ihren Vater und daran, wie wütend er wäre, wenn er sie jetzt sehen könnte.
Sie dachte an ihre Mutter und daran, wie stolz sie wäre, wenn sie Tam jetzt sehen könnte.
Bevor sie es richtig wahrnahm, spielten ihre Finger eine Melodie, langsam und sanft und traurig.
Es war eines der Lieder ihrer Mutter. Tams Lieblingslied. Auch das ihres Vaters, früher mal gewesen. Sie durfte es nicht mehr spielen, natürlich nicht. Einmal hatte sie versucht, es sich selbst vorzusingen, kurz nach dem Tod ihrer Mutter. Aber der Kummer hatte sie überwältigt und ihre Stimme mit Schluchzern erstickt.
Nun aber strömte das Lied aus ihr hervor. Die Laute sang unter ihren Fingerspitzen, und ihre Worte trieben zu den Deckenbalken hoch wie schwebende Laternen, die in einer Sommernacht in den Himmel geschickt werden.
Das Lied hieß Miteinander. Es war nicht wild und ungehobelt und auch nicht erregend. Es erntete auch keinen Jubel, als Tam es spielte. Ihr Onkel – und auch Edwick – machten eine trauervolle Miene. Doch irgendwann legte sich der Geist eines Lächelns auf seine Lippen. Miteinander war kein Lied über eine Schlacht. Es kamen keine Ungeheuer darin vor. Niemand wurde getötet, und nichts wurde erobert.
Stattdessen war es der Liebesbrief einer Bardin an ihre Truppe. Es ging um die kleinen Momente, um die stillen Worte, um das unausgesprochene Band, das die Männer und Frauen miteinander teilten, die Tag um Tag gemeinsam aßen und schliefen und kämpften. Es ging um das Lachen eines Gefährten, um das Schnarchen eines Bettgenossen. Lily Hashford hatte einen ganzen Vers der Beschreibung des schiefen Lächelns ihres Gemahls gewidmet, und ein weiterer handelte vom Geruch von Brans Socken, wenn er seine Stiefel auszog.
»Das sind meine Glückssocken«, hörte sie ihren Onkel sagen, als dieser es dem alten Barden neben ihm gestand. »Ich trage sie immer noch!«
Eine weitere Einzigartigkeit von Miteinander bestand darin, dass die Musik vor den Worten endete, sodass Tam den letzten Kehrreim mit der Laute in ihrem Schoß sang. Ihre Hände waren reglos, ihr Fuß war still. Ihr schmerzendes Herz schlug einen langsamen und stetigen Rhythmus in ihr.
Das Lied endete, und man konnte das Flackern der Kerzen in der darauffolgenden Stille hören.
Gleichzeitig drehten sich zweihundert Köpfe zur Galerie hoch droben. Brune und Cara beobachteten Rose. Freiwolk schaute auf Tam hinunter. Sie sah, dass er grinste, denn er wusste es bereits.
»Willkommen bei Fabel«, sagte Rose.
Und die Menge geriet in Raserei.
Tam zog an der Klingelschnur. Als der Wagen anhielt, sprang sie heraus und rief dem Fahrer ihren Dank zu. Ihr Zuhause lag nur noch einen kurzen Fußweg entfernt, aber sie ließ sich Zeit. Sie senkte den Kopf gegen den treibenden Schnee und trat vorsichtig über die Pflastersteine, die von der Eisschicht, die sich auf ihnen gebildet hatte, rutschig waren. Wie ein Säugling lag Edwicks Rote Dreizehn in ihren Armen. Der Barde des Eckstein hatte darauf bestanden, dass sie das Instrument behielt, und als Tam sich standhaft geweigert hatte – denn sie wollte ihn nicht seines wertvollsten Besitzes berauben –, war er in den hinteren Teil der Taverne gelaufen und mit einem beinahe identischen Instrument zurückgekehrt, das er sogleich Rote Vierzehn getauft hatte. Damit war die Sache entschieden gewesen.
Tam hatte noch nie ein eigenes Instrument besessen. Als sie noch ein Mädchen gewesen war, hatte sie erwartet, sie würde eines Tages Hiraeth, die Laute ihrer Mutter, erben. Doch als ihre Mutter gestorben war, war auch Hiraeth verschwunden. Entweder hatte ihr Vater sie zerstört, oder er hatte sie verkauft, damit sie ihn nicht mehr heimsuchte.
Onkel Bran hatte sie davor gewarnt, nach Hause zu gehen.
»Bleib heute Nacht hier«, hatte er sie angefleht. »Oder schlaf bei der Truppe. Ich werde morgen früh zu deinem Vater gehen und ihm alles erklären. Ich werde sagen, dass ich es gewesen bin, der die Fabel gebeten hat, dich aufzunehmen.«
»Du warst es ja auch.«
Der alte Schurke dachte einen Augenblick lang darüber nach. »Bei den Göttern Granduals, dein alter Herr wird mich umbringen. Ich will damit nur sagen: Wenn dafür gezahlt werden muss, dann werde ich zahlen.«
Es würde dafür gezahlt werden müssen – dessen war sich Tam sicher –, aber wie sehr sie und Tuck sich in den letzten Jahren auch auseinandergelebt haben mochten, sie konnte doch nicht gehen, ohne sich von ihm zu verabschieden.
Bran hatte sie traurig angesehen. »Du hast Feuer in dir, Tam. Ich sehe es in deinen Augen. Ich spüre, wie es von dir abstrahlt, so heiß wie ein Kamin. Ich kenne Tuck, und wenn du dieses Feuer mit nach Hause nimmst, wird er es ersticken. Er wird es auslöschen und zu Asche machen.« Als Tam darüber nur die Schultern gezuckt hatte, war ihr Onkel traurig geworden. »Ich trinke auf deinen Mut«, hatte er gesagt und den Rest des furchtbaren Steinwälzer-Whiskeys heruntergekippt. »Weißt du, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist dieses Zeug gar nicht so schlecht.«
Tam blieb vor der Tür ihres Hauses stehen und stählte sich für das, was vor ihr lag. Von drinnen hörte sie ein Miauen. Threnody kündete ihr Kommen an. Als sie schließlich den Mut fand einzutreten, warf sich die Katze gegen Tams Stiefel und schnurrte zufrieden.
Ihr Vater saß am Küchentisch und hatte die Hände um einen Becher gelegt, von dem sie hoffte, dass er bloß mit Bier gefüllt war. Er starrte ins Nichts und fingerte geistesabwesend an einem Stück gelben Bandes herum.
»Habe ich dir nicht gesagt, du sollst der Katze keine Schleife umlegen?«, meinte er.
Tam schüttelte sich aus ihrem Mantel und hängte ihn neben die Tür, dann kniete sie sich hin und kraulte Threnody hinter den Ohren. Sie wurde mit einem weiteren kehligen Schnurren belohnt. Thren war eine langhaarige Palapti, so weiß wie frisch gefallener Schnee. Tams Mutter hatte sie von einer Reise in den Süden mit nach Hause gebracht. »Aber sie sieht so süß damit aus.«
»Sie sieht lächerlich aus. Du sollst nicht …« Er verstummte, als Tam vor ihm stand und sein Blick auf das Instrument in ihren Armen fiel.
»Wozu ist das?«, fragte er.
»Zum Spielen von Musik«, antwortete Tam. Großartiger Beginn, schalt sie sich selbst. Die beste Möglichkeit, ihm Honig um den Mund zu schmieren.
»Warum hast du es?«, wollte er wissen.
»Ed hat es mir gegeben.«
Tucks ohnehin schon düsterer Blick wurde noch düsterer. »Also, das brauchst du nicht. Du wirst es ihm morgen zurückgeben.«
»Das werde ich nicht.«
»Du wirst …«
»Ich kann nicht.«
»Du kannst nicht?« Ihr Vater sah sie misstrauisch an. »Warum kannst du das nicht?«
Draußen frischte der Wind auf. Er trieb gegen die Mauern und verkrallte sich mit eiskalten Fingern in die Fensterrahmen. Threnody hörte damit auf, Tams Beine zu umkreisen, und tappte zu ihrem Wassernapf hinüber; die Spannung im Raum schien sie nicht wahrzunehmen. Oder sie war ihr gleichgültig. Katzen konnten bisweilen ziemliche Mistviecher sein, und Threnody bildete da keine Ausnahme.
»Die Fabel ist in der Stadt«, sagte Tam. »Heute Abend sind sie im Eckstein gewesen. Onkel Bran …« Sie sah, wie die Fingerknöchel ihres Vaters weiß wurden. Zweifellos wünschte er sich gerade, der Becher zwischen seinen Händen wäre Branigans Kehle. »Sie erwähnten, dass sie nach einem Barden oder einer Bardin suchen, und Bran hat ihnen gesagt, dass ich spielen kann …«
»Ach ja, seit wann?« Die Stimme ihres Vaters klang beinahe fröhlich, wie im Plauderton. Nun wusste sie, dass er wirklich wütend war. »Selbst beigebracht? Ein Naturtalent? Du hast doch keine Laute mehr in den Fingern gehabt, seit du … nun, seit du ein kleines Mädchen warst.«
»Er hat mir nach der Arbeit Unterricht gegeben«, gestand sie. Heute Abend warf sie wohl jeden unter den Streitwagen der Söldner, oder? Sie hätte genauso gut zugeben können, dass Tera sie zweimal in der Woche am Bogen ausbildete und Tiamax ihr am Ende jeder Schicht ein Bier spendierte. Dann hätte ihr Vater wenigstens einen guten Grund, jeden im Eckstein zu töten.
»Ist das so?« Tuck leerte seinen Becher und stand auf. »Wenn du Ed morgen die Laute zurückgibst, kannst du ihm gleich sagen, dass du kündigst. In der Mühle werden zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht. Du kannst schon nächste Woche dort anfangen.«
»Ich habe bereits gekündigt«, sagte sie zu ihm und war wütend über seinen abschätzigen Tonfall. »Ich bin jetzt die Bardin der Fabel.«
»Nein, das bist du nicht.«
»Doch, das bin ich.«
»Tam.« Seine Stimme wurde streng.
»Papa …«
Der Becher flog gegen die Wand und zersplitterte. Threnody schoss aus dem Zimmer, als die Scherben auf den Boden regneten.
Tam sagte nichts, sondern wartete nur darauf, dass seine Wut abklang. Er fiel auf seinen Stuhl zurück. »Es tut mir leid, Tam. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich darf nicht riskieren, auch dich noch zu verlieren.«
»Was soll ich denn tun?«, fragte sie. »Soll ich etwa mein ganzes Leben in Ardburg bleiben? In der Mühle für ein paar lausige Hofmark in der Woche arbeiten? Und dann irgendein nettes, langweiliges Mädchen finden, mit dem ich einen Hausstand gründe?«
»Dagegen gibt es doch nichts zu … warte! Mädchen?«
»Bei der Gnade der Jungfer, Papa, muss das jetzt wirklich sein?«
»Es spielt keine Rolle«, sagte Tuck. »Das ist alles unsere Schuld. Das weiß ich. Deine Mutter und ich, wir haben dir zu viele Geschichten erzählt. Wir haben das Leben eines Söldners prächtiger geschildert, als es in Wirklichkeit ist. Weißt du, in Wahrheit ist es ein hartes Leben. Lange Straßen, einsame Nächte. Die Hälfte der Zeit bist du nass, und dir ist andauernd kalt, und dann kämpfst du gegen irgendein schreckliches Ding an einem furchtbaren Ort, und du machst dir vor Angst in die Hose, weil es dich töten könnte, bevor du es tötest. Es ist nicht wie in den Liedern, Tam. Söldner sind keine Helden. Sie sind Mörder.«
Tam gesellte sich zu ihm an den Tisch. Sie legte die Laute ab und nahm Platz. Der Stuhl zwischen ihnen – der Stuhl ihrer Mutter – blieb leer und wirkte wie eine Kluft.
»Die Dinge sind jetzt anders«, sagte sie und legte ihre Hand auf die seine. »Wir werden hauptsächlich durch die Arenen reisen. Vermutlich werde ich nie das Innere eines Ungeheuernestes sehen oder einen Fuß in den Herzwyld setzen.«
Ihr Vater schüttelte den Kopf, er war nicht überzeugt. »Nördlich von Felsmoor gibt es eine Horde; es sind die Überlebenden von Castia. Rose will sie in Angriff nehmen, das ist so sicher, wie es in der Hölle kalt ist. Keiner liebt den Ruhm mehr als dieses Mädchen. Außer vielleicht ihr Vater damals. Bei den Göttern, der Kerl war übel.«
»Rose will nichts gegen sie unternehmen.«
Das überraschte ihn. »Wirklich?«
Tam zuckte mit den Achseln. »Die Fabel will den letzten Teil ihrer Tournee hinter sich bringen. Sie kämpfen in jedem Ort von hier bis nach Hochteich, und danach haben sie einen Auftrag in Düstermarsch angenommen.«
»In Düstermarsch? Was soll das für ein Auftrag sein?«
»Ich weiß es nicht. Aber was immer es ist, es ist tausend Meilen von der Winterhorde entfernt.« Sie hatte keine Ahnung, ob das stimmte oder nicht. Sie wusste nicht einmal, wo Düstermarsch lag. Ihr Vater schien jedoch halbwegs überzeugt zu sein, und so machte sie sich nicht die Mühe, Roses Warnung zu erwähnen, dass das, wogegen sie kämpfen mussten, möglicherweise genauso gefährlich war wie die Horde selbst.
Für eine Weile richtete ihr Vater den Blick auf den Boden und betrachtete die Tonscherben, als überlege er sich, ob er sie wieder zusammensetzen solle. Die Stille zog sich hin, und Tam wagte schließlich zu hoffen, dass sie den Spalt in der unüberwindlichen Rüstung von Tuck Hashfords Verbitterung gefunden hatte.
»Nein«, sagte er endlich. »Du gehst nicht.«
»Aber …«
»Es ist mir egal«, gab er bleiern zurück. »Was immer du sagen wirst, welche Gründe auch immer deiner Meinung nach ein Fortgehen rechtfertigen … nichts davon hat eine Bedeutung. Nicht für mich. Deine Ansichten zählen hier nicht.«
Ich hätte auf Bran hören sollen, dachte sie. Ich hätte gehen sollen, ohne mich von ihm zu verabschieden. Das Feuer in ihr wurde kleiner, und Tam fürchtete, es könnte für immer erlöschen, wenn sie jetzt nicht handelte.
Sie stand auf und ging zur Tür. Scherben knirschten unter ihren Stiefeln.
»Tam …«
»Ich bleibe heute Nacht im Eckstein.« Sie nahm ihren Mantel vom Haken.
»Tam, setz dich.«
»Gleich morgen früh ziehen wir in die Arena«, sagte sie und bemühte sich, das Zittern aus ihrer Stimme herauszuhalten, »und am Morgen danach brechen wir in Richtung Osten auf. Ich bezweifle, dass ich dich davor noch einmal sehen werde, und deshalb ist das hier vermutlich …« Sie drehte sich um und erstarrte.