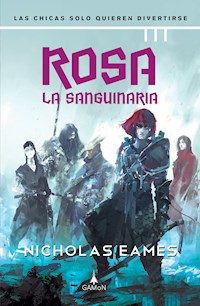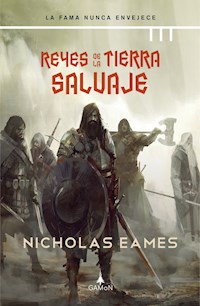13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Könige der Finsternis
- Sprache: Deutsch
Einst war Clay Cooper Mitglied der gefürchtetsten Söldnertruppe im ganzen Land. Kein Ungeheuer, das nicht von ihnen besiegt wurde. Keine Jungfrau in Nöten, die nicht von ihnen gerettet wurde. Inzwischen liegen die Heldentage lange hinter Clay – er hat eine Familie, arbeitet bei der Stadtwache. Dann steht eines Tages sein Freund Gabriel vor der Tür und bittet Clay um Hilfe bei einer Mission, der sich nur die tapfersten Krieger anschließen würden – oder die dümmsten: Gabriel will die alten Gefährten zusammentrommeln und in ein neues Abenteuer ziehen. Doch ein Held zu sein, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach wie früher ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Einst war Clay Cooper ein Held, eine lebende Legende. Als Mitglied der berühmt-berüchtigten Söldnertruppe Die Saga erlegte Clay gemeinsam mit seinen Gefährten Gabe, Ganelon, Matrick und dem Zauberer Moog Drachen, kämpfte gegen Riesen und brach reihenweise die Herzen der Frauen. Nun, beinahe zwanzig Jahre später, hat Clay grau meliertes Haar, arbeitet bei der Stadtwache in Decktal und führt mit seiner Frau Ginny und seiner Tochter Tally ein ruhiges, bescheidenes Leben. Doch mit der Idylle ist es schnell vorbei, als eines Abends sein alter Freund Gabe vor Clays Tür steht und ihn um Hilfe bittet: Im fernen Königreich Castia wütet ein grausamer Krieg, und ausgerechnet dort hält sich Gabes Tochter Rose auf. Gabe ist fest entschlossen, sie zu retten, und dazu möchte er Die Saga wieder zusammenbringen. Werden sich Clay und die alten Gefährten auf diese Herausforderung einlassen, die riskanter ist, als jedes Abenteuer, das sie bisher bestehen mussten? Schließlich führt der Weg nach Castia direkt durch das Herzwyld – ein undurchdringliches Dickicht voller magischer Kreaturen und tödlicher Gefahren –, und ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr so leicht, ein Held zu sein …
Der Autor
Nicholas Eames wurde in Wingham, Ontario geboren. Er besuchte das College für Theaterkünste, gab das Schauspielen aber auf, um Fantasy-Romane zu schreiben. Könige der Finsternis ist sein Debütroman. Er lebt in Ontario, Kanada.
Mehr über Autor und Werk erfahren Sie auf:
www.nicholaseames.com
NICHOLAS EAMES
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Siefener
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Mutter, die es immer geglaubt hat.
Für Rose, die es immer gewusst hat.
Für Vater, der es niemals ganz wissen wird.
1
EIN GEIST AUF DER STRASSE
Clay Coopers Schatten wirkte mächtiger, als der Mann in Wirklichkeit war. Allerdings überragte er immer noch die meisten anderen Menschen, hatte breite Schultern und einen Brustkorb wie ein Fass mit Eisenringen. Seine Hände waren so groß, dass die meisten Krüge darin wie Teetassen aussahen, und das Kinn unter seinem zotteligen braunen Bart wirkte so breit und scharfkantig wie ein Schaufelblatt. Aber sein Schatten, der durch die untergehende Sonne verlängert wurde, schlich wie die beharrliche Erinnerung an den Mann, der er einmal gewesen war, hinter ihm her: gewaltig und dunkel und mehr als nur ein wenig monströs.
Clay hatte sein Tagewerk vollbracht und schlich nun den ausgetretenen Pfad entlang, der in Decktal als Hauptstraße galt. Er grinste und nickte all jenen zu, die vor dem Einbruch der Dunkelheit noch schnell nach Hause wollten. Dabei trug er den grünen Wappenrock der Wächter über einem schäbigen Lederwams, und an seiner Hüfte hing ein abgenutztes Schwert in einem groben alten Futteral. Seinen Schild – mit den Jahren durch die Wirkung vieler Äxte und Pfeile und zupackender Krallen abgeplatzt, eingedellt und zerkratzt – hatte er sich über den Rücken geschlungen, und sein Helm … na ja, Clay hatte den, der ihm in der letzten Woche vom Sergeanten gegeben worden war, verloren, so wie er den, den er vor einem Monat erhalten hatte, inzwischen verlegt hatte. So etwas passierte ihm während der beinahe zehn Jahre, die er nun schon in der Wache verbrachte, fast jeden Monat.
Ein Helm versperrte die freie Sicht und behinderte das Hören, und meistens sah man darunter einigermaßen dämlich aus. Clay Cooper mochte einfach keine Helme, das war alles.
»Clay! He, Clay!« Pip kam zu ihm herübergetrottet. Der Junge trug ebenfalls das Grün der Wächter und hatte seinen eigenen lächerlichen Flachhelm in die Armbeuge gesteckt. »Ich hab grade meinen Dienst am Südtor hinter mir«, sagte er fröhlich. »Und du?«
»Nord.«
»Nett.« Der Junge grinste und nickte, als hätte Clay nicht bloß das Wort Nord gemurmelt, sondern etwas außerordentlich Interessantes von sich gegeben. »Gibt’s da draußen irgendwas Spannendes?«
Clay zuckte die Achseln. »Berge.«
»Ha! ›Berge‹, sagt er. Mustergültig. He, hast du gehört, dass Ryk Yarsson draußen bei Tassels Hof einen Zentauren gesehen hat?«
»Vermutlich war es ein Elch.«
Der Junge schenkte ihm einen zweifelnden Blick, als ob es höchst unwahrscheinlich sei, dass Ryk statt eines Zentauren tatsächlich nur einen Elch gesehen hatte. »Wie auch immer, kommst du noch für ein paar Becher mit in den Königskopf?«
»Das sollte ich lieber nicht tun«, sagte Clay. »Ginny erwartet mich zu Hause, und …« Er verstummte, denn eine bessere Entschuldigung hatte er nicht.
»Ach, bitte«, stachelte Pip ihn an. »Dann eben nur einen … einen einzigen Becher.«
Clay grunzte, blinzelte in die Sonne und wog die Aussicht auf Ginnys Zorn gegen den bitteren Geschmack des Bieres ab, das ihm durch die Kehle rinnen würde. »Also gut«, gab er nach. »Aber wirklich nur einen einzigen Becher.«
Schließlich war es harte Arbeit, den ganzen Tag nach Norden zu schauen.
Im Königskopf war es schon ziemlich voll; an den langen Tischen drängten sich die Gäste, die nicht nur zum Trinken, sondern auch zu Klatsch und Tratsch herkamen. Pip drängte sich zur Theke, während Clay einen Platz an einem Tisch fand, der so weit wie möglich von der Bühne entfernt stand.
Die Gespräche um ihn herum waren von der üblichen Art: das Wetter und der Krieg, und beides war nicht besonders verheißungsvoll. Weit im Westen, im Endland, hatte es eine große Schlacht gegeben, und den Gerüchten zufolge war sie nicht besonders gut verlaufen. Eine ganze Armee der Republik, die zwanzigtausend Mann umfasste und von einigen Hundert Söldnertruppen unterstützt wurde, war von einer Herzwyld-Horde überrannt worden. Die wenigen, die davongekommen waren, hatten sich in die Stadt Castia zurückgezogen und wurden nun dort belagert. Sie mussten Krankheit und Hunger trotzen, während sich der Feind außerhalb der Mauern an den Toten gütlich tat. Außerdem war der Boden heute Morgen ein wenig gefroren gewesen, was für den frühen Herbst recht ungewöhnlich war.
Pip kehrte mit zwei Krügen und zwei Freunden zurück, die Clay nicht kannte und deren Namen er – kurz nachdem sie ihm mitgeteilt worden waren – schon wieder vergessen hatte. Aber es schienen eher nette Kerle zu sein. Clay konnte sich bloß keine Namen merken.
»Du warst also bei der Truppe?«, fragte der eine. Er hatte strähnige rote Haare, und sein Gesicht war eine postpubertäre Masse aus Sommersprossen und angeschwollenen Pickeln.
Clay nahm einen tiefen Zug aus seinem Krug, setzte ihn ab und sah zu Pip hinüber, der immerhin den Anstand besaß, beschämt zu wirken. Dann nickte er.
Die beiden warfen sich einen verstohlenen Blick zu, dann beugte sich Sommersprosse über den Tisch. »Pip sagt, ihr Jungs habt den Kaltfeuerpass drei Tage lang gegen tausend wandelnde Tote gehalten.«
»Ich hab zwar nur neunhundertneunundneunzig gezählt«, berichtigte ihn Clay. »Aber ganz schön viele waren das schon, ja.«
»Er sagt, ihr habt Akatung den Schrecken getötet«, meinte der andere, dessen Versuch, sich einen Bart wachsen zu lassen, lediglich ein paar flaumige Büschel hervorgebracht hatte, über die die meisten Großmütter höhnisch gelacht hätten.
Clay nahm noch einen Schluck, dann schüttelte er den Kopf. »Wir haben ihn bloß verletzt. Aber ich hab gehört, dass er später in seinem Nest gestorben ist. Friedlich. Im Schlaf.«
Sie wirkten enttäuscht, dann jedoch stieß Pip den einen mit dem Ellbogen an. »Frag ihn nach der Belagerung von Hohlberg.«
»Hohlberg?«, murmelte Flaumi, und seine Augen wurden so groß wie Hofmünzen. »Warte mal, meinst du die Belagerung von Hohlberg? Dann war die Truppe, in der du gedient hast …«
»Die Saga«, beendete Sommersprosse den Satz mit großer Ehrfurcht. »Du bist in der Saga gewesen.«
»Ist schon eine Weile her«, sagte Clay und zupfte an einem Knötchen in dem verzogenen Holz der Tischplatte vor sich. »Aber der Name klingt vertraut.«
»Hui«, seufzte Sommersprosse.
»Du willst mich veräppeln«, brachte Flaumi hervor.
»Also … hui«, sagte Sommersprosse noch einmal.
»Du willst mich veräppeln«, wiederholte auch Flaumi, der offenbar nicht überboten werden wollte, wenn es um den Ausdruck des Unglaubens ging.
Darauf sagte Clay nichts mehr, sondern nippte nur noch an seinem Bier und zuckte mit den Schultern.
»Dann kennst du den Goldenen Gabe?«, fragte Sommersprosse.
Ein weiteres Zucken. »Ja, ich kenne Gabriel.«
»Gabriel!«, trillerte Pip und vergoss ein wenig von seinem Bier, als er verwundert die Hände in die Luft warf. »›Gabriel‹, sagt er. Großartig.«
»Und Ganelon?«, fragte Flaumi. »Und Arcandius Moog? Und Matrick Schädeltrommler?«
»Oh, und …« Sommersprosse verzog die Miene, als er angestrengt grübelte – was dem armen Kerl nicht gut zu Gesicht stand, wie Clay fand. Er war so hässlich wie eine Regenwolke an einem Hochzeitstag. »Wen haben wir dabei vergessen?«
»Clay Cooper.«
Flaumi strich sich über die feinen Härchen an seinem Kinn, als er darüber nachdachte. »Clay Cooper … oh«, sagte er und sah verlegen drein. »Richtig.«
Sommersprosse brauchte noch einen Augenblick, bis er die Einzelteile des Bildes zusammengesetzt hatte, dann legte er die bleiche Handfläche gegen die Stirn und lachte. »Gute Götter, ich bin so dumm.«
Das wissen die Götter doch längst, dachte Clay.
Pip spürte die herannahende Peinlichkeit und mischte sich ein. »Erzähl uns eine Geschichte, ja, Clay? Vielleicht über den getöteten Nekromanten in Restfurt. Oder über die Rettung dieser Prinzessin aus … na, von diesem Ort da, erinnerst du dich?«
Von welchem Ort?, fragte sich Clay. Tatsächlich hatten sie mehrere Prinzessinnen gerettet, und er hatte nicht nur einen, sondern mindestens ein Dutzend Nekromanten getötet. Wer behielt bei so etwas schon den Überblick? Es spielte aber gar keine Rolle, denn er war jetzt nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen oder das wieder auszubuddeln, was er so mühsam vergraben und noch mühsamer versucht hatte zu vergessen.
»Tut mir leid, Junge«, sagte er zu Pip und trank den Rest seines Biers. »Das war ein Becher.«
Er entschuldigte sich, gab Pip ein paar Kupfermünzen für das Bier und sagte Sommersprosse und Flaumi Lebewohl – hoffentlich sah er sie nie wieder. Er drängte sich zur Tür und seufzte tief und lange, als er nach draußen in die kühle Stille trat. Sein Rücken schmerzte, weil er sich zu weit über den Tisch gebeugt hatte. Clay reckte und streckte sich zunächst, hob dann den Kopf und betrachtete die ersten Sterne des Abends.
Er erinnerte sich daran, wie klein er sich früher beim Anblick des Nachthimmels gefühlt hatte. Wie unbedeutend. Also war er losgezogen und hatte viel Wind um sich gemacht und sich vorgestellt, dass er eines Tages zu der gewaltigen Menge der Sterne hochschauen und von ihrem Glanz nicht länger eingeschüchtert sein würde. Aber es war ihm nicht gelungen. Nach einer Weile riss Clay den Blick von dem dunkler werdenden Himmel los und ging die Straße entlang nach Hause.
Er tauschte ein paar freundliche Worte mit den Wächtern am Westtor aus. Sie fragten ihn, ob er von dem Zentauren gehört hatte, der angeblich in der Nähe von Tassels Hof gesehen worden war. Und von der Schlacht im Westen und von diesen armen Bastarden, die in Castia festsaßen. Üble, üble Sachen.
Clay folgte dem Pfad und achtete sorgsam darauf, sich nicht den Knöchel in einer Furche zu verzerren. Grillen zirpten im hohen Gras zu beiden Seiten, und der Wind rauschte wie eine Meeresbrandung in den Bäumen über ihm. Er hielt am Schrein des Sommerherrn neben der Straße an und warf eine matte Kupfermünze vor die Füße der Statue. Nach einigen weiteren Schritten und einem kurzen Zögern kehrte er um und opferte eine zweite Münze. So fern von der kleinen Stadt war es noch dunkler, und Clay widerstand dem Drang, abermals nach oben zu schauen.
Es ist das Beste, den Blick auf den Boden zu richten, sagte er zu sich selbst, und die Vergangenheit dort zu lassen, wo sie hingehört. Du hast, was du hast, Cooper, und das ist doch auch das, was du wolltest, oder? Ein Kind, eine Frau, ein einfaches Leben. Es war ein ehrliches Leben. Außerdem war es bequem.
Fast konnte er hören, wie Gabriel darüber höhnte. Ehrlich? Ehrlich ist langweilig, hätte sein alter Freund gesagt. Und bequem ist öde. Doch Gabriel hatte lange vor Clay geheiratet. Er hatte sogar eine kleine Tochter – inzwischen musste sie schon eine erwachsene Frau sein.
Trotzdem stand Gabes Gespenst vor ihm, jung und wild und prächtig, und grinste in einer schattigen Ecke von Clays Gedanken. »Wir waren einmal Riesen,« sagte er. »Überlebensgroß. Und jetzt …«
»Jetzt sind wir müde alte Männer«, murmelte Clay zu niemand anderem als der Nacht. Was war so falsch daran? Zu seiner Zeit war er vielen echten Riesen begegnet, und die meisten waren miese Kerle gewesen.
Trotz Clays Einwänden bedrängte ihn Gabriels Geist auf dem Heimweg immer weiter, glitt vor ihm über den Pfad und blinzelte verschlagen, winkte ihm vom Zaum des Nachbarn zu und hockte wie ein Bettler auf der Treppe vor Clays Haustür. Doch dieser letzte Gabriel war keineswegs mehr jung. Und er wirkte auch nicht mehr wild. Und er war kaum prächtiger als ein altes Brett mit einem rostigen Nagel darin. Tatsächlich sah er sogar ziemlich fertig und heruntergekommen aus. Clay hatte in all den Jahren seines Lebens noch nie einen Mann gesehen, der so traurig wirkte.
Die Erscheinung sprach seinen Namen aus, und in Clays Ohren klang es so wirklich wie das Zirpen der Grillen und das Jammern des Windes in den Bäumen, die an der Straße standen. Und dann zerfiel das brüchige Lächeln, und Gabriel – das war jetzt kein Gespenst, sondern der wahre, echte Gabriel aus Fleisch und Blut – sackte in Clays Arme, schluchzte an seiner Schulter und hielt sich an ihm fest, ganz wie ein Kind, das Angst vor der Dunkelheit hat.
»Clay«, sagte er. »Bitte … ich brauche deine Hilfe.«
2
ROSE
Sobald sich Gabriel wieder gefangen hatte, gingen sie gemeinsam nach drinnen. Ginny drehte sich am Herd um und biss die Zähne zusammen. Griff, der Haushund, kam herbeigelaufen und wedelte mit seinem Stummelschwanz. Ganz kurz beschnupperte er Clay und roch dann an Gabes Bein, als wäre es ein angepinkelter Baumstamm, was tatsächlich nicht ganz falsch war.
Sein alter Freund befand sich ohne Zweifel in einer traurigen Verfassung. Haare und Bart waren eine verfilzte Masse, die Kleidung bestand fast ausschließlich aus schmutzigen Lumpen. In den Stiefeln klafften Löcher, und die Zehen lugten wie schmutzige Straßenkinder durch das spröde Leder. Seine Hände waren in ständiger Bewegung, er rang sie oder zupfte geistesabwesend am Saum seines Hemdes. Doch das Schlimmste waren seine Augen. Sie wirkten tief in das ausgezehrte Gesicht eingesunken, waren hart und blickten so gehetzt hin und her, als würde er überall etwas sehen, was er nicht sehen wollte.
»Griff, hör auf. Aus!«, befahl Clay. Die Augen des Hundes waren feucht, und die rosafarbene Zunge hing ihm aus dem schwarzen Fellgesicht. Als er seinen Namen hörte, hob er den Kopf. Griff war nicht gerade eine edle Erscheinung, und er konnte kaum mehr als Speisereste vom Teller lecken. Er war jedenfalls nicht in der Lage, Schafe zu hüten oder ein Moorhuhn aufzustöbern, und falls jemand ins Haus einbrechen sollte, würde er dem Dieb vermutlich eher die Pantoffeln holen als ihn verjagen. Aber Clay musste jedes Mal lächeln, wenn er den Hund ansah – einen so hinreißenden Eindruck machte der –, und das war doch schließlich mehr als nichts.
»Gabriel.« Endlich hatte Ginny ihre Stimme wiedergefunden. Aber Clays Frau bewegte sich nicht. Sie lächelte nicht einmal. Sie kam auch nicht herbei, um ihn zu umarmen. Sie hatte nie viel für Gabriel übriggehabt. Clay vermutete, dass sie seinen alten Kampfgefährten für all die schlechten Angewohnheiten (Spielen, Kämpfen, heftiges Trinken) verantwortlich machte, die sie ihm in den letzten zehn Jahren abzugewöhnen versucht hatte, und für all die anderen schlechten Angewohnheiten (Kauen mit offenem Mund, Händewaschen vergessen und gelegentlich Leute erdrosseln), die sie ihm noch abgewöhnen wollte.
Dazu kamen Gabriels gelegentliche Besuche, nachdem seine Frau ihn verlassen hatte. Jedes Mal war er mit einem großartigen Plan aufgetaucht, die alte Truppe wieder zusammenzuführen und noch einmal auf die Jagd nach Ruhm, Reichtum und tollkühnen Abenteuern zu gehen. Immer gab es entweder ein Dorf im Süden, das vor einem verheerenden Drachen gerettet werden musste, oder es musste ein Bau von wandelnden Wölfen im Jammerwald ausgeräuchert werden, oder aber eine alte Dame in einer fernen Ecke des Reiches brauchte Hilfe beim Abnehmen ihrer Wäsche von der Leine, und nur die Saga konnte ihr beistehen!
Es war überhaupt nicht so, dass Clay Ginnys Atem in seinem Nacken spüren musste, um sich diesen Plänen zu verweigern und zu erkennen, dass Gabriel nach etwas suchte, das unwiederbringlich verloren war – wie ein alter Mann, der sich an die Erinnerungen seiner goldenen Jugend klammerte. Genauso war es – tatsächlich. Aber Clay wusste, dass das Leben nicht so funktionierte. Es war kein Kreislauf, man musste nicht andauernd alles wiederholen. Das Leben war ein Bogen, dessen Verlauf so unausweichlich war wie der Zug der Sonne über den Himmel, und sie strahlte dann am hellsten, wenn ihr Abstieg begann.
Clay blinzelte, denn er hatte sich in seinen eigenen Gedanken verloren. Das kam manchmal vor, und er wünschte sich, er wäre geübter darin, seine Gedanken in Worte zu fassen. Dann würde er wie ein richtig kluger Kerl klingen, oder etwa nicht?
Doch stattdessen stand er nur stumm da, während das Schweigen zwischen Ginny und Gabriel allmählich unangenehm wurde.
»Du siehst hungrig aus«, sagte sie schließlich.
Gabriel nickte, während seine Hände unruhig in der Luft herumfuhren.
Ginny seufzte zwar, aber dann zwang sich Clays Frau schließlich – seine freundliche, liebliche und großartige Frau – zu einem knappen Lächeln und zog den Löffel aus dem Topf, in dem sie zuvor gerührt hatte. »Dann setz dich«, sagte sie über die Schulter. »Ich gebe dir etwas zu essen. Ich habe nämlich Clays Lieblingsgericht gekocht: Kanincheneintopf mit Pilzen.«
Gabriel blinzelte. »Clay hasst doch Pilze.«
Als Clay sah, wie sich Ginnys Rücken versteifte, sagte er rasch und fröhlich: »Das war früher so«, bevor seine Frau – seine aufbrausende, scharfzüngige und manchmal geradezu furchterregende Frau – sich umdrehen und Gabriels Schädel mit ihrem Holzlöffel spalten konnte. »Ginny macht etwas mit ihnen, und dann schmecken sie mir.« Nicht besonders toll, kam ihm zwar als Erstes in den Sinn. »Ziemlich gut sogar«, setzte er jedoch lahm hinzu. »Wie bereitest du sie eigentlich zu, Liebes?«
»Ich schmore sie«, erwiderte sie, und Clay war erstaunt, wie bedrohlich diese einfachen drei Worte aus ihrem Mund klingen konnten.
Etwas, das entfernt einem Lächeln ähnelte, zupfte an Gabes Mundwinkeln.
Er hat mir schon immer gern dabei zugesehen, wie ich mich winde, rief sich Clay in Erinnerung. Dann setzte er sich auf einen Stuhl, und Gabriel folgte seinem Beispiel. Griff trollte sich zu seiner Decke und leckte ausgiebig seine Hoden, bevor er einschlief. Als Clay das sah, bezwang er ein Gefühl des Neides. »Ist Tally zu Hause?«, fragte er.
»Nein«, sagte Ginny. »Sie ist irgendwo draußen.«
Hoffentlich hatte sie sich nicht zu weit vom Haus entfernt. In den nahen Wäldern gab es Kojoten. Und in den Bergen liefen Wölfe herum. Zur Hölle, Ryk Yarsson hatte sogar einen Zentauren draußen bei Tassels Hof gesehen. Oder vielleicht auch bloß einen Elch. Doch beides konnte ein junges Mädchen töten, wenn es überrascht wurde. »Sie hätte vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause sein sollen«, sagte er.
»Genau wie du, Clay Cooper«, entgegnete seine Frau. »Hast du Überstunden an der Mauer geschoben, oder rieche ich da etwa Königspisse an dir?« Königspisse war ihr Name für das Bier, das sie in der Taverne ausschenkten. Es war tatsächlich eine passende Bezeichnung, und Clay hatte darüber gelacht, als er sie zum ersten Mal gehört hatte. Aber im Augenblick wirkte sie gar nicht so lustig.
Zumindest nicht auf Clay, obwohl sich Gabriels Stimmung in diesem Augenblick ein wenig aufzuhellen schien. Sein alter Freund grinste wie ein Junge, dessen Bruder gerade die Schuld für eine Missetat auf sich nahm, die er gar nicht begangen hatte.
»Sie ist unten im Moor«, sagte Ginny, während sie zwei Keramikschüsseln aus dem Schrank nahm. »Sei froh, dass es bloß Frösche sind, die sie nach Hause bringt. Schon sehr bald werden es Jungs sein, und dann hast du genug Gründe, dir Sorgen zu machen.«
»Nicht ich werde es sein, der sich dann Sorgen macht«, murmelte Clay.
Daraufhin lachte Ginny nur, und er hätte sie gern gefragt, warum sie nicht endlich eine dampfende Schüssel mit Eintopf vor ihn hinstellte. Der Duft brachte seinen Magen zum Knurren, obwohl sich Pilze im Essen befanden.
Nachdem seine Frau schließlich die beiden Schüsseln auf den Tisch gestellt hatte, nahm sie ihren Mantel vom Haken neben der Tür. »Ich sehe nach, ob mit Tally alles in Ordnung ist«, sagte sie. »Vielleicht braucht sie beim Tragen der Frösche Hilfe.« Sie trat vor Clay, küsste ihn auf den Scheitel und glättete danach seine Haare wieder. »Inzwischen könnt ihr Jungs euch miteinander amüsieren.«
Sie öffnete die Tür, doch dann zögerte sie und warf einen Blick zurück – zuerst auf Gabriel, der schon seinen Eintopf löffelte, als wäre dies die erste Mahlzeit, die er seit Langem zu sich genommen hatte, und dann auf Clay. Erst etliche Tage später (und nach einer harten Wahl und allzu vielen bereits zurückgelegten Meilen) begriff er, was er in ihrem Blick gesehen hatte. Es war eine Art von Trauer gewesen, nachdenklich und resigniert, als ob sie – seine liebende, wunderschöne und bemerkenswert scharfsinnige Frau – schon wüsste, was kam, so unausweichlich wie der Winter oder der gewundene Weg eines Flusses ins Meer.
Ein kalter Wind blies von draußen herein. Trotz ihres Mantels zitterte Ginny, dann verschwand sie.
»Es geht um Rose.«
Sie hatten ihr Mahl beendet und die Schüsseln beiseitegeschoben. Clay wusste, dass er sie in das Spülbecken hätte stellen und einweichen sollen, damit sie später nicht so schwer zu säubern waren, aber plötzlich hatte er das Gefühl, dass er den Tisch jetzt nicht verlassen durfte. Gabriel war am Abend zu ihm gekommen, hatte einen langen Weg zurückgelegt und sicherlich etwas Wichtiges zu sagen. Es war das Beste, ihn nicht zu unterbrechen.
»Deine Tochter?«, bedrängte ihn Clay.
Gabe nickte langsam. Seine Hände lagen flach auf der Tischplatte. Sein Blick war zwischen sie ins Nichts gerichtet. »Sie ist … eigensinnig«, sagte er schließlich. »Ungestüm. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie das von ihrer Mutter hat, aber …« Und wieder erschien dieses Grinsen auf seinem Gesicht, wenn auch nur ganz schwach. »Erinnerst du dich daran, dass ich ihr beigebracht habe, mit dem Schwert umzugehen?«
»Ich erinnere mich jedenfalls daran, dass du gesagt hast, dass es eine schlechte Idee gewesen ist«, erwiderte Clay.
Gabriel zuckte mit den Achseln. »Ich wollte ihr nur ermöglichen, sich selbst zu verteidigen. Du weißt schon: Stich mit dem spitzen Ende zu und so was. Aber sie wollte mehr. Sie wollte …« Er verstummte kurz und suchte nach dem passenden Wort. »Sie wollte bedeutend sein.«
»Wie ihr Vater?«
Gabriel machte eine säuerliche Miene. »So ungefähr. Ich glaube, sie hat einfach zu viele Geschichten gehört. Ihr Kopf ist voll von all diesem Unsinn über Heldentum und Kampf.«
Und von wem hat sie all das wohl gehört?, fragte sich Clay.
»Ich weiß«, sagte Gabriel, der Clays Gedanken offenbar erraten hatte. »Ich will nicht verhehlen, dass es teilweise meine Schuld ist. Aber ich bin es nicht allein gewesen. Die Kinder heutzutage … sie sind vom Söldnertum besessen, Clay. Sie beten die Söldner regelrecht an. Das ist ungesund. Und die meisten dieser Söldner sind nicht einmal in einer richtigen Truppe! Sie heuern bloß eine Bande namenloser Trottel an, die das Kämpfen für sie übernehmen, während sie sich die Gesichter bemalen und mit blitzblanken Schwertern und in schimmernder Wehr herumparadieren. Es gibt sogar einen Kerl – ich verkohl dich nicht –, der auf einem Mantikor in die Schlacht reitet.
»Auf einem Mantikor?«, fragte Clay ungläubig.
Gabe lachte bitter. »Unglaublich, was? Wer zum Henker reitet denn auf einem Mantikor? Diese Wesen sind gefährlich. Na, das muss ich dir wohl nicht sagen.«
Natürlich musste er das nicht. Clay hatte eine hässliche Stichwunde im rechten Oberschenkel, die ihn stets daran erinnerte, wie gefährlich es war, sich mit solchen Ungeheuern einzulassen. Ein Mantikor war kein Schoßtierchen – und gewiss auch kein geeignetes Reittier. Als würden flatternde Flügel und ein Schwanz mit Giftstachel an einem Löwenkörper gerade dazu einladen, auf den Rücken eines solchen Geschöpfs zu klettern!
»Sie haben uns ebenfalls angebetet«, betonte Clay. »Nun ja, dich zumindest. Und Ganelon. Selbst heute erzählen sie sich noch die alten Geschichten. Und sie singen die alten Lieder.«
Die Geschichten waren natürlich übertrieben. Und die Lieder waren größtenteils äußerst ungenau. Aber sie blieben bestehen. Sie existierten noch, obwohl die Männer selbst schon lange nicht mehr die (oder das) waren, die (oder was) sie einmal gewesen waren.
Einst waren wir Riesen.
»Das ist nicht dasselbe«, beharrte Gabriel. »Du solltest die Menschenmassen sehen, wenn diese Truppen in die Stadt kommen, Clay. Die Leute schreien, und die Frauen weinen auf der Straße.«
»Das klingt ja schrecklich«, sagte Clay und meinte es auch so.
Gabriel beachtete ihn nicht weiter, sondern fuhr fort: »Wie dem auch sei, Rose wollte den Umgang mit dem Schwert lernen, und ich habe ihr nachgegeben. Ich hatte gehofft, es werde sie früher oder später langweilen, und wenn sie es wirklich lernen wollte, dann sollte wenigstens ich es sein, der es ihr beibringt. Außerdem hat es ihre Mutter unendlich wütend gemacht.«
Das war Clay klar. Ihre Mutter Valerie hasste Gewalt und Waffen jeder Art und ebenso all jene, die das eine oder andere einsetzten, zu welchem Zweck auch immer. Valerie war einer der Gründe dafür gewesen, dass sich die Saga vor vielen Jahren aufgelöst hatte.
»Das Problem bestand darin, dass sie gut war«, sagte Gabriel. »Wirklich gut, und das sagt nicht nur der stolze Vater. Anfangs hat sie mit Kindern geübt, die genauso alt waren wie sie, aber als sie keine Lust mehr hatten, den Hintern versohlt zu bekommen, hat Rose nach Straßenkämpfen Ausschau gehalten oder sich einen Weg in finanzierte Wettkämpfe erschlichen.«
»Die Tochter des Goldenen Gabe persönlich«, meinte Clay nachdenklich. »Das muss eine ziemlich große Attraktion gewesen sein.«
»Vermutlich«, stimmte ihm sein Freund zu. »Aber dann hat Val eines Tages all die Blutergüsse und Prellungen gesehen. Sie hat fast den Verstand verloren. Natürlich hat sie mich dafür verantwortlich gemacht – für alles. Sie hat ein Machtwort gesprochen – du weißt ja, wie sie sein kann –, und für eine Weile hat Rose das Kämpfen eingestellt, aber …« Er verstummte, und Clay sah, wie er verbittert die Zähne zusammenbiss. »Nachdem ihre Mutter weggelaufen ist, sind Rosie und ich … wir sind nicht mehr so gut miteinander ausgekommen. Sie ist immer wieder gegangen, und manchmal ist sie tagelang nicht nach Hause gekommen. Es gab weitere Prellungen und auch ein paar hässliche Wunden. Sie hat sich die Haare abgeschnitten – der heiligen Tetrea sei Dank, dass ihre Mutter damals schon nicht mehr bei uns war, denn sonst wären als Nächstes meine Haare dran gewesen. Und dann kam der Zyklop.«
»Der Zyklop?«
Gabriel sah ihn von der Seite an. »Das sind diese großen Bastarde, mit einem einzigen riesigen Auge mitten auf der Stirn.«
Clay warf ihm einen bösen Blick zu. »Ich weiß, was ein Zyklop ist, du Mistkerl.«
»Warum hast du dann gefragt?«
»Ich habe nicht …« Clays Stimme schwankte. »Egal. Was war mit dem Zyklopen?«
Gabriel seufzte. »Na ja, einer hatte sich in diesem alten Fort nördlich von Ottersbach niedergelassen. Er hat ein paar Kühe gestohlen, einige Ziegen, auch einen Hund, und dann hat er die Leute umgebracht, die nach den Tieren gesucht haben. Die Männer bei Hofe hatten alle Hände voll zu tun und haben darum nach jemandem gesucht, der die Bestie für sie beseitigt. Aber es gab zu jener Zeit keine Söldner in der Nähe – zumindest keine, die Mumm genug hatten, es mit einem Zyklopen aufzunehmen. Irgendwie wurde dann mein Name ins Spiel gebracht. Sie haben sogar jemanden zu mir geschickt, der mich gefragt hat, ob ich die Sache erledigen würde. Ich habe abgelehnt. Verdammt, ich besitze nicht mal mehr ein Schwert!«
Entsetzt warf Clay ein: »Was? Was ist denn aus Vellichor geworden?«
Gabriel senkte den Blick. »Ich … äh … ich hab es verkauft.«
»Wie bitte?«, fragte Clay, doch bevor sein Freund die Worte wiederholen konnte, legte er selbst die Hände auf den Tisch, weil er Angst hatte, er könnte sie zu Fäusten ballen oder eine der Schüsseln nehmen und sie Gabriel an den Kopf werfen. So ruhig, wie es ihm möglich war, sagte er: »Für einen Moment habe ich wirklich geglaubt, du hättest gesagt, dass du Vellichor verkauft hättest. Das Schwert, das dir der Archon auf seinem Sterbebett anvertraut hat? Das Schwert, das er benutzt hat, um einen verdammten Durchgang von seiner Welt in die unsere zu schneiden. Dieses Schwert? Du hast dieses Schwert verkauft?«
Bei jedem Wort war Gabriel tiefer in seinen Stuhl gesunken, und nun nickte er. »Ich musste Schulden abtragen, und Valerie wollte, dass es aus dem Haus verschwindet, nachdem sie herausgefunden hatte, dass ich Rose damit das Kämpfen beigebracht habe«, erklärte er sanft. »Sie hat gesagt, es sei gefährlich.«
»Sie …« Clay unterbrach sich selbst. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und rieb sich mit den Handflächen über die Augen. Er ächzte, und Griff, der seine Verwirrung spürte, jammerte auf seiner Decke in der Zimmerecke. »Erzähl deine Geschichte zu Ende«, sagte er schließlich.
Gabriel fuhr fort. »Ist wohl unnötig zu sagen, dass ich mich geweigert habe, den Zyklopen zu erledigen, und in den folgenden Wochen hat er große Schäden angerichtet. Dann lief plötzlich das Gerücht um, jemand sei ausgezogen und habe ihn getötet.« Er lächelte wehmütig und traurig. »Sie hat es ganz allein getan.«
»Rose«, sagte Clay. Das war keine Frage. Es war nicht nötig zu fragen.
Gabriel nickte. »Über Nacht wurde sie zu einer Berühmtheit. Die Blutige Rose nannte man sie jetzt. Eigentlich ein ziemlich guter Name.«
Allerdings, stimmte Clay ihm zwar zu, aber er machte sich trotzdem nicht die Mühe, es laut auszusprechen. Je eher Gabriel das sagte, weswegen er hergekommen war, desto schneller konnte Clay seinem ältesten und liebsten Freund sagen, er solle sich aus seinem Haus trollen und nie mehr zurückkehren.
»Sie hat sogar ihre eigene Truppe aufgestellt«, sagte Gabe weiter. »Es ist ihnen gelungen, ein paar Nester um den Ort herum auszuheben: Riesenspinnen und einen alten Aaswurm unten in den Abwässern, einen, von dem keiner gewusst hat, dass er noch lebt. Aber ich hatte gehofft …« – er biss sich auf die Lippe – »… ich hatte noch immer gehofft, dass sie am Ende doch einen anderen Weg einschlägt. Einen besseren Weg, anstatt dem meinen zu folgen.« Er schaute auf. »Bis dann die Nachricht aus der Republik Castia kam, in der darum gebeten wurde, dass jedes verfügbare Schwert gegen die Herzwyld-Horde ins Feld ziehen soll.«
Einen Herzschlag lang fragte sich Clay, was das zu bedeuten hatte. Doch dann erinnerte er sich an die Neuigkeiten, die er früher am Abend gehört hatte. Eine Armee von zwanzigtausend Mann war von einem weitaus zahlreicher auftretenden Feind besiegt worden, und die Überlebenden hatten sich nach Castia zurückgezogen. Zweifellos wünschten sie sich, sie wären auf dem Schlachtfeld gestorben, anstatt nun die Abscheulichkeiten in einer belagerten Stadt ertragen zu müssen.
Und das bedeutete, dass Gabriels Tochter tot war. Oder es jedenfalls sein würde, sobald die Stadt fiel.
Clay öffnete den Mund. Er bemühte sich, die Qualen aus seiner Stimme fernzuhalten. »Gabe, ich …«
»Ich geh zu ihr, Clay. Und ich brauche dich an meiner Seite.« Gabriel beugte sich auf seinem Stuhl vor; die Flammen der väterlichen Angst und Wut loderten in seinen Augen. »Jetzt ist es an der Zeit, die Truppe wieder zusammenzubringen.«
3
EIN GUTER MANN
Auf keinen Fall.«
Das war anscheinend nicht die Antwort, die sein Freund erwartet hatte. Zumindest nicht mit solchem Nachdruck. Gabriel blinzelte – das Feuer in ihm erlosch genauso schnell, wie es aufgelodert war. Er wirkte verwirrt. Ungläubig. »Aber Clay …«
»Ich habe Nein gesagt. Ich verlasse diesen Ort nicht, um mit dir nach Westen zu ziehen. Ich lasse Ginny nicht allein zurück und Tally auch nicht. Ich werde nicht auf die Suche nach Moog oder Matrick oder Ganelon gehen – der uns alle gewiss noch immer hassen wird – und dann durch das Herzwyld schlendern! Bei Glifs Titten, Gabe, mehr als tausend Meilen liegen zwischen hier und Castia, und du weißt genau, dass sie nicht mit Steinen gepflastert sind.«
»Ja, das weiß ich«, sagte Gabriel, aber Clay redete weiter.
»Ach, wirklich? Weißt du das tatsächlich, Gabe? Erinnerst du dich an die Berge? Erinnerst du dich auch an die Riesen in diesen Bergen? Erinnerst du dich an die Vögel – an diese verdammten Vögel –, die Riesen in die Luft heben können, als wären es Kinder?«
Sein Freund zog eine Grimasse, als er daran dachte – an den Schatten der Schwingen, die den ganzen Himmel zu überspannen schienen. »Die Roks sind nicht mehr da«, sagte Gabriel ohne große Überzeugung.
»Ja, vielleicht«, gab Clay zu. »Aber sind auch die Raske nicht mehr da? Und die Yethiks? Und die Oger-Clane? Und was ist mit dem tausend Meilen breiten Wald? Ist der noch da? Erinnerst du dich überhaupt an das Wyld, Gabe? An Bäume, die gehen können; an Wölfe, die sprechen – und, he, weißt du, ob die Zentaurenstämme noch immer Menschen in die Falle locken und verspeisen? Ich weiß es nämlich – es ist nach wie vor so! Und dabei habe ich die verdammte Fäule noch gar nicht erwähnt. Und du willst mich bitten, dorthin zu gehen? Durch dieses Gebiet zu spazieren?«
»Es wäre schließlich nicht das erste Mal«, rief Gabriel ihm in Erinnerung. »Weißt du nicht mehr, dass man uns die Könige des Wyld genannt hat?«
»Ja, das stimmt. Als wir zwanzig Jahre jünger waren. Als uns der Rücken noch nicht jeden Morgen wehgetan hat und wir nicht fünfmal in der Nacht aufstehen mussten, um zu pissen. Aber die Zeit hat das getan, was sie am besten kann, nicht wahr? Sie hat uns fertiggemacht. Sie hat uns gebrochen. Wir sind alt geworden, Gabriel. Zu alt, um das zu tun, was wir früher getan haben, wie gut wir darin auch immer gewesen sein mögen. Wir sind zu alt, um das Wyld zu durchqueren, und zu alt, um noch etwas zu erreichen, selbst wenn wir die Durchquerung schaffen sollten.«
Den Rest sprach er erst gar nicht aus. Falls es ihnen tatsächlich gelingen sollte, nach Castia zu gelangen, der Belagerungshorde zu entgehen und in die Stadt einzudringen, war es sehr wahrscheinlich, dass Rose zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben war.
Gabriel beugte sich noch weiter vor. »Sie lebt, Clay.« Seine Augen waren wieder wie aus Stahl, aber die Tränen, die in ihnen aufstiegen, sprachen seiner Gewissheit Hohn. »Ich weiß, dass es so ist. Schließlich habe ich ihr das Kämpfen beigebracht. Sie ist genauso gut, wie ich es damals war. Vielleicht sogar besser. Sie hat ganz allein einen Zyklopen zur Strecke gebracht!«, sagte er, aber es klang, als versuchte er nicht nur Clay, sondern auch sich selbst zu überzeugen. »Es heißt, dass viertausend die Schlacht überlebt und Castia erreicht haben. Viertausend! Rosie hat das geschafft. Natürlich hat sie es geschafft.«
»Ja, vielleicht hat sie das«, sagte Clay. Was hätte er auch sonst sagen sollen?
»Ich muss jetzt gehen«, meinte Gabriel. »Ich muss versuchen, sie zu retten. Und ich weiß durchaus, dass ich alt bin. Ich weiß, dass ich nicht mehr der bin, der ich einmal war. Ich bin nicht mal mehr ein Schatten meines alten Selbst«, gestand er traurig ein. »Ich vermute, das ist keiner von uns. Aber ich bin ihr Vater – ein schlechter Vater, ja schon, denn ich habe sie ziehen lassen, aber ich bin nicht so schlecht, dass ich jetzt herumlungere und über meinen wehen Rücken jammere, während sie in der Falle sitzt und in einer Stadt verhungert, die eine halbe Welt entfernt liegt. Allerdings kann ich es nicht allein schaffen.« Er lachte verbittert. »Selbst wenn ich es mir leisten könnte, Söldner anzuheuern, bezweifle ich, dass ich welche finde, die zu einem solchen Abenteuer bereit wären.«
Da hat er recht, dachte Clay.
»Du bist meine einzige Hoffnung«, sagte Gabriel. »Ohne dich – ohne die Truppe – bin ich verloren. Und Rose ist es auch.« Ein Schweigen setzte ein, das schwer vor Erwartung war. Dann fügte er hinterhältig hinzu: »Wie wäre es wohl, wenn es sich um Tally handelte?«
Lange sagte Clay nichts. Er lauschte auf die knarrenden Bretter seines Hauses. Dabei starrte er die leeren Schüsseln an und auch die hölzernen Löffel, die auf ihren Rändern lagen. Er betrachtete die Tischplatte. Er sah Gabriel an, und Gabriel erwiderte seinen Blick. Er beobachtete, wie sich der Brustkorb des Mannes hob und senkte, hob und senkte und merkte, dass sein Herz offenbar hämmerte, während Clays eigenes leise schlug. Er fragte sich, ob ein so einfaches Organ (nur ein faustgroßer, blutgefüllter Muskel) eine Vorahnung dessen haben könnte, was der Verstand noch nicht wusste.
»Es tut mir leid, Gabe.«
Sein Freund saß einfach nur da. Zuerst runzelte er die Stirn, dann zeigte er dieses seltsame, verwelkte Lächeln.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte Clay noch einmal.
Eine Weile verging, und Gabriel … Gabriel sah ihn nur an, hielt den Kopf ein wenig schräg und sagte nach einer schieren Ewigkeit: »Das weiß ich.«
Er stand auf. Das Geräusch des zurückgeschobenen Stuhls war nach dem langen Schweigen zwischen ihnen so laut wie ein Falkenschrei.
»Du kannst hierbleiben«, bot Clay an, aber Gabriel schüttelte den Kopf.
»Ich gehe. Ich habe meine Tasche auf der Treppe stehen lassen. Gibt es im Ort eine Herberge?«
Clay nickte. »Gabriel«, begann er und versuchte zu erklären … Eigentlich wusste er nicht einmal genau, was er erklären wollte. Vielleicht dass es ihm leidtat (noch einmal). Dass er es nicht riskieren durfte, Ginny zu verlieren oder Tally ohne Vater zurückzulassen, wenn er nach Westen ging und dort vielleicht das Schlimmste eintrat (und es würde eintreten, dessen war er sich sicher). Dass er sich hier in Decktal wohlfühlte. Dass er nach so vielen rastlosen Jahren endlich zufrieden war. Und dass ihn der Gedanke, das Herzwyld zu durchqueren und sich auch nur in die Nähe von Castia und der Belagerungshorde zu begeben, furchtbar erschreckte.
Ich habe Angst, wollte er sagen, aber er konnte es nicht.
Gnädigerweise kam ihm Gabriel zuvor. »Sag Ginny, dass ihr Eintopf köstlich war«, bat er. »Und grüß deine Tochter von Onkel Gabe.«
Biete ihm Stiefel an, drängte etwas in Clays Gedanken. Oder wenigstens einen Mantel. Wasser oder Wein für die Straße. Doch er sagte nichts, sondern saß nur da, während Gabriel die Tür öffnete. Kühle Luft strömte herein. Draußen rauschte der Wind in den Bäumen. Und im hohen Gras war ein Chor von hunderttausend Grillen zu hören.
Griff hob den Kopf auf seiner Decke, sah Gabriel beim Verlassen des Hauses zu und schlief sofort wieder ein.
Gabriel blieb auf der Schwelle stehen und warf einen Blick zurück. Jetzt kommt sie, dachte Clay. Die letzte Bitte. Die beißende Bemerkung, dass er mir helfen würde, wenn es andersherum wäre. Neben Vellichor waren Worte stets Gabes schärfste Waffe gewesen. Damals hatte er ihre Truppe angeführt. Er war ihre Stimme gewesen. Doch alles, was er sagte, bevor er durch die Tür trat und sie hinter sich schloss, war: »Du bist ein guter Mann, Clay Cooper.«
Einfache Worte. Freundliche Worte sogar. Nicht das Messer, das er erwartet hatte. Und auch nicht das zustoßende Schwert.
Dennoch taten sie weh.
Als seine Tochter hereinkam, beharrte sie darauf, ihm sogleich die Frösche zu zeigen, die sie eingesammelt hatte. Sie warf ihre Beute auf den Tisch, bevor ihre Mutter sie davon abhalten konnte. Einer der vier, ein großer gelber Knabe mit Höckern an den Stellen, wo später die Flügel wachsen würden, versuchte sich zu retten. Er sprang auf den Boden, erstarrte aber, als Griff bellend auf ihn zulief. Tally hob ihn sofort auf und gab ihm einen ermahnenden Klaps auf den Kopf, bevor sie ihn wieder zu den anderen setzte. Diesmal regte er sich nicht mehr; entweder war er zu benommen oder zu erschrocken dazu.
»Du musst den Tisch scheuern, bevor du zu Bett gehst«, warnte Ginny.
Ihre Tochter zuckte die Achseln. »Ja. Papa, rat mal, wie viele Frösche ich gefunden habe!«
»Wie viele?«, fragte Clay.
»Nein, du musst raten!«
Er betrachtete die vier Frösche auf dem Tisch. »Hm … einen?«
»Nein! Mehr als einen!«
»Hm … fünfzig?«
Tally kicherte und gebot mit der Hand einem der Frösche Einhalt, als sich dieser auf den Rand der Tischplatte zubewegte. »Nicht fünfzig! Ich habe vier, du Dummer. Kannst du nicht zählen?«
Mit dem strahlenden Stolz eines Pferdehändlers führte sie ihre amphibischen Gefangenen nacheinander vor, betonte die Besonderheiten jedes einzelnen und nannte auch ihre Namen. Sie hielt den großen Gelben mit zwei Händen fest und hob ihn in die Luft, damit Clay ihn genau sehen konnte.
»Das hier ist Bert. Er ist gelb, und Mama sagt, er wird Flügel haben, wenn er erwachsen ist. Ich habe ihn für Onkel Gabriel mitgebracht.« Tally sah sich um, als bemerkte sie jetzt erst, dass Onkel Gabriel nicht da war. »Wo ist er denn? Schläft er?«
Clay tauschte einen raschen Blick mit Ginny. »Er ist gegangen. Ich soll dich von ihm grüßen.«
Seine Tochter runzelte die Stirn. »Und … kommt er zurück?«
Vermutlich nie mehr, dachte er. »Das hoffe ich«, sagte er.
Es dauerte einen Augenblick, bis Tally diese Nachricht verarbeitet hatte. Sie schaute auf den Frosch in ihren Händen, dann grinste sie breit. »Wenn er zurückkommt, wird Bert schon Flügel haben!«, verkündete sie, und die Knötchen auf Berts Rücken zuckten wie zur Bestätigung.
Ginny trat neben Tally und glättete ihr die Haare, so wie sie es auch bei Clay zu tun pflegte. »Also gut, mein Kleines, jetzt ist es Zeit zum Schlafengehen. Deine Freunde können inzwischen draußen warten.«
»Aber Mama, dann werde ich sie doch verlieren«, protestierte Tally.
»Zweifellos wirst du sie morgen wiederfinden«, sagte ihre Mutter. »Ich bin sicher, sie werden sich sehr auf dich freuen.«
Clay lachte, und Ginny grinste.
»Das werden sie«, versicherte ihre Tochter ihnen. Sie nahm einen Frosch nach dem anderen auf und trug sie nach draußen. Dort sagte sie ihnen Lebewohl und gab jedem einen Kuss auf die Stirn, bevor sie die Tierchen freiließ. Ginny zuckte bei jedem Kuss zusammen, und Clay war froh, dass sich keiner der Frösche in einen Prinzen verwandelte. Für heute hatte er genug Gesellschaft gehabt, und überdies war kein Eintopf mehr übrig.
Nachdem Tally den Tisch gescheuert hatte, ging sie sich selbst waschen. Griff trippelte hinter ihr her. Ginny setzte sich an den Tisch, nahm Clays große Hand zwischen die ihren und drückte sie. »Sag es mir«, meinte sie.
Und er sagte es ihr.
Tally schlief. Die Laterne neben ihrem Bett, deren Schirm aus einer Metallblende mit gezackten Löchern bestand, warf flackernde Sternbilder auf die Wände. Ihr Haar schimmerte im sanften Licht; durch das matte Braun, das sie von ihrem Vater geerbt hatte, zogen sich goldene Strähnen, die von ihrer Mutter stammten. Tally hatte darauf bestanden, eine Geschichte erzählt zu bekommen, bevor sie ins Bett gegangen war. Sie hatte etwas über Drachen hören wollen, aber Drachen waren verboten, weil sie davon Albträume bekam. Dennoch fragte Tally immer wieder nach ihnen. Es war tapfer von ihr. Stattdessen bot er ihr Meerjungfrauen an, und einen Hydrachen, der, wie er mitten in der Geschichte erkannte, so etwas wie sieben Drachen gleichzeitig war, und außerdem hoffte er, dass sie nicht schreiend aufwachte.
Der größte Teil davon war eine wahre Geschichte, auch wenn Clay sie ein wenig ausschmückte (er sagte ihr, er habe selbst und höchstpersönlich den tödlichen Schlag gegen den Hydrachen geführt, wo es doch in Wirklichkeit Ganelon gewesen war) und ein paar Einzelheiten unterschlug, die seine neunjährige Tochter – und auch ihre Mutter – nicht unbedingt wissen mussten. Es reichte zu sagen, dass die Meerjungfrauen danach überaus dankbar und huldreich gewesen waren, was Clays recht umfassende Kenntnis der bekanntermaßen so rätselhaften Anatomie dieser Wesen erklärte. Ehrlich gesagt verstand er sie aber noch immer nicht ganz.
Er ließ die Geschichte ins Leere laufen, als er bemerkte, dass Tallys Atemzüge längst tiefer geworden waren und er nur noch mit sich selbst sprach. Nun saß er da und betrachtete ihr Gesicht – den winzigen Mund, die geröteten Wangen, die kleine, vollkommen schöne Nase, die wie aus Porzellan wirkte – und wunderte sich darüber, dass Clay Cooper, wenn auch mit Ginnys offensichtlichem Zutun, etwas so außerordentlich Schönes hatte hervorbringen können. Unwillkürlich streckte er den Arm aus und ergriff ihre Hand. Ihre Finger schlossen sich unbewusst um die seinen, und er lächelte.
Dann flatterten ihre Lider, und sie öffnete die Augen. »Papa?«
»Ja, mein Engel?«
»Wird mit Rosie alles wieder gut werden?«
Sein Herzschlag setzte aus. Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder, während er nach einer passenden Antwort suchte. »Hast du vorhin gelauscht?«, fragte er. Natürlich hatte sie das getan. Sie hatte es sich angewöhnt, ihn und Ginny zu belauschen, seit sie eines Nachts gehört hatte, dass sich die beiden flüsternd darüber unterhalten hatten, ihrer Tochter zum Geburtstag ein Pony zu schenken.
Tally nickte schlaftrunken. »Sie steckt in Schwierigkeiten, nicht wahr? Wird alles wieder in Ordnung kommen?«
»Ich weiß es noch nicht«, antwortete Clay. Ja, hätte er sagen sollen. Natürlich wird es das. Man durfte Kinder doch belügen, wenn es zu ihrem Besten war, oder?
»Aber Onkel Gabe geht zu ihr und rettet sie«, murmelte Tally. Ihre Lider senkten sich, und Clay zögerte einen Moment und hoffte, dass sie wieder eingeschlafen war. »Das ist doch richtig, oder?«, fragte sie und öffnete erneut die Augen.
Diesmal war er bereit für eine Lüge. »Das ist richtig, Liebes.«
»Gut«, sagte sie. »Aber du gehst nicht mit ihm?«
»Nein«, sagte er sanft. »Ich gehe nicht mit.«
»Aber du würdest doch kommen, wenn ich in Schwierigkeiten wäre, Papa, oder? Wenn ich weit weg von bösen Leuten gefangen worden wäre? Dann würdest du kommen und mich retten?«
Ein Schmerz stach in seine Brust; es war eine gärende Fäule, die Scham, Trauer oder Reue sein mochte – vermutlich war es sogar alles gleichzeitig. Er dachte an Gabriels brüchiges Lächeln und an die Worte, die sein ältester Freund gesagt hatte, bevor er aufgebrochen war.
Du bist ein guter Mann, Clay Cooper.
»Wenn es um dich ginge«, sagte er mit einer Stimme, die zwar leise, aber dennoch heftig klang, »dann könnte mich nichts in der Welt aufhalten.«
Tally lächelte und packte seine Hand noch fester. »Du solltest auch Rosie retten«, sagte sie.
Er brach zusammen, biss auf die Zähne und unterdrückte ein Schluchzen, das ihn zu ersticken drohte. Schließlich schloss er gegen die aufquellenden Tränen die Augen – doch zu spät.
Clay war nicht immer ein guter Mann gewesen, aber er hatte ohne Zweifel versucht, einer zu sein. Er hatte seine Neigung zur Gewalt dadurch gezügelt, dass er sich bei der Wache eingeschrieben hatte und seine beschränkten Fähigkeiten zum Nutzen eines größeren Guten einsetzte. Er tat sein Bestes, sich einer Frau wie Ginny als würdig zu erweisen, und auch seiner Tochter, seinem geliebten Mädchen, die sein kostbarstes Vermächtnis war, der Fleck aus Gold, der aus dem schlammigen Fluss seiner Seele herausgefiltert worden war.
Aber es gab auch Maßeinheiten für das Gute. Man konnte das eine gegen das andere abwägen und herausfinden, dass das eine schwerer wog, wenn es vielleicht auch nur um das Gewicht einer Feder ging. Und darum ging es doch, nicht wahr? Man musste eine Wahl treffen – die richtige Wahl, und das war eine Last, die nur wenige tragen konnten.
Nichts zu tun und einfach dazusitzen – aus welchem Grund auch immer –, wenn der älteste und geschätzteste Freund das Einzige verloren hatte, das er je geliebt hatte, war nicht gerade das, was ein guter Mann tat. Auch wenn er sonst vielleicht nicht viel wusste – dies eine wusste Clay nur allzu gut.
Und seine Tochter wusste es ebenfalls.
»Papa, warum weinst du?«, fragte sie und zog die Stirn kraus.
Er nahm an, dass das Lächeln, das er nun aufsetzte, ungefähr so wirkte wie das, das Gabe vorhin auf der Treppe gezeigt hatte: brüchig und gebrochen und auch traurig. »Weil ich dich sehr vermissen werde«, sagte er.
4
AUF DER STRASSE
Auf dem Hügel, von dem aus man über das Gehöft blicken konnte, sagte er Ginny Lebewohl. Clay hatte angenommen, sie würde ihn an der Tür verabschieden oder spätestens dort umkehren, wo der Pfad endete und die lange Straße begann, und diesen Augenblick hatte er so gefürchtet wie ein Mann, der darauf wartet, dass ihn der Henker mit der schwarzen Kapuze aufs Schafott winkt – jetzt bist du an der Reihe, alter Knabe! Doch stattdessen blieb sie bei ihm und redete leise über Belanglosigkeiten, während sie Hand in Hand den Hügel hinaufstiegen. Bald nickte er eifrig und kicherte über etwas, von dem er später in der Nacht nicht mehr wusste, was es gewesen war. Fast hätte er vergessen, dass er ihre Stimme vielleicht nie wieder hören und auch nie wieder das Feuer der Morgensonne in ihren Haaren sehen würde, so wie jetzt, als sie die Hügelkuppe erreicht hatten und die Welt sich golden und grün dahinter ausdehnte.
Als sie einige Stunden zuvor in der grauen Dunkelheit vor dem Anbruch der Morgendämmerung noch immer wach gewesen waren, hatte Ginny ihn gewarnt, sie werde nicht weinen, wenn sie ihm Lebewohl sagte, denn so etwas liege nicht in ihrer Natur. Aber das heiße nicht, dass sie ihn nicht vermisste. Doch nachdem sie ihm auf der Hügelkuppe bei Sonnenaufgang gesagt hatte, was für ein guter Mann er sei, ging sie weiter und weinte, genauso wie er. Als ihre Tränen getrocknet waren, nahm sie sein Gesicht zwischen die Hände und sah ihm tief in die Augen. »Komm zurück zu mir, Clay Cooper«, sagte sie zu ihm.
Komm zurück zu mir.
Daran würde er sich erinnern, bis zum bitteren Ende.
Gabriel hatte offenbar kein Zimmer im Königskopf gemietet, aber Shep, der Wirt, dessen Oberkörper stets hinter dem Holz der Theke zu sehen war, sodass sich Clay manchmal fragte, ob der Mann überhaupt Beine besaß, erwähnte, dass er einen leeren Stall einem schäbigen alten Barden im Austausch für ein paar Geschichten gegeben hatte. »Und es waren verdammt gute«, fügte Shep hinzu und säuberte dabei einige Krüge in einem Spülstein voll von undurchsichtigem Wasser. »Über Freunde, die zu Feinden werden, und über Feinde, die zu Freunden werden. Er hat einen Drachen so genau beschrieben, dass man glauben konnte, er hätte höchstpersönlich gegen das Untier gekämpft! Und er hat auch traurige Geschichten erzählt. Richtig ergreifende Sachen. Der Kerl musste sogar manchmal selbst weinen.«
Der Mann im Stall war tatsächlich Gabriel. Der einst so gepriesene Held, der mit Königen Wein getrunken (und mit Königinnen das Bett geteilt) hatte, lag nun, um sein Gepäck gerollt, auf einem Haufen aus urindurchtränktem Stroh. Er schrie auf, als Clay ihn anstieß und weckte, als wäre er aus den Fängen eines schrecklichen Albtraums gerissen worden – was vermutlich auch der Fall war. Er schleifte seinen alten Freund in den Schankraum und bestellte Frühstück für sie beide. Gabriel zuckte nervös, bis das Essen von einer von Sheps milden, dunkelhaarigen Töchtern gebracht wurde, und dann fiel er genauso heißhungrig darüber her wie über Ginnys Eintopf am vergangenen Abend.
»Ich habe dir frische Kleidung mitgebracht«, sagte Clay. »Und neue Stiefel. Und wenn du mit dem Essen fertig bist, werde ich Shep bitten, dir ein Bad einzulassen.«
Gabe grinste ihn schief an. »Ist es so schlimm?«
»Ziemlich schlimm«, sagte Clay, und Gabriel zuckte zusammen.
Danach stocherte Clay in seiner Mahlzeit herum und fragte sich, ob er damit nicht etwa schon genug getan hätte. Nun konnte er Gabe mit vollem Magen und frischer Kleidung auf den Weg schicken und selbst nach Hause zurückgehen. Er könnte Ginny sagen, dass er keine Spur von seinem alten Freund gefunden hatte, und sie würde sagen: Na gut, du hast es wenigstens versucht, und er würde sagen: Allerdings, und dann würde er neben sie ins Bett schlüpfen, wo es gemütlich und warm war, und vielleicht …
Gabriel beobachtete ihn so eindringlich, als wäre Clays Schädel ein Fischglas, in dem seine Gedanken deutlich sichtbar umherschwammen. Sein Blick glitt zu dem schwer aussehenden Gepäck auf der Bank ihm gegenüber und dann zu dem Rand des großen schwarzen Schildes, den sich Clay auf den Rücken gebunden hatte. Schließlich starrte er auf seinen leeren Teller hinunter, und nach einem langen Schweigen schniefte er und fuhr sich mit dem schmutzigen Ärmel über die Augen.
»Danke«, sagte er.
Clay seufzte und dachte: So viel zum Weg nach Hause. »Nicht der Rede wert«, sagte er.
Auf dem Weg hinaus aus Decktal hielten sie beim Wächterhaus an, damit Clay seinen Umhang abgeben und den Sergeanten darüber in Kenntnis setzen konnte, dass er den Ort verließ.
»Wohin gehst du?«, fragte der Sergeant. Sein wahrer Name war für jeden ein Geheimnis – mit Ausnahme seiner Frau, die aber vor einigen Jahren gestorben war und das Geheimnis mit ins Grab genommen hatte. Er war ein Mann von großer Rechtschaffenheit, schwacher Fantasie und unbestimmbarem Alter und hatte ein Gesicht, das wie ein an der Sonne spröde gewordenes Leder wirkte, sowie einen eisengrau gesträhnten Bart, dessen Enden dick wie Pferdeschweife waren und ihm fast bis zur Hüfte reichten. Soweit man wusste, hatte er nie in einer richtigen Armee gedient oder als Söldner gekämpft oder irgendetwas anderes getan, als über den Ort Decktal zu wachen – sein ganzes Leben lang.
Clay hatte keine Lust, ihre Reise in allen hoffnungslosen Einzelheiten zu beschreiben, und sagte daher nur: »Nach Castia.«
Die Männer, die an beiden Seiten des Tores postiert waren, keuchten überrascht auf, aber der Sergeant strich sich nur über den mächtigen Bart und starrte Clay durch die Höcker hindurch an, die ihm als Augen dienten und aus den Falten des Gesichts herausragten. »Hm«, sagte er. »Weit weg.«
Weit weg? Der alte Mann hätte genauso gut sagen können, dass die Sonne hoch am Himmel stand.
»Ja«, erwiderte Clay.
»Dann nehme ich jetzt dein Grün entgegen.« Der Sergeant streckte die schwielige Hand vor, und Clay gab ihm seinen Wächterumhang. Er reichte ihm auch das Schwert, aber der alte Mann schüttelte den Kopf. »Behalte es.«
»Auf der Straße nach Süden sind einige Leute ausgeraubt worden«, sagte einer der Wächter.
»Und bei Tassels Hof ist ein Zentaur gesichtet worden«, fügte der andere hinzu.
»Hier.« Der Sergeant drückte Clay etwas in die Hände. Es war ein Messinghelm, geformt wie eine Suppenschüssel, mit einem ausgestellten Nasenschutz und einer eingearbeiteten Lederkappe. Die Götter wussten genau, wie sehr Clay Helme hasste, und dieser hier war noch hässlicher als die meisten anderen.
»Danke«, sagte er und steckte sich den Helm unter den Arm.
»Warum setzt du ihn nicht auf?«, fragte Gabriel.
Clay bedachte seinen sogenannten Freund mit einem unheilvollen Blick. Die Frage hatte ernst geklungen, aber Clay erkannte, dass sich Gabriels Mundwinkel belustigt hoben. Auch Gabriel wusste, wie sehr Clay es verabscheute, einen Helm zu tragen. »Wie bitte?«, fragte er, als hätte er Gabriel nicht richtig verstanden.
»Du solltest ihn sofort aufsetzen«, drängte ihn Gabe, doch diesmal verriet ihn seine Stimme, die am Ende des Satzes schriller wurde, während er sich bemühte, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen.
Hilflos blickte sich Clay um, aber er und Gabe waren die beiden Einzigen, die diesen Witz verstanden. Die Männer am Tor sahen ihn erwartungsvoll an. Der Sergeant nickte.
Also setzte Clay den Helm auf und erzitterte, als sich das vom Schweiß anderer Männer verformte Leder um seinen Kopf schmiegte. Der Nasenschutz drückte und quetschte schmerzhaft, und Clay blinzelte, während sich seine Augen allmählich an den schwarzen Balken zwischen ihnen gewöhnten.
»Sieht gut aus«, sagte Gabriel und kratzte sich die Nase, womit er sein Grinsen überdecken wollte.
Der Sergeant sagte nichts, aber etwas – ein Glitzern in seinen krähenscharfen Augen – erregte in Clay den Verdacht, dass ihn der alte Mann doch an der Nase herumgeführt hatte.
Clay lächelte Gabriel gequält an. »Können wir jetzt endlich gehen?«, fragte er.
Sie traten durch das Tor. Nach etwa fünfzig Ellen wandte sich der Weg hinter einem Hain aus dicht beieinanderstehenden grünen Föhren nach Süden. Auf der anderen Seite der Straße erhob sich ein kleiner Hügel, und in dem Augenblick, in dem sie die Biegung umrundet hatten, riss sich Clay den Helm vom Kopf und schleuderte ihn hoch in die Luft. Er prallte zweimal vom Hang ab, schlitterte in langem Bogen herunter und kam schließlich zur Ruhe. Viele andere Helme rosteten dort auf dem Boden, waren von Flechten überwachsen oder halb im Schlamm vergraben. Manche waren zur Heimstatt von Tieren geworden, und als sich der Bronzehelm, den Clay weggeworfen hatte, nicht mehr bewegte, landete ein Zaunkönig auf seinem breiten Rand und beschloss sofort, dass er den geeigneten Ort für ein Nest gefunden hatte.
Nebeneinander gingen Clay und Gabe den erdigen Weg entlang. Zu beiden Seiten erhob sich ein Wald aus hohen weißen Birken und gedrungenen grünen Erlen. Die beiden Männer schwiegen für eine Weile und waren in den schrecklichen Labyrinthen ihrer eigenen Gedanken verloren. Gabriel trug keinerlei Waffen und hatte als Gepäck lediglich einen anscheinend leeren Sack dabei. Clays eigene Tasche war bis zum Bersten gefüllt mit Reservekleidung, einem warmen Mantel, Mahlzeiten für einige Tage und genügend Socken, um die Füße einer ganzen Armee warm zu halten. Das Schwert der Wächter hing an seiner Hüfte, und Schwarzherz hatte er sich über die rechte Schulter geschlungen.
Der Schild war nach einem tobenden Treanten benannt worden, der einen lebendigen Wald auf eine monatelange Mordorgie durch das südliche Agria geführt hatte. Schwarzherz und seine Baumarmee hatten mehrere Dörfer ausgelöscht, bevor sie Hohlberg belagert hatten. Auch wenn noch ein paar tapfere Verteidiger übrig geblieben waren, die ihre Häuser schützen wollten, waren doch Clay und seine Truppe die einzigen richtigen Kämpfer im Ort gewesen. Die Schlacht, die beinahe eine ganze Woche gedauert und einen der zahlreichen Barden der Saga das Leben gekostet hatte, diente als Gegenstand von mehr Liedern, als man an einem Tag singen konnte.
Clay selbst hatte Schwarzherz zur Strecke gebracht, und aus dem Leichnam des Treanten hatte er das Holz für seinen Schild geschlagen, der ihm öfter das Leben gerettet hatte als all seine Kampfgefährten zusammengenommen, und aus diesem Grund war er Clays wertvollster Besitz. Die Oberfläche erzählte die Geschichte zahlloser Kämpfe: hier eingekerbt durch die rasiermesserscharfen Krallen einer brütenden Harpyenmutter, dort versengt von dem Säureatem eines mechanischen Bullen. Sein Gewicht wirkte wie ein vertrauter Trost, selbst wenn der Riemen bereits ein wenig scheuerte, ihm der obere Rand andauernd gegen den Hinterkopf stieß und seine Schultern unter dem Gewicht wie die eines Ackergauls schmerzten, der vor einen Wagen mit Granit gebunden war.
»Ginny scheint es gut zu gehen«, sagte Gabriel und riss damit das lange Schweigen zwischen ihnen ein.
»Hm«, sagte Clay in dem Versuch, es wieder aufzurichten.
»Wie alt ist Tally jetzt?«, bedrängte ihn Gabe. »Sieben?«
»Neun.«
»Neun!« Gabriel schüttelte den Kopf. »Wo ist bloß die Zeit geblieben?«
»Irgendwo an einem warmen Ort«, vermutete Clay.
Schweigend schritten sie wieder eine Weile dahin, aber Clay konnte jetzt sehen, dass sein Freund immer unruhiger wurde. Gabriel war nie sehr zurückhaltend und in sich gekehrt gewesen, was der wesentliche Grund dafür gewesen war, dass er und Clay Freunde geworden waren.
»Und du lebst noch immer in Fünfhof?« Wenn sie schon sprechen mussten, dann wollte Clay wenigstens das Thema von seiner Frau und seiner Tochter weglenken, denn er empfand bereits eine Sehnsucht nach ihnen, die er nie für möglich gehalten hätte.
»Ich habe dort gelebt«, sagte Gabriel. »Aber du weißt ja, wie es ist.«
Clay wusste dies zwar keineswegs, doch er hatte das Gefühl, dass Gabriel keine weiteren Ausführungen dazu machen wollte.
»Ich habe die Stadt vor etwa zwei Jahren verlassen. Danach habe ich eine Weile in Regenbach gewohnt und ein paar Einzelaufträge angenommen, um die Miete bezahlen zu können und etwas zu essen auf den Tisch zu bekommen.«