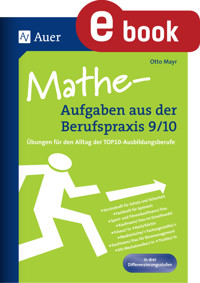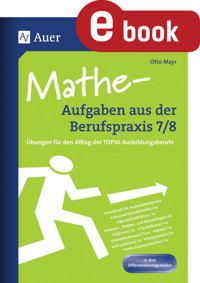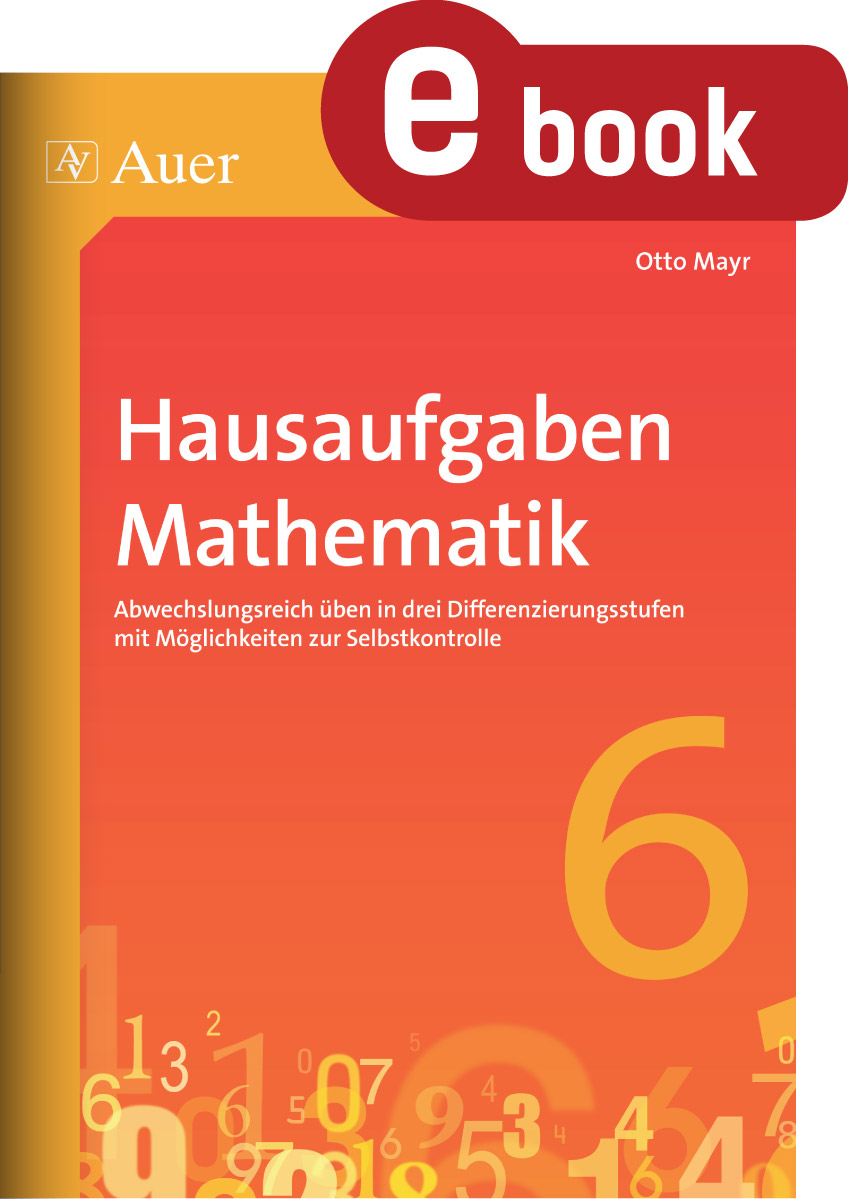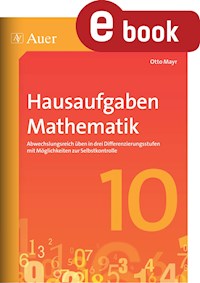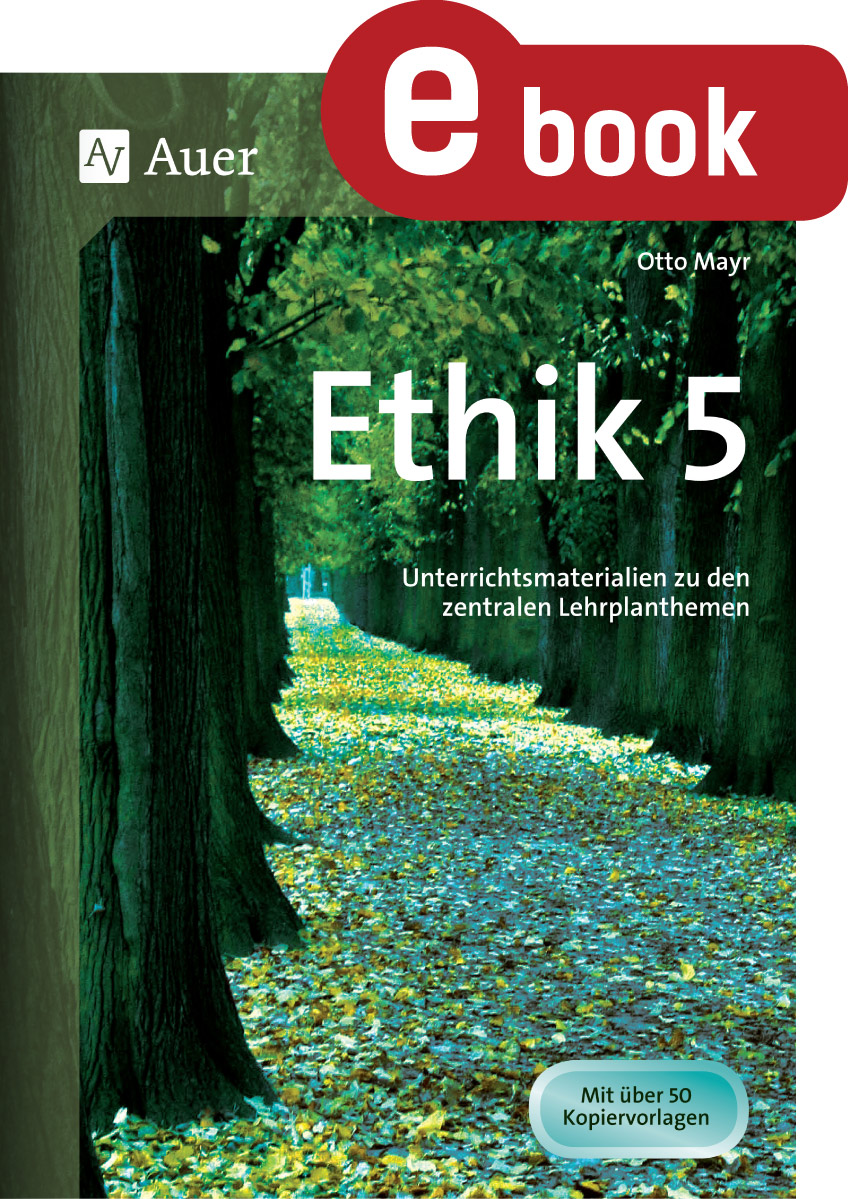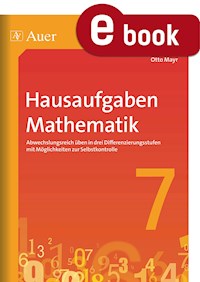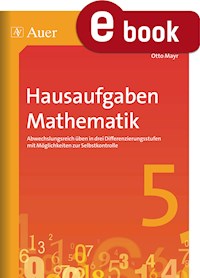Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Inselfestung Lindau wurde gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges zwei Monate lang, im Januar und Februar 1647, von der königlich schwedischen Armee belagert. Das Buch beleuchtet die Geschichte dieser Belagerung und ihrer Vorgeschichte. Lindau war als Freie Reichsstadt dem Kaiser zu Gehorsam und Treue verschworen. Sie stand aber als rein evangelische Stadt im Widerspruch zum Kriegsziel des Kaisers, das Reich zu rekatholisieren. Lindau versuchte darum, im Krieg neutral zu bleiben. Die kaiserliche Regierung war schließlich nicht bereit, diesen Widerspruch zu dulden, und belegte die Festung 1628 mit einer kaiserlichen Garnison. Mit dem Einfall der Schweden 1632 kam der Krieg nach Lindau. Vom Frühling 1632 bis zur Schlacht von Nördlingen im September 1634, als die Schweden sich nach Vernichtung ihrer Armee nach Norddeutschland zurückzogen, stand die Stadt unter ständiger Bedrohung einer Belagerung. Im Spätsommer 1646 fielen die Schweden, unter General Carl Gustav Wrangel, ein zweites Mal in Oberschwaben ein. Anfang Januar 1647, nach der dramatischen Eroberung von Bregenz, standen sie wieder vor Lindau. Diesmal entschlossen sich die Schweden aber zu einer kunstgerechten Belagerung. Die Lindauer verloren nicht die Nerven, sondern verteidigten sich - erfolgreich - mit kaltblütiger Klugheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:www.allitera.de
Dezember 2016 Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2016 Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung unter Verwendung des Bildes »Die Belagerung Lindaus in Vogelschau von Süden«. Kupferstich von Matthäus Merian nach Vorlage von Georg Wilhelm Kleinsträttl, 1707.
Umschlag innen links: »Lindau und Hinterland«, 1628. Kupferstich von Johann Morell, 1643, nach der verschollenen Landtafel von Johann Andreas Rauh, Wangen, 1628.
Umschlag innen rechts: »Lindau im Jahre 1823«. Der erste wissenschaftlich präzise Stadtplan zeigt die Stadt zwei Jahrhunderte nach dem Dreißigjährigen Krieg. Außer dem neuen Hafen und den modernen Befestigungen am Landtor ist die Stadt noch praktisch unverändert im Zustand von ca. 1650.
Frontispiz: »Belagerung der Stadt Lindau durch die Schweden 1646«. Ölgemälde nach Vorlage eines Flugblatts von Lukas Schnitzer, Maler unbekannt, 1647. Oben (von links) Porträts von Truchsess Maximilian Willibald von Waldburg-Wolfegg, Kaiser Ferdinand III., Baron Eusebius von Crivelli. Die Schneelage zeigt den niedrigen Wasserstand des Sees.
ISBN print 978–3-86906–888–6 ISBN PDF 978–3-86906–956–2 ISBN ePub 978–3-86906–957–9 Printed in Europe
INHALT
Vorwort
1. Lindau zu Kriegsbeginn (1618)
1.1 Reichsstadt und Kaiser
1.2 Ein Krieg in Böhmen
1.3 Die Freie Reichsstadt im Krieg
1.4 Die Befestigungen und die Brücke
1.5 Truppendurchzüge
2. Spannungen mit Habsburg (1619–1625)
2.1 Lindau und die Protestantische Union
2.2 Erzherzog Leopold
2.3 Der Bundner Krieg
2.4 Eine Kaiserliche und Erzfürstliche Kommission in Lindau
3. Der Neukomm-Aufstand und seine Folgen (1626–1628)
3.1 Die Wiedereinführung der Privatbeichte
3.2 Neukomms Rebellion gegen die Regierung der Stadt
3.3 Erfolg des Aufstands und Kapitulation des Stadtrats
3.4 Kaiserliche Untersuchungskommission
3.5 Abschluss und Urteilsverkündung
4. Kaiserliche Festung (1628–1632)
4.1 Die Stadt unter militärischem Kommando
4.2 Das Leben in der Festung
5. Ein Wendepunkt des Krieges (1630)
5.1 Der Mantuanische Erbfolgestreit
5.2 Kaiserliche Fehler
5.3 König Gustav Adolfs Landung in Deutschland
5.4 Lindau in Erwartung der Schweden
6. Schwedischer Einbruch in Oberschwaben (1632–1633)
6.1 Der Vorstoß zum Bodensee
6.2 Die Schweden vor Lindau
6.3 Widerstand in Oberschwaben
6.4 Der Fall Fuchs in Lindau
6.5 Kämpfe in Oberschwaben, Sommer 1632
6.6 Oberschwaben nach Gustav Adolfs Tod, Herbst 1632
7. Kaiserlicher Gegenangriff (1633)
7.1 Rückeroberung von Kempten
7.2 Zweiter Sommer der Schweden in Oberschwaben 1633
7.3 Lindauer Festungsalltag unter den Augen des Feindes
7.4 Der Zug des Herzogs von Feria
7.5 Verhaftung von Oberst König und Ankunft seines Nachfolgers Oberst von Vitzthum
8. Krieg am Bodensee, Liquidierung Wallensteins, Nördlingen (1634)
8.1 Der Krieg am Bodensee im Sommer 1634
8.2 Zusammenarbeit und ihre Grenzen
8.3 Wallensteins Beseitigung
8.4 Wechselwirkungen: Kontributionsdispute und militärischer Einsatz
8.5 Nördlingen
9. Kleinkrieg und politische Vorstöße (1635–1640)
9.1 Der Frieden von Prag und Frankreichs Kriegserklärung
9.2 Lösung von Lindauer Problemen
9.3 Der Hohentwiel
9.4 Diplomatische Missionen der Brüder Valentin und Jakob Heider 1635–1639
9.5 Kaiser Ferdinand III.
9.6 Valentin Heider bei Feldmarschall Geleen
9.7 Verstärkung der Befestigungen
10. Oberst von Waldburg-Wolfegg – Ruhe vor dem Sturm (1640–1646)
10.1 Herkunft und erste Initiativen
10.2 Die kaiserlichen Bodenseefestungen
10.3 Rückgewinnung von Überlingen
10.4 Verstärkung der Befestigungen
10.5 Seekrieg
10.6 Der zweite Einbruch der Schweden in Schwaben
11. Wrangels Marsch zum Bodensee (1646)
11.1 Der junge Wrangel
11.2 Torstenssons Plan
11.3 Winterlager und Aufbruch nach Hessen
11.4 Warten auf Turenne
11.5 Vereinigung mit Turenne und Durchbruch nach Süden
11.6 Die Verheerung von Bayern
11.7 Winterquartier in Oberschwaben
11.8 Bregenz
12. Belagerung und Einschließung von Lindau (von Januar 1647 bis März 1647)
12.1 Lindau vor der Belagerung
12.2 Einschließung
12.3 Oberst Freiherr von Crivelli
12.4 Die Schweden in Bregenz
13. Beschießung und Nahkampf am Brückenkopf (bis März 1647)
13.1 Beginn der Beschießung
13.2 Verlauf und Ergebnisse der Beschießung
13.3 Kämpfe um das Schänzlein
13.4 Abzug der Schweden
13.5 Verluste
14. Kriegsende (1647–1649)
14.1 Lindau nach der Belagerung
14.2 Der Ulmer Waffenstillstand
14.3 Kriegslage am Bodensee
14.4 Größere Feldzüge 1647
14.5 Größere Feldzüge 1648
14.6 Zusmarshausen
14.7 Piccolomini
14.8 Prag
14.9 Der Westfälische Frieden
Quellen und Literatur
Anhang
Abbildungen
Dank
Register
VORWORT
Schon zweimal haben Lindauer Historiker über die Belagerung durch die Schweden im Winter 1647 berichtet. Das erste Mal war 1869, als der Lindauer Theologe Gustav Reinwald im ersten Jahrgang der Schriften des neugegründeten Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung eine glänzende Abhandlung über die Belagerung selbst, sowie über ihren Chronisten Jacob Heider veröffentlichte.1 Mit dieser Arbeit begründete Reinwald eine Tradition von Lindauer Geschichtsschreibung durch Lindauer Historiker. Ein Höhepunkt wurde 1909 erreicht mit der monumentalen Geschichte der Stadt Lindau im Bodensee, herausgegeben von Karl Wolfart2 (ebenfalls ein evangelischer Theologe). Das zweibändige Werk bestand aus einem ersten Band mit einer vollständigen Geschichte der Stadt (773 Seiten) und einem zweiten Band mit vielen Einzeluntersuchungen (470 Seiten). Das ganze Werk, von Lindauer Bürgern verfasst, zeigt hohes wissenschaftliches Niveau. Die Darstellung des Dreißigjährigen Kriegs von Dr. H. Loewe umfasste 58 Seiten, von denen zehn der Belagerung galten. So erscheint es heute, über hundert Jahre später, gerechtfertigt das Thema dieses Krieges wieder von Neuem aufzugreifen, mit besonderer Aufmerksamkeit auf seinem entscheidenden Ereignis: der Belagerung.
Die Frage liegt nahe, was sich seit der Veröffentlichung von Wolfarts Buch geändert hat. Gewiss hat die Geschichtswissenschaft in der Zahl der aktiven Forscher, der Ausbildungsstätten und der Forschungseinrichtungen zugenommen, und die Erforschung der Vergangenheit hat sich zu einem internationalen Gemeinschaftsunternehmen entwickelt. Tiefgreifenden Wandel erfuhr die Geschichtswissenschaft durch die digitale Revolution. Es war ein unauffälliger Wandel, der sich in den letzten rund 30 Jahren auf vielen Ebenen, in vielen, undramatischen, kleinen Schritten vollzog. Es war ein willkommener Wandel, der die Arbeit der Historiker erleichtert und ihre Möglichkeiten erweitert hat. Dieser Wandel ist nicht abgeschlossen, auch lässt sich nicht voraussagen, wohin er noch führen mag. Gewiss ist aber, dass auch eine vergleichsweise unkomplizierte Arbeit, wie die vorliegende, der neuen digitalen Technik viel verdankt.
Am Anfang dieser Arbeit stand eine Vorstellung von der Lindauer Belagerung als einem überschaubaren, wohl abgegrenzten historischen Ereignis, dem man auf beschränktem Raum gerecht werden könnte. Bald ließ sich jedoch erkennen, dass die Belagerung im Grunde ein politisches Ereignis war, dessen Wurzeln weit in die Vergangenheit zurückreichten. Damit begann diese Geschichte, an Umfang zuzunehmen. So beginnt sie mit dem Kriegsausbruch und der Entstehung der Kräfte und Strömungen, die zur Lindauer Belagerung führten. Und da es sich beim Gegner um eine ausländische Armee, die des Königs von Schweden, handelte, wurde es notwendig, ihre verwickelten Bewegungen auch außerhalb Lindaus genauer zu verfolgen. So wuchs die Geschichte von der Lindauer Belagerung im Winter 1647 an zu einer Übersicht über die wichtigeren Kriegsereignisse in Oberschwaben und dem Bodenseegebiet während des ganzen Dreißigjährigen Kriegs.
Dennoch ist dies keine Geschichte der Reichsstadt Lindau im Dreißigjährigen Krieg. Für eine solche würde hier Vieles und Entscheidendes fehlen. Quantitative Betrachtungen – Bevölkerungsstatistiken, Mannschaftsstärken der Truppen, usw. – beschränken sich hier auf Angaben, die in den Quellen sowohl als gesichert als auch verständlich erscheinen. Über die komplexen wirtschaftlichen Grundlagen des Kriegs, über Einkünfte, Abgaben und Kontributionen allgemein, und über die verwickelten finanziellen Abhängigkeiten zwischen Armeen, Städten und herrschaftlichen Regierungen kann diese Darstellung keine befriedigende Aufklärung geben. Ebenso schwierig ist es, die Lebensmittelversorgung von Stadt, Garnison, und durchziehenden Truppen, sowie deren Finanzierung, im Einzelnen zu erklären, ein Thema, über das Lindauer Quellen (namentlich die Lindauer Kriegschronik) ausnahmsweise viel, doch hauptsächlich recht rätselhaftes Material liefern. Bei allen solchen Fragen, die sich zahlenmäßig genau nicht beantworten lassen, musste ich mich mit Schätzungen begnügen.
Der Rolle von Schätzungen im Bereich der quantitativen Angaben ist ähnlich derjenigen der Vermutung oder Spekulation gegenüber historischen Problemen. Spekulationen haben einen schlechten Ruf, weil ihre Ergebnisse gelegentlich mit angeblichen Tatsachen verwechselt werden. Vermutungen sind aber nicht nur zulässig, sondern auch reizvoll, weil sie die Fantasie anregen und notwendig sind für die Aufstellung von Hypothesen und als Ausgangspunkt für sachliche Untersuchungen. Wichtig ist nur, dass Spekulationen als solche deutlich gekennzeichnet sind. Von dieser Möglichkeit wird im Folgenden nicht selten Gebrauch gemacht, nicht zuletzt, um den Leser zu selbstständigem Denken und Stellungnahme herauszuforden.
Zu den Beschränkungen dieser Arbeit gehören gewisse Einseitigkeiten in der Quellenlage. Schon bei den Lindauer Quellen soll man nicht übersehen, dass unsere Zeit- und Augenzeugen ausschließlich dem evangelischen Patriziat angehörten. Allerdings war die ganze Stadt einheitlich evangelisch-lutherischer Konfession. Mangel an Symmetrie fällt auch auf, wenn man die Zugänglichkeit der deutschen, insbesondere der Lindauer Quellen vergleicht mit der schwierigen Erreichbarkeit der schwedischen Quellen. Von den deutschen Quellen ist wahrscheinlich ein großer Teil des relevanten, vorhandenen Materials gesichtet und ausgewertet worden. Ganz anders ist die Lage bei den schwedischen Quellen. Zum einen liegen hier die Schwierigkeiten in der Sprache. Zwar ist es ein Glücksfall, dass Deutsch die offizielle Sprache der schwedischen Armee war, und mindestens vom Offizierscorps einheitlich beherrscht wurde. So ist zum Beispiel die Gesamtausgabe von Oxenstiernas Korrespondenz zum großen Teil in deutscher Sprache veröffentlicht. Die moderne schwedische, wissenschaftliche Literatur ist dagegen in schwedischer Sprache geschrieben, und hier gibt es für den Forscher keinen Ausweg als Schwedisch zu lernen. Größer ist die Schwierigkeit, das schwedische Quellenmaterial kennenzulernen und durchzumustern. Obwohl ich eine ermutigende Menge relevanten Materials auswerten konnte, war dies quantitativ gewiss nur ein Bruchteil alles Vorhandenen. Die Schuld liegt nicht bei den schwedischen Archiven; über ihre Leistungsfähigkeit und Hilfsbereitschaft kann man nur das Beste sagen; sie sind wohl ausgestattet und organisiert, und bereit, einem ausländischen Forscher auch per Post und Internet wesentliche Hilfe zu leisten. Das Problem liegt vielmehr in ihrer Vielzahl und Reichhaltigkeit. Bedeutende Archive sind weit über das große Land verteilt (zum Beispiel befindet sich ein großer Teil von Wrangels Schriften im Schloss Skokloster bei Uppsala), und dieser Vielfalt ist schwer gerecht zu werden. Nichtsdestoweniger ist der unerlässliche erste Schritt immer ein Besuch bei den großen Archiven von Stockholm. Er reicht nicht aus, wenn man in die Tiefe dringen will. Was die vorliegende Arbeit angeht, so sind die Ergebnisse über die schwedischen Kriegszüge in Deutschland durchaus als vorläufig zu betrachten.
Ein Gegensatz besteht zwischen dem katastrophalen Charakter des Dreißigjährigen Kriegs im Ganzen und dem glimpflichen Ausgang des Krieges für die Lindauer. Der Gegensatz beruht nicht auf mangelndem Verständnis oder fehlerhafter Beobachtung oder falscher Analyse, sondern bestand in Wirklichkeit. Der Dreißigjährige Krieg hat in Deutschland Unglück über die Bevölkerung und Schaden über das Land gebracht in einem Ausmaß, das schwer zu übertreiben ist. Die Zahl der durch den Krieg verursachten Todesopfer ist nicht ermittelbar, doch die Schätzungen liegen zwischen einem Fünftel und einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Die materiellen Verluste – durch Zerstörung, planmäßige Ausplünderung (namentlich durch die schwedische Armee und ihre Führung), und Verluste an landwirtschaftlichen Arbeitskräften – führten zu jahrhundertelang anhaltender Verarmung des Landes. Auch Lindau hat eine gewisse Verarmung erfahren, Handel und Landwirtschaft haben gelitten. Doch der Feind hat die Stadt nie betreten, die Zahl der Todesopfer durch Kampfhandlungen war gering. Selbst die Schäden, die eine intensive Beschießung während der Belagerung angerichtet hatte, erwiesen sich als mäßig. Grausamkeiten und Greuel, wie sie die Kriegführenden untereinander, vor allem aber an der Bevölkerung verübten, und wie sie in der Literatur zum Dreißigjährigen Krieg ausführlich geschildert sind, werden von den Lindau-Quellen nicht verzeichnet. Nach Kriegsende konnten die Lindauer ihr gewohntes Leben schnell wieder aufnehmen. Insgesamt kamen sie aus den Prüfungen und Gefahren des schlimmen Krieges glücklich hervor. Der Grund war wohl zum einen die glückliche Insellage ihrer Stadt, zum anderen die Tatsache, dass sie in der langen Krise die Nerven behalten und im Wesentlichen immer das Richtige getan haben. Dies soll die folgende Geschichte zeigen.
Otto MayrAshburn/ Virginia, Oktober 2016
1. LINDAU ZU KRIEGSBEGINN (1618)
Kalenderfragen
Während des ganzen Dreißigjährigen Krieges folgten die beiden Gegner verschiedenen Kalendern, und gleiches taten die über sie berichtenden Quellen. Die katholische Kirche hatte 1582 unter Papst Gregor XIII. eine längst fällige Kalenderreform durchgeführt, die im ›Gregorianischen Kalender‹ resultierte, welchem sich die Protestanten starrsinnig verweigerten, um am alten, unzulänglichen Julianischen (von Julius Caesar stammenden) Kalender festzuhalten. Obwohl der praktische Unterschied geringfügig und die Umrechnung vom einen zum anderen einfach ist (für jeden beliebigen Tag ist das Gregorianische Datum um zehn Tage später als das Julianische), führt diese Dualität zu viel Verwirrung, Mißverständnissen und Fehlern.1
Heute ist der neue Kalender selbstverständlich überall und universell im Gebrauch, und historische Daten, wenn Mißverständnisse nicht zu befürchten sind, werden oft stillschweigend in den modernen Kalender umgerechnet. Bei älteren Quellen gilt im Zweifelsfalle der im jeweiligen Kulturkreis gültige Kalender. Auch half der Brauch, den verwendeten Kalender durch die Hinzufügung von s. v. (stilo vetero) oder s. n. (stilo novo) zu identifizieren. Am klarsten ist es jedoch, beide Daten nebeneinander anzugeben, mit dem neuen Kalender immer zuerst.
Daß die Wahl des Kalenders inhaltliche Bedeutung haben kann, zeigen zwei Beispiele: Die Schweden hatten Bregenz am Freitag, dem 25. Dezember 1646 s. v., also am ersten Weihnachtsfeiertag (genauer am 4.1.164/ 25.12.1646) erobert. Obwohl sie es nur dem alten Kalender verdankten, daß ihnen dieser Erfolg gerade an einem so hohen Feiertag geschenkt wurde, hatte es für sie dennoch eine gewisse fromme Bedeutung. Für die katholischen Bregenzer dagegen, die dem neuen Kalender anhingen, war dieser schwarze Tag nichts weiter als der 4. Januar 1647 s. n., ein gewöhnlicher Freitag. Oder: Am 11. Januar 1647 s. n. (oder genauer am 11./ 1.1.1647) hörte man in Lindau ein gewaltiges Schießen aus der Bregenzer Richtung und fragte sich, welcher Feind die Schweden in Bregenz angegriffen hätte. Tatsächlich schossen die Schweden nichts weiter als einen ausgiebigen Neujahrssalut.
1.1 Reichsstadt und Kaiser
Am 17.Juli 1640 war Oberst Augustin von Vitzthum, der Kommandant der kaiserlichen Festung Lindau, plötzlich infolge eines Schlaganfalls verstorben. Eilkuriere benachrichtigten den Kaiser, und schon am 27. Juli traf das kaiserliche Antwortschreiben ein mit der Ernennung des Nachfolgers. Der neue Kriegskommandant und kaiserliche »Gubernator« war Maximilian Willibald Truchsess von Waldburg-Wolffegg.2 Die Eile, mit der Vitzthums Nachfolge entschieden wurde, verrät die Nervosität, mit welcher der kaiserliche Hof die Reichsstadt Lindau betrachtete, und die Angst, die Lindauer auch nur für kurze Zeit ohne straffe kaiserliche Aufsicht zu wissen. Die Spannungen zwischen Lindau und Wien, ein entscheidender Faktor in der folgenden Geschichte, gingen einige Zeit zurück, doch sie hatten nicht immer bestanden.
Vor dem 16. Jahrhundert genoss Lindau besondere kaiserliche Gunst. König Rudolf I. gab der Stadt 1274/75 ihre erste Verfassung,3 und Kaiser Maximilian I. zeichnete sie dadurch aus, dass er hier 1496/97 einen Reichstag abhielt.4 Es war die Reformation, die einen Riss in die Beziehung brachte, denn die Bürger von Lindau hatten sich Martin Luthers Lehre sehr früh, nahezu einstimmig und mit besonderer Hingabe angeschlossen. Das Haus Habsburg, dem alle Kaiser seit Mitte des 15. Jahrhunderts angehörten, lehnte die Reformation schroff ab, aber seine Mittel zu ihrer Bekämpfung waren beschränkt, da das Reich seit der Goldenen Bulle und der umfassenden Reichsreform Maximilians I. sich immer mehr einer konstitutionellen Monarchie annäherte, in welcher wichtige Entscheidungen nicht durch den Kaiser selbst, sondern durch die Reichsstände auf den Reichstagen getroffen wurden.
Ein Meilenstein in der Auseinandersetzung über die Reformation war der Reichstag von Augsburg von 1530. Zum Nachweis, dass es sich bei Luthers Lehre nicht um Häresie handelte, sondern nur um Reformen, die in vollständigem Einklang mit der Heiligen Schrift standen, hatte Melanchthon eine sorgfältig formulierte Kurzfassung dieser Reformen verfasst, welche nachwies, dass sie weithin mit katholischem Dogma übereinstimmten und die Unterschiede unwesentlich waren. Der Text wurde vor dem jungen Kaiser Karl V. und den Reichständen unter starkem Beifall verlesen. Dieses »Augsburger Bekenntnis« (Confessio Augustana) galt fortan als das grundlegende Manifest der deutschen Lutheraner. Die vom Kaiser beauftragte Erwiderung durch katholische Theologen, eine Verurteilung der evangelischen Lehre, entsprach der Position des Kaisers. Er war aber bedächtigen Temperaments und behielt sich weitere Maßnahmen vor. Tatsächlich war es ihm schon aus politischen Gründen unmöglich, einer Glaubensspaltung in seinem riesigen Reich (in dem seit der Eroberung Südamerikas »die Sonne nicht unterging«) zuzustimmen. Jedenfalls war nun anerkannt, dass es sich bei Luthers Lehre nicht um Häresie handelte, sondern – im Gegensatz zu allen anderen reformatorischen Bewegungen – um eine rechtsgültige Konfession.
Die Lindauer spielten in dieser Auseinandersetzung eine Sonderrolle. Die südwestdeutschen Theologen, grundsätzlich Anhänger Luthers, aber wohlvertraut mit der Reformationsbewegung in der deutschen Schweiz, bevorzugten in einigen Punkten, vor allem in der Abendmahlslehre, die nüchternere Anschauung des Zürcher Reformators Huldrych Zwingli. Unwillig, die Augsburger Konfession zu unterschreiben, schlossen sich die vier Städte Straßburg, Konstanz, Lindau und Memmingen zu einem eigenen Manifest zusammen, das die Straßburger Theologen Martin Bucer und Wolfgang Capito verfasst hatten. Diese »Vierstädtekonfession« oder Confessio Tetrapolitana wurde dem Reichstag neben der Augsburger Konfession getrennt vorgelegt, dort allerdings kaum beachtet und später dieser stillschweigend zugeordnet.5
Nach dem Reichstag ließ der Kaiser, mit Kriegen gegen Türken und Franzosen beschäftigt, die Sache zunächst ruhen, während die evangelischen Reichsstände dazu neigten, den kaiserlichen Widerspruch zu ignorieren. So hing eine Spannung im Raum, die sich früher oder später entladen musste. Zur Absicherung vereinigten sich die evangelischen Reichstände zu einem Defensivbündnis gegen die kaiserliche Religionspolitik, dem Schmalkaldischen Bund (1531). Das Bündnis war militärischen Charakters und hatte, dank starker Beteiligung, zunächst bedeutenden Einfluss. Auf die Dauer fehlte ihm aber der Zusammenhalt und seine Macht bröckelte. Als Kaiser Karl V. seine außenpolitischen Aufgaben bewältigt hatte, wandte er sich Anfang 1546 der Auseinandersetzung mit den Protestanten zu. Der Schmalkaldische Bund setzte seine Truppen in Marsch und hatte im Juli Anfangserfolge. Aber inzwischen begannen viele Reichsstände, wie zum Beispiel auch die Stadt Lindau selbst, zu begreifen, dass sie einen Krieg gegen den Kaiser schon angesichts der ungeheuren Kosten nicht durchhalten konnten und dass sie in einem solchen auch grundsätzlich im Unrecht waren. Sobald der Kaiser seine Armee mobilisiert und durch ausländische Hilfstruppen weiter verstärkt hatte, wendete sich das Kriegsglück zu seinen Gunsten. So fanden es die süddeutschen Reichsstädte am klügsten – eine nach der anderen –, ihr Kriegsvolk zurückzurufen und sich dem Kaiser zu unterwerfen. Lindau war eine der letzten Städte, die mit geschickter Diplomatie und demütiger Bitte um Vergebung mit knapper Not im Februar 1647 die kaiserliche Gnade zurückgewannen. Der Schmalkaldische Krieg endete mit der Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1647, in der der Rest des Bundes, hauptsächlich das Heer von Sachsen, entscheidend geschlagen wurde.6
Das Schicksal, dem Lindau damit entronnen war, zeigt das Beispiel von Konstanz. Der Rat der alten Bischofsstadt hatte es abgelehnt, sich gleich den anderen Reichsstädten zu demütigen, und darauf vertraut, dass ihr der Kaiser von sich aus einen gesichtswahrenden Weg zurück in den Kreis der Reichsstädte anbieten würde. Die Konstanzer warteten zu lange. Als sie schließlich verhandlungsbereit waren, fanden sie die gestellten Bedingungen zu hart. Doch waren sie überrascht, als ihnen mit Wirkung vom 6. August 1548 die Reichsacht erklärt wurde. Am frühen Morgen desselben Tages standen auch schon einige Regimenter spanischer Truppen vor ihren Toren und begannen die Stadt zu berennen. Sie wurden zurückgeschlagen und zogen abends ab. Neue Unterhandlungsversuche der Konstanzer beantwortete der Kaiser mit dem Befehl zur Exekution der Reichsacht. Konstanz verlor seinen Rang als Reichsstadt und musste am 11. Oktober seiner Übergabe an Österreich zustimmen.7 Verbunden mit dem Wechsel der Obrigkeit war zwangsläufig die Rückkehr zum Katholizismus.
Die deutschen Protestanten begriffen nun, dass sie Auseinandersetzungen mit ihrem katholischen Kaiser militärisch nicht gewinnen konnten; sie mussten sich unterwerfen und in Zukunft ihre Interessen auf diplomatischem Weg verfechten. Die weiteren Unterhandlungen kamen zum Abschluss mit dem Abschied des Reichstags von 1555 in Augsburg, in dem ein allgemeiner Religions- und Landfriede verkündet wurde. Die Augsburger Konfession wurde endgültig als der katholischen gleichberechtigt anerkannt. Damit war der Zustand der Glaubensspaltung, der sich längst eingestellt hatte, rechtlich abgesichert nach der Formel »cuius regio, eius religio«; fortan bestimmte die jeweilige Obrigkeit die Religion ihrer Untertanen. Daraus folgte, dass regierende Fürsten katholischer Konfession das Recht, ja die Pflicht hatten, »unkatholische« Untertanen zwangsweise zu rekatholisieren. Mit Religionsfreiheit und konfessioneller Toleranz hatte dies nichts zu tun; so waren auch im evangelischen Lindau Katholiken unwillkommen.
Das wichtigste Ergebnis des Augsburger Reichstags war neben dem Religionsfrieden der Abschluss der von Kaiser Maximilian I. begonnenen Reichsreform. Unter ihren Ergebnissen ragt die Gründung bzw. Verstärkung von drei Reichsinstitutionen heraus, deren Autorität über den ganzen Umfang des Reiches galt und die bis zum Ende des Reiches in Kraft blieben: das Reichskammergericht, die Reichskreise und der Reichstag.
Wichtig war auch, Lindau direkt betreffend, eine vom Kaiser verfügte Neuordnung der Verfassungen der Reichsstädte (1551–53). Ihre Bedeutung lag darin, dass sie die traditionelle Vorherrschaft der quasi-demokratischen Zünfte in der Stadtregierung durch eine solche des Patriziats ersetzte, weil der Kaiser diese als konservativer und der alten Lehre anhänglicher beurteilte. Die Entmachtung der Zünfte wurde als so radikal empfunden, dass man sie als Staatsstreich bezeichnet hat.8 Es ist jedoch anzumerken, dass das kaiserliche Gebot der Verfassungsänderung bemerkenswert behutsam durchgesetzt wurde; der Stadt wurde Gelegenheit zu Diskussion und Widerspruch gegeben, und die kaiserlichen Beamten, wie auch der Kaiser selbst, begegneten dem hartnäckigen Widerstand der Stadt mit Geduld. Man einigte sich endlich auf eine Regelung, welche den Wünschen des Kaisers einigermaßen entsprach, die sich aber auch in der Praxis als interpretierbar erwies, sodass die Lindauer mit ihr noch weitere zweieinhalb Jahrhunderte lang arbeiten konnten. Im Gegensatz zu der bisher gültigen mittelalterlichen Ratsverfassung, in welcher der Rat von den Zünften beherrscht wurde (deren zahlreiche Mitglieder Wahlrecht hatten), lag nunmehr die Regierung der Stadt in den Händen eines exklusiven Patriziats. Formale Wahlen jedoch fanden in Lindau kaum noch statt, und Ämterbesetzungen wurden in kleineren Kreisen ausgehandelt, in denen Mitglieder der Patriziergesellschaft »zum Sünfzen« vorherrschten.9 Kaiser Karl V. zog sich im folgenden Jahr in ein spanisches Kloster zurück, wo er 1558 starb. In Lindau wird man in ihm mehr einen Gegner als einen Freund gesehen haben, doch beschreiben ihn Lindauer, die ihm persönlich begegnet sind, als einen zugleich geradlinig-direkten als auch liebenswürdig-humorvollen Mann.10
Während sich Deutschland noch mit der Reformation auseinandersetzte, tagte von 1545 bis 1563 in Trient ein Konzil der katholischen Kirche, um allerhand überfällige Reformen durchzuführen und um über den richtigen Weg in die Zukunft zu beraten. Zu den Zielen gehörten die Beseitigung der Glaubensspaltung und die Rückführung aller Christen zur katholischen Kirche (die »Rekatholisierung«). Ein wichtiges Mittel dazu war die Förderung katholischer Erziehung, bei der die führende Rolle dem neu gegründeten Orden der Jesuiten zugewiesen wurde. Die im Trientiner Konzil gewonnenen Beschlüsse und Zielsetzungen (die Gegenreformation) hatten schwerwiegende Folgen.
Trotz des am Augsburger Reichstag 1555 beschlossenen »Religions- und Landfriedens« war das folgende Halbjahrhundert in Deutschland kein friedliches. Ein Kernproblem lag auf der Ebene der Rechtsprechung. Die Organe des Reiches – genauer: das Reichskammergericht, der Reichshofrat und die Kaiser selbst11 – erwiesen sich als außerstande, die Vielzahl der im ganzen Land dauernd anfallenden Rechtsstreitigkeiten zu bewaltigen,12 die besonders schwerwiegend waren, wenn sie auf der Ebene von Reichsfürsten und anderen Reichsständen auftraten. Die Unfähigkeit des Reiches, solche Streitfälle hinreichend rasch zu entscheiden und seine Urteile durchzusetzen, verleitete die Beteiligten immer wieder dazu, die Lösung auf eigene Faust mit den Waffen zu suchen. So entbrannten immer wieder kleine lokale Kriege, welche Schaden anrichteten und die Machtlosigkeit des Reiches zur Schau stellten.
Wenn Selbsthilfe anstatt des Rechtsweges als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen in allgemeinen Gebrauch kam, war der nächste logische Schritt das Bündnis mit gleichgesinnten Partnern. Ein solches Bündnis war der Schmalkaldische Bund gewesen, dessen unrühmliches Ende von einer Wiederholung hätte abschrecken sollen. Dennoch wurde 1608 zu einem solchen Verteidigungsbündnis der protestantischen Reichsstände von Neuem eingeladen. Daraus wurde die »Protestantische Union«. Das Bündnis stand nominell unter Führung des pfälzischen Kurfürsten Friedrich V., doch Initiator und treibende Kraft war Christian von Anhalt-Bernburg (1568–1630), Landesfürst eines kleinen Fürstentums und zu der Zeit pfälzischer Kanzler in Heidelberg sowie Statthalter in der Oberpfalz. Die Mitglieder der Union verpflichteten sich zur Bereitstellung von Geld und Soldaten. Ein beachtlicher Teil der protestantischen Reichsstände schloss sich an, doch viele, darunter der Kurfürst von Sachsen, ihr unerklärter Führer, verweigerten sich. Die Lindauer hätten manchen Grund gehabt, der Union beizutreten, entschieden sich aber dagegen. Primär war sicher die Gefahr, sich dem Vorwurf der Untreue und des Ungehorsams gegenüber dem Kaiser auszusetzen. Außerdem waren ihnen vermutlich die Schwäche und die unzulängliche Struktur der Union nicht entgangen. In der Folge beobachtete Lindau gegenüber der Union ein Gleichgewicht zwischen diplomatischer Freundlichkeit und sorgfältiger Distanz.
Mit der Gründung der Protestantischen Union war man einem möglichen Krieg einen Schritt näher gerückt. Die Union war deutlich gegen das katholische Kaiserhaus Habsburg und dessen gegenreformatorischen Kurs gerichtet, und sie ließ keinen Zweifel an ihrer Bereitschaft, bei künftigen Auseinandersetzungen auch zu den Waffen zu greifen. Der Gegenseite war diese Gründung anscheinend nicht unwillkommen, denn sie lieferte Herzog Maximilian I. von Bayern, dem mächtigsten der katholischen Reichsfürsten, einen Grund, 1609 ein analoges Gegenbündnis zu organisieren, die »Katholische Liga«. Dennoch bedeutete das nicht, dass die gegensätzliche Paarung von Union und Liga notwendig zum Krieg führen musste – und sie tat es auch nicht. Vielmehr wurde der zehn Jahre später ausbrechende Konflikt, der sich schließlich zu einem dreißigjährigen Krieg ausweiten sollte, nicht durch diese Allianzen verursacht, sondern durch einige zum Äußersten entschlossene Männer, die sich diese Allianzen zu Instrumenten machten.
1.2 Ein Krieg in Böhmen
Der Dreißigjährige Krieg begann nicht mit dem Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618. Vielmehr erforderte es einen ausgedehnten Prozess – beginnend mit dem Tod des Kaisers Matthias am 20. März 1619 und abgeschlossen mit der Schlacht am Weißen Berge am 8. November 1620 –, um die Lawine des großen Krieges ins Rollen zu bringen. Das Folgende ist ein Versuch, die verwickelten Ereignisse, die den Krieg auslösten, in wenigen Sätzen – und grober Vereinfachung – zu skizzieren.
Böhmen war noch im 14. Jahrhundert ein selbstständiges Königreich gewesen, dessen König im Reichsverband als Kurfürst mitgewirkt hatte; es hatte mehrere deutsche Kaiser gestellt, darunter den bedeutenden Kaiser Karl IV. (1333–1378), dem das Reich die Goldene Bulle verdankte. Böhmens slawische Sprache war als offizielle Reichssprache anerkannt.13 An das Haus Habsburg fiel Böhmen erst, als sein letzter König Ludwig II. im Türkenkrieg von 1526 umkam. Da dieser, ein sehr junger Mann, keine Nachkommen hatte, benutzte das Haus Habsburg diese Gelegenheit, sich das Königreich Böhmen als eines seiner Stammländer einzuverleiben; der Kaiser war nun zugleich, ohne Wahl, auch böhmischer König
Im 16. Jahrhundert hatte die Bevölkerung von Böhmen, der Tradition von Johan Hus getreu, sich großenteils zur Reformation bekannt. Der so entstandene Zustand, eine vorwiegend evangelische Bevölkerung unter katholischer Herrschaft, widersprach den Bedingungen des Augsburger Religionsfriedens. Die Spannungen zwischen dem Anspruch der Böhmen auf Religionsfreiheit und auf die Wiederherstellung ihres alten Rechts der freien Königswahl gegenüber der unbeugsamen kaiserlichen Macht, beides zu bestimmen, hielten sich zunächst im Rahmen friedlicher politischer Verhandlung. Tatsächlich gelang es den Böhmen, Kaiser Rudolf II. beides in einem sogenannten »Majestätsbrief« vom 9.Juli 1609 abzuringen.14 Unter der Regierung von dessen Nachfolger Kaiser Matthias (1612–1619) wurde Erzherzog Ferdinand von Steiermark im Juni 1617 zum böhmischen und 1618 zum ungarischen König gewählt und damit zum künftigen Kaiser designiert. Die Wahl fand unter umstrittenen Begleitumständen statt, ohne Beteiligung der böhmischen Stände.
Erzherzog Ferdinand II. (1578–1637) war wie seine beiden über zwanzig Jahre älteren Vettern, die Kaiser Rudolf II. und Matthias, Enkel des Kaisers Ferdinand I. Doch im Gegensatz zu diesen gehörte er einer neuen Generation an. Während jene Vorgänger der Gedankenwelt des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und dem Staatsbegriff eines verfassungsmäßigen Reiches verpflichtet waren, war Ferdinand II. durch eine jesuitische Erziehung vom Geist der Gegenreformation und der Staatsphilosophie des Absolutismus geprägt. Er war von unbedingter, streng katholischer Frömmigkeit und verfolgte das Ziel der vollständigen Rekatholisierung des Reiches mit blinder Konsequenz. Die vollständige Beseitigung der Glaubensspaltung und die Rekatholisierung des ganzen Reiches waren ihm nicht nur politisches Programm, sondern göttlicher Auftrag. Wie kompromisslos er dabei vorzugehen bereit war, hatte er bereits in seiner Regierung als Erzherzog von Innerösterreich (1596–1619) gezeigt. Das Ultimatum an seine »unkatholischen Unterthanen« hieß »Rückkehr zur römischen Kirche oder Auswanderung«, und er führte es dermaßen rücksichtslos durch, dass der gewünschte Erfolg in wenigen Jahren erzielt war, allerdings auf Kosten der Ausweisung eines großen Teils der Bevölkerung und einer erheblichen Einbuße an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Landes.
Als Regent war Kaiser Ferdinand II. bemerkenswert wirksam. Er erwies sich als geschickter Politiker und guter Manager, war leutselig, gesellig und charmant im persönlichen Umgang.15 Er regierte in enger Zusammenarbeit mit einem Kreis gleichgesinnter Vertrauter; tonangebend unter ihnen waren sein Beichtvater, der ideologisch kompromisslose Jesuit Wilhelm Lamormaini (1570–1648), und sein Freund und Kabinettschef, der fähige, pragmatische Freiherr Johann Ulrich von Eggenberg (1568–1634). Entscheidungen, die in diesem Vertrautenkreis getroffen waren, wurden dann in solcher Weise zur Ausführung gebracht, dass der Kaiser von allzu viel Detailkenntnis abgeschirmt blieb, damit er für besonders unangenehme Entscheidungen, zum Beispiel das Blutbad nach dem böhmischen Freiheitskampf oder die Ermordung von Wallenstein, möglichst nicht persönlich verantwortlich gemacht würde. Wie sich zeigte, fehlte ihm jedoch die Fantasie, sich vorzustellen, zu welchen Folgen seine Politik führen musste.
Nach seiner Wahl zum König von Böhmen, aber noch vor dem Tod seines Vorgängers Kaiser Matthias, begann Ferdinand, seine Autorität durchzusetzen mit dem Ziel, Böhmen nach dem Prinzip »cuius regio, eius religio« zu rekatholisieren. Die im »Majestätsbrief« zugestandene Religionsfreiheit und Wiederherstellung des Rechts der freien Königswahl lehnte er schroff ab. Während böhmische und kaiserliche Unterhändler noch über diese Fragen verhandelten, beschloss eine radikale Minderheit aus dem protestantischen böhmischen Adel den Aufstand gegen den Kaiser und warf als sichtbares Zeichen ihrer Rebellion drei hohe kaiserliche Beamte am 23. Mai 1618 aus dem Fenster der Prager Burg. Nach dieser wohltuenden, jedoch kurzsichtigen Geste waren weitere Unterhandlungen nicht mehr möglich. Die böhmischen Rebellen begannen, eine selbstständige Regierung ihres Landes aufzubauen, Streitkräfte für ihre Verteidigung zu organisieren und eine Verfassung für das künftige böhmische Königreich zu entwerfen.16 Auf der anderen Seite sammelte die kaiserliche Regierung ihre Kräfte, um die Rebellion niederzuwerfen und Böhmen wieder unter ihre Herrschaft zu zwingen.
Kaiser Matthias starb am 20.März 1619. Im nun folgenden kaiserlosen halben Jahr beschleunigten sich die Entwicklungen. Am 31. Juli 1619 vollendeten die Böhmen die Verfassung ihrer »Böhmischen Konföderation« und setzten den 1617 gewählten König Ferdinand formal ab, um ihn durch einen König eigener Wahl zu ersetzen. Sie einigten sich auf den jungen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz (1596–1632), der am 26.August gewählt wurde. Er zog am 31. Oktober in Prag ein und wurde am 4.November feierlich gekrönt. Ferdinand, König von Böhmen (seine Absetzung ignorierte er) und Ungarn wurde in absichtlicher Gleichzeitigkeit mit seinem Rivalen am 28. August zum Kaiser gewählt und als Ferdinand II. am 9.September gekrönt. Nun mussten beide, wieder gleichzeitig, ihre Regierungen in den Griff bekommen und ihre Länder auf die kommende Auseinandersetzung vorbereiten. Vielleicht hätte diese Auseinandersetzung als intern böhmische Angelegenheit behandelt werden können. Dabei blieb es jedoch nicht. Vielmehr nahmen die beiden konfessionellen Verteidigungsallianzen im Reich, die Protestantische Union und die Katholische Liga, sich rasch der beiden gegnerischen Parteien an.
Die führende Persönlichkeit in der Union war Christian von Anhalt, Landesfürst eines winzigen ererbten Fürstentums, bestellter Kanzler der Kurpfalz und zugleich Statthalter der Oberpfalz. Im Namen des verstorbenen Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz sowie dessen noch sehr jungen Sohns Friedrich V. betrieb er eine ehrgeizige Politik. Begonnen hatte er 1608 als Gründer und treibende Kraft der Protestantischen Union. Mit ihrer Hilfe gelang es ihm, den jungen pfälzischen Kurfürsten mit der Tochter des englischen Königs zu verheiraten und auf den böhmischen Königsthron bringen. Das so geschaffene protestantische Königreich Böhmen sollte nun im Ensemble der Reichsstände die protestantische Seite dermaßen stärken und die katholische entsprechend schwächen, dass die katholische Vorherrschaft des Hauses Habsburg ein für alle Mal gebrochen wäre. Selbstverständliche Gegner dieses Plans waren Kaiser Ferdinand II., das Haus Habsburg und die Katholische Liga.
Im Herbst 1619 begannen die beiden frisch gekrönten Herrscher, der deutsche Kaiser Ferdinand II. und der böhmische König Friedrich I., ihre neuen Reiche in den Griff bekommen und auf den Krieg vorzubereiten. Das geschah unter ungleichen Bedingungen. Das deutsche Reich war nicht nur um ein Vielfaches mächtiger als Böhmen, es besaß auch eine funktionierende Organisation, mit welcher der neue Kaiser längst vertraut war. Der junge, unerfahrene König von Böhmen dagegen hatte es auf sich genommen, ein fremdes, konfessionell ungeeintes Land, dessen Sprache er nicht verstand, zu regieren, ja in den Krieg zu führen. Dennoch war sich der Kaiser nicht sicher, mit der kaiserlichen Armee allein diesem Feind gewachsen zu sein, und wandte sich um Hilfe an seinen Vetter, Herzog Maximilian I. von Bayern (1573–1651). Die beiden waren nicht nur verwandt und verschwägert,17 sondern auch jesuitisch erzogen, zum Teil gemeinsam an der Universität von Ingolstadt. Beide waren dem Ziel der Rekatholisierung des Reichs bedingungslos verpflichtet. Beide hatten bereits die nötige Brutalität gezeigt, um dieses Ziel durchzusetzen, nämlich Maximilian gegenüber der Reichsstadt Donauwörth, Ferdinand in der Steiermark. Trotz solcher Gemeinsamkeiten war die persönliche Beziehung der beiden Vettern kühl.
Maximilians Antwort auf Ferdinands Hilferuf – diktiert wohl weniger von der Religion als von der Realpolitik – war der Vorschlag eines Geschäfts: Er war bereit, seine Armee (zu der Zeit die beste in Deutschland, geführt von Graf Johann Tserclaes von Tilly, einem der besten Feldherrn Europas) in den bevorstehenden Krieg einzubringen, zum Preis der pfälzischen Kur und mindestens eines Teils ihres Gebiets. Ferdinand sagte dies gern zu; nicht nur war dies eine Erfolgsgarantie, sie kostete ihn auch nichts.18 Der Abschluss dieses Geschäfts war der eigentliche Anfang des Krieges; und das Beharren auf der totalen Rekatholisierung des Reiches machte ihn zu einem sehr langen. Bemerkenswert ist, daß bei jedem der beiden Verbündeten sich frommer Eifer mit der Aussicht auf bedeutenden Gewinn an Macht und Ländereien verband.
Nun folgten die Ereignisse schnell aufeinander. Während der neue böhmische König sich noch in Prag einrichtete und versuchte, die Regierung des ihm fremden Landes zu meistern, bereiteten beide Seiten ihre Streitkräfte vor. Beide Armeen bestanden aus heterogenen Bestandteilen. Die Streitkräfte des böhmischen Königs, einheimische böhmische Truppen sowie Einheiten der Protestantischen Union, standen unter dem Oberbefehl von Christian von Anhalt. Auf kaiserlicher Seite standen, deutlich getrennt, die kaiserliche Armee unter Karl Graf von Bucquoy und die bayerische Armee unter Graf Tilly, verstärkt durch Truppen des spanischen Königs. Das Oberkommando hatte Bucquoy. Die Gesamtstärke der böhmischen Armee kam auf rund 14000 Mann, die der gesamten kaiserlichen Streitkräfte auf mehr als das Doppelte. Trotz seiner Unterlegenheit akzeptierte Christian von Anhalt die Schlacht. Als Schlachtfeld hatte er den »Weißen Berg«, eine Anhöhe rund zehn Kilometer westlich von Prag, gewählt, aber nicht Zeit gehabt, sich zu verschanzen. Die Schlacht fand am 8.November 1620 statt. Sie war kurz und endete mit der vollständigen Niederlage der Böhmen. Das Regime des Königs von Böhmen brach sofort zusammen und er selbst floh nach Norddeutschland. Fortan lebte er als Heimatloser und starb 1632 in Mainz. Der Spottname »Winterkönig« wurde ihm von der katholischen Propaganda schon früh, lang vor seiner Vertreibung, angeheftet; tatsächlich regierte er etwa 14 Monate.
Von Böhmen ergriff der neue Kaiser Ferdinand II. schnell und brutal Besitz. Für die angeblichen Rebellen veranstaltete er in Prag eine öffentliche Massenhinrichtung. Der zahlreiche und außerordentlich begüterte protestantische Adel Böhmens wurde enteignet; böhmische Protestanten, die nicht zur katholischen Konfession übertreten wollten, wurden verbannt. Die Protestantische Union löste sich am 14. Mai 1621 auf. Die Katholische Liga bestand noch bis zum Prager Frieden 1635, ein Machtmittel in der Hand Maximilians I. von Bayern. Wie vereinbart, erhielt dieser 1623 die Kurwürde und die Oberpfalz.
Für die kaiserliche Seite nahm der Krieg, nach ermutigendem Anfang, weiterhin einen erfreulichen Verlauf. Sie war politisch geeint und hatte in Tilly und Wallenstein hervorragende Feldherren. Die protestantische Seite war zersplittert, nicht nur, weil der Loyalitätskonflikt zwischen Reich und Konfession sich nicht leicht auflösen ließ, sondern auch aus Mangel an befähigten Führern sowohl auf politischer wie auf militärischer Ebene. So gewannen die Kaiserlichen die meisten Schlachten und operierten schließlich, nachdem sie Süddeutschland fest im Griff hatten, vorwiegend und ziemlich ungehindert in Norddeutschland (zum Beispiel ließ sich der unersättliche Generalissimus Wallenstein 1629 zum Herzog von Mecklenburg erheben). Je mehr Kaiser Ferdinand II. sein Ziel, die Auslöschung der Reformation, näherrücken sah, desto unnachgiebiger wurde er in der Behandlung der evangelischen Reichsstände. Der Höhepunkt seiner Selbstsicherheit war das Restitutionsedikt vom 6. März 1629, welches die Rückgabe aller seit 1552 von protestantischer Seite eingezogenen geistlichen Güter befahl. Was es forderte, war nicht nur undurchführbar, es zeigte auch seinen Willen, die deutschen Protestanten öffentlich zu demütigen, und zerstörte damit jede Aussicht auf erfolgreiche Friedensverhandlungen. Die Phase kaiserlicher Überlegenheit, das erste Drittel des Dreißigjährigen Krieges, endete mit der Schlacht bei Breitenfeld am 17. September 1631, als die von König Gustav Adolf von Schweden kommandierte protestantische Armee eine kaiserlich-ligistische Armee unter Tilly vernichtend schlug.
1.3 Die Freie Reichsstadt im Krieg
Als Freie Reichsstadt war Lindau eine dem Kaiser direkt unterstellte Stadtrepublik. Sie regierte und verwaltete sich selbst nach einer vom Kaiser verliehenen Verfassung und schuldete ihm Treue, Gehorsam und Steuerzahlung. Für ihre Sicherheit war die Reichsstadt selbst verantwortlich. Gemeinschaftlich bauten und unterhielten die Bürger die Befestigungen ihrer Stadt, beschafften sich die nötigen Waffen und Rüstungen und übten sich in deren Handhabung. An auswärtigen Kriegen hatten sich Lindauer im Rahmen von Bündnissen hin und wieder beteiligt und dabei gelernt, die Verstrickung in solche Abenteuer tunlichst zu vermeiden. Sie wussten, dass ihre kleine Stadt militärisch kein Gewicht hatte, trauten sich aber zu, sie mit Erfolg zu verteidigen.
Etwa ab Beginn des 17. Jahrhunderts wurden die Lindauer Bemühungen um die Verteidigung intensiver. Vielleicht hatte das mit dem militanten Einfluss des Trientiner Konzils zu tun oder mit der zunehmenden Häufigkeit kleiner lokaler Kriege. Die Gründung der Protestantischen Union und der Katholischen Liga, die beide ausdrücklich ihren rein defensiven Charakter beteuerten, verlieh kriegerischen Impulsen eine bestimmte Richtung. Die Freie Reichsstadt Lindau trat keiner der beiden Vereinigungen als Mitglied bei, doch zu beiden, Union wie Liga, pflegte sie gute Beziehungen. Mit den protestantischen Reichsständen verband sie der gemeinsame Glauben. Dem fanatisch katholischen Kaiser war sie als Freie Reichsstadt grundsätzlich zu Treue und Gehorsam verschworen. Mit den katholischen Reichsständen, insbesondere mit den beiden mächtigen Nachbarn, dem Herzog von Bayern und dem Erzherzog von Tirol, arbeiteten die Lindauer pragmatisch zusammen. Überhaupt war es altes Grundprinzip der Kaufmannsstadt, alle Spannungen, einschließlich solcher, die sich aus konfessionellen Differenzen ergeben mochten, mit Diplomatie und Konzilianz von vornherein aus dem Weg zu räumen. So verfolgte Lindau konsequent eine Politik der Neutralität. Für den Notfall pflegte die Stadt aber ihre Verteidigungsmittel: die Wehrkraft ihrer Bürger, die Stärke ihrer Befestigungen und die Qualität ihrer Waffen.
Die Lindauer Sicherheitsbemühungen richteten sich auf drei Ebenen: Steigerung der Wehrfähigkeit der Bürger; Beschaffung der nötigen Vorräte an Nahrungsmitteln, Waffen und Kriegsgerät; Bau und Pflege der Befestigungen. Die zwei wichtigsten Bürgerpflichten waren Wehr- und Wachtdienst sowie Steuerzahlung. Diese Leistungen wurden unerbittlich eingefordert, unter Androhung harter Strafen. Die Bürgerwehr war einfach organisiert. Das Oberkommando, auch im Gefecht, hatte grundsätzlich der amtierende Bürgermeister. Ihm unterstanden sechs Wehrbezirke, in welche die Stadt eingeteilt war und deren Hauptleute aus dem großen Rat abgeordnet waren. Der Amtsbürgermeister hatte die Freiheit, die mit dem militärischen Oberkommando zusammenhängenden Pflichten ganz oder teilweise an andere zu delegieren, insbesondere einen berufsmäßigen Stadthauptmann zu berufen. Der einzelne Wehrpflichtige hatte sich zu stellen, wann immer er aufgerufen wurde, oder er musste einen Ersatzmann bezahlen. Er hatte sich auf eigene Kosten mit einem Harnisch und den nötigen Waffen auszurüsten und diese Ausrüstung immer zu Hause bereit zu halten. Wehr und Waffen durfte er nicht verpfänden. Um Anzahl und Tauglichkeit der Wehrfähigen festzustellen, hielt man von Zeit zu Zeit Musterungen ab. So kam man bei einer Musterung der Lindauer Bürgerschaft im August 1612 auf 1164 Mann, Musterungen des Landvolkes im Jahr 1617 zählten 500 Bauern für Lindau und 370 für Wasserburg.19
Von 1614 bis 1627 war Matthias Polan Stadthauptmann; er war verantwortlich für die Sicherheit der Stadt.20 Polan bemühte sich, diesen Wehrpflichtigen eine militärische Grundausbildung zu geben. Er ließ sie regelmäßig exerzieren und drillte sie im Gebrauch der Waffen. Am wichtigsten war die Fertigkeit in der Handhabung der Musketen und Hakenbüchsen; man errichtete Schießstände für regelmäßiges Scheibenschießen und veranstaltete sportliche Wettkämpfe mit den Schützen der Nachbarorte.21 Matthias Polan22 hatte als spanischer Soldat von 1580 bis 1582 an Feldzügen gegen Portugal teilgenommen und sich 1584 als Beisäß (Einwohner ohne Bürgerrecht) in Lindau niedergelassen. Ab 1599 war er lange abwesend, vermutlich in auswärtigem Kriegsdienst. 1612 kam er wieder zurück nach Lindau. Bald fand er Anstellung bei der Stadt, zunächst bei der Organisation einer Musterung der wehrfähigen Bürger. Im Jahr 1614 beriefen ihn die Lindauer Stadtväter schließlich zum Stadthauptmann. Seine Bestallung wurde im selben Jahr bestätigt, mit einem Jahresgehalt von 200 Gulden. Nun blieb er in Lindau; er war viermal verheiratet und blieb bis zu seinem Tod 1635 Mitglied der Lindauer Patrizier-Gesellschaft Sünfzen23. Als gebürtiger Passauer war Polan vermutlich Katholik. Er war mit dem Grafen Hugo von Montfort-Tettnang, einem engen Vertrauten des Kaisers und feindlichen Nachbarn von Lindau, befreundet (ihm vertraute er seinen schriftlichen Nachlass an) und machte aus seinen Habsburger Sympathien keinen Hehl. Ärgerlich war es für radikal-evangelische Lindauer, zu sehen, dass er alle Laden an seinem Haus weiß und rot anstreichen ließ und die Lindauer Obrigkeit es ihm nicht verübelte.24 Polans Hauptaufgaben waren der Aufbau einer einsatzfähigen Bürgermiliz und die Errichtung von widerstandsfähigen Befestigungen. Im Amt zeigte er Tatkraft und Sinn fürs Praktische. Die Ausbildung seiner Mannschaft bestand aus regelmäßigem Drill und konzentrierte sich auf die Verteidigung. Betont wurde vor allem das Schießen mit Muskete und Hakenbüchse in neu eingerichteten Schießständen, vor Ort auf den verschiedenen Bastionen und sogar vom fahrenden Schiff.
Über die Qualität seiner Krieger urteilte Polan illusionslos, dass die Lindauer »Bürgerschaft im Kriegswesen ganz unerfahren, und fast nur beim Wein, und dann wider ihre Obrigkeit, große Helden und Rittersleut sein«25. Die Bürgermiliz war für den Einsatz für die Verteidigung der Stadt bei Belagerungen gedacht, doch hatte lange keine Gelegenheit gehabt, sich zu bewähren. Vielleicht war sie grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß, denn schon von 1620 bis 1623 hatte die Stadt einige hundert Söldner angeworben, zum Beispiel für Wacht- und Aufsichtsfunktionen gegenüber einquartierten fremden Truppen, doch auch sie wurden im März 1624 wieder entlassen.26 Waffen und militärisches Gerät im Besitz der Stadt wurden im Bürgerzeughaus aufbewahrt. Ausführliche Inventare27 aus den Jahren 1581 und 1620 sowie die Stadtchronik von Neukomm28 beschreiben dort sehr umfangreiche Bestände an Bewaffnung und Ausrüstung. Die schwereren Kanonen standen auf den Befestigungswerken selbst.
1.4 Die Befestigungen und die Brücke
Befestigungen29 waren für den Begriff Stadt von juristischer Bedeutung. Da das Stadtrecht sich vom mittelalterlichen Burgrecht ableitete, war eine Stadt immer zuerst auch eine Burg; das bedeutete: Eine Stadt hatte befestigt zu sein. Die Verlegung des Äschacher Markts auf die Insel um ca. 1100 infolge des Investiturstreits und die bald darauf folgende Gründung der Stadt machten den Bau einer Brücke notwendig; diese, um den Zugang zur Insel zu beherrschen, erforderte die Errichtung eines Stadttors. Das Burg- oder Landtor war der erste Schritt zu einer Stadtbefestigung. Der Aufbau des Gemeinwesens auf der Insel erfolgte darauf so rasch, dass Lindau schon zu Anfang des folgenden 13. Jahrhunderts die Rechte einer Reichsstadt verliehen wurden. Bebaut war nur die (etwas größere) östliche Hälfte der Insel, der unbebaute westliche Teil wurde durch einen Graben, den Inselgraben, und später zusätzlich durch eine Mauer abgetrennt. So bestand Lindau nun aus zwei Inseln; die Lindauer bezeichneten die westliche Insel als Insel (Insul, Insoll usw.) und die östliche, auf der sie wohnten, als die Stadt. Vervollständigt wurde das Ensemble durch eine kleine dritte Insel, die Burg oder Römerschanze; die mit ihren knapp 2000 Quadratmetern etwa 100 Meter südlich der Stadt lag und mit dieser durch einen hölzernen Steg verbunden war. Eine erste Ummauerung der eigentlichen Stadt (mit Ausnahme der dem See zugewandten Südseite) war vermutlich schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts abgeschlossen, die der Insel erst im 16. Jahrhundert. Die Stadtmauer stand dicht am Wasser und besaß die üblichen Wehrgänge sowie eine stattliche Anzahl von Türmen und Toren. Eine wichtige Ergänzung der Mauern ergab ein Ring von Palisaden, eine Reihe von nebeneinander eingerammten Pfählen, der die ganze Insel ab Anfang des 15. Jahrhunderts umgab. Die Palisaden waren ein wirksamer Schutz gegen feindliche Annäherung zu Wasser, mussten allerdings ziemlich oft kostspielig erneuert werden.
Etwa zur Wende zum 17. Jahrhundert begannen die Lindauer, der Pflege ihrer Befestigungen vermehrte Sorgfalt zu widmen. Dank ihrer Insellage hatten sie sich mit deren Modernisierung Zeit gelassen, doch nun begriffen sie, dass weitere Untätigkeit Gefahren barg. Nicht nur hatten sie die Befestigungen in den vergangenen Jahrzehnten ein wenig vernachlässigt. Fortschritte in Technik und Einsatz der Artillerie hatten die Befestigungsarchitektur gewandelt. Anstatt von Steinmauern benötigte man nun dicke Erdwälle und statt hoher Türme niedrige Bastionen30, die als Artillerieplattformen dienten. Die mittelalterlichen Türme hatten ihren Wert verloren. Manche, zum Beispiel den Fledermaus-, den Siegels- und den Krattlerturm, trug man ab (die Steine waren willkommen als Baumaterial). Andere, zum Beispiel der Pulverturm und die Heidenmauer, wurden verkürzt und, wenn möglich, zu Artillerieplattformen umgewandelt; auch das stattliche Landtor erlitt dieses Schicksal. Einige jedoch, der Turm der Peterskirche, der Diebsturm und der Mangturm, blieben zur Freude der Nachwelt erhalten.
Die ganze Inselensemble, vom Siegelsturm zum Pulverturm, war gut einen Kilometer lang; sein Umfang aber, dem Verlauf der Stadtmauern folgend, maß rund drei Kilometer. Diese drei Kilometer wollten befestigt und bewacht sein. Zwar waren nicht alle Teile der Mauer gleich gefährdet. Die dem See zugewandten drei Viertel des Umfangs luden zum Angriff weniger ein; sie waren nur per Boot zu erreichen und konnten vom Festland weder eingesehen noch mit Artillerie bestrichen werden. Für den Angreifer war diese Seite nur von Reiz, wenn er hier Stellen entdecken konnte, die unbefestigt und unbewacht waren. Daher genügte es, wenn die Stadt einem Feind von der Seeseite einen Anblick bot, der ihm den Appetit auf einen Angriff von vornherein verdarb. Man musste ihm hier lückenlose Palisaden vorsetzen, Schanzen mit auf ihn gerichteten Kanonenrohren und starke, abweisende Mauern mit Wachen, die auf jede Annäherung energisch reagierten.
Die steinerne Dammbrücke von Lindau mit ihrer imposanten Länge von 300 Metern. Ausschnitt aus einem Ölgemälde der Gesamtansicht der Insel Lindau, Maler unbekannt, 1579.
Viel gefährdeter dagegen war das nördliche Ufer der Insel, wo ein Teil der Stadtmauer, nach Nordosten gerichtet, eine etwa 150 Meter lange, geradlinige Flanke gegenüber dem Festland präsentierte. Hier befand sich die verwundbarste Stelle der Insel, die lange, steinerne Brücke, die den einzigen Zugang zur Stadt bot. Hier war die Insel nur 300 Meter vom Festland entfernt; hier war die Tiefe des Sees am geringsten; hier kam im Winter, wenn der Seespiegel regelmäßig drastisch absank, der Boden des Sees zutage, insbesondere unter der Brücke und vor der Stadtmauer. Selbstverständlich bot die Brücke den bequemsten Zugang zur Stadt, daher war es der Traum jedes Angreifers, sie unversehrt in die Hand zu bekommen. Das radikalste Mittel, dies zu verhindern, war es, die ganze Brücke zu entfernen. Als dies gegen Ende des Krieges von der Generalität befohlen wurde, sträubten sich die Lindauer mit aller Kraft, doch die schmerzhafte Amputation musste vollzogen werden. Der Widerstand gegen den Abbruch war darum so stark, weil die Bedeutung der Brücke auf vielen Ebenen lag. Zum einen war sie für das tägliche Leben einer Handels-, Markt- und Hafenstadt unentbehrlich; dann verkörperte sie eine gewaltige Investition; auch war sie Symbol der Stärke und des Reichtums der Stadt. Ihre Bedeutung wurzelte aber noch tiefer, denn die Brücke war älter als die Stadt selbst; tatsächlich hatte erst sie den Aufbau des Gemeinwesens auf der Insel ermöglicht.
Die Geschichte der Brücke ist noch nicht gründlich erforscht. Vermutlich wurde eine erste Holzbrücke um ca. 1100 errichtet, aber über das Alter der Lindauer Steinbrücke gibt es keine Quellen, nur die vorherrschende Meinung, dass sie aus dem 15. Jahrhundert stammte und dem gotischen Baustil angehörte. Über ihre genaue Bauweise ist nichts überliefert, gewiss ist aber, dass sie über die Jahrhunderte durch Anbringung, Auswechslung und Entfernung von Zugbrücken, Türmen und Brückenköpfen ihr Aussehen oft gewechselt hat. Die überlieferten Abbildungen – Gemälde, Holzschnitte, Handzeichnungen usw. – zeigen kein Interesse an technischen Einzelheiten. Bei dem Bestreben, die schöne Inselstadt vor ihrem Hintergrund von See und Gebirge wirksam abzubilden, war die große Länge der Brücke störend. So zeigen frühe Ansichten von Lindau stark verkürzte Brücken von bescheidenem Format mit vier bis acht kleinen Bögen, während die großen, heute noch erhaltenen gotischen Steinbrücken von ähnlicher Länge mindestens doppelt so viele und dazu unvergleichlich massivere Bögen besitzen.31 Zum Beispiel hat die Steinerne Brücke in Regensburg (1156) mit 336 Metern Länge 16 Bögen und die Karlsbrücke in Prag (1357) mit 1516 Metern Länge ebenfalls 16 Bögen. Das sind gewaltige Bauwerke von monumentalem Aussehen. Hätte die Lindauer Steinbrücke ähnliches Format besessen, dann hätte es sich gewiss in zeitgenössischen künstlerischen Darstellungen ausgedrückt.32 Daher ist zu vermuten, dass die Lindauer »Steinerne Brücke« keine Bogenbrücke war, sondern eine Art von Dammbrücke, bestehend aus einem gemauerten Damm mit einigen bogenförmigen Durchlässen. Solche Dammbrücken waren einfacher und billiger zu errichten. Für Flüsse mit einiger Strömung waren sie ungeeignet, da sie einem Hochwasser nicht widerstehen konnten; in einem See von geringer Tiefe und ohne Strömung boten sie jedoch große wirtschaftliche Vorteile. Eine solche Brücke zeigt die Lindauer Stadtansicht eines anonymen Malers, bezeichnet durch den Stifternamen Anthoni Remm, datiert 1579.33
Am landseitigen Ende der Brücke, d.h. am Brückenkopf, hatte man irgendwann das sog. Schänzlein errichtet, eine kleine Festung, die bei der späteren Belagerung, gegen alle Erwartung, dem Feind den Zugang zur Insel verweigert und ihn dadurch um Abzug veranlasst hat. Über das Datum und die näheren Umstände seiner Errichtung schweigen die Quellen. Am anderen Ende der Brücke stand das Landtor. Ebenso wie die Brücke selbst war seine Aufgabe, Zugang zu ermöglichen und nicht zu versperren. Zwar konnte es unerwünschte Besucher aussperren, aber es war nicht fähig, konzentrierter Gewalt zu widerstehen. Für einen entschlossenen Angreifer war es leichter, das Stadttor aufzubrechen als in die Stadtmauer eine Bresche zu schlagen. Ein erstes Burg- oder Landtor wurde vermutlich schon bald nach Bau der ersten Brücke im frühen 12. Jahrhundert errichtet. Seitdem ist es immer wieder durch neue Konstruktionen ersetzt worden, zum letzten Mal vor dem Krieg im Jahr 1569 durch einen Renaissancebau mit Staffelgiebel. Für die Verteidigung im Krieg war das Tor nur mehr von geringem Wert, so wurde es im es 1635 durch ein unauffälliges Gewölbetor ersetzt, das über die Stadtmauer nicht mehr herausragte.
»Lindaw im Bodense«. Kupferstich von Matthäus Merian, 1643. Die Stadtansicht ist fehlerhaft, denn die stark verkürzte Bogenbrücke ist reine Fantasie.
Wenn man die nördliche Seite der Insel im Zustand vor den modernen Aufschüttungen betrachtet, wie ihn der älteste, auf exakter Vermesssung beruhende Stadtplan von 1823 zeigt, so sieht man, dass sie nach Norden (etwa vom Heiliggeistspital bis zum kaiserlichen Zeughaus) eine lange, geradlinige Front von knapp 400 Metern Länge aufweist und östlich anschließend in ungefähr südöstlicher Richtung einen ebenfalls geradlinigen Abschnitt (vom Heiliggeistspital bis zum Bürgerzeughaus, heute Maxkaserne) von etwa 130 Metern Länge. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts waren die beiden Eckpunkte dieses letzteren Abschnitts markiert durch den Fledermausturm im Westen (links) und den Siegelsturm (auch Knöpfles- oder Huyersturm) im Osten (rechts). Die beiden Türme waren baufällig, militärisch bedeutungslos und wurden bald abgetragen, dienten aber noch einige Zeit lang als topografische Bezeichnungen. Der genannte Abschnitt zwischen Fledermausturm und Siegelsturm mit dem Landtor und der Brücke in der Mitte war während des ganzen Krieges für die Lindauer Verteidigung die kritische Zone.
Da Brücke und Tor unvermeidlich Schwachstellen in der Verteidigung waren, mussten angrenzende Befestigungen ihren Schutz zu übernehmen. Mit dieser Aufgabe war man ständig beschäftigt. Schon zwischen 1556 und 1561 hatte man hier die alte Stadtmauer durch eine davor gesetzte starke Mauer verstärkt.34 1607 hatte man zwischen Burgtor und Spital zwei neue Dämme, vermutlich durch Aufschüttungen, angelegt und dies bis 1609 fortgesetzt mit dem Ergebnis einer »neuen stattlichen Pastey« vom Spital bis zum Bürgerzeughaus, »mit wasser gräben, und anderem, so zu einer festen notwehr gehörig, nicht ohn anwendung großes uncosttens«35. Damit war entlang der Stadtmauer über die ganze Länge dieses Abschnitts, einige Meter vorwärts in den See hinein, eine langgestreckte Bastion geschaffen. Fragt man, wer für diese Arbeiten verantwortlich war, dann möchte man vermuten, dass dies ein (namentlich nicht bekannter) Stadtbaumeister war, der sich mit seiner Mannschaft fortwährend und ziemlich selbstständig um Unterhalt, Reparatur und Verbesserung der Befestigungen kümmerte.
Gleichzeitig und von solchen einheimischen Bemühungen unabhängig zeigte sich eine parallele Initiative.
Der Steiermärker Edelmann und Exulant Adam Seenus von Freudenberg, der um 1600 zugezogen und sich in Lindau eingebürgert hatte, war bei den Bemühungen der Lindauer um Verbesserung ihrer Befestigungen mit den Herren des Stadtrats ins Gespräch gekommen und hatte diese überzeugt, dass dieses Problem beiderseits des Landtors eine viel grundsätzlichere Lösung erforderte als die bisher begonnenen Maßnahmen. Sogleich lud Seenus den Basler Festungsbaumeister Valentin Friderich36zu einem Besuch ein.37 Dieser kam nach Lindau, vermaß die Örtlichkeit und legte dann ein sorgfältig ausgearbeitetes Projekt vor, bestehend aus einem maßstäblichen Grundriss, signiert »VF.1607« (Valentin Friderich),38 und ausführlichen schriftlichen Erklärungen.39 Die vorgeschlagene Anlage bestand aus zwei zusammenhängenden Schanzen, die schmetterlingsförmig symmetrisch zu beiden Seiten des Landtors angeordnet waren und sich vorwärts weit in den See hinaus erstreckten. Der Rat war begeistert und beschloss, zunächst eine Hälfte der geplanten Anlage, den linken, westlichen Flügel des Schmetterlings, auszuführen. Bald konnte Johann Bertlin in seiner Chronik berichten: »Anno 1609 sind auff anleitung Herrn Adam Seenus von Freudenberg, eines vertribnen Steyrmarckischen Edelmanns, die Herren zu Lindaw räthig worden, auff der lincken hand beym Burgthor ein neu Pastey zu bauen, welche auch in dießem Jahr stattlich und köstlich angefangen worden, und hat man den überschlag gemacht, daß dieser gewaltige Bau in die 40 000 fl kosten werde.«40
Allerdings enthielt der Plan des Schweizer Baumeisters einige Schwierigkeiten. Zum einen war der Entwurf nicht vereinbar mit den nüchtern-ökonomischen Arbeiten der Lindauer Bauabteilung, welche bereits ausgeführt waren; diese hätten zugunsten des neuen Plans beseitigt werden müssen. Das bedeutete Verschwendung von Material und Arbeitskraft. Zum anderen würde die neue Anlage weit in den See hinausragen; das bedeutete gewaltige Aufschüttungen von Erdreich, die aber nur erfolgen konnten bei äußerst niedrigem Wasserstand, wie man ihn nur im Hochwinter vorfand. Weitere Einwände lagen im hohen Personalbedarf der riesigen Anlage sowie in der geometrischen Orientierung der Schanzen. Schnell folgte auf die erste Begeisterung Ernüchterung, und der kostspielige Entwurf wurde zu den Akten gelegt und geflissentlich vergessen. Danach findet man in den Quellen keine weiteren Erwähnungen von Seenus.41
Grundriss einer projektierten Bastion am Landtor, signiert »V F. 1607 fecit«. Maßstabliche Federzeichnung auf Papier von Valentin Friderich, Baumeister zu Basel. Der kostspielige Entwurf wurde nicht ausgeführt, diente aber als Anregung.
In den Jahren zwischen 1614 und 1622 wurde unter Polans Leitung an den Befestigungen viel gebaut. Zu den Ergebnissen gehörten mehrere neue oder verbesserte Schanzen auf der »Insul« und im Hafenbereich; die Befestigung der Burg wurde mehrfach verbessert. Ca. 1620 kam eine neue Bastion, die Gerberschanze hinter der Fischergasse, hinzu, welche die Südostflanke der Stadt sicherte (und welche noch heute in ursprünglicher Form erhalten ist)
Schwieriger waren die Aufgaben an der Nordostflanke im Bereich von Brücke und Landtor. Wieder kam ein Anstoß von außen. Im Sommer 1619 machte Graf Friedrich von Solms, ehemaliger Generalwachtmeister der Evangelischen Union, einen kurzen Besuch in Lindau. Er war ein alter Bekannter der Stadt aus der Anfangszeit der Evangelischen Union, als Lindau von dieser heftig, aber vergebens umworben worden war. Nun sprach der Graf nach Besichtigung der Befestigungen vor einigen Ratsherren eine beunruhigende Warnung aus: »Ihr Herren von Lindau, wie seidt ihr so gar sicher und bloß, gedenckht nur nicht anderst, dann der erst herr der kombt, dessen aigen seit ihr. Allso wann wir (die unierte Armada mainendt) anfangs kommen, so seit ihr unser aigen. Kommen dann die Catholischen vor unß, so seit ihr auch deren aigen.«42Von Polan mögen die Ratsherren solche Warnungen schon oft gehört haben, doch von einer auswärtigen Autorität kommend machten sie stärkeren Eindruck. Nun erinnerte man sich wieder an den alten Entwurf des Schweizer Baumeisters. Polan suchte ihn aus den Akten hervor, studierte ihn und verfasste eine gründliche Kritik.43Zu den Schwächen der vorgeschlagenen Anlage gehörten ihre übertriebene Größe, die dadurch erforderliche zahlreiche Besatzung, die verkehrte Orientierung und Proportionierung der Schanzen und die exzessiven Baukosten. An ihrer Stelle schlug Polan eine einfachere, kompaktere Anlage vor, die nur einen Bruchteil der Kosten erforderte. Der Rat stimmte zu und gab Polan den erforderlichen Auftrag.
Polans neues Konzept bestand darin, dass er die bereits massiv verstärkte gerade Mauer vom Fledermausturm bis zum Siegelsturm mit dem Landtor dazwischen hinnahm und an ihren beiden Enden zwei getrennte Schanzen von mäßiger Größe vorwärts in Richtung zum See anbaute. Polan konzentrierte sich zunächst auf die östliche Schanze beim Siegelsturm und brachte sie auch zügig zum Abschluss. Später betrachtete er sie, neben der Gerberschanze, als seinen deutlichsten Erfolg. Unter seinen Nachfolgern wurde daran weiter gearbeitet, doch auf den vorhandenen Abbildungen zeigt sie immer die gleiche ursprüngliche Form. Schwierig war die Frage ihres Namens. Der benachbarte Siegelsturm, der bald abgetragen wurde und auf den Abbildungen nicht sichtbar ist, eignete sich nicht als Namensgeber. Schließlich, in den 1640er-Jahren, bürgerte sich die Bezeichnung »Königsschanze« ein – ob zu Ehren des Stadtkommandanten Franz Peter König, der an ihr keine Verdienste hatte, oder des vormaligen Königs von Ungarn (und späteren Kaisers Ferdinand III.), ist nicht zu entscheiden.
Die gegenüberliegende Schanze – die Fledermausschanze (dieser Name blieb bestehen) – hatte eine schwierige Entstehung. Für den Februar 1620 verzeichnete der Chronist Ulrich Neukomm, dass die »neue große Pastey« zur Linken des Tors »noch des wärenden Sees willen unausgeführt«44 bleibt. Sie litt an technischen, finanziellen und schließlich politischen Schwierigkeiten. Zum einen erforderte ihr Fundament einen niedrigen Wasserstand des Sees, wie er nur für kurze Zeit im Hochwinter gegeben war. Zweitens brauchte man hier erhebliches Geld für Arbeitskräfte und behauene Quadersteine. Später verursachte ihr Bau, wie noch zu berichten ist, ernste politische Schwierigkeiten mit Erzherzog Leopold, dem Landesfürsten von Tirol, welcher in ihr den Ausdruck von unstatthaftem Machtstreben der Lindauer sah. So wurde der Bau zeitweise ganz eingestellt.
Es bleibt noch das Schänzlein (auch »Hornwerk« genannt45) zu besprechen, eine unscheinbare Bastion am Brückenkopf, über welche die Quellen schweigen und deren Bedeutung darin liegt, dass bei der späteren Belagerung der Ansturm der Schweden an ihr gescheitert ist. Über die Vorgeschichte des Schänzleins ist wenig bekannt; seine Form kennen wir nur von einer einzigen, etwas unbefriedigenden Abbildung auf einer Stadtansicht von Matthäus Merian von 1638. Die früheste schriftliche Erwähnung des Schänzleins datiert vom Frühjahr 163246, als die Schweden erstmals vor der Stadt standen. Fragt man, wann und von wem sie am wahrscheinlichsten gebaut wurde, darf man die Festungsjahre seit 1628 ausschließen, in denen mangels eines ordnungsgemäßen Stadtkommandanten keine nennenswerten Festungsprojekte angefangen worden waren, und ebenso die vorhergehenden Jahre seit etwa 1622, in denen die Lindauer wegen der Missbilligung des Tiroler Landesfürsten alle bedeutenderen Befestigungsarbeiten einstellten. So kommt man in die Zeit der Wirksamkeit des Stadthauptmanns Polan, dem unter anderem der Bau der Siegelsturmschanze und der Gerberschanze gelungen war. Zweifellos war er erfahren genug, um die Notwendigkeit einer widerstandsfähigen Befestigung des Brückenkopfes zu begreifen, und tatkräftig genug, um eine solche herzustellen. So steht die Tatsache fest, dass eine Schanze am Brückenkopf tatsächlich gebaut worden ist, dass aber durch die Zufälle der Überlieferung kein Bericht über ihre Errichtung erhalten ist. Die Form des Schänzleins betreffend, haben wir nur das Zeugnis von Merians Stadtansicht von Lindau, erstmals veröffentlicht im Jahr 1638. Sie zeigt am Festland vor der Brücke eine Bastion in Form eines Pflugs, die mit Max Willibald von Waldburg-Wolfeggs Bezeichnung Hornwerk durchaus verträglich ist. Die dargestellte Bastion ist in friedensmäßigem Zustand; es fehlt eine Zugbrücke und der Graben ist nicht mit dem See verbunden; diese Mängel lassen sich allerdings mithilfe der tüchtigen Lindauer Zimmerleute und der auf dem Lande reichlich zur Verfügung stehenden Frohner innerhalb von wenigen Tagen beheben.
»Statt Lindaw am Bodense«. Übersicht über die Befestigungen. Urheber unbekannt. Bleistiftzeichnung auf Papier, ca. 1635–40. Der präzise gezeichnete Plan, vermutlich vom Stab des Stadtkommandanten, zeigt den Stand der Befestigungen Ende der 1630er-Jahre. Die schmetterlingsförmige Schanze am Brückenkopf ist nicht durch Quellen belegt, vermutlich handelte es sich nur um einen Vorschlag.