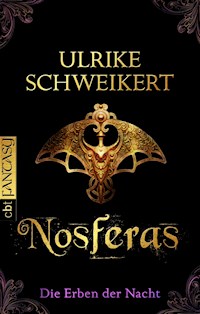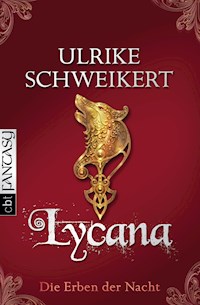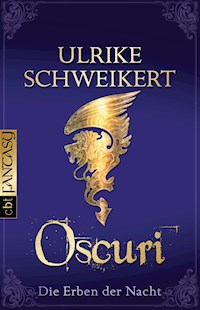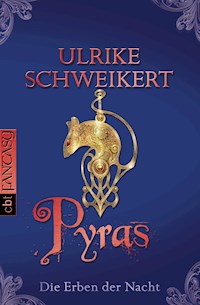6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schon Bastian Balthasar Bux hatte es in der »Unendlichen Geschichte« erlebt: Die Welt Phantásien verändert sich jeden Tag. Phantásien wächst oder schrumpft, bringt unendlich Schönes und ebenso Schreckliches hervor. So wie im Tal der Blauschöpfe. Nacht für Nacht bedrohen dunkle Kreaturen das naturverbundene Volk. Ein eilig zur Kindlichen Kaiserin entsandter Bote kehrt nicht zurück. In ihrer Not fliehen die Blauschöpfe ins mächtige Reich Nazagur. Niemand weiß, warum es schneller wächst als jedes andere Land in Phantásien. Allein die junge Tahâma wartet im Tal der Blauschöpfe weiter auf den Boten. Schwer verletzt kehrt er zurück. Die Nachricht von der Flucht der Blauschöpfe nach Nazagur erschüttert ihn zutiefst. Tahâma versteht sein wirres Gerede nicht, während er ihren Armen stirbt. Nur so viel: Die Blauschöpfe schweben in großer Gefahr. Sie muss ihr Volk retten. Tahâma begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie nur mithilfe treuer Gefährten überlebt: den Erdgnom Wurgluck und Céredas, einen Jäger mit einem dunklen Geheimnis. Tahâma fühlt sich schneller zu dem wilden jungen Mann hingezogen, als ihr lieb ist. Als die drei Nazagur erreichen, fängt für sie der Albtraum erst an. Eine unheimliche Macht hält das Land in seinem Bann. Und nun streckt diese Macht ihre Krallen auch nach Tahâma aus. »... aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.« Sechs deutsche Autoren haben sich diesem bekannten Satz aus Michael Endes »Die unendliche Geschichte« angenommen. In der Tradition von Michael Ende unternehmen sie in der Reihe »Die Legenden von Phantásien« spannende Entdeckungsreisen in die Welt der Phantasie: Ralf Isau, Tanja Kinkel, Ulrike Schweikert, Wolfram Fleischhauer, Peter Freund und Peter Dempf erzählen die aufregenden Geschichten eines grenzenlosen Reiches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Die Seele der Nacht
Die Legenden von Phantásien
Roman
Prolog: Ein neues Kapitel
Das Buch schwebte in der Finsternis. Es strahlte in sanftem rötlichen Licht. Aufgeschlagen hing es da im düsteren Raum. Der Einband war aus kupferfarbener Seide. Zwei Schlangen ringelten sich über den Stoff. Sie bissen sich gegenseitig in die Schwänze und bildeten so ein Oval, in dem die Worte DIE UNENDLICHE GESCHICHTE zu lesen waren.
Ein Mann mit zerfurchtem Gesicht und hageren, faltigen Händen stand dort in der Dunkelheit und ließ einen Stift langsam und stetig über die Seiten wandern. Blaugrüne Tinte formte sich zu Buchstaben und Wörtern, die Wörter bildeten Sätze und die Sätze Geschichten. Der Schimmer der feuchten Tinte beleuchtete sein Gesicht. Die klaren Augen waren auf die Spitze des Stifts gerichtet, die Stirn in konzentrierte Falten gelegt. In dem düsteren Raum war es ganz still, obwohl um die Behausung des Alten der heulende Sturmwind strich. Die Wände des riesenhaften Eis, in dem der Mann stand und schrieb, schluckten jedes Geräusch aus der Welt dort draußen.
Die seltsame Behausung des Alten ruhte auf drei bläulichen Spitzen hoch oben auf dem eisig umwehten Plateau des Wandernden Berges. Niemals legte der Alte den Stift nieder, um etwa hinauszusehen, und noch niemals hatte er seinen Platz verlassen. Er schrieb und schrieb, ohne innezuhalten und ohne zu ermüden. Alles, was in Phantásien geschah, schrieb er auf, und was er aufschrieb, das geschah, denn das Buch, das er mit Worten füllte, war Phantásien, und Phantásien war das Buch, und selbst der Alte und das Buch waren in ihm aufgezeichnet.
Wenn er das Ende einer Seite erreichte, hob der Alte langsam den Stift. Er wartete einen Augenblick, bis die Schrift getrocknet war, dann griff er mit der Linken nach der Ecke des Blatts. Ganz leicht schlossen sich Zeigefinger und Daumen, gerade nur so fest, dass er die Seite umschlagen konnte und ein neues, unbeschriebenes Blatt vor ihm lag. Er zögerte nicht, setzte den Stift wieder auf und fuhr mit seinen Aufzeichnungen fort.
Die Worte erzählten von einem Mädchen mit langem, blauem Haar. Sorglos lebte es mit seiner Sippe in einem fruchtbaren Tal am Fuß der Nanuckberge, denn sie wusste noch nicht, was das Schicksal mit ihr vorhatte. Sie ahnte nicht, wie bald schon ihr gewohntes Leben voller Musik und Poesie zu Ende sein würde. Dann beschwor die Schrift die Gestalt eines jungen Jägers herauf, stolz und kraftvoll, mit der Zuversicht der Jugend, dass es ihm vergönnt sein werde, große Taten für sein Volk aus dem schwarzen Felsengebirge zu vollbringen. Voller Hoffnung machte er sich auf, die Mission zu erfüllen, zu der ihn der Rat seines Stammes ausgesandt hatte. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ er die Hochtäler zwischen den schroff aufragenden schwarzen Gebirgsspitzen.
Wieder blätterte der Alte um. Seine Gedanken verließen den Jäger und wanderten in ein grünes Land im Norden Phantásiens. Zwischen toten Kiefern stand eine trutzige Burg auf einem kahlen Hügel. Es dämmerte bereits. Düster schob sich der wehrhafte Bergfried aus alter Zeit in den Abendhimmel. Ein roter Mond erhob sich über dem Horizont. Bald folgte die silberne Sichel eines zweiten Mondes. Noch lag die Burg wie ausgestorben da, doch als Mitternacht nahte, regten sich Schatten. Sie krochen und flossen, schlichen und liefen auf das Burgtor zu. Es waren zottige Monster mit geifernden Rachen unter ihnen, andere Wesen erinnerten an große Spinnen mit langen, haarigen Beinen. Wieder andere krochen über den Boden wie Schlangen oder glitten auf zahllosen kurzen Beinchen dahin. Es gab große Wölfe und hyänengleiche Bestien mit säbelartigen Zähnen, doch auch Männer und Frauen waren dabei, so schien es im trüben Nachtlicht. Bei näherer Betrachtung glichen sie verwesten Leichen, die sich aus ihren Gräbern erhoben hatten. Boshaft funkelten gelbe und grüne Augen in der Nacht. Schweigend verharrten sie schließlich im Burghof. In den Städten und Dörfern des Landes hatte es gerade zur Mitternacht geläutet, da öffneten sich die Türflügel, die zur großen Halle des Palas führten, und der Herr von Tarî-Grôth trat auf die Treppe hinaus.
Fast sieben Fuß groß ragte seine Gestalt auf. Schweigend stand er da, der dünne Körper von einem weiten, schwarzen Umhang verhüllt. Selbst die klauenartigen Hände blieben in den Ärmeln verborgen. Die Kapuze jedoch hatte er zurückgeworfen, sodass das Mondlicht sich in seinem silberweißen Haar verfing, das ihm bis auf den Rücken hinabhing. Die Wangen waren eingefallen, seine Haut war totenblass und spannte sich eng um den Schädel, die schwärzlichen Lippen waren nur schmale, dunkle Striche. Es schien kein Leben in diesem Antlitz, nur die Augen, die tief in ihren Höhlen eingesunken lagen, glühten rot. Der Wind erfasste sein Gewand und blähte es wie Schwingen, das silberne Haar flatterte um sein Haupt. Langsam kam er die Treppe herunter. Man sah keinen Fuß unter dem Gewand hervorlugen, und seine Bewegungen waren seltsam fließend. Als er den Hof erreichte, knirschte kein Stein unter seinem Schritt. Die Schar seiner Schattenwesen sah ihn abwartend an. Eine zitternde Unruhe breitete sich aus. Endlich teilten sich die geschwärzten Lippen einen Spalt.
»Auf nach Gwonlâ!«, hallten seine Worte bis zum Tor hinunter. »Heute Nacht werden wir im Tal des Winolds unsere Gier stillen!«
1. Kapitel: Die Tashan Gonar
Tahâma hob den Kopf und lauschte. Sie kamen näher. Das schauderhafte Heulen war lauter geworden. Das Mädchen erkannte die Stimmen der großen grauen Wölfe aus den Nanuckbergen. Ob sie das Dorf schon erreicht hatten? Strichen sie nun hungrig durch die Gassen? Wieder erklang ein vielstimmiges Heulen und dann noch ein anderes Geräusch, das Tahâma zurücktaumeln ließ. Mordolocs! Einmal hatte sie einen gesehen und seinen Schrei gehört, als sie mit dem Oheim vor vielen Monden durch die Berge gezogen war. Tahâma presste sich die Hände an ihre schmalen, spitz zulaufenden Ohren, doch die Schreie klangen in ihr weiter und schmerzten sie am ganzen Körper. Mordolocs, die gefährlichen pelzigen Räuber mit einem schlanken Leib von fast zehn Fuß Länge, sechs flinken Beinen und einem Rachen voll giftiger Zähne, gehörten nicht in Tahâmas friedliche Welt. Das Blauschopfmädchen wusste, dass diese Raubtiere früher fern des Tales in den roten Felsen gelebt hatten, die die Wüste Vastererg umgaben. Doch nun waren sie über den Kamm der Nanuckberge gestiegen und strömten hinter den Wölfen und anderen Bergwesen zum Talgrund herab, wo das Dorf der Tashan Gonar inmitten eines frischgrünen Hains lag.
Wann hatte dieser Albtraum begonnen? Wann waren Furcht und Schrecken in das friedliche Land der Blauschöpfe eingedrungen? Vater sagte, der rote Mond hätte das Unglück angekündigt. Tahâma schloss die Augen und begann eine Melodie zu summen. Die Angst lockerte ihren Griff. Die schrecklichen Bilder verschwammen. Ganz deutlich konnte sie ihren Vater sehen, seine schlanke Gestalt in dem blauen, fließenden Gewand, sein geliebtes Gesicht. Sie hörte seine Lieder, mit denen er den Verzagten Mut machte und die Ängstlichen beruhigte. Früher hatte er nur Melodien der Liebe und der Harmonie, des Glücks und der Geborgenheit gespielt, doch heute mussten die Tashan Gonar andere Lieder anstimmen, um dem Schrecken zu begegnen.
Draußen, auf dem Platz vor dem Haus, erscholl ein Knurren, dann folgten ein Schrei und die Geräusche eines Kampfes. Tahâma öffnete die Augen, das Lied brach ab. Zögernd schob sie sich hinter der alten Truhe hervor, hinter die sie geflüchtet war, und kroch über den dunklen Dachboden zu dem winzigen Giebelfenster hinüber, das zum Marktplatz hinauszeigte. Im Garten unter ihr war nun der Lärm von zerbrechendem Glas und berstendem Holz zu hören. Offensichtlich waren die Kämpfenden dabei, ihre wertvollen Windinstrumente zu zerstören. Einige Saiten rissen mit einem schmerzhaften Ton. Tahâma richtete sich auf und spähte durch die Öffnung. Zwei schattenhafte Gestalten wälzten sich ineinander verkrallt über eine flache Schale mit duftenden Flamingoblüten und krachten dann gegen ein Gestell, an dem tropfen- und rosettenförmige Glasplättchen hingen. Klirrend regneten die kleinen farbigen Kunstwerke herab. Tahâma unterdrückte einen Seufzer.
Trotz ihrer jungen Jahre war sie eine begabte Windkünstlerin, und nun zerbrach die Arbeit vieler Monde unter den schweren Körpern der Kämpfenden dort unten. Hatten die Musik und die Schönheit der Windspiele in diesen Zeiten überhaupt noch einen Sinn? Jetzt, da das ganze Land in Gefahr war, verschlungen zu werden? Seine grünen Täler, die gewundenen klaren Bäche, die türkisfarbenen Seen, die Bäume der Wälder, deren Blätter sich zweimal im Jahr feuerrot färbten. Ja, selbst das Dorf der Blauschöpfe würde vielleicht nicht mehr lange bestehen. Es waren nicht die wilden Bergbewohner, die den Hain und das ganze Land bedrohten. Weder Wölfe noch Mordolocs hatten die Tashan Gonar aus ihren Häusern vertrieben. Die Gefahr, der sie nichts entgegensetzen konnten, kam lautlos daher, rückte heimlich und leise näher. Ein Schauder rann Tahâma über den Rücken, als sie daran dachte. Sie hatte es vom Grat oben gesehen oder, besser gesagt, nicht gesehen, denn dort, wo sich einst ein grüner Hügel mit einem fast kreisrunden See erhoben hatte, war nun nichts mehr. Auch der Kiefernhain mit der Quelle war verschwunden.
Entsetzt hatte Tahâma sich die Augen bedeckt. »Was ist das, Oheim? Wenn ich dorthin sehe, ist mir, als wäre ich plötzlich blind geworden.«
Der große Mann mit dem samtblauen Haarschopf nickte bedächtig. »Es ist das Nichts, Tahâma. Wir haben gehört, dass andere Länder Phantásiens davon betroffen sind, aber bisher waren die Nanuckberge und unser Tal davon verschont geblieben.« Seine elfenbeinweiße Stirn legte sich in Falten. »Ich wollte den wandernden Jägern keinen Glauben schenken, als sie mir davon berichteten, doch es ist wahr. Nun beginnt das Nichts auch unser Land zu vernichten. Komm schnell. Wir müssen beraten, was geschehen soll.«
Eilig machten sie sich auf den Rückweg. Die drei Häupter der Tashan Gonar trafen sich in der Turmstube und rangen viele Stunden um eine Lösung. Ihnen war klar, alleine würden sie das Nichts unmöglich bekämpfen können. So saßen sie zusammen, Thuru-gea, die Mutter der Harmonie, Granho, der Sohn des Rhythmus, und Rothâo da Senetas, der Vater der Melodien. Am Ende beschlossen sie, Rothâo solle zur Kindlichen Kaiserin reisen und sie um Rat fragen. Sofort packte er sein Bündel und rief mit einer alten Melodie einen Hippogreif zu sich. Das Wesen, halb Adler und halb Pferd, erhob sich mit Rothâo auf dem Rücken in die Luft und flog davon. Wochen vergingen, doch die Tashan Gonar warteten vergeblich auf eine Nachricht. Längst war der Hippogreif in seinen Wald zurückgekehrt, von Tahâmas Vater aber fehlte noch immer jede Spur.
Ein Jaulen riss Tahâma aus ihren Gedanken. Die beiden Kämpfenden unter dem Fenster stoben auseinander und verschwanden in der Finsternis. Das Mädchen reckte den Kopf noch ein wenig höher und spähte in die Gasse, die zu ihrer Linken auf den Platz mündete. Welche fremden Wesen waren noch in das Land der Blauschöpfe eingedrungen? Der weiße Kies schimmerte sanft im Licht des roten Mondes Rubus. Ein Schatten huschte am Haus des Glasbläsers vorbei, hinüber zur Werkstatt des Flötenschnitzers und teilte sich dann in zwei Gestalten. Ganz deutlich zeichneten sich ihre Silhouetten gegen den hellen Grund ab, als sie ins Mondlicht traten. Es waren große, kräftige Wesen mit behaarten Körpern, die sich auf zwei Beinen fortbewegten. Ihre Köpfe glichen denen von Hyänen, und wie Hyänen lebten sie in großen Rudeln zusammen. Sie jagten alles, was ihre Reißzähne bewältigen konnten, verschmähten jedoch auch Aas nicht. Tahâma kannte diese Wesen nur aus Erzählungen wandernder Jäger, aber diese Geschichten ließen sie vermuten, dass die beiden Gnolle nicht alleine ins Dorf gekommen waren.
Das Mädchen wich vom Fenster zurück. Sie wusste, dass weder die Wölfe noch die Mordolocs die steile Treppe zum Boden hochsteigen konnten, den Gnollen aber traute sie durchaus zu, die Häuser vom Keller bis zum Dach hinauf zu durchwühlen. Sie musste sich verstecken! Suchend sah sie sich auf dem Dachboden um. Kisten, Truhen und Schränke waren in der Dunkelheit kaum zu erahnen, doch sie wagte nicht, ihren Kristall zu benutzen. Sicher würde der Lichtschein von unten bemerkt werden. Sollte sie sich in einer der Truhen verstecken? Nein, wenn die Gnolle in das Haus eindrangen, würden sie Kästen und Truhen durchstöbern. Ihnen war sicher nicht entgangen, dass die Bewohner das Dorf verlassen hatten. Sie konnten also in Ruhe alles nach brauchbarer Beute durchsuchen.
Tahâma tastete sich zu einem Schrank hinüber, der an den Rändern und über den Türen mit prächtigen Schnitzereien versehen war. Auch in diesem Schrank würde sie nicht sicher sein, aber vielleicht darauf? Sie schob eine Kiste heran, kletterte auf einen Korb, dann auf die Kiste und schwang sich auf den Schrank. Seine Decke war groß genug, dass sie sich darauf ausstrecken konnte, und die Schnitzereien an der Front und an den Seiten verbargen sie von unten, zumindest wenn sie flach dalag. Staub drang ihr in die Nase. Sie unterdrückte das aufsteigende Niesen und lauschte mit weit geöffneten Augen den Geräuschen, die aus den Gassen und vom Marktplatz heraufdrangen. Wieder formte sich eine Melodie in ihr, deren Töne kaum hörbar zwischen ihren Lippen hervorperlten. Ihr Atem wurde ruhig.
Plötzlich schreckte Tahâma hoch. Sie musste eingeschlafen sein, denn nun drang bleiches Morgenlicht durch das Giebelfenster. Das Mädchen rieb sich die Augen. Was hatte sie geweckt? Waren die Gnolle noch immer unterwegs? Sie mieden das Sonnenlicht und hatten sich bestimmt an einen dunklen Ort zurückgezogen. Langsam richtete sich Tahâma auf und reckte die steifen Glieder. Da! War das nicht das Knarren der Treppe im unteren Stock? Das Mädchen lauschte. Sie konnte Schritte auf dem Holzboden unter ihr hören. Wollten sich die Gnolle während des Tages ausgerechnet in diesem Haus niederlassen? Die Schritte kamen näher, hielten immer wieder inne, strebten aber unaufhaltsam auf die schmale Stiege zu, die zum Dachboden hinaufführte. Tahâma zog einen kurzen Stab mit einem kleinen, wasserklaren Kristall an der Spitze aus der Schärpe ihrer Tunika. Dolche, Schwerter und Degen gab es nicht im Tal der Blauschöpfe. Kyrôl war ihre einzige Waffe, doch würde er genügen, sie vor einer Horde wilder Gnolle zu beschützen?
Die Holzstufen knarrten, eine Hand legte sich auf den Türgriff. Tahâma hob den Stab, bereit, die scharfe Tonfolge auszustoßen, die den Stein zum Glühen brachte. Quietschend schwang die Tür auf und gab den Blick auf eine schlanke Gestalt mit langem, fliederfarbenem Haar frei. In der Rechten hielt sie einen langen Stab, dessen Spitze bläulich flackerte. Ihr glattes Gesicht mit der fast durchscheinenden weißen Haut war in sorgenvolle Falten gelegt, die türkisfarbenen Augen tasteten über die Schatten des Dachbodens.
»Vater!«, rief Tahâma und ließ sich vom Schrank herabgleiten. Sie eilte zu ihm und schlang ihre Arme um die Gestalt mit dem alterslosen Antlitz.
Rothâo erwiderte die Umarmung und schob Tahâma dann eine Armeslänge von sich. Sie spürte die Zärtlichkeit in seinen türkisblauen Augen, als sein Blick aufmerksam über ihr schmales, blasses Gesicht strich, das tiefblaue Haar, das ihr bis zur Hüfte fiel, den zierlichen Körper, der von einer eng anliegenden Hose und einer geschlitzten, knielangen Tunika bedeckt wurde, bis zu den Füßen, die in weichen Schlupfschuhen steckten.
»Geht es dir gut, mein Kind?«, fragte Rothâo besorgt. »Bist du unverletzt?«
Tahâma nickte und umarmte ihn noch einmal. Sie presste ihre Wange an seine Brust, und es war ihr, als könne sie die Melodie hören, die er ihr als Kind vor dem Schlafengehen immer vorgesungen hatte. Er war ihr Mutter und Vater zugleich, denn ihre Mutter hatte sie nicht einmal kennengelernt, so früh war sie gestorben.
»Was ist geschehen? Warum ist das Dorf verlassen und du bist alleine zurückgeblieben?«, fragte Rothâo und schob die blassblauen Augenbrauen zusammen.
»Weil, weil …« Tahâma trat zwei Schritte zurück und hob die Hände. Wo sollte sie nur anfangen? »Lieber Vater, Ihr seid so lange weggeblieben, dass die Hoffnung zu schwinden begann, Ihr könntet Rettung für uns alle bringen«, begann sie, doch dann brach sie ab. Ein trüber Schleier hatte sich über Rothâos Augen gelegt und plötzlich taumelte er einen Schritt zur Seite. Der Stab mit dem blauen Kristall an der Spitze fiel zu Boden. Schwer atmend stützte sich Rothâo am Türrahmen ab.
Tahâma stürzte zu ihm. »Was ist mit Euch? Seid Ihr krank? Habt Ihr Hunger oder Durst?«
Rothâo richtete sich wieder auf. »Ich fürchte, einer der Mordolocs hat seine Zähne in mein Fleisch gegraben, bevor ich ihn vertreiben konnte«, antwortete der Tashan Gonar mit einem von Schmerzen verzerrten Lächeln. Er deutete auf den Saum seines silbernen Gewandes, das sich über dem linken Knöchel rot verfärbt hatte. »Ohne die Kraft der Harmonie und die Stärke des Rhythmus war selbst der mächtige Kristall Krísodul zu schwach.«
Aus Tahâmas Gesicht wich auch noch der Rest an Farbe. »Die Mordolocs haben Giftzähne«, hauchte sie. »Der Oheim hat es mir gesagt.« Sie zog des Vaters Arm über ihre Schulter, um ihn zu stützen, denn er wankte schon wieder. Langsam führte sie ihn in die prächtig bemalte Stube hinunter, deren Glasmosaikfenster zum Marktplatz hinauszeigten. Zwischen einer perlmuttschimmernden Harfe und einigen anderen großen Saiteninstrumenten lagen weiche Polster auf dem Boden. Früher standen stets Schalen mit kandierten Früchten und Nüssen auf den niedrigen Tischen, nun sammelte sich seit Wochen Staub auf allen Flächen.
Rothâo sank auf die Ruhebank vor dem Kamin und schloss die Lider. Sein Gesicht wirkte nun eingefallen, um die Augen bildeten sich dunkle Ringe, seine Haut war eiskalt. Tahâma eilte zum Kamin, schob eine Handvoll Laub zwischen die sauber gestapelten Scheite und setzte es mit ihrem Kristallstab in Brand.
»Wo sind Granho und Thuru-gea?«, fragte Rothâo, ohne die Augen zu öffnen.
»Sie sind mit den anderen davongezogen«, antwortete Tahâma leise. »Das Volk der Blauschöpfe ist schon viele Wochen unterwegs.«
Rothâo da Senetas nickte.
»Lasst mich Euer Bein ansehen«, sagte Tahâma. »Ich bin keine Heilkundige, wie Ihr wisst, doch vielleicht wird das Kristallwasser Linderung bringen.«
Der Vater lag bewegungslos auf der Ruhebank. Mit zitternden Händen schob Tahâma den kühlen, silbrigen Stoff hoch, bis die Wade sichtbar wurde, in der sich die blutigen Abdrücke zweier Zähne abzeichneten. Käme die Wunde von einem anderen Wesen, hätte Tahâma sie mit Kristallwasser gesäubert, eine beruhigende Weise auf der Harfe gespielt und sich weiter keine Gedanken um die Heilung gemacht, doch die schwärzlichen Ränder um die roten Kerben, von denen sich nun ein Netzwerk feiner Linien ausbreitete, trieben ihr Tränen in die Augen. Sie konnte nichts für ihn tun.
Trotzdem eilte sie ein Stockwerk tiefer in die Bibliothek der Melodien, in deren Mitte ein kleiner Brunnen sprudelte. Tahâma vermied es, die leeren Regale anzusehen. Sie schöpfte einen Krug Wasser und eilte damit zurück in die Stube, betupfte die Wunde und verband sie, doch der Vater reagierte nicht. Schlief er oder dämmerte er schon dem Tod entgegen? Das Mädchen verbot sich solche Gedanken. Sie lief in die Küche hinunter, holte einen Krug mit starkem Kräuterwein und das frische Nussbrot, das sie sich gestern gebacken hatte. Sie packte auch noch einige süße Früchte und eine Schale Honig in ihren Korb, dann kehrte sie zurück an das Lager des Verletzten.
»Vater?«, fragte sie, und die Angst schwang in ihrer Stimme.
Rothâo öffnete die Augen, stemmte sich hoch und versuchte sich an einem Lächeln. »Rieche ich dein wundervolles Nussbrot? Wie lange musste ich es entbehren. Komm, setz dich zu mir. Spiele mir eine schöne Melodie.«
Das Mädchen zog eine schlanke weiße Flöte aus ihrer Tunika und setzte sie an die Lippen. Zarte Töne umwebten den Leidenden und glätteten sein vor Schmerz verzerrtes Gesicht. Schweigend aß er Brot und Früchte und trank vom gewürzten Wein. Das Mahl schien ihn zu stärken und seinen Geist zu klären.
Tahâma ließ die Flöte sinken. »Habt Ihr die Kindliche Kaiserin gesehen?«, fragte sie.
Rothâo schüttelte den Kopf. »Nein, sie hat keinen der zahlreichen Boten empfangen.«
Ihre Augenlider flatterten. »Andere Boten?«
»Ja, von überall aus Phantásien kamen sie, und alle erzählten das Gleiche. Sie sprachen voller Angst von dem unheimlichen Nichts, das ihre Länder zerstört. Leise und kaum merklich, doch unaufhaltsam.«
»Aber sie muss doch irgendetwas dazu gesagt haben?«, wandte Tahâma ein. »Sie kann doch nicht einfach zusehen, wie ihr Reich verschwindet!«
»Die Kindliche Kaiserin ist krank, sehr krank, und im ganzen Elfenbeinturm wurde hinter vorgehaltener Hand davon gesprochen, dass selbst die klügsten Ärzte keinen Rat mehr wüssten.«
»Sie wird doch nicht …«, hauchte Tahâma, wagte aber nicht, den Satz zu beenden.
»Sterben?«, ergänzte Rothâo und seufzte. »Vielleicht, ja, davon haben sie gesprochen, doch eine Hoffnung gibt es noch. Der Heiler Cairon, der Schwarz-Zentaur, ist mit AURYN unterwegs, um einen Krieger namens Atréju zu suchen. Die Gebieterin der Wünsche vertraut ihm, dass er Phantásien retten wird, also sollten wir es auch tun.« Erschöpft schloss Rothâo für eine Weile die Augen. Zitternd tastete seine Hand nach dem Becher mit dem Kräuterwein, doch er war schon zu schwach, um ihn an die Lippen zu heben. Tahâma stützte ihn und gab ihm zu trinken.
»Erzähle mir, was hier geschehen ist«, forderte er sie auf.
Tahâma rückte ein Stück näher und nahm seine eisigen Hände in die ihren. »Als Ihr auf dem Rücken des Hippogreifs abgereist seid, waren alle guter Hoffnung. Obwohl die Beobachter, die Granho in alle Teile unseres Landes geschickt hatte, berichteten, dass das Nichts sich ausbreitet und immer näher kommt, gingen die Männer und Frauen mit leichtem Sinn ihrem Tagewerk nach. Sie sangen, sie brachten die Saiten zum Klingen und pflegten weiterhin die Musik aller Zeitalter, denn sie vertrauten darauf, dass Eure Mission Erfolg haben würde und die Kindliche Kaiserin einen Rat wüsste.« Tahâma unterdrückte einen Seufzer. Rothâo sah sie traurig an.
»Nach einer Woche kam der Hippogreif zurück. Wir warteten voller Zuversicht, aber als Ihr dann ausbliebt, wuchs die Ungeduld. Der rote Mond nahm ab, der silberne Arawin wurde rund und verblasste wieder, doch von Euch fehlte jede Spur. Als Rubus wieder voller wurde, begannen die Tashan Gonar zu verzagen. Sie wollten nicht mehr spielen und singen, und Schwermut senkte sich auf uns herab. An dem Tag, als Rubus wieder voll und rund am Himmel stand, kamen zwei Fremde ins Dorf, ein Mann und eine Frau aus dem Land Nazagur.«
Rothâo zuckte zusammen und stöhnte auf.
»Vater, kann ich irgendetwas tun, um Eure Schmerzen zu lindern?«, fragte Tahâma erschrocken.
Er hob zitternd eine Hand und strich ihr über den üppigen blauen Haarschopf. »Fahre fort, mein Kind«, krächzte er.
Sie warf ihm noch einen beunruhigten Blick zu, dann sprach sie weiter. »Thuru-gea lud die Fremden ein, bei ihr zu wohnen. Am Abend, als alle im runden Haus beim Klang der Windharfen beisammensaßen, um mit den Gästen zu speisen, erhob sich der Vater des Rhythmus, um eine wichtige Entscheidung zu verkünden.«
Tahâma machte eine Pause und beobachtete voll Sorge, wie es um den Mund des Vaters schmerzlich zuckte. Sie stand auf, um im Kamin ein paar Scheite nachzulegen, und flößte ihm dann noch einige Schlucke Kräuterwein vermischt mit Kristallwasser ein.
»Sprich weiter!«, sagte er und umklammerte ihre Hand, als wolle er sie zerbrechen.
»Granho erklärte, die Gäste hätten ihm und Thuru-gea von ihrer Heimat berichtet. Nazagur sei ein großes, blühendes Land mit saftigen Wiesen und unendlichen Wäldern, mit Flüssen und Bächen und sanften Hügeln. Es gebe dort Felder mit Korn und Weiher voll von Fischen, und in den Wäldern tummle sich das Wild.«
Rothâo stieß einen dumpfen Laut aus, doch Tahâma sprach weiter.
»All das ist gut, sagte Granho, doch das unbegreifliche Wunder ist, Nazagur wird nicht vom Nichts bedroht! Nirgendwo gibt es Löcher oder Gräben, die sich weiten und heimlich vorwärtsfressen. Nein, Nazagur wächst sogar! Es dehnt sich aus und bietet Platz für neue Völker, die sich in diesem lieblichen Land niederlassen wollen.«
»Nein!«, schrie Rothâo plötzlich. Er bäumte sich auf, sein Blick huschte wie irr im Zimmer umher. »Das darf nicht sein! Bitte sag, dass es nicht wahr ist!«
Tahâma drückte ihn sanft auf das Lager zurück. »Alle waren damit einverstanden, in das verheißungsvolle Land zu ziehen, denn sie fürchteten, Ihr wärt auf Eurer Mission verunglückt und würdet nie zurückkehren. Bereits am nächsten Tag packten alle Tashan Gonar ihre Bündel, beluden die Karren mit Instrumenten und der gesammelten Musik und machten sich auf den Weg nach Nazagur. Ich blieb zurück, um auf Euch zu warten.« Ihre Stimme war nur noch ein Flüstern. »Ich konnte einfach nicht glauben, dass Ihr nicht wiederkommen würdet, dass Eure Mission scheitern könnte.« Sie tupfte ihm den kalten Schweiß von der Stirn. »Und wenn Ihr wieder gesund seid, dann werden wir gemeinsam den anderen folgen!«, fügte sie trotzig hinzu.
Der Vater stöhnte und schlug wild um sich. »Nein!«, schrie er. »Nein, du darfst nicht nach Nazagur gehen!«
Tahâma versuchte ihn zu beruhigen. »Es ist das Fieber und das Gift, das in Euren Adern kreist. Ihr müsst Euch keine Sorgen machen, unser Volk ist in Sicherheit. In Nazagur kann das Nichts ihnen nichts anhaben. Sie werden ein neues Dorf aufbauen, Melodien und Lieder pflegen und auf uns warten.«
Wieder schüttelte Rothâo wild den Kopf. »Nicht in Sicherheit«, stöhnte er, »in tödliche Gefahr reisen sie. Versprich mir, dass du keinen Schritt in dieses Land setzen wirst!«
»Aber Vater, welche Gefahren sollten dort auf uns warten? Wie kommt Ihr auf diesen Einfall?«
»Ich war dort«, keuchte er, und seine Augen verdunkelten sich, »der Schrecken, der dunkle Lord …« Seine Stimme versagte. Krampfhaft hob und senkte sich seine Brust.
»Ein schrecklicher Lord? Der Herrscher des Landes? Was habt Ihr dort erlebt, das Euch so entsetzt?«, fragte Tahâma erstaunt. In ihrer Vorstellung war Nazagur eine liebliche Landschaft. Wie konnten dort Angst und Schrecken herrschen?
»Ich habe ihn gesehen, ihn und seine Kreaturen.« Er schnappte nach Luft, sein Gesicht verfärbte sich bläulich. »Versprich es mir … dein Großvater …« Er brach ab. Noch einmal holte er Luft. »Sing«, krächzte er, »sing mir mein Totenlied!«
Mit tränenerstickter Stimme begann Tahâma zu singen. Es waren keine Worte, nur tröstliche Töne, die sich zu einer Melodie fügten. Ihre Stimme wurde kräftiger, die Tränen auf ihren Wangen trockneten. Noch immer streichelte sie die Hand des Vaters, die schlaff in der ihren lag.
Auf einmal erklang seine Stimme, kräftiger als zuvor. »Bring mir Krísodul!«
Das Mädchen beeilte sich, seinen Wunsch zu erfüllen. Rothâo löste den blauen Stein von der Spitze des Stabes und legte ihn Tahâma in die Hände.
»Er ist dein. Wer sonst wäre dazu ausersehen, ihn nun zu besitzen.«
»Aber Vater, wer bin ich, dass ich diesen Schatz annehmen könnte?«, rief Tahâma aus. »Ein unwissendes Kind, kaum ein paar Dutzend Jahre auf dieser Welt. Nur wer stark ist, vermag den Kristall einzusetzen. Seine Macht entfesseln können nur die drei Kräfte der Musik zusammen – habt nicht Ihr selbst mir das immer wieder erklärt?«
»Ja, du hast recht«, stimmte ihr Rothâo zu, »dennoch wird er dir helfen. Du bist stark im Willen und voll Zuversicht im Herzen. Tahâma, meine Tochter und Centhâns Enkelin, du bist begabt, die Vorsehung hat dich auserwählt. Glaube an dich, so wie ich es tue. Verwende Krísodul klug und erinnere dich stets an die Melodien, die ich dich gelehrt habe. In Melodie, Harmonie und Rhythmus liegt die Kraft, das darfst du nie vergessen. Der Stein wird dir helfen, deinen Weg zu finden.«
Er zog ihre Hand an seine Lippen und küsste sie. »Ich bin immer bei dir«, hauchte er. Ein Krampf schüttelte seinen Leib, sein Blick wurde trüb. Dann erschlaffte der Körper, seine Arme sanken herab, die Hände fielen zu beiden Seiten des Ruhebetts zu Boden.
Tahâma sah starr auf den leblosen Körper hinab. Sie konnte nicht singen, und es war ihr auch nicht möglich, ihrer Flöte nur einen einzigen Ton zu entlocken. Den Kristall in der Hand, saß sie nur stumm neben dem Toten. Ihr Verstand weigerte sich zu glauben, dass seine Geschichte nun zu Ende war. Der kluge Rothâo da Senetas, der mehr als einhundert Jahre im Rat der Drei die Geschicke der Tashan Gonar in Händen gehalten hatte. Zögernd küsste sie seine Stirn und schloss die türkisfarbenen Augen, deren Glanz für immer erloschen war.
Der Tag verrann. Bewegungslos verharrte Tahâma neben dem Leichnam ihres Vaters und ließ ihre Gedanken wandern. Fröhliche Erinnerungen schweiften durch ihren Sinn, wundervolle Melodien, die sie zusammen gesammelt und in fein verzierte Kästchen verpackt hatten, um sie für die Ewigkeit zu bewahren. Es war ihr, als schreite sie wieder staunend neben dem Vater an den Regalreihen voller Musikschachteln entlang, die nun verwaist waren. Eine Stimme hallte durch ihren Sinn: Er ist tot, er hat dich verlassen, für immer. Nun bist du ganz auf dich allein gestellt.
Es wurde Abend, die Sonne sank und tauchte den lieblichen Hain, in dessen Mitte das Dorf lag, in warmes Licht. Die spitzen blauen Dächer flammten in Purpur, die mit Blütenranken bemalten Wände schimmerten. Die letzten Strahlen drangen durch die vielfarbigen Fensterscheiben und brachen sich in den Kristallen der Windspiele, die vor jedem Haus standen und leise Melodien murmelten. Die Schatten krochen über das Dorf hinweg. Bald glühten nur noch Wolkenschleier am verblassenden Himmel.
In der Stube wurde es dunkel. Das Feuer war längst heruntergebrannt, aber noch immer rührte sich Tahâma nicht. Erst als die Nacht hereinbrach und von den Berghängen wieder das Heulen der Wölfe erklang, schreckte sie aus ihren Gedanken. Nervös sah sie sich um. Wo sollte sie die Nacht verbringen? Wieder auf dem Schrank oben auf dem Dachboden? Noch hatten die Gnolle dieses Haus nicht durchsucht, aber sie gab sich nicht der Illusion hin, dass sie sich das prächtigste Haus des Dorfes entgehen ließen. Sie erhob sich. Ihr Blick strich über den Toten auf dem Ruhebett. Seine Gesichtszüge waren nun friedlich, als würde er nur schlafen.
Sie konnte seinen Körper nicht einfach den Leichen fressenden Raubtieren überlassen! »Nein, ihr werdet ihn nicht bekommen!«, sagte sie. Auf den Dachboden schleppen konnte sie ihn allerdings auch nicht.
Tahâma stieg in die Küche hinab und packte sich ein Bündel mit Honigbrot, Trockenfrüchten und einem vollen Wasserschlauch. In der Halle der Melodien füllte sie drei kleine Flaschen mit Kristallwasser aus dem Brunnen, dessen schimmernde Schale auf einer Kugel aus gehämmertem Silber ruhte. Sorgfältig verstaute sie die Phiolen in ihrem Bündel. Sie waren ein kostbarer Besitz. Nicht nur konnte ein winziger Schluck den Durst eines ganzen Tages löschen, das Kristallwasser säuberte auch Wunden und erhellte, wenn man eine alte Weise dazu sang, einen trübsinnigen Geist. Nur gegen Gifte war es leider wirkungslos.
Aus ihrer Kammer holte sich Tahâma einen langen Umhang, der aus dem gleichen fließend weichen Stoff gemacht war wie ihre Tunika. Auch er wechselte die Farbe, von zartem Flieder über tiefes Blau bis zu dunklem Violett, je nachdem, welche Tages- oder Nachtzeit herrschte. Der wundervolle Stoff wärmte nicht nur bei Kälte und kühlte in der Tageshitze, er war immer rein wie die Töne ihrer Windharfe, er hielt Schnee und Regen ab, und er machte seinen Träger im dämmrigen Licht des Morgens und des Abends nahezu unsichtbar. Tahâma wusste nicht, welches Lied die Frauen, die den Stoff einst webten, bei ihrer Arbeit gesungen hatten, aber bei jedem Schritt schienen leise Töne aus ihrem Gewand zu perlen.
Noch einmal trat sie zu dem Toten, um von ihm Abschied zu nehmen. Sie bedeckte den Leichnam mit einem Seidentuch in tiefem Blau, der Farbe der Harmonie, die für die Tashan Gonar so wichtig war. Zu seinem Haupt und zu seinen Füßen zündete sie eine Totenkerze an, dann häufte sie Holz um seine Ruhestätte. Seinen knorrigen Stab, der den mächtigen blauen Kristall getragen hatte, legte sie auf seine Brust. Dann verbeugte sie sich vor dem Toten und stimmte sein Requiem an. Ihre Finger strichen über die Saiten der großen Harfe, die Flammen der Kerzen tanzten im Takt, sanftes Licht hüllte den Toten ein. Nachdem die letzten Töne längst verklungen waren, wogten die Harmonien noch lange durch den Raum.
Der Abschied nahte. Noch einmal blieb Tahâma am Totenbett stehen. Wenn sie jetzt gehen würde, dann wäre es für immer. Das Brüllen eines Mordolocs ganz in der Nähe schreckte sie auf. Waren sie von der Musik oder vom Kerzenlicht angelockt worden? Nun konnte sie auch das Jaulen der Gnolle hören.
»Ihr werdet immer bei mir sein, Vater«, sagte sie leise. »Eure Geschichte ist zu Ende, aber Ihr werdet wiederkehren. Als ein neues Wesen, in fremder Gestalt zwar, doch es wird Euer Lebensfunke sein, der in diesem Wesen weiterbrennen und eine neue Geschichte erzählen wird.«
Sie hob ihren kaum armlangen Stab, löste den kleinen, klaren Kristall und befestigte stattdessen Krísodul an seiner Spitze. Mit dem blauen Kristall berührte sie einen der Holzscheite und sang eine scharfe Tonfolge. Sofort züngelten Flammen am trockenen Holz empor. Sie entzündete den Holzring an drei weiteren Stellen, dann eilte sie hinunter in die Küche und schlüpfte durch die Hintertür in den Blumengarten.
Tahâma duckte sich hinter einen dichten Schmetterlingsblütenbusch, der im Hauch des Nachtwindes eine leise Melodie zirpte. Hier hinter dem Haus schien alles ruhig zu sein, doch vorn hörte sie die Schläge einer Axt, die in die mit Schnitzereien verzierte Eingangstür fuhr. Ihr Blick wanderte zum ersten Stock hinauf, wo hinter den Scheiben die Flammen emporschlugen. Es wurde Zeit zu gehen.
Geduckt eilte Tahâma im Schatten der Häuser entlang. Ohne einem der durch die Nacht streifenden Räuber zu begegnen, erreichte sie den Wald, der den Ort in Form eines Sterns umgab. Leichtfüßig lief sie zwischen den in der Dunkelheit grünlich schimmernden Stämmen nach Norden, bis sie den jenseitigen Waldrand erreichte. Nun erst gestattete sie sich, für ein paar Atemzüge stehen zu bleiben und zu lauschen. Sie hörte den Wind in den Wipfeln rauschen und den Gesang eines Nachtvogels, aber nichts, was eine Bedrohung erahnen ließ.
Dennoch war es zu gefährlich, hier am Boden auf den Morgen zu warten. Tahâma zog sich an einem der Stämme hoch und verschwand im dichten roten Blattwerk. Die Arme um den seidenglatten Baumstamm geschlungen, schlief sie, bis das Licht der Sonne sie wieder weckte.
2. Kapitel: Céredas
In derselben Nacht, in der Tahâma ihr Dorf verließ, wanderte eine Gestalt etwa zwanzig Meilen nordostwärts durch den Wald. Am Abend war sie noch unter dem lichten Laub vereinzelt stehender Eichen dahingeeilt, doch nun, da es auf Mitternacht zuging, rückten die Stämme immer dichter zusammen, und die belaubten Kronen waren längst zu einem undurchdringlichen Blätterdach verschmolzen.
Mittlerweile war es so dunkel, dass der junge Mann die Hindernisse auf seinem Weg eher ahnte als sah und daher gezwungen war, seine Schritte zu zügeln. Dennoch war er nicht bereit, seine Reise für einige Stunden zu unterbrechen. Er fühlte sich noch frisch, war er doch erst drei Tage unterwegs und hatte die letzte Nacht auf einem Mooslager geruht. Außerdem war sein Auftrag so wichtig, dass er keinen Aufschub duldete. Céredas kin Lahim war stolz darauf, dass sein Volk ihn auserwählt hatte, diese Reise zu unternehmen. Er sollte zum Elfenbeinturm eilen, die Kindliche Kaiserin um Rat zu bitten. Sie musste den Jägern aus dem schwarzen Gebirge jenseits der gelben Steppe gegen das Nichts helfen, denn sonst würde es bald keine Felsen mehr geben, durch deren Täler und über deren Höhen die Co-Lahims ziehen konnten, um Bären und Riesenfelsböcke zu jagen.
Trotz seiner jungen Jahre war Céredas schon ein erfolgreicher Jäger, davon zeugten die Zähne des Manticores, die er an einem Lederband um den Hals trug. Auch die giftige Rubinotter, mit deren rot-schwarz gestreifter Haut er sein langes Haar zurückzubinden pflegte, hatte er selbst erlegt. Fast zehn Fuß war die Schlange lang gewesen, die sich auf ihrem kräftigen Schwanz aufrichten konnte, um dem Gegner ihr tödliches Gift in die Augen zu spucken.
Der Rat der Co-Lahims bestand aus zehn Männern und Frauen, je zur Hälfte von den Ältesten und von jungen, kräftigen Jägern und Jägerinnen besetzt. Céredas war einer von ihnen und nun dazu auserkoren, sein Volk vor dem Nichts zu bewahren.
Wie fast alle Männer und Frauen der Felsenjäger war Céredas hochgewachsen – mehr als sechs Fuß groß – und von muskulöser Gestalt. Seine Haut glänzte im Sonnenlicht wie gebrannter Ocker, seine Haare waren von tiefem Schwarz und seine Augen dunkelbraun. Die Brust wurde von einem weiten Lederhemd verhüllt, die sehnigen Beine steckten in Wildlederhosen von einem roten Hirsch, im Gürtel hing ein Jagdmesser, und an den Füßen trug er kurze, weiche Stiefel. Ein weiter Umhang verhüllte seine kräftigen Schultern. Der Bogen und ein Köcher voller Pfeile hingen mit einem kleinen Bündel über seinem Rücken, und in der Rechten trug er eine leichte Axt mit silbernem Blatt.
Die Nacht schritt voran. Céredas blieb stehen und legte den Kopf in den Nacken. War er noch auf dem richtigen Weg? Schon lange war das Blätterdach so dicht, dass er die Sterne nicht mehr erkennen konnte, doch er hoffte wenigstens einen Schimmer des rötlichen Rubus zu entdecken, der um diese Nachtzeit im Süden stehen musste. Langsam drehte sich der junge Jäger um seine Achse, aber er konnte nicht einmal den kleinsten Schimmer des Mondes erspähen. Sollte er doch lieber hier rasten und auf die Morgendämmerung warten? In schnellem Schritt bei Tageslicht würde er den Zeitverlust rasch wieder gutmachen und riskierte nicht, von der Richtung abzukommen. Aber konnte man den Elfenbeinturm überhaupt mithilfe von Sonnen- und Mondenstand finden? Bewegte er sich nicht selbst, wie so vieles in Phantásien? Nicht zum ersten Mal huschte dieser Zweifel durch Céredas’ Gedanken, aber er schüttelte ihn ab wie ein lästiges Insekt. Seine Mission war wichtig, und er sehnte nichts mehr herbei, als den Elfenbeinturm zu finden. Das allein musste schon genügen, um ihn auf kürzestem Wege dorthin zu führen.
Céredas nahm Bogen und Köcher von der Schulter und warf sein Bündel zu Boden. Im Schneidersitz ließ er sich ins trockene Laub sinken, wickelte seinen Umhang fester um die Schultern und lehnte sich an die glatte Rinde einer Blutbuche. Die Axt noch immer fest in den Händen, schloss er die Augen. Sein Atem wurde ruhig und gleichmäßig, und doch blieben seine Sinne geschärft.
Bewegungslos saß er eine Stunde da, als sich plötzlich seine Lider ein Stück hoben. Er hörte ein Käuzchen fast lautlos vorbeigleiten, der Wind säuselte in den Wipfeln, und irgendwo erklang das Fiepen einer Maus, aber da war noch etwas anderes. Etwas Bedrohliches, das langsam näher kam. Es bewegte sich geschmeidig und geräuschlos, dennoch spürte Céredas den vertrauten Schauder im Nacken, der ihn stets vor Gefahren warnte. Seine Hand spannte sich um den Stiel der Axt. Vielleicht hatte ihn das Wesen nicht bemerkt. Was es auch war, dachte er, vermutlich hielt es nach einer anderen Beute Ausschau.
Céredas lauschte angestrengt. Kein Geräusch verriet ihm, in welcher Gestalt die tödliche Gefahr heranschlich. Plötzlich schnellte ein Schatten auf ihn zu. Mit dem Instinkt des Jägers duckte sich Céredas seitlich weg. Schon war er auf den Beinen und schwang seine Axt. Das Tier, was immer es war, landete auf dem weichen Boden, drehte sich blitzschnell um und setzte erneut zum Sprung an. Céredas sah zwei grün glimmende Augen und einen Rachen mit langen Reißzähnen auf sich zuschnellen. Wieder wich er aus und schlug mit seiner Axt zu, doch er verfehlte den Angreifer. Mit einem tiefen Knurren kauerte der sich nieder und spannte sich zum nächsten Sprung. Für einen Augenblick erkannte der Jäger einen riesigen Wolf mit zottigem Fell und einem fürchterlichen Rachen. Wieder wollte er ausweichen, nun aber hatte der Wolf seine Finte durchschaut und sprang zur selben Seite. Die Reißzähne bohrten sich in Céredas’ linke Wade und brachten ihn zu Fall. Schmerz loderte in einer heißen Welle durch sein Bein, aber er ignorierte das aufsteigende Schwächegefühl. Er kniff die Augen zusammen, hob die Axt und ließ sie mit aller Kraft herabsausen. Das Gebiss an seinem Bein ruckte, dann lösten sich die Zähne aus seinem Fleisch, und das Tier stieß ein klagendes Heulen aus. Lautlos, wie er gekommen war, verschwand der Wolf wieder in der Nacht.
Der Jäger unterdrückte ein Stöhnen. Nun, da die direkte Bedrohung vorbei schien, brandete der Schmerz mit aller Macht in sein Bewusstsein. Vorsichtig tastete Céredas über seinen linken Unterschenkel. Im Dunkeln erspürte er die Wunde und fühlte das klebrige Blut, das reichlich auf den Boden floss. Die Wunde schien tief zu sein, seine Knochen jedoch waren heil geblieben. Céredas zog sein Messer aus der Scheide und schnitt das zerfetzte Hosenbein bis zum Knie auf. Er trennte einen handbreiten Streifen vom Saum seines Umhangs und wickelte ihn fest um die verletzte Wade. Wieder jagte der Schmerz in brennenden Wellen sein Bein hinauf, doch noch immer gab der junge Mann keinen Laut von sich. Eine Weile saß er reglos da und wartete, bis das Pochen in der Wunde nachließ. Dann rutschte er zu einem dünnen Baum und zog sich daran hoch, bis er auf seinem rechten Bein stand. Behutsam belastete er den linken Fuß, aber ein Schwindel erfasste ihn und ließ ihn wanken. Schwer atmend klammerte sich Céredas an einen tief hängenden Ast.
Sollte er hier auf dem Boden den Rest der Nacht zubringen? Wenn der riesige Wolf zurückkehrte, würde er eine leichte Beute abgeben. Céredas straffte den Rücken. Er würde kämpfen und sein Leben teuer verkaufen, doch hatte er gegen dieses Biest eine Chance?
»Man hat immer eine Chance!«, sagte er leise zu sich selbst. »Du hast den Manticore besiegt und die Rubinotter getötet, du bist mutig und stark, und kein noch so großer Wolf kann dich das Fürchten lehren!«
Dennoch war es gefährlich, noch länger an diesem Ort zu bleiben. War nicht der größte Feind des Jägers der Leichtsinn? Prüfend zog Céredas an dem kräftigen Ast, den er immer noch umklammert hielt. Vielleicht konnte er sich ja noch ein Stück weiter hinaufziehen, bis er vor den Klauen und Zähnen des Riesenwolfes in Sicherheit war.
Céredas schloss beide Hände um den Ast und zog sich langsam hoch. Schwitzend und leise keuchend schwang er sich hinauf und blieb auf dem Ast sitzen, bis sein Atem sich beruhigt hatte. Dann richtete er sich vorsichtig auf, um nach dem nächsten Halt zu suchen. Bald war er mehr als fünfzehn Fuß über dem Boden. Erschöpft kroch er zum Stamm hinüber, lehnte sich dagegen und schlief ein.
*
Die Sonne ruhte noch hinter dem Horizont, doch Tahâma hatte ihr nächtliches Baumlager bereits verlassen und wanderte über die leicht gewellte Grasebene weiter nach Norden. Ein paar olivgrüne Grasböcke kreuzten ihren Weg, und ab und zu erklang der schrille Ruf der Erdhörnchen, die ihre Sippe vor einer drohenden Gefahr warnten, um dann blitzschnell in ihren Höhlen zu verschwinden.
Tahâma eilte voran. Sie versuchte ihre Gedanken von dem zu lösen, was sie hinter sich ließ, und stattdessen an das neue, verheißungsvolle Land zu denken und an die Freunde, die dort auf sie warteten. Die Sonne schob sich blutrot über den Rand der Berge im Osten und wurde mit jeder Stunde, die sie höher stieg, blasser und heißer. Bald glühte der Staub, den Tahâmas Füße aufwirbelten. Der Durst brannte in ihrer Kehle.
Zu Mittag rastete sie einige Minuten und erfrischte sich an einem Schluck Kristallwasser und einer Handvoll getrockneter Beeren, ehe sie ihren Weg fortsetzte. Über ihr kreisten zwei Adler im flirrenden Blau. Tahâma lauschte ihrem Ruf. Ein Musikstück kam ihr in den Sinn, und so summte sie die Töne im gleichmäßigen Takt ihrer Schritte. Am Nachmittag zeichnete sich der dunkle Saum des Silberwaldes am Horizont ab, wie es die beiden Reisenden aus Nazagur beschrieben hatten. Es war schon dunkel, als Tahâma den Waldrand erreichte. Wie in der Nacht zuvor wählte sie sich einen hohen Baum mit breiten Ästen als Lager und schlief tief und traumlos, den Baumstamm fest umschlingend.
Am nächsten Morgen machte sie sich auf, den Wald zu durchqueren. An manchen Stellen sah er nicht anders aus als der Hain im Tal der Blauschöpfe, doch dann traf sie immer häufiger auf knorrige Bäume, deren Blattoberflächen mal scharlachrot, mal gelb oder orange leuchteten, während die Unterseiten wie reines Silber schimmerten. Es war, als liefe sie durch Bögen und Lauben aus kunstvoll gehämmertem Silberschmuck. Der Wind strich durch die Blätter und ließ sie klingen. Wie zarte Glöckchen hörte es sich an. Später säumten wieder Eichen und Buchen ihren Weg, und der Boden war von Farnen und Moos bedeckt.
Eine Wegstunde weiter wichen die Bäume unvermittelt zurück und gaben den Blick auf eine kleine Lichtung frei. Tahâma hielt inne. Plötzlich war ihr, als würde sie beobachtet. Langsam trat sie in die Schatten der tief hängenden Zweige zurück und sah aufmerksam um sich. Sie griff nach dem Stab mit dem blauen Kristall an der Spitze, obwohl sein Lichtschein ihr bei Tag sicher keinen Schutz bieten konnte. Noch einmal tastete ihr Blick das Buschwerk zu Füßen der Bäume ab und blieb dann an einem saftig grünen Schirmblattstrauch hängen. Was war das dort zwischen den riesengroßen Blättern? Starrten sie zwei braune Augen an?
Tahâma zögerte noch einen Moment, dann trat sie auf die Lichtung, streckte den Kristallstab aus und rief: »Komm aus deinem Versteck. Ich habe dich längst gesehen!«
Nichts rührte sich. Sie rief es noch einmal, diesmal jedoch nicht in Tashan Gonar, sondern in Hochphantásisch, der Sprache, die alle Wesen in Phantásien verstanden. Die Wörter kamen ein wenig holprig heraus, aber sie war sich sicher, dass das Wesen, das sich dort im Busch verbarg, sie verstanden hatte.
»Wenn du dich nicht sofort zeigst, werde ich dich mitsamt dem Busch in einem einzigen Lichtblitz vernichten!«, drohte sie, obwohl sie wusste, dass sie viel zu schwach war, Krísoduls zerstörerische Kräfte zu wecken. Aber woher sollte das Wesen im Busch das wissen, beruhigte sich Tahâma, deren Herz vor Aufregung heftig schlug.
»Ich komme ja schon«, drang endlich eine Antwort aus der Tiefe des Buschs. Die schirmgroßen Blätter bewegten sich, dann tauchte ein schwarzhaariger junger Mann mit ockerfarbener Haut auf und musterte sie aus dunkelbraunen Augen. »Ich dachte immer, die Blauschöpfe wären ein friedliebendes Volk«, sagte er, und ein leichter Vorwurf schwang in seiner Stimme »Du bist doch eine von ihnen?« Er deutete auf das blaue Haar, das Tahâma nun mit Schwung auf den Rücken warf.
»Ja, ich gehöre zum Volk der Tashan Gonar«, antwortete sie stolz. »Und du? Wer bist du?«
Der junge Mann senkte den Kopf und legte seine rechte Hand an die Brust. »Céredas kin Lahim, ich bin ein Jäger aus dem schwarzen Felsengebirge einige Tagesmärsche weiter im Osten.«
»Ein Jäger, so, so«, sagte sie und trat einige Schritte näher, ohne den Stab zu senken. »Was lockt einen Mann, dessen Volk das Jagen und Töten verehrt, in den Silberwald?«
»Du brauchst das nicht so verächtlich zu sagen. Die Jagd ist eine hohe Kunst!«
Tahâma verzog das Gesicht. »Unsere Verehrung gilt der Melodie, der Harmonie und dem Rhythmus. Wir lieben das Spiel des Windes in unseren Werken aus Saiten und farbigen Kristallen. Das verstehe ich unter Kunst! Wir leben in Frieden mit der Natur, ohne sie zu berauben und zu töten.«
Céredas schürzte die Lippen. »Das ist ja sehr schön, und doch zielst du noch immer mit deinem Stab auf mein Herz, um mich zu töten, obwohl ich dich nicht einmal bedroht habe.«
»In fremden Ländern ist Vorsicht geboten«, erwiderte Tahâma. »Tritt endlich aus deinem Busch heraus und zeige mir, was du unter deinem linken Arm verbirgst.«
Umständlich schob der junge Jäger mit der rechten Hand einen Zweig zur Seite und humpelte dann, die linke auf einen starken Stock gestützt, auf die Lichtung hinaus. Eine Axt baumelte an seiner Seite, Rucksack, Köcher und Bogen hingen auf seinem Rücken.
Tahâmas Blick wanderte zu dem zerfetzten Hosenbein und dem blutigen Verband. »Was ist dir zugestoßen?« Sie steckte den Stab in ihre Schärpe und trat zu Céredas hinüber.
»Vor zwei Nächten wurde ich angegriffen«, sagte er und zog eine Grimasse. Im Stehen schmerzte sein Bein fast unerträglich, und da er fürchtete, gleich würde es wieder schwarz vor seinen Augen werden, ließ er sich auf ein Moospolster sinken. Das Mädchen setzte sich ihm gegenüber. Einige Augenblicke schwiegen beide und sahen auf den schmierigen Verband hinab, durch den an zwei Stellen gelbliche Flüssigkeit sickerte.
»Das ist nicht gut«, sagte das Blauschopfmädchen nach einer Weile. »Du solltest den Verband wechseln.«
Céredas nickte. »Ich weiß, das allein wird aber nicht genügen. Kennst du dich in der Heilkunde aus?«, fragte er voller Hoffnung.
Tahâma schüttelte den Kopf, rückte aber trotzdem noch ein Stück näher und löste den verklebten Stoffstreifen. Sie sah auf die tiefe Wunde, die von Eiter verklebt war und sich an den Rändern schwärzlich verfärbte. »Ich könnte deine Verletzung mit Kristallwasser säubern«, schlug sie vor und nahm ihr Bündel vom Rücken. Die Verletzung erinnerte sie an die qualvollen letzten Stunden ihres Vaters. War auch dieser Körper vergiftet? Würde sie schon wieder an einem Sterbelager wachen müssen? »Was war es, das dich verletzt hat?« Sie benetzte ein Tuch mit dem klaren Wasser und tupfte vorsichtig den gelben Schleim von der Wunde. Leise begann sie eine Tonfolge zu summen.
»Ein Wolf«, antwortete Céredas, »ein ungewöhnlich großer und kräftiger Wolf«, fügte er hinzu, so als wäre es ihm peinlich, von einem normalen Wolf verletzt worden zu sein.
»Das ist nicht ganz korrekt«, erklang eine schnarrende Stimme aus dem Gebüsch neben ihnen. Es folgte ein knarzendes Lachen. Die beiden fuhren herum, konnten jedoch niemanden entdecken.
»Es war kein ungewöhnlich großer Wolf, es war ein gewöhnlich großer Werwolf«, fuhr die Stimme fort. »Und um noch genauer zu sein, es war der Werwolf Gmork.« Die dichten Zweige des Mondbeerenbuschs zu ihrer Linken rauschten, und eine kleine, dürre Gestalt trat auf die Lichtung. Das Wesen war etwa zwei Fuß groß, mit dünnen Ärmchen und Beinen, die eher Wurzeln ähnelten, und einem tonnenförmigen Leib, der in einen groben Kittel von grünlicher Farbe gehüllt war. Das zerfurchte Gesicht war von erdigem Braun, auf dem Kopf trug es einen topfförmigen Rindenhut, auf dem eine gebogene grüne Feder steckte. »Wurgluck«, sagte das Männchen, zog den Hut und verneigte sich. »Ich wünsche den Reisenden einen glücklichen Tag.« Er setzte den Rindenhut wieder auf und tippelte mit eiligen Schritten auf das gegenüberliegende Gebüsch zu.