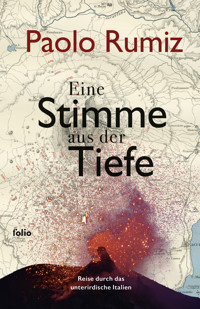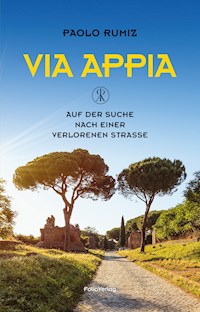Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der Po, eine unbekannte Welt, ein grandioses Abenteuer: Kulturgeschichte von Italiens größtem Fluss. Italiens König der Flüsse ist einer der letzten blinden Flecken auf der Landkarte. Paolo Rumiz hat ihn zu Wasser erkundet: mit Kanu, Barke, Segelboot, von den Gebirgen des Piemont bis zur Mündung ins Adriatische Meer. Den selbsternannten Argonauten rund um Rumiz erschließt sich eine Welt ungeahnter Freiheiten. Wo oben, hinter dem Damm, der Verkehr tost, regiert auf dem Wasser die Stille, nur die Stimme des Flusses spricht. Die Reisenden lagern an verlassenen Ufern, nachts kreuzen Schmuggler und Piraten ihren Weg, Fischer erzählen von ihren Fängen und die Speisepläne spiegeln die Vielfalt von Natur und Mensch wider.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAOLO RUMIZ
DIE SEELE DES FLUSSES
AUF DEM PO DURCH EIN UNBEKANNTES ITALIEN
Mit Fotografien von Alessandro Scillitani
Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl
Inhalt
Die unendliche Landkarte
Teil eins
Sechs Piraten; Die Lampe; Unsichtbar zwischen den Weiden; Song of the paddle; Die ersten Zuflüsse; Die Katastrophe; Allein am Abend; Der schiefe Baum; Am Ufer in der Dunkelheit; Der Traum von der Zugfahrt; Der tote See; Die Kaimauern; Das große Tal; Die Fahnenflucht des Wassers; Viehherden und Reisfelder; Der Aderlass; Schatten über dem Fluss; Nebel; Graumohn
Teil zwei
Rudern wie in einer Gondel; Der Schmetterling; Die Brücke und der Mond; Die Litanei; Verschwundene Mäander; Grillen am Tag; Mischlingswasser; Das Mastodon; Schlaflose Nacht; Die glühend heiße Stunde; Der Name; Die Mündung eines Gebirgsbachs
Teil drei
Die Epiphanie des Segelboots; Schatten auf dem Lago Gerundo; Lust auf Schiffbruch; Unter Deck; Mäander; Der vergessene Hof; Stimmen in der Nacht; Der heilige Fährmann; Die Najaden; Die Leitplanke; Malstrom; Der Riese; Annibale; Die Frau in Schwarz; Die Sperre; Piraten
Teil vier
Noch nie gesehene Fische; Ausverkauftes Wasser; Glühende Siebensilber; Der Seitenarm; Der Wels; Ibant obscuri; Wildbäche; Blues; Die Schaluppe; Der Walfänger; Der Raub; Paso doble; Die Wirbel des Zyklopen; Turbans und Kanus; Wendung nach Nordosten; Kanäle und Brennöfen; Das Pfeifen des Zuges; Hexensabbat; Der Schrei Persephones; Der Archipel; Die Prozession; Die letzten Brücken; Die Schatzinsel; Die sternförmige Festung
Teil fünf
In der Stille; Das Gewitter; Hinter der Brücke; Die Drachen; Der Barde Francesco; Das Opfer; Der Gesang des Bootsführers; Duft nach Meer; Die Worte des Buches; Der Leuchtturm; Die Insel
Teil sechs
Finis Terrae; Der Reißverschluss; Der Prophet; Das offene Meer; Rembetiko; Die Schildkröte; Der Zweisilber
Die unendliche Landkarte
Hinter Cremona hob kräftiger Wind an; Paolo Lodigiani machte den Motor aus und hisste das Segel. Eine plötzliche, verzauberte Stille umfing uns. Wir befanden uns im Bauch der italienischen Industrielokomotive; hinter dem Damm klirrten Stahlwerke, furzten Schweine und donnerten Lkws, doch auf dem Fluss herrschte absolute Stille, es ergab sich wie von selbst, dass wir leise sprachen. An Bord herrschte Schweigen. Valentina und Alex waren an Land geblieben, und wir waren weit weg von allem, zwischen mauerhoher Vegetation wie auf dem Mekong oder dem Mississippi. Das Besansegel hatte sich auf Dreiviertel gedreht, der Wind wehte quer zur Strömung. Paolo sagte: „Rückenwind nützt uns nichts, er ist genauso schnell wie das Wasser.“ Ich begriff, so entstand kein Auftrieb, deshalb starten Flugzeuge immer gegen den Wind. Ich setzte das Gaffelsegel, es füllte sich, drückte uns gegen den Damm links und einen Bauernhof namens Bandera.
Man hatte uns gewarnt: Mit einem Motorboot auf dem Fluss zu fahren ist, als würde man mit dem Motorroller durch die Uffizien brausen. Eine Schande, ein Sakrileg. So hört man nicht die Stimme des Gottes, der ihn bewohnt. Jeder Fluss hat einen eigenen Gott mit einer ganz individuellen Stimme und Strömung. Der Euphrat hat dasselbe Timbre wie die Seine. In der Kurve zwischen den Bergen, zwischen Esztergom und Budapest, brüllt die Donau, doch schon zweihundert Meter später wird sie zu einer flüsternden Panflöte, zu einem leisen Gesang, der sich im Gebiet zwischen Ungarn, Serbien, Kroatien und Rumänien, wo Drau, Mureş, Save, Theiß und March ein Meer bilden, verliert. Und der Nil, dessen Stimme ich ein Jahr davor eines Abends, zur Stunde der Löwen, in dem weitläufigen Gebiet zwischen Uganda und der Karthoum-Oase gelauscht hatte, war reine Polyphonie, eine Partitur, bei der jedes Rinnsal ein Notensystem war. Ganges, der Fluss der Hindus, trägt den Gesang bereits in seinem Namen, der auf das Fließen verweist.
Ich musste lange warten, bis ich die Stimme des Po hörte, obwohl ich ihn oft befahren hatte. Ich befand mich in der Gegend von Ficarolo, mehrere Gewitter über den Alpen hatten ein Hochwasser verursacht. Ich hatte ein Zimmer in einem ungefähr hundert Meter vom Ufer entfernten Gasthaus gefunden, in der Nacht hatte mich ein lang anhaltender Donner aus dem Schlaf gerissen, und ich war uf den Damm gerannt. Jenseits dieser Grenze feierte man die Epiphanie des Grauens. Millionen Bisons galoppierten im Mondlicht, witterten Blut, ein Schlachthaus, trampelten alles nieder. Der Schwerpunkt des Nordens, der labyrinthische Padus, der sogar römische Legionen in die Falle gelockt hatte, war ein Kanal geworden, ein geradliniger Abfluss, ein endloser Niagarafall. Ich beobachtete, wie das Übernatürliche sich für die Plünderung des Wassers rächte, die ganze Ebene verstummte infolge der schrecklichen Veränderung. In den Dörfern, den Ställen, entlang der Straßen und in den Wäldern schwiegen Menschen und Tiere vor Angst. Am Damm allerdings wimmelte es vor Lebewesen. In Mäntel gehüllte, argwöhnische Menschen, einem fernen Jahrhundert entsprungen. „Keiner schlafe“, hatte der Po mit Baritonstimme befohlen, und kilometerweit hatte die Menschheit schweigend gewacht, eingeschüchtert vom planetarischen Donner.
Nach zwei, höchstens drei Kilometern ließ die Bora das Segel des Gatto chiorbone, der sturen Katze, knattern. Inzwischen wussten wir: Aus geheimnisvollen Gründen weht die Brise auf dem Po untertags immer stromaufwärts, und in diesem Augenblick blies sie uns ins Gesicht. Die Geschwindigkeit des Wassers summierte sich zu der des Windes, der sofort auffrischte. Wir setzten auch das Klüversegel, das Boot bebte, schwoll an, vom äußersten Punkt des kurzen Spriets bis zum Steuer, und der Fluss und das Rahsegel machten ein Tänzchen, wir hüpften von einem Damm zum anderen, was uns in noch bessere Laune versetzte. Das Wasser sang und wälzte sich unter dem Holz des Kiels, und der Gatto miaute wie noch nie zuvor, die fünfeinhalb Meter lange Verschalung vibrierte. Inmitten dieser Symphonie verwandelte sich der zurückhaltende Paolo: Er strömte über vor Glück, er lebte das „hier und jetzt“ mit dem freudigen Fatalismus einer Initiation, überließ sich dem graugrünen, zwischen den Weiden dahinfließenden Teppich.
Dummerweise versuchten wir die Position zu bestimmen, als wüssten wir nicht, dass ein Fluss nicht das Meer ist. Wir hatten ein Dutzend Karten an Bord, und die zuverlässigsten waren die des Touring Clubs und die der Aipo, der überregionalen Po-Agentur. Doch seltsamerweise gaben sie unterschiedliche Distanzen an: 382 und 395 Kilometer Entfernung von der Quelle. War das möglich? Wir verloren nicht allzu viel Zeit, um uns den Kopf über diese Differenz zu zerbrechen: Der Campanile von Cremona lag ja hinter uns und der von Polesine Parmense vor uns. Was brauchten wir mehr? Alles war genau dort, wo es hingehörte. Die Insubrischen Alpen im Norden und der Apennin bei Parma im Südosten. Wir begriffen, dass die Positionsbestimmung eine lächerliche Hysterie der technologiesüchtigen Moderne ist, und überließen uns der köstlichen Ungewissheit der Pioniere. In diesem Augenblick offenbarte sich der Po als das, was er ist: eine Schlange, die hinkriecht, wo es ihr passt, sich mal klein und mal groß macht, auf ihrem Kiesbett ständig die Richtung ändert. Und dass es überflüssig und eitel ist, ihre Länge zu messen.
Aus meiner Jugend weiß ich, dass genaue Landkarten nicht dazu dienen, sich zu orientieren, sondern von Wegen zu träumen und sich vielleicht nach vollendetem Abenteuer daran zu erinnern. Für das Abenteuer auf dem Po hatte ich eine mit Hand gezeichnet, wie schon öfters bei wichtigen Reisen: eine drei Meter lange und sechzig Zentimeter breite, gefaltet wie eine Ziehharmonika. Ich hatte mehrere Wochen daran gearbeitet und wie besessen Notizen eingefügt, doch die Karte wurde nie fertig, weil ich noch immer Namen und Orte hinzufügte, vielleicht in dem Versuch, auch sie zu einem Fluss im Maßstab eins zu eins zu machen. Marlow aus Herz der Finsternis hatte mich dazu inspiriert. „Da war ein riesengroßer Fluss“, sagt Joseph Conrads Held, „auf der Karte sah er aus wie eine riesige, gelenkige Schlange, mit dem Kopf im Meer, der Körper schlängelte sich durch die weitläufige Ebene, und der Schwanz grub sich tief in den Boden. Ich stand vor der Karte in der Auslage des Ladens, so gebannt wie eine Schlange vor einem Vogel.“
Unterwegs öffneten wir oft die Karte, aber öfter noch am Abend, wie nebenbei auf einem Wirtshaustisch. Je nach Situation oder dem untersuchten Gebiet verwandelte sie sich in eine Seezunge, einen Aal oder eine Lamprete. Zwischen Tellern mit Lasagne und mit Bonarda gefüllten Gläsern wurde die perfekte Winkelhalbierende ein saftiger Servierteller, ein Fisch mit Rückgrat und dem doppelten Kamm der seitlichen Gräten, von denen jede einen Namen trug: Oglio, Adda, Panara. Sie war mein Teppich von Bayeux, mein verrückter topografischer Talmud, die chinesische Schlange, mein Jahrmarktsbuden-Loch-Ness, ein nebeliges Wesen, das man den Ufervölkern auf dem Seziertisch darbot. Beim Abendessen wurden die Notizen und Zeichnungen darauf immer dichter, und sie zog die Aufmerksamkeit von Gästen und Passanten auf sich, forderte die staunenden Einheimischen zu Ausrufen, Erinnerungen und Notizen heraus, und das stachelte mich an, noch mehr Kommentare hinzuzufügen.
Ach, die Osterie, die wunderbaren Stationen des Flusspilgers! Auf dem Meer gibt es keine. Das ist der erste Unterschied zwischen den beiden Wasserreichen. Deshalb fürchten sich die Menschen der Ebene vor dem Meer, gar nicht so sehr wegen dessen Unendlichkeit. Und deshalb sehnen sich die Matrosen auf dem Meer mehr noch nach den Osterie als nach ihren Frauen und nach Bordellen. In mezo al mare xe un’osteria, xe l’alegria del marinar. Mitten im Meer steht eine Osteria, das ist die Freude des Matrosen, singt man am östlichen Adriaufer, von Triest bis Montenegro, und beschwört etwas offensichtlich Unmögliches herauf. Tatsächlich ist die Adria, die Verlängerung des Po, das einzige Meer auf der Welt, auf dem man innerhalb eines Tages eine Osteria erreichen kann. Giacomo De Stefano, ein Veneter, der sein Leben in einem Boot ohne Motor verbringt und ohne Motor über den Po und die Donau gefahren ist, erzählt gern die Legende von den Trabaccoli, alten venezianischen Schiffen, die nie den Atlantik befahren haben, und zwar nicht aus dem banalen Grund, weil dieser groß und gefährlich ist, sondern einfach, weil sie, bei den Herkulessäulen angelangt, die riesige Fläche des Atlantiks sahen, begriffen, dass es im Atlantik keine Osterie gab, und umkehrten.
Die Reise ist nun seit geraumer Zeit vorüber, doch ich stelle fest, dass ich noch immer Details auf dem komplizierten Pergament hinzufüge. Das Wasser ist ein perfekter Erzählfaden, und da sich Reisen in der Erinnerung endlos fortsetzen, ist auch die Karte wie von selbst zu einer unendlichen Geschichte geworden. Aufgrund von Aktualisierungen ist daraus ein eigenständiges zu erforschendes Labyrinth geworden, mehr als die Darstellung einer geografischen Realität. Was für ein Genuss, sie nach abgeschlossenem Abenteuer wieder aufzuschlagen! Ich kann sie noch immer stundenlang wenn ich Eintragungen lese wie: „Die Falle des schiefen Baumes“, „Der tote See“, „Der verschwundene Lirone“, „Das Herz der Mäander“, „Der Mastodon-Kiefer“, „Die Linie wird zum Raum“, „Die Symphonie der Zuflüsse“ oder „Hannibals Furten“. Keine Orte, sondern Geschichten. Nicht die Karte eines Flusses, sondern einer Schatzinsel, ein Reiseführer, eine Route zwischen Untiefen, Gespenstern und Piraten. Aber kehren wir zu dem Augenblick zurück, als wir hinter der Schlinge von Cremona das Segel setzten. Ich sah, wie Paolo unter Deck ging und in dem Gepäck stöberte, das auf der Seite des Bugs in einem unordentlichen Haufen lag. Nach ein paar Minuten kam der Kapitän mit einem merkwürdigen Gerät wieder hoch, stellte es am Mastbaum auf, machte es an, stopfte die Pfeife mit einer Handvoll holländischem Tabak, setzte sich wie ein Satrap neben das Steuer und sagte: „Horch.“
Es war Giuseppe Verdis Maskenball, und tatsächlich näherten wir uns gerade der Heimat Verdis. Eine Stimme bahnte sich den Weg im Wind und begrüßte den Maestro.
la rivedrà nell’estasi / raggiante di pallore.
Ha, welche hohe Wonne wird mir dies Fest gewähren!
Die menschenleeren Ufer antworteten auf die Stimme aus den schwachen Lautsprechern des Gatto mit einem Regen von Kastanienblüten. Ich versuchte den Dialog im Libretto mitzulesen.
Ormai tre volte l’upupa / dall’alto sospirò / la salamandra ignivora / tre volte sibilò.
Schon dreimal von oben schrie der Wiedehopf / dreimal hat gezischt der Feuersalamander.
Stimmen, Pauken und Geigen verloren sich in der Ebene, Verdi füllte mit seiner Musik eine unermessliche Stille.
Wie eine Szene aus Fitzcarraldo, in der der Protagonist das Grammofon anmacht und die halbnackten Wilden am Ufer des Flusses verzaubert lauschen. Wasser, Wind und Musik zogen uns in den Sog der Zeit. Mithilfe des Librettos führte Paolo mich ins 19. Jahrhundert, in eine Welt unmöglicher Liebschaften, Verschwörungen und Intrigen, dann entkorkte er eine Flasche Barbera, und aus seiner Pfeife stiegen bernsteinfarbene Spiralen in den Himmel auf, der hinter uns in Flammen stand.
„Du wirst dich langweilen, der Fluss sieht immer gleich aus.“ So hatten mich die Kanufahrer, die an aufregende Fahrten durch Stromschnellen gewohnt waren, vor der Abreise gewarnt. „Der Fluss ist voller Gift“, diese Prophezeiung hatten mir die Leute mitgegeben, die sahen, dass ich an meinem Entschluss festhielt.
Jetzt, wo die Reise vorüber ist, kann ich sagen, dass das alles nicht stimmt. Die Reise auf dem Po war ein großartiges Abenteuer. Sie hat alle Hoffnungen, jede Vorstellung übertroffen. Jeder Kilometer war eine Entdeckung. Sie war ein Wunder, und wir haben es registriert und kartografiert, wir haben ihm gelauscht und es transkribiert. Siebenhundert Kilometer – darunter auch die Verästelungen des Deltas, die wir durchfahren haben – das sind tausendvierhundert Uferkilometer, die wildesten, einsamsten und freiesten auf der ganzen italienischen Halbinsel. Millionen Menschen drängen sich unter Sonnenschirmen, doch die Strände des Po, die von derselben Sonne beschienen werden, sind nach wie vor leer und glänzend wie die Namibias. Es ist überhaupt nicht dumm zu sagen: „Ich erforsche den Po.“ Über den wahren Po weiß man wenig oder nichts, obwohl tonnenweise Literatur über ihn geschrieben worden ist.
Oben habe ich „Piraten“ gesagt, aber nicht zum Spaß. Auch hier gibt es welche, genauso wie auf dem Mekong oder an der Küste Somalias. Geheimnisvolle, schnelle Boote, die nachts ohne Positionslichter fahren, Wilderer im Tarnanzug, nächtliche Drogenkuriere, Motordiebe, Händler und Schmuggler; Leute, die die Geste des Halsabschneidens machen, wenn man ihnen zu nahekommt. Andererseits sind wir nie, tatsächlich nie, Polizei- oder Carabinieri-Patrouillen begegnet und auch nicht den lauten Streifen der Föderalisten. Auf dem großen Fluss gibt es kein Gesetz. Das italienische Meer ist mit Hafenbehörden zugekleistert und erstickt vor Verboten, aber der Schwerpunkt der landwirtschaftlichen und industriellen Macht des Landes kennt weder Kontrollen noch Vertreter der Staatsmacht.
In der Republik Venedig gab es einen Magistrato delle Acque, einen Wasserbeauftragten, der alles über die Flüsse und Kanäle zwischen Adda und Tagliamento wusste. Italien hingegen verzichtet auf die Wasserhoheit, es verkehrt nicht auf den Gewässern, kennt sie nicht mehr, lässt sie verkommen, lässt zu, dass sie uns fremd werden wie eine Kolonie in Zentralafrika. Die Kriminellen wissen das, sie bewegen sich ganz frei auf dem Wasser. Auf dem Po kann man machen, was man will, das haben wir ganz schnell herausgefunden. Man kann an jedem Ufer anlegen und zelten, auf jeder Insel Feuer machen wie in einer Erzählung von Mark Twain.
Auf dem Po gibt es keine Kreisverkehre und keine Umgehungsstraßen. Er führt einen nicht in die Irre, und er kennt seinen Weg. Er lässt sich nicht betrügen und keine Zügel anlegen. Wenn man es doch versucht, tritt er über die Ufer, schwillt an, wird wütend, zahlt es einem heim. Er hasst Beton und fordert den Platz ein, der ihm zusteht. Der Fluss der Ebene ist eine wilde Anakonda, er kriecht überall hin und akzeptiert keine von Politik und Verwaltung gezogenen Grenzen. Man braucht ihn ja nur zwischen Emilia und Lombardei zu betrachten. Er würde gern mit den Windungen einer Schlange übereinstimmen, schafft es aber nicht. Vor Jahrzehnten ist ein Verlauf festgelegt worden, den es nicht mehr gibt, und deshalb hat er die Funktion einer Demarkationslinie verloren, ist zu einer Linie geworden, die nichts trennt. Teile der Lombardei befinden sich nun im Süden und Teile der Emilia nördlich des Flusses. Die Grenze ist einfach lächerlich, umsonst versucht sie dem Flusslauf zu folgen.
Es gibt nichts Freieres als einen Fluss. Vielleicht gehen ihm die Italiener, die den Mächtigen jahrhundertelang die Hand geküsst haben und vor ihnen Kniefälle gemacht haben, deshalb aus dem Weg, und vielleicht ignoriert ihn deshalb die Politik. Heerscharen von Müttern halten ihre Kinder vom fließenden Wasser fern. In Motta Baluffi, einen Steinwurf vom Damm entfernt, habe ich Menschen kennengelernt, die den Po nur von Autobahnbrücken aus gesehen hatten. In San Mauro Torinese lebt ein Großvater mit seinem Enkel, der sich darüber wunderte, dass ich das Ufer hinter einem Wald von Leitplanken suchte; er selbst wollte nie zu dem Fluss gehen, an dem er zur Welt gekommen war. Ich habe zwar am Ufer Hunderte von Fischern kennengelernt, aber alle beschränkten sich auf ihr Segment des Flussufers. Sie wunderten sich vielmehr darüber, dass wir von so weither kamen, als ob der Fluss in seiner Ganzheit gar nicht vorstellbar wäre, als ob es eine Idiotie wäre, ihn zu befahren.
Deshalb waren wir ganz allein auf dem Großen Vergessenen unterwegs, einsam zwischen Schilf und Welsen, Gespenstern von Argonauten und Goldsuchern, auf der Suche nach Ziehharmonikas und Uferhäuschen, die Datschas aus der Sowjetzeit glichen. Bis heute gibt es keine Karte, auf der der ganze Verlauf des Po dargestellt ist, samt Brücken, Wirtshäusern, Museen, Inseln, Straßen, Zuflüssen, Staumauern, gefährlichen Stellen und Zugängen vom Festland aus. Sicher, es gibt eine Karte der Landeplätze, ein Verzeichnis der Radwege oder der Uferrestaurants. Aber es gibt kein Gesamtbild, das den Italienern vor Augen führt, was sie versäumen. Dies ist vielleicht der erste Versuch, eines herzustellen.
Der Po, ein Archipel unterschiedlicher Erinnerungen, braucht vielleicht einen großen Regisseur, der ein einheitliches Bild von ihm entwirft, jemanden, der eine systematische Zählung der Augenzeugen einer untergehenden Welt vornimmt. Studenten der nahen Universität in Pollenzo – am Nebenfluss Tanaro – haben ihn vom Anfang bis zum Ende befahren und Fragmente von Geschichten gesammelt, doch der Großteil der Arbeit steht noch aus. Der Fluss ist Leben, Mythos, Religion, Arbeit, Freizeitvergnügen, Transportmittel, Botanik, Zoologie, Hydraulik und vieles mehr, aber es gibt kein Bild, auf dem man alle diese Aspekte gemeinsam betrachten könnte. Es heißt, das Wasser lässt sich nicht stückweise verwalten. Die Manipulationen talwärts rächen sich talaufwärts. In einer Entfernung von hundert Kilometern.
Trema la terra / il ciel s’oscura / ma quei dal Po i n’gha mai paura! Die Erde bebt / der Himmel verdunkelt sich, doch die Leute am Po fürchten sich nicht!: Das hatte mir ein Mantuaner aus der Tiefebene vorgesungen, fast als ob er ahnte, dass in diesem Frühling ein Erdstoß Modena und Ferrara erschüttern würde. Er sollte recht behalten. Doch die Menschen in der Po-Ebene hatten selbst in den Tagen des Erdbebens etwas, das ihnen Trost spendete, an das sie sich klammern konnten. Und zwar den Fluss, der keine Katastrophen kennt und weiterfließt. Der Po war das Bild der Kontinuität des Lebens. Nachdem die Häuser eingestürzt waren, suchten viele Menschen zwischen Mirandola und Carpi ausgerechnet am Flussufer Trost, bei dem frei und furchtlos dahinfließenden Wasser, das sich sogar über die zerstörerische Kraft der Natur hinwegsetzte, weil es selbst unzähmbare Natur war. Am Ende der Reise, nach der Katastrophe, sind wir auf den Fluss zurückgekehrt, und abgesehen von ein paar Rissen am Damm hatte sich nichts auf ihm verändert. Nur die vom Menschen geschaffenen Dinge trugen die Zeichen der Vergänglichkeit.
Ich hatte ihn hofiert, über ihn gelesen, ihn studiert, mir ihn vorgestellt, ich war ihm auf seinem Halbkreis am Fuße der Alpen gefolgt, um vom Bauchweh im Norden Italiens zu erzählen. Vom großen Tal aus hatte ich die schiefen Ebenen der Zuflüsse vermessen; diese sind am linken Ufer lang, mächtig und regelmäßig, am rechten Ufer sind es reißende Bäche. Ich hatte die schönen Brücken gezählt, den Vibrationen gelauscht, wenn Lastwagen und Züge über sie donnerten. In Trockenzeiten war ich mit dem Wasser bis zum Gürtel durch ihn gewatet, bei Hochwasser war ich am Ufer mit dem Rad an ihm entlanggefahren oder -gegangen. Ich hatte ihn im Auto überquert, war bei unzähligen Flugzeugstarts und -landungen über ihn geflogen; bei meiner Reise von der Kwarner Bucht bis zu den Meeralpen und von den Meeralpen bis zu den Marken entlang der Gotenstellung hatte ich den Nebel in der Ebene gesehen. Ich glaubte ihn zu kennen, wusste jedoch nichts über ihn. Einen Fluss lernt man erst kennen, wenn man ihn befährt.
Und außerdem will ich Folgendes sagen: Es würde schon reichen, wenn man ihn in Ruhe ließe. Wenn er nicht manipuliert würde, wäre er imstande, die Abwässer einer Stadt wie Mailand zu klären. Sein Kiesbett ist ein idealer Filter. Doch wir lassen ihn nicht in Frieden. Auf dieser Reise haben wir immer wieder Schreckliches gesehen. Unter den Brücken von Moncalieri mussten wir über spitze Eisengegenstände, Waschmaschinen, Matratzen und Autowracks klettern. In Casalgrasso, zwischen Saluzzo und Turin, mussten wir die Kanus über Abfallhaufen, über Dornen und giftigen Schlamm ziehen, nur so konnten wir eine abbröckelnde Staumauer überwinden. Hinter Piacenza mussten wir das Boot mit einem Kran über die Staumauer des Kraftwerks Isola Serafini hieven; die Schleuse talwärts funktionierte nicht, weil sich das Flussbett eben aufgrund der Staumauer abgesenkt hatte. Italien schert sich nicht um die Flussfahrer.
Doch obwohl dem Fluss soviel Schaden zugefügt wird, regeneriert er sich immer wieder, er war immer sauberer als gedacht. Ich staunte mehrmals darüber, dass er sich die ursprüngliche Reinheit teilweise bewahrt hatte. In den Lambro hat man Rohöl eingeleitet, doch auch er hat sich erholt. Die Flüsse sind die Nieren einer Nation. Es ist eine Schande, den Po mit riesigen Stauseen lahmzulegen, wie die Lombardei es macht. „Als könnte der Mensch auf die perfekte Dialysemaschine der Nieren verzichten“, so mein Freund Giovanni Damiani vor der Abreise, er ist übrigens der Urheber meiner aberwitzigen Flussleidenschaft.
Noch eine Warnung an alle, die dieses Buch lesen: Wir sind nicht bei der Quelle in Pian del Re aufgebrochen. Das wäre allzu abgeschmackt gewesen. Das haben uns die verdorben, die das Wasser vergöttert haben, damit sie es besser vermarkten können. Niemand kommt mehr auf die Idee, an die Quelle zu pilgern und dort eine Ampulle Wasser zu entnehmen, wie es ein schlauer Anhänger „Padaniens“ getan hat. Schauen Sie sich die Piave an: Zuerst wurde sie zum „heiligen Fluss“ erklärt, dann zerstört, und jetzt ist sie nur noch eine Kieswüste.
Wir wollten keine Fiktion schaffen, deshalb haben wir jenen Teil des Po ausgelassen, der nicht schiffbar ist. Wir wollten Italien vom Wasser aus kennenlernen. Deshalb haben wir uns bei den sanften Stromschnellen von Staffarda eingeschifft, vierzig Kilometer unterhalb des monolithischen Monte Viso, und sind bis ins Schilf des Nebenarms Po di Goro gefahren. Dort haben wir zu Füßen des von der Tramontana gepeitschten Leuchtturms in Bacucco ein Zelt aufgeschlagen, in der Abenddämmerung mit dürren Zweigen ein Lagerfeuer entfacht und zur Gitarre Old man river gesungen. Aber nicht einmal im Delta war die Geschichte zu Ende. Wir wollten das Meer erleben und sind zu diesem Zweck andere Nebenarme entlanggefahren und haben schließlich ein zweites oder sogar drittes Finale der Geschichte gefunden.
Ich bin in einer Stadt am Meer zur Welt gekommen und lebe noch immer dort. Ich bin über die Adria, das Ionische Meer und die Ägäis gesegelt. Ich empfinde riesengroßen Genuss, wenn ich ein Ruder ins Wasser tauche. Mit drei Jahren habe ich schwimmen gelernt, und bei gutem Wetter schwimme ich sogar im Winter. Doch nach diesem Abenteuer auf dem Po hatte ich das Gefühl, dass ich das Meer noch nicht wirklich kennengelernt hatte. Es ist eine Sache, an Bord zu gehen und sofort in See zu stechen. Eine ganz andere ist es, aufs Meer hinauszufahren, nachdem man tagelang in einem endlosen Labyrinth aus Sand, Pappeln und Mäandern gefangen war.
Aus einem geschlossenen Raum hinauszufahren und den endlosen Horizont zu sehen. Dem Geheimnis beizuwohnen, wie aus einer Linie Raum wird. Zu spüren, wie das trübe Süßwasser sich in die salzige Lagune verwandelt und sich mit dem Wind, der Strömung und den Gezeiten erneuert. Sich im grenzenlosen Delta verloren zu fühlen. Den Stimmen der Schiffbrüchigen zu lauschen, die sogar im nebeligen Delta aus den Tiefen rufen. Zu spüren, wie etwas im Augenblick des Todes neugeboren wird. Solche Dinge verändern das Leben.
Aber beginnen wir beim Anfang.
Teil eins
Prospector
Sechs Piraten
In der Abenddämmerung betrachteten wir von der Brücke aus die Strudel des noch jungen Flusses, ohne zu wissen, was uns talabwärts erwartete, und ohne ein Gefühl für die Entfernung zum Meer zu haben. Wir waren drauf und dran, in den dichtest bevölkerten Teil Italiens einzudringen, den nervösesten und produktivsten, wo sich das Schicksal der Nation entscheidet, doch dieses Knäuel an Interessen, Orten und Menschen sollte unserem Blick verborgen bleiben. Wir wussten nicht einmal genau, welche Hindernisse uns erwarteten. Valentina und Flavio hatten den Flusslauf zwar vom Festland aus erkundet, doch nicht einmal sie, die erfahrensten Kanufahrer der Gruppe, kannten ihn zur Gänze. Die italienischen Kanufahrer sind merkwürdige Leute: Sie sind zwar imstande, über die schwierigsten Gewässer des Landes zu fahren, doch sie ignorieren den Fluss der Flüsse. Zu einfach, sagen sie, zu banal und vielleicht auch fad.
Über den Po gibt es jede Menge Abhandlungen und auch Spezialreiseführer, doch der Wasserweg ist nach wie vor unbekannt. Mit einem Wort, am Anfang wussten wir nichts über ihn. Giancarlo Nardoni, der Besitzer des Ostello del Po, versicherte uns, dass der Po bis Villafranca Wasser führte und es somit unwahrscheinlich war, dass man hinter Staffarda auf Grund lief. Der Rest war ungewiss. Über die berüchtigte Staumauer in Casalgrasso, ungefähr zwanzig Kilometer talabwärts, oder über die mit Beton und Eisen gespickten Brückenpfeiler in Moncalieri gab es nur Gerüchte. Ich dachte, vielleicht war es besser so. So würde das Abenteuer größer sein. Bei allen meinen Reisen hatte es sich immer am meisten gelohnt, über das Unvorhergesehene, wenn nicht gar über die Hindernisse zu erzählen.
Eines möchte ich gleich klarstellen: Eine Flussexpedition ist ein riesiges Chaos. Eine Materialschlacht: wasserfeste Schlafsäcke, Socken, Funktionsunterwäsche, Wasserbehälter, und natürlich auch Pullover, trotz der Hitze, man kann ja nie wissen. Und dann die verdammten Begleitautos, die man nicht los wird und zu denen man Abend für Abend mithilfe irgendeines Wohltäters gelangen muss. Ganz zu schweigen vom Logbuch, das immer Gefahr läuft, unterzugehen, und deshalb in einer wasserdichten Tasche verstaut werden muss.
Und dann gab es da noch Dinge, die die Sache zusätzlich komplizierten: Alex’ Kamera, sein Stativ und ein Haufen technische Apparate, die den Fluss fürchteten wie die Pest. Ich hatte von einer Reise in völliger Freiheit à la Huckleberry Finn geträumt, mit Schlafsack, Zelt und Biwaks auf dem Kies. Doch ganz im Gegenteil, adieu Leichtigkeit. Der Schatten der Logistik legte sich auf das Abenteuer, und das Festland mit seinen Komplikationen ließ uns einfach nicht los. Wir waren viele, vielleicht zu viele. Fünf Männer und eine Frau. Sechs Gläser Bier aufgereiht am Tresen des Ostello, im letzten Licht der Sonne, die schon tief über der Brücke stand, dort, wo der Fluss aus den Bergen hervorbrach und in die Ebene floss.
Wir waren völlig unterschiedliche Charaktere. Ohne die brünette Valentina, stets auf der Suche nach Bergen, Flüssen und Schlamasseln, wäre die Reise unmöglich gewesen; im Augenblick der Abfahrt trug sie eine irritierende Ruhe zur Schau. Der gute Alex mit seinem grauen Bürstenhaarschnitt war wie gelähmt angesichts der Entscheidung, welche komplizierten Gepäckstücke er mitnehmen sollte. Der winzige Pierluigi mit dem wachen Blick, ein begeisterter Wanderer, war in Gedanken noch immer in den Bergen rund um die Quelle des Ganges, von wo er gerade zurückgekehrt war, nach tausend Kilometern auf unmarkierten Wegen. Flavio, mit der Statur und der Mähne eines Wikingers, ein langgedienter Kanufahrer, schwieg und genoss unsere Verwirrung. Und dann war da noch Angelo Bosio mit seinem bronzefarbenen Körper, der Älteste der Gruppe, er kaute auf seiner Toscano, glücklich, wieder eine Reise auf dem Fluss seines Lebens machen zu dürfen. Gemeinsam mit mir, dem Autor, waren wir dreihundertzweiunddreißig Jahre alt. Das Durchschnittsalter betrug fünfundfünfzig Jahre. Eine Expedition von Senatoren mit tausend Wehwehchen, aber der Neugier von Jugendlichen.
Die Sonne war untergegangen, rund um den Monte Viso erlosch der berühmte Fächer aus Lichtstrahlen, doch der Fluss floss über eine Unterlage noch funkelnder Goldklumpen. Am Fuße der Alpen ist der Po eine Goldmine, die Dora Baltea, der Bormida und der Sesia spülen in Gebirgshöhen Goldsplitter aus. „Die Sesia“, sagte ich leise zu mir, in der weiblichen Form. Ich hatte den männlichen Artikel satt, der die Flüsse Italiens militarisiert. Man sollte ein Buch über das Geschlecht der Flüsse schreiben. Wer weiß, dachte ich, vielleicht ist der Po ein Hermaphrodit; vor einiger Zeit hatte ich gehört, dass er in der Gegend von Viadana als „Flüssin“ bezeichnet wurde.
Aber es ist an der Zeit zu erzählen, wie diese Geschichte begonnen hat. Es war Winter, es schneite, in einer Hütte in der Provinz Mantua hatten wir ein großes Kaminfeuer entfacht. Mein Freund Fausto De Stefani, seines Zeichens Alpinist und Wohltäter, mit Rauschebart und langen Haaren, herrschte von dieser Hütte aus über einen ganzen Hügel. Das war seine Arche Noah, sein Schützengraben, in dem er Widerstand gegen die Betonierer leistete. Er besaß Esel, Ziegen, Enten, Hühner und Dutzende Freunde, die ihm dabei halfen, das Unterholz sauber zu halten und die Tiere vor den illegalen Überfällen der Jäger zu schützen. Er ließ Kinder zu sich kommen, zeigte ihnen die Natur und bezauberte sie mit seinen Erzählungen. Eines Tages erzählte ich ihm vom Po, und er lud mich mit anderen Kandidaten zu einer Reise ein. Er deckte den Tisch, machte zum x-ten Mal ein Feuer, und die Idee der Reise nahm konkrete Gestalt an.
Wenn ich die Notizen lese, die ich an diesem Tag gemacht habe, spüre ich die Aufregung von Neuem. Valentina warf provokante Bemerkungen auf die gedeckte Tafel wie Jetons auf einen grünen Roulettetisch. Nebenflüsse, Goldsucher, Osterie, illegale Goldschürfer und Schmuggler. Paolo Lodigiani rauchte seine Pfeife und machte hin und wieder eine ironische Bemerkung. Andrea Goltara hingegen sprach von Brücken mit freigelegten Pfeilern, Kiesgruben, dem Wasserkraftwerk Isola Serafini, einem Ungetüm, an dem Störe verendeten, vom abgezapften Wasser des Brembo, dem noch jungfräulichen Bett der Trebbia. Themen und Namen purzelten wild durcheinander, ich notierte sie.
Wir wussten noch nicht, mit was für Booten wir fahren sollten. Der Gatto chiorbone, Paolos Segelschiff, war zum Abenteuer bereit, aber wo konnte man es zu Wasser lassen? Für den Oberlauf des Flusses war es zu schwer. Dort mussten wir uns mit einem anderen Fahrzeug behelfen, aber mit welchem? Mit einem Kanu, das gewöhnlich als „Kanadier“ bezeichnet wird, oder mit einem gemütlichen Schlauchboot? Jemand hatte die Idee, mit einem Lastkahn zu fahren, wie sie früher üblich waren, doch wir wussten nicht, wo wir einen hätten auftreiben können. Wir wussten nur, dass wir fahren wollten.
Die Lampe
Unzählige Sterne und der Halbmond senkten sich auf die Cottischen Alpen. Aus den moosigen Lichtungen rund um das Kloster Staffarda, ehemaligen Sümpfen, stiegen inmitten von Leuchtkäfern und quakenden Fröschen hellblaue Nebel und Schatten von Zisterziensermönchen auf. Zu Fuß gingen wir ganz nah am Fluss unter der Brücke durch und tasteten uns zum Gasthaus Ai pesci vivi vor, das nur von einer kleinen Lampe auf der anderen Straßenseite beleuchtet wurde und kaum zu sehen war. Unter der Pergola blitzten weiße Tischtücher auf, darauf marinierter Aal, frittierte Flussfische und ein unbeschreibliches Dessert namens bunette. Das sollte nur die Vorspeise auf der endlos langen Speisekarte sein, die das Tal des Guten Essens ankündigte.
Unter meinen vielen Flusskarten befand sich auch ein Gastronomieführer, der voller Wunder war. Italien war darauf wie eine Föderation von köstlichen Speisen dargestellt. Es gab eine Region des Risotto mit Fisch und eine Region des Risotto mit Gemüse, eine Region der gefüllten Teigwaren und eine der tortelli cremaschi. Im Delta triumphierte die Polenta, im Piemont der fritto misto. Und dann gab es da noch das Gebiet der Froschschenkel, des Schinkens, des Eselfleisches. Man hätte sich darin verlieren können. Aal, Trüffel und Brotsorten mit unbekanntem Namen: boslà, mica, ricciatina, semella. Das Buch war schon etwas in die Jahre gekommen, und der gewundene Flusslauf hatte sich seit damals ziemlich verändert, doch die gastronomische Karte war noch immer aktuell. In einem Italien, aus dem Landschaften und Dialekte verschwanden, hatten sich die lokalen Eigenheiten offenbar in die Speisen zurückgezogen. So auch hier, in dieser Ebene, die theoretisch dazu verdammt war, der Vermischung der Geschmäcker Vorschub zu leisten. Wir wohnten dem Wunder der „guten“ Globalisierung bei: einer Flussökumene, die imstande war, gleichzeitig eines und viele zu sein. Sergio Maffioli, mein Freund aus Saluzzo, erzählte uns Geschichten von Bibern, Mardern, Stören, Welsen, Lampreten; mit ausladenden Gesten imitierte er den Sprung eines Hechts, der sich eine Maus am Ufer schnappte. Valentina hörte ihm zu und stellte ihm unzählige Fragen. Auch der Bürgermeister von Saluzzo kam mit einigen Freunden, und die Trankopfer fanden erst ein Ende, als der stürmische Maffioli die piemontesischen Heiligen Chiaffredo und die Marketenderin Varena beschwor, uns zu segnen. Wir stellten fest, dass es in der Umgebung von Staffarda eine ungewöhnlich hohe Dichte von Heiligen gab, wie an allen Orten, die lange heidnisch geblieben waren.
Geheimnisvolles Piemont. Die Tischgenossen erinnerten sich an den Wilden Mann, an die uralten religiösen Bräuche in einem Dorf namens Envie, am Fuße des Monte Viso. Es hieß, in Crissolo wurden noch immer Johannisfeuer entzündet, um Dämonen zu bekämpfen, und in Revello veranstaltete man in Zeiten der Dürre noch immer Bittprozessionen, ein heiliger, mittlerweile von der Kirche vergessener Brauch. Wir befanden uns in einem heiligen Labyrinth, das mit mündlich überlieferten Erinnerungen gespickt war, das Buch wurde überflüssig.
Unter dem einsamen Gipfel, der zwischen den Sternen aufragte, hörte man den letzten quälenden Ruf des Berges. Der Po erzählte, und wir erschauderten vor Furcht, wir könnten seine Stimme nicht hören. Es wurde Mitternacht, und wir torkelten ins Bett, nach zu vielen Gläsern Arquebus, einem beinahe ausgestorbenen piemontesischen Kräuterbitter, der nach Rosenkranz und Handkuss schmeckte. Und während die Scheinwerfer des guten Maffioli Richtung Saluzzo verschwanden, bevölkerte sich die Dunkelheit mit den Augen der Nacht: Käuzen, Eulen. Ein unbeweglicher Fuchs auf dem Kiesbett, der raschelnde Schatten einer Katze, aufgescheuchte Mäuse auf dem Kies, Leuchtkäfer knapp über dem Wasser.
Der Po murmelte, gluckste, floss kilometerlang unterirdisch dahin, tauchte dann wieder auf und lief über. Fahles Mondlicht fiel auf die Hänge des Monte Bracco, wo Leonardo da Vinci die Quelle des Eridanus gesucht hatte, und auf die Felswände von Revello, in denen sich Felswohnungen befanden wie in den Canyons von New Mexico. Der Inhaber des Ostello hatte ein Feuer entfacht, Funken sprühten. Die Kanus schliefen im Gras, wenige Meter vom Ufer entfernt, doch die Mannschaft war wach.
In den Schlafsälen mussten die Schlafsäcke ausgerollt werden, wir liefen in Unterhosen durch das Chaos, lachten wegen jeder Kleinigkeit und fragten uns, was wir in die Kanus laden sollten und was nicht. Inmitten des vielen Zeugs blickte ich in den Spiegel, und mich überkam ein gnadenloses Gefühl der Lächerlichkeit. Was machte ich hier, in meinem Alter? Ich ließ mich auf ein Teenager-Abenteuer ein. Floskeln wie „Die Jugendlichen von heute haben den Sinn für Abenteuer verloren“ oder „Die Jugendlichen heute reisen im Sitzen“ konnten mich nicht trösten. Der Vorwand zog nicht. Zum Glück wusste ich, dass zu jedem Abenteuer auch Zweifel gehören, sie sind ein Tunnel, den man bei jeder Abreise durchqueren muss. Denn jede Abreise ist ein Sprung ins Leere.
Ich betrat eine unbekannte Welt. Ich hatte Meere befahren, doch noch nie einen ganzen Fluss. Das geschlossene Fenster zwischen mir und der Dunkelheit war eine Ikonostase, die mich daran hinderte, ein Geheimnis zu feiern. Ich fragte mich, was ich dahinter vorfinden würde. Vielleicht die Zeit, die mir Tag für Tag zwischen den Fingern zerrann. Einer Sache war ich jedoch sicher: Über den Po waren zwar jede Menge Geschichten geschrieben worden, doch von hier bis zum Meer konnte ich auf das geschriebene Wort verzichten. Wie in der Geschichte von dem Wissenschaftler, der eine ganze Bibliothek zerstört, um sich vom Buch abzuwenden und sich stattdessen den Menschen am Fluss zu widmen, spürte auch ich angesichts des Geheimnisvollen das Bedürfnis, die ehrwürdigen Texte zu vergessen und mich Begegnungen zu überlassen.
Ich besaß nur Landkarten, und ich suchte eine Sprache, die nicht die notarielle Sprache der Prosa war. Aufgrund der einzigartigen Sprachmelodie Sergios aus Saluzzo kam ich zu dem Schluss, dass die oral history des Flusses noch intakt war, trotz der Jahre der malora – in Beppe Fenoglios Formulierung –, als die Bauern zuerst Arbeiter und dann Parasiten geworden waren, beraubt ihrer handwerklichen Fähigkeiten und des praktischen Wissens ihrer Väter. Für uns begann eine Geschichte der Freiheit und des Wassers, bei der wir viel zuhören und wenig lesen würden. Eine Geschichte, die ausschließlich uns gehörte. Die außergewöhnliche Reise von Valentina und Pierluigi, Angelo, Flavio, Alessandro und Paolo.
Unsichtbar zwischen den Weiden
Es segneten uns der Monte Viso, der hl. Johannes, der ehrwürdige Chiaffredo und die tausend Märtyrer der thebäischen Legion. Dann legten wir ab, wir konnten es kaum glauben, dass wir die Leinen losmachten. Von der Brücke in Staffarda aus führte uns der Fluss unnachgiebig Richtung Meer, glitt dahin wie eine Klinge, durchsichtig und unwiderstehlich auf funkelndem Kies. Wir waren so aufgeregt, dass wir in einer Viertelstunde vier Fehlstarts hinlegten; wir vergaßen immer wieder etwas an Land: wasserdichte Taschen, Trinkflaschen, die auf die einzelnen Boote verteilt werden sollten, Karabiner, Taue zum Anlegen. Fast hätten wir sogar Alex an Land zurückgelassen, er war kurz ausgestiegen, um die Abfahrt mit der Kamera zu verewigen. Ich sah nur zufällig, wie er sich verdutzt an einen Pfeiler klammerte und uns davonfahren sah. Sechs Kanufahrer – davon drei blutige Anfänger – sind ein Zirkus, der eine Weile braucht, bis er sich in Bewegung setzt. Doch schließlich war die Taufe vollendet, und wir fuhren in einem Archipel von Felsen und kleinen Stromschnellen dahin, fast ohne uns dessen bewusst zu sein.
Nicht wir betraten das Reich des Wassers, sondern das Wasser drang in uns ein und nahm von uns Besitz. Der Lärm der Lkws auf der Brücke erlosch und es begann das Reich des Schweigens. Das Piemont glitt an uns vorbei wie in einem Film: Weiden, Erlen, moosbewachsene Uferböschungen, die schwarzen Pfähle alter Fischwehre. Angelo fuhr allein in seinem Kanu, murmelte, dass ein Niesen genügte, um es zum Kentern zu bringen, und pries hingegen seinen Kahn, die manzonianische Barke, mit der wir die Strecke zwischen Casale und Pavia zurücklegen würden. Trotzdem war er zufrieden. „Im Wasser“, sagte er, „wird alles gut. Die Probleme beginnen an Land.“ Alessandro saß zwischen Flavio und Valentina, damit er in Ruhe filmen konnte. Ich sah, wie er davonglitt, hundert Kilo schwer, zufrieden und aufmerksam. Ich fuhr mit Pier im Anfängerboot und lernte schnell, dass man auf einem Fluss nicht viel paddeln muss, es reichte, den Kurs zu korrigieren. Mit jedem Kilometer fiel der Schlag des Paddels weniger kräftig aus; man musste das Wasser nur streicheln. Das war das Schönste: getragen zu werden, zu lauschen und zu schauen, ohne etwas zu tun. Zum Fluss zu werden.
Als Erstes fuhr das Flaggschiff, ein schlammgrünes Old Town, siebzehn Fuß lang, mit Narben von unzähligen Abenteuern. Es war in Maine hergestellt worden und hatte, nach dem Vorbild der Indianerkanus aus Birkenholz, ein kräftiges Holzskelett. Wenn es zwischen den kleinen Stromschnellen hüpfte, wurden elegantes Stuhlgeflecht und ein Messingschild am Bug sichtbar, auf dem der Name des ersten Besitzers, Ghezzi, eingraviert war. Nach unzähligen Reisen hatte er sein Geschöpf seinem Schüler Mainardi vermacht. Eine Handbreit über dem Kies folgte die amarantfarbene, sechs Fuß lange Prospector: Sie war gedrungener, besaß einen größeren Frachtraum und eignete sich für schwierigere Gewässer. „Die Old Town ist der Rolls Royce unter den Kanus“, sagte Valentina, „das hier hingegen ist die Historie.“ Als letzte kam die Pignatta, ein Kosename, der von Anfang an zu diesem Kanu passte. Ein Boot für harte Männer; eine durch und durch instabile Aluminiumschüssel, mit Beulen von den Stößen, die sie abbekommen hatte. Die anderen hatten keinen Namen und auch keinen Spitznamen.
Die Ufer waren menschenleer. Vor einem halben Jahrhundert hätten wir hier Schmiede, Müller, Kinder, Fährmänner, Wäscherinnen, Fischer angetroffen, die Forellen und Hechte fingen. Wir sahen jedoch nur drei nackte Frauen auf einer Kiesbank, sie sprangen sofort auf und verhüllten sich, erschrocken bei dem Gedanken, der Fluss könne befahrbar und bewohnt sein. Sie hatten drei scharfe Hunde bei sich, die bellend ins Wasser sprangen; einer war besonders hitzköpfig und wollte in ein Paddel beißen. Alex bellte zurück, um sie aufzustacheln, und die Frauen am Ufer sahen uns in ihre Badetücher gehüllt an, als wären wir geistesgestört. Die Menschen am Land sind nicht darauf gefasst, dass jemand vom Wasser her kommt, können es sich vielleicht gar nicht vorstellen. Wir lernten, dass es eine klare Trennlinie zwischen Landbewohnern und Wasserbewohnern gibt. Die Letzteren befolgen eigene Gesetze, der Fluss ist ihr Freiraum, ihr Versteck.
Zwischen Pappeln und Robinien glitten wir unsichtbar dahin, bis die ersten Nebenflüsse in den Gebirgsfluss mündeten. Ghiandone und Cantogno, ihre Namen waren Elfen im Reinzustand. Sie flüsterten zwischen den Weiden, zeichneten Beistriche, Spiralen und Klammern. Mit langen Paddelschlägen fuhren wir ein Stück flussaufwärts – die Neugier war stärker als der Termindruck – und entdeckten am Ufer ein Gewimmel von sich paarenden Libellen. Damigelle werden sie hier genannt, Dämchen; Naturwissenschaftler sind allerdings Sexmuffel und haben ihnen einen hässlichen männlichen Namen gegeben: Odonaten. In der Gegend gab es auch noch andere Dämchen: Sie zogen die Farbe Pink vor, warteten an der Straße, die von Pinerolo nach Saluzzo führt; halbnackt und professionell saßen sie auf einem Sessel an einem kleinen Tisch, unter einem Sonnenschirm. Unsere hingegen trugen die Farben smaragdgrün und nachtblau, wohnten in der Stille und nisteten in den schattigsten Winkeln, am glasklaren Wasser. Alle diese Geschöpfe wurden in gleicher Weise vom einsamen Kristallprisma des Monte Viso überragt, der abends seinen Strahlenkranz entfachte.
Das grüne Wasser des Ghiandone flüsterte, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sein ruhiges Fließen sich in zerstörerischen Furor verwandeln konnte. Aber ein Stück talwärts, in Cardé, belehrte uns die von einem Hochwasser weggerissene Brücke eines Besseren, und das Dröhnen der Autos auf den Eisentraversen der provisorischen Brücke verursachte uns nach einer Stunde Stille einen ersten Schock. Damit begann eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse. Angelo, ein noch unerfahrener Kanufahrer, fuhr in einen Strudel unter einem umgestürzten Baum und kippte um wie eine reife Frucht. Er verlor seine Zigarre und sein neckisches Strohhütchen mit der Käuzchenfeder, fluchend schwamm er in der Strömung, dann kam er allein wieder auf die Beine. Seine Tasche fischten wir hundert Meter talwärts aus dem Fluss.
Weder Uhren noch Fotoapparate waren griffbereit. Alles war in wasserdichten Taschen versiegelt. Wie spät war es? Wo waren wir? In der Ukraine? In der Türkei? In Paraguay? Ich dachte an die Flüsse, die ich kannte, und stellte fest, dass ich noch nichts Vergleichbares gesehen hatte. Ich erinnerte mich an den nebeligen Rhein in den herbstlichen Feldern des Elsass, mit den Weingärten der Vogesen rundherum und den sinnlosen Bunkern der Maginotlinie. Ich dachte an die Donau im Winter, an den Zug, der sie überquert und langsam auf die Bögen der Eisenbahnbrücke geschlagen hatte, ich hörte das Krachen des Treibeises in den Karpaten, an den Gesang eines einsamen Fährmannes kurz vor dem Eisernen Tor, den Ruf der Zugvögel im Labyrinth des Deltas. Ich sah die Felshänge an der Dordogne im Abendlicht, die Mäander des okzitanischen Flusses voller Musik und Düfte, wie man ihn von Schloss Monfort aus sah. Und den violetten Abend am Dnister, der im Wind silbern wurde, Schwäne, die über das Weizenmeer segelten, die Festungen am östlichen Limes, die ockerfarbenen Felsböschungen, die Tränken, um die Kosaken und ottomanische Armeen gekämpft hatten, verrückte Pferde und Kameltreiber. Ich hatte bereits eine Menge Flüsse gesehen, doch keiner ähnelte diesem einsilbigen Gott, der in einem perfekten Gebirgsrund seinen Weg suchte.
Nordwestwind. Flavio erklärte uns, dass die Füße der Flussvögel ein perfekter Wasserstandsmesser sind. „Wenn der Seidenreiher mit dem Arsch im Wasser wackelt, beträgt die Wasserhöhe nicht mehr als einen halben Meter.“ Die Flotte zerbröselte, hin und wieder verschwand ein Boot zwischen den Weiden, auf der aussichtslosen Suche nach einem ganz eigenen Kurs. Jeder von uns hegte den Wunsch, sich abzusondern und allein mit dem Fluss zu sein. „Wo ist der Canale Cavour?“ „Da unten! Eine Stockente ist aufgeflogen!“ Wir warfen uns kurze Rufe zu, dann schwiegen wir wieder. Nur unsere Stimmen hallten zwischen den Dämmen wider. Kein Kontakt mit der Welt, klaustrophobische Akustik und ein auf sechs Stimmen reduziertes Drehbuch.
Song of the paddle
In Villafranca schließlich ein Fenster zur Welt. Das verlassene Ufer im Schatten riesiger Bäume zeichnete die Karikatur eines Dorfes, das offenbar aufgrund irgendeiner Seuche das Wasser scheute. Die italienischen Mütter, die ihre Kinder vor dem Dämon des Flusses warnen, sind mir nur allzu gut bekannt: um Himmels willen, das kalte Wasser, die Strudel, der Giftmüll, die Insekten … Ach ja, dachte ich, sollten sie doch ihre Kinder zum Spielen ans Meer bringen, in diese warme, schmutzige Suppe, und wenn sie auf dem Weg dorthin stundenlang im Stau stehen! Im Grunde hatten wir es den italienischen Müttern zu verdanken, dass unser Abenteuer versprach, großartig zu werden, in einem Gebiet, das so unerforscht war wie der Sambesi.
Die Ufer waren blitzblank, der Müll, den man uns immer wieder angekündigt hatte, war nicht zu sehen. Ein perfekter Ort fürs Picknick: im Fluss gekühlte Bierdosen, Salami, Käse, Oliven und Tomaten. Aus den wasserdichten Taschen tauchten Fleischkonserven auf, und Flavio wärmte in seiner sein Essen.
„Ich habe schon selbstgefischte Fische und Garnelen in der Konservendose gekocht, mit Salzwasser.“
Er packte die Gelegenheit beim Schopf, um eine seiner vielen Reden über die Philosophie des Kanufahrens zu halten: „Wir Kanufahrer“, sagte er, „zeichnen uns dadurch aus, dass wir ganz entspannt herumfahren. Wir haben nichts mit dem Profisport am Hut, uns geht es um den reinen Genuss und den Kontakt mit der Natur. Kajakfahrer würden nie auf diese Weise den Po runterfahren. Die Langsamkeit würde sie krank machen. Für uns hingegen ist das Fahren auf dem Fluss eine Art und Weise, uns selbst besser kennenzulernen und Zeit in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Das Schöne am Kanufahren ist, dass man überall hinfahren kann und Orte sieht, die vom Ufer aus unerreichbar sind.“
Valentina: „Ich liebe das Kanufahren, seitdem ich die Bücher von Bill Mason gelesen habe, Song of the paddle und Path of the paddle, die mittlerweile als Bibel und Philosophie des Kanufahrens gelten. Dem Ganzen liegt die Idee zugrunde, sich völlig frei zu bewegen, mit einfacher Ausrüstung, im Gegensatz zum technisch hochgerüsteten Kajak. Mit dem Kajak hat man das Gefühl, in den Krieg zu ziehen, Neoprenanzüge, Vollvisierhelm, lauter absurde Dinge … Der Kanadier ist unkomplizierter, weniger aufgemotzt.“
„Wir sind jedoch die Ausnahme von der Regel“, grinste Pierluigi, „wir schleppen jede Menge Zeug mit.“
Während der grüne Teppich Richtung Turin trieb, zankten zwei Kohlmeisen wie Waschweiber auf dem tiefhängenden Ast eines Ahorns. Unter Wasser begrüßte uns ein ausgelassener Schwimmreifen mit der Schnauze eines gescheckten Hundes; und Pierluigi machte ein Schläfchen an Deck eines Hausboots, das als Fährschiff benutzt wurde. Wahrscheinlich träumte er in der Wasserwüste des Piemont von den dicht besiedelten Ufern des Ganges, von denen er eben zurückgekehrt war.
Widerwillig nahm ich eine Kleinigkeit zu mir. Mir lagen die vielen ungeschriebenen Worte im Magen. Mein Tagebuch war noch leer. Es ist unmöglich, mit dem Paddel in der Hand zu schreiben, und zu kompliziert, das Logbuch aus der wasserdichten Tasche zu holen. Ich begriff, dass ich in der Falle saß: Auf einem Fluss muss man alles, was man gesehen hat, bei sich behalten, erst in den Ruhepausen kann man es niederschreiben. In Villafranca hatte ich ein paar Zeilen geschrieben, sie kamen mir vor wie eine fade Aufzählung von Dämmen, Bäumen, Brücken. Für jemanden, der es gewohnt ist, Bilder spontan zu Papier zu bringen, fühlte sich die zeitversetzte Niederschrift wie Betrug an. Zu viele Details gingen dabei verloren. Aber es gab noch etwas Schlimmeres. Im Sitzen sah ich nicht über die Uferböschung, und die Landschaft glitt vorbei, ohne sich der Erinnerung einzuprägen. Was die Erzählung anbelangte, saß ich also in der Falle. Um etwas zu sehen, hätte ich alle paar Kilometer aussteigen, das Kanu an Land ziehen und auf die Böschung klettern müssen. Unmöglich.
Doch damit nicht genug. Während das Gehen an Land Schritt für Schritt eine Erzählung erzeugt, Erinnerungen hervorruft und durch den Rhythmus das Denken anregt, ist das Flusswasser ein Mantra, das den Geist abschaltet. Das Paddeln folgt keinem Rhythmus, man korrigiert damit nur das Dahingleiten, es ist die Kapitulation vor einem größeren Fließen. Ich sagte eine Formel auf: Yoga chitta vritti nirodha. Irgendwo hatte ich gelesen: „Yoga ist der innere Zustand, in dem die seelischen Vorgänge zur Ruhe kommen.“ Auch der Fluss wusch meine Gedanken: vielleicht war das die Erklärung meiner Verwirrung. Die Alltagssorgen schwiegen, allerdings konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Die Stille, die von den leeren Seiten des Tagebuchs belegt wurde, irritierte mich nach wie vor.
Die ersten Zuflüsse
Valentina warnte uns: Wir näherten uns einer schwierigen Brücke. In Italien ruhen die Brücken auf den Kadavern ihrer Vorgänger, die von einem Hochwasser oder von einem Krieg weggerissen wurden. Niemand fährt mehr auf dem Fluss, deshalb entfernt auch niemand die Steinbrocken. Sobald Kanufahrer eine Brücke sehen, wird ihnen deshalb bang ums Herz. Um die bestmögliche Passage zwischen den Pfeilern zu finden, standen Flavio und Vale auf und balancierten im Kanu; sie versicherten mir, auf einem Fluss brauche man sich nur um ein paar Zentimeter zu erheben, und schon vergrößere sich das Gesichtsfeld. Man steht einen Augenblick lang auf, und die Welt offenbart sich: Berge, Dörfer, Glockentürme, Platanenalleen und Weinberge. Meine Klaustrophobie war also durchaus begründet.
Als unsere Anführer im Boot standen wie Jesus auf dem See Genezareth, sahen sie, dass das Wasser am Sockel der Brücke auf Ruinen schäumte; sie sahen jedoch auch, wo der beste Durchschlupf war und wo wir uns wieder der Strömung anvertrauen konnten. Während wir die Stelle passierten, behielt uns eine Schwanenfamilie im Auge, die Posten bezogen hatte, um ihr Revier zu verteidigen. Die Symbole tierischer Schönheit machten uns Angst: Sie fauchten, plusterten sich auf und reckten ihre mörderischen Schnäbel gegen die Eindringlinge.