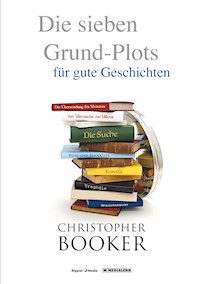
13,99 €
Mehr erfahren.
Dieses Buch liefert eine umfassende Antwort auf das uralte Rätsel, ob es nur eine kleine Anzahl von "Grundgeschichten" auf der Welt gibt. Anhand einer Fülle von Beispielen, die von antiken Mythen und Volksmärchen über die Theaterstücke und Romane der großen Literatur bis hin zu den populären Filmen und TV-Seifenopern von heute reichen. Das Ergebnis: sieben archetypische Plots, die in jeder Art von Erzählung wiederkehren. Dies ist jedoch nur der Auftakt zu einer Untersuchung darüber, wie und warum wir "programmiert" sind, uns Geschichten auf diese Weise vorzustellen, und wie sie mit den tiefsten Mustern der menschlichen Psychologie zusammenhängen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen, von Proust bis zu Detektivgeschichten, vom Marquis de Sade bis zu E.T., führt uns Christopher Booker dann durch die außergewöhnlichen Veränderungen in der Natur des Geschichtenerzählens in den letzten 200 Jahren und erklärt, warum so viele Geschichten "den Faden verloren" haben, indem sie den Kontakt zu ihrem zugrunde liegenden archetypischen Zweck verloren haben. Booker analysiert, warum die Evolution uns das Bedürfnis gegeben hat, Geschichten zu erzählen, und veranschaulicht, wie das Geschichtenerzählen einen einzigartigen Spiegel für die psychologische Entwicklung der Menschheit in den letzten 5.000 Jahren geliefert hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1765
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
7 Basis-Plots fürs Storytelling
Warum wir Geschichten erzählen
© Christopher Booker 2004
© Christopher Booker 2004
This translation of The Seven Basic Plots is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.
Vorwort
2004 hat Christopher Booker, Journalist und Autor, sein Lebenswerk veröffentlicht – nach 34 Jahren Arbeit daran: Dieses Buch.
2019 ist er verstorben. Drei Jahre später haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sein Werk ins Deutsche zu übersetzen. Warum? Weil es ein Storytelling-Standardwerk ist: Booker hat Geschichten auf ihre Erzählweisen untersucht. Die Basis dafür: die Psychologischen Persönlichkeitstypen von C.G. Jung. Das Ergebnis: Sieben Grundhandlungen, die fast jeder Geschichte zu Grunde liegen.
Natürlich gibt es darüber hinaus noch mehr Grundhandlungen. Sicherlich mag die ein oder andere Interpretation Bookers strittig erscheinen – wie auch in mancher Hinsicht der Autor selbst: 2009 bezeichnete er sich selbst als Leugner der globalen Erwärmung.
Dennoch haben wir uns zur Übersetzung dieses Buches entschlossen, da die sieben Grundhandlungen ins Standard-Repertoire von Geschichten-Erzählenden gehören: Was die Tonleitern für Musiker sind, sind die Grundhandlungen für Storyteller.
Unsere Rolle beschränkte sich dabei ausschließlich auf das Übersetzen des Werkes. Ausdrücklich vertreten wir weder als Verlag noch als Übersetzende die Meinungen des Autors. Die Formulierungen aus dem Englischen haben wir so wörtlich wie möglich übersetzt. Eine Anpassung in Sachen gendergerechter Sprache oder generell unter Woke-Gesichtspunkten war uns als Lizenznehmer des Englischen Werkes nicht gestattet. Sollten Sie also keine Gendersternchen finden, über Formulierungen stolpern, die nicht LGBTQ-inklusiv sind oder Gedankengut, das ehemals „normal“ und heute klassistisch oder rassistisch ist: Wir haben aus oben genanntem Grund keine dieser Stellen überarbeiten dürfen. Ebenso wenig waren uns tiefgreifende Vereinheitlichungen von Begriffen oder Zeitenfolgen erlaubt.
Einleitung und historische Anmerkungen
„Er hatte ebenfalls ein Werk geplant, aber es ist nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt seines Lebens, um zu zeigen, wie wenig ECHTE FIKTION es auf der Welt gibt; und dass die gleichen Bilder, mit sehr geringen Abweichungen, allen Autoren gedient haben, die je geschrieben haben.“
Dr. Samuel Johnson, aufgezeichnet in Boswells Life of Johnson
Mitte der 1970er Jahre bildeten sich überall in der westlichen Welt Schlangen vor den Kinos, um einen der dramatischsten Horrorfilme aller Zeiten zu sehen. Steven Spielbergs "Der weiße Hai" läutete die Ankunft des erfolgreichsten populären Geschichtenerzählers des späten 20. Jahrhunderts ein. Der Film erzählte, wie die Ruhe des kleinen Badeortes Amity auf Long Island durch die Ankunft eines monströsen Hais von fast übernatürlicher Kraft erschüttert wird: Wochenlang holt sich der Hai in wilden Angriffen ein Opfer nach dem anderen und versetzt die Bürger in Angst und Schrecken. Als das Gefühl der Bedrohung kaum noch zu ertragen ist, macht sich der Held der Geschichte, der örtliche Polizeichef Brody, mit zwei Begleitern auf, um das Monster zu bekämpfen. Auf dem Höhepunkt des Films kommt es zu einem gewaltigen Kampf unter Wasser mit vielen abgetrennten Gliedmaßen, bis der Hai endlich erlegt ist. Die Bedrohung ist gebannt, die Bevölkerung bricht in Jubel aus und das Leben in Amity geht wieder seinen gewohnten Gang.
Millionen von anspruchsvollen Kinobesuchern des 20. Jahrhunderts wurden von dieser Geschichte gepackt. Man kann davon ausgehen, dass die wenigsten von ihnen gedacht hätten, wie viel sie mit einem ungepflegten Haufen angelsächsischer Krieger in Tierfellen gemeinsam hatten, die 1200 Jahre zuvor um das Feuer einer zugigen Halle hockten und gebannt den Worten eines Minnesängers lauschten, der ein episches Gedicht sang. Die Geschichte dieses uralten Gedichts hat bis in unsere Tage überlebt. Generationen gelangweilter Studenten der englischen Literatur haben sich seither damit in ihren Prüfungen herumgeschlagen:
Der erste Teil von „Beowulf“ erzählt, wie der Frieden der kleinen Küstengemeinde Heorot durch die Ankunft von Grendel, einem Monster von fast übernatürlicher Kraft, das in den Tiefen eines nahegelegenen Sees lebt, erschüttert wird. Nacht für Nacht holt sich Grendel in wilden Angriffen ein Opfer nach dem anderen aus der Halle, in der sie schlafen und reißt es in Stücke. Angst und Schrecken regieren in Heorot. Als das Gefühl der Bedrohung kaum noch zu ertragen ist, macht sich der Held der Geschichte, Beowulf, auf, um zuerst das Monster Grendel und dann seine noch schrecklichere Mutter zu bekämpfen. Auf dem Höhepunkt der Erzählung kommt es zu einem gewaltigen Kampf unter Wasser mit vielen abgetrennten Gliedmaßen, bis beide Monster endlich erlegt sind. Die Bedrohung ist gebannt, die Bevölkerung bricht in Jubel aus und das Leben in Heorot geht wieder seinen gewohnten Gang.
Der Horrorfilm aus dem 20. Jahrhundert und das Epos aus dem 8. Jahrhundert sind sich in ihren Grundzügen so frappierend ähnlich, dass man fast meinen könnte, sie erzählten dieselbe Geschichte. Wurde Peter Benchley, der Autor vom „Weißen Hai“, von „Beowulf“ beeinflusst? Natürlich nicht. Eine so packende Geschichte wie den „Weißen Hai“ schreibt man nicht ab, sondern sie entsteht spontan in der Fantasie des Autors, selbst wenn er „Beowulf“ gelesen hätte.
Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass die beiden Geschichten ein bemerkenswert ähnliches Muster haben. Dieses Grundmuster teilen sie darüber hinaus mit unzähligen anderen Geschichten in der Literatur der Menschheit zu vielen verschiedenen Zeiten und überall auf der Welt.
Was ist die Erklärung dafür?
Es ist merkwürdig: Wir investieren in unserer modernen Zivilisation Unmengen an Zeit, Energie und Ressourcen, um in die entferntesten Winkel unserer Galaxie vorzudringen oder die winzigsten Atomteilchen zu erforschen – alles in dem vermeintlichen Versuch dem Universum auch noch sein letztes Geheimnis zu entlocken. Dabei liegt eines der größten und wichtigsten Geheimnisse so dicht vor unserer Nase, dass wir es nicht einmal mehr als Geheimnis wahrnehmen:
Zu jedem Zeitpunkt sind überall auf der Welt hunderte Millionen von Menschen mit einer der ursprünglichsten Formen menschlicher Aktivität beschäftigt. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf eine dieser merkwürdigen Sequenzen von mentalen Bildern, die wir eine „Geschichte“ nennen.
Wir merken es vielleicht nicht, aber jeder von uns verbringt einen sehr großen Teil seines Lebens damit, Geschichten zu verfolgen: Wir lesen Geschichten nicht nur, wir hören ihnen zu, sehen sie täglich im Fernsehen, im Kino oder auf Bühnen – Geschichten prägen uns und begleiten unseren Alltag auf Schritt und Tritt. Dabei geht es nicht nur um fiktionale Geschichten in traditionellen Formaten wie Märchen, Romane, Filme, Theaterstücke und Opern, „Soaps“ oder Comics. Natürlich spielen diese in unserem Leben eine bedeutende Rolle. Aber auch Zeitungen und das Fernsehen präsentieren uns das Weltgeschehen in Form von Geschichten. Unsere Geschichtsbücher sind voll von Geschichten und sogar ein großer Teil unserer täglichen Konversation besteht darin, anderen die Ereignisse in unserem Leben als Geschichten zu erzählen. Geschichten, diese strukturierten Bildfolgen, sind die natürlichste Art, fast alles, das in unserem Leben passiert, zu beschreiben.
Trotzdem denken wir bei dem Wort „Geschichten“ meist nur an die fiktionale Form. Unser Bedürfnis nach Geschichten ist so tief verwurzelt und so instinktiv, dass wir schon als kleine Kinder, kaum dass wir sprechen gelernt haben, nach Geschichten verlangen. Dieses Verlangen hält in abgewandelter Form unser Leben lang an. Geschichten haben immer schon und in allen Gesellschaften eine derart zentrale Rolle innegehabt, dass wir wie selbstverständlich große Geschichtenerzähler wie Homer oder Shakespeare zu den berühmtesten Menschen zählen, die je gelebt haben. Auch heute empfinden wir es nicht als seltsam, dass Männer und Frauen wie Charlie Chaplin oder Marilyn Monroe zu den berühmtesten Menschen des 20. Jahrhunderts gehören – einfach nur deswegen, weil sie Charaktere aus Geschichten auf der Kinoleinwand verkörpert haben.
Die Menschheit sucht sogar Geschichten außerhalb der Erde: Viele der auffälligsten Himmelskörper im All sind nach Figuren aus Geschichten benannt: Venus, Mars, Jupiter, Orion, Perseus, Andromeda…
Umso erstaunlicher ist es, wie wenig wir uns mit der Frage beschäftigen, warum wir einer so seltsamen Tätigkeit so viel Lebenszeit widmen. Welchem Zweck dient das Geschichtenerzählen? Unser Bedürfnis, Geschichten zu erzählen ist etwas so Selbstverständliches, dass wir uns diese Frage gar nicht stellen. 1
Dieses Mysterium baut auf einem anderen auf. Unsere Leidenschaft für das Geschichtenerzählen beruht auf einer Fähigkeit, die ebenfalls so sehr Teil von uns ist, dass wir sie nicht hinterfragen: Unsere Fähigkeit, uns "etwas vorzustellen", Bilder von Dingen in unsere bewusste Wahrnehmung zu bringen, die sich nicht tatsächlich vor unseren Augen befinden.
Wenn jemand zu uns "das Matterhorn" sagt… oder "ein Zebra"… oder "Ihr Küchentisch zu Hause"… oder "ein feuerspeiender Drache"… dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Irgendwo in unserem Kopf lösen die Worte ein geistiges Bild aus. Niemand weiß genau, wo oder wie dieses Bild entsteht oder wahrgenommen wird. Wir haben die Fähigkeit, innere Bilder nicht nur von Orten, Menschen und Dingen heraufzubeschwören, die unseren Sinnen in dem Moment nicht präsent sind, sondern sogar von Dingen wie feuerspeienden Drachen, die nie existiert haben.
Wir haben die Fähigkeit, uns ganze Sequenzen solcher Bilder vorzustellen und sie vor unserem inneren Auge wie einen Film ablaufen zu lassen. Das ist der Grund, warum wir im Schlaf träumen und unsere Aufmerksamkeit im wachen Zustand den mentalen Mustern widmen können, die wir „Geschichten“ nennen.
Dieses Buch will zeigen, dass die Entstehung von Geschichten einem viel tieferen und bedeutenderen Zweck in unserem Leben dient, als uns bewusst ist und der kaum zu hoch bewertet werden kann. Der erste entscheidende Schritt dahin ist die Erkenntnis, dass überall auf der Welt, wo Männer und Frauen je Geschichten erzählt haben, diese Geschichten ihrer Vorstellungskraft entsprangen und sich auf bemerkenswerte Weise ähneln.
Wir alle haben schon einmal davon gehört, dass es vielleicht "nur sieben (oder sechs oder fünf) Grundhandlungen auf der Welt" gibt. Diese Idee wurde schon oft geäußert, jedoch scheinen die Autoren nie weiter zu verfolgen, was für Handlungen das sein könnten. Es ist nun schon mehr als 30 Jahre her, dass mir der Gedanke kam, dass an der Idee der sieben Grundhandlungen tatsächlich etwas Wahres dran sein könnte.
Bei der Arbeit an einem Buch über ein völlig anderes Thema, konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit auf eine kleine Anzahl bestimmter Geschichten. Darunter Macbeth von Shakespeare, Vladimir Nabokovs Roman Lolita, ein französischer Film aus den 1960er Jahren: Truffauts Jules et Jim, die griechische Ikarus-Sage und die deutsche Legende von Faust. Auf den ersten Blick scheinen diese Geschichten nicht viel gemeinsam zu haben. Auf einer tieferen Ebene scheinen sie sich jedoch alle nach demselben allgemeinen Muster zu entfalten: Jede beginnt mit einem oder mehreren Helden, der oder die in irgendeiner Weise unvollendet sind. Die Stimmung zu Beginn jeder Geschichte ist voller Vorfreude. Der Held scheint am Beginn eines großen Abenteuers oder Erlebnisses zu stehen. Er genießt eine Zeitlang einen traumhaften Erfolg und seine Ambitionen scheinen sich zu erfüllen: Macbeth wird König; Humbert beginnt eine Affäre mit der bezaubernden Lolita; Jules und Jim, zwei junge Männer im Paris vor dem Ersten Weltkrieg, treffen das Mädchen ihrer Träume; Ikarus entdeckt, dass er fliegen kann; Faust erhält vom Teufel Zugang zur Magie. Doch dann verdüstert sich die Stimmung der Geschichten allmählich und der Held gerät mehr und mehr in Schwierigkeiten, bis er sich in einer ausweglosen Situation befindet. Der ursprüngliche Traum wird zum Albtraum. Schließlich läuft die Geschichte scheinbar unaufhaltsam auf einen Höhepunkt der gewaltsamen Selbstzerstörung hin und der Traum endet mit dem Tod.
Das Muster, das diesen Geschichten zugrunde lag, war so konsistent, dass man es in leicht in fünf Stadien nachverfolgen konnte: Von der anfänglichen Stimmung der Vorfreude über ein "Traumstadium", in dem alles unglaublich gut zu laufen scheint, über das "Frustrationsstadium", in dem die Dinge auf mysteriöse Weise beginnen, schief zu gehen, bis hin zum "Albtraumstadium", in dem alles furchtbar schiefgeht, und dem Ende der Geschichte in Tod und Zerstörung. Kaum hatte ich dieses Muster identifiziert, sah ich das gleiche Schema in vielen anderen Geschichten, darunter viele Tragödien aus Theater und Oper, wie „Romeo und Julia“ oder „Carmen“, aber auch Mythen und Legenden wie „Don Juan“. Romane wie die zum Albtraum gewordenen Träume der beiden unglücklichen Heldinnen Emma Bovary und Anna Karenina, die beide im Selbstmord enden, gehörten ebenso dazu, wie der Film „Bonnie und Clyde“, in dem zwei junge Liebende unbeschwert eine Karriere als Bankräuber starten und dann im Kugelhagel enden. Immer wieder taucht in der Geschichte des Geschichtenerzählens dieses Motiv auf: Ein Held oder eine Heldin wird in eine Handlung hineingezogen, die zunächst zu traumhaftem Erfolg führt, sich dann aber unaufhaltsam in einen Alptraum der Zerstörung verwandelt. An diesem Punkt drängten sich mir zwei Fragen auf:
Erstens: Warum war das so? Warum folgte die Fantasie der Geschichtenerzähler so leicht und regelmäßig diesem Muster? Und warum ist das für uns eine zufriedenstellende Form für eine Geschichte?
Zweitens: Gibt es andere grundlegende Muster wie dieses, die Geschichten auf andere Weise prägen? Schließlich beschreibt dieser Zyklus der Selbstzerstörung nur Geschichten mit einem "unglücklichen Ende". Was ist mit all den Geschichten, die ein "Happy End" haben? Gibt es dort ähnliche Grundmuster?
Sobald ich anfing, Geschichten in diesem Licht zu betrachten, tauchte eine Reihe anderer möglicher Grundhandlungen auf. Da gab es zum Beispiel die Geschichten über die Überwindung eines "Monsters", wie Der weiße Hai oder Beowulf. Diese Geschichten konzentrieren sich auf die Bedrohung durch eine monströse Figur des Bösen, die dann vom Helden herausgefordert und schließlich auf dem Höhepunkt der Handlung im Kampf getötet wird. Es gab Geschichten vom Typ „vom Tellerwäscher zum Millionär", wie „Das hässliche Entlein" oder „Aschenputtel", bei denen ein anfangs bescheidener und unbeachteter kleiner Held oder eine Heldin zu großem Erfolg und Glanz aufsteigt. Es gab Geschichten, die auf dem Thema einer großen Suche basierten, wie die „Odyssee“ oder “Der Herr der Ringe“, wo sich der Held auf eine schwierige, gefährliche Reise zu einem weit entfernten, sehr wichtigen Ziel macht.
Ich begann fast wahllos, hunderte von Geschichten aller Art zu lesen und wieder zu lesen und erkannte dabei, an wie wenige Details wir uns selbst von Geschichten erinnern, die wir gut zu kennen glauben. Nach kurzer Zeit machte ich eine verblüffende Entdeckung: Es stimmte nicht nur, dass es in Geschichten aus fast allen Kulturräumen und Zeiten eine Reihe von immer wiederkehrenden Grundhandlungen gab, sondern sie stimmten auch bis in kleine Details überein. Ich fand einen bekannten Roman aus dem 19. Jahrhundert, der fast genauso aufgebaut war wie eine 1200 Jahre ältere nahöstliche Volkssage und oder eine populäre moderne Kindergeschichte, die bemerkenswerte versteckte Parallelen mit der Struktur eines epischen Gedichts aus dem alten Griechenland aufwies.
Als eine "Grundhandlung" nach der anderen zum Vorschein kam, jede mit ihrer eigenen Struktur, fand ich mich schließlich einem unübersichtlichen Stapel von Geschichten wieder, die in keines der Muster passen wollten. Ich grübelte einige Zeit über diese Geschichten, die völlig unterschiedlich zu sein schienen: Darunter waren klassische Kindergeschichten wie „Peter Hase“, „Peter Pan“ und „Alice im Wunderland“; eine lange Liste von Romanen, von „Robinson Crusoe“ bis „Wiedersehen mit Brideshead“; Science-Fiction-Geschichten wie H. G. Wells' „Die Zeitmaschine“; Filme von „Der Dritte Mann“ und „Der Zauberer von Oz“ bis „Vom Winde verweht“. Dann fiel der Groschen. Auch diese Geschichten waren tatsächlich von einer gleichen Grundhandlung geprägt, die ich vorher gar nicht in Betracht gezogen hatte. Ich taufte sie „Reise und Rückkehr". So ging mir auf, dass die lange verbreitete Idee über eine Handvoll grundlegender Handlungsstränge tatsächlich wahr sein könnte. Bis dahin hatte ich diese Idee nicht ernster genommen als die meisten Menschen. Nun ist sie die Grundlage dieses Buches.
Ich wusste schon, dass die Wahrheit keineswegs so einfach war, wie die Hinweise auf eine begrenzte Anzahl von Grundhandlungen vermuten ließen. Es ist nicht so, dass jede Geschichte sauber in die eine oder andere Handlungskategorie passt: Sonst hätten wir das alle schon längst bemerkt, und unsere Geschichten wären wohl kaum so unendlich vielfältig und faszinierend, wie sie es sind. Es gibt große Überschneidungsbereiche zwischen den einzelnen Handlungstypen und auch viele Geschichten, die von mehr als nur einer Handlung geprägt sind. Es gibt sogar eine sehr kleine Anzahl von Geschichten, die alle sieben Grundhandlungen enthalten. „Der Herr der Ringe“ ist so ein Beispiel. Andere Geschichten dagegen sind nur von einem Teil einer Grundhandlung geprägt. Dann wiederum gibt es sehr viele Fälle, in denen wir fühlen, dass die Geschichte „irgendwie schiefläuft“, dass die zugrundeliegende Handlung nicht vollständig verwirklicht wird. Solche Geschichten lassen das Publikum oft unzufrieden zurück. Wir werden noch sehen, warum das so ist und wie wir daraus lernen können, wie Geschichten wirklich funktionieren.
Je weiter meine Untersuchung voranschritt, desto deutlicher traten zwei Dinge zutage. Erstens: es gibt tatsächlich eine kleine Anzahl von Handlungen, die so grundlegend sind, dass es für einen Geschichtenerzähler praktisch unmöglich ist, sich ganz von ihnen zu lösen.
Zweitens: Je besser wir die Formen und Kräfte kennenlernen, die unter der Oberfläche der Geschichten liegen und je mehr wir sie in Richtung von Mustern drängen, die jenseits der bewussten Kontrolle des Geschichtenerzählers liegen, desto mehr stellen wir fest, dass das Erkennen einer Handlung nur ein Tor zu einem ganzen Reich ist: Wir entdecken eine Art verborgene, universelle Sprache: einen Kern von Situationen und Figuren, die der eigentliche Stoff sind, aus dem Geschichten gemacht werden. Und wenn wir diese Symbolsprache erst einmal kennen und ihre außerordentliche Bedeutung begreifen, gibt es buchstäblich keine Geschichte der Welt mehr, die wir nicht in einem neuen Licht sehen können: Weil wir dann zum Kern dessen vorgedrungen sind, worum es in Geschichten geht und warum wir sie erzählen.
Die Erkenntnis, dass in Erzählungen verschiedene Grundthemen und -situationen immer wieder auftauchen, ist nicht neu. In den letzten zweihundert Jahren haben sich Schriftsteller, Anthropologen, Gelehrte und Psychologen diesem Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln genähert und versucht zu erklären, warum dieselben Grundtypen von Geschichten in der Literatur und den Märchen und Mythen verschiedener Kulturen auf der ganzen Welt zu finden sind.
Das vorliegende Buch betrachtet alle Arten des Geschichtenerzählens gründlicher als alle Werke zu diesem Thema zuvor. Weit über das hinaus, was als "ernsthafte" Literatur gilt, untersucht es jede nur vorstellbare Art von Geschichten, von den Mythen des alten Mesopotamiens und Griechenlands bis zu „James Bond“ und „Star Wars“; von mitteleuropäischen Volksmärchen bis zu „E.T“. und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“; von P. G. Wodehouse bis Proust; von den Marx Brothers bis zum Marquis de Sade und „The Texas Chainsaw Massacre“; von der biblischen Geschichte von Hiob bis zu Orwells „Nineteen Eighty-Four“; von den Tragödien des Aischylos bis zu „Sherlock Holmes“; von den Opern Wagners bis zu „The Sound of Music“; von Dantes „Göttlicher Komödie“ bis zu „vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Wer dem Geschichtenerzählen wirklich auf den Grund geht, wird feststellen, dass letztendlich alle Geschichten der gleichen Quelle entspringen, von den gleichen Regeln geprägt sind und aus der gleichen universellen Sprache gesponnen sind.
Bis zu diesem Punkt ist es jedoch eine lange Reise, für die es einer kleinen Wegbeschreibung bedarf. Dieses Buch ist daher in vier Teile gegliedert:
Teil eins, "Die sieben Tore zur Unterwelt", untersucht die sieben "Grundhandlungen" der Reihe nach. Auf den ersten Blick ist jede von ihnen unverwechselbar. Schnell tritt jedoch zutage, dass sie bestimmte Schlüsselelemente gemeinsam haben und dass jede Grundhandlung eine andere Sichtweise auf dasselbe zentrale Anliegen präsentiert, in dem der Kern des Geschichtenerzählens liegt.
Der zweite Teil, "Das komplette Happy End", befasst sich allgemeiner mit den Gemeinsamkeiten der Grundhandlungen. Wir werden feststellen, dass es nicht nur grundlegende Handlungen gibt, sondern auch eine Reihe von Grundfiguren, die in Geschichten aller Art immer wieder auftauchen. Die Werte dieser Figurentypen sowie ihre Beziehungen untereinander eröffnen eine neue Perspektive darauf, um was es beim Geschichtenerzählen geht. Wir werden zu dem Schluss kommen, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine Geschichte zu einem vollständig gelösten Ende zu bringen. Dies führt im dritten Teil zur Untersuchung eines der aufschlussreichsten aller Faktoren, die darüber bestimmen, wie Geschichten im menschlichen Geist Gestalt annehmen.
Der dritte Teil des Buches, "Das Ziel verfehlen" konzentriert sich fast ausschließlich auf Geschichten aus den letzten 200 Jahren. Hier untersuchen wir, wie und warum es in der Vorstellung eines Geschichtenerzählers möglich ist, dass eine Geschichte "aus dem Ruder läuft". In den ersten beiden Teilen des Buches geht es vor allem um Geschichten, die die archetypischen Grundmuster so zum Ausdruck bringen, dass sie sich zu einem vollständig befriedigenden Ende hin auflösen. Im dritten Teil sehen wir, dass sich das Geschichtenerzählen der westlichen Welt in den letzten zwei Jahrhunderten auf höchst bedeutsame Weise geändert hat. Dabei geht es nicht nur um die Frage, warum die Geschichten der jüngeren Zeit so sehr von Sex und Gewalt geprägt sind. Vielmehr hat jede der Grundhandlungen eine „dunkle“, „gefühlsbetonte“ Version entwickelt, wobei sich ein besonderes Element der Desintegration in das moderne Geschichtenerzählen einschleichen konnte. Dieses Element unterscheidet die modernen Geschichten von allen vorherigen. Trotzdem haben sich die archetypischen Regeln, die das Geschichtenerzählen seit Anbeginn der Geschichte bestimmen, in keiner Weise verändert. Die „abweichenden“ Geschichten gehorchen nicht nur denselben Regeln; sie liefern sogar alle Hinweise darauf, was schiefgelaufen ist und warum sie nicht zu einem völlig zufriedenstellenden Ende kommen können. Sie zeigen uns also, wie und warum in der kollektiven Psyche unserer Kultur das Element der Desintegration entstanden sein muss.
Dieser dritte Teil des Buches endet mit einem Kapitel über die beiden wohl zentralen rätselhaften Geschichten, die die westliche Vorstellungswelt hervorgebracht hat: Sophokles' Ödipus Tyrannos und Shakespeares Hamlet. Erst an dieser Stelle ist die Vorarbeit geleistet, um die tiefsten Fragen überhaupt zu betrachten: Warum hat die Menschheit im Laufe ihrer Evolution die Fähigkeit entwickelt, diese Bildmuster in unserem Kopf zu erzeugen? Welchem Zweck dienen sie? Und wie hängen Geschichten mit dem zusammen, was wir "echtes Leben" nennen?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im vierten und letzten Abschnitt des Buches, 'Warum wir Geschichten erzählen'. Der vierte Teil beginnt mit zwei bedeutenden Arten von Geschichten, die wir bis dahin noch nicht betrachtet haben: Mythen über die Erschaffung der Welt und den "Sündenfall". Diese werden mit der Evolution des menschlichen Bewusstseins und unseren Beziehungen zur Natur und unseren Instinkten in Verbindung gebracht. Dabei sehen wir, wie und warum die verborgene Sprache der Geschichten uns ein objektives Bild der menschlichen Natur und der inneren Dynamik des menschlichen Verhaltens liefern kann. Ein richtiges Verständnis davon, warum wir Geschichten erzählen, wirft ein neues Licht auf fast jeden Aspekt der menschlichen Existenz: auf unsere Psychologie, auf die Moral, auf die Muster von Geschichte und Politik, auf die Natur der Religion, auf das zugrunde liegende Muster und den Zweck unseres individuellen Lebens.
Die letzten beiden Kapitel sind die längsten des Buches. Sie versuchen, alles zu nutzen, was wir über das Geschichtenerzählen gelernt haben, um die psychologische Entwicklung der Menschheit seit dem Beginn der Zivilisation neu zu interpretieren. Das erste, "Von Göttern und Menschen", führt uns von den Höhlenmalereien von Lascaux bis zur Französischen Revolution und zum Aufkommen der Romantik. Das letzte Kapitel führt durch das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert bis in die Gegenwart und endet mit der Verfilmung von "Der Herr der Ringe" und dem zweiten Golfkrieg 2003. Das Buch endet dann mit einem kurzen Epilog, der sich mit einer der größten Geschichten befasst, die je geschrieben wurden, Platons Höhlengleichnis.
Wenn wir an diesem Punkt in der Erforschung der wahren Gründe angelangt sind, warum wir Geschichten erzählen, hoffe ich, etwas davon vermittelt zu haben, warum es für die Menschheit nur noch wenige wichtige Geheimnisse auf dieser Erde zu enträtseln gibt.
WARUM TAUCHEN ÜBERALL AUF DER WELT ÄHNLICHE GESCHICHTEN AUF? EINE HISTORISCHE ANMERKUNG ZU FRÜHEREN ANSÄTZEN ZU DIESER FRAGE
Der früheste Hinweis eines Autors, dass ähnliche Geschichten und Situationen in der gesamten Literatur zu finden sind, findet sich in James Boswells Biografie von Dr. Samuel Johnson aus dem späten achtzehnten Jahrhundert. In einem ergreifenden Verweis auf Projekte, von denen Johnson während seines Lebens sprach, die er aber nie vollenden konnte, erinnert ein Freund Boswell daran, wie der große Mann einmal seine Absicht erwähnt hatte, ein Buch zu schreiben, das (mit den zu Beginn dieses Prologs zitierten Worten) zeigt:
'wie wenig ECHTE FIKTION es auf der Welt gibt; und dass die gleichen Bilder, mit sehr geringen Abweichungen, allen Autoren gedient haben, die je geschrieben haben.'
Dr. Johnson war einer der belesensten Männer seiner Zeit. Er kannte praktisch die gesamte überlieferte Literatur der klassischen Zeit, dazu die meisten herausragenden Theaterstücke und Romane, die seit der Renaissance (zumindest in englischer Sprache) geschrieben worden waren. Er war mit seinem scharfen Verstand von der ständigen Wiederkehr bestimmter Bilder und Situationen in Erzählungen so beeindruckt, dass er hoffte, eines Tages systematischer darüber nachdenken zu können. Leider bleibt uns nicht mehr als dieser Hinweis darauf, wie weit ihn seine Beobachtungen gebracht haben könnten.
Ein anderer, dessen Gedanken in die gleiche Richtung gingen, war Johnsons belesener Beinahe-Zeitgenosse, Goethe (1749-1832). In seinen Gesprächen mit Eckermann berührt er mehrmals diese Frage, am bemerkenswertesten in der seitdem oft zitierten Stelle:
Gozzi behauptete, dass es nur sechsunddreißig dramatische Situationen geben kann; Schiller gab sich große Mühe, mehr zu finden, war aber nicht in der Lage, auch nur so viele wie Gozzi zu finden.'2
Dann, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kam aus einer ganz anderen Richtung eine verblüffende Entdeckung: Das wachsende Heer der Anthropologen, Ethnologen und Völkerkundler stellte fest, in welchem Ausmaß dieselben Themen und Motive in den Mythen und Volksmärchen der ganzen Welt auftauchten. Es gab nicht nur, wie Sir James Frazer in „The Golden Bough“ (1890) zeigte, bemerkenswerte Ähnlichkeiten in den zentralen religiösen Mythen verschiedener Kulturen, wie z. B. die Idee des Gottes, der stirbt und wiedergeboren wird (schon 1871 war George Eliots Mr. Casaubon in Middlemarch mit "einem großen Werk" beschäftigt, um zu zeigen, dass "alle mythischen Systeme oder erratischen mythischen Fragmente in der Welt Korruptionen einer ursprünglich offenbarten Tradition" waren: Wiederum erhalten wir nicht den geringsten Hinweis darauf, wie Casaubon zu einer solchen Vorstellung gekommen sein könnte). Das wirklich Erstaunliche war, dass die Sammler von Volksmärchen an kulturell und geographisch so weit voneinander entfernten Orten auf Versionen derselben Grundhandlung stießen, dass es unmöglich schien, dass diese Geschichten nur einer einzigen ursprünglichen Quelle entsprungen sein sollten. Varianten von, sagen wir, "Aschenputtel" in ganz Europa zu finden, von Serbien bis zu den Shetlands, von Russland bis Spanien, war eine Sache. Immerhin haben diese Länder einige gemeinsame kulturelle und sprachliche Traditionen. Aber als man dieselbe Geschichte in anderer Form in China, in Afrika und bei den nordamerikanischen Indianern fand, war klar, dass ihre Allgegenwärtigkeit nicht mehr einfach durch kulturellen Kontakt oder eine gemeinsame historische Quelle, wie archaisch auch immer, erklärt werden konnte.
Woher kamen also die Geschichten? Eine Antwort von vielen Autoren des späten 19. Jahrhunderts war, dass all diese Geschichten, Mythen und Legenden Versuche waren, Naturphänomene zu erklären und zu dramatisieren. Der Philologe Friedrich Max Muller (1823-1900) vertrat die damals populäre Theorie, dass es sich bei den Geschichten vom Gott, der stirbt und wiedergeboren wird, um "Sonnenmythen" handele, die den Untergang und den Aufgang der Sonne beschreiben. Es wurde auch vermutet, dass die weit verbreiteten Volksmärchen, in denen eine Heldin von einem Ungeheuer gefressen wird, etwas damit zu tun haben müssen, dass die Sonne bei einer Sonnenfinsternis vom Mond "gefressen" wird. Andere wiederum vertraten die Ansicht, dass die auf der ganzen Welt verbreiteten Geschichten von "Drachen" und "Monstern" ihren Ursprung in der Entdeckung von Dinosaurierknochen haben. Allerdings waren solche Theorien völlig unzureichend, um die erstaunliche Universalität nicht nur der Geschichten selbst, sondern oft auch der winzigen Details, mit denen sie ausgedrückt wurden, zu erklären. Eine besser ausgefeilte, aber ebenfalls unzureichende Version dieser "Metaphern für die Natur"-Argumente in wurde in jüngerer Zeit von Autoren wie dem kanadischen Akademiker Northrop Frye vorgebracht, der in seiner Anatomie der Kritik versucht hat, die zugrundeliegenden Formen von Tragödie und Komödie mit dem Thema "Tod und Auferstehung" im natürlichen Jahreszyklus (Winter, der dem Frühling weicht, usw.) in Verbindung zu bringen.
Eine zweite Antwort besagt, dass es einfach keine befriedigende, allumfassende Erklärung für die Allgegenwärtigkeit bestimmter Erzählformen gibt. Diese Sichtweise ist vor Allem unter Experten für Folklore beliebt. Seit der viktorianischen Zeit hat sich ein großes Interesse an der Sammlung von Parallelen und Verbindungen zwischen den Volksmärchen hunderter verschiedener Kulturen entwickelt. Allein von "Aschenputtel" sind weit über 1000 Versionen gesammelt worden. Mittlerweile sind die Bibliotheken voll mit Büchern wie "Dreihunderfünfundvierzig Varianten von Aschenputtel, Catskin und Cap O'Rushes, zusammengefasst und tabellarisch dargestellt, mit Diskussion der mittelalterlichen Analoga und Anmerkungen“, oder "Tom-Tit-Tot: Ein vergleichender Essay über Aarne-Thompson Typ 500 - Der Name des Helfers"; oder „Eine neue Klassifizierung der grundlegenden Version der Tar Baby-Geschichte auf der Grundlage von zweihundertsiebenundsechzig Versionen“. Die Folkloreexperten haben festgestellt, dass die Verbreitung von Märchen durch kulturellen Kontakt im Laufe der Geschichte ein weitaus komplexerer Prozess war, als es auf den ersten Blick scheint. Geschichten, die die Brüder Grimm im frühen 19. Jahrhundert sammelten, lassen sich auf über tausend Jahre ältere indische Quellen zurückführen, die über Handelswege oder zur Zeit der Kreuzzüge nach Europa gelangten und dazwischen von zahllosen Geschichtenerzählern überarbeitet wurden. Geschichten, die in der Neuzeit in Afrika und Asien als "indigene Volksmärchen" gesammelt wurden, gehen wiederum auf die Brüder Grimm zurück. Sie wurden von Missionaren weitergegeben und lokal angepasst.
Eine Folge dieser komplexen Entdeckungen war, dass die fleißigen Sammler von dem Berg an Material, den sie angehäuft hatten, überwältigt waren. Sie verzweifelten an der Suche nach einer Theorie, die eine gemeinsame Basis in der menschlichen Psychologie erkennen konnte, um sowohl den Ursprung der Märchen und ihre wiederkehrenden Merkmale als auch deren anhaltende Anziehungskraft über viele Generationen auf Millionen von Menschen in unterschiedlichen Kulturen erklären konnte. Mit den Worten von Peter und Iona Opie:
„Erfreulicherweise werden solche allumfassenden Theorien heute mit Skepsis betrachtet. Man ist nicht mehr der Meinung, dass eine einzige Theorie geeignet ist, auch nur den größten Teil der Erzählungen zufriedenstellend zu erklären. Ihre Quellen sind sicherlich zahlreich … ihre Bedeutungen – falls sie jemals Bedeutungen hatten – werden als vielfältig angesehen. Jede Erzählung, so glaubt man heute, sollte separat untersucht werden.“3
Es ging förmlich ein Seufzer der Erleichterung durch die Fachwelt – das eigentliche Rätsel wurde jedoch durch diese Herangehensweise nicht gelöst.
Ende des 19. Jahrhunderts stellte der deutsche Ethnologe Adolf Bastian (1826-1905) die Theorie auf, dass der menschliche Geist scheinbar auf natürliche Weise um bestimmte Grundbilder herum arbeitet. Damit näherte man sich der Frage nach dem Geschichtenerzählen zum ersten Mal auf einer tieferen Ebene. Bastian erklärte die Ähnlichkeiten in den Mythen und Erzählungen verschiedener Kulturen mit etwas, das er Elementargedanken oder "elementare Ideen" nannte. Diese, so vermutete er, stammten aus der Natur der menschlichen Psyche und seien daher allen Menschen gemeinsam.
Etwas später, in den 1890er Jahren, deutete Sigmund Freud an, dass ein großer Teil des menschlichen Verhaltens durch das „Unbewusste“ erklärt werden könnte: Große Bereiche unserer psychischen Aktivität lägen unterhalb der Schwelle unseres Bewusstseins.
Eine der offensichtlichsten Arten, wie wir uns der Existenz dieses Bereichs bewusstwerden, sind unsere Träume. Sie präsentieren uns spontan Bildsequenzen, wie Fragmente von Geschichten, ohne dass wir bewusst eingreifen oder ihren Inhalt in irgendeiner Weise zu steuern können. Freud war besonders von den Parallelen zwischen den Inhalten von Träumen und den Themen bestimmter Mythen beeindruckt.
Vielleicht waren solche Mythen in gewisser Weise mit der Grundlage dessen verbunden, wie wir die Welt unbewusst wahrnehmen: mit den inneren Mustern unserer psychischen Entwicklung als Individuen?
Sicherlich schien das berühmte Beispiel des "ödipalen Dreiecks" eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen einem alten Mythos und der Erfahrung zahlloser moderner Individuen zu zeigen: Aus dem immerwährenden Kampf des Kindes mit der riesigen, überschattenden psychischen Präsenz seiner Eltern leitet sich eine große Hürde auf dem Weg zur Etablierung einer eigenen gesunden, unabhängigen psychischen Identität ab, die später bei diesen Menschen zu Problemen führt.
Vielleicht könnte man alle anderen Motive von Mythen und Folklore in demselben Freud’schen Licht sehen: als Geschichten von "raubgierigen Müttern" (Hänsel und Gretel), "Kastrationsängsten" (das Schwert, das bricht) oder der "Flucht aus dem Mutterleib" (Jona und der Wal). Immerhin geht es in den Geschichten um etwas, das die Menschheit universell erlebt: unsere Sexualität, unsere grundlegendsten menschlichen Beziehungen, unsere Erinnerungen an die Geburt und unsere Ängste vor dem Tod. In den letzten 100 Jahren wurden unzählige Versuche unternommen, Mythen, Volksmärchen und andere Geschichten auf diese Weise zu interpretieren. So zum Beispiel Ernest Jones' Aufsatz, der Hamlet als ein weiteres Beispiel für das ödipale Dreieck analysiert, oder Dr. Bruno Bettelheims The Uses of Enchantment (1976), in dem er die Gründe für die Anziehungskraft und den Wert der alten Märchen für die Kinder von heute analysiert.
Dennoch schien ein solcher Ansatz als umfassende Erklärung von Geschichten bei weitem nicht ausreichend und in vielen Fällen sogar grotesk begrenzt. So universell und wichtig unsere Beziehungen zu unseren Eltern oder unsere Sexualität auch sein mögen, dies war sicherlich nicht die ganze Erklärung für die komplexe Struktur von Mythen und Erzählungen auf der ganzen Welt? Gab es nicht eine noch tiefere Ebene, auf der die Bedeutung dieser Geschichten lag: eine Ebene, die die Freud’sche Erklärung nicht in ihrer Gesamtheit ablehnte, sondern sie transzendierte und insgesamt etwas viel Tieferes und Universelleres widerspiegelte?
Mein Ansatz steht in der Tradition von Bastian und Freud, dass erstens die menschliche Vorstellungskraft so beschaffen zu sein scheint, dass sie auf natürliche Weise um bestimmte "elementare" Formen und Bilder herum arbeitet und dass zweitens ein Großteil dessen, was das menschliche Verhalten erklärt, unterbewusst abläuft. Während Freud sich nur mit einem Teil des Bildes beschäftigte, mit der Sexualität und den Problemen der individuellen Psyche, ging sein Schweizer Kollege Carl Jung zu einer viel umfassenderen Frage über: Wie sind wir auf einer tieferen Ebene psychologisch konstruiert? Nach Jung haben wir alle den gleichen psychologischen Tiefenbauplan, genauso wie wir alle genetisch programmiert sind, uns körperlich zu entwickeln. Unsere Individualität kommt somit nur auf den oberflächlicheren Ebenen unserer Psyche zum Vorschein.
Wenn wir nach einer Erklärung suchen, warum bestimmte Bilder, Symbole und Gestaltungsformen in Geschichten in einem Ausmaß wiederkehren, das nicht allein durch kulturelle Überlieferung erklärt werden kann, müssen wir zuerst auf die tieferen Ebenen des Unbewussten schauen, die wir alle gemeinsam haben. Nach Jung liegen auf dieser Ebene archetypische Strukturen und nur dort kann die grundlegende Bedeutung und der Zweck der Muster gefunden werden, die dem Geschichtenerzählen zugrunde liegen.
In der gleichen Tradition stand der Amerikaner Joseph Campbell. Er versuchte in "Der Held mit den tausend Gesichtern" und "Die Masken Gottes", einen Großteil des Geschichtenerzählens zu einer Art universellen Geschichte in Verbindung zu setzen, von der die einzelnen Mythen und Erzählungen lediglich verschiedene Aspekte darstellen. Er nannte das den „Monomythos“.
Andere Autoren weiteten diese Art von allgemeinem Ansatz auf einige der bekannteren literarischen Werke unserer Kultur aus, wie Northrop Frye in seiner „Anatomy of Criticism“ und Leslie Fiedler in „Love and Death In The American Novel“, die auf den folgenden Seiten zitiert werden. Ein weniger bekannter Autor darf in dieser Aufzählung keinesfalls fehlen: John Vyvyan, dessen kleines Buch „The Shakespearean Ethic“ nicht nur ein Versuch war, diese Art der Analyse auf einige von Shakespeares Stücken auszudehnen, sondern auch das originellste Buch über Shakespeare ist, dass ich je gelesen habe.
Der entscheidende Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass alle Arten von Geschichten, letztlich der gleichen Quelle entspringen, nach den gleichen Grundmustern geformt sind und den gleichen verborgenen, universellen Regeln unterliegen.
An diesem Punkt kann unsere Reise beginnen.
Teil I
Prolog zum ersten Teil
Stellen Sie sich vor, wir tauchen gleich in eine Geschichte ein – irgendeine Geschichte der Welt. Auf einer Bühne hebt sich der Vorhang. Ein Kino verdunkelt sich. Wir wenden uns dem ersten Absatz eines Romans zu. Ein Erzähler spricht die uralte Formel "Es war einmal…" aus.
Auf den ersten Blick ist die menschliche Vorstellungskraft und damit der Bereich, der dem Geschichtenerzähler zur Verfügung steht, so grenzenlos, dass man meinen könnte, dass buchstäblich alles als nächstes passieren könnte.
Aber in Wirklichkeit gibt es bestimmte Dinge, die wir ziemlich sicher wissen können, noch bevor die Geschichte beginnt.
Zunächst einmal ist es wahrscheinlich, dass die Geschichte einen Helden oder eine Heldin oder beides haben wird: eine zentrale Figur oder Figuren, auf deren Schicksal unser Interesse an der Geschichte beruht; jemand, mit dem wir uns identifizieren können.
Wir werden unserem Helden oder unserer Heldin in einer imaginären Welt vorgestellt. Kurz oder ausführlich wird die allgemeine Szene festgelegt. Der Zweck der Formel "Es war einmal …" ist es, uns aus unserem gegenwärtigen Ort und unserer Zeit in das imaginäre Reich zu versetzen, in dem sich die Geschichte entfalten soll. Dort wird uns dann die zentrale Figur vorgestellt, mit der wir uns identifizieren sollen.
Dann passiert etwas: ein Ereignis oder eine Begegnung, die die Handlung der Geschichte auslöst und ihr einen Fokus gibt. In der Tat wird der Anfang jeder Geschichte von einer Art Doppelformel beherrscht: „Es war einmal eine Person, die lebte an einem bestimmten Ort … und dann, eines Tages, geschah etwas".
Wir lernen einen Jungen namens Aladdin kennen, der in einer Stadt in China lebt… Dann kommt eines Tages ein Zauberer und führt ihn aus der Stadt in eine geheimnisvolle unterirdische Höhle.
Wir treffen einen schottischen General Macbeth, der gerade einen großen Sieg über die Feinde seines Landes errungen hat… Dann, auf seinem Heimweg, begegnet er den geheimnisvollen Hexen.
Wir treffen ein Mädchen namens Alice, das sich amüsieren möchte… Dann sieht sie plötzlich ein weißes Kaninchen vorbeilaufen und in einem geheimnisvollen Loch verschwinden.
Wir sehen den großen Detektiv Sherlock Holmes in seiner Wohnung in der Baker Street sitzen… Dann klopft es an der Tür, und ein Besucher tritt ein, um ihm seinen nächsten Fall zu präsentieren.
Dieses Ereignis stellt den "Ruf" dar, der den Helden oder die Heldin aus ihrem anfänglichen Zustand in eine Reihe von Abenteuern oder Erlebnissen führt, die ihr Leben mehr oder weniger stark verändern werden.
Das Nächste, dessen wir uns sicher sein können ist, dass die Handlung Konflikte und Ungewissheit beinhaltet, denn ohne ein gewisses Maß an beidem kann es keine Geschichte geben. Wo es einen Helden gibt, kann es auch einen Bösewicht geben (in manchen Fällen ist sogar der Held selbst der Bösewicht). Selbst, wenn die Charaktere in der Geschichte nicht explizit als "die Guten" und "die Bösen" gegenübergestellt werden, ist es wahrscheinlich, dass einige auf der Seite des Helden oder der Heldin stehen, während andere darauf aus sind, sie zu bekämpfen.
Schließlich sollen wir spüren, dass die Geschichte auf eine Art Auflösung hinausläuft. Jede vollständige Geschichte muss auf einen Höhepunkt hinarbeiten, an dem der Konflikt und die Ungewissheit meist am größten sind. Dieser führt dann zu einer Auflösung all dessen, was zuvor geschehen ist, und bringt die Geschichte zu ihrem Ende. Hier sehen wir, wie jede Geschichte, manche ganz subtil und manche mit Nachdruck, ihre Hauptfigur oder -figuren in eine von zwei Richtungen führt: Entweder sie enden glücklich, mit einem Gefühl der Befreiung, Erfüllung und Vollendung. Oder sie enden unglücklich, in irgendeiner Form von Unbehagen, Frustration oder Tod.
Zu sagen, dass Geschichten entweder ein glückliches oder ein unglückliches Ende haben, ist ein solcher Gemeinplatz, dass man fast zögert, ihn auszusprechen. Aber es muss gesagt werden, denn dies ist das Wichtigste, was man bei Geschichten beobachten kann. Darum und um das, was notwendig ist, um eine Geschichte zu der einen oder anderen Art von Ende zu bringen, dreht sich die ganze Bedeutung von Geschichten in unserem Leben.
Einer der wenigen allgemeinen Texte über Geschichten ist Aristoteles' Poetik, die vor weit über 2000 Jahren unvollendet blieb. Es war Aristoteles, der als Erster feststellte, dass eine zufriedenstellende Geschichte "einen Anfang, eine Mitte und ein Ende" haben muss. Er war es auch, der im Zusammenhang mit den beiden Haupttypen von Bühnenstücken zum ersten Mal ausdrücklich auf die beiden Arten von Enden hinwies, auf die eine Geschichte hinauslaufen kann.
Einerseits gibt es, wie Aristoteles es in der Poetik formuliert, tragische Geschichten. In ihnen schlägt das anfängliche Glück des Helden oder der Heldin in eine Katastrophe um (das griechische Wort "Katastrophe" bedeutet wörtlich "Abwärtsschlag", der Abschwung des Heldenglücks am Ende einer Tragödie).
Auf der anderen Seite gibt es im weitesten Sinne Komödien: Geschichten, in denen die Dinge für den Helden oder die Heldin zunächst immer komplizierter zu werden scheinen, bis sie sich in einen scheinbar unlösbaren Knoten verstrickt haben. Doch schließlich kommt das, was Aristoteles die Peripetie oder "Umkehrung des Schicksals" nennt: Der Knoten wird auf wundersame Weise aufgelöst (daher kommt das französische Wort denouement, was wörtlich "Entknotung" bedeutet). Held, Heldin oder beide zusammen sind befreit; und wir können jubeln.
Diese Einteilung gilt für eine viel größere Bandbreite an Geschichten, als es die Begriffe "Tragödie" und "Komödie" vermuten lassen. In der Tat gilt sie, mit Einschränkungen, für den gesamten Bereich des Geschichtenerzählens. Die Handlung einer Geschichte führt ihren Helden oder ihre Heldin entweder in eine "Katastrophe" oder in eine "Entknotung"; in die Frustration oder in die Befreiung; in den Tod oder in eine Erneuerung des Lebens. Man könnte meinen, dass es fast ebenso viele Arten gibt, dieses Auf und Ab zu beschreiben, wie es individuelle Geschichten in der Welt gibt. Doch je sorgfältiger wir die große Bandbreite der Geschichten betrachten, die die menschliche Vorstellungskraft im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat, desto deutlicher können wir erkennen, dass es immer wiederkehrende allgemeine Formen gibt, die den Weg des Helden oder der Heldin zu ihrem endgültigen Ziel vorgeben.
Auf die wichtigsten dieser „Grundhandlungen“ wollen wir nun schauen.
Kapitel 1 - Die Überwindung des Monsters
„Legenden von der Tötung eines zerstörerischen Ungeheuers findet man überall auf der Welt. Der Gedanke, der ihnen allen zugrunde liegt, ist, dass das getötete Ungeheuer übernatürlich und menschenfeindlich ist.“
E. S. Hartland, Die Legende von Perseus (1896)
Im Jahr 1839 machte sich der junge Engländer Henry Austen Layard auf, über Land nach Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, zu reisen. Auf halber Strecke, in der wilden Wüstenregion Mesopotamiens, erweckte eine Reihe mysteriöser Hügel im Sand seine Neugierde. Er hielt inne, um sie zu untersuchen. So begann eine der wichtigsten Untersuchungen in der Geschichte der Archäologie. Das, worüber Layard gestolpert war, entpuppte sich als die Überreste einer der frühesten Städte, die jemals erbaut worden waren: das biblische Niniveh.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden in Niniveh viele faszinierende Entdeckungen gemacht, aber keine war so faszinierend wie eine Vielzahl von Tontafeln, die 1853 ans Tageslicht kam. Die Tafeln waren mit kleinen keilförmigen Zeichen bedeckt, offensichtlich eine unbekannte Form der Schrift. Die Aufgabe, diese "Keilschrift" zu entziffern, sollte den größten Teil der nächsten 20 Jahre in Anspruch nehmen. Als George Smith vom Britischen Museum 1872 endlich die Ergebnisse seiner Arbeit enthüllte, war die viktorianische Öffentlichkeit elektrisiert. Eine Sequenz der Tafeln enthielt Fragmente eines langen epischen Gedichts, das in die Anfänge der Zivilisation zurückdatiert wurde und die bei weitem älteste schriftliche Geschichte der Welt darstellte.
Der erste Teil des sumerischen „Gilgamesch-Epos“, wie wir ihn heute kennen, erzählt davon, wie das Königreich Uruk unter den schrecklichen Schatten eines großen und geheimnisvollen Bösen fällt. Als Quelle der Bedrohung wird eine monströse Gestalt, Humbaba, genannt, die auf der anderen Seite der Welt im Herzen eines abgelegenen Waldes lebt. Der Held Gilgamesch geht zu den Waffenschmieden, die ihn mit besonderen Waffen ausstatten, einem großen Bogen und einer mächtigen Axt. Er begibt sich auf eine lange, gefährliche Reise zu Humbabas entfernter Höhle, wo er schließlich dem Ungeheuer gegenübersteht. Sie liefern sich eine Reihe spöttischer Wortgefechte, bevor sie sich in einen titanischen Kampf stürzen. Gegen Humbabas übernatürliche Kräfte scheint Gilgamesch unmöglich gewinnen zu können. Doch schließlich gelingt es ihm durch eine übermenschliche Leistung, seinen monströsen Gegner zu töten. Die schattenhafte Bedrohung ist gebannt. Gilgamesch hat sein Reich gerettet und kann triumphierend nach Hause zurückkehren.
Im Herbst 1962, fast 5000 Jahre nachdem die Geschichte von Gilgamesch in der Bibliothek von Niniveh platziert wurde (ein Zeitraum, der fast die komplette dokumentierte Menschheitsgeschichte umfasste) versammelte sich eine mondäne Menge am Leicester Square in London zur Premiere eines neuen Films. Dr. No war der erste von vielen Filmen, die in den nächsten 40 Jahren zur populärsten Filmreihe aller Zeiten werden sollten. Mit ihrer für das späte 20. Jahrhundert typischen Mischung aus Weltraumtechnik, Gewalt und Sex schienen diese Filme von der primitiven Welt der Bewohner der ersten Städte, die den religiösen Mythos von Gilgamesch erdachten, meilenweit entfernt zu sein.
Doch denken Sie an die Geschichte, die die Serie der Bond-Filme einleitete. Die westliche Welt steht unter dem Schatten eines großen und mysteriösen Übels. Die Quelle der Bedrohung wird auf eine monströse Gestalt zurückgeführt, den verrückten und deformierten Wissenschaftler Dr. No, der am anderen Ende der Welt in einer unterirdischen Kaverne auf einer abgelegenen Insel lebt. Der Held James Bond sucht den „Waffenschmied“ auf, der ihn mit Spezialwaffen ausrüstet. Er begibt sich auf eine lange, gefährliche Reise zu Dr. No's entferntem Versteck, wo er schließlich dem Monster gegenübersteht. Die beiden liefern sich einen spöttischen Schlagabtausch, bevor sie sich in einen titanischen Kampf stürzen. Gegen die fast übernatürlichen Kräfte von Dr. No scheint Bond nicht gewinnen zu können. Doch schließlich gelingt es ihm durch eine übermenschliche Leistung, seinen monströsen Gegner zu töten. Die schattenhafte Bedrohung ist gebannt. Die westliche Welt ist gerettet. Bond kann triumphierend nach Hause zurückkehren.
Eine Geschichte, die einen solchen Sprung über die gesamte aufgezeichnete Geschichte der Menschheit machen kann, muss eine tiefe symbolische Bedeutung haben. Unseren ersten Typ von Geschichte, die "Überwindung des Monsters", erfüllt dieses Kriterium sicherlich.
Im Reich der Geschichten gibt es nichts Spektakuläreres als dieses furchterregende, lebensbedrohliche, scheinbar allmächtige Monster, dem sich der Held in einem Kampf auf Leben und Tod stellen muss.
Die ersten Begegnungen mit solchen Geschöpfen haben wir meist schon früh in unserem Leben, in Gestalt der Wölfe, Hexen und Riesen aus den Märchen. Rotkäppchen macht sich auf den Weg in den großen Wald, um die freundliche Großmutter zu besuchen. Sie muss feststellen, dass die Großmutter durch den bösen Wolf ersetzt wurde, der Rotkäppchen fressen will. In letzter Sekunde platzt ein tapferer Jäger herein, tötet den Wolf und die kleine Heldin ist gerettet. Hänsel und Gretel werden grausam zum Sterben im Wald ausgesetzt, wo sie eine scheinbar freundliche alte Frau treffen, die in einem Haus aus Lebkuchen lebt. Doch die Frau entpuppt sich als böse Hexe, die die beiden verschlingen will. Gerade als alles verloren scheint, gelingt es ihnen, sie in ihren eigenen Ofen zu stoßen. Zur Belohnung finden sie einen großen Schatz, mit dem sie triumphierend nach Hause zurückkehren. Hans klettert auf seine magische Bohnenstange und entdeckt oben eine neue Welt. Dort betritt er ein geheimnisvolles Schloss, das einem furchterregenden und blutrünstigen Riesen gehört. Nachdem er diese monströse Gestalt bei drei aufeinanderfolgenden Besuchen nach und nach erzürnt und jedes Mal einen Goldschatz stiehlt, reizt Hans den Riesen schließlich zu einer scheinbar tödlichen Verfolgungsjagd. In letzter Sekunde klettert Han die Bohnenstange herunter bringt sie mit einer Axt zum Einsturz. Der Riese fällt tot zu Boden und Jack kann sich an den drei wertvollen Schätzen erfreuen.
Die Essenz der "Überwindung des Monsters"-Geschichte ist einfach. Sowohl wir als auch der Held werden auf die Existenz einer übermenschlichen Verkörperung einer bösen Macht aufmerksam gemacht. Dieses Monster kann menschliche Gestalt annehmen (z.B. ein Riese oder eine Hexe), die Gestalt eines Tieres (ein Wolf, ein Drache, ein Hai) oder eine Kombination aus beidem (der Minotaurus, die Sphinx). Das Monster ist immer tödlich und droht denen, die seinen Weg kreuzen oder in seine Fänge geraten, mit Zerstörung. Oft bedroht es eine ganze Gemeinschaft oder ein Königreich, sogar die Menschheit und die Welt im Allgemeinen. Oft hat das Ungeheuer eine große Beute in seinen Fängen, einen unbezahlbaren Schatz oder eine schöne "Prinzessin".
Die Präsenz dieser Figur ist so mächtig, das Gefühl der Bedrohung so groß, dass das Einzige, worauf es uns ankommt, der Tod des Monsters und der Sieg über die dunkle Macht ist. Schließlich muss der Held dem Monster entgegentreten. Dabei ist er oft mit einer Art "magischer Waffe" bewaffnet und die Konfrontation findet meist in oder in der Nähe des Verstecks des Monsters statt. Dieses Versteck ist ein abgelegener oder schwer zugänglicher Ort wie eine Höhle, ein Wald, ein Schloss, ein See, das Meer oder Ähnliches. Es kommt zum Kampf, in dem der Held scheinbar keine Chance hat und in der Tat gibt es immer einen Moment, in dem seine Vernichtung fast unausweichlich scheint. Im letzten Moment, wenn die Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, kommt es jedoch zu einer dramatischen Wendung. Der Held entkommt dem Tod und das Ungeheuer wird erschlagen. Die Belohnung des Helden ist von großem Wert, z.B. ein Schatz, oder die Hand der "Prinzessin". Mit seinem Sieg befreit der Held seine Gemeinschaft, sein Königreich, die menschliche Rasse oder gleich die ganze Welt aus dem Schatten der Bedrohung durch das Monster und sichert ihr Überleben. Zu Ehren seiner Leistung wird er in manchen Fällen zu einer Art Herrscher oder König erklärt.
Es gibt nur wenige Kulturen auf der Welt, die nicht irgendeine Version dieser Geschichte hervorgebracht haben. Eine Zivilisation, die wir besonders mit solchen Geschichten in Verbindung bringen, ist die der alten Griechen. Ihre Mythologie wimmelte nur so von Monstern jeder Art. Da waren die Titanen, die von Zeus besiegt wurden; der einäugige Riese Polyphem, der von Odysseus geblendet wurde; die mächtige Python, die von Apollo erwürgt wurde; und die Sphinx, die sich über die Klippe stürzte, als Ödipus ihr Rätsel richtig beantworten konnte (wofür er zum König von Theben gewählt wurde).
Einer der berühmtesten griechischen Monstertöter war Perseus, der nicht nur ein, sondern gleich zwei Ungeheuer bezwingen musste, ein weibliches und ein männliches. Als er als Junge mit seiner schönen Mutter, der Prinzessin Danae, in die Welt hinausgeworfen wird, geraten die beiden in den Schatten des grausamen Tyrannen Akrisios. Akrisios verlangt, dass Danae sich seinen Avancen unterwirft. In einem verzweifelten Versuch, seine Mutter vor diesem Schicksal zu bewahren, bietet der junge Perseus an, jede Aufgabe zu erfüllen, die ihm der Tyrann stellt. Der grausame Akrisios schickt den Jungen deshalb ans Ende der Welt, um das Haupt der schrecklichen Gorgone Medusa zu holen, deren Anblick einen Menschen zu Stein werden lässt. Perseus wird von den Göttern ausgestattet: Er erhält ein Paar geflügelter Sandalen, mit denen er fliegen kann, einen "Unsichtbarkeitshelm" und einen glänzend polierten Schild, in dem er das Spiegelbild der Medusa sehen kann, ohne sie direkt ansehen zu müssen. Auf "abgelegenen und unwegsamen Wegen" erreicht Perseus die Höhle der Gorgonen am westlichen Rand der Welt und schlägt Medusas Schlangenkopf ab. Scheinbar hat Perseus seine Aufgabe triumphal abgeschlossen. Aber dann erfahren wir, dass dies nur die Vorbereitung auf eine weitere immense Aufgabe war, die ihn auf seiner Heimreise erwartet: Als er mit seiner Beute zurückfliegt, blickt er auf eine schöne, weinende Prinzessin, Andromeda, die an einen Felsen am Meer gekettet ist. Sie wurde dort als Tribut platziert, um ein furchterregendes Seeungeheuer zu besänftigen, das von Poseidon geschickt wurde, um das Königreich ihres Vaters zu verwüsten. Perseus sieht, wie sich das riesige Reptil aus den Tiefen erhebt, um Andromeda zu ergreifen, und stürzt sich hinab, um es zum Kampf zu stellen. Mit dem Haupt der Medusa gelingt es ihm, das Ungeheuer zu versteinern. Perseus wird mit der Hand der Prinzessin belohnt, weil er das Reich ihres Vaters von der Bedrohung durch das Seeungeheuer befreit hat. Er kehrt nach Hause zurück, wo er das Haupt der Medusa noch einmal benutzt, um auch den Tyrannen Akrisius zu versteinern. Schließlich wird Perseus König von Argos.
Ein weiterer gefeierter Monstertöter war Theseus.Er wächst der ebenfalls allein mit seiner Mutter auf. Als er volljährig wird, macht er sich auf den Weg zu seinem Vater, König Ägeus in Athen. Auf dem Weg dorthin muss er eine Reihe von Monstern und Schurken töten. Doch als er in Athen ankommt, findet er das Reich seines Vaters unter dem schrecklichen Schatten des rivalisierenden Königshauses von Kreta, das von dem grimmigen Tyrannen König Minos regiert wird. Jedes neunte Jahr müssen die Athener dem Tyrannen einen Tribut zahlen, indem sie die Blüte der Jugend ihrer Stadt aussenden, um ein schreckliches Ungeheuer, den Minotaurus, zu füttern. Der Minotaurus ist halb Mensch, halb Stier und lebt im Herzen eines dunklen Steinlabyrinths, aus dem noch nie jemand einen Ausweg gefunden hat. Theseus meldet sich freiwillig, um die Gruppe junger Männer und Frauen anzuführen, dem Minotaurus geopfert werden sollen. Als er auf Kreta ankommt, gewinnt er die Liebe und Unterstützung von Ariadne, der Tochter des Tyrannen. Sie stattet ihn heimlich mit "magischen Hilfsmitteln", einem Schwert und einem Faden. Er findet den Weg in die Mitte des Labyrinths, stellt sich dem Minotaurus und tötet ihn. Mit Ariadnes Faden, den er zuvor ausgerollt hat, findet Theseus den Weg durch das Labyrinth zurück ins Freie. Als sie gemeinsam zurück nach Athen fliehen, lässt Theseus seine Prinzessin auf der Insel Naxos zurück. In Sichtweite des Festlandes vergisst er dann, ein weißes statt eines schwarzen Segels zu hissen, um seinem Vater die siegreiche Heimkehr anzukündigen. König Ägeus wirft sich vor Kummer in das Meer, das fortan seinen Namen trägt. Theseus übernimmt das Königreich und wird der größte Herrscher, den Athen je hatte. Er heiratet Ariadnes Schwester Phaedra und macht sie zu seiner Königin.
Verglichen mit dem Aufgebot an abscheulichen und übernatürlichen Ungeheuern in der griechischen Mythologie, erscheint der Bösewicht der bekanntesten jüdischen Legende dieser Art fast brav. Aber als die Armee der Philister in das Königreich Sauls einfällt, gibt es für die Kinder Israels nichts Furchterregenderes als den scheinbar unbesiegbaren Riesen Goliath. Als der unscheinbare Hirtenjunge David vortritt, um den Riesen herauszufordern, reagieren seine Brüder und die gesamte Armee Israels zunächst verächtlich. Das ändert sich schlagartig, als sie sehen, wie David seine Steine zielsicher auf die Stirn des Riesen schleudert und dieser leblos zu Boden stürzt. Als Retter seines Landes erhält David die Hand von König Sauls Tochter, der Prinzessin Michal, und wird schließlich als Nachfolger Sauls zum größten König seines Landes.
Die unmittelbare Belohnung des Helden für das Töten des Monsters ist vielleicht nicht immer der Gewinn einer "Prinzessin" und die Nachfolge in einem Königreich: aber in der einen oder anderen Form sind diese selten sehr weit entfernt.
Eine andere bemerkenswerte Konstellation von Monstergeschichten waren die, die im ersten Jahrtausend in Nordeuropa auftauchten. Selten hat die Welt eine solche Parade von Riesen, Drachen, Trollen, verräterischen Zwergen, üblen Unholden und "ekelhaften Würmern" gesehen, wie sie in den nordischen Sagen sowie in den germanischen und keltischen Epen dieser Zeit vorkamen. Hier war die Belohnung des Helden für die Tötung des Monsters meist ein sagenhafter Schatz. Eine solche Erzählung ist eine Episode in der „Volsunga-Saga“, die davon berichtet, wie der junge Held Sigurd mit Hilfe seiner "Zauberwaffe", dem großen Schwert Gram, das schreckliche Ungeheuer Fafnir erschlägt. Fafnir lebt mitten in der Wildnis und wacht über einen großen Schatz, zu dem auch der Zugang zu allerlei Runenwissen gehört, etwa das Verstehen des Vogelgesangs. Doch dann entdeckt Sigurd "die schöne Schildmaid" Brynhild, die schlafend auf einem Berggipfel liegt. Sie wird von einem Ring aus magischen Flammen bewacht, den nur "der wahre Held" betreten kann. Dank seiner Schätze und des geheimen Wissens, das er zuvor durch seinen Sieg über Fafnir gewonnen hat, kann Sigurd Brynhil wecken und ihre Liebe gewinnen. Diese Geschichte fand später durch die Adaption von Wagner größere Verbreitung.
Eine weitere berühmte Überwindung des Monsters aus dem „finsteren Mittelalter“ ist die eingangs erwähnte Geschichte von Beowulf. Wieder beginnen wir mit dem vertrauten Bild eines Königreichs, das unter einen schrecklichen Schatten gefallen ist: die kleine Gemeinde Heorot, die von den räuberischen Angriffen des mysteriösen Monsters Grendel bedroht wird. Der junge Held Beowulf kommt von jenseits des Meeres und fügt dem Ungeheuer in einem großen nächtlichen Kampf schließlich eine tödliche Wunde zu: Nur um dann, als er die Blutspur Grendels verfolgt, festzustellen, dass er sich seiner noch schrecklicheren Mutter stellen muss, die in ihrer Höhle auf dem Grund eines tiefen Sees über dem Körper ihres toten Sohnes grollt. Beowulfs unmittelbare Belohnung für seinen Sieg über die beiden Ungeheuer sind "alte Schätze und gedrehtes Gold" von dem dankbaren König, dessen Königreich er gerettet hat. Er kehrt dann nach Hause zurück, um König über sein eigenes Königreich zu werden. Viele Jahre später, am Ende seines Lebens, muss er sich einem dritten Ungeheuer stellen. Dies ist eine zutiefst symbolische Episode, auf die wir viel später im Buch noch eingehen werden.
Von den vielen Geschichten über die Überwindung eines Ungeheuers, die das christliche Europa im Mittelalter hervorgebracht hat, ist die von St. Georg und dem Drachen wohl die bekannteste. Sie scheint eine christliche Adaption des Perseus-Mythos zu sein.4 Der Held kommt in ein Königreich, das von einem Drachen verwüstet wurde, und findet wie Perseus eine schöne Prinzessin, die am Rande des Meeres angebunden ist, wo sie von ihren Landsleuten in einem letzten verzweifelten Versuch platziert wurde, die Angriffe des Monsters abzuwehren. Das Ungeheuer nähert sich und Georg erschlägt es. Im Gegensatz zu Perseus heiratet Georg die Prinzessin allerdings nicht. Es handelt sich hier um eine "christliche" Version der Geschichte: Georg besteht als Belohnung darauf, dass alle Bewohner des Landes getauft werden. Mit anderen Worten, Georg verlangt, dass alle in ein anderes "Königreich", das Königreich Christi, eintreten sollen. 5
In den Jahrhunderten nach Mittelalter und Renaissance schwand der Glauben an das Übernatürliche und mit ihm verschwanden auch die fantastischen Drachen und Ungeheuer zunehmend, aber nie ganz, aus den europäischen Erzählungen. Viel später kamen dann fabelhafte und furchterregende "Monster" auf bemerkenswerte Weise wieder in Mode.
Es geschah ganz plötzlich, in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. In den vorangegangenen 100 Jahren hatte es eine Reihe von Vorzeichen gegeben, vor allem in der Vorliebe für den "Gothic Horror", der mit Geschichten wie "The Castle of Otranto" (1764) und Mary Shelleys "Frankenstein" (1817) ein wichtiges Zeichen für den Aufstieg der romantischen Bewegung war. In den 1890er Jahren erschienen innerhalb weniger Jahre in England eine Reihe von Geschichten, in denen Monster, grotesker als nie zuvor, wieder in den Vordergrund der westlichen populären Erzählung traten: Geistergeschichten, Gruselgeschichten und Science-Fiction tauchten auf und spielen seither eine dominante Rolle in der populären Unterhaltung.
Im Jahr 1894 schrieb M. R. James eine Geschichte mit dem Titel „Canon Alberic's Scrap Book“. Geschichten von Gespenstern und Spuk wurden seit jeher erzählt, aber mit seiner ersten Reihe von Geistergeschichten hob James das Grauen auf eine neue Ebene. In einer "verfallenden Stadt" in den Pyrenäen findet der englische Gelehrte Denniston einen Folianten mit alten Manuskripten. Sie gehörte einem Kanoniker der örtlichen Kathedrale, der 200 Jahre zuvor unter mysteriösen Umständen gestorben war. Besonders eine Zeichnung erregt Dennistons Aufmerksamkeit - eine Gruppe entsetzter Soldaten am Hof von König Salomon, die eine seltsame, unförmige Kreatur umringen. Spät am Abend, während er die Zeichnung in seiner Unterkunft untersucht, wird Denniston plötzlich einer schrecklichen Präsenz im Raum gewahr:
„Er flog aus seinem Stuhl mit tödlichem, unfassbarem Schrecken, der sich an sein Herz klammerte. Die Gestalt … erhob sich zu einer stehenden Haltung hinter seinem Sitz … grobes Haar bedeckte sie, wie auf der Zeichnung. Der Unterkiefer war dünn - wie kann ich es nennen? - flach, wie der eines Tieres. Zähne zeigten sich hinter den schwarzen Lippen; es gab keine Nase; die Augen waren von einem feurigen Gelb, gegen die sich schwarz und intensiv die Pupillen abzeichneten… Der jubelnde Hass und der Durst, Leben zu zerstören, die dort leuchteten, waren das Schrecklichste an der ganzen Vision.“
Denniston greift nach einem Kruzifix, wie nach einer 'Zauberwaffe': zwei Diener stürmen herein und spüren, wie 'etwas' sie aus dem Zimmer schiebt. Denniston zerstört die Zeichnung; das 'Ungeheuer' ist überwunden und erscheint nicht mehr.
Drei Jahre später, im Jahr 1897, veröffentlichte Bram Stoker seinen Dracula. Geschichten von blutsaugenden Vampiren waren schon früher erzählt worden, aber Stokers Version war auf einer neuen Ebene des Grauens konzipiert. Die Geschichte gliederte sich in zwei Teile. Im ersten Teil besucht der Held, ein junger englischer Anwalt namens Harker, eine geheimnisvolle Burgruine tief in den wolfsverseuchten Wäldern Transsilvaniens. Es liegt ein Hauch des Bösen in der Luft, sowohl über dem Ort als auch über seinem Klienten, Graf Dracula. Dracula ist ein Mann mit scharfen, vorstehenden Zähnen und unnatürlich roten Lippen. Was folgt, lässt alle "gotischen Schrecken" des vorhergehenden Jahrhunderts trivial erscheinen. Harker entdeckt, dass er in der Falle eines Mannes sitzt, der bei Mondlicht mit dem Gesicht nach unten an der Schlossmauer herunterkriechen kann. Dann findet er seinen Klienten eines Tages wie tot daliegend, "aufgedunsen" mit Blut, "wie ein dreckiger Blutegel, erschöpft von seiner Sättigung". Als sei das noch nicht genug, scheint Dracula eine ganze Armee ebenso schrecklicher überirdischer Geister zu befehligen.
Wie der Held dem scheinbar sicheren Untergang entkommt, wird nie klar, aber der zweite Teil der Geschichte erzählt, wie Dracula in England "einfällt". Harker und seine Freunde wollen verhindern, dass das Monster zwei junge Mädchen, eines davon Harkers zukünftige Frau Mina, in seine Gewalt bringt, um sie für seine Armee der lebenden Toten zu rekrutieren. Minas Freundin Lucy gerät in Draculas tödliche Macht:
„Weit unten in der Eibenallee sahen wir eine weiße Gestalt voranschreiten … Lucy Westenra, aber doch wie verändert. Die Süße hatte sich in unerbittliche, herzlose Grausamkeit verwandelt und die Reinheit in ungezügelte Wollust … (ihre) Lippen waren purpurrot von frischem Blut … (ihre) Augen voller Höllenfeuer.'
Nachdem Dracula die eine "Prinzessin" vernichtet hat, richtet er seine nächtlichen Angriffe auf Mina, die Verlobte des Helden. Wir lesen, wie sie allmählich in der tödlichen Macht des Monsters versinkt. Harker und seine Freunde bringen Dracula schließlich zur Strecke und verfolgen ihn zurück in sein transsilvanisches Versteck. Gerade noch rechtzeitig, bevor Mina stirbt, schaffen sie es, ihre "magische Waffe" einzusetzen: Sie stoßen einen Pflock in das Herz des Monsters (die einzige Möglichkeit, einen Vampir zu töten):





























