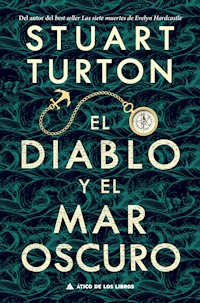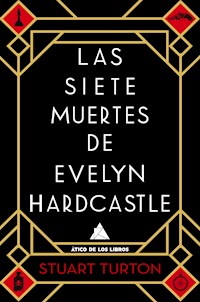11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
Maskenball auf dem Anwesen der Familie Hardcastle. Am Ende des Abends wird Evelyn, die Tochter des Hauses, sterben. Und das nicht nur ein Mal. Tag für Tag wird sich ihr mysteriöser Tod wiederholen – so lange, bis der Mörder endlich gefasst ist. Familie Hardcastle lädt zu einem Ball auf ihr Anwesen Blackheath. Alle Gäste amüsieren sich, bis ein fataler Pistolenschuss die ausgelassene Feier beendet. Evelyn Hardcastle, die Tochter des Hauses, wird tot aufgefunden. Unter den Gästen befindet sich jemand, der mehr über diesen Tod weiß, denn am selben Tag hat Aiden Bishop eine seltsame Nachricht erreicht: »Heute Abend wird jemand ermordet werden. Es wird nicht wie ein Mord aussehen, und man wird den Mörder daher nicht fassen. Bereinigen Sie dieses Unrecht, und ich zeige Ihnen den Weg hinaus.« Tatsächlich wird Evelyn nicht nur ein Mal sterben. Bis der Mörder entlarvt ist, wiederholt sich der dramatische Tag in Endlosschleife. Doch damit nicht genug: Immer, wenn ein neuer Tag anbricht, erwacht Aiden im Körper eines anderen Gastes und muss das Geflecht aus Feind und Freund neu entwirren. Jemand will ihn mit allen Mitteln davon abhalten, Blackheath jemals wieder zu verlassen. Stimmen zum Buch »Stellen Sie sich darauf ein, dass dieses Buch Sie völlig umhauen wird ... ein berauschendes Verwirrspiel und ausgesprochen originelles Leseerlebnis.« Daily Express »Komplex, faszinierend und verblüffend … Ein erstaunlich ausgefeiltes Debüt.« The Times »Was für ein Vergnügen, sich von diesem Buch in die Irre führen zu lassen.« Guardian »Dieses Buch verdient es, ein echter Hit zu werden … Unvergleichlich unterhaltsam und spannend.« Sunday Express
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Englischen von Dorothee Merkel
Tropen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle«
© 2018 Raven Books, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, London
Für die deutsche Ausgabe
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Zero-Media.net, München, unter Verwendung der Daten des Originalverlags, Illustration: © Emily Faccini
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50421-7
E-Book: ISBN 978-3-608-19166-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der vierte Tag (Fortsetzung)
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der fünfte Tag
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der fünfte Tag (Fortsetzung)
Der sechste Tag
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der sechste Tag (Fortsetzung)
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der sechste Tag (Fortsetzung)
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der siebte Tag
Der dritte Tag (Fortsetzung)
Der achte Tag
Der zweite Tag (Fortsetzung)
Der achte Tag (Fortsetzung)
Danksagung
Karte
Für meine Eltern, die mir alles gegeben und nichts verlangt haben. Für meine Schwester, meine erste und strengste Leserin, angefangen bei den Hummel-Geschichten bis hin zum heutigen Tag. Und für meine Frau, deren liebevoller Unterstützung – und Ermahnungen, ab und zu auch einmal den Blick von meiner Tastatur loszureißen – es zu verdanken ist, dass aus diesem Buch so viel mehr geworden ist, als ich es jemals für möglich gehalten hätte.
Der erste Tag
1.
Zwischen einem Schritt und dem nächsten vergesse ich alles.
»Anna!«, rufe ich und klappe dann überrascht den Mund zu.
In meinem Kopf herrscht völlige Leere. Ich weiß nicht, wer Anna ist oder warum ich ihren Namen rufe. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierhergekommen bin. Ich stehe in einem Wald und halte mir schützend die Hand über die Augen, um den Nieselregen abzuwehren. Mein Herz klopft wie wild, ich verströme einen penetranten Geruch nach Schweiß, und mir zittern die Beine. Ich muss gerannt sein, aber ich kann mich nicht erinnern, warum.
»Wie bin ich …« Der Anblick meiner eigenen Hände lässt mich verstummen. Sie sind knochig und hager. Hässlich. Die Hände eines Fremden. Ich erkenne sie nicht wieder.
Ich spüre, wie mich ein erster Anflug von Panik überkommt, und versuche, mir irgendetwas über mich selbst in Erinnerung zu rufen, ein Familienmitglied, meine Adresse, mein Alter, ganz gleich was, aber es will sich nicht das Geringste einstellen. Ich weiß nicht einmal meinen Namen. Sämtliche Erinnerungen, die ich noch wenige Sekunden zuvor gehabt haben muss, sind ausgelöscht.
Meine Kehle schnürt sich zusammen, und meine Atemzüge werden immer lauter und hastiger. Der Wald dreht sich, schwarze Punkte verdüstern mein Blickfeld.
Bleib ruhig!
»Ich kann nicht atmen«, keuche ich. Das Blut tost in meinen Ohren. Ich sinke zu Boden und kralle die Finger in die Erde.
Du kannst atmen, du musst dich nur wieder beruhigen.
Der kalte, gebieterische Klang dieser inneren Stimme hat etwas Tröstliches.
Schließ die Augen und lausche den Geräuschen des Waldes. Sammle dich.
Ich gehorche der Stimme und schließe die Augen so fest wie möglich, aber das Einzige, was ich hören kann, ist mein eigenes panisches Keuchen. Für eine halbe Ewigkeit erstickt es jedes übrige Geräusch. Doch langsam, unendlich langsam gelingt es mir, eine kleine Kerbe in meine Angst zu schlagen, sodass auch andere Laute zu mir durchdringen können. Regentropfen, die auf die Blätter herabrieseln. Äste, die über meinem Kopf rascheln. Ein plätschernder Bach ein Stück weit zu meiner Rechten. Ein paar Krähen, die aus den Bäumen aufflattern und die Luft mit ihren Flügelschlägen zersplittern. Etwas huscht durch das Unterholz. Das dumpfe Trommeln von Kaninchenpfoten, so nah, dass ich das Tier berühren könnte. Ich nehme diese neuen Erinnerungen und verknüpfe sie Stück für Stück miteinander, bis ich schließlich über eine Vergangenheit verfüge, die ganze fünf Minuten währt und in deren schützenden Mantel ich mich einhüllen kann. Es genügt, um meine Panik zu besiegen, jedenfalls für den Augenblick.
Unbeholfen rappele ich mich auf und stelle dann überrascht fest, wie groß ich bin und wie weit ich vom Erdboden entfernt zu sein scheine. Noch ein wenig schwankend wische ich mir die feuchten Blätter von der Hose und bemerke dabei zum ersten Mal, dass ich einen Smoking trage. Das weiße Hemd ist mit Schlamm und Rotwein besudelt. Ich muss auf einem Fest gewesen sein. Meine Taschen sind leer, und ich trage keinen Mantel, also kann ich mich nicht besonders weit von diesem Fest entfernt haben. Das beruhigt mich ein wenig.
Den Lichtverhältnissen nach zu urteilen muss es früh am Morgen sein. Das bedeutet wohl, dass ich die ganze Nacht hier draußen verbracht habe. Man wird sich kaum so schick anziehen, wenn man nur einen ruhigen Abend allein verbringen möchte, was wiederum bedeutet, dass meine Abwesenheit in der Zwischenzeit irgendjemandem aufgefallen sein dürfte. Bestimmt gibt es jenseits dieses Waldes ein Haus, dessen Bewohner gerade aufwachen, alarmiert mein Fehlen bemerken und Suchtrupps losschicken, um mich aufzuspüren. Ich lasse den Blick durch den Wald schweifen und glaube schon fast, jeden Moment meine Freunde zwischen dem dichten Laub der Bäume auftauchen zu sehen. Sie werden mir auf die Schulter klopfen, mich ein wenig necken und dann zurück nach Hause begleiten. Aber irgendwelchen Tagträumen nachzuhängen wird mich nicht aus diesem Wald befreien. Ich kann nicht einfach hier ausharren und auf Rettung hoffen, denn ich zittere am ganzen Körper vor Kälte und mir klappern die Zähne. Ich muss ausschreiten, mich bewegen, und sei es auch nur, um mich warm zu halten. Doch ich sehe nichts als Bäume, ganz gleich, wohin ich schaue. Ich kann also unmöglich wissen, ob ich mich in die richtige Richtung bewege, ob ich der Hilfe entgegeneile oder mich von ihr entferne.
Ratlos kehre ich zu dem letzten Gedanken zurück, der mein vorheriges Ich beschäftigt hat.
»Anna!«
Wer auch immer diese Person sein mag, sie ist ganz offenbar der Grund dafür, dass ich mich hier draußen befinde. Aber es will mir nicht gelingen, mir ihr Bild vor Augen zu führen. Vielleicht ist sie ja meine Frau oder meine Tochter? Keines von beidem fühlt sich richtig an. Und doch übt der Name einen gewissen Sog auf mich aus. Ich kann spüren, wie er meine Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung lenken will.
»Anna!«, rufe ich, mehr aus Verzweiflung denn aus Hoffnung.
»Hilfe!«, schreit eine Frau zurück.
Ich drehe mich so schnell um die eigene Achse, dass mir schwindlig wird, und suche nach der Stimme. Dann erhasche ich einen flüchtigen Blick auf eine Frau in einem schwarzen Kleid, weit entfernt zwischen den Bäumen. Sie rennt um ihr Leben. Sekunden später entdecke ich ihren Verfolger, der mit lautem Krachen durch das Unterholz bricht.
»Sie da, bleiben Sie stehen!«, brülle ich, aber meine Stimme ist zu schwach und kraftlos und wird von den beiden durch den Wald hastenden Menschen niedergetrampelt.
Starr vor Schreck bleibe ich stehen, der Mann und die Frau sind schon fast außer Sichtweite, als ich endlich die Verfolgung aufnehme. Ich fliege geradezu über den Boden, in einem Tempo, das ich meinem schmerzgeplagten Körper niemals zugetraut hätte. Aber ganz gleich, wie schnell ich laufe – die beiden anderen bleiben mir immer ein Stück voraus.
Der Schweiß rinnt mir die Stirn herab, und meine ohnehin geschwächten Beine werden immer schwerer, bis sie schließlich unter mir nachgeben und ich der Länge nach zu Boden stürze. Ich stolpere durch die Blätter und raffe mich im selben Moment auf, in dem die Frau schreit. Der spitze, von einer fürchterlichen Angst erfüllte Laut hallt durch den Wald, bis ein Pistolenschuss ihn zum Verstummen bringt.
»Anna!«, rufe ich verzweifelt. »Anna!«
Die einzige Antwort, die ich bekomme, ist das rasch verklingende Echo des Pistolenknalls.
Dreißig Sekunden. So lange habe ich gezögert, als ich sie zum ersten Mal sah und so weit war ich von ihr entfernt, als sie ermordet wurde. Dreißig Sekunden der Unentschlossenheit. Dreißig Sekunden, in deren Verlauf ich jemanden erbarmungslos seinem Schicksal überließ.
Ich hebe einen dicken Ast auf, den ich neben meinen Füßen entdecke, und lasse ihn versuchsweise durch die Luft sausen. Sein Gewicht und die raue Beschaffenheit seiner Rinde haben etwas Beruhigendes. Gegen eine Pistole wird er mir zwar nicht besonders viel nützen, aber es ist immer noch besser, als mich hilflos mit leeren Händen durch diesen Wald zu tasten. Ich bin von dem schnellen Lauf immer noch außer Atem, aber mein Schuldgefühl drängt mich in die Richtung, aus der ich Anna habe schreien hören. Vorsichtig, aus Angst, zu viel Lärm zu machen, biege ich die herabhängenden Äste zur Seite und suche nach etwas, das ich eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen möchte.
Zu meiner Linken knacken Zweige.
Ich halte den Atem an und lausche mit jeder Faser meines Körpers.
Das Geräusch erklingt erneut. Füße, die Blätter und Zweige zertreten und sich mir in einem Halbkreis von hinten nähern.
Das Blut gefriert mir in den Adern und lässt mich vollkommen bewegungslos erstarren. Ich wage es nicht, einen Blick über meine Schulter zu werfen.
Das Knacken der Zweige kommt näher, bis schließlich unmittelbar in meinem Rücken flache, gepresste Atemzüge zu hören sind. Meine Beine geben unter mir nach, und der Ast fällt mir aus der Hand.
Ich würde ja ein Gebet sprechen, aber mir fallen keine Worte ein.
Ein warmer Atem streift meinen Nacken. Ich rieche Alkohol und Zigaretten, den Gestank eines ungewaschenen Körpers.
»Nach Osten«, krächzt eine Männerstimme, und dann lässt die Person einen schweren Gegenstand in meine Hosentasche gleiten.
Sie zieht sich in meinem Rücken weiter zurück, und ihre Schritte verhallen im Wald. Ich sacke in mich zusammen, presse meine Stirn gegen den Waldboden, atme den Geruch der nassen Blätter und der Fäulnis ein und lasse zu, dass mir die Tränen die Wangen herabströmen.
Meine Erleichterung ist armselig, meine Feigheit erbärmlich. Ich konnte meinem Peiniger nicht einmal in die Augen sehen. Was bin ich nur für ein Mann?
Es dauert fast zehn Minuten, bis meine Furcht so weit abgeklungen ist, dass ich mich wieder bewegen kann, und selbst dann sehe ich mich noch gezwungen, mich an einen der nahestehenden Bäume zu lehnen, um meine Kräfte zu sammeln. Das Geschenk des Mörders schlingert in meiner Tasche hin und her. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Dennoch stecke ich meine Hand hinein und ziehe einen silbernen Kompass hervor.
»Oh«, sage ich überrascht.
Das Glas ist gesprungen, die metallene Oberfläche zerkratzt, und auf der Unterseite sind die Initialen SB eingraviert. Ich verstehe nicht, was sie bedeuten, aber die Anweisung des Mörders war klar und deutlich. Ich soll den Kompass benutzen, um nach Osten zu gehen.
Von Schuldgefühlen gepeinigt sehe ich mich im Wald um. Annas Leiche muss hier irgendwo in der Nähe liegen, aber ich habe furchtbare Angst davor, wie der Mörder reagieren könnte, falls ich auf sie stoße. Vielleicht bin ich ja nur deshalb noch am Leben, weil ich mich dem Ort des Geschehens nicht noch weiter genähert habe. Möchte ich wirklich ausloten, wie weit die Grenzen seines Erbarmens reichen?
Gesetzt den Fall, dass es sich hier tatsächlich um Erbarmen handelt.
Eine halbe Ewigkeit lang stehe ich nur da und starre auf die vibrierende Kompassnadel. Es gibt nicht mehr viel, was ich mit Sicherheit weiß, aber bei dieser einen Sache bin ich mir sicher: Mörder kennen kein Erbarmen. Was auch immer das für ein Spiel sein mag, das er hier mit mir spielt, ich kann seinem Rat kein Vertrauen schenken und sollte ihm nicht folgen. Aber wenn ich es nicht tue … Erneut schaue ich mich suchend im Wald um. In jeder Richtung sieht es vollkommen gleich aus. Endlose Baumreihen unter einem gehässigen Himmel.
Wie schlimm muss man sich verirrt haben, um sich vom Teufel heimleiten zu lassen?
So schlimm wie ich in diesem Augenblick, entscheide ich.
Ich löse mich von dem Baum, an den ich mich gelehnt hatte, und betrachte den Kompass, der in meiner Handfläche liegt. Seine Nadel strebt unermüdlich gen Norden. Also drehe ich mich nach Osten, dem Wind, der Kälte und der gesamten erbarmungslosen Welt entgegen.
Die Hoffnung hat mich im Stich gelassen.
Ich bin ein Mann im Fegefeuer, mit Blindheit geschlagen und in Unkenntnis der Sünden, die mich an diesen Ort getrieben haben.
2.
Der Wind heult. Auch der Regen ist heftiger geworden. Er prasselt so ungestüm durch das Laub der Bäume, dass die Tropfen knöchelhoch vom Boden in die Luft zurückspringen. Ich lasse mich von dem Kompass leiten.
Mitten in der Düsternis entdecke ich plötzlich einen blitzartig aufflackernden Farbtupfer und wate zu ihm hinüber. Im Näherkommen erkenne ich, dass dort jemand ein rotes Stück Tuch an einen Baum genagelt hat – das Überbleibsel eines längst in Vergessenheit geratenen Kinderspiels, wie ich vermute. Ich schaue mich suchend nach einem weiteren Tuch um und entdecke eines, das nur ein paar Meter entfernt hängt. Dann noch eins und noch eins. Ich stolpere zwischen ihnen entlang und bahne mir so einen Weg durch die Dunkelheit, bis ich schließlich den Waldrand erreiche. Die Bäume weichen zurück und geben den Blick frei auf ein weitläufiges, im georgianischen Stil errichtetes Herrenhaus, dessen rote Backsteinfassade unter wucherndem Efeu begraben liegt. Soweit ich erkennen kann, ist das Haus leer und verlassen. Auf der langen Kiesauffahrt, die zur Eingangstür führt, wächst üppig das Unkraut, und die rechteckigen Rasenflächen zu beiden Seiten haben sich in Sumpfland verwandelt, an dessen Rändern verdorrte Blumen stehen.
Ich halte nach einem Lebenszeichen Ausschau und lasse den Blick über die dunklen Fenster wandern, bis ich im ersten Stock einen schwachen Lichtschein entdecke. Eigentlich sollte ich erleichtert sein, aber ich zögere. Ich habe das Gefühl, auf ein schlafendes Monstrum gestoßen zu sein – als wäre jenes ungewisse Licht der Herzschlag einer ebenso riesigen wie gefährlichen Kreatur, die im Augenblick noch vollkommen reglos verharrt. Warum sonst sollte mir ein Mörder diesen Kompass schenken, wenn nicht zu dem Zweck, mich einem noch viel größeren Unheil auszuliefern?
Doch der Gedanke an Anna lässt mich schließlich einen Schritt vorwärts machen. Sie hat wegen jener dreißig Sekunden der Unentschlossenheit ihr Leben verloren, und nun stehe ich hier und zögere erneut. Ich versuche, meine Angst in den Griff zu bekommen, wische mir das Regenwasser aus den Augen, überquere den Rasen und steige die zerbröckelnden Stufen zur Eingangstür hoch. Dort angekommen, hämmere ich mit kindischer Wut gegen das Holz und schleudere meine letzte Kraft in jeden Hieb. Etwas Furchtbares ist in jenem Wald geschehen, aber der Schuldige kann immer noch seine gerechte Strafe erhalten, wenn ich es nur schaffe, die Bewohner dieses Hauses aufzurütteln.
Doch unglücklicherweise gelingt mir das nicht.
Obwohl ich so lange gegen die Tür schlage, bis ich keine Kraft mehr habe, kommt niemand, um zu öffnen.
Ich beschirme meine Augen mit beiden Händen und presse die Nase gegen eines der hohen Fenster, von denen die Tür umrahmt wird, aber das Buntglas ist mit einer so dicken Schmutzschicht überzogen, dass ich nur schmierige gelbliche Flecken erkennen kann. Ich schlage mit der Handfläche gegen das Fensterglas, trete dann ein paar Schritte zurück und blicke an der Fassade hoch, um nach einem anderen Weg ins Innere Ausschau zu halten. Erst in diesem Moment fällt mir der Klingelzug auf, dessen rostige Kette sich im Efeu verheddert hat. Ich befreie die Kette mit einem Ruck aus den Fängen der Pflanze und ziehe kräftig daran, immer und immer wieder, bis sich hinter den Fenstern endlich etwas regt.
Die Tür wird von einem verschlafenen Kerl geöffnet, dessen Erscheinungsbild so außergewöhnlich ist, dass ich einen Moment lang nur verblüfft dastehe und ihn anstarre. Ihm scheint es jedoch nicht anders zu ergehen. Er ist klein, krumm und verschrumpelt – offenbar aufgrund eines Feuers, das ihm auch die Hälfte seines Gesichts verbrannt hat. Ein viel zu großer Schlafanzug schlottert ihm um die kleiderbügelähnlichen Glieder, und um seine schiefen Schultern ist ein schmutzig brauner Morgenrock drapiert, dessen Farbe an ein Rattenfell erinnert. Er hat kaum noch Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen, sondern kommt mir vielmehr wie der letzte Angehörige einer urzeitlichen Spezies vor, die in den Irrungen und Wirrungen unserer Evolution verschollen gegangen ist.
»Oh, dem Himmel sei Dank, ich brauche Ihre Hilfe«, sage ich, nachdem ich mich wieder ein wenig gefangen habe.
Er starrt mich mit offenem Mund an.
»Gibt es hier ein Telefon?«, versuche ich es erneut. »Wir müssen die Polizei verständigen!«
Nichts.
»Stehen Sie nicht einfach nur so dumm da, Sie Teufel!«, rufe ich, packe ihn an den Schultern und rüttele ihn. Schließlich dränge ich mich an ihm vorbei in die Eingangshalle. Als ich meinen Blick durch den Raum schweifen lasse, bleibt mir vor Erstaunen der Mund offenstehen. Überall glänzt und funkelt es, und in dem schwarzweiß karierten Marmorboden spiegelt sich ein Kristallkronleuchter, der mit Dutzenden Kerzen geschmückt ist. Zahllose, in kostbare Rahmen gefasste Spiegel hängen an den Wänden, eine breite Freitreppe mit einem prunkvollen Geländer schwingt sich zu einer Galerie empor, und ein schmaler roter Teppich fließt die Treppen herab wie das Blut eines geschlachteten Tieres.
Im hinteren Teil des Raumes knallt eine Tür, und ein halbes Dutzend Diener erscheint aus den Tiefen des Hauses, die Arme vollbeladen mit violetten und rosafarbenen Blumen, deren Duft den vorher noch so penetranten Geruch nach heißem Wachs fast vollständig überlagert. Als sie das Schreckgespenst entdecken, das keuchend an der Tür steht, brechen sämtliche Gespräche abrupt ab. Einer nach dem anderen drehen sie mir ihre Köpfe zu, und die gesamte Eingangshalle scheint die Luft anzuhalten. Es dauert nicht lange, und das einzige Geräusch, das noch zu hören ist, sind die Wassertropfen, die aus meinen durchnässten Kleidern auf den makellos sauberen Boden fallen.
Tropf.
Tropf.
Tropf.
»Sebastian?«
Ein gutaussehender blonder Mann, der in einen Cricket-Pullover und Leinenhosen gekleidet ist, eilt immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe herunter. Er ist etwa Anfang fünfzig, wirkt jedoch keineswegs müde oder abgespannt. Die Jahre haben ihm vielmehr einen zerzausten, dekadent eleganten Anstrich verliehen. Er hat die Hände in den Hosentaschen vergraben und kommt quer durch die Halle geradewegs auf mich zu. Die Dienstboten weichen zu beiden Seiten zurück und geben eine Schneise für ihn frei. Ich habe den Eindruck, als bemerke er ihre Gegenwart überhaupt nicht – mit einer solchen Intensität ist sein Blick auf mich gerichtet.
»Mein lieber Freund, was ist denn mit dir geschehen, um Himmels willen?«, fragt er und runzelt besorgt die Stirn. »Als ich dich das letzte Mal sah …«
»Wir müssen sofort die Polizei rufen«, sage ich und packe ihn am Arm. »Anna wurde ermordet.«
Im Raum erhebt sich ein schockiertes Flüstern.
Der blonde Mann schaut mich erneut stirnrunzelnd an und lässt dann seinen Blick kurz zu den Dienstboten hinüberschweifen, die alle einen Schritt nähergekommen sind.
»Anna?«, fragt er mit leiser Stimme.
»Ja, Anna, jemand hat sie verfolgt.«
»Wer denn?«
»Eine schwarzgekleidete Gestalt. Wir müssen die Polizei rufen!«
»Gleich, gleich, lass uns erst in dein Zimmer hinaufgehen«, versucht er mich zu besänftigen, während er mich zur Treppe hinüberdrängt.
Ich weiß nicht, ob es die Hitze ist, die hier im Haus herrscht, oder die Erleichterung, ein freundliches Gesicht zu sehen, aber ich fühle mich einer Ohnmacht nah und muss mich schwer auf das Geländer stützen, um nicht zu stürzen, während wir die Treppe hinaufsteigen.
Am oberen Ende der Stufen empfängt uns eine alte Standuhr, deren Räderwerk vom Rost zerfressen ist und auf deren reglosem Pendel die Sekunden zu Staub zerfallen. Es ist später, als ich gedacht hatte, schon fast halb elf Uhr morgens.
Zu beiden Seiten erstrecken sich Korridore, die in die einander gegenüberliegenden Flügel des Hauses führen. Der Flur im Ostflügel ist jedoch durch einen Samtvorhang versperrt, den jemand hastig mit Nägeln an die Decke geheftet hat. Ein kleines, am Stoff angebrachtes Schild besagt, dass dieser Teil des Hauses gerade renoviert wird.
Voller Ungeduld, mir endlich den Schock von der Seele zu reden, den ich heute früh erlitten habe, versuche ich erneut, das Gespräch auf Anna zu lenken, aber mein Samariter bringt mich mit einem verschwörerischen Kopfschütteln zum Verstummen.
»Diese verdammten Dienstboten werden alles, was du sagst, in weniger als einer halben Minute im gesamten Haus verbreiten«, sagt er so leise, dass seine Stimme fast vom Erdboden verschluckt wird. »Wir warten mit unserer Unterhaltung am besten, bis wir unter vier Augen sind.«
Und schon ist er mir um zwei Schritte voraus. Ich schaffe es kaum, in einer geraden Linie zu laufen, geschweige denn, mit ihm Schritt zu halten.
»Mein lieber Freund, du siehst ja fürchterlich aus«, sagt er, als er mein Zurückbleiben bemerkt.
Er stützt meinen Arm, legt mir die Hand aufs Kreuz, presst seine Finger leicht gegen mein Rückgrat und geleitet mich so den Flur hinab. Trotz der flüchtigen Berührung kann ich seine Dringlichkeit spüren. Zu beiden Seiten des Flurs, den wir entlanggehen, befinden sich Schlafräume, in denen die Zimmermädchen gerade Staub wischen. Die Wände müssen erst vor Kurzem frisch gestrichen worden sein, denn die Farbdämpfe bringen meine Augen zum Tränen. Während wir durch den Flur eilen, erkenne ich immer mehr Anzeichen dafür, mit welcher Hast hier renoviert wurde. Die Bodendielen sind mit Spritzern einer Holzbeize übersät, die farblich nicht zum Rest passt, und hier und da liegen Teppiche auf dem Boden, um das Geräusch der knarzenden Fugen zu dämpfen. An den Wänden sind Lehnstühle aufgereiht, damit man die tiefen Risse nicht sehen kann, von denen sie durchzogen sind, und überall sind Gemälde und Porzellanvasen verteilt, die den Blick von den abbröckelnden Simsen lenken sollen. Bei dem Grad von Verfall, der hier herrscht, scheinen mir diese Versuche, ihn zu übertünchen, ein müßiges Unterfangen zu sein. Man hat nichts anderes getan, als eine dem Untergang geweihte Ruine mit allem möglichen Tand auszuschmücken.
»Ah! Dies ist dein Schlafzimmer, nicht wahr?«, sagt mein Gefährte und öffnet die Tür zu einem Raum, der nicht weit vom Ende des Flures entfernt liegt.
Ein kalter Luftzug schlägt mir ins Gesicht und weckt ein wenig meine Lebensgeister, aber mein Begleiter geht rasch voran und schließt das Fenster, durch das die Luft in den Raum geströmt ist. Ich folge ihm dicht auf den Fersen und betrete ein freundlich wirkendes Zimmer. In der Mitte steht ein großes Himmelbett, dessen majestätische Pracht nur unwesentlich durch den durchhängenden Baldachin und die verschlissenen Bettvorhänge getrübt wird – auch wenn die darauf aufgestickten Vögel mit der Zeit so fadenscheinig geworden sind, dass sie eher auseinander- als in die Luft zu fliegen scheinen. Die linke Hälfte des Raumes ist durch einen Wandschirm verdeckt, hinter dem man durch die Lücken zwischen den Paneelen eine gusseiserne Badewanne erkennen kann. Ansonsten ist der Raum äußerst karg möbliert. Er enthält nur noch einen Nachttisch und einen großen Kleiderschrank neben dem Fenster. Beide Möbelstücke sind von der Sonne ausgeblichen, und ihr Holz ist an zahlreichen Stellen abgesplittert. Der einzige persönliche Gegenstand, den ich entdecken kann, ist eine King-James-Bibel mit abgewetztem Buchdeckel und zahlreichen Eselsohren, die auf dem Nachttisch liegt.
Während mein Samariter mit dem schwergängigen Fenster kämpft, stelle ich mich neben ihn. Die Aussicht, die sich mir dort bietet, verbannt für einen Moment alle anderen Gedanken aus meinem Kopf. Wir sind an allen Seiten von dichtem Wald umgeben, dessen grünes Kronendach von keinem einzigen Dorf, keiner einzigen Straße durchbrochen wird. Ohne den Kompass, ohne die Gnade eines Mörders, hätte ich diesen Ort niemals gefunden. Und doch kann ich das Gefühl nicht abschütteln, in eine Falle gelockt worden zu sein. Warum sollte er Anna töten und mich verschonen, wenn nicht, um irgendeinen größeren, weitreichenderen Plan zu verfolgen? Was will dieser Teufel von mir, das er mir nicht auch schon im Wald hätte nehmen können?
Mein Begleiter schlägt das Fenster zu und weist auf einen Sessel, der neben dem sanft flackernden Kaminfeuer steht. Dann reicht er mir ein frisches weißes Handtuch, das er aus dem Schrank genommen hat, setzt sich auf die Bettkante und schlägt ein Bein über das andere.
»Dann erzähl mal ganz von vorn, altes Haus«, sagt er.
»Dazu ist keine Zeit«, entgegne ich und umklammere die Armlehne des Sessels. »Ich werde all deine Fragen zu gegebener Zeit beantworten, aber jetzt müssen wir zuallererst die Polizei rufen und den Wald durchsuchen! Da draußen läuft ein Wahnsinniger frei herum.«
Sein Blick mustert mich, als sei die Wahrheit über das Geschehene in den Falten meiner schmutzigen Kleider zu finden.
»Ich fürchte, wir können niemanden anrufen. Wir haben hier draußen keinen Telefonanschluss«, sagt er und reibt sich das Kinn. »Aber wir können den Wald durchsuchen und dann einen der Dienstboten ins Dorf schicken, falls wir dort fündig werden. Wie viel Zeit brauchst du, um dich umzuziehen? Du wirst uns die Stelle zeigen müssen, wo es passiert ist.«
»Nun …« Ich ringe die Hände, während ich das Handtuch umklammert halte. »Das ist schwierig, ich hatte die Orientierung verloren.«
»Dann beschreibe eben, wie es sich zugetragen hat«, sagt er und zieht ein Hosenbein hoch, sodass sein Knöchel und eine seiner grauen Socken zum Vorschein kommen. »Wie sah der Mörder aus?«
»Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Er war in einen schweren schwarzen Mantel gekleidet.«
»Und diese Anna?«
»Sie war ebenfalls schwarz gekleidet«, sage ich. Mir steigt die Hitze in die Wangen, als mir bewusst wird, wie spärlich die Informationen sind, die ich zu bieten habe. »Ich … Nun, ich weiß nichts als ihren Namen.«
»Verzeih mir, Sebastian, aber ich dachte, sie sei eine Freundin von dir.«
»Nein …« Ich stottere. »Ich meine, ja, vielleicht. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen.«
Mein Samariter beugt sich mit einem verwirrten Lächeln vor und lässt dabei die Hände zwischen den Knien baumeln. »Ich habe da wohl etwas nicht ganz verstanden, fürchte ich. Wie ist es möglich, dass du ihren Namen weißt, aber nicht sicher sein kannst, ob …«
»Ich habe mein Gedächtnis verloren, verdammt noch mal«, unterbreche ich ihn. Mein Geständnis landet mit einem dumpfen Aufprall zwischen uns auf dem Fußboden, als hätte ich einen Stein fallengelassen. »Ich kann mich nicht mal mehr an meinen eigenen Namen erinnern, geschweige denn an die meiner Freunde.«
Sein Blick füllt sich mit Skepsis. Ich kann es ihm nicht verübeln. Das alles hört sich sogar in meinen eigenen Ohren absurd an.
»Mein Gedächtnisverlust hat jedoch meine Erinnerung an die Geschehnisse, deren Zeuge ich wurde, in keiner Weise beeinträchtigt«, insistiere ich und versuche verzweifelt, mich an den letzten Rest meiner Glaubwürdigkeit zu klammern. »Ich habe gesehen, wie eine Frau verfolgt wurde, ich habe sie schreien hören, und dann wurde sie durch einen Pistolenschuss zum Schweigen gebracht. Wir müssen diesen Wald durchsuchen!«
»Ich verstehe«, sagt er, hält dann einen Moment inne und schnipst sich ein paar Staubflusen vom Hosenbein. Seine nächsten Worte sind ein behutsames Angebot, ebenso vorsichtig gewählt wie unterbreitet.
»Besteht die Möglichkeit, dass es sich bei den beiden Menschen, die du gesehen hast, vielleicht um ein Liebespaar handelte? Zwei Menschen, die im Wald irgendein Spiel gespielt haben? Das Geräusch war vielleicht das Knacken eines Astes, vielleicht ja sogar eine Startschusspistole.«
»Nein, nein, sie hat um Hilfe gerufen, sie hatte Angst«, entgegne ich. Meine Aufregung reißt mich vom Sessel hoch, und ich werfe das nun schmutzige Handtuch auf die Erde.
»Natürlich, natürlich«, sagt er beruhigend und sieht mir dabei zu, wie ich verzweifelt hin und her laufe. »Ich glaube dir ja, alter Freund, aber die Polizei ist bei diesen Dingen immer sehr genau, und darüber hinaus gibt es nichts, was diese Leute mehr erfreut, als wenn es ihnen gelingt, Angehörige der besseren Gesellschaft dumm aussehen zu lassen.«
Ich starre ihn hilflos an und habe das Gefühl, in einem Meer von Allgemeinplätzen zu ertrinken.
»Der Mörder hat mir dies hier gegeben«, sage ich, als mir plötzlich der Kompass wieder einfällt. Ich ziehe ihn aus der Tasche. Er ist voller Schlamm, und ich muss ihn mit meinem Ärmel erst sauber wischen. »Da sind Buchstaben auf der Rückseite eingraviert«, sage ich und zeige mit einem zitternden Finger darauf.
Er betrachtet den Kompass mit zusammengekniffenen Augen und wendet ihn dann mit methodischer Zielstrebigkeit um.
»SB«, sagt er gedehnt und schaut zu mir hoch.
»Ja!«
»Sebastian Bell.« Er hält inne, als er meine Verwirrung bemerkt. »Das ist dein Name, Sebastian. Das hier sind deine Initialen. Das ist dein Kompass.«
Mein Mund öffnet und schließt sich wieder, ohne dass ich einen Ton von mir gegeben hätte.
»Ich muss ihn verloren haben«, sage ich schließlich. »Vielleicht hat ihn der Mörder ja aufgehoben.«
»Vielleicht«, nickt er.
Seine Liebenswürdigkeit nimmt mir vollkommen den Wind aus den Segeln. Er hält mich für halb wahnsinnig, für einen betrunkenen Narren, der die Nacht im Wald verbracht hat und bei seiner Rückkehr irgendwelche Fantastereien brabbelt. Doch statt wütend darüber zu werden, bemitleidet er mich. Das ist das Schlimmste. Wut ist greifbar, sie hat ein gewisses Gewicht. Man kann mit den Fäusten darauf einschlagen. Doch Mitleid ist ein Nebel, in dem man sich nur verirren kann.
Ich lasse mich zurück in den Sessel fallen und vergrabe den Kopf in den Händen. Da draußen läuft ein Mörder frei herum, und mir will es nicht gelingen, mein Gegenüber von der drohenden Gefahr zu überzeugen.
Ein Mörder, der dir den Heimweg gewiesen hat?
»Ich weiß, was ich gesehen habe«, sage ich.
Du weißt nicht einmal, wer du bist.
»Natürlich tust du das«, sagt mein Gefährte. Er hat offenbar missverstanden, was ich hier eigentlich beteuern wollte.
Ich starre ins Leere. Das Einzige, woran ich denken kann, ist eine Frau namens Anna, die tot im Wald liegt.
»Hör zu. Du ruhst dich jetzt erst einmal aus«, sagt er und steht auf. »Ich höre mich mal im Haus um, ob irgendjemand vermisst wird. Vielleicht kommt dabei ja etwas heraus.«
Sein Tonfall ist versöhnlich, klingt jedoch gleichzeitig auch sehr nüchtern. Trotz der Güte und Freundlichkeit, die er mir erwiesen hat, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass er bei den Zweifeln, die er ganz offensichtlich hegt, irgendetwas Sinnvolles zustande bringen wird. Wenn sich die Tür meines Zimmers erst einmal hinter ihm geschlossen hat, wird er allenfalls ein paar halbherzige Fragen an ein paar vereinzelte Mitglieder der Dienerschaft richten. Und derweil liegt Anna dort draußen im Wald, von allen im Stich gelassen.
»Ich habe gesehen, wie eine Frau ermordet wurde«, sage ich, während ich mich resigniert von meinem Stuhl erhebe. »Eine Frau, der ich hätte helfen müssen. Und wenn ich jeden Zentimeter dieses Waldes durchsuchen muss, um das zu beweisen, dann werde ich das eben tun.«
Er schaut mir einen Moment lang fest in die Augen, und ich kann erkennen, wie seine Skepsis angesichts meiner unumstößlichen Gewissheit ins Schwanken gerät.
»Wo würdest du anfangen?«, fragt er. »Es gibt dort draußen tausende Hektar Land. Deine Absichten mögen noch so ehrenvoll sein, aber du hast es ja schließlich kaum geschafft, die Treppe hinaufzusteigen. Wer auch immer diese Anna ist – sie ist bereits tot, und ihr Mörder ist geflohen. Gib mir eine Stunde Zeit. Ich stelle einen Suchtrupp zusammen und höre mich um. Irgendjemand in diesem Haus muss doch wissen, wer sie ist und welche Richtung sie eingeschlagen hat. Wir werden sie finden, das verspreche ich dir, aber wir müssen dabei mit Bedacht vorgehen.«
Er legt mir eine Hand auf die Schulter.
»Könntest du tun, worum ich dich gebeten habe? Nur eine Stunde, bitte.«
Ich habe so viele Einwände, dass ich fast daran ersticke, aber er hat recht. Ich muss mich ausruhen, muss wieder zu Kräften kommen, und ich mag mich wegen Annas Tod noch so schuldig fühlen, aber ich will auf keinen Fall allein in diesen Wald hinausstapfen. Es ist mir ja schon das erste Mal kaum gelungen, daraus zu entfliehen.
Ich füge mich in das Unvermeidliche und nicke kleinlaut.
»Danke, Sebastian«, sagt er. »Man hat ein Bad für dich eingelassen. Warum wäschst du dich nicht erst einmal, und ich schicke derweil nach dem Arzt und bitte meinen Kammerdiener, ein paar Kleider für dich zurechtzulegen. Ruh dich ein bisschen aus, und dann treffen wir uns zur Mittagszeit im Salon.«
Ich hätte ihm eigentlich alle möglichen Fragen zu diesem Haus stellen sollen, bevor er das Zimmer verlässt, und dazu, weshalb ich mich eigentlich hier aufhalte, aber ich bin viel zu ungeduldig und möchte, dass er so bald wie möglich mit seiner Befragung beginnt, damit wir die Suche nach Anna aufnehmen können. Doch es gibt eine Sache, die mir jetzt wichtig erscheint. Er hat die Tür bereits geöffnet, als ich die richtigen Worte finde.
»Habe ich hier im Haus Familie?«, frage ich. »Gibt es irgendjemanden hier, der sich vielleicht Sorgen um mich gemacht hat?«
Er wirft mir über die Schulter einen Blick zu und wählt – offenbar aus Mitgefühl – seine nächsten Worte sehr behutsam.
»Du bist Junggeselle, alter Freund. Und du hast keine nennenswerte Familie, außer einer schrulligen alten Tante irgendwo da draußen, die dir jederzeit den Geldhahn zudrehen kann. Du hast natürlich Freunde, zu denen auch ich zähle, aber wer auch immer diese Anna ist, du hast sie jedenfalls mir gegenüber noch nie erwähnt. Um ehrlich zu sein, habe ich dich bis zum heutigen Tag nicht einmal ihren Namen sagen hören.«
Mit einem verlegenen Schulterzucken kehrt er mir und meiner Enttäuschung den Rücken zu, verschwindet in den kalten Flur hinaus und schließt die Tür hinter sich, sodass das Feuer unstet aufflackert.
3.
Kaum, dass sich der Luftzug verflüchtigt hat, bin ich schon aus meinem Sessel aufgesprungen und habe die Schubladen meines Nachttisches geöffnet. Ich durchsuche meine sämtlichen Besitztümer nach einem Hinweis auf Anna, nach irgendetwas, das beweist, dass sie nicht das Hirngespinst eines verwirrten Geistes ist. Doch das Schlafzimmer gibt sich unglücklicherweise bemerkenswert zugeknöpft. Abgesehen von einer Brieftasche, die einige wenige Pfundscheine enthält, ist der einzige andere persönliche Gegenstand eine in Gold gestanzte Einladungskarte, auf der vorne eine Gästeliste und auf der Rückseite eine in eleganter Handschrift verfasste Nachricht steht.
Lord und Lady Hardcastle laden Sie anlässlich der Rückkehr ihrer Tochter Evelyn aus Paris herzlich zum Maskenball ein. Die Feier wird am zweiten Septemberwochenende auf Blackheath House stattfinden. Da sich das Anwesen in einer sehr abgeschiedenen Lage befindet, werden wir für alle geladenen Gäste einen Transfer vom nahegelegenen Ort Abberly arrangieren.
Die Einladung ist an einen gewissen Doktor Sebastian Bell gerichtet – ein Name, bei dem es einige Sekunden dauert, bis ich ihn als meinen eigenen erkenne. Zwar hatte mein Samariter ihn eben noch erwähnt, doch es ist sehr viel verstörender, ihm nun in schriftlicher Form zu begegnen, und dann auch noch in Verbindung mit meinem Berufsstand. Ich fühle mich nicht wie ein Sebastian, geschweige denn wie ein Arzt.
Ein gequältes Lächeln huscht mir übers Gesicht.
Ich frage mich, wie viele meiner Patienten mir wohl treu bleiben werden, wenn ich mich ihnen mit einem verkehrt herum gehaltenen Stethoskop nähere.
Ich werfe die Einladung zurück in die Schublade und wende mich der Bibel zu, die auf dem Nachttisch liegt. Während ich die zerlesenen Seiten durchblättere, stelle ich fest, dass manche Abschnitte unterstrichen und einige beliebig wirkende Worte mit roter Tinte umkringelt sind. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, was diese Worte für eine besondere Bedeutung haben sollen. Ich hatte gehofft, eine Widmung im Innern zu finden oder einen Brief, der in den Seiten versteckt ist, aber die Bibel hat mir keine weiteren Erkenntnisse zu bieten. Ich umklammere das Buch mit beiden Händen und unternehme einen unbeholfenen Versuch zu beten, in der Hoffnung, ich könne vielleicht so den Glauben wieder zum Leben erwecken, den ich einmal besessen haben muss – welche Gestalt dieser auch immer gehabt haben mag. Doch mein Bemühen fühlt sich äußerst töricht an. Offenbar hat mich meine Religion im Stich gelassen, genau wie alles Übrige, das mein Leben ausgemacht hat.
Als Nächstes wende ich mich dem Schrank zu und durchsuche die Taschen meiner Kleider, aber auch da werde ich nicht fündig. Doch dann entdecke ich einen Schiffskoffer, der unter einem Stapel Decken begraben liegt. Es ist ein wunderschöner alter Koffer, dessen abgewetztes Leder von matten Eisenbeschlägen eingefasst ist. Ein schwerer Schnappverschluss schützt den Inhalt vor neugierigen Blicken, und auf dem Etikett ist eine Londoner Adresse eingetragen – meine eigene Adresse, vermutlich, aber sie ruft keinerlei Erinnerung in mir wach.
Ich ziehe mein Jackett aus und schleife den Koffer mühsam über das blanke Holz der Fußbodendielen, wobei sein Inhalt bei jedem Ruck ein lautes Scheppern von sich gibt. Ich murmele unwillkürlich aufgeregt vor mich hin, während ich auf den Knopf des Verschlusses drücke, doch mein Murmeln geht in ein enttäuschtes Aufstöhnen über, als mir klar wird, dass das verdammte Ding verschlossen ist. Ich zerre an dem Deckel, einmal, zweimal, doch er gibt nicht nach. Noch einmal durchsuche ich die geöffneten Schubladen und die Kommode und lege mich sogar auf den Bauch, um unter dem Bett nachzuschauen. Aber dort gibt es nichts als Staub und kleine Kügelchen mit Rattengift.
Der Schlüssel ist nirgends zu finden.
Der einzige Ort, an dem ich noch nicht gesucht habe, ist der Teil des Raumes, in dem die Badewanne steht. Ich laufe wie ein Besessener um den Wandschirm herum und erschrecke mich fast zu Tode, als mir auf der anderen Seite eine Kreatur mit wild aufgerissenen Augen begegnet, die mir dort aufgelauert hat.
Es ist mein Spiegelbild.
Die wild dreinblickende Kreatur im Spiegel macht bei dieser Entdeckung einen ebenso peinlich berührten Eindruck wie ich.
Vorsichtig trete ich einen Schritt vor und betrachte mich zum ersten Mal. Enttäuschung steigt in mir hoch. Jetzt, da ich diesen zitternden, ängstlichen Kerl dort sehe, wird mir bewusst, dass ich ganz andere Erwartungen in mich selbst gesetzt hatte. Größer, kleiner, dünner, dicker, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls nicht diese nichtssagende Gestalt im Spiegelglas. Braune Haare, braune Augen, ein Kinn, das diese Bezeichnung kaum verdient – ich bin irgendein Gesicht in der Menge. Nur ein bisschen Füllmaterial, mit dem Gott die Lücken schließt, die sich gelegentlich auftun.
Ich bin meines eigenen Spiegelbilds sehr rasch überdrüssig. Stattdessen setze ich die Suche nach dem Schlüssel zu meinem Koffer fort, aber abgesehen von ein paar Toilettenartikeln und einem Krug Wasser ist hier hinten nichts weiter zu entdecken. Wer auch immer ich früher gewesen sein mag – es hat ganz den Anschein, als hätte ich vor meinem Verschwinden auch mich selbst weggeräumt, zusammen mit sämtlichen Spuren, die ich in der Welt hinterlassen habe. Ich will gerade vor lauter Frustration laut aufheulen, als ich von einem Klopfen an der Tür unterbrochen werde. In den fünf beherzten Schlägen lässt sich schon die gesamte Persönlichkeit desjenigen erkennen, der dort Einlass begehrt.
»Sebastian, sind Sie da?«, fragt eine barsche Stimme. »Mein Name ist Richard Acker und ich bin Arzt. Man hat mich gebeten, nach Ihnen zu schauen.«
Ich öffne die Tür und sehe mich einem gigantischen grauen Schnurrbart gegenüber. Es ist ein wahrhaft bemerkenswerter Anblick. Die gekräuselten Spitzen des Bartes stehen so weit vom Gesicht ab, dass man meinen könnte, sie gehörten gar nicht mehr dazu. Der Mann, der hinter dem Schnurrbart steckt, ist etwa Mitte sechzig, vollkommen kahl und hat eine Knollennase und blutunterlaufene Augen. Er riecht nach Brandy, aber auf eine heitere Weise, als hätte er jeden einzelnen Tropfen des Alkohols mit einem glücklichen Lächeln genossen.
»Du lieber Gott, Sie sehen ja furchtbar aus«, sagt er. »Um mal eine ganz fachmännische Diagnose abzugeben.«
Er nutzt meine Verwirrung, um sich an mir vorbei ins Zimmer zu drängen, wirft seine schwarze Arzttasche auf das Bett und schaut sich gründlich um, wobei er insbesondere meinem Koffer besondere Aufmerksamkeit widmet.
»Ich hatte früher auch mal so ein Ding«, sagt er und streicht liebevoll mit der Hand über den Deckel. »La volaille, nicht wahr? Hat mich in den Orient und wieder zurückbegleitet, als ich noch in der Armee gedient habe. Man sagt ja immer, man könne den Franzosen nicht über den Weg trauen, aber ohne das von ihnen hergestellte Gepäck wäre ich aufgeschmissen.«
Er tritt versuchsweise dagegen und stößt einen schmerzlichen Laut aus, als sein Fuß von dem unnachgiebigen Leder abprallt.
»Da müssen Sie ja Ziegelsteine drin haben«, sagt er und legt erwartungsvoll den Kopf schief, als gäbe es auf diese Bemerkung eine vernünftige Antwort.
»Er ist verschlossen«, stottere ich.
»Und Sie können den Schlüssel nicht finden, was?«
»Ich … nein. Doktor Acker, ich …«
»Nennen Sie mich Dickie, alle anderen tun das auch«, sagt er forsch, während er zum Fenster geht und einen Blick nach draußen wirft. »Ich mochte den Namen noch nie, wenn ich ehrlich sein soll, aber ich scheine ihn nicht loswerden zu können. Daniel sagt, es sei Ihnen etwas Übles zugestoßen.«
»Daniel?«, frage ich und versuche, mich an das Gespräch festzuklammern, das mir immer mehr zu entgleiten droht.
»Coleridge. Der Bursche, der Sie heute früh in der Eingangshalle aufgelesen hat.«
»Ach so, ja.«
Doktor Dickie strahlt mich an, als er meine Verwirrung bemerkt.
»Gedächtnisverlust, was? Na, da machen Sie sich mal keine Sorgen, ich habe während des Krieges ein paar solcher Fälle erlebt. Nach ein oder zwei Tagen kehrten sämtliche Erinnerungen wieder zurück, ob der Patient das nun wollte oder nicht.«
Er schiebt mich zu dem Koffer hinüber und fordert mich auf, darauf Platz zu nehmen. Dann zieht er meinen Kopf nach vorn und untersucht ihn mit dem Zartgefühl eines Metzgers. Als ich vor Schmerz zusammenzucke, kichert er.
»O ja, Sie haben hier am Hinterkopf eine hübsche Beule abbekommen.« Er schweigt einen Moment und betrachtet meine Verletzung. »Sie müssen sich irgendwann gestern Abend den Kopf gestoßen haben. Ich nehme an, das war dann auch der Moment, an dem Ihnen alle Tassen aus dem Schrank gekippt sind, sozusagen. Haben Sie noch über irgendwelche anderen Symptome zu klagen? Kopfschmerzen, Übelkeit oder dergleichen?«
»Da ist diese Stimme«, antworte ich, ein wenig beschämt ob dieses Eingeständnisses.
»Eine Stimme?«
»In meinem Kopf. Ich glaube, es ist meine eigene Stimme, außer dass sie, nun ja, dass sie gewisse Dinge sehr genau zu wissen scheint.«
»Ich verstehe«, sagt er nachdenklich. »Und diese … Stimme, was sagt sie denn so?«
»Sie erteilt mir Ratschläge. Manchmal kommt es auch vor, dass sie Kommentare dazu abgibt, was ich gerade tue.«
Dickie schreitet nachdenklich im Raum hinter mir auf und ab und zupft währenddessen an seinem Schnurrbart herum.
»Und diese Ratschläge, sind die … nun, wie soll ich das ausdrücken … sind die immer ganz hasenrein? Nichts Gewalttätiges oder Perverses?«
»Selbstverständlich nicht«, sage ich, verärgert über diese Unterstellung.
»Und hören Sie die Stimme jetzt in diesem Moment auch?«
»Nein.«
»Seelisches Trauma«, sagt er schroff und hebt einen Finger in die Luft. »Das wird es sein. Und das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Man stößt sich den Kopf, und dann passieren plötzlich alle möglichen Dinge. Man sieht Gerüche, schmeckt Geräusche, hört Stimmen. Das geht meistens nach ein, zwei Tagen vorbei, höchstens nach einem Monat.«
»Ein ganzer Monat!«, rufe ich und drehe mich, immer noch auf dem Koffer sitzend, panisch nach ihm um. »Wie soll ich es einen ganzen Monat in diesem Zustand aushalten? Wäre es nicht besser, ich würde mich in einem Krankenhaus untersuchen lassen?«
»Du lieber Gott, nein, das sind ganz scheußliche Einrichtungen, diese Krankenhäuser!«, entgegnet er entsetzt. »Da fegt man Krankheit und Tod einfach in eine Ecke und lässt zu, dass sich alle möglichen Seuchen ganz gemütlich direkt zu den Kranken ins Bett legen. Hören Sie lieber auf meinen Rat: Gehen Sie spazieren, schauen Sie, ob Sie in Ihren persönlichen Habseligkeiten irgendwelche Anhaltspunkte finden und reden Sie mit ein paar Freunden. Ich habe gestern Abend gesehen, wie Sie und Michael Hardcastle sich beim Essen gemeinsam eine Flasche Wein gegönnt haben. Genauer gesagt waren es mehrere Flaschen. Es muss ziemlich hoch hergegangen sein, wie man hört. Michael sollte Ihnen doch eigentlich helfen können. Ich kann Ihnen versichern, wenn erst einmal Ihr Gedächtnis zurückgekehrt ist, wird auch diese innere Stimme wieder verschwinden.«
Er schweigt einen Moment, bevor er fortfährt. »Dieser Arm macht mir viel größere Sorgen.«
Wir werden von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Bevor ich Einspruch erheben kann, hat Dickie sie schon geöffnet. Es ist Daniels Kammerdiener, der die versprochenen Kleider vorbeibringt. Dickie bemerkt meine Unentschlossenheit, nimmt dem Dienstboten kurzerhand den Stapel ab, schickt ihn seiner Wege und legt die ordentlich gebügelten Kleider dann auf dem Bett für mich zurecht.
»Also, wo waren wir stehen geblieben?«, fragt er. »Ach ja, dieser Arm.«
Ich folge seinem Blick und entdecke ein Muster aus Blutflecken, das sich über meinen Hemdsärmel zieht. Dickie schiebt den Ärmel ohne langes Federlesen hoch und legt mehrere üble Schnitte und das zerfetzte Fleisch darunter frei. Es sieht so aus, als hätte sich ursprünglich bereits eine Kruste gebildet, aber die Strapazen der letzten Stunden müssen dafür gesorgt haben, dass die Wunden erneut aufgebrochen sind.
Der Arzt nimmt meine steifen Finger, biegt sie einen nach dem anderen nach hinten, um ihre Beweglichkeit zu prüfen, fischt dann eine kleine braune Flasche und Verbandszeug aus seiner Tasche, reinigt die Wunden und tupft schließlich noch etwas Jod darauf.
»Das sind Messerstiche, Sebastian«, sagt er mit besorgter Stimme. Seine fröhliche Stimmung hat sich von einem Moment auf den anderen in Luft aufgelöst. »Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass man sie Ihnen zugefügt hat. Es sieht aus, als hätten Sie den Arm hochgehalten, um sich selbst zu schützen. Etwa so.«
Er demonstriert es mir mit einem Tropfenzähler aus seiner Arzttasche. Dabei tut er so, als würde er sich damit gewaltsam den Unterarm aufschlitzen, den er sich schützend vors Gesicht gehoben hat. Sein kleines Schauspiel jagt mir eine Gänsehaut über den Körper.
»Können Sie sich an irgendetwas von gestern Abend erinnern?«, fragt er und zieht den Verband um meinen Arm so fest, dass mir ein schmerzliches Zischen entfährt. »Irgendetwas, ganz gleich was?«
Ich konzentriere mich. Als ich aufwachte, ging ich davon aus, dass alles verloren sei, doch jetzt stelle ich fest, dass das nicht der Fall ist. Ich kann spüren, dass meine Erinnerungen fast in Reichweite sind. Sie haben eine Gestalt, haben Gewicht, wie verhüllte Möbel in einem verdunkelten Zimmer. Ich habe einfach nur die Lampe verloren, mit deren Lichtschein ich sie betrachten könnte.
Seufzend schüttele ich den Kopf.
»Es will sich nichts einstellen«, sage ich. »Aber heute früh habe ich gesehen, wie …«
»Eine Frau ermordet wurde«, unterbricht mich der Arzt. »Ja, Daniel hat es mir erzählt.«
Jedes seiner Worte ist von Skepsis durchtränkt, doch er verknotet meinen Verband, ohne einen Einwand zu erheben.
»Wie dem auch sei, Sie müssen unbedingt sofort die Polizei verständigen«, sagt er. »Die Person, die für diese Wunden verantwortlich ist, wollte Ihnen erheblichen Schaden zufügen.«
Er nimmt seine Tasche vom Bett auf und schüttelt mir etwas unbeholfen die Hand.
»Ein strategischer Rückzug, mein lieber Freund, das ist es, was hier jetzt vonnöten ist«, sagt er. »Reden Sie mit dem Stallmeister, er kann bestimmt einen Transfer ins Dorf für Sie arrangieren. Und von dort aus können Sie dann auch die Gendarmerie auf den Plan rufen. In der Zwischenzeit ist es wahrscheinlich das Beste, wenn Sie stets auf der Hut sind. Es übernachten an diesem Wochenende zwanzig Leute in Blackheath und weitere dreißig werden für den Ball am heutigen Abend erwartet. Den meisten davon ist so ein Angriff durchaus zuzutrauen. Und sollten Sie einem von denen in die Quere gekommen sein … Nun …«, er schüttelt den Kopf, »seien Sie bloß vorsichtig, das rate ich Ihnen.«
Nachdem er das Zimmer verlassen hat, hole ich hastig den Zimmerschlüssel aus der Kommode, um die Tür hinter ihm abzuschließen, verfehle jedoch mehr als einmal das Schlüsselloch, weil meine Hände so heftig zittern.
Vor einer Stunde noch hielt ich mich für den Spielball eines Mörders. Ich dachte zwar, man wolle mich quälen, glaubte mich jedoch gleichzeitig vor jeder körperlichen Bedrohung gefeit. Da ich mich in der Gesellschaft anderer Menschen befand, fühlte ich mich sicher genug, um auf der Bergung von Annas Leichnam zu bestehen und somit auch die Suche nach ihrem Mörder in die Wege zu leiten. Doch dieses Gefühl der Sicherheit ist nun verflogen. Da draußen ist jemand, der schon einmal versucht hat, mir das Leben zu nehmen, und ich hege nicht die Absicht, ihm eine weitere Gelegenheit dazu zu geben. Die Toten können von den Lebenden keine Schuld einfordern. Was auch immer ich Anna schuldig sein mag, muss aus sicherer Entfernung beglichen werden. Sobald ich die Verabredung mit meinem Samariter im Salon hinter mich gebracht habe, werde ich Dickies Ratschlag befolgen und dafür sorgen, dass mich jemand ins Dorf bringt.
Es ist Zeit, dass ich heimkehre.
4.
Das Wasser schwappt über den Rand der Badewanne, während ich hastig die zweite Haut aus Schlamm und Blättern entferne, in die ich eingehüllt bin. Ich untersuche meinen sauber geschrubbten, rosafarbenen Körper nach Muttermalen oder Narben – irgendetwas, das meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte. In zwanzig Minuten werde ich unten im Salon erwartet, und ich weiß noch immer nicht mehr über Anna als in dem Moment, als ich die Eingangsstufen von Blackheath hinaufstolperte. Es war frustrierend genug, gegen diese Mauer in meinem Kopf anzurennen, als ich noch glaubte, bei der Suche behilflich sein zu können, aber jetzt könnte mein Unwissen das gesamte Unterfangen zum Scheitern verurteilen.
Als ich mit dem Waschen fertig bin, ist das Badewasser so schwarz wie meine Stimmung. Niedergeschlagen trockne ich mich ab und inspiziere die Kleidung, die der Kammerdiener vorbeigebracht hat. Die von ihm getroffene Auswahl erscheint mir recht steif und formell, doch als ich einen Blick auf die etwaigen Alternativen in meinem Kleiderschrank werfe, verstehe ich das Dilemma. Bells Kleidung – denn es will mir wahrhaftig noch immer nicht gelingen, uns beide unter einen Hut zu bringen – besteht aus mehreren vollkommen identischen Anzügen, zwei Smokings, Jagdbekleidung, einem Dutzend Hemden und einigen wenigen Westen. Sämtliche Kleider sind in Grau- oder Schwarztönen gehalten. Es ist die fade, biedere Uniform eines Menschen, der, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ein außerordentlich anonymes Leben zu führen scheint. Die Vorstellung, dieser Mann könne irgendjemanden zu einer Gewalttat veranlasst haben, ist so absurd, dass sie mir – je länger ich darüber nachdenke – unglaubwürdiger vorkommt als alles andere, was an diesem Vormittag geschehen ist.
Rasch kleide ich mich an, aber mein Nervenkostüm ist derart angegriffen, dass ich erst tief durchatmen und mich selbst mit ein paar strengen Worten ermahnen muss, bis ich es endlich schaffe, mich der Tür zu nähern.
Ich habe das instinktive Bedürfnis, mir etwas in die Hosentaschen zu stecken, bevor ich den Raum verlasse. Meine Hand huscht in Richtung der Kommode, bleibt dort jedoch unverrichteter Dinge in der Luft schweben. Das war ganz offenbar der Versuch, persönliche Gegenstände an mich zu nehmen, die nicht vorhanden sind und an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Zweifellos ein Teil von Bells Routine – ein Schatten meines früheren Lebens, der mir immer noch durch den Kopf spukt. Der Drang ist so stark, dass es mir äußerst seltsam vorkommt, wie ich da so mit leeren Händen stehe. Dieser verdammte Kompass war unglücklicherweise das Einzige, was ich aus dem Wald mitnehmen konnte, aber auch ihn kann ich nirgends entdecken. Mein Samariter – der Mann, den Doktor Dickie als Daniel Coleridge bezeichnet hat – muss ihn mitgenommen haben.
Während ich in den Flur hinaustrete, kribbelt mein ganzer Körper vor Aufregung.
Mein Gedächtnis erstreckt sich lediglich über einen einzigen Vormittag, und nicht einmal diese wenigen Erinnerungen kann ich festhalten.
Ein vorbeieilender Diener weist mir die Richtung zum Salon, der hinter dem Speisesaal liegt, nur ein paar Türen von der marmornen Eingangshalle entfernt, durch die ich heute früh das Haus betreten habe. Der Raum wirkt sehr unfreundlich und erinnert wegen seiner dunklen Holzvertäfelung und roten Vorhänge an einen überdimensionalen Sarg. Im Kamin flackert ein Kohlenfeuer und spuckt seinen öligen Rauch in die Luft. Es sind etwa zwölf Personen versammelt. Auf einem der Tische wurden kalte Platten serviert, doch die meisten Gäste scheinen das Essen zu ignorieren. Sie haben sich in Ledersessel fallen lassen oder stehen an den bleiverglasten Fenstern und starren schwermütig in das grauenhafte Wetter hinaus, während ein Dienstmädchen mit Marmeladenflecken auf der Schürze unauffällig zwischen ihnen hin und her huscht und die schmutzigen Teller und leeren Gläser auf einem riesigen Silbertablett sammelt, das sie kaum zu halten vermag. Ein rundlicher Mann in grüner Jagdkleidung hat sich an das Klavier gesetzt, das in einer Ecke steht, und spielt eine schlüpfrige Melodie, die aber einzig und allein wegen ihrer stümperhaften Darbietung Anstoß erregt. Niemand schenkt ihm besonders viel Aufmerksamkeit, ganz gleich, wie sehr er sich auch bemüht.
Es ist fast Mittag, aber Daniel ist nirgends zu sehen. Also vertreibe ich mir die Zeit, indem ich die verschiedenen Karaffen im Getränkeschrank inspiziere, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, worum es sich dabei handelt oder was mir davon schmecken könnte. Schließlich gieße ich mir irgendeine braune Flüssigkeit ins Glas, drehe mich zu den anderen Gästen um und starre sie an. Falls eine dieser Personen für die Wunden an meinem Arm verantwortlich ist, müsste ihr Unmut darüber, mich nun gesund und munter hier stehen zu sehen, doch eigentlich offen zu Tage treten. Und sicher würde doch mein Verstand mir keinen Streich spielen und die Identität dieser Person vor mir geheim halten, sollte diese sich dazu entschließen, sich mir zu erkennen zu geben? Immer gesetzt den Fall, mein Kopf schafft es irgendwie, Schuldige und Unschuldige auseinanderzuhalten. Bei fast sämtlichen der hier anwesenden Herren handelt es sich um bullige, blökende, rotgesichtige Rüpel in Jägerkluft, während die Damen eher nüchtern gekleidet sind und Röcke, Leinenblusen und Strickjacken tragen. Anders als ihre prahlerischen Ehemänner unterhalten sie sich mit gedämpften Stimmen, geben sich zurückhaltend und mustern mich aus den Augenwinkeln. Ich habe das Gefühl, als würde man mich beobachten wie einen seltenen Vogel. Es ist ein zutiefst verunsicherndes Gefühl, obwohl dieses Verhalten natürlich andererseits durchaus verständlich ist. Daniel kann seine Fragen unmöglich gestellt haben, ohne dabei gleichzeitig meine gegenwärtige Verfassung preiszugeben. Und nun bin ich zu einem Teil des Unterhaltungsprogramms geworden, ob mir das nun gefällt oder nicht.
Ich umklammere mein Glas und versuche mich abzulenken, indem ich ein paar der Gespräche belausche, die um mich herum stattfinden. Es ist ein Gefühl, als würde ich meinen Kopf in einen Dornbusch stecken. Die eine Hälfte beklagt sich, die andere Hälfte lässt diese Klagen über sich ergehen. Man beschwert sich über die Unterbringung, über das Essen, über die Frechheit der Dienerschaft, über die abgelegene, isolierte Lage oder über den Umstand, dass man nicht selbst herfahren konnte, sondern sich abholen lassen musste (obwohl nur der Himmel weiß, wie sie diesen Ort ganz allein finden wollten). Hauptsächlich richtet sich ihr Zorn jedoch gegen Lady Hardcastle, die sich noch nicht hat blicken lassen, obwohl viele der Anwesenden bereits gestern Abend eingetroffen sind – ein Umstand, den man als persönliche Beleidigung zu empfinden scheint.
»’Tschuldigung, Ted«, sagt das Dienstmädchen, während sie versucht, sich an einem Mann mit breiter Brust vorbeizudrängen. Er ist etwa Mitte fünfzig, hat schütter werdende rote Haare, leuchtend blaue Augen und einen Sonnenbrand auf dem Schädel. Auch er ist in eine Jägerkluft aus Tweed gekleidet, die sich um seinen breiten, zur Dickleibigkeit neigenden Körper spannt.
»Ted?«, ruft er wütend, packt sie am Handgelenk und drückt es so fest, dass sie vor Schmerz zusammenzuckt. »Wen zum Teufel glaubst du denn hier vor dir zu haben, Lucy? Du hast mich gefälligst Mr. Stanwin zu nennen. Ich gehöre nicht mehr zu den Ratten im Dienstbotentrakt.«
Sie nickt verängstigt und lässt ihren Blick hilfesuchend über unsere Gesichter gleiten. Niemand bewegt sich, selbst das Klavier scheint sich auf die Zunge zu beißen. Alle hier haben Angst vor diesem Mann, wie mir in diesem Augenblick klar wird. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch nicht anders reagiere. Ich bin gleichsam auf dem Boden festgefroren, halte den Blick gesenkt und betrachte das Geschehen aus den Augenwinkeln, in der verzweifelten Hoffnung, dass er seine vulgäre Wut nicht in meine Richtung lenkt.
»Lass sie los, Ted«, sagt Daniel Coleridge von der Türschwelle her. Seine Stimme ist fest und eiskalt. In jedem Wort schwingt die Drohung eines Nachspiels mit.
Stanwin schnaubt durch die Nase und starrt Daniel mit zusammengekniffenen Augen an. Eigentlich sind die beiden alles andere als ebenbürtige Gegner. Stanwin ist ein stämmiger, gedrungener Kerl, der Gift und Galle spuckt. Doch in der Art, wie Daniel dort steht, die Hände in den Hosentaschen vergraben, den Kopf zur Seite geneigt, ist etwas, das Stanwin innehalten lässt. Vielleicht fürchtet er, er könne von dem Zug überrollt werden, auf dessen Ankunft Daniel zu warten scheint.
Eine Uhr trommelt all ihren Mut zusammen und gibt ein lautes Ticken von sich.
Mit einem Grunzen lässt Stanwin das Dienstmädchen los und drängelt sich im Türrahmen an Daniel vorbei. Dabei murmelt er etwas, das ich nicht ganz verstehen kann.
Der Raum atmet auf, das Klavier spielt weiter, die heldenhafte Uhr tickt, als wäre nichts geschehen.
Daniels Augen gleiten von einem zum anderen. Sein Blick scheint sämtliche Anwesende auf die Waagschale zu legen.
Unfähig, seiner Musterung standzuhalten, wende ich den Kopf und starre stattdessen mein Spiegelbild im Fenster an. Auf meinem Gesicht zeichnet sich Ekel ab, Ekel und Abscheu vor den nicht enden wollenden Schwächen meines Charakters. Erst der Mord im Wald und jetzt dies. Wie viele Ungerechtigkeiten lasse ich noch tatenlos geschehen, bevor ich genügend Mut aufbringe, einzuschreiten?
Daniel kommt zu mir hinüber, ein Geist im Fensterglas.
»Bell«, sagt er leise und legt mir eine Hand auf die Schulter. »Ob du wohl einen Moment Zeit hättest?«
Schamgebeugt folge ich ihm in das angrenzende Arbeitszimmer, während sich sämtliche Augenpaare in meinen Rücken bohren. Nebenan ist es noch düsterer. Wild wuchernder Efeu hat die Bleiglasfenster unter sich begraben, und das wenige Licht, dem es gelungen ist, sich durch das Glas zu zwängen, wird von zahlreichen Gemälden in dunklen Ölfarben aufgesogen. In einer Ecke steht ein Schreibtisch, der so ausgerichtet ist, dass man von dort aus auf die Wiese vor dem Haus schauen kann. Es sieht so aus, als hätte gerade eben noch jemand daran gesessen. Aus einem Füllhalter tropft Tinte auf ein zerfetztes Stück Löschpapier und daneben liegt ein Papiermesser. Man mag sich kaum vorstellen, was das für Briefe sind, die in einer derart bedrückenden Atmosphäre verfasst wurden.
In der gegenüberliegenden Ecke, in der Nähe einer zweiten Tür, die aus dem Zimmer hinausführt, steht ein ebenfalls in Tweed gekleideter junger Mann, starrt ratlos in den Trichter eines Grammophons und fragt sich ganz offensichtlich, warum die sich drehende Platte keine Musik in den Raum befördert.
»Da studiert er ein einziges Semester in Cambridge, und schon hält er sich für Isambard Kingdom Brunel«, sagt Daniel. Bei seinen Worten schaut der junge Mann von dem Rätsel auf, das er gerade zu lösen versucht. Er ist kaum älter als vierundzwanzig, hat dunkle Haare und breite, flache Gesichtszüge – so flach, dass der Eindruck entsteht, als sei sein Antlitz gegen ein Fensterglas gepresst. Als er mich sieht, zieht sich ein breites Grinsen über sein Gesicht. Sofort ist hinter der männlichen Fassade der kleine Junge zu sehen, der er einmal war – ganz so, als würde dieser zum Fenster hinausschauen.
»Belly, du Krücke, da bist du ja«, sagt er, drückt meine Hand und klopft mir gleichzeitig auf den Rücken. Es fühlt sich an, als hätte er mich in einen liebevollen Schraubstock gespannt.
Er starrt mir prüfend und erwartungsvoll ins Gesicht und kneift, als ich ihn ganz offenbar nicht wiedererkenne, seine grünen Augen zusammen.
»Es stimmt also, du kannst dich an nichts mehr erinnern«, sagt er und wirft Daniel einen flüchtigen Blick zu. »Du Glückspilz! Komm, lass uns zur Bar gehen! Dann zeige ich dir mal, was ein ordentlicher Kater ist.«
»Neuigkeiten verbreiten sich ja schnell in Blackheath«, sage ich.
»Bei der gewaltigen Langeweile, die hier herrscht, steht ihnen ja auch kaum ein Hindernis im Wege«, sagt er. »Ich heiße Michael Hardcastle. Du und ich, wir sind alte Freunde, obwohl dann wohl jetzt der Begriff ›neue Bekannte‹ zutreffender wäre.«
In der Bemerkung lässt sich auch nicht die geringste Spur einer Enttäuschung entdecken. Er scheint sich vielmehr über das Ganze zu amüsieren. Schon bei der ersten Begegnung wird rasch deutlich, dass sich Michael Hardcastle über die meisten Dinge amüsiert.
»Michael hatte gestern beim Abendessen einen Platz direkt neben dir zugewiesen bekommen«, sagt Daniel, der nun seinerseits das Grammophon inspiziert. »Wenn ich’s mir recht überlege, bist du wahrscheinlich genau deshalb in den Wald geflüchtet und hast dir dort selbst eins über den Schädel gezogen.«
»Nun tu schon so, als fändest du das urkomisch, Belly. Wir warten alle noch auf den Tag, an dem er tatsächlich etwas Lustiges von sich gibt«, sagt Michael.