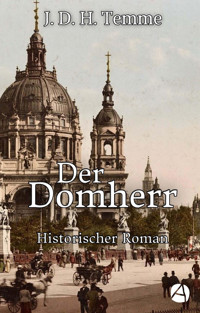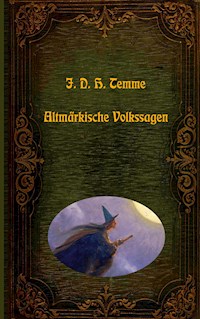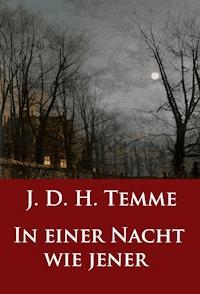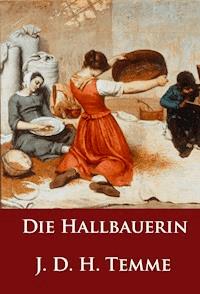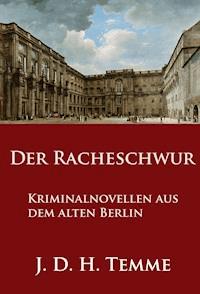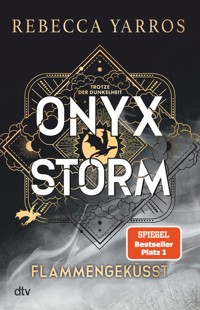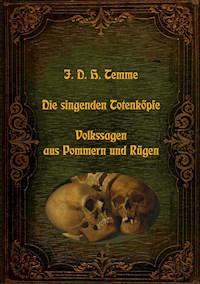
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lebendiges Brauchtum - Sagen, Märchen und Legenden aus aller Welt
- Sprache: Deutsch
Im vierten Band der Buchreihe "Lebendiges Brauchtum - Sagen, Märchen und Legenden aus aller Welt" werden zahlreiche Sagen und Legenden aus Mecklenburg-Vorpommern behandelt. Beginnend mit Sagen von den dortigen heidnischen Urahnen und dem Einzug des Christentums liefert die vorliegende Sammlung allerlei Wissenswertes: neben ortsgeschichtlichen Hintergründen und Anekdoten enthält sie eine große Anzahl an Legenden und Sagen von Hexen, Zauberern, Riesen, Werwölfen, Zwergen und Heinzelmännchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lebendiges Brauchtum - Sagen, Märchen und Legenden aus aller Welt
Band 4
Inhaltsverzeichnis.
Einleitung.
Verzeichnis der benutzten Werke.
Sagen.
Die Zweikämpfe u. d. Oberherrschaft zw. d. Wenden u. Dänen.
Unterjochung der Wenden durch die Dänen.
Der Dänen-König Frotho und die wendischen Schnapphähne.
Die Königin Wißna.
Der gefangene König Jaromar.
Die Langobarden in Rügen.
Der Liebeskampf.
König Schweno von Dänemark und die Wolliner.
Der Ranisberg bei Lübeck.
Strafe des Kirchenraubes.
Der Ritter auf dem weißen Roß.
Der wendische Hund.
Rethra.
Vineta.
Julin.
Der Bischof Bernard und die Juliner.
Der heilige Brunnen bei Pyritz.
Das heidnische Edelweib zu Cammin.
Sankt Otto in Julin, und Bogdal.
Die Bekehrung der Stettiner.
Julins Abfall vom Christentum.
Stettins Abfall vom Christentum.
Die Bekehrung von Wolgast.
Stettins Wiederbekehrung.
Der Götzenbaum in Stettin.
Die Götzenfliegen zu Gützkow.
Die bestraften Götzenpriester.
Der Gott Triglaf und das Dorf Triglaf.
Wunderwerke des Hl. Otto.
St. Ottos Tritte.
Der schwarze Hahn des Hl. Otto.
Die singenden Totenköpfe.
Die Heiligung des Meeres.
Die Corveier Mönche auf Rügen.
Die Fünte bei Schwantow.
Swantewit und Arcona.
Die Götter in Carenza.
Der Hertha-See.
Claus Hane.
Die Frauen und Jungfrauen in Stolpe.
Sankt Johann! Sankt Johann!
Die verdorrte Linde zu Schildersdorf.
Zacharias Hase.
Der Seeräuber Eseborn.
Herzog Bogislav X. und der Hofnarr.
Bogislav X. und Hans Lange.
Herzog Bogislav X. und die Türken.
Herzogs Bogislav X. Rückkehr aus dem Heiligen Land.
Jürgen Krokow.
Herzog Philipps Trauring.
Die Oderburg bei Stettin.
Das Aussterben der Herzöge von Pommern.
Wunderzeichen zu Pyritz.
Der große Kurfürst in Pommern.
Die Bauern zu Connerow.
Drei hohe Häupter auf dem Darß.
Napoleon und der Teufel.
Die Manteuffel.
Die Familie von Lepell.
Der erste Lepell in Pommern.
Die Schlieffen und Adebare in Colberg.
Das Wappen der Familie von Dewitz.
Die Kirche zu Gingst.
Entstehung der Gertrudenkirche zu Stettin.
Die Kapelle auf dem Gollenberg.
Der Gollenberg.
Die drei Mönche im Dome zu Colberg.
Der ermordete Herzog Wartislav.
Baggus Speckin.
Die Kapelle zu Levenhagen.
Die Kirche zu Cablitz.
Die offene Kirche zu Pollnow.
Das Spiel zu Bahne.
Die beiden Störe und die geizigen Mönche zu Grobe.
Die Maränen im Madüesee.
Die Gräfin Jarislav von Gützkow.
Das hochmütige Edelweib zu Wusseken.
Die Raubmönche zu Stettin.
Eulenspiegel in Pommern.
Die Putzkeller im Lande Bart.
Die blutigen Judenkinder.
Matthias Puttkammer der Schläfer.
Der jähzornige Edelmann zu Dünnow.
Der disputierende Mönch.
Bestrafung eines Meßpfaffen.
Der Papenhagen in Langenhagen.
Der Teufel in der St. Nicolaus-Kirche zu Stettin.
Die Verschwörer wider die Ehe.
Magister Fristus.
Der Gotteslästerer in Lassahn.
Pastor Cradelius.
Die ungeratenen Kinder in Stettin.
Die Blutflecken in der Jacobikirche zu Stettin.
Der verzweifelte Kornwucherer.
Treue Liebe.
Das Feuer in Stargard.
Das fluchende Weib in Demmin.
Das Feuer in Garz.
Der Brand in Pyritz.
Der Artushof in Stralsund.
Der tote Ratsherr in Stralsund.
Die Gefangenen in den Tonnen.
Der Priesteraufruhr in Stralsund.
Der Landvogt Barnekow.
Der Dänholm bei Stralsund.
Herzog Wallenstein vor Stralsund.
Der Katzenritter zu Stralsund.
Der Kampf der Blinden in Stralsund.
Der Büttel und die grauen Mönche in Stralsund.
Der gotteslästerliche Organist in Stralsund.
Der Teufel in der Nicolaikirche zu Stralsund.
Der Blutregen in Stralsund.
Der Calands-Ornat zu Stralsund.
Die arme reiche Frau.
Die Straßenbeleuchtung in Stralsund.
Der Name Greifswald.
Der Ratsspruch in Greifswald.
Der Wettlauf um das Opfergeld.
Das Nordfenster im Nicolaiturm zu Greifswald.
Hans Katte.
Greifswalder Lammsbraten.
Anklamer Schwinetrecker.
Cösliner Sacksöfers.
Pook und Kollen.
Der hochgelobte Adel.
Das neue Tief.
Die Insel Hiddensee.
Die Insel Rattenort.
Die Bewohner des Darß.
Die Strandbewohner in Hinterpommern.
Der Name Demmin.
Der Name Usedom.
Der Name Swinemünde.
Neuwarp.
Das Dorf Klempin.
Putbus.
Der Königstuhl auf Stubbenkammer.
Das Nonnenloch auf Mönchgut.
Das Zeichen am Turm zu Bergen.
Das zehntfreie Dorf.
Das Bozelgeld in Schlave.
Die Kirche ohne Turm.
Die Ruine des Hauses Demmin.
Der Ritter mit der goldenen Kette.
Ritter Flemming.
Claus Hinze.
Die Windmühlen bei Stettin.
Sagen vom Schloß zu Daber.
Die Grafen von Eberstein in Retztow.
Der geizige Graf von Eberstein.
Das Schloß zu Matzdorf.
Der Krakauberg bei Zachan.
Die Eule im Schloß zu Labes.
Der Dollgemost auf Rügen.
Die Burg Ralow.
Claus Störtebeck und Michael Gädeke.
Die Räuber im Gollenberge.
Das Raubschloß bei Cantreck.
Der Raubritter Vicho.
Der Leichensee.
Die Räuberhöhle bei Schmölle.
Das versunkene Schloß bei Plathe.
Das versunkene Dorf im Madüesee.
Die alte Stadt bei Werben.
Das Pommersche Sodom und Gomorrha.
Der schwarze See bei Grimmen.
Die versunkene Stadt im Grabowsee.
Die versunkene Stadt im Scharpsower See.
Die versunkene Stadt im Barmsee.
Die versunkene Stadt Regamünde.
Der Nonnensee bei Bergen.
Der Gollen auf Usedom.
Die Hünengräber zu Züssow.
Das Hünengrab bei Gristow.
Der lange Berg bei Baggendorf.
Der Hünenstein bei Wusterhusen.
Der Riesenstein bei Zarrentin.
Der Opferstein bei Buschmühl.
Der Teufelsstein auf dem Wartherfelde.
Der hohe Stein bei Anklam.
Der Riesenstein bei Kleptow.
Der Riesenstein bei Rehhagen.
Der Teufelsstein bei Polchow.
Der Teufelsstein bei Hohen-Kränik.
Der verwünschte Schäfer.
Der Stein bei Wiskow.
Die großen Steine bei Groß-Tycho und Burzlaff.
Die Steine bei Pumlow.
Hünengräber auf Rügen.
Der Dubberworth.
Die neun Berge bei Rambin.
Der Riesenstein bei Nadelitz.
Das Hünengrab bei Nobbin.
Der Mägdesprung auf dem Rugard.
Die sieben Steinreihen auf der Prove.
Der Schatz im Hause Demmin.
Der Schatz in Demmin.
Der Schatz bei Gahlkow.
Die Kriegskasse bei Hanshagen.
Der Schatz zu Schwerinsburg.
Der Schatz und der Stiefel.
Die Klosterruine zu Eldena.
Die Ruine des Klosters Belbog.
Der Schatz in Plathe.
Sagen von Gollnow.
Die drei Ringe zu Pansin.
Der Schatz bei Lanken.
Die Jungfrau im Ziegenorter Forst.
Prinzessin Swanwithe.
Die schwarze Frau auf dem Königsstuhl.
Die Jungfrau am Waschstein bei Stubbenkammer.
Die schwarze Frau in der Stubbenkammer.
Die Seejungfer im Haff.
Der Chimmeke in Loitz.
Die Kobolde mit den roten Hosen.
Die Erdgeister in Greifswald.
Die Üllerkens bei Boek.
Die Unterirdischen bei Bernstein.
Die Unterirdischen bei Budow.
Das Patengeschenk.
Die Zwerge in den neun Bergen.
Johann Wilde.
Fritz Schlagenteufel.
Der leichte Pflug.
Jochen Schulz.
Matthes Pagels.
Das unterirdische Wasser zu Rothemühle.
Die Bergschlange im Bauerberg bei Wolgast.
Die beiden Lindwürmer.
Der Jungfernberg bei Rankwitz.
Der alte Mann im Gollenberge.
Die vier Eichen bei Stolzenburg.
Der Teufelsdamm im Galenbecker See.
Der Teufelsdamm im Naugarder See.
Die Schätze in Greifswald.
Der Grenzwächter.
Der Feuerkönig auf dem Seegrunder See.
Der Strand zwischen Swine und Dievenow.
Die drei Lichter am H. drei Königs-Abend.
Der Schimmelreiter bei Pasewalk.
Der Mann ohne Kopf bei Pyritz.
Der Spuk auf der Brücke bei Pyritz.
Der Teufel in Greifenberg.
Der schußfeste General.
Der Schwarzkünstler in Eldena.
Sidonia Borken.
Der unschuldige Hexenmeister.
Die verbrannte Hexe zu Hohendorf.
Die Hexenmütze und der Kreuzdornstock.
Das Gespenst in Hohen-Bünsow.
Die sieben bunten Mäuse.
Der Erbdegen.
Der Kalfater oder Klabautermannn.
Das Brotmännlein in Stettin.
Das Waldhorn in Gahlkow.
Die brennende Mütze.
Die tote Schlange.
Die Vampire in Kassuben.
Die Werwölfe in Greifswald.
Der Werwolf bei Zarnow.
Die Cholera.
Der prophezeiende Täufling.
Der Beamte mit dem roten Faden um den Hals.
Die drei Schüsse nach dem lieben Gott.
Der Teufel auf dem Tanzboden.
Die gebannten Glocken.
Der schwarze See und die gebannte Glocke bei Wrangelsburg.
Die singende Glocke.
Die Glocke in Stargard.
Hack up, so fret ik di.
Das von Hexengeld aufgebaute Dorf.
Der Turm zu Wobeser.
Die Schwedin in Pommern.
Das Mannagras an der Leba.
Der Bettler auf der Insel Oie.
Die Steinprobe.
Der Geist des Herrn von Kemnitz.
Die alte Stadt Grimmen.
Der Mäusewagen in Grimmen.
Die sieben eingemauerten Bauern zu Turow.
Der Schatz in der Vollmondnacht.
Die Wenden-Glocken im Wirchow-See.
Der Geist des Bürgermeisters Rubenow.
Anhang.
Abergläubische Meinungen und Gebräuche in Pommern und Rügen.
Schiffer-Meinungen und Gebräuche.
Fischer-Meinungen.
Das Tonnenabschlagen auf dem Darß.
Einleitung.
Die Sage lebt in und mit dem Volk; sie gehört zu dem romantischen Teil seines Lebens, den es mit einem eigentümlichen poetischen Kleid umgeben hat. Sie gehört in solcher Weise seinem vergangenen, wie seinem gegenwärtigen Leben an; sie zieht sich selbst bedeutungsvoll in seine Zukunft hinüber. Seiner Vergangenheit gehört die rein geschichtliche Sage an; der Gegenwart die Sage, welche entweder ganz, oder auch zum Teil als geschichtliche, an noch vorhandene Gegenden, Orte oder Denkmäler sich anknüpft. Für die Zukunft wird sie bedeutungsvoll, indem sie durch Prophezeiungen, Ahnungen, oft nur durch dunkle Andeutungen, über das künftige Schicksal des gesamten Volkes, einzelner Gegenden, Städte, Dörfer, oft nur einzelner Familien bestimmt.
Immer hat sie eine nahe Beziehung auf das Volk, dem sie angehört, aus dem sie entstanden, das sie in sich aufgenommen und sie ausgebildet hat. „Sie ist sein liebes Kind geworden, und eben dadurch sein Schutzgeist“, wie die Brüder Grimm in ihrer Vorrede zu den Deutschen Sagen dies so schön ausführen. Durch diese Beziehung unterscheidet sie sich wesentlich vom Märchen. Das Märchen ist überall, in der ganzen Welt zu Hause, es hat durchaus keine spezielle National- oder gar nur Lokal-Beziehung. So wie die Sage dem Leben eines bestimmten Volkes angehört, so gehört das Märchen in seiner Allgemeinheit dem gesamten Menschengeschlecht.
Indes gibt es zwischen beiden auch noch einen anderen erheblichen Unterschied. Das Märchen enthält immer etwas Wunderbares, es teilt Ereignisse und Wirkungen mit, deren Existenz und Ursachen der menschliche Geist nicht begreifen kann. Sein Gebiet ist das des spielenden Kindes, der duftigen Traum- Phantasie. Anders ist dies bei der Sage. Auch von ihr ist das Gebiet des Unbegreiflichen und Wunderbaren nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, die meisten Sagen werden gerade diesem Gebiet anheim fallen, weil der eigentliche Charakter des Volks ein unverdorben kindlicher ist, und der Charakter des Volks auch seine Poesie modifiziert; sie werden ihm daher um so mehr angehören, je einfacher das Volk ist, dem sie angehören, oder je weiter der Zeitpunkt von uns zurückliegt, in dem sie entstanden sind. Denn je mehr die fortschreitende Zeit die Kultur der Völker entwickelt, desto mehr nimmt sie ihnen von ihrer Einfachheit, von ihrer kindlichen Poesie.
Aber darum ist das Wunderbare der Sage nicht wesentlich notwendig. Sie kann auch ohne dasselbe bestehen. Man will dies nicht überall zugestehen; man will den Begriff der Sage von dem Erfordernis des Übernatürlichen nicht trennen. Es sind in dieser Hinsicht namentlich den preußischen und litauischen Sagen, die der Unterzeichnete gemeinschaftlich mit dem Landrat, jetzt Regierungsrat von Tettau herausgab, von mehreren Seiten Vorwürfe gemacht. Indes dürfte, die Sache aus dem richtigen Gesichtspunkt betrachtet, die Ansicht des Unterzeichneten manches für sich haben. Volkssage ist, was das Volk sagt, näher: was es sich selbst und anderen aus seinem Leben und aus dem Leben solcher Personen sagt, die ihm angehören und zugleich so bedeutend geworden sind, daß es sie als einen Teil seiner selbst betrachtet; dies ist namentlich mit seinen ausgezeichneten Fürsten der Fall. Freilich ist auch mit dieser näheren Bestimmung das Wesen der Volkssage noch nicht angegeben. Das Charakteristische der Volkssage besteht nämlich zum großen Teil auch darin, daß sie bleibend im Volk ist. Ihre Feuerprobe ist, daß sie nur mit dem Volk, dem sie gehört, stirbt, daß sie dasselbe noch sogar überlebt, wenn nicht das Volk späterhin seinen Sinn für sie verliert. So leben für uns noch die griechischen Götter- und Heldensagen, obgleich das griechische Volk längst untergegangen war; sie leben, was ihr bewährtester Probierstein ist, zum großen Teil selbst noch unter jenen wilden, unkultivierten Stämmen, die mit den alten Griechen sonst fast nichts mehr gemein haben, als den Boden, auf dem sie geboren sind, und die Luft, die sie atmen. Mit diesem Boden, mit dieser Luft hat sich die Sage erhalten.
Volkssage ist, was das Volk aus seinem eigenen Leben erzählt. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß von bleibendem Interesse nur dasjenige für das Volk sein kann, was ihm bedeutungsvoll, bemerkenswert ist. Das Gewöhnliche, Alltägliche wird es in seinem Gedächtnis nicht aufzeichnen.
Wollte man nun von der Sage nur einen dem Verstand unbegreiflichen, einen wunderbaren Inhalt fordern, so würde man dadurch behaupten, daß nur dies dem Volk bedeutungsvoll wäre, daß es nur dafür Empfänglichkeit hätte. Wie sehr Unrecht würde man dadurch seinem richtigen, und für alles Schöne und Große empfänglichen Sinn, seinem Geist zufügen! Wie arm und beschränkt würde man seine Sage machen, wenn man ihm jene schönen, herrlichen Erzählungen nähme, in denen es auf seine Weise die historischen Taten seiner Vorfahren, die glänzenden Eigenschaften seiner Fürsten feiert!
Es ist freilich nicht zu verkennen, daß auf solche Weise Sage und Geschichte sehr nahe aneinander gebracht, in manchen Fällen gar miteinander verschmolzen werden. Aber darum bleibt noch immer ein großer Unterschied zwischen beiden. Was die Geschichte uns mitteilt, ist wahr, wenigstens so wahr, als es historische Wahrheit überhaupt gibt. Es ist also durch gültige Zeugnisse erwiesen. Was uns aber die Sage erzählt, dafür gibt es keine weiteren Zeugnisse, als nur den Glauben. So wie die Geschichte durch die Feuerprobe der Kritik bewährt ist, so besteht die Sage, ein Kind des Glaubens, nur durch Glauben. Treffen nun gleichwohl Geschichte und Sage ganz zusammen, was indes kaum in einem Fall ganz sein dürfte, so ist das ein Zufall, der weiter nicht in Betracht kommen, namentlich auf das Wesen der Sage keinen Einfluß äußern kann. Wie Geschichte und Sage aneinander grenzen, möge z.B. die Sage unter Nr. 104. („Der Landvogt Barnekow“) dieser Sammlung zeigen.
Dabei ist das poetische Kleid nicht zu übersehen, mit welchem das Volk seine Sage umgibt und welches ebenfalls ein durchaus wesentlicher, notwendiger Teil derselben ist. Was in dem Gewand der Geschichte, wenn auch ohne alle höhere Gelehrsamkeit, vorgetragen ist, wird nie Eigentum des Volkes werden, zumindest nie in solchem Gewand. Soll es in das Volk übergehen, so wird dieses es sofort, oder vielmehr zuvor, auf seine Weise umgestalten, und seinem Wesen anpassen. Dieses Wesen ist nun aber immer mehr oder weniger ein poetisches. Ohne poetische Elemente besteht kein Volk. Bei den meisten Völkern sind sie die überwiegenden. Daher würde man es dann nur als eine Nüchternheit des Volkes betrachten können, wenn es zufällig bei ihm eine Sage gäbe, die ganz, ohne alle poetische, sagenartige Beimischung, mit der Geschichte zusammenfiele. Die geschichtliche Volkssage steht insofern dem historischen Roman gleich; nur mit dem wesentlichen Unterschied, daß dieser einen Romanschreiber, jene aber ein poetisches Volk zum Verfasser hat. Darum erlebt die einfache Volkssage oft mehr Jahrhunderte, als die Mehrzahl der historischen Romane Jahre.
Die hier angedeuteten Gründe haben den Herausgeber bewogen, trotz jener Einwendungen gegen einzelne Stücke seiner früheren Sammlungen, in die gegenwärtige Sammlung auch solche Sagen aufzunehmen, denen das Element des Wunderbaren fehlt, wenn sie nur sonst echte Sagen waren. In Betreff der geschichtlichen Sagen glaubte er, diesem gemäß um so mehr verfahren zu müssen, als es vielleicht keine germanische oder slawische Provinz geben mag, die einen solchen Reichtum der herrlichsten, kräftigsten und frischesten geschichtlichen Sagen hat, wie gerade Pommern. Aber auch in Betreff der nicht geschichtlichen, sondern bloß lokalen Sagen glaubte er, ebenso ohne Ängstlichkeit um so zuversichtlicher verfahren zu dürfen, als er das Beispiel der Brüder Grimm für sich hat, von deren deutschen Sagen manche, z.B. der Glockenguß zu Attendorn, ebenfalls ohne allen wunderbaren Inhalt sind.
Einem zweiten Vorwurf, der den „Preußischen Sagen“ gemacht wurde, ist der Herausgeber schon in der Vorrede zu seinen Volkssagen der Altmark begegnet. Er hält es aber nicht für überflüssig, auch hier noch einige Worte darüber zu sagen, da er in gleicher Art auch der gegenwärtigen Sammlung gemacht werden könnte. Es sind nämlich viele Sagen bloß aus Chroniken aufgenommen. Die eigentliche Volkssage aber soll nur aus dem Volk genommen werden. Jene Chroniken-Sagen hätten also nicht dürfen aufgenommen werden. Allein dieser Einwand ist illusorisch. Denn nicht der Chronikant, dem hier nacherzählt ist, hat das ihm Nacherzählte erfunden und gemacht. Die Erzählung existierte vielmehr im Volk, der Chronikant fand sie schon vor, und teilte sie nur weiter mit. Es ist hiernach also die Aufnahme der Sage in die Chroniken gerade ein Beweis für ihre Echtheit als Sage; denn das Volk hatte sie sich so ganz und gar zu eigen gemacht, daß selbst der gelehrte Chronikant sie gläubig, gar als Wahrheit mitteilte, oder doch mindestens, eben weil sie so innig mit dem Volk, dessen Geschichte er schrieb, verbunden war, es für notwendig hielt, ihrer zu erwähnen. Rührte aber auch die Sage wirklich von dem Chronikanten, als dessen Erfindung her, so würde sie auch hierdurch nichts von ihrem Charakter verlieren. Denn auch die echteste Volkssage ist, sofern sie nicht einen geschichtlichen Boden hat, zuerst von einem, gläubig oder ungläubig, aufgenommen und weiter erzählt, und so zur Sage geworden. Ob dieses ursprüngliche Erzählen von einem aus dem Volk oder von einem Chronisten ausgegangen ist, bleibt gleichgültig, denn die Sage ist nur dadurch geworden, daß das Volk sie in sich aufnahm, sie als einen denkwürdigen Teil seines Lebens betrachtete, als solchen sie zu seinem Eigentum machte und sie weiter erzählte.
Auch das läßt dieser Gattung der Volkssagen sich nicht zum Vorwurf machen, daß sie nicht mehr im Volk leben, sondern nur noch in den toten Büchern stehen. Es genügt, daß sie einmal als Sage des Volks wirklich gelebt haben. Ist dies jetzt nicht mehr der Fall, so ist dies ein Zeichen, entweder, nach dem Obigen, daß ihr Kern und Gehalt nicht ein so echt volkstümlicher war, daß sie sich ganz und gar mit dem Volk erhalten und in ihm fortleben mußten, oder aber daß das Volk sie aus anderen, außerhalb der Sage und ihrem Wert liegenden Gründen aufgab und vergaß. Solche Gründe gibt es eine große Menge. Manche davon sind im Volk selbst zu suchen: Indolenz, Mangel an anhaltendem poetischen Sinne, Flüchtigkeit der Auffassung etc. Manche liegen aber auch außer ihm, wie denn leider namentlich die letztere Hälfte des vorigen Jahrhunderts in ihren auf das Volk einwirkenden Richtungen nicht dazu geschaffen war, eine kernhafte, tüchtige Volksbildung zu schaffen. Finden wir doch selbst in den Volksgeschichten, in den Städte-und Ortsbeschreibungen aus dieser Zeit eine Dürre und Nüchternheit, die auch dem trockensten Gelehrten jetzt schwerlich mehr zusagen wird, aus der am Ende gar nichts zu entnehmen ist. Solche Umstände können aber nicht zwingen, vergessene Sagen nun gar nicht mehr als Sagen gelten zu lassen. Im Gegenteil, haben sie wirklich einen echten volkstümlichen Kern, so wird es Wohltat für den einen, und Pflicht für den anderen Teil, sie der Gefahr einer gänzlichen Vergessenheit zu entreißen, und sie auch dem Volk, dem sie eigentlich angehören, zurückzugeben. Diese Sagen aber, die nicht aus Mangel an innerem Wert, sondern nur durch andere äußere Umstände dem Volk entfremdet sind, machen die unbestrittene Mehrzahl der bloß noch in den Chroniken lebenden Sagen aus. Man darf sogar, ohne Übertreibung, behaupten, daß sie es nur allein sind, oder es möchte denn die eine oder andere sich finden, die ein so eigentümlich, dem Volkssinn widerstrebendes Element enthält, daß von vornherein angenommen werden muß, sie sei von Anfang an nichts weiter als das Hirngespinst eines müßigen Kopfes gewesen und geblieben. Solche Erzählungen dürfen denn selbstredend in keine Sagensammlung aufgenommen werden, und der Herausgeber glaubt nicht, sie früher oder auch gegenwärtig aufgenommen zu haben.
Es ist überhaupt ein eigen Ding, die Sage bis zu ihrem Ursprung hin verfolgen zu wollen. Dem Geschichtsforscher ist dies allerdings von Erheblichkeit, wenn sie ihm dazu dienen soll, die Geschichte zu erläutern oder zu berichtigen. Aber der Sagensammler, der sich darauf einlassen wollte, um danach einen Maßstab für den Wert, oder gar für die Aufnehmbarkeit der einzelnen Sagen zu finden, würde jedenfalls fehl greifen. Ihm muß es genug sein, daß das, was er mitteilt, wirklich im Volk lebt oder gelebt hat. Jene, die verlangen, man solle nur diejenigen Sagen geben, welche nicht bloße Erfindungen der Chronikenschreiber seien, haben freilich an sich recht. Allein wie soll ihr Recht aus den konkreten Verhältnissen herausgefunden werden? Sehr viele echte Volkssagen sind sicher ursprünglich nichts als Erfindungen eines müßigen Kopfes, oder gar eines Betrügers; in der vorliegenden Sammlung soll z.B. nur auf die Sage Nummer 256: „Die brennende Mütze“ verwiesen werden. Aber ist sie darum keine Volkssage? Sollte sie aus der Sammlung hinausgestoßen werden, trotz ihres reinen, volkstümlichen Sagen-Elements?
Der Herausgeber glaubt nicht, nach den angedeuteten Richtungen hin seine Sammlung weiter rechtfertigen zu müssen. Dagegen muß er dies noch in zwei anderen Beziehungen. Es sind zuvörderst mehrere geschichtliche Sagen aufgenommen, die als Pommersche Sagen vielleicht nicht dürften bestehen können. Dies gilt namentlich von den Kämpfen zwischen den Wenden und Dänen. Neuere geschichtliche Forschungen glauben wenigstens so viel festgestellt zu haben, daß diese Streitigkeiten, wenn sie überhaupt stattgefunden, doch sicher das Pommersche Volk nicht berühren. Der Herausgeber war gleichwohl der Meinung, sie aufnehmen zu müssen. Die meisten Chronisten beziehen sie auf Pommern, insbesondere auch noch Kantzow; dies war dem Herausgeber eine Gewährleistung, daß sie irgendwann und wie von dem pommerschen Volk sich angeeignet, und deshalb pommersche Sagen seien. Die Sage muß überhaupt und im Ganzen gläubig aufgenommen werden, nicht bloß hinsichtlich ihres Inhalts, sondern auch hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Zeit. Historische Kritik muß sich ganz fern von ihr halten. Sie darf nur in einer einzigen Beziehung sich ihr nahen, nämlich nur insofern, als es sich darum handelt, Sage und Geschichte voneinander zu trennen. Diese, vorzüglich in der neueren Zeit geltend gemachte Aufgabe der Geschichtsforschung ist nun aber der Sage nichts weniger als gefährlich. Es muß auch der leidenschaftlichste Freund der Sage wohl nur mit einem „Leider“ das Gegenteil eingestehen. Dieser harmlosen Bemerkung muß eine nähere Andeutung fremd bleiben. Aber ein Wunsch kann hier nicht unterdrückt werden. Das Mittelalter und die nächste Periode nach ihm warf Geschichte und Sage ohne Kritik bunt durcheinander; darauf folgte eine Zeit bis tief in das vorige Jahrhundert hinein, die sich nur mit einem trockenen Aufsammeln des Materials beschäftigte. Jetzt leben wir in der Zeit der alles zerschneidenden und zersetzenden Kritik. Die Geschichte wird zur Sage und die Sage wieder wird zu gar nichts heruntergesetzt. Möge auch dies nur eine Übergangsperiode sein, die, ohne daß sich ihr Gegensatz an sie knüpft, zur Erkennung der lauteren historischen Wahrheit führt!
Ein zweiter Gegenstand der Rechtfertigung ist, daß der Herausgeber mehrere Sagen nicht aufgenommen hat, die von vielen gerade als pommersche Sagen ausgegeben werden. Hierher gehörten vorzüglich die Sagen von der Jomsburg. Allein solche Sagen, deren Lokalität, anders wie bei den eben erwähnten, so durchaus unbestimmt und bestritten ist, wie hier, und die zudem nur gerade durch ihre Lokalität in Pommern wurzeln könnten, indem im übrigen ihre Helden unbestritten einem fremden Volke angehören, glaubte der Herausgeber notwendig hier ausschließen zu müssen. –
Nach diesen Erörterungen hat der Herausgeber nur noch wenig über die gegenwärtige Sammlung zu sagen.
Er hat bei derselben im ganzen dasselbe Verfahren beobachtet, wie bei den preußischen und altmärkischen Sagen. Jede Sage mit der gewissenhaftesten Treue wiedergegeben, so wie sie entweder noch unmittelbar im Munde des Volkes oder in den Chroniken aufgefunden ist. Freilich entbehrt dadurch manche Sage einer eigentlichen Pointe; allein desto sicherer und ungetrübter stellt sich dadurch das Bild der Volkseigentümlichkeit heraus, von welcher die Sagenpoesie eines Volkes Zeugnis gibt. Die äußere Einkleidung, die Sprache, ist in der einfachsten Form gehalten, wie sie ihrem einfachen Gegenstand nur angemessen sein kann. Wo nur ein einigermaßen ansprechender, namentlich nicht zu breiter (der Hauptfehler dieser Bücher) Chronikenton vorgefunden wurde, ist dieser beibehalten. Insbesondere konnte in dieser Hinsicht der Stil Kantzows als musterhaft betrachtet werden. Seine Schreibart ist so durch und durch einfach, anspruchslos und treuherzig, klar, so eigentlich sagenhaft in einem anderen Sinne des Wortes, daß man beim Lesen desselben unwillkürlich verleitet wird, auch die wahrste Geschichte, die er erzählt, für köstliche Sagen zu halten.
Was die Anordnung der Sammlung betrifft, so muß der Herausgeber, auch abgesehen davon, daß er einige ihm zu spät zugekommene Sagen, ohne Ordnung an das Ende der Sammlung hat verweisen müssen, mehrere Vorwürfe befürchten, die er auch durch die nachfolgenden Bemerkungen nicht ganz wird beseitigen können. Er hat sich nämlich im ganzen dabei dem Systeme der preußischen Sagen angeschlossen, welches von der Verwandtschaft des Inhalts der einzelnen Sagen ausging. So stehen auch hier die alten geschichtlichen Sagen des Volkes und Landes voran. Unter diesen, die im Ganzen der Chronologie folgen, sind diejenigen, welche sich auf die Bekehrungsgeschichte Pommerns und späterhin Rügens beziehen, wieder besonders gruppiert. Es folgen darauf die Sagen, die sich auf einzelne Familien des Landes beziehen. Ihnen schließen sich zunächst die Sagen an, welche das kirchliche und religiöse Leben der Provinz betreffen, besonders im Mittelalter und bis in die Zeit der Reformation hinein, welche aber desjenigen geschichtlichen Elements entbehren, das den Sagen aus den eben genannten Bekehrungsperioden eigentümlich ist. Hierauf folgen die eigentlichen Lokalsagen allerlei Inhalts. Sie sind zumeist nach Verschiedenheit dieses Inhalts verschieden klassifiziert, je nachdem, ob sie sich mit dem Ursprung von Eigennamen der Städte, Dörfer etc. beschäftigen, oder versunkene Örter, Seen, Steine, Berge, Raubritter, Riesen, Zwerge, Unterirdische, Zauberer und dergleichen mehr zum Gegenstand haben.
Hierbei nun fanden sich mannigfache Schwierigkeiten. Zuerst war der Inhalt mancher Sagen derart, daß sie sowohl zu der einen als zu der anderen Klasse gehörten; es entstand daher die Frage, wo sie unterzubringen seien. Der Herausgeber hat zwar in der Regel nach dem am meisten hervorstechenden Stoff die Klassifikation vorgenommen; er kann aber auch nicht leugnen, manchmal mehr nach einer augenblicklichen Laune, als nach einer durch jene Rücksicht gegebenen Notwendigkeit verfahren zu haben. Zum andern führte gerade eine solche Rücksicht einen anderen, nicht unerheblichen Übelstand herbei. Manche einzelne Gegenden und Städte haben nämlich einen überwiegend großen Reichtum an Sagen, so daß, wenngleich diese von dem verschiedenartigsten Inhalt sind, es doch interessant sein mußte, sie in einer Gruppe beisammengestellt zu sehen. Namentlich war dies bei Stettin und bei dem Gollenberg der Fall. Hierauf mußte nun leider verzichtet werden. Nur eine einzige Ausnahme glaubte der Herausgeber machen zu müssen, auf die Gefahr hin, daß sie ihm als Inkonsequenz ausgelegt werden würde. Die Stadt Stralsund nämlich, so wie sie noch bis auf den heutigen Tag eine Stellung behaupten will, die gegen die Stellung auch der am meisten privilegierten Korporationen im gegenwärtigen Staatsrecht wenigstens sehr eigentümlich ist, hat sich von der ersten Zeit ihres Entstehens an ebenso sehr durch diese nämliche Eigentümlichkeit als durch die Wichtigkeit ihrer Stellung ausgezeichnet. Sie ist insofern von ihrem Entstehen bis jetzt hin eine geschichtliche Merkwürdigkeit. Dieser ihr Charakter stellt sich nun auch wieder in ihren Sagen heraus, deren im Ganzen zwar nur wenige sind, von denen aber jede einzelne etwas so besonderes und eigenes, und zugleich in der angegebenen Hinsicht charakteristisches hat, daß es schon darum allein schade wäre, sie zu trennen, wenn sie auch nicht eben durch ihre Gesamtheit dazu beitrügen, uns ein Bild von dem ganz besonderen Leben einer merkwürdigen Stadt zu geben. Einigermaßen vervollständigt wird dieses Bild durch manche Sagen der, ebenfalls durch Eigentümlichkeiten, wenn auch in einem weit geringeren Grad ausgezeichneten Stadt Greifswald; darum wurden auch deren Sagen meist in ihrem Zusammenhang mitgeteilt.
Eine dritte, wenngleich nicht ganz hierher gehörige Schwierigkeit lag in der anordnenden Behandlung der einzelnen Sagen selbst, besonders der geschichtlichen. Schon den Preußischen Sagen wurde der Vorwurf gemacht, daß sie zu sehr zerrissen, daß anstatt einer Menge einzelner kleiner Sagen nicht eine einzige Sagengeschichte gegeben wäre. So hätten namentlich auch hier die Kämpfe der Wenden und Dänen, die Sagen vom Hl. Otto, von der Bekehrung der Insel Rügen, ferner die Sagen von Bogislav X. jedesmal als eine einzige Sage mitgeteilt werden können. Allein in jenem Vorwurf selbst dürfte zugleich dessen Widerlegung liegen. Es war und ist nicht die Aufgabe, die Sagengeschichte eines Volkes zu schreiben. Es sollen nur die einzelnen Sagen des Volks wiedergegeben werden, als solche, sowohl ihrem Inhalt, als ihrer Form nach. In letzterer Beziehung existieren sie eben nur einzeln. Zudem ist nicht außer acht zu lassen, daß ein Erzählen vieler einzelnen Geschichten im Zusammenhang, ohne Abschnitte und Ruhepunkte, notwendig etwas Ermüdendes hat, was bei der eigentlichen Geschichte nur durch die kritische und pragmatische Darstellung derselben beseitigt wird, also durch eine Form, die am allerwenigsten für die Sage passen würde. –
Die vorliegende Sammlung bietet einen reichen Stoff zu Vergleichungen dar, sowohl der pommerschen Sagen mit den Sagen anderer deutschen Provinzen, und dieser wieder mit denen anderer Völker, als auch der Volkssage überhaupt mit dem ihr verwandten Volkslied, sowie mit der sogenannten Schildsage, die nur für einzelne Familien traditionell geblieben ist, ohne in das Volk selbst überzugehen. Doch dies alles würde hier zu weit führen, und der Herausgeber behält sich daher vor, das Material, das er darüber gesammelt hat, bei einer anderen Gelegenheit zu bearbeiten zu suchen.
Dagegen fühlt er sich um desto mehr verpflichtet, hier öffentlich seinen Dank auszusprechen für die viele und freundliche Teilnahme und Unterstützung, die von fast allen Seiten der Provinz Pommern seinem Unternehmen geworden ist. Ganz besonderen Dank ist er der verehrlichen Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde schuldig, die ihm bereitwillig ihre Akten mitteilte, und den Herren Professoren Böhmer und Hering in Stettin, die ihn nicht nur mit einer Menge von Beiträgen unterstützten, sondern ihm auch außerdem manchen lehrreichen Wink und manche freundliche Aufmunterung zuteil werden ließen. Wer weiß, mit wie vielen Schwierigkeiten das Sammeln von Volkssagen verbunden ist, zumal in der gegenwärtigen Zeit, wo die Kultur der unteren Stände des Volkes im Gären, und in vieler Hinsicht noch eine Afterkultur ist, die namentlich auch durch ein vornehmes Verleugnen aller Eigentümlichkeit, und mit ihr der Sage, sich kund gibt, der wird sich von der Aufrichtigkeit des hier ausgesprochenen Dankes überzeugen.
Es knüpft sich hieran noch eine Bemerkung. Die vorliegende Sammlung gibt Zeugnis von dem Sagenreichtum Pommerns. Schon bei den Preußischen Sagen wurde deren Reichtum anerkannt. Die Provinz Preußen aber hat über zwei Millionen Einwohner, wogegen Pommern kaum eine Million hat; in fast gleichem Verhältnis steht das Areal beider Provinzen. Gleichwohl war, durch mehrjährigen unermüdlichen Fleiß und durch vielfache Unterstützung, in Preußen eine nicht so reiche Sammlung zustande zu bringen, als die gegenwärtige. Nur eins bedauert der Herausgeber hierbei: daß es ihm nicht hat gelingen wollen, von einzelnen, noch in mittelalterlicher Eigentümlichkeit abgeschlossen lebenden Volksstämmen mehr Sagen zu erhalten, insbesondere von den Kassuben in Hinterpommern, zum Teil von den Mönchsgütern auf der Insel Rügen. Es existiert bei diesen Stämmen eine, ganz ihrer äußeren Abgeschlossenheit gleichstehende innere Verschlossenheit, zumal auch hinsichtlich ihrer Sagen, worüber hier an das erinnert werden darf, was der Herausgeber in gleicher Beziehung auf die Altmark in der Vorrede zu den altmärkischen Sagen angeführt hat. –
Wie den früheren Sammlungen, hat der Herausgeber auch der gegenwärtigen einen Anhang von abergläubischen Volksmeinungen und Gebräuchen beigefügt. Sie ergänzen das Gebiet und oft das Verständnis der Sage. Es ist darunter ein Gebrauch aufgenommen – das Tonnenabschlagen auf dem Darß – der zwar nicht zu den abergläubischen gerechnet werden kann, der aber um seiner Eigentümlichkeit willen nicht ganz unwillkommen sein dürfte. Es dürfte überhaupt ein nicht verdienstloses Unternehmen sein, eine Beschreibung aller besonderen Volksfeste einer Provinz oder eines Landes zu veranstalten. –
Zur leichteren Übersicht der Quellen ist zugleich ein Verzeichnis der zu der Sammlung hauptsächlich benutzten Werke mitgeteilt.
Der Herausgeber.
Verzeichnis der Werke, die zu Pommerschen Sagen benutzt sind.
1. Des fürtrefflichen Hochgelahrten Herrn Alberti Krantzil Wandalia, oder: Beschreibung Wendischer Geschicht etc., transferiret und übersetzet durch M. Stephanum Macropum vom Andreasberge. Lübek, bei und in Verlegung Laurentz Albrechts, Buchhändlers, 1600.
2. Johannis Micrälii Sechs Bücher vom Pommerlande etc. Stettin und Leipzig, Johann Kunkel, 1723.
3. Martini Rangonis Origines Pomeranicae etc. Colbergae, Georg. Bothius, 1684.
4. Joh. Bugenhagii Pomerania etc., Gryphiswaldiae, Jac. Löfflerus, 1738.
5. Valentini ab Eikstedt Epitome Annalium Pomeranie etc. Gryph. J. Löfflerus, 1728.
6. Alberti Georgii Schwarzii Historia finium principatus Rugiae etc., Gryph. Typis Höpfnerianis, 1727.
7. Diplomatische Geschichte der Pommersch-Rügenschen Städte Schwedischer Hoheit, nach ihrem Ursprunge und erster Verfassung. Nebst angehängter Historie der Pommerschen Grafschaft Gützkow. Entworfen von Albert Georg von Schwarz. Greifsw. bei H.J. Struck (Mit einer vom 15. November 1755 datierten Vorrede von J.H. Dähnert, der dieses Werk nach dem Tode des Verfassers herausgegeben hat.)
8. Das große Pommersche Kirchen-Chronikon D. Danielis Crameri etc. Alten Stettin, Nic. Barthelt, 1628.
9. Pomerania, oder Ursprunk, Altheit und Geschichte der Völker und Lande Pomern, Cassuben, Wenden, Stettin, Rhügen, in vierzehn Büchern beschrieben durch Thomas Kantzow, weiland Geheimschreiber in der Fürstlich-Pommerschen Kanzley zu Wolgast, und aus dessen Handschrift herausgegeben von Hans Gottfried Ludwig Kosegarten. Greifswald, auf Kosten des Herausgebers 1816. II. Teil 1817.
10. Geschichte von Pommern bis auf das Jahr 1129, von Peter Friedrich Kanngießer. Greifsw. in Comm. der Univ. Buchh. 1824. (Auch unter dem besonderen Titel: Bekehrungsgeschichte der Pommern zum Christentum.)
11. Geschichte des Herzogthums Pommern von den ältesten Zeiten bis zum Tode des letzten Herzogs, oder bis zum Westphälischen Frieden 1648. Von Johann Jacob Sell. Nach dessen Tode herausgegeben. Berlin, Flittner, I. und II. TI 1819. III. Tl. 1820.
12. Pommerbuch, oder vaterländisches Lesebuch für die Provinz Pommern. Herausgegeben von Karl Lappe. Stralsund, 1820.
13. Rügensche Geschichte. Ein Versuch von E.D. Gustav v.d. Lanken. Greifsw. a. Kosten d. Verf. 1819.
14. Märchen und Jugenderinnerungen von E.M. Arndt, Berlin, Realschulbuchhandlung, 1818.
15. Pommersche Sagen, in Balladen und Romanzen, von Ed. Hellm. Freyberg, Pasewalk und Prenzlau, in Comm. b.F.W. Kalbersberg, 1836. (Enthält neunzehn poetisch bearbeitete Pommersche Sagen.)
16. Berliner Kalender auf die Jahre 1837 und 1838. (In beiden namentlich die schätzbare „Geschichte von Pommern und Rügen“ vom Professor Barthold in Greifswald.)
17. Chronik der Stadt Wolgast, von Carl Heller, Greifsw. gedr. bei Kuhnike, 1829.
18. Pommersches Magazin, herausgegeben von D. C.G.N. Gesterding. Greifswald und Stralsund, 1747-1782.
19. Pommersches Museum, von Demselben. Gedr. zu Rostock 1782-1787.
20. Pommersche Mannigfaltigkeiten, von Demselben, Neu-Brandenburg, 1796.
21. Pommersche Denkwürdigkeiten, gesammelt von Friedrich Rühs. Greifswald 1803.
22. Altes und Neues Pommerland, von Christian Schöttchen, Stargard 1721.
23. Nicolaus von Klempzen, vom Pommerlande und dessen Fürsten-Geschlecht-Beschreibung. Stralsund 1777.
24. Historische Nachricht von den alten Einwohnern in Pommern, auch von dero Religion und Bekehrung etc. von Christiano Zickermann. Stettin 1724.
25. Wahrhafftige erschreckliche newe Zeitung und Geschichte, so sich ausser und in der Stadt Stralsundt dieses jetzt lauffenden 97. Jahrs der minderzall zugetragen und begeben. Als das es zu unterschiedlichen malen Blut und Schwefel geregnet etc. Greifswald. 1597.
26. Memorabilia Pomeraniae etc. quae etc. recenset etc. M. Christophorus Pylius. Sedini (ohne Jahrszahl).
27. Stralsundische Chroniken, herausgegeben von D. G. Ch. F. Mohnike und D. E.H. Zober, Stralsund, 1833.
28. Baltische Studien, herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin, 1833 fern.
29. Geschichte von Rügen und Pommern, durch F.W. Barthold, Prof. zu Greifswald. Hamburg 1839.
30. Der Darß und der Zingst, ein Beitrag zur Kenntniß von Neuvorpommern. Vom Hauptmann August von Wehrs. Hannover 1819.
31. Pommersche Provinzial-Blätter für Stadt und Land. Band 1 bis 5. Treptow a.d. Rega 1820-1823.
32. Jahresberichte der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1827 etc.
33. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Klöster in Neuvorpommern, von Diedrich Herrmann Biederstedt. Vier Theile, Greifswald 1818 und 1819.
34. Altes und Neues Rügen, das ist, Kurtzgefaßte und umständliche Nachricht von demjenigen, was sowohl in civilibus, als vornehmlich in ecclesiasticis mit dem Fürstenthum Rügen von Anfang an bis auf gegenwärtige Zeit sich zugetragen etc. (von E.H. Wackenroder). Zu finden bei bei Jacob Löfflern, Buchhändler 1730.
35. Geschichte der Klöster in Pommern und den angränzenden Provinzen etc., von Johann Joachim Steinbrück, Prediger bei der St. Peters- und Paulskirche zu Alten-Stettin. Stettin 1796.
36. Neue und genaue geographisch-statistisch-historische Darstellung von der Insel und dem Fürstenthume Rügen. Zur näheren und gründlichen Kenntniß dieses Landes entworfen von Johann Jacob Grümbke, 2 Teile. Berlin, bei Reimer, 1819.
37. Topographische und chronologische Beschreibung der Pommerschen Kauf- und Handelsstadt Anklam, von Carl Friedrich Stavenhagen, Stadt-Sekretär in Anclam. Greifswald 1773.
38. Beschreibung und Geschichte der uralten, ehemals festen, großen und berühmten Hansestadt Demmin etc., von Wilhelm Carl Stolle, Archidiacono an der St. Bartholomäikirche und Pastore zu St. Marien in Demmin. Greifswald 1772.
39. Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogtums Vor- und Hinterpommern, von Ludwig Wilhelm Brüggemann, K. Preuß. Consistorialrat und Hofprediger bei der Schloßkirche zu Stettin. Stettin, 1779-1800. 5 Teile.
40. Geschichte und Beschreibung der St. Marien- Dom-Kirche zu Colberg. Vom Dr. I. G. W. Maaß, Königl. Superintendent und Oberprediger. Colberg 1837.
41. J. C. Dähnert, Pommersche Bibliothek (eine Zeitschr.) Greifswald 1753 folg.
42. Reise durch Pommern nach der Insel Rügen etc., von Joh. Friedr. Zöllner, K. Pr. Ober-Consistorialrat und Probst. Berlin, 1797.
43. Bartholomäi Sastroven Herkommen, Geburt und Lauff seines ganzen Lebens etc. Aus der Handschrift herausgegeben und erläutert von Gottl. Christ. Friedr. Mohnike, Consistorial- und Schulrat etc. zu Stralsund. Greifswald 1823. 1824.
1. Die Zweikämpfe um die Oberherrschaft zwischen den Wenden und Dänen.
In den alten Zeiten wurde das jetzige Pommerland von einem Volk bewohnt, welches Wenden genannt wurde. Diese Wenden waren sehr tapfer und kriegerisch. Insbesondere wurden sie in viele und arge Kriege mit den Dänen verwickelt. Einstmals, lange Zeit vor der Geburt des Herrn, lebte in Dänemark ein König namens Rorich, welcher viel Krieg mit seinen umliegenden Nachbarn führte. Derselbe unterstand sich auch, die Wenden im Pommerland zu bekriegen. Er fand diese zum Streit lustig, und die beiden Völker kamen in ihren Schiffen auf der See gegeneinander. Die Wenden hatten etliche Schiffe in einen Halt versteckt, und ließen nur einige wenige sehen, indem sie meinten, der dänische König solle auf diese losgehen; so wollten sie dann weichen bis auf jene Seite des Haltes, und alsdann den König von vorn und von hinten zugleich überfallen. Aber der König merkte den Betrug, und als die Wenden vor ihm flohen, verfolgte er sie nur bis zu dem Halte hin und überfiel flugs die im Halt und schlug sie in die Flucht, ehe die anderen umkehren konnten. Diese kamen ihnen aber doch nach einer Weile wieder zur Hilfe, und sie setzten sich nun sämtlich dem König zur Wehr. Als der König das sah, hielt er stille, und überlegte, was er tun sollte.
Wie nun die Feinde so gegeneinander lagen, trat einer der Wenden hervor, der hieß Maska, und war ein weidlicher starker Mann von Gliedmaßen und von Gemüt. Derselbige rief, daß die Dänen, um viel Blutvergießen zu vermeiden, einen gegen ihn schicken sollten, daß sie miteinander um die Oberhand kämpften, also welcher von den Kämpfern gewänne, daß dessen Volk des andern Herr sein sollte, so wollten die Wenden ihr Glück und Unglück darauf setzen. Dem Könige und den Seinen bedünkte es zwar schwer zu sein, um solche hochwichtige Sache, an der ihre Freiheit und ganze Wohlfahrt stände, auf eines einzigen Mannes Hand zu wagen; dennoch zogen sie sich es zum Schimpf, daß nicht einer unter ihnen sein sollte, der so keck und stark wäre als einer der Wenden; sie forschten deshalb unter sich, und fanden einen, der sich gegen den Wenden zum Kampf erbot. Also willigten sie in den Vorschlag der Wenden ein, und gaben Maska einen Gegenmann.
Diese beiden Kämpfer traten nun zu Lande; die anderen aber blieben alle in ihren Schiffen, damit kein Teil seinem Kämpfer zu Steuer kommen mochte, und sahen mit großer Begierde und Angst zu, wie es doch die Kämpfer endigen würden. Darauf stießen die Trompeter an, und die beiden Kämpfer liefen feindlich aneinander. Der Däne schmiß weidlich gegen den Wenden an, und gab ihm einen Streich über den andern, und verwundete ihn etlichemal hart, so daß er schier erlegen hätte. Aber der Wende säumte auch nicht, schlug aller Orten um sich herum, und wehrte sich mannhaft, bis er zuletzt dem Dänen das Haupt mitten entzwei hieb und ihn so erwürgte.
Da erhob sich ein großes Geschrei und Frohlocken unter den Wenden; sie holten ihren Kämpfer Maska zu Schiff, ließen ihn verbinden und erwiesen ihm große Ehre. Von den Dänen aber forderten sie, gemäß der gegenseitigen Vereinbarung, daß sie ihnen untertänig sein sollten. Über solches Unglück wurden die Dänen traurig und sie begannen ihren Unbedacht zu verfluchen, daß sie so leichtsinnig ihr höchstes Gut und Wohlfahrt, die Freiheit, auf eines Mannes Hand gestellt hatten. Sie suchten daher Ausflüchte, wie sie sich von ihrer Verpflichtung befreien möchten, und sagten, der Kampf sei ungleich gewesen, dies und jenes hätte daran gefehlt, sonst hätte ihr Kämpfer wohl so gut gewinnen mögen als Maska; sie wollten ihrer Zusage nicht entfallen, aber es müsse ehrlich und unparteiisch zugehen; daher wollten sie noch einmal zwei Kämpfer gegeneinander stellen, und dieselbigen sollten, ihrem vorigen Bescheid nach, durch ihren Gewinn oder Verlust entscheiden, wer da herrschen oder dienen solle.
Den Wenden bedünkte die Ausflucht unbillig; aber sie nahmen die Sache in Bedenken bis auf den andern Tag, und unterdessen beredete Maska sie, sie sollten den Vorschlag der Dänen annehmen, nicht daß sie es schuldig seien, sondern zum Übermaß, er glaube, obgleich er etwas verwundet wurde, dennoch so stark zu sein, daß er einem Dänen, er möchte sein, wer er wolle, manns genug sein könnte, und die Dänen würden auch so leicht keinen finden, der sich gegen ihn zu erheben vermöchte: deshalb sollten sie es nur kühn auf ihn wagen, er wolle ihnen, mit Hilfe der Götter, keinen Schimpf oder Verlust zuwege bringen. Da die Wenden solch einen Trost hörten, ergaben sie sich darein, und bewilligten den Dänen ihren Vorschlag, doch daß es einen Tag oder vierzehn anstände, bis daß Maska ganz geheilt wäre. Das nahmen die Dänen fröhlich auf, und sie zogen unterdessen auf Mone (Insel Möne) und die Wenden auf Rügen. Die Dänen konnten anfangs nicht leicht einen unter sich finden, den sie zu dem Kampf bringen konnten; zuletzt hat sich einer, Ubbo genannt, dazu angegeben. Dem hat der König Rorich große Verehrung zugesagt und ihm auch sogleich seine güldenen Armbänder geschenkt.
Nachdem nun der Anstand verlaufen war, sind die Dänen und Wenden wieder zur See gezogen, und haben die Stelle des Kampfes auf Falster benannt. Daselbst traten die Kämpfer auf den Strand und boten sich den Kampf.
Die Wenden und Dänen hielten auf dem Wasser in ihren Schiffen, und sahen zu. Da stießen die Trompeten an, und Maska und Ubbo liefen wie Riesen, mit großem Ungeheuer auf einander, und stritten mörderlich zusammen, so daß von den Schlägen das Feuer aus den Waffen flog und einer dem andern den Harnisch zerhieb, daß die Stücke klangen und das rote Blut zur Erde lief. Darüber erhob sich ein großes Geschrei und Rufen in den Schiffen. Ein jeder Teil ermahnte seinen Kämpfer und wünschte ihm zu gewinnen, und beide Teile standen in Hoffnung und Angst.
Aber wie die Kämpfer also aufeinander erhitzt waren, und einer auf den anderen mörderlich drängte, da erwürgten sie sich zuletzt beide, so daß keiner übrig blieb.
Darauf vermeinten die Dänen, die Sache wäre jetzt gleich. Aber die Wenden bezogen sich darauf, daß ihr Kämpfer zuerst gewonnen, nachdem auch nicht verloren hätte; darum sollte die erste Überwindung nicht tot sein, und die Dänen sollten ihnen Untertänigkeit geloben. Das wollten die Dänen nicht, und so war die Sache wie zuvor. Nach vielem Zanken und Drohen haben sie sich jedoch in der Länge so vertragen, daß die Dänen sich absagen mußten, nimmer wieder ohne billige Ursache gegen die Wenden zu kriegen.1
2. Unterjochung der Wenden die Dänen
Hernach war einstmals König bei den Dänen Frotho, und bei den Pommern und Wenden war König Strumik. Nachdem nun die alten Verträge des Friedens fast in Vergessenheit gekommen waren, und beiden Völker danach stand, daß eins das andere unter sich brächte, taten sie beiderseits einander vielen Einfall und Schaden. Doch waren die Wenden den Dänen auf dem Wasser zu behende. Das verdroß in die Länge den König Frotho, und er schickte gegen sie seinen Hauptmann Erich mit acht Jachten, während er sich selbst auch rüstete. Als Erich nun in die See kam, erfuhr er, daß die Wenden nicht fern wären, und nur sieben Schiffe hätten. Er ließ darauf sieben von seinen Jachten mit grünem Buschwerk und Laub um und um bestecken, und legte sie in einer Wieke in einen Hinterhalt, mit dem Gebot, sie sollten da stille liegen, und wo sie auch sähen, daß die Feinde ihm nacheilten, sollten sie sich nicht daran kehren, bis daß sie ganz an sie heran kämen, dann sollten sie getrost angreifen. Er selber zog mit der achten Jacht aufs Meer, und zeigte sich den Wenden. Als diese seiner inne wurden, und sahen, daß er nur ein Schiff hatte, setzten sie ihm fröhlich nach. Da floh Erich zurück, und die Wenden jagten flugs hinter ihm her, und kannten die sieben Jachten nicht, die da im Hinterhalte standen. Denn weil sie mit grünem Buschwerk besteckt waren, meinten sie es wären Bäume, die an den Dünen und am Strand ständen, und liefen also mitten in die Wiek. Darauf wendete Erich, und die sieben Jachten erhoben sich auch, und umringten die Wenden, daß sie nicht zurück konnten, und fingen sie und führten sie mit den Schiffen weg.
Dieses Unglück verursachte viel Niederlage und Schrecken in dem Lande der Wenden. Das benutzte der König Frotho; er hatte eine große Kriegsflotte und viel Volks versammelt, mit demselben zog er nun fort, um die Wenden auch daheim zu besuchen. Der Wenden König Strumik sandte zwar eine Gesandtschaft, und ließ ihn um Anstand bitten. Den hat ihm aber Frotho nicht bewilligen wollen, und ist fortgezogen, und hat den König Strumik mit allem seinem Kriegsvolk erschlagen und die Pommern und Wenden unter sich gebracht.2
3. Der Dänen-König Frotho und die wendischen Schnapphähne.
Als nun der König Frotho die Wenden untertänig gemacht hatte, da sah er wohl, daß sie ihm und den Seinen keinen Frieden lassen würden, wo er nicht ganz und gar alle diejenigen ausrottete, welche das Freibeuten und Rauben gewohnt waren. Darum besann er sich auf folgende List: Er ließ ein gemeines Gebot ausgehen, wo jemand unter den Wenden wäre, der zum Freibeuten, Rauben und Kriegen Lust hätte, der solle sich kund tun, der König bedürfe solcher Leute wider seine Feinde; er wolle sie herrlich besolden. Solches gefiel den Schnapphähnen und den anderen bösen Buben unter den Wenden wohl, und es ließen sich alle einschreiben, und zeigten an, was ein jeder könnte, und je mehr einer Böses zu tun wußte, desto mehr Sold erhoffte er sich vor den anderen. Da nun also alle Schnapphähne und wüste Gesellen unter den Wenden zusammen waren, da ließ der König Frotho sie vor sein Kriegsvolk bringen, und sagte zu den anderen Wenden: „Diese sind, ihr lieben Wenden, diejenigen, die zwischen uns und euch Unruhen machen, und unter euch keinen beständigen Frieden bleiben lassen. Sehet, wie keck sie noch sind in ihrer Bosheit, weil sie glauben, daß sie auch noch für ihre Bosheiten großen Sold erlangen sollten. Deswegen ist es für uns und euch das Beste, daß wir und ihr nicht weiter durch sie bekümmert werden.“ – Und er ließ sie allzumal an den lichten Galgen hängen, einen jeden neben einem Wolf.
Dadurch ward eine Zeitlang guter Friede, beides, zu Wasser und zu Land; und der König Frotho ordnete das Land, und setzte Amtleute darin von den Wenden selbst, damit sie über die Fremden nicht murren dürften, und sich daraus keine Ursache zum Abfallen nähmen.3
4. Die Königin Wißna.
Wie also die Dänen die Herrschaft über die Wenden gehabt, haben sie hernachmals übermütig regiert, und dies hat die Wenden in die Länge verdrossen. Darum taten sie sich zusammen und empörten sich gegen die Dänen und erwählten eine männliche Jungfrau zu ihrer Königin, Wißna, aus dem Geschlecht des erschlagenen Königs Strumik. Der ordneten sie zwei Kriegsfürsten zu, Duck und Dall genannt. Und es entstand solche Erbitterung und Ergrimmung gegen die Dänen, daß auch die Königin selbst und viele Frauen und Jungfrauen sich zum Reiten und zum Krieg gewöhnten, und mit in das Feld zogen, auch so fertig und geschickt zum Kriege wurden, daß sie den Männern in nichts nachstanden. – Als nun die Dänen die Empörung der Wenden hörten, rüsteten sie sich auch, und zogen mit großer Gewalt herüber, um die Wenden wieder zum Gehorsam zu bringen. Aber die Königin Wißna schlug sie, und setzte ihnen bis nach Dänemark nach, schlug sie daselbst auch etlichemal, und tat ihnen großen Schaden; und nahm die Inseln Möne und Schonen ein. Da haben sich aber endlich beiderseits der Adel, von den Dänen wie von den Wenden, ins Mittel geschlagen, und Frieden gemacht, so daß Wißna Schonen wieder abtrat, Möne aber für den Schaden zwanzig Jahre behielt, und die Wenden frei sein und bleiben sollten, so auch die Dänen.
Die Königin Wißna regierte darauf noch lange und hatte viele Kriege, auch einmal mit den Sachsen, deren König Hengst sie zu Walsleben gefangen nahm. Zuletzt aber mußte sie elendiglich sterben. Denn als der König Harald von Dänemark schweren Krieg mit den Schweden bekam, und sie ihm darin beistand, zog sie selbst wiederum mit ins Feld, samt ihren Kriegsheldinnen. Den Sieg gewannen jedoch die Schweden, was sie einem ungeheuren Riesen namens Star Kater zu verdanken hatten, der an Stärke des Leibes, wie an Erfahrung des Kriegshandels nicht seinesgleichen hatte. Dieser Star Kater kam auch mit der Königin Wißna in der Schlacht zusammen, und wie sie sich ritterlich seiner erwehrte, hieb er ihr die rechte Hand ab. An dieser Wunde starb die Königin nicht lange hernach. In derselben Schlacht blieben auch ihre beiden Kriegsfürsten Duck und Dall.4
5. Der gefangene König Jaromar.
Nachdem die Schweden durch Hilfe des Star Kater die Dänen besiegt hatten, nahm ihr König Ringo das Land Dänemark samt der Insel Möne ein, und zwang auch die Wenden, weil sie seinen Feinden beigestanden hatten, daß sie ihm untertänig sein und Tribut geben mußten. Dies blieb so, bis nach etlichen Jahren Sievert König in Dänemark wurde. Gegen den setzten sich die Wenden, und weigerten sich, ferner Tribut zu geben. König Sievert jedoch zog mit vielem Volk gegen sie, und bezwang sie wieder. Die Wenden hatten aber dazumal keinen Herrn, sondern nur etliche Hauptleute. Sie bedachten daher, sie hätten ihre Niederlage nur darum erlitten, weil sie kein Haupt oder Herrn gehabt hatten, und erwählten darauf zu ihrem König Ismarus, einen Verwandten der Königin Wißna. Mit dem zogen sie wieder gegen Sievert, und trafen ihn in Fünen, und schlugen ihn samt seinem Volk, daß er nach Jütland flüchtete, wo er von Neuem viel Volk zusammen brachte. Aber Ismarus zog ihm nach nach Jütland, und schlug ihn noch einmal, und fing auch seinen Sohn Jaromar und seine beiden Töchter Ida und Bammeltrud. Er nahm darauf ganz Jütland und Dänemark ein, und besetzte es mit Amtleuten und genügend Kriegsvolk, so daß er es immer in Gehorsam hielte. Die Prinzessin Ida verkaufte er den Deutschen, und die Bammeltrud den Norwegern. Den Prinzen Jaromar und noch einen gefangenen Dänen, Namens Gunno, warf er ins Gefängnis.
Die Dänen waren darauf viele Jahre den Wenden untertan, und gaben ihnen Tribut. Dies nahm aber auf folgende Weise ein trauriges Ende.
Als nämlich Ismarus, der Wenden-König, meinte, daß er die Dänen nun für immer unter seiner Gewalt und Gehorsam hätte, hatte er zuletzt Erbarmen wegen des Elends und schweren Gefangenschaft des Prinzen Jaromar und seines Gesellen Gunno. Er entließ sie daher ihrer Haft, und tat sie in ein Vorwerk, wo sie arbeiten helfen mußten. Da hat sich besonders Jaromar so fleißig erzeigt, daß jedermann Mitleid mit seinem Unglück hatte, und ihn der König zuletzt zum Meier über das Vorwerk setzte. Auch diesem Amt stand er so wohl vor, daß der König ihn sowohl um seines Verstandes und Fleißes, als auch um seiner Geduld willen lieb gewonnen, ihn zu sich an seinen Hof genommen und ihn zu seinem vertrautesten Rat gemacht hat, mit Vertröstung, ihm mit der Zeit noch zu etwas Besserem zu verhelfen, so er sich ferner ehrlich und treu erzeigen würde.
Des Königs Gemahlin Woislafa hatte zwar immer einen argen Wahn gegen ihn, und riet dem König, ihm nicht allzugroßes Vertrauen zu geben; der König aber besorgte sich gar nicht vor ihm und befahl ihm auch die wichtigsten Sachen seines Königreiches an.
Dadurch kam Jaromar mit den Dänen, die oft zu Hofe mußten, wieder in Kundschaft, und erfuhr ihr Gemüt, daß sie gern die Absicht hätten, sich von der Herrschaft der Wenden zu befreien. Also hielt er heimliches Verständnis mit ihnen, und sprach mit ihnen ab, wie sie sich und ihn befreien wollten. Als nun zu einer Zeit der König mit seiner Königin und seinen Kindern auf der Jagd war, da bestellte er heimlich die Schiffe der Dänen, und sie überfielen in der Nacht den König und seine Gemahlin, pfählten das Gemach zu, worin sie mit ihren Kindern schliefen, und zündeten es von außen an, daß dieselbigen sämtlich darin verbrannten. Darauf erhob sich ganz Dänemark gegen die Wenden, und sie erschlugen alle Wenden, die im Land waren. Damit war Jaromar, den sie zu ihrem König machten, noch nicht zufrieden; er zog herüber zu den Wenden und schlug sie und brachte sie unter sich. Er setzte ihnen Amtleute und Vögte, und hielt sie sehr streng in Zaum, so daß sie nicht einmal trinken durften. Die Wenden empörten sich zwar, und suchten die fremde Herrschaft von sich abzuschütteln. Aber Jaromar bezwang sie bald, und ließ etliche ihrer Obersten enthaupten und etliche aufhängen, so daß sie ihm ganz untertan sein mußten.
„Also soll man einen Feind, den man hat, als Feind halten, und ihm nicht zuviel trauen. Denn hätte der König Ismarus das getan, so wäre ihm und den Wenden so großes Unglück nicht widerfahren, und er samt seiner Gemahlin und Kindern hätten noch lange gelebt und wären Herren gewesen; nun aber sind sie tot, und die armen Wenden sind jämmerlich umgebracht, und die anderen müssen den Dänen dienen.“5
6. Die Langobarden in Rügen.
In uralten Zeiten war einmal eine große Teuerung und Hungersnot in Norwegen. Da traten die starken Leute auf, die des mittleren Alters waren, und wollten die Alten und die Jungen, als den schwächeren Teil, töten, damit sie nicht alle Hungers stürben. Dasselbe hat aber eine ehrbare Frau, Gamboir geheißen, abgeraten und gesagt, man sollte lieber das alte und junge untüchtige Volk an einen Haufen, und das starke Volk an einen anderen Haufen setzen, und das Los darum werfen, wer aus dem Lande ziehen sollte; welchen Teil das Los träfe, dem würden die Götter schon gute Wege zeigen. Solches gefiel ihnen allen wohl und sie warfen das Los. Das traf die starken. Dieselben mußten nun wegziehen, und kamen nach langem Streifen und Umherziehen zuletzt auf das Land zu Rügen. Daraus vertrieben sie die Rüger und setzten sich an deren Stelle im Land fest. Und weil sie auf ihrer langen Reise die Bärte hatten lang wachsen lassen, hießen sie sich die Langbarte, welchen Namen sie auch behalten haben. Sie sollen auch die Stadt Barth erbaut haben, welche in ihrem Wappen noch ein Haupt mit einem langen Barte führt.
Diese Langbarte haben bei fünf Könige Zeiten auf der Insel Rügen und dem festen Lande gegenüber gewohnt. Darauf sind ihrer aber wieder zu viele geworden, und die meisten von ihnen sind fortgezogen, zuerst an die Elbe, dann an die Donau, und zuletzt nach Italien hin, wo sie ein Land eingenommen haben, das jetzt mit einem etwas verkehrten Namen von ihnen die Lombardei heißet.
Die vertriebenen Rüger hatten sich nach Hinterpommern gezogen, wo sie auch die Stadt Rügenwalde erbaut haben. Dort saßen sie ruhig, bis der Mehrteil der Langbarte das Land zu Rügen also geräumt hatten. Da brachen sie auf, überfielen die zurückgebliebenen Langbarte, und nahmen ihre alte Heimat wieder ein. Die Langbarte zerstreuten sich überall im Lande umher, und wurden da von nun an Wandalen genannt.6
7. Der Liebeskampf.
Es ist schon tausend Jahre her und noch länger, als einst in Polen ein Herzog lebte, welcher Cracus hieß, und der auch die Stadt Krakau erbaut haben soll. Dieser hinterließ zwei Söhne und eine Tochter. Von den Söhnen hieß der eine Cracus wie der Vater, der andere Lechus; die Tochter hieß Wenda. Die Regierung sollte nach dem Tod des alten Herzogs an seinen ältesten Sohn, Cracus, fallen; aber Lechus gönnte sie diesem nicht, und brachte ihn eine Tages auf der Jagd meuchelmörderischer Weise um. Doch die Polen wollten nun keinen Brudermörder über sich haben, und gaben das Reich der Wenda. Zu dieser kamen darauf viele Könige und Prinzen, die sie zur Ehe begehrten; denn sie war zugleich mächtig, klug und schön. Doch sie wollte lieber Prinzessin allein sein, als eines Prinzen Weib, und sie schlug alle Anträge ab, und ließ mit solchen Antworten die Freier von sich.
Das hörte ein Fürst der Rügianer im Pommerland, Namens Rütiger, ein gar mächtiger und tapferer Held. Er glaubte die Fürstin zu gewinnen, und zog aus an ihren Hof und buhlte um sie. Aber er bekam keinen besseren Bescheid als die übrigen. Darüber ergrimmte der Fürst in seinem Herzen, und da er in großer Liebe zu der Prinzessin entbrannt war, so brachte er ein ansehnliches Heer auf die Beine und fiel damit in Polen ein, um mit Gewalt um sie zu werben. Wenda das Fräulein zog ihm entgegen, gleichfalls mit großer Heeresmacht, und in ihrem Herzen gelobend, wenn sie den Feind besiegen sollte, zeitlebens den Göttern ihre Jungfrauschaft zum Opfer zu bringen.
Als nun aber die beiden Heere gegeneinander hielten, da dünkte es den Pommern schimpflich, daß sie wider ein Weib das Schwert ziehen sollten, und sie hielten bei ihrem Fürsten an, daß er sich eines Besseren bedenken möge. Darüber entbrannte der edle Rütiger dermaßen vor Zorn und Liebe, daß er sein eigenes Schwert ergriff und sich dasselbe durch das Herz stieß. Also zogen die Pommern und Polen wieder voneinander, nachdem sie einen neuen Bund unter sich gemacht hatten.
Wenda aber, das Fürstenfräulein, hatte von der Stunde an großes Herzeleid; und als sie wieder in ihr Schloß kam, wollte sie nicht länger leben, nachdem sich ihrethalben ein so tapferer Held ums Leben gebracht hatte. Sie sprang deshalb von der Brücke ihres Schlosses in die Weichsel, wo sie ihren Tod fand.
Solches ist geschehen bald nach dem Jahre des Herrn 700. Nach Wendas Tode kamen die zwölf Woiwoden in Polen wieder an das Regiment.7
8. König Schweno von Dänemark und die Wolliner.
Vor Zeiten lebte in Dänemark ein König namens Harald. Der hatte einen bösen, ungeratenen Sohn, Schweno. Dieser Schweno warf das Christentum ab, setzte sich gegen seinen Vater, und vertrieb ihn aus dem Reich. Harald flüchtete nach der Insel Wollin in Pommern, und die Wolliner nahmen sich freundlich seiner an, obschon er ein Christ war. Sie rüsteten auch eine große Kriegsflotte aus, um ihn wieder in sein Land einzusetzen, und zogen damit gegen Schweno, mit dem sie sich einen ganzen Tag schlugen, so daß es ungewiß blieb, wer gewonnen hätte oder nicht. Aber sie erreichten ihren Zweck nicht, weil Schweno am nächsten Tag seinen Vater durch einen Dänen meuchlings erschießen ließ.
Darüber faßte Schweno einen so großen Haß gegen die Wolliner, daß er großes Volk und viele Schiffe zusammen brachte und also gegen sie zog. Aber die Wolliner säumten auch nicht, sondern zogen ihm entgegen, und schlugen und fingen ihn, so daß er sich lösen mußte mit vielen tausend Mark Goldes. Nicht besser erging es ihm, als er sich nach einiger Zeit rächen wollte und von neuem gegen jene zog. Darüber wurde er nun sehr ärgerlich in seinem Gemüt, und obgleich er Frieden hatte zusagen müssen, so brach er doch sein Versprechen und zog wieder gegen sie, da er glaubte, das Glück werde sich doch einmal auf seine Seite wenden. Aber die Wolliner waren auch diesmal auf, und kamen ihm zwischen Möne und Falster entgegen.