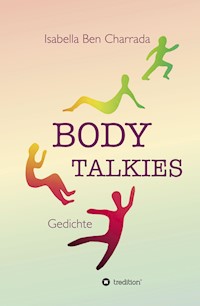4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die phantastische Geschichte einer ungewöhnlichen jungen Frau, die aufbricht, um sich aus dem Korsett ihrer Herkunftsstadt, der Pflicht zum Brillentragen, zu befreien. Nur heimlich, auf abenteuerliche Weise, verlässt sie diesen Ort der beschränkten Sicht. Mit beiden Augen, ohne Brille, will sie in die Welt schauen, sich lebendig fühlen und sich verlieben. Nach Tagen und Nächten gelangt sie zum Südtor, zur Autobahn in den Süden. Dabei trifft sie auf ihre Träumerin, die zur treuen Begleiterin wird, auf Szenerien ihrer Vergangenheit und auf viele skurrile Gestalten. Starke Innen-Bilder, eine poetische Sprache, und schließlich das so oft erträumte Überwinden von Gegensätzen nimmt uns als Lesende gefangen. Gefangen, um uns selbst zu befreien, aus dieser manchmal bedrückenden, manchmal erheiternden, fremden und doch irgendwie vertrauten Welt. Dieses Buch ist wie ein heilendes Unkraut - Zwischenraumsammler lacht es an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
2021 Isabella Ben Charrada
Umschlag: Irina Naruga
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-25137-3 (Paperback)
978-3-347-25138-0 (Hardcover)
978-3-347-25139-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Über die Autorin
Isabella Ben Charrada, Autorin, schamanische Begleiterin und Beraterin, arbeitete lange Zeit für das Europäische Parlament in Straßburg und die Europäische Kommission in Luxemburg. Sie schrieb immer parallel zu ihrer alltäglichen Beschäftigung für Europa, meist Alltagspoesie mit humoristischer Verve. Sie liebt Schüttelreime – hat das Leben die gebürtige Hamburgerin in Nordafrika, Belgien, Frankreich und Luxemburg doch selbst auch oft genug durchgeschüttelt.
Jetzt lebt und schreibt sie wieder in Hamburg.
Bisher erschienen:
Kurzgeschichten in „So nah und doch so fern – Die Geschichten mit den Eltern“
Hrsg. Herrad Schenk
„Der Ernst des Lebens – Verständigungstexte“
Hrsg. Ruth-Esther Geiger und Hartmut Klenke
„Lauffeuer“, Lyrik, CD
Body Talkies – Gedichte“, Buch und CD
Finden verbinden Schritt für Schritt Mit – mit – mit
Hallo!
Jetzt sitzen Sie da und erwarten von mir, dass ich Sie ablenke, unterhalte – oder was immer Sie sich so vorstellen. Ich kenne Sie nicht – Sie mich nicht – und da sind wir mitten drin: Sie haben sicher schon etwas übers Träumen gehört oder gelesen. Vergessen Sie es! Sag ich, denn ich muss es ja wissen! Weil ich direkt aus dem Land der Träume komme. Grenzgängerin bin ich – zwischen Tag und Nacht und heiße Ira.
Denn bei uns lebt man in farbigen Bildern, Szenerien. Sprache fließt oder tröpfelt – je nach dem – Symbolsprache, die in einem Wort viele verschiedene Aussagen verdichtet – Kürzel – Torbögen – Hängebrücken.
All Ihr Tagmenschen kommt in unser Nachtland, begegnet Eurem Doppelgänger und statt euch mit ihm zusammenzutun, zuzuhören, zu lernen, streitet Ihr euch. Jeder behauptet, nur er sei das wahre "ICH". Ihr kehrt in den Tag zurück und habt fast alles vergessen. Kaum macht ihr die Augen auf, wird der Spiegel blind, in dem ihr gelesen habt. Und damit werden wir auch immer blasser und bildschwächer.
Aber Sie sind bei uns auch Ausländer – wie ich bei Euch – und so lassen Sie es uns halt miteinander versuchen. Warum? Tja, ich bin so eine Art – Botschafter.
Ich bin also Grenzgängerin aus Notwehr geworden. Ich suchte meinen Tagschatten – der mich, klaro, nur für einen Nachtschatten hielt, und ich will Ihnen davon erzählen, wie wir zusammen kamen, eine Gestalt wurden und nur noch einen Schatten werfen.
Mit Eurer Sprache habe ich so meine Probleme, so mach’ ich’s wie einige von Euch: ich rette mich durch Schnoddrigkeit. Aber Sie merken schon – das ist wie Hinken auf drei Beinen.
"Ira, du hast noch nicht alles gesagt!"
"Stimmt. Mich ärgert dieses "Träume sind Schäume". Ich bin die Gleichgültigkeit der Tagmenschen und den Krieg zwischen Tag und Nacht leid."
"Bist du eine Friedenstaube?"
"Mach’ dich nur lustig über mich! Seitdem wir uns hören und fühlen können, näher spüren, sind wir fidel wie schon lang nicht mehr, oder?"
"Ja, schon."
"Die Tagländer müssen ihre Träume wiederfinden, denn ihre Träume sind unser Leben!" ist das Motto unseres Ober-Wolkenschieber (weiser Traumtänzer und Phantast).
In diesem Sinne, auf geht’s!
1
Eines Nachts fand ich Bella in einem Schlafsack, zusammengerollt wie ein krankes Tier. Zwischen Steinbrocken und neben einem kümmerlichen Strauch. Nicht weit von der Stadtmauer der Brillenmacher. Im Niemandsland.
Gehört hatte ich sie nur, weil sie vor dem Einschlafen immer wieder schluchzend und schniefend vor sich hinleierte: "Keiner hört mir zu – ich bin so allein!"
Zuerst erlauschte ich nur schwache Geräuschfetzen, die aber wie Lichtsignale aufblitzten und mich neugierig machten. Dann wurde es immer lauter, als drehe jemand ein Radio auf, und schließlich verstand ich alles ganz deutlich – und wurde wütend.
So ein Quatsch – "Keiner hört mir zu!" – Bella war ja nie zu mir gekommen. Ich wollte ja schon die ganze Zeit nichts anderes als zuhören, bei ihr sein. Wie konnte sie sagen, dass sie allein war! Und ich? Ich bin doch auch noch da!
Aber dann tat Bella mir leid, wie sie so verkrümmt dalag. Ich setzte mich zu ihr, flüsterte ihr ins Ohr: "Komm’ schon, ich bin doch hier. Du bist nicht allein. Erzähl’ mir alles!"
Dachte, nun fängt sie an – aber nein.
Sie wälzte sich hin und her, bis ihr der Reißverschluss des Schlafsacks über die Nase rutschte und prompt war sie in ihren Kinderalbtraum hineingeraten. Fiel von einer Brücke – fiel und fiel – in waberndes Zwielicht, und die Angst vor dem Aufprall presste auf Kehlkopf und Brustkorb.
Schnell zog ich den Schlafsack von ihrem Gesicht und schickte ihr einen Flugtraum. Nun flog sie über weite Landschaften – gemächlich, schwerelos und von Regenbogenvögeln begleitet.
Sie wurde ruhiger, liess das Zähneknirschen, landete an einer Quelle, die in der Sonne glitzerte und streckte sich im weichen Moos aus. Wassertröpfchen sprengten auf ihr Gesicht und dann sah und hörte sie mich – endlich.
Nachdem Bella noch viele Male stotternd und seufzend ein- und ausgeatmet hatte, machte sie den Mund auf, wieder zu, grinste schief und sagte dann: "Da bist du ja wieder!" – – "Als ich kleiner war, bist du immer dagewesen. Und dann habe ich dich verloren. Ich weiß nicht mehr genau, wann.
Als Mutti ihre Brille nicht mehr abnahm – als Vati wegging? Oder später?
Ich weiß nur noch, dass du nicht plötzlich verschwunden bist. Es wurde nur immer schwerer, dich zu hören und zu sehen. Neue, dunkle Bilder funkten dazwischen, löschten deine leuchtenden Farben hie und da aus, überdeckten immer größere Flächen mit Dämmer – eine schummrige Zärtlichkeit, die mich traurig machte. Dann wurde mehr und mehr undurchsichtig, fleckig, dunkelte ein, verdunkelte sich – Finsternis, die wie saugende Brunnenlöcher die Farben verschluckte. Nacht wurde Angst, und Angst wurde zu schwarzen offenen Mündern. Die schnappten: "Sei stille! Sitz nicht so krumm! Setz deine Brille auf! Sonst holt dich … "
Harte Stimmen, ein Zischen und Zubeißen.
Schwere Hände drückten auf mir, Ira.
Ich rannte und hetzte fort – Bewegung ließ alles als Hintergrund zurück.
Aber ein riesiger Schatten warf sich auf meinen Rücken.
Wieder und wieder kam ich zur Brücke, fühlte das Fallen, dem Aufprall nahe, Angst – Panik – nie Erlösung.
Ohne zu wissen, wie ich mein Gleichgewicht verloren hatte.
So fasse ich das heute in Worte ein – aber damals?
Nein, früher hatte ich keine Worte dafür.
Waren es Unterwasserklänge oder lautlose Bilder hinter geschlossenen Augenlidern, Kehlezuschnüren oder Zerren und Mitgerissenwerden?
Die, die ich einmal war, ist irgendwo dahinten – eingesperrt – Türen – Türen – große rostige Vorhängeschlösser. Wenn eine Tür endlich aufgerüttelt ist, wieder nur ein lichtloser Raum und ein neuer Türblock. Dumpf. Geschrumpft. Ich kann es nicht mit Worten greifen."
"Lass nur, Bella. Später einmal werden wir Türen und Fenster aufreißen – Licht und Farben in diese Räume hereineinlassen. Du wirst eine neue Sprache lernen – Bilderhören und Tönesehen. Lass nur alles heraus, wie es kommt. Ich bin kein Deutschlehrer – Worte sind für mich nur Spiegelscherben, Passepartout und Wolkenflitzer. – Erzähl weiter!"
"Rück’ ein bisschen ran, dann wird mir gemütlich.
Es ist schön hier. Grün – diamantweiß, warm. Zurückgehen ist für mich Totentanz."
"Nein Bella, eher Gräberausheben und Begraben. Loskommen und Loslassen, Annehmen und in den Arm nehmen. Freischaufeln. Eine Reise zu dir."
"Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe immer noch den Blick durch meine dunkle Brille. Meine Augen haben sich noch nicht umgewöhnt – Brillenrand und – tönung sind noch als Nachbild in meinem Hirn. Obwohl ich gestern Abend dieses elende Gestell zertrampelt habe! Weggelaufen bin aus der Stadt der Brillenmacher! Und …"
"Langsam, langsam, Bella! Alte Oma ist kein D-Zug!"
"Ich lache ja!?
D-Zug – den gibt’s nicht mehr. Aber Tante Hedi, die Äppeltante, sagte das immer zu mir. Wenn ich an ihrem Rock zog, damit sie schnell mitkommt. "Bitte! Jetzt gleich!!" Ich wollte mein Staunen mit ihr teilen, es noch größer machen. Schob sie endlich ihr rechtes Bein vor, hörte ich den D-Zug dampfen und vorwärtsstampfen. Das passte zu meiner Vorfreude.
Freude – Worüber habe ich mich gefreut??
Wenn mir jemand zuhörte, mitkam, mit mir teilen wollte, Zeit für mich hatte, mir Geschichten erzählte und das Um-mich-herum erklärte. Schon immer hatte ich so viel zu erzählen, und so oft schnitt man mir die Worte durch. Ich fragte so gern – das war wie Anschleichen. Aber schnell hieß es wieder: SEI STILLE!
Reden wie ein Herantasten, Wärme suchen, nicht mehr allein.
Zuhören wie Staunen und Verzauberung und wer sein.
Ach, Ira, du sagst das so einfach: "Lass alles heraus!"
Ich muss zuerst einmal dieses "SEI STILLE" loswerden.
Hin und her, runter und tiefer, höher und treibend sind die Teilchen in meinem Kopf, kaleidoskopgeschüttelt."
"Bella, du hockst da wie auf einem Ameisenhaufen, drückst die armen Viecher platt und wunderst dich, dass sie dir in den Allerwertesten zwicken! – Fang doch am Anfang an! – Nein, nicht der Ordnung halber. Ich weiß doch, da fällt dir nur deine Mutter und ihr "Ordnung ist das halbe Leben" ein. – Weil’s einfacher ist, deshalb – ein Konzentrationspunkt, nichts weiter. Ja?"
"Na gut, aber was weiß ich schon über diesen Anfang?"
"Bella! Entweder willst du nun erzählen oder nicht!"
Schweigen. Bella war beleidigt. Sie wollte, dass ich über ihre Gehirnblähungen mitjammere. Aber nicht mit mir! Ich puste lieber den heißen Brei kalt, statt drumherum zu schleichen. Aber Bella?
Bella wollte zwar reden, aber doch nur darüber, dass sie nicht erzählen – nicht leben konnte. So ging das aber nicht!
Ich musste nachdenken und um Zeit zu gewinnen, bat ich unseren Traumjoker, sich um Bella zu kümmern. Er kam auch gleich angehüpft und verwickelte sie in allerlei Rau. Ich schaute noch einmal auf ihr Gesicht: die Augäpfel rollten unter den geschlossenen Lidern und so wusste ich: Bella hatte erstmal zu tun.
2
Ich setzte mich ein Stück abseits in eine kleine Mulde, den Rücken gegen einen Stein. "Nur Bella kann mir alles erklären", kam mir in den Sinn. Also schlüpfte ich in Bellas Kopf, um ihren letzten Tag in der Stadt der Brillenmacher zu erleben.
"Erleben?" fragen Sie. "Ja!
Ich kann nicht nur zuhören, ich kann auch gleichzeitig all die Bilder in Bellas Kopf sehen und mich hineinfühlen. Jetzt, wo Bella nicht mehr in der Stadt ist.
Für euch Tagländer ist das Gehirn ja nur Schalt- und Steuerzentrale – Nervenzellen, die alle Eindrücke weiterleiten, koordinieren, lagern oder tatkräftig machen, wie mir unser Taglandkorrespondent erklärte.
Für uns aber ist es eher wie ein langer Gang mit unzähligen Türen. Hinter jeder eine gelebte Stunde oder auch nur ein paar Sekunden. Wenn ich eine Tür öffne, so bin ich mittendrin, sehe, rieche, höre und fühle mit.
Nun war ich also in der Stadt.
Wie sich alles verändert hatte seit meinem letzten Besuch!
War es schon so lange her?
Ja, es mussten viele Jahre vergangen sein.
Seitdem die Tagländer ihre Häuser und Stadtmauern mit Vernunftschirmen bestückt hatten, konnten wir nur noch in ihr Land, wenn wir gerufen wurden.
Aber wer rief uns schon?
Kinder, viele Alte, sogenannte Kopflose, einige Aufmucker. Und die hatten es schon schwer mit dem Rufen, bei all den Ratioapparaten.
Ab und an gelang uns eine List, denn so Mancher, der uns studierte oder klassifizierte, wurde von unserem Joker beschwatzt und ließ uns heimlich ein.
Vieles wusste ich nur vom Hören-Sagen.
Bella hatte mich so lange nicht mehr gerufen.
Ich wollte Bellas letzten Tag nicht nur erleben, sondern auch verstehen – aber wie sollte ich verstehen, wenn ich ihre Stadt kaum kannte! Beim letzten Besuch bei Bella war sie noch sehr klein, wusste wenig über ihre Umwelt. Wie konnte ich daran anknüpfen? Ach ja, unser Korrespondent fiel mir ein.
Mit einem Gedankenblitz schaltete ich mich zu ihm. Er war grad’ im Traum eines Studenten von der Universität „Überblick". Ich grinste in mich hinein, denn der Studiosus würde gleich eine kleine Stadtrundfahrt machen.
Fliro, unser Korrespondent, begann auch sofort: "Diese Stadt liegt am Strom Blee, 180 km vom Nordmeer und wird von einem kleinen Flüsschen, der Strela, durchquert, die sich hier- und dorthin verzweigt, in der Innenstadt zu einem großen und einem kleinen Becken aufgestaut ist und den Stadtpark säumt, bevor sie die Stadt verlässt.
Im Mittelalter entstand die Stadt um eine Burg herum, die durch eine Mauer befestigt war. Nach und nach wurden die umliegenden Dörfer von der Stadt eingemeindet, die Stadtmauer erweitert und um die Neuerwerbungen gezogen.
Aber komm, das schauen wir uns mal von oben an, Vorträge sind immer so langweilig", sagte Fliro und schon waren wir hoch über der Stadt, die mit dem Zick und Zack ihrer Mauer wie ein riesiger Stofffetzen mit ausgestanzten Rändern aussah.
Ich blickte auf die fünf Stadttore hinunter – eins zum Hafen, eins zur Autobahn nach Norden, eins nach Süden, eins nach Westen und eins nach Osten, und die Strassen schlängelten sich zur Stadt hinaus wie Krakenarme.
Die Mauer: ein Flickwerk – alte restaurierte Teile, lange Strecken Betonwall, aber mit Mosaiken und Mauergemälden, hie und da eine Statue und über allen Toren riesige Brillen mit goldenen Gläsern und nicht zu vergessen, überall, wie schwarze Warzen, die Vernunftschirme.
"Jedes Tor wird streng bewacht", hörte ich nun Fliro wieder, "man kommt nur mit Ausweisen hinein oder hinaus. Wenn Brillenlose in die Stadt wollen, werden sie gründlich kontrolliert. Es heißt, sie haben eine Augenkrankheit – nicht so wie die Blinden – nein, viel schwerwiegender. Sie müssen den Nachweis erbringen, dass sie nicht ansteckend sind und brauchen eine Sonderaufenthaltsgenehmigung, die selten gewährt wird. Im Zweifelsfall bringt man sie ins "Ausblickkrankenhaus auf die Quarantänestation oder weist sie ab."
Ich schaute wieder hinunter, sah all die Autos, Schiffe, Fahrräder, Busse, Bahnen und Menschen, ein Pulsieren, so dass mir fast schwindelig wurde.
Nord- und Hafentor waren ganz modern, in Glas und Stahl, die Tore selbst in Eisen mit Kupferbeschlägen.
"Jedes Tor wird von 10 Torhütern bewacht", meinte Fliro, " aber die Hauptarbeit machen die Computer. Niemand muss mehr die Tore eigenhändig öffnen oder schließen. Pünktlich um 6 Uhr früh sirrt es und die Tore schwingen auf und um 2 Uhr nachts wieder zu. Auch das Alarmsystem und alle Vernunftschirme werden vom Zentralcomputer "Schauklar XZ4" gesteuert."
Nicht weit vom Westtor sah ich die Hafenanlage: Lagerschuppen, bunte Kästen aufgestapelter Container, Kräne und Laufkatzen, Docks, Werften, moderne und ein paar Häuserzeilen alter Bürogebäude, Hafenbecken, Kaimauern, Brücken, Fähren, Schlepper, Schuten, Dampfer und Ozeanriesen im milchkaffeetrüben Wasser.
Als hätte jemand Bauklötzer ausgeschüttet – so sah alles von oben aus – und würde nun mit unsichtbaren Händen darin rumfuhrwerken.
Dort, wo die Stadtmauer einige Zickzacks aus Beton machte, neue Stadtviertel: Fabrikschlote und Rieseneier, dicke Türme – von Raffinerien und dem Gaswerk – graugeklotzt, qualmig – nah am Hafen. Weiter zum Süden hin das große Elektrizitätswerk – Drähtegewirr und Hochspannungsmasten, Riesenstecknadeln in verknäulten Fäden.
Zwischen Nord- und Osttor der Sender für Radio und Fernsehen mit seinen weißroten Antennen und dem Funkturm, der einen Lichtfinger über die Stadt kreisen ließ. Alles so fein und dünn wie Mikadostäbe.
Der Flughafen im Osten: Flugfelder im Schachbrettmuster, eine riesige Schachtel mit viel Glas – das Flughafengebäude und der Abfertigungsturm wie ein umgestülpter Zauberhut, aber nicht so schön bunt und mit Sternen, nein, auch Grau und Glas. Busse und kleine Wägelchen flitzten hin und her, Flugzeuge wurden aufgetankt, eines war gerade angekommen und Reisende schoben sich die Gangway hinunter. Da wurde beladen und entladen, Stewardessen in blau und gelb fuchtelten mit den Armen und winkten Passagiere heran. Eine Maschine hob ab, zog einen Bogen in den verhangenen Himmel und verschwand in den Wolken.
In diesen Randbezirken sah ich aber auch Wohngegenden: Ansammlungen von Hochhäusern – Kantklötze, kleinere und größere, kaum Bäume, Sträucher oder Rasen. "Grünanlagen nehmen zu viel Platz weg", fiel mir Fliro in meine Beobachtungen. "Dafür sind die Häuser mit psychologisch fein abgestimmten Brillenfarben getüncht, damit ihre Bewohner nicht trübsinnig werden. Und die Attraktion: alle zuasphaltierten Straßen, Wege und Pfade sind mit Fluorantrazit beschichtet und leuchten "sternig" in der Dunkelheit. – Schlafsilos werden diese Häuser auch von manchen genannt, weil tagsüber alles in die Stadt zur Arbeit strömt. Übrig bleiben ein paar Alte, Kranke, Hausfrauen, Kinder, Arbeitslose und die Aufmucker, die nicht zur Arbeit wollen – hocken da im Beton und werden ganz dumpf im Kopf oder randalieren, bekritzeln Wände und reißen Telefonhörer aus den Kabinen. Aber grad’ von hier rufen uns immer mehr Tagländer."
Es gab auch Stadtviertel, wo es grün und bunt von Blumen leuchtete, nicht nur aus dem Stadtpark.
Nahe am Nordtor, wo eine frische Brise vom Strom Blee herüberwehte, die Residenz der Brillenmacher und der reichen Kaufleute – vornehm wie eine alte Gräfin mit ihrem Edelsteinschmuck: Villen, gepflegte Gärten, Parks, Glitzern von Teichen und die von wiegenden Trauerweiden eingefassten Seitenarme der Strela.
Aber nicht weit von solcher Pracht Mietshäuser mit nässefleckigen Brandmauern, an denen Reklametafeln für Waschpulver oder neuartige Brillengestelle hingen. Ein trostloses Einerlei, nur die Strassen waren oft von alten Kastanienbäumen flankiert. Dazwischen ein altmodisches Gebäudeviereck. "Die Blick-nach-vorn-Kaserne", ließ sich Fliro wieder hören. "Alles arme ratiogeschüttelte Soldaten dort, die nur eines lernen: gehorchen und wie man am besten Menschen umbringt oder in Angst und Schrecken versetzt. Sollen die Stadt verteidigen – gegen Brillenlose und anderes "Gezücht" – obwohl die ja auch Tagländer sind. Aber ein Tagländer ist des anderen Feind – oder besser gesagt, eine Horde – hier die der Brillenmacher – der anderen Horde. Die Soldaten müssen auch dafür sorgen, zusammen mit der Polizei, dass keinem einfällt, seine Brille abzusetzen oder sich zusammenzurotten, mit den Nacktäugern zum Beispiel. Die Nacktäuger behaupten nämlich, man könne ohne Brille besser sehen und die Brillenmacher wollten nur durch den Zwang zum Brillentragen die Leute blind machen, ihnen das Geld aus der Tasche ziehen und das Kastensystem aufrechterhalten, wo viele arm und nur wenige reich sind, würden lügen, wenn sie die Stadt die der Brillenmacher nennen, wo doch die meisten Bewohner keine Brillenmacher, sondern nur einfache Brillenträger sind. Man sagt den Nacktäugern – die nur so heißen, aber doch ihre Brillen tragen, denn sonst säßen sie schon längst im Gefängnis – "Geht doch zu den Blinden oder Brillenlosen!" Aber sie haben ihre Anhänger, vor allem unter den Jugendlichen und deshalb wird jedem Soldaten und Polizisten eingeschärft: "Keine Gnade für Nacktäuger!"
Da drüben, in der Innenstadt, am großen Becken der Strela, steht das Polizeihochhaus "Scharfblick" – das höchste der Stadt mit seinen 35 Stockwerken und dem Zentralcomputer. Die Polizei hat in jedem Stadtteil mehrere Wachen und regelt alles, vom Verkehr in den Straßen bis zum kleinsten Verstoß gegen die Brillenmachergesetze. Immer auf der Lauer, eine dicke Spinne in ihrem Netz. Ich kann die Polizisten und Soldaten nur an ihren verschiedenen Uniformen unterscheiden. Es ist so schwer, in deren Köpfe zu kommen und Genaueres zu erfahren. Sie sind alle so schrecklich vernünftig", klagte Fliro.
Ich lugte zu dem hohen Block hinüber: verspiegelte Fensterfronten, damit man nicht hineinschauen konnte, Antennen auf dem Dach und ein Hubschrauberlandeplatz, unten schossen sirenenheulend und mit kaltblauem Aufblinken Polizeiautos aus den Tiefgaragen, und in einen Mannschaftsbus stiegen mit Helmen, Knüppeln und Schilden Bewaffnete ein. Ob die wohl gegen die Nacktäuger ausrückten?
So viele Häuser: Warenhäuser, an deren Fassaden Neonreklamen morsten, Bürohäuser, moderne, wieder in Stahl, Beton und Glas, aber auch ältere, mit verzierten Fassaden, gediegen – Schulgebäude, alte, düstere mit Höfen voller breitkroniger Bäume oder moderne Flachbauten mit asphaltierten Schulhöfen, ein paar Bäumen und Bänken. Sportplätze mit schwärzlichen Aschenbahnen, Fußballtoren oder lösrote Flächen, wo Weißgekleidete Tennis spielten. Hallen – Schwimmhallen, Turnhallen, Konzerthallen, Messehallen, eine glasgedeckte Markthalle in der Nähe des Bahnhofs. Krankenhäuser, auf deren Grünflächen Menschen in Bademänteln vorsichtig auf und ab gingen, ein Hinein und Hinaus von Krankenwagen und Tragen mit eingewickelten Gestalten wurden hastig vorwärtsgeschoben. Irrenhäuser, deren Bewohner keine Brillen tragen wollten und schrille Schreie ausstießen oder nur stumm vor sich hinstierten. Altenheime, vor denen Rentner auf Bänken saßen oder auf einen Stock gestützt über Kieswege schlurrten.
"In den Krankenhäusern werden die Bebrillten geboren – ohne Brille, natürlich", meldete sich Frilo, "man klopft ihnen auf den Rücken, damit sie ordentlich schreien, wiegt und misst sie, untersucht sie und windelt sie ein, schnell weg von der warmen Haut ihrer Mütter, auf eine Babystation, wo die Armen dann jämmerlich weinen. Alles wie am Fließband zwischen blitzenden Gerätschaften und allerlei Computern und Apparaten. Es werden Karteikarten von ihnen angelegt, sie werden gemeldet bei den Ämtern und alles wird vom Zentralcomputer gespeichert. Dann bleiben sie ein paar Jahre bei ihren Müttern oder kommen in eine Babykrippe, wenn die Mütter arbeiten müssen oder ins Waisenhaus, wenn sie keine Mütter haben. In dieser Zeit werden sie zum Brillentragen dressiert, zum Sprechen, Saubersein, Dankesagen und vor allem zum Gehorchen, wie bei den Soldaten. Dann geht’s in den Kindergarten, wo sie von Mitkindern und Kindergärtnerinnen weiter dressiert werden. Aber, wenn du meinst, das sei ein richtiger Garten für die Kinder – nein, schau bloß mal runter: wenig Grün vor diesen Häusern, ein paar armselige Spielgeräte und immer ein Zaun drumherum. Oder sie müssen in Reih und Glied spazieren gehen. Aber die Gärtner, da drüben, nahe am Westtor, hinter dem Friedhof, die pflanzen ja auch alles in Reih und Glied, da passt der Name Kindergarten wohl doch.
Weiter in die Schulen mit ihnen, wo ihnen beigebracht wird, wie ein Bebrillter zu sein hat. Auch über die stolze Geschichte der Brillenmacher lernen sie Daten: Kriege, Eroberungen und Gesetze; sie lernen Wissenschaften, Künste, Sport, fremde Sprachen (damit sie andere Tagländer verstehen und bespitzeln oder mit ihnen Handel treiben können, was fast aufs gleiche rausläuft). Sie werden regelmäßig untersucht, geprüft und eingeordnet. Manche kommen auf Sonderschulen, weil sie schwer dressierbar sind und keine Brillen mögen, trotz aller Anstrengungen der Eltern und Lehrer. Vielleicht sind sie auch krank oder mit einem Körperfehler zur Welt gekommen und passen deshalb nicht in die normalen Schulen.
Es gibt Volks-, Sonder-, Mittel- und Oberschulen. Da wird aussortiert und meist sind es die Kinder reicherer Eltern, die ihre Abschlussprüfung auf der Oberschule machen und dann zur Universität gehen.
Aus den Kindern werden Heranwachsende und die müssen sich dann ans Geldverdienen machen.
Eine Pyramide von Berufen und Tätigkeiten erwartet sie.
Ganz oben die Reichsten, die Brillenmacher. Dann die Kaufleute mit ihren fetten Bankkonten, die Reeder und Besitzer von Fabriken (wobei die Brillenmacher auch oft Besitzer von allerlei sind, was Geld einbringt), Eigentümer von Warenhäusern, Mietshäusern und noch vielem mehr. Ihr Geld legen sie bei den Banken an und deren Direktoren stehen auch ganz oben. Oder sie spekulieren damit an der Börse, gewinnträchtig, denn sie kennen sich aus oder kennen Leute, die ihnen gute Tipps geben können. Oder sie investieren: kaufen Neues, erweitern, treiben Handel über die Stadt hinaus.
Ganz unten die Arbeitslosen, die Ungelernten, die Alten, die in ihrem Leben auch schon unten oder vielleicht in der unteren Mitte waren und keine große Rente beziehen oder solche, die durch Spekulationen und Betrug, auf den sie hereingefallen waren, arm geworden sind. Die Irren, die Arbeitsunfähigen oder die, die keine Arbeit finden, die Mißgeborenen, die Blinden und Invaliden, auch viele Frauen, die ihre Kinder allein aufziehen müssen – all die – und so zahlreich sind sie – werden gedrückt und hinuntergepreßt in einen Sumpf, der sie Stück um Stück eingesaugt.
Die Arbeiter sind am oberen Rand dieser Basis, manche steigen auf zur Mitte, manche fallen hinab. Müssen in den Fabriken, Werften und anderswo die Dreckarbeit machen, alles Monotone, werden wie Menschenmaschinen gehandelt.
In der Mitte die kleinen Geschäfte, kleinen Gewerbetreibenden, Angestellten der Büros, die Fabriken und Geschäfte, alle, die Dienstleistungen erbringen in den vielen verschiedenen Einrichtungen und die mittleren Beamten der Stadtverwaltung. Darüber die höheren Angestellten, die höheren Beamten, dann Freischaffende, Ärzte, manche Künstler (die in Mode sind, andere kannst du auch ganz unten finden), gutbezahlte Journalisten, die den Ruhm der Brillenmacher zu pflegen wissen in Wort und Bild, Professoren und allerlei andere Spitzenverdiener.
Dann gibt es noch Gauner, kleine oder große Betrüger, Zuhälter und Verbrecherbosse, die viel Zaster und manchmal auch viel Macht haben, sich aber lieber unauffällig im Hintergrund halten und von dort aus ihre Machenschaften dirigieren.
In dieser Pyramide ist ein Gewimmel – der reinste Bienenstock. Es geht auf und ab wie in einem Paternoster, aber oben und ganz, ganz unten verändert sich nur wenig.
Vorbei die Kindheit. Keine Zeit mehr, in Muße zu leben, zu spielen, Streiche auszuhecken, vor sich hinzuträumen, im Zoo fremde Tiere zu bestaunen, ohne sich auch nur eine Minute zu langweilen, weil jeder Tag noch wie ein Wunder ist. Nun stehen sie da, diese Jugendlichen – oder besser gesagt, schwimmen in einem großen Kübel, werden über diese Pyramide ausgeschüttet und bleiben irgendwo hängen oder finden und finden keinen Platz. Die Eltern schieben und stoßen, drängeln und quetschen.
Mancher schafft es, das zu werden, was er möchte. Die meisten nicht. Viele werden das, was ihre Eltern von ihnen erwarten. Die Kinder von Reichen bekommen die guten Plätze, die anderen müssen eben sehen, wo sie bleiben, schließlich heißt es: "Bei uns kann jeder Brillenmacher werden!" – Was glatt gelogen ist.
Ein Hasten und Eilen, Gedrücktwerden oder Drücken durch den langen Gang der Jahre. Sie heiraten auf den Ämtern, bekommen Kinder in den Krankenhäusern oder liegen selbst dort, wenn ihr Körper streikt. Wählen ihren Oberbrillenmacher und seine Beisitzer und das Parlament aus Nicht-Brillenmachern, das sich in verschiedene Parteien aufteilt, die mit ihren unterschiedlichen Strategien und Meinungen, meist Vorurteilen, das Stadtvolk repräsentieren sollen. Da herrscht ein Gestreite und Geschreie – aber es läuft doch darauf hinaus, dass die Brillenmacher das Sagen haben.
Sie gehen in Kirchen oder Wirtshäuser, die Männer zu den Frauen im Vergnügungsviertel, die Frauen zu Ärzten oder Pfarrern. Reisen vom Bahnhof oder Flugplatz ab, aus Geschäftsgründen oder in den Urlaub oder auf Nimmerwiedersehen (was selten vorkommt). Sie fahren mit der U-Bahn von der Arbeit nach Haus’, von zuhause zur Arbeit und samstags mal zum Großeinkauf in die Stadt oder sonntags zum Ausflug in den Hafen.
Werden sie alt, ab in die Altenheime oder auf spezielle Krankenstationen – bis auf die Wenigen, die sich Besseres leisten können.
Werden sie unglücklich und kein Seelendoktor kann mehr helfen und sie reißen vielleicht sogar ihre Brillen runter, bleibt nur noch das Irrenhaus – weggeschlossen – ins Schauhaus.
Wollen sie nicht mehr oder können sie nicht mehr, sieht man sie als Pennbrüder und Pennschwestern herumschleichen. Oder sie werden Trinker oder Drogensüchtige, um nichts mehr sehen zu müssen und landen auch auf irgendwelchen Endstationen. Manche bringen sich auch um, weil sie keinen Ausweg mehr finden.
Werden sie Aufmucker, macht man ihnen das Leben schwer oder verschließt sie ins Gefängnis.
Zum Schluβ bleibt ihnen – je nach Kontostand des Verstorbenen oder seiner Familie – ein großes oder kleines Plätzchen auf dem Friedhof mit einem Marmorstein, auf dem ihr Name eingemeißelt ist, Geburts- und Todesdatum und oft ein sentimentaler Spruch aus ihren Kirchenbüchern.
Zu Lebzeiten redeten ununterbrochen Stimmen auf sie ein, was sie zu tun hätten. Aus den Pressehäusern die Zeitungsstimmen, aus den Funkhäusern die Unterhaltungs- und Politikerstimmen, aus dem Rathaus die "Du-sollst"-Stimme, aus den Kirchen Brillenmacher-Gottes Stimme. Aus den Bars des Weingeists Stimme, den Warenhäusern die "das-musst-du-haben"-Stimme, an den Arbeitsplätzen die "Tu das und nichts anderes"-Stimme, hinter den Bankschaltern die "Mehr-mehr"-Stimme, von ihren Eltern die "Fall bloss nicht auf"-Stimme und aus ihrer Wohnung die "Weiter hoch"-Stimme.
Ob sie wohl nun im Grabe endlich Frieden finden?
Fliros Bericht machte mir ganz schwarz vor Augen, aber ich dachte mit traumländischer Zärtlichkeit: ja, die Tagländer müssen ihre Träume wiederfinden, sonst ersticken sie noch an ihrer so gelobten Vernunft.
Ich schaute noch einmal auf die Stadt hinunter, ihr Muster aus grünen und bunten, steingrauen und schmutzigbraunen Flächen, den silbrig glitzernden Bändern der Strela, die feuchten Augen der Teiche und Becken, dem Punktegeschüttel von fahrenden Autos, Menschen, Lichtern, der Farbgirlande des Vergnüngungsviertels am Hafen, wo die Frauen zur Ware wurden, dem protzigen Blick-auf-Rathaus, schräg gegenüber vom Kontrollzentrum-Polizeihochhaus – nur durch ein paar Häuserblocks und Straßen getrennt – dem Bahnhof, ein Stück weiter und der Hauptpost mit ihrem Bauch voller Telegramme, Geschäftsbriefe, Grußkarten, Mitteilungen, Heirats- und Todesanzeigen, Liebesbriefe und Abschiedsbriefe und es blubberte darin von den vielen Telefonanrufen. Ich sah zum Zoo am Südtor hinüber mit seiner künstlichen Landschaft und den vielen Tieren in Käfigen, nicht anders als die Menschen in ihren Häusern.
Das Netzwerk der Straßen: Alleen, Prachtstraßen, Ringstraßen, Durchgangsstraßen, Chausseen, Spielwege, Geschäftsstraßen, Sackgassen; die dicke Ader der Hauptstraße, Nebenstraßen, Querstraßen, Gässchen, Zugangswege; miteinander verknotet durch große und kleine, runde oder viereckige Plätze. Die Nord-, Süd-, Ost- und Westautobahn mit wuchtigen Alleebäumen wies hinaus aus den Mauern. Der Hafen, die Blee und bis an die Nordautobahn das feine Viertel der Brillenmacher. Aber auf der anderen Seite der Nordautobahn, rundherum um die Stadt, bis zur Westautobahn, begrenzt von dem Grüngürtel dieser beiden Straßen und durchschnitten vom Grünstreifen entlang der Ost- und Südautobahn: um die Stadtmauer ein schmales Rund von Geröll und Steinhaufen, dann Niemandsland und danach eine endlos erscheinende Breite Abfall. Der Ring der Müllhalde – mit Bergen und Schluchten zerfetzter, verbeulter, vermoderter Dinge, aber auch Stummfilmszenerien wie in den Schaukästen der Museen: da ein halbes Wohnzimmer, dort ein Stück von einem Krankenzimmer. Papierreste wehten hoch, Möwen pickten in diesem Geschütter und flogen gellend wieder auf, Ratten wühlten im Brei von Unkenntlichem, ab und an ein Mensch, wie verloren in einem Albtraum, stolpernd und taumelnd. Fern am Horizont der mächtige Drahtzaun und nicht weit von der Straße nach Süden ein hohes Tor darin. Große Lastwagen der städtischen Müllabfuhr zogen an einem anderen Tor, fast gegenüber, aber in der Stadtmauer, ein und aus, fuhren auf Rampen in diese Schutt- und Schrottlandschaft, luden dampfende Ströme aus, schütteten neue Berge auf. Ich roch hochziehenden Gestank, hörte schleifendes Aufklatschen und metallisches Scheppern.
über der Stadt hing eine gelbgraue Dunstglocke. Ein ätzender Geruch hier oben und ich telepathierte Fliro: "Genug, genug! Ich kann nicht mehr!"
3
Kaum hatte ich Zeit, mit den Augen zu blinzeln, war ich auch schon wieder bei Bella: ihr letzter Tag in der Stadt.
Da ging sie nun durch das Menschengewimmel – ein Schieben und Stossen, Hasten und Rennen.
Bella schlenderte dahin, musste ausweichen, wurde angerempelt, war ein Hindernis in all diesem strömenden Gewühle. Manchmal trafen sie böse Blicke: "Bummlerin – Zeitverschwenderin" schienen sie zu sagen. Aber Bella hatte ihre verspiegelte Sonnenbrille auf, obwohl der Himmel trübgrau war. So konnte niemand ihre Augen sehen und sie fühlte sich unbeobachtet, verschanzt, sicherer vor argwöhnischen, höhnischen Augen.
Sie schaute vor sich hin und dachte: "Euer „Zeit ist Geld“! Wie ich das hasse! Es lebe das Faulenzen!" Und sie sah einem graumelierten Herrn mit Aktenkoffer verächtlich in die Brille. Aber der war schon wieder weiter und Bella fühlte sich nun auch nicht besser.
Ein dicker harter Kloß Unzufriedenheit und Hass saß in ihrer Kehle, die Brille drückte sie und schon wollte sie dieses elende Ding abnehmen, als ihr gerade noch rechtzeitig einfiel: "Vorsicht, wenn du erwischt wirst, gibt’s nur Schwierigkeiten!"