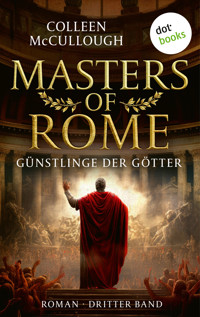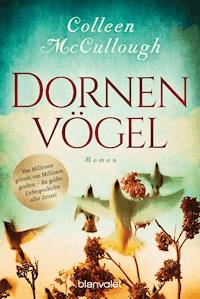Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal muss man fallen, bevor man fliegen kann … Sydney in den 1960er Jahren. Nach außen führt die junge Harriet als Tochter einer wohlhabenden Familie das perfekte Leben – doch insgeheim sehnt sie sich nach mehr als einer Zukunft als brave Ehefrau. Eines Tages wagt sie den Schritt ins Ungewisse: Sie lässt die Sicherheit ihres Elternhauses hinter sich und zieht in eine kleine Wohnung im Armenviertel der Stadt. Hier kämpft Harriet für ihr neues, selbstbestimmtes Leben und lernt auch nach und nach die Bewohner des Wohnhauses kennen – allen voran Flo, die kleine Tochter ihrer Vermieterin, die sie schon bald ins Herz schließt. Als ein schwerer Schicksalsschlag Flo in große Gefahr bringt, setzt Harriet alles daran, das Mädchen wiederzufinden – und muss dabei mehr Stärke beweisen, als jemals zu vor … »Große Erzählkunst, Mrs. McCullough!« Bild am Sonntag Von der Autorin des Bestsellers »Die Dornenvögel«: Ein ebenso gefühlvoller wie mitreißender Roman für die Fans von Katharina Fuchs oder »Die Wunderfrauen«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sydney in den 1960er Jahren. Nach außen führt die junge Harriet als Tochter einer wohlhabenden Familie das perfekte Leben – doch insgeheim sehnt sie sich nach mehr als einer Zukunft als brave Ehefrau. Eines Tages wagt sie den Schritt ins Ungewisse: Sie lässt die Sicherheit ihres Elternhauses hinter sich und zieht in eine kleine Wohnung im Armenviertel der Stadt. Hier kämpft Harriet für ihr neues, selbstbestimmtes Leben und lernt auch nach und nach die Bewohner des Wohnhauses kennen – allen voran Flo, die kleine Tochter ihrer Vermieterin, die sie schon bald ins Herz schließt. Als ein schwerer Schicksalsschlag Flo in große Gefahr bringt, setzt Harriet alles daran, das Mädchen wiederzufinden – und muss dabei mehr Stärke beweisen, als jemals zu vor …
Über die Autorin:
Colleen McCullough (1937-2015) wurde in Wellington geboren und wuchs in Sydney auf. Nach einem Studium der Neurologie arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern in Australien und England, bevor sie einige Jahre nach Amerika ging, um an der Yale University zu forschen und zu lehren. Hier entdeckte sie auch ihre Liebe zum Schreiben, wobei ihre ersten beiden Romane, »Tim» und »Die Dornenvögel«, direkt zu internationalen Bestsellern aufstiegen.
Colleen McCullough veröffentlichte bei dotbooks Ihre Romane »Die Frauen von Missalonghi« und »Die Stadt der Hoffnung«.
Außerdem erschien von der Autorin das mitreißende Historienepos »Masters of Rome« mit den Einzeltiteln »Adler des Imperiums«, »Die Krone der Republik«, »Günstlinge der Götter«, »Das Blut des Spartacus«, »Caesars Frauen«, »Tochter des Adlers« und »Die Wasser des Rubikon«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Die australische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »Angel Puss« bei HarperCollins Publishers, Sydney. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Haus der Träume« bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der australischen Originalausgabe 2004 by Colleen McCullough
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / Adriana, einem Motiv von © lindsaybridge / flickr sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-208-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Stadt der Hoffnung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Colleen McCullough
Die Stadt der Hoffnung
Roman
Aus dem Englischen von Elfriede Peschel
dotbooks.
Kapitel 1:Freitag, 1. Januar 1960 (Neujahrstag)
Wie zum Teufel könnte ich David nur loswerden? Natürlich hatte ich Mordgedanken gehegt, aber mit Mord käme ich genauso wenig durch wie mit dem Bikini, den ich mir von den fünf Pfund gekauft hatte, die Großmama mir zu Weihnachten geschenkt hatte.
»Bring ihn zurück, mein Mädchen, und kauf dir was Einteiliges mit einer anständigen Balkonverkleidung«, hatte Mama gesagt.
Wenn ich ehrlich bin, war ich beim Blick in den Spiegel selbst auch ein wenig entsetzt, wie viel dieser Bikini von mir zur Schau stellte, inklusive der schwarzen Schamhaar-Koteletten, die mir nie aufgefallen waren, wenn sie in einem züchtigen Badeanzug versteckt waren. Schon die bloße Vorstellung, mir eine Million Schamhaare auszuzupfen, ließ mich den Bikini gegen ein Esther-Williams- Modell in der aktuellsten Modefarbe umtauschen – American Beauty. Das war ein kräftiges, ins Rot spielende Pink. Die Verkäuferin meinte, ich sähe hinreißend darin aus, aber wen sollte ich wohl hinreißen, solange dieser verdammte David Murchison mich umkreiste wie ein Hund seinen Knochen? Bestimmt nicht den verfluchten David Murchison!
Es war an die vierzig Grad warm, also ging ich runter an den Strand, um den neuen Badeanzug einzuweihen. Die Brandung war sehr hoch, was für Bronte ziemlich untypisch ist, aber die Wellen sahen aus wie grüne Satinwürste-Brecherwellen, nicht geeignet fürs Bodysurfen. Ich breitete mein Laken auf dem Sand aus, schmierte mir Zinkcreme auf die Nase, setzte meine Badekappe – ebenfalls in der Farbe American Beauty – auf und rannte aufs Wasser zu.
»Viel zu heftig, um reinzugehen, du wirst reingezogen werden«, sagte eine Stimme hinter mir. David. Der verfluchte David Murchison. Wenn er jetzt noch anpreist, wie sicher dagegen der Kindertümpel ist, überlegte ich mich wappnend, dann wird es einen Kampf geben.
»Lass uns rüber zum Schlammloch gehen, da ist es sicher«, schlug er vor.
»Damit uns die Kinder dort mit ihren Schlammkugeln platt machen? Nein!«, knurrte ich und nahm den Kampf auf. Wobei »Kampf« nicht das richtige Wort ist. Ich schrie und führte mich gewöhnlich auf, während David sich mit überlegener Miene weigerte anzubeißen. Aber im heutigen Kampf würde ich eine neue Bombe zum Platzen bringen – endlich wäre ich geistesgegenwärtig genug, ihn darüber zu informieren, dass ich es leid war, Jungfrau zu sein.
»Lass uns eine Affäre haben«, sagte ich.
»Sei doch nicht doof«, entgegnete er gelassen.
»Ich bin nicht doof! Jeder, den ich kenne, hat schon mal was gehabt, nur ich nicht! Verdammt noch mal, David, ich bin einundzwanzig und mit einem Kerl verlobt, der beim Küssen noch nicht mal den Mund öffnet!«
Er tätschelte mir sanft die Schulter und setzte sich auf sein Handtuch. »Harriet«, verkündete er mit seiner hochnäsigen, supervornehmen, für die Jungs aus dem katholischen College typischen Stimme, »es ist an der Zeit, einen Hochzeitstermin ins Auge zu fassen. Ich habe meinen Doktortitel, die C.S.LR.O. hat mir mein eigenes Labor und ein Forschungsstipendium zugesagt, wir gehen seit nunmehr vier Jahren miteinander und sind seit einem Jahr verlobt. Affären sind eine Sünde. Die Ehe nicht.«
Grrr!
»Mama, ich möchte meine Verlobung mit David auflösen!«, sagte ich zu ihr, als ich vom Strand nach Hause kam, der neue Badeanzug noch ungetauft.
»Dann sag ihm das, meine Liebe«, erwiderte sie.
»Hast du jemals versucht, David Murchison zu verklickern, dass du ihn nicht mehr heiraten willst?«, fragte ich sie.
Mama kicherte. »Nein, habe ich nicht. Ich bin bereits verheiratet.«
Oh, wie ich es hasse, wenn Mama auf meine Kosten lustig ist!
Aber ich gab nicht auf. »Das Problem ist, ich war erst sechzehn, als ich ihn kennen lernte, siebzehn, als er anfing mit mir auszugehen, damals war es klasse, einen Freund zu haben, den ich nicht ständig abwimmeln musste. Aber Mama, er ist so – so prüde! Jetzt, da ich volljährig bin, behandelt er mich nicht anders als damals mit siebzehn! Ich fühle mich wie eine im Bernstein gefangene Fliege.«
Mama ist ein guter Kumpel und kam mir deshalb auch nicht mit einer Moralpredigt, ein wenig besorgt wirkte sie aber doch.
»Wenn du ihn nicht heiraten willst, Harriet, dann lass es sein. Aber er ist eine sehr gute Partie, meine Liebe. Gutaussehend, gut gebaut – und dann noch mit einer glänzenden Zukunft! Überleg doch mal, was aus all deinen Freundinnen geworden ist, vor allem aus Merle. Die lassen sich mit Jungs ein, die noch nicht reif und vernünftig sind wie David, und leiden dann darunter. Da kommt nichts dabei raus. David hängt wie eine Klette an dir, daran wird sich nichts ändern.«
»Ich weiß«, sagte ich zähneknirschend. »Merle macht mir wegen David ständig Vorwürfe – er sei göttlich, ich wisse mein Glück gar nicht zu schätzen. Aber er geht mir derart auf den Wecker! Ich gehe schon so lange mit ihm, dass alle anderen Männer, die ich kenne, glauben, ich sei bereits vergeben – nie werde ich Gelegenheit haben herauszufinden, wie der Rest der Männerwelt ist, so ein Mist!«
Aber sie hörte gar nicht richtig hin. David hat Mamas und Papas ganze Zustimmung immer schon gehabt. Wenn ich vielleicht eine Schwester hätte, oder altersmäßig näher an meinen Brüdern dran wäre – es ist hart, ein Unfall und dann auch noch vom falschen Geschlecht zu sein! Außer mir sind da noch Gavin und Peter, beide Mitte dreißig, die noch immer zu Hause wohnen und scharenweise Frauen im Kofferraum ihres Kleinlasters auf einer Gummimatratze flachlegen, gemeinsam mit Papa den Sportartikelladen schmeißen und in ihrer Freizeit Kricket spielen – so sieht das typische Leben von Riley aus! Ich jedoch teile mir ein Zimmer mit Großmama, die in einen Nachttopf pisst, den sie dann im Hinterhof übers Gras kippt. Stinkt wie verrückt.
»Du kannst dich glücklich schätzen, Roger, dass ich ihn nicht über der Wäsche von nebenan ausgieße«, lautet ihre lakonische Antwort, wenn Papa ihr Vorhaltungen macht.
Was für eine gute Idee doch dieses Tagebuch ist! Ich habe genügend verrückte und wunderbare Psychiater kennen gelernt, um zu wissen, dass ich jetzt über ein »Medium verfüge, das es mir erlaubt, Frustrationen und Repressionen abzureagieren«. Der Vorschlag war von Merle gekommen – ich vermute ja, dass sie bei ihren Besuchen gerne einen Blick reinwerfen würde, aber sie hat keine Chance. Ich habe vor, es unter Großmamas Bett hinter der Fußleiste direkt hinter dem Pott zu verstauen.
Was ich mir heute wünsche: Keinen David Murchison mehr. Keinen Pott mehr. Keine Currywürste mehr. Ein Zimmer für mich allein. Einen Verlobungsring, damit ich ihn David ins Gesicht schleudern kann. Er meinte, ein Verlobungsring sei Geldverschwendung. So ein Knauser!
Kapitel 2:Samstag, 2. Januar 1960
Ich habe den Job bekommen! Nachdem ich letztes Jahr an der Sydney Tech meinen Abschluss gemacht hatte, bewarb ich mich in der Röntgenabteilung des Royal Queens Hospitals für eine Stelle als Röntgenassistentin, und heute brachte mir der Briefträger den Brief mit der Zusage! Gleich am Montag werde ich im größten Krankenhaus der südlichen Hemisphäre – mehr als tausend Betten! – als Röntgenassistentin anfangen. Das lässt das Ryde Hospital, meine alte Alma Mater, wie ein Dingi neben der Queen Elizabeth aussehen. Nach meinem jetzigen Erfahrungshorizont hätte ich meine Ausbildung niemals am Ryde Hospital machen sollen, aber damals, als David es vorschlug, hielt ich es für eine ausgezeichnete Idee. Sein älterer Bruder, Ned, war dort Krankenhausarzt – ein einflussreicher Freund. Pah! Er führte sich als Wachhund auf. Jedes Mal, wenn mir ein männliches Wesen einladende Blicke zuwarf, war dieser verdammte Ned Murchison schon zur Stelle – ich sei die Freundin seines Bruders, also kein Wildern im fremden Revier! Anfangs machte mir das nichts aus, aber als ich meiner Teenagerunsicherheit entwuchs, meine Bescheidenheit ablegte und mir gelegentlich vorstellte, dass es Spaß machen könnte, mit dem einen oder anderen auszugehen, erwies er sich als gewaltiger Hemmschuh.
Einen Vorteil hatte die Ausbildung am Ryde jedoch. Man braucht von Bronte aus zwei Stunden, um mit dem öffentlichen Nahverkehr dort hinzukommen, und das Lernen während der Fahrt übertrifft jeden Versuch, im purcellschen Anwesen zwischen Großmama und Mama, die vor dem Fernseher sitzen, und den Männern, die sich jeden Abend ums Geschirrspülen reißen, um nebenbei Seemannsgarn über Kricket, Kricket, Kricket zu spinnen, etwas zu lernen. Clint Walker und Efrem Zimbalist Junior im Wohnzimmer, Keith Miller und Don Bradman in der Küche, und keine Türen zwischen all dem, der einzige Platz zum Lernen: der Esszimmertisch. Da ist die tägliche Bus- oder Zugfahrt doch wesentlich besser. Und was kam dabei raus? Ich habe alle übertroffen! Die bestmöglichen Noten. Deshalb habe ich auch die Stelle im Royal Queens bekommen. Als ich die Ergebnisse hatte, meckerten Mama und Papa ein wenig, weil ich mich nach meinem Abschluss an der Randwick Highschool geweigert hatte, auf die Uni zu gehen und dort einen Abschluss in Naturwissenschaften oder Medizin zu machen. Doch ich nehme an, dass mein hervorragender Abschluss als Röntgenassistentin dann doch meinen mangelnden Ehrgeiz wettmachte. Wer möchte schon an die Uni und sich dort all den Fallstricken und Giftpfeilen der Männer aussetzen, die keine Frauen in Männerberufen haben wollen? Ich jedenfalls nicht!
Kapitel 3:Montag, 4. Januar 1960
Heute Morgen habe ich meine Stelle angetreten. Neun Uhr. Das Royal Queens liegt so viel näher an Bronte als das Ryde! Wenn ich die letzten beiden Kilometer laufe, dauert meine Busfahrt nur zwanzig Minuten.
Da ich mich an der Fachhochschule eingeschrieben hatte, war ich hier noch nie gewesen, nur ein paar Mal vorbeigekommen, wenn wir gelegentlich zu Besuch oder wegen eines Picknicks Richtung Süden fuhren. Was für ein Ort! Das Krankenhaus hat seine eigenen Läden, Banken, Postamt, Energieversorgung, eine Wäscherei, die so groß ist, dass sie auch noch Aufträge von Hotels übernehmen kann, Werkstätten, Lagerhallen – mit einem Wort: Royal Queens hat es! Ich spreche von einem Labyrinth! Fünfzehn Minuten habe ich gebraucht, um schnellen Schritts vom Haupteingang zur Röntgenabteilung zu kommen, vorbei an fast jeglicher Form von Architektur, die Sydney in den letzten hundert Jahren hervorgebracht haben dürfte. Innenhöfe, Rampen, von Säulen gesäumte Veranden, Sandsteinbauten, rote Klinkerbauten, jede Menge dieser grässlichen neuen Gebäude mit ihren Glasfronten – drückend heiß, wenn man da drin arbeitet!
Gemessen an den Leuten, die mir begegnet sind, müssen es zehntausend Angestellte sein. Die Schwestern sind in so viele Stärkelagen gehüllt, dass sie wie grünweiße Pakete aussehen. Die armen Dinger müssen dicke braune Baumwollstrümpfe und flache braune Schnürschuhe tragen! Selbst Marilyn Monroe hätte Probleme, in blickdichten Strümpfen und Schnürtretern verführerisch zu wirken. Ihre Hauben erinnern an zwei ineinander verschlungene weiße Tauben, und die wadenlange Tracht hat Manschetten und Kragen aus Zelluloid. Die staatlich geprüften Krankenschwestern sehen genauso aus, nur dass sie keine Schürzen und anstatt der Hauben ägyptische Schleier auf dem Kopf tragen und Nylonstrümpfe anhaben – ihre Schnürschuhe haben fünf Zentimeter hohe Blockabsätze.
Nun, ich habe immer schon gewusst, dass ich für all diese reglementierte, hirnlose Disziplin nicht geschaffen bin, genauso wenig wie dafür, mich an der Uni von männlichen Studenten schikanieren zu lassen, die ihre männliche Domäne verteidigen. Wir Fachkräfte müssen nur weiße vorn geknöpfte Kittel tragen (Saum unterm Knie), dazu Nylonstrümpfe und Mokassins.
Physiotherapeuten scheint es hier an die hundert zu geben – ich hasse Physios! Ich meine, was sind Physios denn anderes als verherrlichte Masseusen? Aber Junge, Junge, die bilden sich was ein! Die stärken sich ihre Uniformen sogar freiwillig! Und sie tragen ständig diese übereifrige, vergnügte Cheerleaderüberheblichkeit zur Schau, wenn sie flott wie Armeeoffiziere daherkommen und bei Ausrufen wie »Na prima!« und »Oh, super!« ihre Pferdegebisse entblößen.
Zum Glück war ich zeitig genug von zu Hause aufgebrochen, um trotz des fünfzehnminütigen Fußmarsches noch rechtzeitig in Schwester Toppinghams Büro zu erscheinen. Was für eine Tyrannin! Pappy sagt, jeder nenne sie Schwester Agatha, also mache ich das auch – hinter ihrem Rücken. Sie ist an die tausend Jahre alt und war früher Krankenschwester – sie trägt auch noch immer den gestärkten ägyptischen Schleier einer staatlich geprüften Krankenschwester. Ihre Figur ist birnenförmig, passend zu ihrer Aussprache. Schröcklich-schröcklich. Mit ihren hellblauen Augen, kalt wie ein frostiger Morgen, sah sie durch mich hindurch, als wäre ich ein Schmierfleck auf der Fensterscheibe.
»Anfängen werden Sie bei den Brustkörben, Miss Purcell. Zum Einstieg hübsche, einfache Lungen, verstehen Sie? Ich halte es für richtig, dass alle Neueinstellungen in ihrer Orientierungsphase etwas Einfaches machen. Später werden wir dann sehen, was Sie tatsächlich tun können, ja? Also gut. Also gut!«
Mannomann, was für eine Herausforderung! Brustkörbe. Drück sie an eine aufrechte Platte und lass sie die Luft anhalten. Als Schwester Agatha Brustkörbe sagte, meinte sie damit die üblichen Thoraxdurchleuchtungen – von den nichtstationären Patienten, nicht die ernsten Fälle. Drei von uns, ich und zwei Auszubildende, sind mit diesen Routineuntersuchungen befasst. Aber die Dunkelkammern werden ständig in Beschlag genommen – wir müssen unsere Kassetten deshalb in Höchstgeschwindigkeit entwickeln, das heißt, jeder der länger als neun Minuten braucht, bekommt einen Anschiss.
Wir haben hier eine reine Frauenabteilung, was mich erstaunt. Sehr selten! Röntgenassistenten werden nach Männertarif bezahlt, und das bedeutet, dass sich in diesem Beruf viele Männer tummeln – am Ryde Hospital waren fast alle Männer. Dass es am Queens anders aussieht, dürfte an Schwester Agatha liegen, und deshalb kann sie so übel nicht sein.
Der Schwesternhelferin bin ich in den trübseligen Räumlichkeiten begegnet, die unsere Spinde und Toiletten beherbergen. Sie war mir auf den ersten Blick sympathisch, und das weit mehr als jede der technischen Assistentinnen, die mir heute begegnet sind. Meine beiden Lehrlinge sind nette Mädchen, aber beide im ersten Ausbildungsjahr und somit ein bisschen langweilig. Während Schwesternhelferin Papele Sutama interessant ist. Ihr Name ist sonderbar – aber das ist seine Besitzerin auch. Ihre Augen haben zwar Oberlider, aber das Erscheinungsbild ist doch entschieden chinesisch, wie ich bei unserer ersten Begegnung fand. Nicht japanisch, dazu sind ihre Beine zu wohlgeformt und gerade. Den chinesischen Einschlag bestätigte sie mir später. Oh, sie ist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe! Ein Mund wie eine Rosenknospe, Wangenknochen, für die man sterben möchte, fedrige Augenbrauen. Man nennt sie Pappy, und das passt zu ihr. Ein winziges kleines Ding, etwa eins fünfundfünfzig groß und sehr zierlich, ohne dabei auszusehen, als wäre sie einer jener Fälle von Anorexia nervosa, die mir die Psychiatrie immer zur Routinedurchleuchtung schickt – warum um Himmels willen hungern Teenager sich zu Tode? Aber zurück zu Pappy, ihre Haut ist wie elfenbeinfarbene Seide.
Pappy mochte mich auch auf Anhieb, und als sie mitbekam, dass ich mir von zu Hause eine Brotzeit mitgebracht hatte, lud sie mich ein, diese mit ihr auf der Wiese vor der Leichenhalle zu verspeisen, nicht weit entfernt von der Röntgenabteilung, aber so, dass Schwester Agatha uns auf ihrem Rundgang durch die Abteilung nicht entdecken konnte. Schwester Agatha macht keine Mittagspause, sie ist zu sehr damit beschäftigt, ihr Imperium zu überwachen. Natürlich bekommen wir nicht die ganze Stunde, die uns zusteht, vor allem nicht montags, wenn die ganzen Routinefälle vom Wochenende zwischen den normalen Untersuchungen eingeschoben werden müssen. Aber Pappy und ich schafften es, auch in gerade mal dreißig Minuten jede Menge voneinander in Erfahrung zu bringen.
Als Erstes erzählte sie mir, dass sie am Kings Cross wohnt. Puh! Das ist der Teil von Sydney, der von Papa zur Sperrzone erklärt wurde – eine Höhle der Niedertracht, meint Großmama. Voller Laster. Ich weiß zwar nicht, was Laster sind, abgesehen von Alkoholismus und Prostitution. Am Kings Cross gibt es von beidem mehr als genug, geht man danach, was Reverend Alan Walker zu sagen hat. Aber der ist ein Methodist – ein ganz aufrechter. Kings Cross ist dort, wo Rosaleen Norton, die Hexe, lebt – sie ist wegen ihrer obszönen Bilder ständig in den Nachrichten. Was ist ein obszönes Bild – kopulierende Menschen? Ich fragte Pappy, aber sie meinte dazu nur, dass die Obszönität im Auge des Betrachters liege. Pappy ist sehr tiefgründig, sie liest Schopenhauer, Jung, Bertrand Russell und andere Gelehrte, von Freud halte sie jedoch nicht viel, wie sie mir erklärte. Ich wollte wissen, weshalb sie nicht auf der Universität von Sydney sei, und sie erwiderte, sie habe nicht viel formelle Schulbildung erhalten. Ihre Mutter war Australierin, ihr Vater Chinese aus Singapur, und die beiden hatten sich im Zweiten Weltkrieg kennen gelernt. Ihr Vater starb, ihre Mutter wurde nach vier Jahren im Gefangenenlager Changi verrückt – was für ein tragisches Leben manche Menschen haben! Ganz im Gegensatz zu mir, deren einzige Klagepunkte David und der Nachtpott sind. In Bronte geboren und aufgewachsen.
Pappy meint, David sei ein einziges Bündel an Verdrängung, was in seiner katholischen Herkunft begründet liegt – sie hat sogar einen Namen für die Davids dieser Welt: »An Verstopfung leidende katholische Schulknaben«. Aber ich wollte gar nicht über ihn reden, ich wollte wissen, wie das Leben am Kings Cross ist. Wie überall anders auch, sagt sie. Aber das nehme ich ihr nicht ab, dazu ist es zu berüchtigt. Ich sterbe vor Neugier!
Kapitel 4:Mittwoch, 6. Januar 1960
Schon wieder David. Warum bekommt er es nicht in seinen Kopf, dass jemand, der in einem Krankenhaus arbeitet, keinen schwülstigen Continental-Schinken im Kino sehen möchte? Für ihn mag das ja alles schön und gut sein, da oben in seiner sterilen kleinen Laborwelt, wo das Aufregendste, was je passiert, eine blöde Maus ist, der ein blöder Knoten wächst, aber ich arbeite an einem jener Orte, wo die Menschen Schmerzen erleiden und manchmal sogar sterben! Ich bin von grausamer Realität umgeben – ich weine genug, ich bin niedergeschlagen genug! Wenn ich also ins Kino gehe, möchte ich lachen oder wenigstens richtig schön schluchzen, wenn Deborah Kerr die Liebe ihres Lebens aufgibt, weil sie im Rollstuhl sitzt. Während die Filme, die David mag, so deprimierend sind. Nicht traurig, einfach nur deprimierend.
Genau das versuchte ich ihm zu erklären, als er mit mir zum Savoy Theatre unterwegs war, wo wir uns den neuen Film anschauen wollten. Aber das Wort, das ich benutzte, war nicht deprimierend, sondern erbärmlich.
»Große Literatur und große Filme sind nicht erbärmlich«, erwiderte er.
Ich machte ihm den Vorschlag, doch in aller Ruhe seine Seele im Savoy zu peinigen, während ich ins Prince Edward ging, um mir einen Western anzuschauen, aber er kriegt sofort diesen Gesichtsausdruck, der, wie lange Erfahrung mich gelehrt hat, einer Lektion vorausgeht, die eine Mischung zwischen Predigt und Tirade ist, also gab ich nach und ging mit ihm ins Savoy, um dort Gervaise anzuschauen – nach Zola, wie David mir erklärte, als wir aus dem Kino kamen. Ich fühlte mich wie ein ausgewrungener Wischlappen, was aber wirklich ein schlechter Vergleich ist. Es spielte alles in der viktorianischen Version einer riesigen Wäscherei. Die Heldin war so jung und hübsch, aber es gab nicht einen Mann, der eine beifällige Betrachtung verdient hätte – sie waren fett und kahl. Ich glaube, David wird auch mit einer Glatze enden, sein Haar ist nicht mehr so dicht wie es war, als ich ihn kennen lernte.
David bestand darauf, mit dem Taxi nach Hause zu fahren, obwohl ich viel lieber flott am Kai entlang gegangen wäre und den Bus genommen hätte. Jedes Mal lässt er das Taxi vor unser Haus fahren, begleitet mich dann über den Seitengang hinein, wo er mir im Dunkeln seine Hände auf die Taille legt und drei so keusche Küsse auf meine Lippen schmatzt, dass der Papst es nicht für sündig hielte, sie ihm zu gewähren. Danach wartet er, bis ich sicher durch die Hintertür bin, und geht dann die vier Häuserblocks weit zu seinem Haus. Er lebt bei seiner verwitweten Mutter, obwohl er einen geräumigen Bungalow am Coogee Beach gekauft hat, den er aber an eine Familie von Neu-Australiern aus Holland vermietet hat – sehr sauber, die Holländer, erklärte er mir. Oh, hat dieser David denn überhaupt kein Blut in den Adern? Niemals hat er auch nur einen Finger, geschweige denn eine Hand auf meine Brüste gelegt. Wozu habe ich sie denn?
Meine großen Brüder waren im Haus und machten sich, während sie Tee kochten, über die Vorgänge im Seitengang lustig.
Was ich mir wünsche: Dass es mir gelingt, in meinem Job fünfzehn Pfund pro Woche zu sparen, so dass ich Anfang 1961 genügend gespart habe, um einen zweijährigen Arbeitsurlaub in England zu machen. Dann werde ich David loswerden, der unmöglich seine verdammten Mäuse allein lassen kann, für den Fall, dass einer davon ein blöder Knoten wächst.
Kapitel 5:Donnerstag, 7. Januar 1960
Meine Neugier auf Kings Cross wird am Samstag befriedigt werden, dann werde ich bei Pappy zu Abend essen. Ich werde jedoch Mama und Papa gegenüber die genauere Adresse von Pappys Behausung verschweigen. Ich werde nur sagen, dass sie am Rand von Paddington wohnt.
Was ich mir wünsche: Dass Kings Cross keine Enttäuschung wird.
Kapitel 6:Freitag, 8. Januar 1960
Gestern Abend gab es eine kleine Krise wegen Willie. Typisch Mama, dass sie darauf beharrt hat, dieses Kakadubaby von der Mudgee Road aufzulesen und aufzuziehen. Willie war so dürr und elend, dass Mama begann, ihn mit einem Tropfen warmer Milch aufzupäppeln, in den sie einen Schuss Dreistern-Weinbrand tat, den wir für Großmamas komische kleine Anfälle bereithalten. Weil sein Schnabel nicht hart genug war, um die Samenkörner zu knacken, ging sie dann zu Porridge über, wieder mit einem Schuss Weinbrand. So wuchs Willie zu einem hinreißenden dicken weißen Vogel mit gelbem Kamm und einer mit getrocknetem Porridge bekleckerten Brust heran. Mama hat ihm seine Porridge- Weinbrand-Mischung immer im letzten der noch verbliebenen Häschenteller serviert, die ich als Kind hatte. Aber gestern ging ihr der Häschenteller kaputt und sie stellte ihm sein Fressen stattdessen in einem widerlichen grünen Teller hin. Willie warf einen Blick darauf, verteilte sein verschmähtes Essen in der Gegend und drehte durch – kreischte das hohe C ohne Unterlass, bis sämtliche Hunde in Bronte jaulten und Papa Besuch von den Jungs in Blau bekam, die mit der grünen Minna anrollten.
Ich wage zu behaupten, dass jahrelange Krimilektüre meine Kombinationsgabe geschärft hat, denn nach einer fürchterlichen Nacht mit einem kreischenden Papagei und tausend jaulenden Hunden sind mir zwei Dinge klar geworden. Erstens, Papageien sind intelligent genug, um einen Teller mit gewieften kleinen, am Rand entlangjagenden Häschen von einem Teller in schauderhaftem Grün zu unterscheiden. Zweitens, Willie ist Alkoholiker. Als er den falschen Teller sah, schloss er, dass man ihm seine Porridge-Weinbrand-Mahlzeit verweigerte, und verweigerte sich daraufhin selbst – deshalb der Krawall.
Der Friede wurde aber schließlich in Bronte wiederhergestellt, als ich am Nachmittag von der Arbeit nach Hause kam. Ich hatte mich mittags ins Taxi gesetzt und war in die Stadt gehetzt, um einen neuen Häschenteller zu kaufen. Eine Tasse musste ich gleich mit dazu kaufen – zwei Pfund zehn! Aber Gavin und Peter sind gute Kumpel, obwohl sie meine großen Brüder sind. Sie spendeten jeder ein Drittel dieser zweieinhalb Pfund, und so wurde mein Geldbeutel nicht ganz so strapaziert. Doof, oder? Aber Mama liebt diesen verrückten Vogel so sehr.
Kapitel 7:Samstag, 9. Januar 1960
Kings Cross war keinesfalls eine Enttäuschung. Ich stieg an der Haltestelle vor dem Taylor Square aus dem Bus und ging den Rest des Wegs zu Fuß, wobei ich mich an Pappys Wegbeschreibung hielt. Offenbar isst man am Kings Cross nicht besonders zeitig zu Abend, denn ich sollte erst um acht Uhr auftauchen, und so war es schon ziemlich dunkel, als ich aus dem Bus stieg. Als ich dann am Vinnie’s Hospital vorbeikam, fing es zu regnen an – nur ein Nieseln, nichts was mein pinkfarbener Rüschenschirm nicht abhalten konnte. Als ich die riesige Kreuzung erreichte, die meines Wissens das eigentliche Kings Cross darstellt, war dies zu Fuß bei nassen Straßen und den blendenden Neonlichtern und Autoscheinwerfern, die sich gebrochen im Wasser spiegelten, ein gänzlich anderer Anblick, als wenn man mit einem Taxi darüber hinweg sauste. Es ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie die Geschäftsinhaber die Ladenschlussgesetze von Sydney umgehen, denn selbst an einem Samstagabend haben sie geöffnet. Ein wenig enttäuscht war ich, als ich entdeckte, dass mich meine Route nicht entlang der Geschäfte an der Darlinghurst Road führte – ich musste die Victoria Street hinuntergehen, an der DAS HAUS lag. So nennt Pappy es nämlich. »DAS HAUS«, und zwar mit Großbuchstaben. Als wäre es eine Institution. Und ich muss zugeben, dass ich zielstrebig an den Mietshäusern der Victoria Street vorbeiwanderte.
Für die alten viktorianischen Mietshäuser, welche das Innenstadtbild von Sydney prägen, kann ich mich immer wieder begeistern – obwohl sie heutzutage nicht mehr gut in Stand gehalten sind. All das hübsche Gusseisengitterwerk hat man abmontiert und durch Fiberglasplatten ersetzt, um aus den Balkonen zusätzliche Räume zu gewinnen, und die stuckierten Mauern sind schmuddelig. Aber auch so sind sie sehr geheimnisvoll. Die Fenster sind mit Manchester-Spitzenvorhängen und Packpapierrollos verhängt und sehen aus wie geschlossene Augen. Sie haben so viel gesehen. Unser Haus in Bronte ist erst zweiundzwanzig Jahre alt, Papa hat es gebaut, als die schlimmste Phase der Depression vorbei war und sein Laden langsam was abwarf. Außer uns ist nichts darin passiert, und wir sind langweilig. Unsere größte Krise war die mit Willies Teller – jedenfalls war dies das einzige Mal, dass die Polizei bei uns auftauchte.
DAS HAUS lag im hinteren Teil der Victoria Street, und auf meinem Weg fiel mir auf, dass hier noch einige der Häuser ihre Gusseisenverzierungen behalten hatten, frisch gestrichen und gut erhalten waren. Ganz am Ende, hinter der Challis Avenue, weitete sich die Straße zu einem halbkreisförmigen Wendekreis. Offenbar war der Stadtverwaltung hier der Teer ausgegangen, denn die Straße war mit kleinen Holzblöcken gepflastert, und mir fiel auf, dass im Wendekreis keine Autos parkten. Dadurch wirkte der Halbmond mit den fünf Mietshäusern wie aus einer anderen Zeit. Sie hatten alle die Nummer 17 – 17a, b, c, d und e. Das in der Mitte, 17 c, war DAS HAUS. Seine fabelhafte Eingangstüre war aus rubinrotem Glas, in das ein Lilienmuster bis auf die durchsichtige Glasfläche darunter geätzt war, dank der Innenbeleuchtung glitzerten die Kanten bernsteinfarben und violett. Die Tür war nicht abgeschlossen, also stieß ich sie auf.
Aber die Märchentür führte in eine Wüste. Ein schmuddeliger Flur in schmutzigem Cremeton, eine rote Zederntreppe, die nach oben führte, ein paar mit Fliegendreck gesprenkelte nackte Glühbirnen an langen, verdrehten braunen Kabeln, fürchterlich altes braunes Linoleum mit Pfennigabsatzmuster. Von den Scheuerleisten bis zu einer Höhe von etwa einem Meter dreißig war jedes Stückchen Wand, das ich sehen konnte, von Gekritzel bedeckt, ziellosen Bögen und Wirbeln in den verschiedensten Farben, wächsern wie von Malkreide.
»Hallo!«, rief ich.
Hinter der Treppe tauchte Pappy auf und lächelte einladend. Ich glaube, ich starrte sie ziemlich unverschämt an, sie sah so anders aus. Anstatt ihrer wenig schmeichelhaften malvenfarbenen Uniform und der Kappe, unter der sich das Haar verbarg, trug sie ein hautenges Schlauchkleid aus pfauenblauem Satin, bestickt mit Drachen, und über dem linken Bein so hoch geschlitzt, dass ich ihren Strumpfsaum und einen rüschenbesetzten Spitzenstrumpfhalter sehen konnte. Ihr Haar ergoss sich in einer üppigen, glatten, glänzenden Masse über ihren Rücken – warum habe ich nicht solche Haare? Meins ist genauso schwarz, aber es ist so stark gelockt, dass es, würde ich es lang wachsen lassen, wie ein Besen bei einem epileptischen Anfall abstehen würde. Deshalb stutze ich es mit einer Schere immer ziemlich kurz.
Sie führte mich durch die Tür am Ende des Durchgangs neben der Treppe, und wir tauchten in einen weiteren, weitaus kürzeren Flur ein, der seitwärts abbog und im Freien zu enden schien. Er hatte nur eine Tür, und diese öffnete Pappy.
Es war, als betrete man eine Traumlandschaft. Der Raum war so vollgestopft mit Büchern, dass man keine Wände mehr sah, nur Bücher, Bücher, Bücher, vom Fußboden bis zur Decke, und dann noch stapelweise herumliegende Bücher, die sie vermutlich von den Stühlen und dem Tisch heruntergeräumt hatte, um mich empfangen zu können. Im Verlauf des Abends versuchte ich sie zu zählen, aber es waren zu viele. Ihre Lampensammlung warf mich um, eine fantastischer als die andere. Zwei Libellen aus Buntglas, eine beleuchtete Weltkugel auf einem Ständer, elektrifizierte Kerosinlampen aus Indonesien, eine Lampe, die wie ein zwei Meter hoher weißer Kamin aussah, überzogen mit geschlitzten violetten Ausbuchtungen. Die Deckenlampe war ein chinesischer Papierlampion mit seidenen Quasten.
Pappy machte sich wieder an die Zubereitung des Essens, das überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Katzenfraß von Hoo Flung oben an der Bronte Road hatte. Meine von Ingwer und Knoblauch gekitzelte Zunge verführte mich dazu, dass ich mir drei Mal Nachschlag holte. Mit meinem Appetit ist alles in Ordnung, aber es will mir nicht gelingen, genügend zuzunehmen, um von Cup B in einen Cup-C-BH zu wachsen. Zu doof. Jane Russell füllt einen ausgewachsenen D-Cup, aber bei Jayne Mansfield finde ich, dass sie nur einen B-Cup auf einem riesigen Brustkorb herumträgt.
Als wir zu Ende gegessen und eine Kanne duftenden grünen Tee getrunken hatten, verkündete Pappy, es sei an der Zeit, nach oben zu gehen und Mrs Delvecchio Schwartz kennen zu lernen. Die Vermieterin.
Als ich bemerkte, dass dies ein eigenartiger Name sei, grinste Pappy. Sie geleitete mich zurück zum vorderen Flur und über die rote Zederntreppe nach oben. Als ich ihr voller Neugier folgte, fiel mir auf, dass das Kreidegekritzel kein Ende nahm. Im Gegenteil, es nahm noch zu. Die Treppe führte hoch in den ersten Stock, dann gingen wir weiter, bis wir einen riesigen Raum im vorderen Teil des Hauses erreichten, und Pappy schubste mich hinein. Suchte man nach einem Raum, der das genaue Gegenteil von Pappys Zimmer war, dann war es dieser. Kahl. Bis auf das Gekritzel, das hier so dicht war, dass für mehr kein Fitzelchen Platz wäre. Wohl aus diesem Grund war ein Abschnitt grob überstrichen worden, offenbar um den Künstler mit frischem Malgrund zu versorgen, denn ein paar Schnörkel schmücken ihn bereits. Man hätte in diesem Raum sechs Wohnzimmergarnituren und einen Esstisch für zwölf Personen untergebracht, aber er stand fast leer. Ein Küchentisch mit verrostetem Chromgestell und einer roten Resopalplatte, vier rostige Stühle, deren Sitzpolsterung aus dem roten Plastik hervorquoll wie Eiter aus einem Karbunkel, eine Samtcouch, die an einem schlimmen Anfall von Alopezie litt, und eine ganz moderne Kühl/Gefrierschrankkombination. Ein Paar Glastüren führten hinaus auf den Balkon.
»Hier draußen, Pappy!«, rief jemand.
Wir traten hinaus auf den Balkon, wo zwei Frauen standen. Diejenige, die ich zuerst sah, kam ganz eindeutig aus einem der östlichen Vororte von Harbourside oder von der oberen Nordküste – blau gefärbtes Haar, ein Kleid Pariser Mode, passende Schuhe, Tasche und Handtasche in burgunderfarbenem Ziegenleder, und ein winziges Hütchen, das sehr viel schicker war als alles, was Queen Elizabeth normalerweise trug. Dann trat Mrs Delvecchio Schwartz nach vorne, und ich vergaß sämtliche Modepüppchen mittleren Alters.
Mann! Was für ein Berg von einer Frau! Nicht dass sie fett gewesen wäre, sie war vielmehr gigantisch. Gute eins neunzig in diesen schmutzigen alten Slippern mit heruntergetretenen Hacken, und ein regelrechtes Muskelpaket. Keine Strümpfe. Ein verblasstes, ungebügeltes, altes, vorne durchgeknöpftes Hauskleid mit einer Tasche auf jeder Hüfte. Ihr Gesicht war rund, faltig, stupsnasig und wurde voll und ganz von ihren Augen beherrscht, die mir direkt in die Seele blickten, hellblau mit dunkler Irisumrandung, kleine Pupillen so scharf wie Zwillingsnadeln. Ihr dünnes graues Haar trug sie kurz geschnitten wie ein Mann, die Augenbrauen hoben sich kaum von ihrer Haut ab. Alter? Weit über fünfzig meiner Schätzung nach.
Sobald sie den Blick von mir abließ, meldete sich meine medizinische Erfahrung. Akromegalie? Cushing-Syndrom? Aber sie hatte nicht den übergroßen Unterkiefer oder die vorspringende Stirn eines an Akromegalie Erkrankten und auch nicht die Physiognomie und Behaartheit eines Cushing-Patienten. Bestimmt stimmte was nicht mit der Hirnanhangdrüse oder dem Mittelhirn oder dem Zwischenhirn, aber was, das hätte ich nicht sagen können.
Das Modepüppchen nickte mir und Pappy höflich zu, drückte sich an uns vorbei und entfernte sich mit Mrs Delvecchio Schwartz in ihrem Gefolge. Weil ich in der Tür stand, sah ich die Besucherin in ihre Tasche greifen und ein dickes Bündel ziegelfarbener Banknoten – Zehner! – hervorholen und jeweils ein paar gleichzeitig überreichen. Pappys Vermieterin stand bloß mit geöffneter Hand da, bis die Anzahl der Banknoten ihrer Vorstellung entsprach. Dann faltete sie sie zusammen und steckte sie sich in die Tasche, während das Modepüppchen aus einem der teuersten Vororte Sydneys den Raum verließ.
Dann kam Mrs Delvecchio Schwartz wieder herein, warf sich auf einen der vier Stühle und forderte uns mit einer Geste ihrer Hand – sie hatte die Größe einer Lammkeule – auf, Platz zu nehmen.
»Setzen Sie sich, Prinzesschen, setzen Sie sich!«, dröhnte sie. »Wie geht’s Ihnen denn, Miss Harriet Purcell? Ein guter Name – zwei Mal sieben Buchstaben – starke Magie! Spirituelle Wahrnehmung und ein wohlgesonnenes Schicksal, Glück durch ausgezeichnete Arbeit, hä-hä-hä.«
Dieses »hä-hä-hä«, ein verschlagenes Kichern, das Bände sprach: als könne nichts auf der Welt sie überraschen, obgleich sie sich über alles Irdische köstlich amüsiert. Es erinnerte mich an Sid James’ Kichern in den CarryOn-Filmen.
Ich war so nervös, dass ich ihre Bemerkung über meinen Namen aufgriff und sie mit der Geschichte der Harriet Purcell beglückte, ihr erzählte, dass dieser Name viele Generationen weit zurückreiche, aber bis zu meiner Ankunft die Trägerinnen dieses Namens alle ein wenig übergeschnappt gewesen seien. Eine Harriet Purcell, erzählte ich, sei im Gefängnis gelandet, weil sie ihren Beinaheliebhaber kastriert hatte, eine andere dafür, weil sie den Premierminister von New South Wales während einer Suffragettenversammlung tätlich angegriffen hatte. Sie hörte mir mit Interesse zu, seufzte jedoch enttäuscht, als ich meine Geschichte damit beendete, dass es in der Generation meines Vaters aus lauter Angst vor diesem Namen keine Harriet Purcell gegeben habe.
»Und doch hat Ihr Vater Sie Harriet getauft«, sagte sie. »Ein guter Mann! Klingt ganz so, als wäre es lustig, ihn kennen zu lernen, hä-hä-hä.«
Oha! Hände weg von Papa, Mrs Delvecchio Schwartz! »Er meinte, ihm gefalle der Name Harriet und er gebe nichts auf das Familiengeschwafel«, sagte ich. »Ich war ein Nachzügler, wissen Sie, und alle dachten, ich würde auch ein Junge.«
»Waren aber keiner«, grinste sie. »Oh, das gefällt mir!«
Während all dessen trank sie unverdünnten und ungeeisten Dreistern-Weinbrand aus einem Streichkäseglas von Kraft. Pappy und ich bekamen auch jede eins, aber ein Schluck von Willies Ruin ließ mich auf meinen verzichten – ein fürchterliches Zeug, rau und beißend. Mir fiel auf, dass Pappy offenbar Geschmack daran fand, obwohl sie ihn nicht halb so schnell hinunterkippte, wie Mrs Delvecchio Schwartz das tat.
Jetzt sitze ich hier schon eine ganze Weile und gehe mit mir ins Gericht, ob ich mir nicht eine Menge Schreibarbeit ersparen soll, indem ich den Namen auf Mrs D-S abkürze, aber habe nicht den Mut dazu. Es fehlt mir nicht an Mut, aber Mrs D-S? Nein.
Dann wurde ich gewahr, dass noch jemand anderes mit uns auf dem Balkon war, die ganze Zeit bereits, sich aber vollkommen unsichtbar gemacht hatte. Ich bekam eine Gänsehaut und eine köstliche Kühle ergriff mich, wie der erste Windstoß eines südlichen Lüftchens nach tagelanger Hitzewelle über der Vierzig-Grad-Marke. Ein Gesicht tauchte über dem Tisch auf und guckte versteckt hinter Mrs Delvecchio Schwartzs Hüfte hervor. Dies überaus bezaubernde Gesichtchen mit dem spitzen Kinn und den hohen Wangenknochen gleich unterhalb der Augenhöhlen, und einer makellos beigen Haut, Büscheln hellbraunen Haars, schwarzen Brauen und schwarzen Wimpern, so lang, dass sie sich zu verwirren schienen – oh, ich wünschte mir, eine Dichterin zu sein, um dieses göttliche Kind zu beschreiben! Ich wurde schwach, sah sie nur an und liebte sie. Ihre weit auseinander stehenden, bernsteinfarbenen Augen waren riesig und so traurig, wie ich noch keine gesehen hatte. Ihr kleiner Rosenknospenmund öffnete sich, und sie lächelte mich an. Ich lächelte zurück.
»Oh, hast dich wohl dafür entschieden, zu uns zu stoßen?« Schon saß das kleine Ding auf Mrs Delvecchio Schwartzs Knie, das Gesicht mir noch immer lächelnd zugewandt, aber mit einer winzigen Hand an Mrs Delvecchio Schwartzs Kleid zupfend.
»Das ist Flo, meine Tochter«, stellte die Hausherrin sie vor. »Vor vier Jahren glaubte ich in den Wechseljahren zu sein, dann bekam ich Bauchschmerzen und ging aufs Klo, weil ich dachte, die Scheißerei zu haben. Und – peng! Da kam Flo und wand sich, überall mit Schleim bedeckt, auf dem Boden. Ich wusste die ganze Zeit nicht, dass sie unterwegs war, bis sie rausflutschte – ein Glück nur, dass ich dich nicht ins Klo habe fallen lassen, stimmt’s, Engelmiez?« Letzteres war an Flo gerichtet, die an einem Knopf herumfummelte.
»Wie alt ist sie?«, fragte ich.
»Gerade vier geworden. Ein Steinbock, der kein Steinbock ist«, sagte Mrs Delvecchio Schwartz und knöpfte beiläufig ihr Kleid auf. Die Brust, die daraufhin herausrutschte, sah aus wie ein alter Socken, dessen Zeh man mit Bohnen ausgestopft hatte, und sie steckte ihre riesige, verhornte Brustwarze in Flos Mund. Flo schloss ekstatisch ihre Augen, lehnte sich im Arm ihrer Mutter zurück und fing mit gierigen, unglaublich geräuschvollen Schlürflauten zu saugen an. Ich saß mit offenem Mund da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Der Röntgenblick hob sich und konzentrierte sich auf mich.
»Die mag die Milch ihrer Mutter, unsere Flo«, meinte Mrs Delvecchio Schwartz im Plauderton. »Ich weiß, sie ist vier, na ja, aber was hat das Alter damit zu tun, Prinzessin? Der beste Proviant, den’s gibt, Muttermilch. Schlimm ist nur, dass sie schon alle Zähne hat und es höllisch wehtut.«
Ich brachte den Mund gar nicht mehr zu, bis Pappy ganz überraschend sagte: »Nun, Mrs Delvecchio Schwartz, was meinen Sie?«
»Ich meine, dass DAS HAUS Miss Harriet Purcell braucht«, erklärte Mrs Delvecchio Schwartz mit einem Nicken und einem Zwinkern. Dann sah sie mich an und fragte: »Haben Sie schon mal daran gedacht, von zu Hause auszuziehen, Prinzessin? Vielleicht in eine nette kleine Wohnung ganz für Sie allein?«
Mein Mund schnappte zu, und ich schüttelte den Kopf. »Das kann ich mir nicht leisten«, antwortete ich. »Ich spare, um mir einen zweijährigen Arbeitsaufenthalt in England leisten zu können, wissen Sie.«
»Zahlen Sie zu Hause denn Logis?«, wollte sie wissen.
Ich sagte, ich zahle fünf Pfund die Woche.
»Nun, ich habe eine wirklich hübsche kleine Wohnung draußen im Hinterhof, zwei große Zimmer, für vier Pfund die Woche, Strom inklusive. Drinnen im Waschhaus gibt es ein Bad und ein Klo, das nur Sie und Pappy benutzen. Janice Harvey, meine Mieterin, zieht aus. Es steht ein Doppelbett drin«, fügte sie anzüglich hinzu. »Ich hasse diese putzigen Einzelbetten.«
Vier Pfund! Zwei Zimmer für vier Pfund? Das Wunder von Sydney!
»Deine Chancen, David loszuwerden, stehen besser, wenn du hier wohnst anstatt zu Hause«, meinte Pappy überzeugend und fügte achselzuckend hinzu: »Außerdem wirst du nach Männertarif entlohnt, du könntest trotzdem für deine Reise sparen.«
Ich weiß noch, dass ich schluckte und verzweifelt eine höfliche Ausrede suchte, um nein sagen zu können, aber plötzlich sagte ich ja! Ich weiß nicht, woher dieses Ja kam – gedacht habe ich jedenfalls keins.
»Donnerlittchen, Prinzessin!«, strahlte Mrs Delvecchio Schwartz, riss Flo den Nippel aus dem Mund und kam schwerfällig auf die Beine.
Als meine Augen denen Flos begegneten, wusste ich, warum ich ja gesagt hatte. Flo hatte mir das Wort in den Mund gelegt. Flo wollte mich hier haben, und in ihren Händen war ich Wachs. Sie kam zu mir, umarmte meine Beine und lächelte mit milchigen Lippen zu mir hoch.
»Nun sieh dir das an!«, rief Mrs Delvecchio Schwartz aus, wobei sie Pappy angrinste. »Fühlen Sie sich geehrt, Harriet. Normalerweise geht Flo nicht auf andere Menschen zu, nicht wahr, Engelmiez?«
Nun sitze ich hier und versuche dies alles niederzuschreiben, ehe es undeutlich wird und verschwimmt, und frage mich, wie um Himmels willen ich meiner Familie beibringen kann, dass ich in Kürze in zwei große Zimmer am Kings Cross ziehe, dem Zuhause von Alkoholikern, Prostituierten, Homosexuellen, satanischen Künstlern, Klebstoffschnüfflern, Haschischrauchern und Gott weiß was sonst noch. Sagen könnte ich, dass mir das, was ich in der regnerischen Dunkelheit erkennen konnte, gefiel und Flo es sich wünscht, dass ich in DAS HAUS ziehe.
Zu Pappy habe ich gesagt, ich könnte die Lage des HAUSES ja vielleicht mit Potts Point umschreiben, aber Pappy lachte nur.
»Potts Point ist ein Euphemismus, Harriet«, klärte sie mich auf. »Potts Point ist ganz und gar im Besitz der Royal Australian Navy.«
Was ich mir wünsche: Dass die Eltern nicht der Schlag trifft.
Kapitel 8:Sonntag, 10. Januar I960
Ich hab’s ihnen noch nicht erzählt. Bringe einfach den Mut nicht auf. Als ich gestern Abend zu Bett ging – Großmama schnarchte wie ein Weltmeister – , war ich mir sicher, ich würde es mir heute früh beim Aufwachen noch mal anders überlegen. Aber ich hab’s mir nicht anders überlegt. Das Erste, was ich sah, war Großmama, die auf dem Pott hockte, und da schob sich mir die Klinge in meine Seele. So ein toller Ausdruck! Erst seit ich zu schreiben begonnen habe, merke ich, dass ich offenbar beim Lesen jede Menge guter Ausdrücke aufgeschnappt habe. Im Gespräch tauchen sie nicht auf, auf dem Papier aber schon. Und obwohl das hier erst ein paar Tage alt ist, steckte ich bereits mittendrin in einem dicken Tagebuch, und ich bin richtig süchtig danach. Vielleicht liegt das daran, dass ich nie stillsitzen und denken kann, ich muss immer was zu tun haben, aber jetzt schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich muss darüber nachdenken, was mit mir geschieht, doch gleichzeitig tue ich auch etwas. Die Disziplin, die es braucht, das Zeug niederzuschreiben, verhilft zu einem klareren Blick. Genauso wie in meiner Arbeit. Ich bin mit Leib und Seele dabei, weil ich Freude daran habe.
Über Mrs Delvecchio Schwartz bin ich mir noch uneins, wenngleich ich sie sehr mag. Sie erinnerte mich an einige meiner erinnerungswürdigeren Patienten, denen es gelingt, mir im Gedächtnis zu bleiben, und zwar seit Anbeginn meiner Röntgenarbeit, vielleicht bleiben sie sogar für den Rest meines Lebens bei mir. Wie der liebe Alte aus dem Lidcombe State Hospital, der seine Zudecke immer ordentlich in Falten legte. Als ich ihn fragte, was er da mache, erklärte er mir, er falte Segel, und dann, als ich mich zu ihm setzte, um mit ihm zu plaudern, erzählte er mir, er sei Bootsmann auf einem Windjammer gewesen, einem der Weizenklipper, die, bis zum Schandeck vollgepackt mit Weizen, heim nach England flitzten. Seine Worte, nicht meine. Ich erfuhr eine Menge, dann wurde mir klar, dass er in Bälde sterben würde, und all diese Erfahrungen mit ihm sterben würden, weil er sie nie aufgeschrieben hatte. Nun, Kings Cross ist kein Windjammer, und ich bin kein Seemann, aber wenn ich alles aufschreibe, wird irgendwann in ferner Zukunft es irgendjemand vielleicht lesen, und man wird erfahren, was ich für ein Leben geführt habe. Weil ich das komische Gefühl habe, dass es nicht mehr das langweilige alte Vorortsleben sein wird, dem ich mich am Neujahrstag gegenübersah. Ich fühle mich wie eine sich häutende Schlange.
Was ich mir wünsche: Dass die Eltern nicht der Schlag trifft.
Kapitel 9:Freitag, 15. Januar 1960
Ich hab’s ihnen noch immer nicht erzählt, aber morgen Abend ganz bestimmt. Als ich Mama fragte, ob David bei uns Steak und Pommes mitessen könne, meinte sie, natürlich; ich finde es das Beste, sie alle auf einen Streich fertig zu machen. Auf diese Weise wird David sich vielleicht an die Vorstellung gewöhnen, ehe er genügend Zeit mit mir allein hat, um mich zu piesacken und zu tyrannisieren, bis ich nachgebe. Wie ich seine Lektionen fürchte! Aber Pappy hat Recht, es wird leichter sein, David den Laufpass zu geben, wenn ich nicht mehr zu Hause wohne. Allein dieser Gedanke hat mich an meinem Kurs in Richtung Cross, wie die Einheimischen es nennen, festhalten lassen.
Heute sah ich auf der Arbeit einen Mann auf der Rampe, die von der Röntgenabteilung zum Chichester House führt, dem schicken roten Klinkerbau, der die Privatpatienten luxuriös beherbergt. Für jeden ein eigenes Zimmer mit Bad, statt der bis zu zwanzig Betten auf jeder Seite einer Großstation. Muss unheimlich toll sein, beim Liegen nicht mitkriegen zu müssen, wie die Hälfte der Patienten sich erbricht, spuckt, hustet oder ausrastet. Obwohl es zweifellos ein unglaublicher Anreiz sein dürfte, zu gesunden und entlassen zu werden, oder auch das Sterben hinter sich zu bringen und es hinter sich zu haben, wenn man zuhört, wie die Hälfte der Patienten sich erbricht, spuckt, hustet oder ausrastet.
Der Mann. Schwester Agatha kriegte mich dran, als ich gerade ein paar Filme in der Trockenkammer aufgehängt hatte – bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Film vermasselt, was meine zwei Auszubildenden zu demütiger Ehrfurcht nötigt.
»Miss Purcell, seien Sie doch so nett und bringen Sie die rüber auf Chichester Drei für Mr Naseby-Morton«, sagte sie und wedelte mit einem Röntgenkuvert.
Ich spürte ihren Missmut, nahm das Kuvert und rannte los. Pappy wäre die Erste auf ihrer Liste, das konnte nur bedeuten, dass Schwester Agatha sie nicht hatte finden können. Vielleicht hielt sie auch gerade eine Spuckschale oder hantierte mit einer Bettpfanne. Die Gründe zu erforschen, war nicht meine Aufgabe – wie der unterste Lehrling düste ich ab in die Privatabteilung.
Ziemlich protzig, dieses Chichester House! Die Gummiböden glänzten derart, dass ich die rosa Schlüpfer von Schwester Chichester Drei darin gespiegelt sah, und man hätte mit den vielen Blumen, die auf teuren Podesten in den Fluren verteilt standen, leicht ein Blumengeschäft aufmachen können. Es war so still, dass mich, als ich in Höhe von Chichester Drei meinen Fuß auf die letzte Treppenstufe setzte, sechs verschiedene Leute anstarrten, die alle den Zeigefinger vor den Mund hielten. Schschsch! Ooooo-aa! Also machte ich ein betretenes Gesicht, übergab die Filme und tänzelte davon wie Margot Fonteyn.
Als ich die Hälfte der Rampe hinter mir hatte, sah ich eine Gruppe Ärzte näherkommen – einen Sanitätsrat und sein Gefolge an Befehlsempfängern. Es genügt ein Arbeitstag in einem Krankenhaus, um mitzukriegen, dass der Sanitätsrat Gott ist, aber Gott am Royal Queens ist dem Gott am Ryde Hospital an Göttlichkeit überlegen. Hier tragen sie blaue Nadelstreifen oder graue Flanellanzüge, Fliege und Hemdmanschetten mit diskreten, aber soliden Goldknöpfen, braune Wildleder- oder schwarze Ziegenlederschuhe mit dünner Sohle.
Dieses Exemplar trug grauen Flanell und braune Wildlederschuhe. Bei ihm waren zwei Krankenhausärzte (lange weiße Mäntel), sein erster und zweiter Stationsarzt (weiße Anzüge und weiße Schuhe) und sechs Medizinstudenten (kurze weiße Mäntel) mit ostentativ zur Schau gestellten Stethoskopen, in den Händen mit den abgebissenen Nägeln, Kästen mit Objektträgern oder Gestelle mit Reagenzgläsern. Ja, eine sehr überkommene Version von Gott, mit so viel tanzender Aufmerksamkeit um ihn herum. Das fiel mir ins Auge. Bei den Routine-Brustkorbdurchleuchtungen kommt man nicht mit Gott in Kontakt, weder mit dem alten noch dem jungen, also war ich neugierig. Er redete sehr erregt auf einen der Krankenhausärzte ein, den feinen Kopf zurückgeworfen, ich wusste, ich musste mein Tempo drosseln und meinen Mund zumachen, der in letzter Zeit dazu neigt, sich als Fliegenfänger zu betätigen. Oh, was für ein schöner Mann! Sehr groß, ein Paar prächtige Schultern, ein flacher Bauch. Jede Menge dunkelrotes, welliges Haar und zwei schneeweiße Koteletten, leicht sommersprossige Haut, gemeißelte Züge – ja, er war ein schöner Mann. Sie unterhielten sich über Osteomalazie, deshalb klassifizierte ich ihn als Orthopäden. Als ich mich an ihnen vorbeidrückte – sie nahmen tatsächlich die ganze Rampe ein –, fühlte ich mich von einem Paar grünlicher Augen suchend betrachtet. Puh! Mir wurde zum zweiten Mal in einer Woche schwach um die Brust, obwohl dahinter kein Liebesschwall steckte, wie bei Flo. Hier ging es um atemberaubende Anziehung. Ich bekam weiche Knie.
Beim Mittagessen quetschte ich, bewaffnet mit meiner Theorie, dass er Orthopäde war, Pappy über ihn aus.
»Duncan Forsythe«, sagte sie ohne Zögern. »Er ist der Erste Sanitätsrat der Orthopädie. Warum fragst du?«
»Er hat mir einen Blick zugeworfen«, sagte ich.
Pappy starrte mich an. »Tatsächlich? Das ist aber ungewöhnlich, er gehört nämlich nicht zu den Lotharios des Queens. Er ist sehr verheiratet und als der netteste Sanitätsrat im ganzen Haus bekannt – durch und durch ein Gentleman, der nie mit Instrumenten nach der OP- Schwester schmeißt oder schmutzige Witze erzählt oder auf seinen Stationsärzten herumhackt, egal wie ungeschickt oder taktlos diese sind.«
Ich ließ das Thema fallen, obwohl ich mir sicher war, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Er hatte mir weder mit den Augen die Kleider ausgezogen noch sonst etwas Dummes dieser Art getan, aber der Blick, den er mir zuwarf, war ganz eindeutig einer von Mann zu Frau. Und was mich betrifft, ist er für mich der attraktivste Mann, der mir je begegnet ist. Der Erste Sanitätsrat! Jung für diesen Posten, er konnte nicht älter als vierzig sein.
Was ich mir wünsche: Dass ich mehr von Mr Duncan Forsythe zu sehen bekomme.
Kapitel 10:Samstag, 16. Januar 1960
Nun, heute Abend habe ich es am Esstisch in Gegenwart von David hinter mich gebracht. Steak mit Pommes ist unser aller Lieblingsessen, obwohl es für Mama mühsam ist, denn sie muss ständig die T-Bones in der großen Pfanne braten und dabei auch noch die Fritteuse im Auge behalten. Gavin und Peter schaffen jeder drei, und selbst David isst zwei. Zum Nachtisch gab es Spotted Dick, den köstlichen Rosinenpudding mit Vanillesauce, ebenfalls sehr beliebt, so dass der ganze Tisch zufrieden und gut gelaunt war, als Mama und Großmama die Teekanne abstellten. Zeit für mich zuzuschlagen.
»Wisst ihr was?«, fing ich an.
Keiner fühlte sich veranlasst nachzufragen.
»Ich habe mir eine Wohnung am Kings Cross gemietet, und ich ziehe aus.«
Auch darauf erfolgte keine Antwort, aber alle Geräusche verstummten. Das Klappern der Löffel in den Tassen, Großmamas Schlürfen, Papas Raucherhusten. Dann zog Papa seine Packung Ardaths heraus, bot sie Gavin und Peter an, dann zündeten sie sich alle drei ihre Kippen mit demselben Streichholz an – oha, das war vielleicht schwer!
»Kings Cross«, meinte Papa dann endlich und sah mir fest in die Augen. »Du bist verrückt, mein Mädchen. Wenigstens hoffe ich, dass du verrückt bist. Denn nur Verrückte, Bohemiens und Nutten wohnen am Kings Cross.«
»Ich bin aber nicht verrückt, Papa«, widersprach ich tapfer, »und eine Nutte oder eine Bohemien bin ich auch nicht. Übrigens nennt man die Bohemiens heute Beatniks. Ich habe eine sehr respektable Wohnung in einem äußerst respektablen Haus gefunden, das zufälligerweise am Cross liegt – am besseren Ende des Cross, nahe der Challis Avenue. Eigentlich Potts Point.«
»Potts Point gehört der Royal Australian Navy«, erklärte Papa.
Mama sah aus, als würde sie gleich losheulen. »Warum, Harriet?«
»Weil ich einundzwanzig bin und ein Zimmer für mich allein brauche, Mama. Ich habe jetzt die Ausbildung hinter mir und verdiene gutes Geld, die Wohnungen am Kings Cross sind auch für mich erschwinglich, so dass ich dort wohnen und trotzdem noch Geld für meinen Englandaufenthalt nächstes Jahr sparen kann. Wäre ich woanders hingezogen, hätte ich mir den Raum mit zwei oder drei anderen Mädchen teilen müssen, und da wüsste ich nicht, ob das besser wäre, als zu Hause zu wohnen.«
David sagte kein Wort dazu, saß einfach zu Papas Rechten und sah mich an, als wäre mir noch ein zweiter Kopf gewachsen.
»Na los, mach schon, Schlaukopf«, brummte Gavin ihn an, »was hast du denn dazu zu sagen?«
»Ich bin nicht einverstanden«, antwortete David mit eisiger Stimme, »aber ich würde lieber mit Harriet allein sprechen.«
»Also, ich finde das gut«, meinte Peter und beugte sich über den Tisch, um mich in den Arm zu knuffen. »Du brauchst mehr Platz, Harry.«
Das schien für Papa den Ausschlag zu geben, denn er meinte seufzend: »Ich kann ja wohl nicht viel machen, um dich aufzuhalten, oder? Auf alle Fälle ist es nicht so weit wie das englische Mutterland. Wenn du Probleme kriegst, kannst du jederzeit von Kings Cross ausreißen.«
Gavin brach in bellendes Gelächter aus, lehnte sich, den Schlips in die Butter tauchend, über den Tisch und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Gratuliere, Harry!«, rief er. »Ende des ersten Durchgangs, und du behauptest dich immer noch an der Schlaglinie. Halt dein Schlagholz für die Googlies* bereit!«
»Wann hast du denn diesen Entschluss gefasst?«, mischte Mama sich heftig gegen die Tränen ankämpfend ein.
»Als Mrs Delvecchio Schwartz mir die Wohnung anbot.«
Der Name hatte einen seltsamen Klang in unserem Haus. Papa zog die Stirn kraus.
»Missus wer?«, fragte Großmama, die während der ganzen Zeit ziemlich selbstgefällig ausgesehen hatte.
»Delvecchio Schwartz. Sie ist die Vermieterin.« Da fiel mir ein Umstand ein, den ich unerwähnt gelassen hatte. »Pappy wohnt dort, und auf diese Weise habe ich Mrs Delvecchio Schwartz kennen gelernt.«
»Ich wusste doch, dass dieses Chinesenmädchen einen schlechten Einfluss auf dich haben würde«, sagte Mama. »Seit du sie kennen gelernt hast, hast du dir nicht die Mühe gemacht, dich mit Merle zu treffen.«
Ich reckte mein Kinn. »Merle hat sich nicht die Mühe gemacht, sich mit mir zu treffen. Sie hat einen neuen Freund, weiter reicht ihr Horizont nicht. Ich stehe erst dann wieder in ihrer Gunst, wenn er sie fallen lässt.«
»Ist das eine richtige Wohnung?«, hakte Papa nach.
»Zwei Zimmer. Das Badezimmer teile ich mir mit Pappy.«
»Es ist unhygienisch, sich ein Badezimmer zu teilen«, warf David ein.
Ich reckte auch ihm mein Kinn entgegen. »Ich teile auch hier das Badezimmer, oder?«
Daraufhin hielt er den Mund.
Mama beschloss, in den sauren Apfel zu beißen. »Also gut«, sagte sie, »dann wirst du Geschirr, Besteck und Kochutensilien benötigen. Wäsche. Du kannst deine eigenen Bettlaken von hier mitnehmen.«
Ohne nachzudenken platzte es aus mir heraus. »Nein, kann ich nicht, Mama. Ich habe ein ganzes Doppelbett für mich allein! Ist das nicht wunderbar?«
Sie saßen da und gafften mich an, als hätten sie das Doppelbett vor Augen, darauf die Busschaffnertasche, um die Gebühren zu kassieren.
»Ein Doppelbett?«, staunte David erbleichend.
»Richtig, ein Doppelbett.«
»Allein stehende Mädchen schlafen in Einzelbetten, Harriet.«
»Nun, das mag so üblich sein, David«, herrschte ich ihn an, »aber dieses alleinstehende Mädchen wird in einem Doppelbett schlafen!«
Mama sprang auf die Füße. »Jungs, das Geschirr wäscht sich nicht von allein!«, zwitscherte sie. »Großmama, Zeit für 77 Sunset Strip.«
»Kooky, Kooky, leih mir deinen Kamm!«, trällerte Großmama und deutete ein Hüpfen an. »Also nein, wer hätte das gedacht? Harriet zieht aus, und ich bekomme ein Zimmer ganz für mich allein! Ich glaube, ich werde ein Doppelbett haben, hi-hi!«
Papa und die Brüder räumten den Tisch in der doppelten Geschwindigkeit ab und ließen mich mit David allein.
»Wie kommst du denn darauf?«, fragte er schmallippig.
»Zu wenig Privatleben.«
»Du hast was viel Besseres als bloß Privatleben, Harriet. Du hast ein Zuhause und du hast Familie.«
Ich schlug mit der Faust auf den Tisch. »Wie kann man nur so kurzsichtig sein, David? Ich teile mir ein Zimmer mit Großmama und dem Nachtpott, und ich habe keine Möglichkeit mich irgendwo auszubreiten, ohne alles wieder wegzuräumen, sobald ich mit meinen Aufgaben fertig bin! Jeder Raum, der mir hier zur Verfügung steht, wird auch von anderen benützt. Und deshalb werde ich jetzt in meinen eigenen Räumen schwelgen.«
»Am Kings Cross.«
»Ja, am verdammten Kings Cross! Wo die Mieten erschwinglich sind.«
»In einem Wohnhaus, das einer Ausländerin gehört. Einer Neu-Australierin.«
Das war der Gipfel, und ich lachte ihm ins Gesicht. »Mrs Delvecchio Schwartz eine Ausländerin? Sie ist eine Aussie, mit einem Aussie-Akzent, den du mit dem Messer schneiden kannst!«
»Das ist ja noch schlimmer«, erklärte er. »Eine Australierin mit einem halb italienischen und halb jüdischen Namen? Dann hat sie auf jeden Fall unter ihrem Stand geheiratet.«
»Du verdammter Snob!«, keuchte ich. »Du bigotter Kerl! Was ist denn so toll an den Australiern? Wir stammen alle von verfluchten Sträflingen ab! Unsere Neu-Australier sind wenigstens als freiwillige Siedler hierhergekommen!«
»Mit SS-Nummern in ihre Achselhöhlen tätowiert oder mit Tuberkulose oder nach Knoblauch stinkend!«, knurrte er. »Und was die ›freiwilligen Siedler‹ angeht, da hast du Recht – sie sind alle nur deshalb hierhergekommen, weil sie für die subventionierte Überfahrt nur zehn Pfund bezahlen mussten!«
Das gab den Ausschlag. Ich sprang auf und fing an, mit beiden Fäusten auf ihn einzuschlagen, und zwar direkt über den Ohren. Wumm, wumm, wumm! »Hau ab, David, hau verdammt noch mal ab!«, schrie ich.
Und er ging, in seinen Augen stand zu lesen, ich hätte wohl wieder einen dieser Tage, und er werde wiederkommen, um es noch mal zu versuchen.
Das war’s also. Ich mag meine Familie wirklich – es sind gute Kumpel. Aber David ist genau das, was Pappy ihn geheißen hat – ein an Verstopfung leidender katholischer Schuljunge. Gott sei Dank gehöre ich der Church of England an.