
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nur knapp ist Mara einem Bombenattentat in der U-Bahn entgangen. Ihre Mitschüler nennen sie seither "Das Mädchen, das überlebt hat" und erwarten Betroffenheit von ihr. Aber Mara hat ganz andere Sorgen. Ihre Freundin Sirîn meldet sich immer seltener und scheint plötzlich komplett unerreichbar. Je mehr Mara ihr zu helfen versucht, desto mehr Unverständnis und Ablehnung erntet sie. Was verheimlichen alle vor ihr? Erst als sich ihr Schwarm Chriso in die Suche einschaltet, kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht. "Ein Buch, das unter die Haut geht." Corinna Schmitz, Blog "buecherweltcorniholmes" "Ein Buch, das aktueller nicht sein könnte!" Timo Muth, Blog "rainbookworld" "Ein Roman, der mich unsagbar berührt und völlig verloren und erschüttert zurückgelassen hat." Susanne Matiaschek, "Magische Momente Alys Bücherblog" "Wer gerne feinfühlige, spannende, emotionale und lebensnahe Jugendbücher liest, sollte unbedingt zu "Die Stille zwischen den Sekunden" von Tania Witte greifen. Mich hat die Geschichte komplett von den Füßen gerissen und ich bin in jeglicher Hinsicht begeistert." Blog "Buchstabenträumerei"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tania Witte
Die Stille zwischen den Sekunden
Alle Begriffe aus dem Kurdischen und ihre Verwendung beruhen auf eigenen Recherchen. Es gibt allerdings so viele lokale Ausprägungen der vornehmlich mündlich überlieferten Sprache, dass sich hier Begrifflichkeiten mischen können oder unterschiedliche Meinungen über die korrekte Verwendung existieren. Dies hier ist meine eigene Auslegung – Fehler sind also möglich, wenn auch nicht beabsichtigt.
Tania Witteist Schriftstellerin, Journalistin und Spoken-Word-Performerin und lebt in Berlin und Den Haag. Neben diversen internationalen Stipendien erhielt sie 2016 den Felix-Rexhausen-Sonderpreis für ihre journalistische Arbeit, 2017 den Martha-Saalfeld-Förderpreis für Literatur und 2019 den Mannheimer Feuergriffel für Kinder- und Jugendliteratur. Das Manuskript von »Die Stille zwischen den Sekunden« wurde 2018 mit einem Arbeitsstipendium des Landes Niedersachsen ausgezeichnet.
Weitere Bücher von Tania Witte im Arena-Verlag:Ella Blix: Der Schein
Für M und Y –ihr fehlt.
1. Auflage 2019
©2019 Arena Verlag GmbH, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Alexander Kopainski unter Verwendung von Motiven von shutterstock © doodko, Sergey Novikov, Joshua Davenport, Yarlander
Gesamtherstellung: Westermann Druck Zwickau GmbH
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing GmbH, Dortmund, www.readbox.net
E-Book ISBN 978-3-401-80824-6
Folge uns unter:
www.arena-verlag.de
www.arena-verlag.de/twitter
www.arena-verlag.de/facebook
EINS
Schneller, Mara, schneller! Ich hetzte die Stufen zur U-Bahn hinunter. Die gekachelten Wände verwischten zu einem schmutzigen Türkis, das eine absurde Schwimmbadatmosphäre ausströmte. Die Lautsprecherdurchsage ertönte, als ich die letzten drei Stufen hinabsprang – mitten hinein in eine Touristengruppe. Beim Versuch auszuweichen, landete ich halb auf dem Schuh eines Mannes und knickte um. Mist, verdammter. Ich ignorierte den Schmerz und das Fluchen und das Gelächter, rappelte mich auf und raste weiter. Die Türen der Bahn schlossen sich bereits. Mit einem letzten Hechtsprung zwängte ich meine Schulter zwischen die Türen, aber der Spalt war zu klein. Ich prallte ab.
»Scheiße!«
Meine Hände donnerten gegen die Scheiben, zweimal.
Die Menschen in der Bahn sahen erschrocken von ihren Handys auf. Eine Frau legte beschützend die Arme um das Baby, das sie vor ihren Bauch gebunden hatte, und sah wütend in meine Richtung. Neben ihr wedelte ein älterer Mann mit der flachen Hand vor seinem Gesicht herum – das vermutlich internationale Bist-du-bescheuert-Zeichen. Ein Typ, ungefähr so alt wie ich, sprang von innen in Richtung Tür und tat, als würde er ebenfalls gegen die Scheibe schlagen. Er stoppte seine Bewegung kurz vor dem Glas. Witzig. Fanden zumindest die Jungs, die ihn umrundeten – ihr Gejohle war bis draußen zu hören. Ich schnitt ihnen eine Grimasse. Die Jungs hampelten herum, bis der grüne Zug aus meiner Sichtweite fuhr und im Tunnel verschwand.
Die Anzeigetafel ratterte: Zehn Minuten bis zur nächsten Bahn. Ausgerechnet heute hatte ich Mam versprochen, um halb sechs zu Hause zu sein, was laut Anzeige schon vor fünf Minuten gewesen war. Dabei hatte ich mich so beeilt und war den ganzen Weg vom Skatepark zum Kröpcke gerannt, wo ich wie jeden Mittwoch mit Sirîn abgehangen hatte. Alles nur, weil Mam heute unbedingt gemeinsam und extrafrüh zu Abend essen wollte, bevor Torsten vier Tage auf irgendeine Konferenz musste. Vier Tage, kein halbes Jahr! Ich trat ein paar Schritte zurück, lehnte mich an die Schwimmbadkachelwand und zog das Handy heraus.
Mam reagierte sofort. Ein Yoga-Emoji. Hieß: Bloß kein Stress. In »Bloß kein Stress« war meine Mutter gut – sie war von Natur aus tiefenentspannt. So sehr, dass sie bei beinahe allem, was sie tat, übelsten italienischen HipHop hörte, damit sie nicht beim Putzen einschlief und beim Baden ertrank. Von Tiefenentspannung war ich gerade Lichtjahre entfernt.
Ungeduldig sah ich zur Tafel, dann setzte ich den Kopfhörer auf, der mich so wunderbar von der Welt abschottete und obendrein wärmte – und mit dem ich aussah wie ein Koala mit mintgrünen Ohren. Ich scrollte durch meine zuletzt gehörten Songs, hielt aber keinen länger als vier Takte aus. Vielleicht sollte ich es mal auf Mams Art versuchen – nur umgekehrt. Versuchsweise tippte ich »Meditation« auf Spotify ein, aber schon der Gong zum Auftakt machte mich kribbelig. Bei den Panflöten klickte ich weg. Ich landete in der »Dein Mix der Woche«-Liste, die heute mit dem Song einer Sängerin begann, von der ich noch nie gehört hatte. Er hieß »Ordinary Day« und war mir eigentlich ein bisschen zu gitarrig, aber ich hatte keine Lust mehr weiterzusuchen.
This is just an ordinary day,
wipe the insecurities away …
Die Anzeige sprang auf neun Minuten. Mein Blick schweifte über die feierabendliche Menschenmenge, die die Treppe hinunter auf den Bahnsteig strömte, alle gehetzt und graugesichtig.
Was soll’s, beschloss ich. Es ist zwar November, aber es regnet nicht und Mam wartet. Lauf’ ich halt.
Ich drehte den Gleisen den Rücken zu, drängelte mich durch die Menschen und stiefelte die Treppe wieder hinauf. Immer nach vorne schauen, nie zurück.
War das auch aus einem Song? Lauter, klickte ich, noch lauter, lauschte den Gitarren und der Stimme und dachte an Chriso, weil ich immer an ihn dachte, wenn ich nicht gerade an andere Dinge denken musste. Chriso hieß eigentlich Christian und ging in die Zwölf, zwei Klassen über mir. Seit einem Austauschjahr in den USA hatte er einen eigenen YouTube-Kanal – klar, dass alle ihn bewunderten, als er auf unserer Schule landete. Wegen des Kanals – und weil er der Älteste in seiner Klasse war. Und der Coolste, wegen Amerika. Dass sie ihn ein ganzes Jahr zurückgestuft hatten, weil er drüben mehr gevloggt als gelernt hatte, polierte sein Image auf Hochglanz.
Woher ich das alles wusste? Weil er natürlich auch dazu ein Video gedreht hatte. Alles rund um Chriso gehörte zum Allgemeinwissen bei uns und jedes zweite Mädchen schwärmte für ihn.
Ich auch. Wegen dreißig Sekunden, die jetzt ein Jahr und vier Monate her waren.
Chrisos erster Tag bei uns. Ich stand in der großen Pause am Kiosk und wartete auf Lyd. Gerade als ich ihr eine Nachricht tippte, entdeckte ich ihn.
Später fiel mir auf, dass dies das einzige Mal war, dass ich ihn alleine gesehen hatte. Er wirkte anders damals, ein bisschen verloren fast, und einen kleinen Moment lang schauten wir uns in die Augen. Eine Sekunde, noch eine, noch eine.
Und dann … rempelte mich jemand an und das Handy fiel mir aus der Hand. Chriso, von dem ich noch nicht wusste, dass es Chriso war, machte einen Schritt, der nur ein klein bisschen größer war als seine vorigen, und das Telefon landete sicher in seiner Hand. Meine Wangen prickelten. Meine Augen klammerten sich an seiner Hand fest. Schöne Hand, dachte ich. Schöner Arm, schöner Geruch, schöne Stimme.
»Oops«, machte er. Dann legte er mir das Telefon zurück in die Hand, ganz vorsichtig, als ob es sehr wertvoll wäre. Als ob ich sehr wertvoll wäre.
»Danke«, stammelte ich. Ganz kurz berührten mich seine Fingerspitzen.
»Kein Ding«, sagte er leise. Räusperte sich – und ging.
Er ging!
Hinein in sein neues Leben, in dem er immer umzingelt sein würde und in dem ihn alle anhimmelten. Vermutlich hatte er mich sofort vergessen.
Ich ihn nicht.
Vor den Eingängen zur Stadtbahn und rund um die riesige Weihnachtspyramide, die auf die Eröffnung des Weihnachtsmarktes wartete, wimmelte es von Menschen. Die Sternbeleuchtung hing zwar schon, aber nur die Lichtwolke, die seit ein paar Jahren über dem Platz schwebte, brannte. Nicht mal der Mond war zu sehen. Alles wirkte surreal. Ich machte mich auf den Weg, mein Kopf noch immer voll von Chriso.
So ging das jetzt seit einem Jahr und vier Monaten, in denen ich jeden Tag hunderttausendmal an ihn dachte. Wohlgemerkt, obwohl ich, nachdem ich mir zum ersten Mal sein Vlog angeschaut hatte, alles daransetzte, ihn mir aus dem Kopf zu schlagen. Denn sein Kanal war … nicht besonders originell, um es freundlich auszudrücken.
Hey, Leute, schön, dass ihr wieder da seid! Und ich garantier euch, es wird sich loooohnen! Heute wird’s hier nämlich mal wieder gaaaaanz crazy bei mir!
Close-up von irgendeiner Langhaarblondine: Schwör!
Close-up Chriso: Ich schwör’!!!
Und dann kam ein »gaaaaanz crazy« Boy versus Girl-Scheiß oder Die zehn besten Songs für Dates/Sex/Feiern/irgendwas – der übliche Kram, den Vlogger halt machten. Das hätte ich ja noch halbwegs verkraftet, aber Chrisos Erfolgsgeheimnis beruhte auf etwas anderem – etwas, das ihn von anderen Vloggern unterschied: Er filmte heimlich Gespräche von Leuten, in denen sie über irgendwen abhetzten. Das Ganze kommentierte er mit Emojis, schnitt Standbilder von sich selbst mit passender Mimik dazwischen und versah es mit (leider wirklich witzigen) Hashtags. Es war auf verdrehte Art gemein, weil man nie wusste, ob er sich über die Lästerer oder über ihre Opfer lustig machte. Man sah nie Gesichter, deshalb konnte ihm niemand was. Aber ziemlich oft wusste man, um wen es ging, und alle klickten wie verrückt die Videos, entweder mit Respekt oder Angst.
Oder weil sie verknallt waren.
Das ging in meinem Fall nur, weil der Chriso in den Videos nichts mit dem Menschen zu tun hatte, der mir an seinem ersten Schultag begegnet war. Sogar seine Stimme war anders, wenn er vloggte, hart und hyper, die Ausstrahlung distanziert und unecht. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, an ihn zu denken … Wobei … eigentlich dachte ich nicht an ihn, sondern an den Dreißig-Sekunden-Chriso. Und hasste mich dafür, weil das alles so ein bescheuertes Klischee war.
Ich ging Chriso weiträumig aus dem Weg, vor allem wenn er ein Handy in der Hand hatte und versuchte, mir einzureden, dass er genauso dumm wie gut aussehend war, aber so ganz gelang es mir nicht. Zumindest behauptet Sirîn, dass ich immer einen violetten Blick bekomme, wenn ich an ihn denke. Violetter Blick! Das sagte sie wirklich und erstaunlicherweise klang es nicht mal blöd bei ihr. Im Gegensatz zu mir schien Chriso unsere Begegnung kaltgelassen zu haben, denn er zeigte niemals auch nur das winzigste Anzeichen von Erkennen, wenn wir einander begegneten.
Ich wusste, dass Mam es nicht mochte, wenn ich im Dunklen allein durch die Stadt lief, aber es ging gegen ihre Ehre, das auszusprechen. Schließlich war ich schon sechzehn und außerdem: Wann war es im Winter mal nicht dunkel?
Ich schlängelte mich aus dem Gewimmel Richtung Georgstraße. Meine empfohlene Wochenplaylist wechselte zu italienischem Schmalz. Welcher Algorithmus hatte sich die für mich ausgedacht und aufgrund welcher Daten, bitte schön?
Das Schlimme war, dass ich verstand, was sie sangen, denn Mam hatte alle Energie darauf verwendet, mich zweisprachig aufwachsen zu lassen. Wenn ich schon nicht italienisch aussähe – weil ich blond auf die Welt gekommen und blond geblieben war! –, sagte sie immer, müsse ich wenigstens die Sprache beherrschen, das wäre ich meinen Großeltern schuldig. Wenn ich allerdings solche Musik hörte, wünschte ich, sie hätte mir die blonden Haare braun gefärbt, statt mir die Sprache beizubringen.
Aber zu deinen Füßen,zu deinen Füßen,oh, ah, Baby,zu deinen Füßen,werfe ich meine Lieder,mich, Baby,zu deinen Füßen, oh, ah …
Ich stöhnte innerlich, war aber zu faul, das Handy aus der Tasche zu ziehen und weiterzuklicken. Vor meinen Füßen (oh, ah!) lagen keine Lieder, dafür würden sie mich sicher nach Hause tragen. Währenddessen dachte ich weiter an Chriso und an Sirîn dachte ich auch und daran, wie bescheuert es war, dass ab Ende November alle wie die Irren die Geschäfte stürmten, und fragte mich, ob wohl irgendwo auf der Welt ein anderer Geburtstag so ausschweifend gefeiert wurde wie bei uns der 24. Dezember.
*
Als ich die Wohnungstür aufschloss, drang aus der Küche Fluchen und Geschepper. Beides deutete darauf hin, dass Mam am Kochen war. Das verhieß nichts Gutes.
Es war nämlich so, dass meine Mam alles hatte und konnte, was auf einer How-to-Liste für Mütter stand. Sie war warmherzig und aufmerksam und liebevoll und klug und empathisch. Ein Typ aus meiner Parallelklasse hatte sie mal eine MILF genannt, woraufhin ich ihm eine runtergehauen hatte. Seitdem lud ich nur noch äußerst selten Besuch zu mir nach Hause ein.
So einen MILF-Satz würde ich garantiert selbst nie zu hören bekommen. »Du kommst nach deinem Vater«, seufzte meine halb sizilianische Mam hin und wieder. Und dann schwiegen wir beide, wegen Papa, und weil das eben auch hieß, dass ich nicht aussah wie Mam. Nicht so hübsch. Meinte sie nicht so, hörte ich aber. Und sie hatte recht. Das Einzige, was ich von ihr geerbt hatte, waren die dunkelbraunen Augen und die Körpergröße. Oder eher: meine Winzigkeit. Im Gegensatz zu ihr war ich nicht kurvig und weich, sondern grobknochig und v-förmig. Ich trieb bewusst wenig Sport, weil ich – eben genau wie Papa – im Handumdrehen Muskeln aufbaute und dann aussah wie ein Miniaturpreisboxer. Dazu kam eine stupsige Nase, struppiges naturblondes Haar und die zwar ausgeprägten, aber ebenfalls blonden Augenbrauen. Selbst wenn ich akzentfrei Italienisch sprach, glaubte mir keiner, dass ich sizilianische Wurzeln hatte.
Immerhin schien irgendwer da draußen Sinn für Humor zu haben, denn ein Punkt fehlte Mam zur perfekten Klischeemutter: Sie konnte nicht kochen. Das war umso heimtückischer, weil jeder Durchschnittsdeutsche von einer Halbitalienerin die beste Pasta der Welt erwartete. Aber Mams Nudeln verklebten immer oder waren innen steinhart und außen schleimig.
Ich streifte Schuhe und Jacke ab und näherte mich vorsichtig schnuppernd der Küche.
Ohne Tiefkühlmahlzeiten hätte ich meine ersten sieben Lebensjahre vermutlich nicht überstanden. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass Auftauen kein Synonym für Kochen ist. Ich war Mam regelrecht dankbar, als sie sich in Torsten verliebte, denn mit ihm kam Essen in mein Leben, gutes, echtes Essen. Er schwor nämlich auf Mitbringmahlzeiten aus Restaurants und To-Go wurde das neue Aufwärmen.
Als Mam schwanger wurde, war ich acht, nur ein bisschen älter als Lilli heute. Bevor sie geboren war, hatte ich bereits entschieden, dass meine Schwester kein To-go-Kind werden würde. Also lernte ich kochen. Erst Nudeln mit Tomatensoße, später Risotto und noch später Soufflés – alles mithilfe von YouTube-Kochtutorials mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Schritt für Schritt gelang es mir auch, Mam vom Herd zu verbannen. Seit ein paar Jahren war die Küche ganz offiziell mein Terrain. Ich versuchte, es nicht persönlich zu nehmen, dass Lilli trotz meines Kochfetisches seit einem halben Jahr ausschließlich Reis mit Sojasoße aß.
Mam jedenfalls, das war der Deal, kochte nur in Notfällen. Eine vierzig Minuten verspätete Mara war definitiv kein Notfall. Verwundert lehnte ich mich an die Küchentür und beobachtete, wie sie mit zusammengepressten Lippen, die Zungenspitze dazwischengeschoben, in einem Topf rührte.
»Mam!« Ich konnte den genervten Ton in meiner Stimme nicht verbergen. »Was machst du denn?«
Sie fuhr herum.
»Mara!«, rief sie begeistert. »Da bist du ja.« Sie platschte mit dem Kochlöffel im Topf herum, Tropfen von irgendwas flogen durch die Luft. »Ich dachte, ich fang’ schon mal an zu kochen!«
»Superidee.« Ich riss ein Stück Papier von der Küchenrolle und wischte das Gesprenkel von den Fliesen.
»Keine Angst! Ich wärme nur dein Curry von vorgestern auf.«
Zu sagen, dass ich erleichtert war, wäre gnadenlos untertrieben. Ich drückte ihr einen dankbaren Kuss auf die Wange und drehte, nebenbei und unauffällig, die Gasflamme herunter. Dann schenkte ich mir ein Glas Wasser ein und verzog mich in mein Zimmer.
Beim Reinkommen stellte ich – ein Reflex, den ich mir abgewöhnen sollte, aber nicht wollte – den Fernseher an und ließ mich aufs Bett fallen. Ich war gerade dabei, eine Nachricht an Sirîn zu tippen, als die Atmosphäre im Raum kippte. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass das an der Stimme des Moderators lag, der die Berichterstattung von einem Celebrity-Event unterbrach. Ich sah auf. Ein magerer Mann in viel zu dünnem Jackett stand vor einer U-Bahn-Station. Seine Haut war blass, seine Wangen gerötet, was ihn gleichermaßen verwirrt und euphorisch wirken ließ. Die Treppen, die hinter ihm zur U-Bahn hinabführten, wurden von zwei Polizisten bewacht. Ein Absperrband flatterte von Geländer zu Geländer. Rechts hinter dem Reporter war das U-Bahn-Schild zu erkennen, am Haus links von ihm prangten eine Reihe grüner Leuchtbuchstaben. … K-T-H-A-L-L-E, entzifferte ich.
Moment mal! War das etwa …? Ich schob mich näher zur Bettkante und kniff die Augen zusammen.
Ach du Scheiße! Das war hier. In Hannover! Der Typ stand vor der Markthalle! Weiter im Hintergrund erkannte ich jetzt auch die roten Backsteingebäude an der Karmarschstraße und die angestrahlte Marktkirche.
Und Polizei.
Jede Menge Polizei.
»Mam?«, wollte ich rufen, aber es kam nur ein Krächzen raus, vielleicht weil mein Mund offen stand. Ohne den Fernseher auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, durchwühlte ich das Bett nach der Fernbedienung, stellte lauter und warf sie neben mich. Mein Blick klebte am Bildschirm, ich wagte nicht zu blinzeln. Irgendetwas war passiert, und zwar hier, an der Markthalle. Meiner Markthalle!
Der, in der ich früher manchmal mit Mam gegessen hatte, wenn sie mich von der Schule abgeholt hatte, in der wir noch immer unser Obst und Gemüse kauften, der Markthalle, die Torsten »Den Bauch« und Mam »Das Herz von Hannover« nannte. Was …?
»… gerade den Bahnhof Kröpcke verlassen …« Der Mann sah starr in die Kamera und betonte jede Silbe, als wäre er Deutschlehrer und die Zuschauer allesamt begriffsstutzig. »… und befand sich mitten im Tunnel. Wenige Sekunden, bevor der Zug der Stadtbahn in den Bahnhof Markthalle-Landtag einfahren sollte, vor dem ich hier stehe, um genau siebzehn Uhr sechsunddreißig …« Ungläubig starrte ich auf den Fernseher. »… riss eine Detonation einhundertzweiunddreißig Menschen in den Tod. Mehrere Hundert sind …«
Siebzehn Uhr sechsunddreißig.
Aber da war ich doch …
Mitten im Tunnel.
Die Polizei geht von einem Attentat aus.
In meinem Kopf dehnten sich die Worte gegen die Zeit; in den Sekunden zwischen den Worten dehnte sich die Stille.
Ich löste den Blick von dem bleichen Reporter, schaute auf mein Handy, klickte die angefangene Nachricht an Sirîn weg und suchte die, die ich Mam geschrieben hatte.
Versendet um17:35. Der Raum um mich herum beschlug wie meine Brille, wenn ich den heißen Ofen öffnete. Nur dass ich gerade Linsen trug und das Zimmer kein Ofen war … Das Handy in meiner Hand begann zu zittern. Ich versuchte, das Bild auf dem Fernsehbildschirm wieder scharf zu stellen. Als es mir gelungen war, las ich den Fließtext, der unter dem Bild entlangrollte.
+++ Eilmeldung +++ Explosion im U-Bahn-Tunnel +++ 132 Tote in der U9 ++ Hunderte Verletzte +++ Polizei geht von einem Anschlag aus +++ Eilmeldung +++ Explosion im U-Bahn-Tunnel +++132 Tote in der U9 +++ Hunderte Verletzte +++ Polizei geht von einem Anschlag aus +++ Eilmeldung +++ Explosion im U-Bahn-Tunnel +++132 Tote in der U9 +++ Hunderte Verletzte
»Essen!«, rief Mam.
Für einen Moment war ich unfähig zu reagieren. Ich tastete erneut nach der Fernbedienung, und als ich sie fand, presste ich den Knopf, presste ihn schnell, fest, noch einmal. Dann stand ich wie fremdgesteuert auf, steckte mein Handy in die Tasche und ging zur Küche. Die Welt um mich herum blieb beschlagen.
*
Ich konnte nicht schlafen. In meinem Kopf tobten die Gesichter aus der Bahn – der Mann, der mich mit der Bist-du-bescheuert-Geste bedacht hatte, die Mutter mit dem Baby, die Jungsgruppe.
Die Mutter mit dem Baby.
Die Bilder verwischten und verwoben sich mit Mams Entsetzen, Torstens Unglaube, Lillis Verwirrung, Sirîns Sorge.
Als ich es endlich geschafft hatte, wieder klar zu sehen, hatte ich meiner Familie von dem Anschlag erzählt – und davon, dass das genau die Bahn war, die ich verpasst hatte. Torsten hatte mich ungläubig angestarrt und dann sein Handy gezückt und den Newsfeed gecheckt, obwohl Handys bei uns am Tisch verboten waren.
»Ach du lieber Himmel«, hatte er gestöhnt. Und: »Warum hat meine Warn-App mir das nicht gemeldet?«
Mam hatte vor ihrem Teller gesessen und die Hände gehoben, beide gleichzeitig, und mit ihnen in der Luft neben ihrem Kopf gewackelt. »Mein Gott!«, hatte sie gerufen. »Meingottmeingottmeingott! Du hast einen Schutzengel gehabt! Einen Schutzengel! Stell dir vor, was passiert wäre, wenn du nicht gestolpert wärst …«
»Das stellen wir uns nicht vor.« Mit einem warnenden Seitenblick auf Lilli war Torsten ihr über den Mund gefahren. »Es nützt nichts, sich da reinzusteigern. Sie ist dem Teufel von der Schippe gesprungen und gut ist.«
»Dem Tod«, korrigierte Mam ihn. »›Dem Tod von der Schippe gesprungen‹ heißt das.«
Torsten grunzte. »Das Ergebnis ist das Gleiche, oder?«
Dann hatten sie geschwiegen, beide, und gegessen. Selbst Lilli hatte die Anspannung gespürt und still ihren Reis gelöffelt. Und ich? Hatte keinen Bissen runtergekriegt, dabei war das Curry nicht mal angebrannt.
Gott. Mir gingen die Worte vom Abendessen durch den Kopf, als ich im Bett lag, eine Wärmflasche auf dem Bauch und das Handy in der Hand. Schutzengel. Teufel. In einer Familie, in der keiner eine Bibel besaß. Torsten kam aus der ehemaligen DDR, er hatte es nie besonders mit Religion gehabt. Und Mam war gleich nach meiner Geburt, als Papa gerade gestorben war, aus der Kirche ausgetreten und hatte, zum Entsetzen ihrer sizilianischen, tiefkatholischen Mutter, nie wieder einen Fuß hineingesetzt. »Ein Gott, der grausam genug ist, eine frischgebackene Familie auseinanderzureißen, kann mir gestohlen bleiben«, hatte sie erklärt und dabei war es bis heute geblieben. Aber wenn die eigene Tochter beinahe einem Anschlag zum Opfer fällt, bricht ihr alter Glaube eben doch durch. Wenn auch nur in Form von Phrasen.
Schutzengel, dachte ich erneut.
Der einzige Mensch, den ich kannte und bei dem das ganze Gottesgetue glaubwürdig wirkte, war Sirîn. Deren Reaktion (»Allah sei gepriesen!«) war echt. Genau wie die Nachricht, die sie hinterherschickte, als öffentlich gemacht wurde, wer sich zu dem Anschlag bekannt hatte.
»Diese blöden Arschlöcher mit ihrem kranken Scheiß«, hatte sie geschrieben.
Und dann, ein paar Minuten wütenden Schweigens später: »Himmel, Mara, stell dir mal vor! Was würde ich denn ohne dich machen?«
Oder ich ohne dich, hatte ich gedacht. Wobei ich sie ja gar nicht vermissen könnte, wenn ich tot wäre … Ich hatte an Torsten gedacht und seinen Rat, mich nicht reinzusteigern, hatte »Ist ja noch mal gut gegangen« getippt, das Handy endlich aus der Hand gelegt und das Licht ausgeschaltet. Mein Hirn konnte ich leider nicht ausschalten.
*
Beim Aufwachen war ich dann wirklich tot. Mein ganzer Körper war steif, meine Augen wollten sich nicht öffnen.
Die Mutter mit dem Baby.
Zweieinhalbmal lief mein aktueller Lieblingssong »Auf und davon«, bis ich endlich in der Lage war, den Wecker auszustellen und meinem Körper die notwendigen Befehle zu erteilen, die ihn ins Bad brachten, ihn duschten, seine Zähne putzten, die Kontaktlinsen in die Augen balancierten, ihn anzogen. Dann dirigierte ich mich in die Küche.
Mam saß am Tisch, eine große Tasse Kaffee vor sich.
»Torsten schon weg?« Meine Stimme hörte sich an wie eine Gitarre nach einer nassen Nacht im Freien.
»Seit einer halben Stunde. Bringt Lilli zur Schule, damit wir noch ein bisschen Zeit miteinander haben. Trinkst du einen Kaffee mit mir?«
Gute Frage. Ein Teil von mir wollte alles, nur nicht sitzen, alles, nur nicht reden. Nichts, nur weg. Der andere Teil, der tote, war zu erschöpft, um Nein zu sagen. Ich warf einen Blick auf die Uhr über der Tür. Mir blieben zwanzig Minuten, bis ich zur Schule radeln musste. Ich sah Mam an, ihren Blick, der morgendlich verschleiert auf meine Antwort wartete. Ich nickte. Vielleicht würde der Kaffee mich retten. Kaffee war gut und nötig und Kaffee war selbst mit Mam safe, denn den machte die Maschine.
Sie stand auf, nahm meine Lieblingstasse, die wärmeempfindliche, die sich verfärbte, wenn man etwas Heißes hineingoss, und schob sie auf das Gitter der Maschine. Drückte auf das Display, wartete. Mein Kopf krallte sich dankbar an diese Erinnerung: Lilli hatte mir die Tasse geschenkt, als ich vierzehn geworden war. Ich weiß gar nicht, wer begeisterter von dem Ding war – sie oder Mam oder ich. Jedenfalls hatten wir zu dritt um die Tasse herumgestanden, immer abwechselnd heißes und kaltes Wasser hineingegossen und über die Farbveränderung gelacht. Dunkelgrün war »kalt«, hellgrün »heiß«. Mittlerweile besaß jedes Familienmitglied eine: Lillis war pink, Torstens orange, Mams blau. Die tollste aber hatte ich Sirîn zu Weihnachten geschenkt: Ihre Tasse war schwarz, und wenn man was Heißes hineingoss, tauchten darauf lauter Tiefseefische mit glühenden Augen auf. Sie liebte das Teil und taufte es ihren Blickwinkelwechsler, und weil ich das Wort so hammer fand, haben wir unser gemeinsames Kochblog so benannt.
Nach einer Tasse.
Als Mam jetzt meine vom Gitter zog, war sie lindgrün geworden und dunkelte ins Apfelgrün, als sie Milch dazugoss. Sie drückte mir den Becher in die Hand und mich, sanft, auf einen Stuhl.
»Müsli?«, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf, umklammerte die Tasse und hielt mich am Kaffeeduft fest.
»Weißt du …«, begann sie zaghaft, als sie sich wieder setzte.
»Was?« Hitzedunstwölkchen stoben auf, als ich hineinsprach. Am liebsten hätte ich die Worte in den Kaffee hineingeblubbert.
»Also … Gestern Abend hat Sirîns Bruder angerufen.«
»Adyan?«
Sie nickte.
»Warum?«
»Er wollte wissen, ob Sirîn hier ist.«
»Und?«
»Wie: Und?«
»Was hast du gesagt?« Ich blickte sie lauernd über den Kaffeebecher hinweg an.
»Die Wahrheit.« Diesmal war es Mam, die in ihren Kaffee murmelte.
Der Tod wich schlagartig aus meinen Gliedern. Hellwach und ungläubig starrte ich meine Mutter an. »Ganz toll.« Mehr konnte ich nicht sagen. »Ganz, ganz toll, Mam!«
Die arme Sirîn. Ihre Eltern waren Glucken. Liebend, überbeschützend, streng. Glucken eben.
»Wenn man eine Reportage über kurdische Mädchen in Deutschland machen würde – ich wär’ die ideale Protagonistin«, frotzelte Sirîn gern. »Die Reportage würde natürlich Zwischen den Welten heißen und ich wär’ die zerrissene Tochter, die lieber im Skatepark abhängt, aber jeden Abend pünktlich zu Hause sein muss. Und dann Großaufnahme von Bavo, der voller Stolz erzählt, dass seine volltollintegrierte Tochter aufs Gymnasium geht und später mal Lehrerin werden wird. Und Yadê, wie sie mir die Wange tätschelt, und dann gucke ich mit tapferem Blick in die Kamera und sage, dass es mir gar nichts ausmacht, dass Kino abends echt nicht so wichtig ist, weil ich mir eh nix Schöneres vorstellen kann, als jeden Abend zu Hause mit Yadê in der Küche zu stehen, und dass Lehrerin mein übelster Traumberuf ist.« Dann tat sie, als ob sie sich den Finger in den Hals stecken würde, aber ich wusste, dass sie übertrieb. Sie liebte ihre Familie und das Kochen liebte sie auch. Bloß dass sie eben manchmal abends wegwollte – und zwar am liebsten zum Skaten.
Wir hatten also einen Plan ausgetüftelt, damit sie das machen konnte, ohne zu Hause eine Krise auszulösen: Seit einem halben Jahr trafen Sirîn und ich uns offiziell einmal pro Woche nachmittags bei mir, um gemeinsam an dem Businessplan zu feilen, mit dem wir unser Blog ganz groß rausbringen wollten. Weil es ein Kochblog war und ich ein Mädchen ohne ältere Brüder, weil sie schwor, zum Abendessen zu Hause zu sein, weil wir nur eine Straße voneinander entfernt wohnten und meine Mutter eben meine Mutter war, hatten sich Sirîns Eltern breitschlagen lassen.
Seither saßen wir alle zwei Wochen an dem Blog-Plan und den anderen, ergaunerten Frühabend verbrachte Sirîn in der Halfpipe. Vorher kam sie bei uns vorbei – für den Fall, dass ihre Eltern sie beschatteten, und um ihr Board zu holen, das wir unter meinem Bett deponiert hatten, und meistens ging ich mit, um zuzugucken. Wie gestern auch. Nur dass ich eben gestern …
Nicht an gestern denken!
Ich starrte Mam an und beschoss sie mit Giftgedanken, weil sie, ausgerechnet sie, Sirîn hatte auffliegen lassen. Sie verschanzte sich hinter ihrer Kaffeetasse.
»Ich war so geschockt von dem … Attentat, ich habe es einfach vergessen«, gestand sie kleinlaut. »Und Adyan hat gesagt, seine Mutter würde sich verrückt machen vor Sorge! Weil sie von der Sache gehört hatten und es dunkel war und Sirîn noch nicht zu Hause.«
»Natürlich nicht!«, schoss ich. »Sie war ja im Skatepark!«
»Natürlich nicht«, wiederholte sie. »Natürlich.«
Ich nahm die roten Flecken wahr, die an ihrem Hals hinaufzogen, und ich wusste, dass sie damit kämpfte, dass ausgerechnet sie, die progressive, feministische Zeitgeistmutter, die selbstverständlich die arme kurdische Freundin ihrer Tochter deckte, wenn die mal ein bisschen skaten wollte, dass ausgerechnet sie versagt hatte. Ich fühlte, wie mein Giftspeicher leerlief, und stand abrupt auf.
»Ich muss los.« Ich stürmte aus der Küche, raffte meine Sachen zusammen und schlug die Wohnungstür hinter mir zu.
*
Leider hatte ich bei meinem überstürzten Abgang die Handschuhe vergessen. Meine Fingerspitzen waren vollkommen gefühllos, als ich an der Schule ankam. Passend zu meinem Innenleben. Ich schloss das Rad an und tippte mit tauben Fingern eine Nachricht an Sirîn.
Sirîn antwortete sofort.
Verdammt. Einen mikroskopisch kleinen Moment dachte ich darüber nach, sie anzurufen, aber Sirîn hasste Telefonieren, also chatteten wir ausschließlich, immer schon, das aber in jeder freien Minute, und manchmal gab’s eine Sprachnachricht. Ich beschloss abzuwarten, stopfte das Handy in die Hosentasche und betrat den Schulhof.
Er war zu voll für die Temperatur, als hätten alle schlagartig ein übergroßes Bedürfnis nach Frischluft entwickelt und, die Älteren, nach Nikotin. Im Vorbeilaufen sah ich Chriso, der umringt von seinen Jüngern wild gestikulierend bei den Raucherbüschen stand. Adyan war nicht bei ihnen, obwohl er eigentlich zu diesem Kreis dazugehörte. Ich lief schnell weiter und umschlängelte dabei all die Grüppchen, die die Köpfe zusammensteckten. Doch auch aus der Ferne schnappte ich verstohlen getuschelte oder betont laute Hast-du-schon-gehörts und Stell-dir-nur-mal-vor-wenns auf. Von rechts, links, von den Fünftklässlern bis zur Oberstufe: alle, alle, alle sprachen davon. Aber nicht ruhig oder sachlich, sondern ängstlich, laut und panisch. Sie sprachen davon, als hätte es was mit ihnen zu tun. Als ob sie dabei gewesen wären, als ob sie jemanden kennen würden, der dringesessen hatte … oder eben jemanden, der fast dringesessen hatte.
Wie ich.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis rauskommen würde, dass ich diese Fast-Person war. Von mir aus lieber später als früher. Erst mal musste ich selbst die Situation verdauen und vor allem musste ich Lyd davon erzählen. Schließlich war sie meine beste Freundin an der Schule und außerdem die Ruhe selbst – sie würde nicht kreischen und auch nicht sensationslüstern nachbohren, sie würde mich verstehen. Ich zog die Mütze tiefer ins Gesicht, senkte den Blick und schritt durch die Mutmaßungen und die Ängste, die Vorverurteilungen und die Hysterie.
Ein Spießrutenlauf, hatte der Lugner in Geschichte mal erklärt, war früher eine hohe Strafe gewesen. Ziemlich oft endete er tödlich. Jemand musste dem Lugner während seines Referendariates erzählt haben, dass man Jugendliche mit blutrünstigen Geschichten kriegt, weshalb er immer ein bisschen zu plastisch erzählte.
Als ich über den Schulhof lief, krampfhaft darum bemüht, keine Blicke zu fangen und nicht um mein Entsetzen gebeten zu werden, fiel mir also nicht nur das Wort Spießrutenlauf ein, sondern – Danke, Lugner – auch die durchbohrten Körper, die an dieser Redewendung hingen. Passend dazu rissen mir die Satzfetzen, die mich umfegten, die Haut auf. Ich sank in mich zusammen und ich beschleunigte meinen Schritt.
Am Treppenabsatz zur zweiten Etage lungerte die dreiköpfige Hydra. Lyd hatte die Mädels so getauft, weil jeder Kontakt mit ihnen gefährlich war. Die Hydra mobbte, was das Zeug hielt, on- wie offline, und mit perverser Leidenschaft. Besser, man mied die drei großräumig – was schwierig war, wenn man ausgerechnet mit ihnen in dieselbe Klasse ging, so wie Lyd und ich.
»Hey, Mara«, zischte Hydra eins träge, als ich mich an ihnen vorbeidrücken wollte. Hydra zwei hielt mich am Arm fest. »Haste schon gehört?«
»Wer nicht?«, brummelte ich, machte mich los und steuerte den Klassenraum an. Als ich die Tür erreichte, zitterten meine Beine, als hätte ich zu Fuß die Erde umrundet.
*
Lyd lungerte schon an ihrem Platz und unterhielt sich mit Nicolaj. Er war neben Lyd mein einziger Freund an der Schule. Außerhalb gab es noch Sirîn, also hatte ich insgesamt drei, wobei Sirîn eigentlich doppelt zählen müsste und Nicolaj nur halb.
Dass Nicolaj nur noch ein halber Freund war, hatte ich mir selbst zuzuschreiben. Die gigantische Idee, mit meinem allerbesten Freund mein erstes Mal zu haben, war leider gar nicht so gigantisch gewesen … Dabei hatten wir das zusammen beschlossen, Nicolaj und ich, weil wir beide neugierig waren und von wegen Vertrauen und so – schließlich kannten wir uns schon seit der Grundschule. Und ganz ehrlich: Ich hatte ja nicht ahnen können, dass er sich nach diesem einen Mal gleich in mich verlieben würde!
Maximal blöd gelaufen.
Das war vor den Sommerferien gewesen. Aber kaum hatte die Schule wieder angefangen, hatte er Lyd (ausgerechnet!) gesteckt, dass er mir noch immer nicht verziehen hatte, dass nicht mehr aus uns geworden war. Mir gegenüber tat er zwar so, als wäre alles gechillt, aber manchmal, vor allem wenn er betrunken war, schickte er mir wütende oder bettelnde Nachrichten. In stummem Einverständnis benahmen wir uns beide am nächsten Tag, als hätte ich sie nie bekommen und er sie nie verschickt.
Deshalb war Nicolaj über die Sommerferien von allerbester Freund zu »es ist kompliziert« abgerutscht, aber wir taten unser Bestes. Mein Bestes war, dass ich mich so kumpelig wie möglich gab und versuchte, mich nicht darüber aufzuregen, dass Nicolaj mit der hohlen Annabell flirtete.
Auch jetzt, selbst im Gespräch mit Lyd, hatte er den Arm um ihre Schulter liegen. Urgs. Als ich meinen Rucksack neben den Tisch und mich selbst rücklings auf den Stuhl plumpsen ließ, blickten mich alle drei erwartungsvoll an.
»Krass, oder?«
Ja, nickte ich ergeben. »Voll krass.«
Es war ein perfekter Moment, um Lyd und Nicolaj von gestern zu erzählen. Ich sammelte meinen Mut, dann fiel mein Blick auf Annabell. Die schmiegte sich an Nicolaj, als ob sie mit ihm verwachsen wollte, die Augen noch weiter aufgerissen als sonst. Ihre falschen Wimpern waren immer schlecht aufgeklebt, aber heute lag ein gefühlter Zentimeter zwischen den echten und den falschen, was sie aussehen ließ wie eine übernächtigte Drag Queen.
»Nicolaj sagt, Chriso war dabei.«
Der perfekte Moment verpuffte.
Dabei.
Ohne weitere Erklärung. Schließlich wusste jeder, worum es ging, und offensichtlich brannte jeder, außer mir, darauf mitzureden. Weil mitreden wichtig war. Noch wichtiger war nur: dabei gewesen sein. Ausgerechnet Chriso.
»Echt?« Ich betete, dass es desinteressiert rüberkam. Bloß nicht violett werden, bloß nichts anmerken lassen. In Wirklichkeit rasten fünf ICEs gleichzeitig durch meine Nervenbahnen.
»Ja! Nicolaj sagt, Chriso sagt, dass er einen Typen mit einem Rucksack gesehen hat, der hat sich voll auffällig benommen! Er hat ihn sogar zufällig gefilmt, krass, oder? Er musste dann natürlich gleich eine Aussage machen! Bei der Polizei, wie heftig ist das denn bitte!«
Oh? Mein Kopf schmerzte von all den unausgesprochenen und ausgesprochenen Ausrufezeichen. Chriso war auch dort gewesen? Ich konnte mich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben … Wenn er da gewesen wäre, hätte ich das dann nicht spüren müssen? Die ICEs bremsten dröhnend ab und mein Körper wurde seltsam leer. Ich durchwühlte mein Gedächtnis nach Bildern, stieß aber nur auf eine Mauer aus Nebel, die sich über Nacht um gestern gelegt hatte.
»Hallo?« Nicolaj stupste mich mit der Fußspitze an. »Haste gehört? Chriso war dabei!«
»Dabei«, wiederholte ich und konnte ihn nicht anschauen. »In der U-Bahn?«
»Quatsch!«, sagte Annabell. »Natürlich nicht in der Bahn! Dann wär’ er ja wahrscheinlich …« Das Tremolo in ihrer Stimme klang erschütternd echt.
Nicolaj sprang ein. »Er hat am Kröpcke auf die Bahn zur Lister Meile gewartet und stand auf dem gegenüberliegenden Gleis, verstehst du?«
»Was hat er denn da gemacht?« Ich gab wirres Zeug von mir. »Wollte er shoppen gehen? Und woher weißt du das?« Nebel, überall Nebel. Ich blickte Lyd Hilfe suchend an. Wie lange würde dieses absurde Gespräch noch dauern?
»Shoppen?«, wiederholte Nicolaj verständnislos. Als wir noch ganze Freunde gewesen waren, hätte er gelacht und darüber gewitzelt, dass Chriso seine Klamotten natürlich ausschließlich in »den Staaten« bestellte und garantiert nicht auf der Lister Meile kaufte, aber mein halber Freund runzelte lediglich die Stirn und sah mich an, als wär’ ich nicht mehr ganz dicht. Stimmte wahrscheinlich auch. »Keine Ahnung, was er da wollte! Ist doch auch total egal, der Punkt ist: Er war da, am Bahnsteig gegenüber, und hat alles genau verfolgt! Und er sagt, es gab einen Tumult und dann kam dieser Typ mit dem Rucksack und die Bahn ist weggefahren und keine Minute später – BÄMM! Er sagt, die ganze U-Bahn-Station hat gewackelt, als die Bombe hochgegangen ist. Obwohl die Bahn da schon fast am Landtag war! Stell dir das mal vor!«
»Der Tunnel«, murmelte Lyd, »… hat wahrscheinlich die Druckwelle verstärkt.«
»Und danach«, Annabells Stimme zitterte vor Erregung, »danach war alles voll mit kreischenden Menschen, sagt Chriso.«
»Bämm?«, echote ich. »Sagt Chriso?«
Ich konnte nicht anders, es war zu bescheuert. Durch den Nebel hindurch spürte ich Wut. Scharfe, klare Wut. Chriso verdiente kein bisschen meines Violetts, dieser aufmerksamkeitssüchtige, alles filmende Arsch. »Was für ein Loser! Er war überhaupt nicht da, ich hätte ihn doch …«
Erschrocken brach ich ab. Das war einer dieser Momente, über den Sirîn später die Augen verdrehen würde. Weil es eine Chance war, die ich, natürlich, mal wieder, nicht ergriff: Ich könnte meine Geschichte erzählen und Chriso schrumpfen lassen, aber zu seinem Glück (und garantiert zu Sirîns Bedauern) war ich nicht nur noch immer verschwommen vor Schreck, sondern wahrscheinlich auch die Einzige an dieser Schule, die noch nie ein Selfie gepostet hatte. Was alles über mich sagt.
Leider war Lyd, die bis dahin geschwiegen hatte, nicht umsonst ein Mathegenie. Und sie hatte zugehört, gut zugehört, und kombiniert und …
»Nicht dein Ernst!«, rief sie. »Du warst auch da?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:



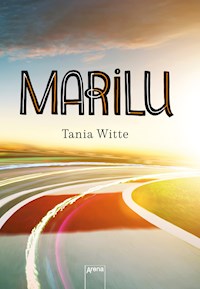












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












