
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender Coming-of-Age-Roman über Sehnsüchte, Identität und Toleranz. Und die großen Fragen des Heranwachsens: wer bin ich und was sehen die andern in mir? In Pauls Leben läuft alles schief: Er liebt ein Mädchen, das er nicht bekommen kann, ist Frontmann einer Band, in der alle besser singen als er selbst und jedes Gespräch mit seinem Vater endet in einer Brüllorgie. Als er dann auch noch erfährt, dass er nicht der biologische Sohn seiner Eltern ist, scheint das Leben am Höhepunkt von "kompliziert" angekommen. Allerdings ahnt er da noch nicht, was die Suche nach seiner Mutter aufdecken wird … und dass die Erfüllung seiner Sehnsucht nicht der einzige Weg zum Glück ist. Die preisgekrönte Autorin Tania Witte schreibt authentisch und ehrlich mit viel Einfühlungsvermögen und Humor über die wichtigste Frage im Leben: wer bin ich? Weitere Titel von Tania Witte im Arena Verlag: • Marilu • Die Stille zwischen den Sekunden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Weitere Bücher von Tania Witte im Arena Verlag:Marilu
Die Stille zwischen den Sekunden
Weitere Bücher als Ella Blix im Arena Verlag:Wild. Sie hören dich denken
To honor those who came before us
Tania Witte
ist Schriftstellerin, Journalistin und Spoken-Word-Performerin. Sie lebt und schreibt hauptsächlich in Berlin und am liebsten in Den Haag (NL). Neben diversen (inter)nationalen Stipendien erhielt sie zahlreiche Preise, unter anderem 2017 den Martha-Saalfeld-Förderpreis für Literatur sowie 2019 den Mannheimer Feuergriffel für »Marilu«. Im selben Jahr wurde ihre Arbeit mit einem Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds gefördert. »Die Stille zwischen den Sekunden« erhielt das KIMI-Siegel für Vielfalt im Jugendbuch.
Ein Verlag in der Westermann Gruppe
Zu diesem Titel stehen Unterrichtserarbeitungen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
1. Auflage 2022
© 2022 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Str. 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Textcopyright: © 2022 Tania Witte
Abdruckgenehmigung S. 91: Jörn Pfennig. GRUNDLOS ZÄRTLICH, Lüchow: Edition Talberg 2009, S. 12, ISBN 978-3-9813473-0-2
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, unter Verwendung von Bildmaterial von © Shutterstock, © michealjung (Bildnummer: 102482123) und © groodday28 (Bildnummer: 258918545)
Lektorat: Nikoletta Enzmann
E-Book ISBN 978-3-401-81028-7
Besuche uns auf:www.arena-verlag.de
@arena_verlag
@arena_verlag_kids
1
Blaue Lichtstrahlen durchzucken die Nebelschwaden, die Luft ist gesättigt von Schweiß. Der Nebel umwabert Menschen, die springen, tanzen, toben. Über ihnen die DJ-Kanzel, aus der Beats peitschen, die sie antreiben. Meine Beats. Der silberne Glitzerstern auf meinem schwarzen Lieblingsshirt funkelt in dem Kegel des Scheinwerfers, der auf mich gerichtet ist. Meine strubbeligen Haare sind an den Seiten kurz geschoren, eine große schwarze Sonnenbrille schützt meine Augen vor dem flackernden Licht.
How I wish
– der Bass trägt meine verzerrte Stimme durch den Raum –
How I wish
– die Klänge dringen in die Ohren der Menschen –
I wish
– in die Poren –
I wish
– in die Zellen –
I wish
– alles schwingt.
Everything draws me to you, to you,
you-ohoh,
you-ohoh,
emptiness
Ich spüre, wie mit jedem Beat eine Reihe von Leuchtdioden an der Wand hinter mir aufblitzt, Silbe für Silbe malen sie meine Worte, meine Gefühle, in grellem Grün:
emp ti ness
lone li ness
Der angesagteste Club Berlins pulsiert in meinem Rhythmus. Meine rechte Hand schlägt den Beat in die Luft, die andere klebt an den Reglern, als sich von hinten ein Arm um meine Taille schlingt. Ich neige den Kopf, mir weht ein Duft in die Nase und einen Moment lang gerät die Welt aus dem Takt. Amira.
How I wish
und alles, was ich fühle ist –
»Bist du krank?«
Ich schüttelte mich zurück in die Realität, in der vor mir keine Mischpulte standen, sondern ein zerkratzter Schultisch, und ich auf einem unbequemen Plastikstuhl saß mit Blick auf das Whiteboard, auf das unser Lehrer eine Reihe lateinischer Vokabeln geschmiert hatte. Der Klassenraum um mich herum war leer. Verwirrt fuhr ich mir durchs Haar, spürte die Stoppeln an der Seite und hielt mich an den längeren Strähnen am Oberkopf fest. Immerhin der Geruch stimmte mit dem in meiner Fantasie überein: Salmiakpastillen und Melissenhaarseife. Amira.
»Krank?«, echote ich und wandte mich zu ihr. Sie thronte rechts von mir, falschrum auf einem Stuhl, hatte die Arme auf der Rückenlehne abgestützt und betrachtete mich aufmerksam. »Wieso sollte ich krank sein?«
Sie kicherte auf ihre flüchtige Amira-Art – beinahe lautlos, als wäre es nur für sie selbst bestimmt. Dabei hob sie den linken Daumen und tippte mit dem rechten Zeigefinger dagegen. »Erstens«, begann sie, »hast du den Gong verpasst. Zweitens«, Zeigefinger gegen Zeigefinger, »sind die anderen schon seit Ewigkeiten draußen und drittens«, ihr Zeigefinger tippte nun auf den Mittelfinger, mehrmals, und verharrte dort, »drittens glänzen deine Augen so komisch.«
Weil ich ihr unmöglich die Wahrheit über die Tagträume erzählen konnte, die mich durch den Lateinunterricht (und eigentlich durch mein ganzes Leben) retteten, deutete ich auf das Whiteboard.
»Ich hab einfach sehr intensiv über die Bedeutung des Wortes miraculus nachgedacht.« Ich versuchte, das Näseln unseres Lateinlehrers nachzuahmen. Gelang eher mittelmäßig, aber Amira ließ es mir durchgehen, während sie ihre Sachen packte.
»Ja, nee, is klar.« Sie konnte nicht nur still in sich hineinkichern, sie konnte auch in Worte hineinkichern. Ich hasste Latein, das wusste sie.
Was sie nicht wusste, war, dass ich es nicht bloß gewählt hatte, weil das die Bedingung meines Vaters war: Wenn ich Musik als Leistungskurs belegen wollte, müsse ich Latein behalten. Ein Kurs fürs Herz, einer für den Geist, hatte er gefordert. Als würde mir Latein was nützen, wenn ich Musikproduktion studieren würde. Was sollte ein DJ und-oder Producer mit Latein?
Eben.
Trotzdem hatte ich so schnell nachgegeben, dass wir nicht mal dazu gekommen waren, uns anzuschreien, denn – und das war der Punkt, den ich Amira verschwiegen hatte – Latein zu behalten, bedeutete, Extrazeit mit Amira verbringen zu können.
An meinem Vater rächte ich mich für seine Erpressung, indem ich während Latein von Musik träumte. Auch wenn sich in diese Träume immer meine beste Freundin schlich.
Kurz verlor ich mich in ihrem vertrauten Gesicht, mit der leicht schiefen Nase und dem Ring im Nasenflügel und der forschenden Miene und spürte das vertraute Sehnen in meinem Bauch. Ich hatte mich in dem Moment in sie verknallt, als ich sie vor fünf Jahren zum ersten Mal gesehen hatte. Da waren wir beide elf gewesen, sie war neu in unsere Klasse gekommen mit ihrem immer wirren dunklen Haar und den Augen, die mich an Drei-Sorten-Schokolade-Cookies erinnerten, und ich hatte hilflos dabei zusehen müssen, wie sich mein Herz ohne Vorankündigung aus mir gelöst und ihr in die Arme geworfen hatte. Bildlich gesprochen. Leider war mein Herz ziemlich hart aufgeschlagen, aber es weigerte sich hartnäckig, zu mir zurückzukehren.
Amira boxte mich gegen den Oberarm, wie jedes Mal, wenn ich in meinem Kopf verschwand. »Du denkst zu viel und teilst zu wenig«, hieß das und meistens lag sie damit richtig. Es gab in der Tat zwei Pauls: einen in meinem Kopf und einen anderen, den der Rest der Welt sehen konnte. Sie hatten wenig miteinander zu tun.
Zu meinem Bedauern schien Amira die äußere Version lieber zu mögen. Sie nannte sie Ru, nach RuPaul. Keine Ahnung, warum eigentlich. Vielleicht fand sie meinen Namen zu unglamourös für den Sänger einer Schulband.
Deshalb gab es den äußeren Paul, den nicht interessierte, was andere dachten. Seinetwegen und auch wegen RuPaul’s »Drag Race« zog ich mittlerweile Sachen an, die andere schräg fanden, und lackierte mir die Nägel. Die Grenzen zwischen den beiden Versionen meiner selbst verschwammen immer öfter. Aber was hatte das mit meinem Namen zu tun? Paul, das war ich. Ru nicht.
Trotzdem schwieg ich und hoffte, dass Amira es an einem bestimmten Punkt selbst merken würde. Darauf wartete ich allerdings seit über drei Jahren vergeblich.
Irgendwann würde ich es ihr einfach sagen müssen. Das mit dem Namen und das mit … der Band.
»Komm endlich!« Amira war schon auf dem Weg in die Freiheit. Seufzend schaufelte ich meine Sachen in den Rucksack, stemmte mich hoch und hastete ihr hinterher. Nebeneinander quetschten wir uns durch die Tür und liefen den Gang entlang.
»Hast du bei deinem intensiven Gebrüte über lateinische Vokabeln zufällig mitgekriegt, dass die Schule für heute rum ist und draußen ein wunderschöner Sommertag auf uns wartet?«
Das Grinsen kam, ich konnte nichts dagegen tun. »Jetzt, wo du’s sagst«, erwiderte ich, und weil ich wusste, worauf sie hinauswollte, fügte ich hinzu: »Heißt das, wir sollten uns vor der Bandprobe ein Eis holen?«
Sie johlte auf und tanzte übermütig die Treppe runter. Ich war von ihrem Anblick dermaßen verzaubert, dass ich fast über einen Typen stolperte, der ausgestreckt auf der untersten Treppenstufe fläzte und auf seinem Handy herumscrollte.
»Scheiße, pass doch auf!« Er fuhr herum, um mich zu beschimpfen, aber als er erkannte, wen er vor sich hatte, wich sein genervter Gesichtsausdruck einem breiten Grinsen. »Hey, Mérida! Bisschen übertrieben mit Kiffen, was?« Er überging meinen irritierten Blick, der sich widerwillig von Amira löste. »Oh, verstehe: Du hast zu wenig Schlaf gekriegt.« Ein brüllendes, falsches Lachen. Ich rollte mit den Augen, aber er hatte sich bereits umgedreht. »Hey, Mira!«, schrie er. Und während ich mich fragte, warum Jungs an unserer Schule immer mit den Nach- und Mädchen mit den Vornamen angesprochen wurden, wandte sie sich bereits hüpf-tanzend um und winkte ihm zu. Er streckte den Arm mit gehobenem Daumen in ihre Richtung. »Cooler Auftritt letzte Woche!«
»Danke!« Sie deutete eine Verbeugung an. »Empfehlen Sie uns weiter.«
Er lachte und zwinkerte mir verschwörerisch zu. Ohne darauf zu reagieren, stapfte ich an ihm vorbei.
»Zu wenig Schlaf gekriegt«, knurrte ich, als ich neben Amira zum Stehen kam. »Na, wenn der sich mal nicht für megawitzig hält.«
»Lass ihn. Sollen sie denken, was sie wollen.« Sie stupste mit dem Zeigefinger gegen meine Nase. »Ist doch gut, wenn sie glauben, wir haben was miteinander. Das erhöht den Sexappeal der Band.«
Die Band, immer die Band. Glücklicherweise missinterpretierte sie das Stöhnen, das mir entfuhr.
»Ärger dich nicht. Hauptsache, wir kennen die Wahrheit.« Sie ahmte das verschwörerische Zwinkern unseres Fans nach.
Die Wahrheit war, dass unsere Beziehung rein platonisch war.
Platonisch.
War das auch lateinisch? Oder griechisch?
»Latein nervt«, lenkte ich ab.
»Nee«, widersprach sie. »Latein ist die beste Sprache der Welt.«
»Der toten Welt.«
Sie ignorierte meinen Einwurf. »Ich könnte einen Song auf Latein schreiben«, schlug sie vor, als wir durch die Halle Richtung Ausgang schlenderten. »Für die Band.«
Es war unglaublich, wie es ihr bei jedem Thema gelang, einen Bogen zur Band zu schlagen. Ich wünschte, ich würde genauso für Going Under brennen wie sie. Immerhin konnte ich meine mangelnde Begeisterung meistens überspielen, genau wie jetzt.
»Superidee! Das kommt bestimmt voll Potter-mäßig«, witzelte ich und sang übertrieben laut zu einer Melodie, die es nicht gab und die es auch besser nicht geben sollte: »Wingardium Leviosa, Petrificus Totalus, Lumos, Lumos, Expelli-ar-mus!«
Die letzte Silbe zog ich in die Länge, laut, lauter, malträtierte eine imaginäre Gitarre und ging in die Knie. Keine Ahnung, was mich ritt, der äußere Paul hatte diese Momente … Und wie das meiste, was dieser Teil von mir veranstaltete, fanden die vereinzelten Grüppchen, die im Eingangsbereich der Schule herumhingen, es nicht vollkommen gestört. Im Gegenteil: Ein paar von ihnen applaudierten sogar! Amira allerdings zog missbilligend die Brauen hoch.
»Das ist kein Latein, es tut nur so«, bemerkte sie bissig. »Und außerdem …«
Ich sprang in den Stand, zog meine Hose zurecht und schaute sie abwartend an.
»Potter geht echt gar nicht mehr.«
Womit sie, leider, recht hatte. Die Zaubersprüche würde ich dennoch nie vergessen, genauso wenig wie die Erinnerung an all die Abende, in denen meine Mutter die Bettdecke um mich herum festgestopft und mir in meinem dunklen Zimmer ein Kapitel nach dem anderen vorgelesen hatte. Das Licht der Stirnlampe hatte scharfe Schatten auf ihr Gesicht geworfen – und auf alles, was sie ansah. Es war gruselig und wundervoll gewesen. Diese Abende waren eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen. Und dann machte die Autorin mir das kaputt. Es war zum Heulen. »Stimmt, die Rowling«, klagte ich. »Die Welt ist grausam.«
»Vor allem ist sie immer in Bewegung.« Amira scheuchte zwei Jungs beiseite, die in der Schlange vor dem Getränkeautomaten anstanden, marschierte zur Tür und drückte sie mit dem Rücken auf. »Nach dir, Queen.«
Wir bummelten über den Schulhof und streunten durch die Straßen zu Alphi’s Eis, einem Laden, den Amira so sehr liebte, dass sie ihm sogar den falschen Apostroph verzieh.
Weiße Schokolade mit Pistazie, zwei Kugeln, für sie, Schoko-Spaghetti-Eis für mich. Schweigend lümmelten wir uns auf eine der grob gezimmerten Holzbänke vor der Eisdiele und beobachteten die vorbeihastenden Menschen. Hin und wieder hob Amira träge die Hand, um jemanden zu grüßen, der ebenfalls aus Richtung Schule an uns vorbeischlenderte. Keine Ahnung, ob sie jeden Menschen, dem sie zuwinkte, kannte, mir kamen die Gesichter wenig vertraut vor. Aber ich hatte ohnehin ein sagenhaft schlechtes Gedächtnis für Gesichter, was mir den Ruf einbrachte, arrogant zu sein. Warum mich trotzdem die halbe Schule mochte, war mir ein Rätsel. Der Sänger der Schulband zu sein, trug vermutlich dazu bei. Und das, obwohl ich nicht mal besonders gut sang, da waren sich alle einig, die Ahnung von Musik hatten.
»Okay, Ru, was ist los?« Amira legte die Hand auf meinen Oberschenkel.
Abgesehen von deiner Hand auf meinem Bein? Ich verkniff mir den Kommentar, weil das nirgendwohin führte und ich meine Gefühle für Amira im Griff behalten musste. Es kostete extrem viel Energie – Energie, die ich gerade nicht hatte. Obwohl ich wusste, dass es ein Fehler war, stellte ich den Eisbecher ab und legte die freie Hand auf Amiras, woraufhin sie ihre wegzog.
Natürlich.
Einen Moment lang betrachtete ich den abblätternden dunkelroten Lack auf meinen Nägeln und spürte der Phantomwärme nach, die Amiras eben-noch-da-gewesene Hand hinterlassen hatte. Dann, als wäre nichts geschehen, hob ich den Eisbecher wieder hoch, steckte den Löffel hinein und vermied es, sie beim Sprechen anzusehen.
»Was los ist? Das Übliche. Mein Vater.«
Amira stöhnte. »Was hat er jetzt schon wieder gemacht?«
»Jetzt schon wieder« traf es ziemlich gut. Wir stritten ständig. Keine Ahnung, warum genau, aber seit ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, ihm nichts recht machen zu können. Erst gestern Abend hatten wir wieder einen heftigen Streit gehabt, der sich um meine vermeintliche Unfähigkeit gedreht hatte, mich auf die »wichtigen Dinge des Lebens« zu konzentrieren. Wichtig, das war für ihn keine Musik, kein Social Media und überhaupt nichts von dem, was er »Hedonismus« und ich »Spaß« nannte. Wichtig waren für meinen Vater das Bestreben, die Gesellschaft voranzubringen, und eine klassische Bildung. Folgerichtig war der Aufhänger gestern, zum tausendsten Mal: die Lateinhausaufgaben.
»Ein bisschen mehr Respekt!«, hatte er gemahnt, als er mich dabei erwischte, wie ich Kotz-Emojis in mein Lateinbuch malte. Und dann hatte er so intensiv auf mich eingelabert, wie ich ihn zu ignorieren versuchte, bis er bei seiner absoluten Lieblingsstelle in dem sich wöchentlich wiederholenden Loop angekommen war: »Alle großen Denker waren Römer oder Griechen! Und alle großen Dichter übrigens Deutsche. Da kannst du ruhig stolz drauf sein, wenn ihr das nächste Mal Schiller lest oder Goethe oder Hesse oder Fontane! Oder Kleist! Kleist ist der …«
An der Stelle hatte ich mein Lateinbuch mit einem Knall zugeklappt. »Seit wie vielen Millionen Jahren sind die noch mal tot mittlerweile?«, hatte ich geätzt und in Erinnerung an meine Emojis ein Würgegeräusch gemacht. Woraufhin mein Vater rot anlief und etwas mit »Kulturgut!« und »Klassiker!« rief, und ich höhnisch echote: »Klassiker, ist klar!«. Dann hatte ich ihm Amiras Argumente entgegengeschleudert. Von wegen alten weißen Männern, der komplett verzerrten Geschichtsschreibung, die kein Mensch zu hinterfragen schien, und dass wir bis zum Abi kein einziges Buch von einer Frau, geschweige denn von Leuten lesen würden, die nicht weiß waren. »Kein einziges!«, hatte ich am Ende gebrüllt. »Kulturgut, my ass!«
Mit jedem meiner Worte war sein Gesicht rotfleckiger geworden. Sein Adamsapfel hüpfte, während er um eine Antwort rang und die Hände zu Fäusten ballte, die sich schlossen und öffneten und schlossen und öffneten.
Er hatte dermaßen Ähnlichkeit mit einem Fisch gehabt, dass ich in Lachen ausgebrochen war. So endete es immer: Er schwieg, und ich lachte und schließlich drehte ich ihm den Rücken zu und ließ ihn stehen. Dann erst begann er zu brüllen.
Diese Macht hatte ich: Ich konnte einen stillen, sanften Mann in ein hilfloses, brüllendes Kleinkind verwandeln.
Jedes Mal.
Aber statt Amira damit vollzujammern, wie kompliziert die Situation mit meinem Vater war, entschied ich mich für etwas Konkreteres: einen Auszug aus unserem Frühstücksstreit von heute Morgen. »Er findet, ich sollte mich mehr auf die Schule als auf die Band konzentrieren. Und endlich mal ein Mädchen mit nach Hause bringen.«
»Warte … Hä? Hat er dir nicht neulich noch einen Vortrag gehalten, weil du zu viele Mädels am Start hattest?« Sie kickte mir gegen das Schienbein, sehr sanft, aber ich schnappte demonstrativ nach Luft. »Weil du Poser nicht durchhattest, dass er dir auf Insta folgt?«
Peinlich, aber wahr. Sobald ich herausgefunden hatte, dass sich hinter McMarty mein Vater verbarg, hatte ich ihn blockiert.
»Mensch, wie lange wirst du mir das noch unter die Nase reiben?«
»Bis wir achtzig sind. Mindestens.«
»Gnade! Sei ehrlich, Mira: Kennst du alle, die dir folgen?«
»Überwiegend.«
Ich zog mein Handy raus, klickte, scrollte. »Okay … Wer ist Trivoed739?«
»Das ist leicht. Das ist Tristan aus der B.«
»SternenschnauzeMitSchnuppe?«
»Becca.«
»Wer ist Becca?«
»Die Tochter unserer Nachbarn in Mahlsdorf.«
»Aber – was? Ihr seid doch schon vor Ewigkeiten nach Charlottenburg gezogen!« Vor fünf Jahren, um genau zu sein. Das wusste ich so genau, da es den Tag markierte, an dem Amira in mein Leben getreten war.
»Na und? Wir folgen uns halt noch.«
Ihre Miene war undurchdringlich. Sagte sie die Wahrheit? Ich scrollte noch ein paar Kontakte durch und fand einen Account ohne Foto. »JoshiIsTheGreatest«, triumphierte ich.
»Meine Cousine.«
Ihre Augenlider flatterten – jetzt log sie und wusste, dass ich es wusste. Statt das allerdings zuzugeben, blieb sie in der Rolle, biss ein Stück Eiswaffel ab und schloss betont desinteressiert die Augen. Na warte.
»Du hast eine Cousine mit grauem Vollbart, die vor einem Haus voller amerikanischer Flaggen mit einer Pumpgun posiert?«, frotzelte ich.
»Wa…?« Sie riss die Augen auf und mir mein Handy aus der Hand. Hektisch checkte sie das Profil, auf dem es nichts zu sehen gab, weil es auf Privat gestellt war, und stieß die Luft erleichtert aus. »Du Arsch.«
»Gib halt zu, dass dir dasselbe hätte passieren können. Wer erwartet denn bitte, von seinem Ü40-Historiker-Vater auf Insta gestalkt zu werden? Facebook, okay, aber Insta?«
Sie lachte. »Hat er auch einen TikTok-Account?«
»Oh, bitte! Es ist schon schlimm genug, dass er jedes einzelne meiner Fotos auf Insta gesehen hat, mach mir nicht noch TikTok kaputt.«
»Hast du ihm denn mal gesteckt, dass du nicht mit jeder, mit der du Fotos machst, was hattest?«
»Ich hab’s versucht.«
Das hatte ich in der Tat. Allerdings halbherzig, denn ein klein wenig hatte ich es genossen, dass mein Vater mich für einen derartigen Aufreißer hielt. Selbst wenn es null der Realität entsprach. Ich machte einfach gerne Selfies. Bevorzugt mit anderen Leuten im Arm. Und ich wusste auch ohne Amiras Küchentischpsychologie, dass ich das für mein Ego tat. Um mir selbst zu beweisen, dass ich gemocht wurde. Es tat fast weh in seiner Banalität – aber mein stalkender Vater hatte es trotzdem komplett fehlinterpretiert.
»Ich glaub, er kann sich nicht entscheiden, ob er mehr Angst hat, dass mein Leben zu wild ist oder zu langweilig.«
»Als ob ihn das irgendwas angehen würde!«
»Exakt. Vor allem, wenn er gleichzeitig so tut, als würde es ihn gar nicht interessieren …« Ich knüllte meinen Eisbecher zusammen und warf ihn mit großer Geste Richtung Papierkorb. Traf nicht.
Amira gackerte, als ich aufstand, um den Becher zu entsorgen. »Aus dir wird nie ein echter Mann!«, rief sie mir hinterher, die perfekte Imitation meines Vaters. Das hatte der zwar nur ein einziges Mal gesagt, und auch das halb im Scherz, aber es hatte mich getroffen. Amira fand den Spruch allerdings dermaßen lächerlich, weil »dein Vater ein krass verkorkstes Bild von Männlichkeit hat«, dass sie ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit raushaute.
Als ich vom Mülleimer zurückkam und sie an den Händen von der Bank hochzog, hatte sich ein ernstes Funkeln in ihre dunklen Augen geschlichen.
»Nimm es dir nicht so zu Herzen. Wenn wir den Contest gewinnen, findet er es bestimmt nicht mehr so schrecklich, dass du dir manchmal die Nägel lackierst.«
Es half nichts, ich musste lachen.
Es war jedes Mal eine Frage der Zeit, ehe wir bei einem von Amiras Lieblingsthemen landeten.
Platz drei: ihre Lieblingslieblingslieblingsband Måneskin.
Platz zwei: die Ungerechtigkeit der Welt, Unterpunkte: jeder -ismus, der ihr einfiel. Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und gefühlte tausend andere.
Platz eins, immer: unsere Band Going Under, Dauerbrenner-Unterpunkt seit ein paar Monaten: der Bandcontest.
Sie hatte sich komplett in den Wettbewerb verbissen, wahrscheinlich, weil darin gleich zwei ihrer Lebensinhalte zusammentrafen, denn der Hauptpreis war eine Aufnahme-Session in einem Profistudio mit einer Produzentin, die schon mit – tataaa – Måneskin gearbeitet hatte.
Kein Wunder, dass Amira unbedingt gewinnen wollte. Sie war ein Überfan, und das schon lange, bevor die Italiener den Eurovision Songcontest gewonnen hatten. Ihre Verehrung ging so weit, dass sie bei der Gründung unserer Band allen Ernstes vorgeschlagen hatte, uns Solskin zu nennen. Obwohl Amira beinahe alles durchsetzte, was sie durchsetzen wollte: Mit der Idee war sie aufgelaufen. Stattdessen hatten wir uns auf Going Under geeinigt und sangen neben einer Handvoll eigener Songs vor allem Coverversionen.
Die anderen kamen mit Amiras Obsession klar, aber mich nervte es extrem. Weil ich eifersüchtig auf diesen Sänger war.
So sehr, dass ich kurz erwogen hatte, mir die Nägel NICHT mehr zu lackieren, weil ich nicht wie seine Kopie aussehen wollte. Tat es trotzdem, weil es mir gefiel, und tröstete mich damit, dass selbst er Amira nicht hätte haben können, wenn er gewollt hätte. Und doch war ich eifersüchtig – auch darauf, dass er im Gegensatz zu mir wirklich singen konnte.
Der einzige Grund, warum ich in unserer Band am Mikrofon stand, war der, dass ich kein Instrument beherrschte, Amira mich aber unbedingt dabeihaben wollte, als sie Going Under in der Achten gegründet hatte. Also wurde ich der Sänger, aber meine eigentliche Rolle war eine andere.
»Du bist unser Girl Magnet«, stichelte Amira gern. Und den brauchten wir, fand sie, um den Bandcontest zu gewinnen, der wiederum die erste Stufe war, die uns zu ihrem großen Traum, dem ESC, führen sollte.
Das mit dem Girl Magnet war vermutlich als Kompliment gemeint und es passte, weil ich eben bei allen so mühelos beliebt war, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war mehr als das, und ich konnte und liebte Musik durchaus, aber eben nicht die, auf die Amira stand.
Mein Instrument war mein Computer.
An dem frickelte ich stundenlang (und heimlich) an Tracks, die nicht ins Bandkonzept passten und die wir deshalb nie spielen würden. Beziehungsweise, schlimmer: weil die Songs keine Band brauchten, sondern bloß mich und meinen Rechner und die Software, mit der ich meine Stimme unter Kontrolle bekommen konnte.
Aber Amira liebte die Band und wollte gewinnen, und ich liebte Amira und die Bandmitglieder waren zu Freunden geworden, also spielte ich mit, traf die Töne maximal am Rand dessen, was gerade noch als richtig gelten konnte, und strahlte Charisma aus. Bisher hatte das gereicht.
Aber je näher der Bandcontest rückte, desto schlechter schlief ich und desto intensiver wurden meine Tagträume von mir selbst als DJ Paul Mérida. Und umso mehr nervte mich die Theorie vom rockstarigem Girl Magnet. Für Amira mochte Bühnenpräsenz wichtiger sein, als Noten zu treffen – ich hatte meine Zweifel.
Der Rest der Band war musikalisch nämlich top. Skyler zum Beispiel: Der spielte außer E-Bass noch Gitarre und Ukulele und Banjo und Mandoline – und wahrscheinlich überhaupt jedes Instrument, das Saiten hatte, die man zupfen konnte. Er brauchte nicht mal Noten, er lebte Musik. Und Marie hatte wahrscheinlich schon als Kleinkind beim Topfschlagen alle davon überzeugt, dass sie später eine begnadete Schlagzeugerin werden würde. Nur Julian war musikalisch eine Niete. Deshalb war er kein richtiger Teil der Band, sondern unser Manager. Aber darin war er top. So gut, dass er mir schon, kurz nachdem er zu uns gestoßen war, nahegelegt hatte, Gesangsstunden zu nehmen. Ich hatte spöttisch gelacht und seither, spätestens, verachteten wir uns gegenseitig.
Der Punkt war: Außer Amira behauptete niemand, dass Ausstrahlung wichtiger war als Gesangskünste. Warum sie also auf mich als Sänger bestand, war mir ein Rätsel. Vermutlich, weil sie hoffte, dass der äußere Paul auf den inneren abfärben würde. Oder sie glaubte, schiefer Gesang würde demnächst der neue heiße Scheiß werden. Oder weil sie einfach gern Zeit mit mir verbrachte. Wir waren schließlich allerbeste Freunde und sie fühlte sich, sagte sie zumindest immer, safe bei mir.
Bevor ihre Faust wieder auf meinem Oberarm landen würde, um mich aus meinen Gedanken zu retten, griff ich nach meinem Rucksack und warf ihn mir über die Schulter.
»Glaubst du echt, wir haben eine Chance?«, fragte ich zum hunderttausendsten Mal.
»Absolut!« Amira war das Erklärbild zu der Redewendung »im Brustton der Überzeugung«. Sie griff nach meinen Händen und schaute mir in die Augen. Ihre eigenen wirkten gerade schwarz, was an den geweiteten Pupillen lag, die ihre dunkelbraune Iris mit den hellbraunen Sprenkeln darin fast verdrängten. Drei-Sorten-Schokolade-Cookies. Ich schluckte.
»Du denkst dich kaputt, Paul«, sagte sie sacht. »Lass dich von deinem Vater nicht so verunsichern. Und …«, sie musste das Zucken in meinen Fingern bemerkt haben, »von den anderen auch nicht. Wir rocken das zusammen, okay?«
»Du«, widersprach ich. »Du wirst es rocken.«
»Wir. Zusammen. Du hast die Looks, und ich die Gitarre.« Sie ließ meine Hände los – Nähe hielt sie nie lange aus – und warf mir ein imaginäres Mikro zu. Ich tat, als würde ich es auffangen, und wusste, dass sie es schaffen würde. Allerdings brauchte sie mich dazu nicht. Weil sie eben nicht nur die Gitarre, sondern auch die Stimme hatte und obendrein die Looks, und weil sie nach vorne gehörte. Sie, nicht ich.
»Twelve Points go to …« Ich schlug mit dem imaginären Mikro einen Trommelwirbel in die Luft. »The Incredible Mira mit Lumos, Lumos!«
»Nie im Leben!«, kreischte sie und setzte an, mich über die Straße zu jagen. »Nie im Leben!«
2005
Mein geliebtes Kind.
Ich weine, seit du da bist. Vor Glück, vor Hilflosigkeit und auch, weil ich keine Ahnung hatte, was es in mir auslösen würde, dein Gesicht zu sehen.
Alles an dir ist Liebe und Vertrauen. Du schreist, damit ich dich an meine Brust lege, und ich tue es, natürlich tue ich es. Und jedes Mal, wenn du trinkst, werde ich mir fremder. Es ist, als würde ich stückchenweise sterben müssen, damit du leben kannst.
Dabei wollte ich dich! Ich wollte dich so sehr, uns so sehr, und jetzt lieg ich hier und alles tut mir weh, alles fühlt sich falsch an.
Alles außer dir.
Du bist richtig, jede Zelle, jeder Finger, Zeh, Nagel, alles an dir ist: vollkommen.
Vergiss das nie, egal, was passiert: Du bist perfekt.
Es ist die Welt, die das nicht ist.
Und ich.
Ich bin auch nicht perfekt. Oder vielleicht schon, aber nicht so, nicht hier. Wahrscheinlich nicht für dich und ganz sicher nicht für deinen Vater.
Ich lese es in seinen Augen. Wenn er dich ansieht, leuchtet er, wenn sein Blick zu mir gleitet, erlischt er. Ja, so ist das: Du bringst uns zum Leuchten, und ich bringe uns zum Erlöschen.
Wenn ich auf uns schaue, sehe ich mich auf dem Bett liegen – im Arm ein Kind, das vollkommen ist, daneben ein Mann, der vollkommen ist. Ich sehe, wie er meine Hand hält, sehe, wie du trinkst, und empfinde nichts von dem, was diese Person da empfinden sollte. Stattdessen spüre ich Schuld. Und Scham.
Mich selbst spüre ich nicht.
Dein Vater wird mit jedem Tag grauer. Er sagt, ich müsse mich entscheiden.
Wie soll ich das?
Wie kann ich das?
Ich liebe dich jetzt schon mehr, als ich jemals gedacht hatte, lieben zu können.
K
2
Normalerweise gönnte ich mir nach der Bandprobe einen Umweg, um runterzukommen und meine Gefühle zu sortieren. Aber ich war schon später dran als sonst, die Probe hatte länger gedauert, wie so oft in den letzten Wochen. Und diesmal hatte es nicht an Amiras Perfektionismus gelegen, sondern an Julian. Je näher der Bandcontest rückte, desto pedantischer wurde er. Würde man gar nicht vermuten, wenn man ihn sah, er wirkte eher verträumt mit seinem schulterlangen roten Haar und den großen braunen Welpenaugen, aber er war wahnsinnig gewissenhaft. Er hatte uns bei unserem allerersten Auftritt gesehen und entschieden, uns »groß rauszubringen«. Obwohl er zwei Jahre älter war als wir und schon vorletztes Jahr Abi gemacht hatte, richtete er seine gesamte Energie auf unseren Erfolg.
Beziehungsweise: Amiras Erfolg.
Weil er, davon war ich absolut überzeugt, rettungslos in sie verknallt war. Weshalb ich ihn genauso scheiße fand wie er mich.
Am Anfang hatte er sogar versucht, mich rauzuschmeißen, aber zu seinem Pech waren Amira, Skyler und Marie zu hundert Prozent Team Paul. Wir waren nicht nur eine Band, wir waren Freunde.
Was es noch komplizierter machte, dass ich die Musik, die wir spielten, eher langweilig fand. Weshalb ich es ihnen nie erzählt hatte … Sie waren meine Leute und für seine Leute tat man eben auch Dinge, die man selbst nicht so prickelnd fand. Vielleicht nicht drei Jahre lang, aber …
Verdammt.
Wie sollte ich diesen Knoten in meinem Kopf auflösen?
Gleich würde ich vor der Haustür stehen, und sobald ich die aufschloss, würde es vorbei sein mit ruhigem Denken. Es war schon fast vier, und ich musste noch Schulkram machen, bevor ich mich mit Skyler treffen würde. Die Zeit und ich, wir hatten eine komplizierte Beziehung. Wie irgendwie alle und ich. Oder ich und alle.
Wider besseres Wissen bog ich nach links ab und erlaubte mir eine Extrarunde um die Kirche. Als würden die zusätzlichen Minuten etwas daran ändern, dass Julian nervte.
Und zwar seit dem Tag, an dem Amira ihn angeschleppt und vorgeschlagen hatte, dass er uns managen würde. Julian hatte sie auf eine dermaßen verstrahlte Art angesehen; meine Alarmsysteme hatten sofort zu schrillen begonnen. Bevor ich fragen konnte, wozu eine Schulband einen Manager brauchte, und wenn, warum ausgerechnet diesen, hatte Skyler bereits genickt und Marie bejahend den Kopf schief gelegt. Und ich war überstimmt gewesen, ehe ich überhaupt den Mund aufgemacht hatte.
Seitdem war er Teil der Band.
Ich wich einem Hundehaufen aus, exakt als ich zum x-ten Mal »Scheiße« dachte – als wollte das Universum mir recht geben.
Julian war schrecklich, aber eben nicht nur. Ja, er war pedantisch und piesackte mich seit der Sache mit den Gesangsstunden bei jeder Gelegenheit. Aber diese Management-Nummer machte er, leider, richtig gut. Zu seiner Schulzeit musste er der absolute Liebling des gesamten Lehrpersonals gewesen sein – er hatte immer noch so gute Kontakte, dass wir im Theaterraum der Schule proben durften. Außerdem hatte er es geschafft, uns schon drei Monate nach unserer Gründung regelmäßige Gigs zu verschaffen, auf Festen oder in kleinen Pubs, die es in Berlin an jeder Ecke gab. Geld sahen wir dafür nie.
»So läuft das am Anfang«, behauptete er und Amira nickte bestätigend.
Also spielten wir jeden Gig, der uns angeboten wurde, und wurden besser und besser. Ja, selbst ich.
Letztes Jahr hatte Julian sogar eine Journalistin vom Tagesspiegel dazu gebracht, Amira zu interviewen und eines unserer Konzerte zu besuchen, das erste größere, auf einem Stadtfest in Friedrichshain. Auftritte, Presse, die ersten Fans – in Riesenschritten kamen wir Amiras großem Traum näher: Going Under sollte die nächste Schülerband sein, die es schaffte. Wie Tokio Hotel, wie AnnenMayKantereit, wie Måneskin.
Mittlerweile konnte selbst ich mir das vorstellen. Nur eben … ohne mich. Seufzend bog ich nun doch in unsere Straße ein, schüttelte die Gedanken an Julian und meine Zweifel ab und stapfte in den vierten Stock.
Zu Hause duftete es intensiv nach Frühlingsblumen und aus der Küche drang Gelächter. Zweistimmig, meine Mutter und meine Schwester Linn. Ich kickte die Schuhe von den Füßen und lauschte, aber mein Vater schien unterwegs zu sein. Die Freude, die mich überkam, erschreckte mich, aber ich hatte keine Lust auf die nächste Denkspirale, also erlaubte ich mir, bei der Aussicht auf ein paar dramafreie Stunden erleichtert zu sein. Duschen, beschloss ich, essen, Hausaufgaben und gegen Abend mit Skyler in Neukölln zwei potenzielle Locations checken, an denen, laut Julian, alle wichtigen Influencer abhingen. Ich stellte meinen Rucksack auf den Stuhl neben der Tür und lief durch den Flur zur Küche. Linn lungerte auf der Sitzbank, unsere Mutter auf einem Stuhl. Beide hatten die Ellbogen auf den Küchentisch gestützt und beugten sich einträchtig über ein bunt bedrucktes Blatt Papier.
Erst als ich mich räusperte, bemerkte mich Linn.
»Da bist du ja!«, freute sie sich. »Mama muss weg, aber ich brauch Hilfe.«


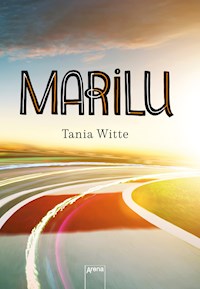














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











