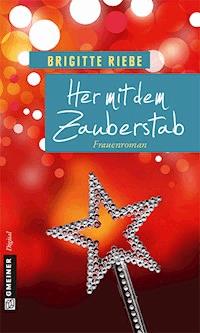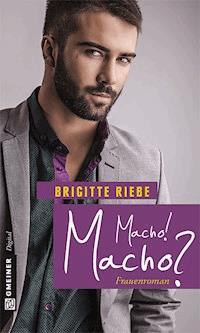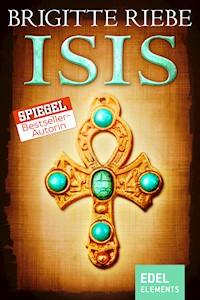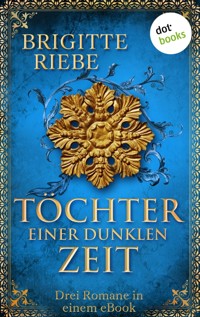Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Jakobsweg-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau – eine abenteuerliche Reise: Der historische Roman »Die Straße der Sterne« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe als eBook bei dotbooks. Regensburg im Jahre 1246: Einst war ihr Leben voller Farben, doch seit eine Krankheit ihr das Augenlicht geraubt hat, ist Pilar nur noch von Dunkelheit umgeben. Als Tochter eines reichen Händlers führt sie dennoch ein Leben in Sicherheit und Wohlstand – bis ihr Vater stirbt und das Schicksal sie zwingt, all ihren Mut zusammenzunehmen. Pilar wagt die gefahrvolle Reise auf der Straße der Sterne: dem Pilgerweg, der sie zum Grab des Apostels Jakobus führen soll, wo sie sich Heilung erhofft. Noch ahnt die junge Frau jedoch nicht, welchen ungewöhnlichen Reisegefährten sie begegnen wird – und was diese ihn Wahrheit mit ihrer Familie verbindet … »Brigitte Riebes große Historienromane bieten Spannung, Liebe und Leidenschaft«, urteilt die Zeitschrift »Marie Claire«. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der glänzend recherchierte Mittelalterroman »Die Straße der Sterne« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe ist der erste, in sich abgeschlossene Roman ihrer großen Jakobsweg-Saga. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Regensburg im Jahre 1246: Einst war ihr Leben voller Farben, doch seit eine Krankheit ihr das Augenlicht geraubt hat, ist Pilar nur noch von Dunkelheit umgeben. Als Tochter eines reichen Händlers führt sie dennoch ein Leben in Sicherheit und Wohlstand – bis ihr Vater stirbt und das Schicksal sie zwingt, all ihren Mut zusammenzunehmen. Pilar wagt die gefahrvolle Reise auf der Straße der Sterne: dem Pilgerweg, der sie zum Grab des Apostels Jakobus führen soll, wo sie sich Heilung erhofft. Noch ahnt die junge Frau jedoch nicht, welchen ungewöhnlichen Reisegefährten sie begegnen wird – und was diese ihn Wahrheit mit ihrer Familie verbindet …
»Brigitte Riebes große Historienromane bieten Spannung, Liebe und Leidenschaft«, urteilt die Zeitschrift »Marie Claire«.
Über die Autorin:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem mehr als 50 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
Bei dotbooks veröffentlichte Brigitte Riebe ihre historischen Romane:
»Schwarze Frau vom Nil«
»Pforten der Nacht«
»Liebe ist ein Kleid aus Feuer«
»Die Hexe und der Herzog«
»Die Braut von Assisi«
»Die Prophetin vom Rhein«
»Die schöne Philippine Welserin«
»Der Kuss des Anubis«
»Die Töchter von Granada«
Sowie ihre Jakobsweg-Saga mit den Romanen:
»Die Straße der Sterne«
»Die sieben Monde des Jakobus«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint Brigitte Riebes Roman »Der Wahnsinn, den man Liebe nennt«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Dieses Buch erschien bereits 2003 und 2006 unter dem Titel »Straße der Sterne« bei Heyne und Diana.
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Marion von Schröder Verlag, ein Verlag der Ullstein Heyne List GbmH & Co. KG, München; 2006 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-431-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Straße der Sterne« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe
Die Straße der Sterne
Die große Jakobsweg-Saga
dotbooks.
Für Reinhard, der mit mir den Sternenweg geht
Mein Herz fügt sich jeder Form:
Wiesen den Gazellen; Klöster für den Mönch
Tempel für die Götzenbilder; Kaaba der Pilgerfahrt
Tafeln der Thora; Buch des Korans.
Ich nahm die Liebe zur Religion
In welche Richtung sie weisen mag
Religion und Glauben ist sie.
Ibn Arabis: Tjumân al-Ashwâq, um 1210
Übersetzung: R. A. Nicholson, London 1911
Finis Terrae
Hoch über ihr eine Möwenschar, die sich landeinwärts treiben lässt, bis sie plötzlich abdreht, um kreischend Kurs auf die Klippen zu nehmen. Kurz vor dem Wasser steigt sie wieder auf und verliert sich in der Ferne des Himmels. Mit einem Anflug von Neid sieht Pilar ihr hinterher. Sich schwerelos wie ein Vogel in die Lüfte schwingen zu können – wie einfach wäre dann selbst der schwierigste Weg zu bewältigen!
Der Morgen ist verhangen und regnerisch gewesen; beim Aufwachen haben sich Nebelstreifen über ihr Gesicht gelegt wie flüchtige Träume. Jetzt jedoch erscheint ihr das Land offen und weit. Wolkenschiffe segeln über den Himmel, leuchtend wie blaues Glas. Trotzdem kommt sie nur langsam voran, denn noch immer schlägt der Wind ihr entgegen. Ihre Beine werden mit jedem Schritt schwerer. Keuchend stolpert sie blindlings weiter.
Du wirst nicht erlöst, flüstert die hässliche innere Stimme, mach dir nichts vor! Nicht einmal der heilige Jakobus, zu dem sie alle von weit her kommen, hat dir helfen können. Wozu sich noch weiter sinnlos anstrengen?
Hör auf!, befiehlt sie, bevor das Gift tiefer in ihr Herzsickern kann, sei still. Ich will dir nicht zuhören. Weshalb kannst du mich nicht in Frieden lassen?
Aber die Stimme raunt unbeirrt weiter.
Es gibt nur noch eines zu tun. Du weißt längst, was es ist. Weshalb wehrst du dich? Es ist nicht schwer, du wirst sehen! Ein bisschen Mut – und dann ist sie da, für immer, deine lang ersehnte Ruhe.
Sie spürt, wie die Kraft in den Beinen nachlässt, und stemmt sich umso wütender gegen den Wind. Eine Macht, stärker als ihr Wille, treibt sie voran. Sie wird nicht aufgeben. Nicht so nah vor dem Ziel.
Tief unten donnert das Meer. Die Luft riecht nach Fisch und Tang. Blanke Felsen, Steilhänge, wohin man schaut, geröllübersät, menschenverachtend. Ringsumher größere Gesteinsbrocken, als hätte ein Riese achtlos seinen Sack verschüttet. Ihre Füße versinken in den ausgewaschenen Kerben. Endlich ist sie nah genug. Mit einem tiefen Atemzug beugt sie sich hinunter – und erschrickt.
Schwarze Tiefe, ein Heulen, Gurgeln und Brodeln, als stöhnten tausenderlei Stimmen zu ihr herauf. Nichts als Wasser, überall. Ist sie tatsächlich an der Grenze zum Schattenreich angelangt?
Unmöglich, den Blick zu lösen von den Riffen und Schlünden, gegen die haushohe Wellen branden. Längst liegen die Gemüsegärtchen hinter ihr, auf die Tariq sie unterwegs aufmerksam gemacht hat, hilflose Versuche von Menschenhand, sich gegen die Gewalt des Meeres zu behaupten, das am Ende doch die Oberhand behalten wird. Weit entfernt kriecht ein Segler zwischen Brechern vorwärts, ein Geisterschiff, das sich schon im nächsten Augenblick im Blau des Horizonts auflösen kann. Geschichten über verlorene Seelen schießen ihr durch den Kopf. Ein Schritt nur über die Klippen, dem unwiderstehlichen Sog entgegen – und es wäre vorüber.
Von irgendwo her ertönt schepperndes Gelächter.
»Der Teufel will nicht die, die freiwillig zu ihm kommen. Hast du schon vergessen?«
Plötzlich weht weißes Feenhaar im Wind, und sie meint einen Schatten zu spüren, der die Arme nach ihr ausstreckt. Alles in ihr zieht sich sehnsuchtsvoll zusammen – noch immer.
Sie tastet nach einem Halt und fasst ins Leere.
»Die Seele eines Menschen zieht die Milchstraße entlang nach Westen, bis sie beim Schöpfer angelangt ist. Wenn wir uns also dem Ende nähern, kommen wir auch wieder an den Anfang zurück ...«
Das ist die andere Stimme, warm und tröstlich!
Verzweifelt versucht Pilar sich zu erinnern, wem sie gehört. Es ist wichtig, das weiß sie, aber je mehr sie sich anstrengt, desto leerer wird ihr Kopf. Meerluft verweht ihren Atem. Sie krümmt den Rücken und stemmt sich mit den Füßen fest gegen den felsigen Grund. Windböen peitschen ihr die Haare ins Gesicht.
Irgendwann gelingt es ihr, sich von den Klippen zu lösen. Weiter draußen scheint die See weniger stürmisch und eher blau als schwarz. Die glänzende Fläche bewegt sich wie in einem langsamen Tanz. Plötzlich hat sie das Gefühl, der Ballast des langen Weges könne vielleicht doch von ihr abfallen.
Sie ist so weit gegangen. Ist sie endlich bei sich angekommen?
»Pilar!«
Im ersten Augenblick glaubt sie an eine Sinnestäuschung. Es können nur die Wogen sein, die tief unter ihr schmatzen und fauchen, und bei jedem Anbranden ganze Steinladungen gegen die Felsen schmettern.
»Pilar, Liebste! Hörst du mich nicht?«
In ihrem Herzen bildet sich ein Knoten hilflosen Verlangens. Sie wendet den Kopf zur Seite, weil sie Angst hat, nur zu träumen.
»Pilar! Ich bin es – siehst du mich?«
Langsam dreht sie sich um.
Sie ist doch nicht allein. Hat die Schwarze Madonna ihre Gebete schließlich erhört? Vielleicht wird sie nun nie mehr allein sein müssen ...
Im Moment des Erwachens wusste sie, dass etwas anders war als sonst. Ihre Zehen stießen an den mittlerweile abgekühlten Ziegelstein, den Tariq ihr fürsorglich unter die Decke gesteckt hatte. Ihre Hand erspürte auch die Wärme eines Tierkörpers. Aber ihre Katze war fort. Ein Loch in der Tür ermöglichte es Minka, nach Belieben zu kommen und zu gehen.
Sie dehnte und streckte sich in dem Bett mit den geschnitzten Löwenfüßen, das einmal einer maurischen Prinzessin gehört haben mochte. Eine Decke aus Fuchsfell war über sie gebreitet, und obwohl sie es nicht sehen konnte, wusste sie, dass wie in Kindertagen eine Öllampe in der Ecknische brannte, weil sie sich als kleines Mädchen vor der Dunkelheit gefürchtet hatte.
Jetzt war es immer dunkel für Pilar.
Manchmal gelang es ihr, sich in das Unvermeidliche zu fügen, und es konnte sogar geschehen, dass sie beinahe vergaß, wie bunt und hell ihr Leben früher einmal gewesen war. Freilich gab es auch Tage, an denen sie fürchtete, all das Schwarz um sie herum könne in sie eindringen und ihre Seele ebenso auslöschen wie das innere Licht, über das sie niemals sprach. Mit Ausnahme von Tariq, dem maurischen Diener, der sich nie täuschen ließ, schaffte sie es, anderen gegenüber ihre Verzweiflung zu verbergen. Am meisten lag ihr daran, in Gegenwart des Vaters wenn schon nicht fröhlich, so doch wenigstens ausgeglichen zu wirken, damit er sich nicht noch mehr Sorgen machen musste. Heinrich Weltenpurger sorgte dafür, dass seine Tochter jede erdenkliche Unterstützung erhielt, vor allem, wenn er unterwegs war. So hatte er beispielsweise den Mauren angewiesen, die Wege mit ihr so lange abzuschreiten, bis sie sich mit Hilfe eines Weidenstocks im Haus allein zurechtfinden konnte.
Nichts, woran er in seiner umfassenden Fürsorge für sein einziges Kind nicht gedacht hätte: Ohne seine Einwilligung durfte kein Gegenstand verrückt werden. Zwischen den Möbeln gab es ausreichend Spielraum, und die Teppiche, die die Winterkälte abhalten sollten, waren an allen Seiten mit Kupfergewichten beschwert, damit sie nicht rutschten. Es war eigens ein Leibstuhl angeschafft worden, um ihr das Benutzen des Abtritts zu ersparen, der aus der Ostseite des mehrstöckigen Hauses an der Wahlenstraße ragte.
Und im vergangenen Winter, als das letzte Licht ihrer Augen erloschen war, hatte der weitgereiste Mercator, einer der angesehensten im Regensburger Kaufmannsviertel, den besten Tischler der Stadt bestellt. Seitdem waren alle Kanten ihrer Bettstatt abgerundet, damit sie sich beim Aufstehen nirgendwo anstoßen konnte.
Es dauerte, bis das Mädchen sich ganz zurechtfand, aber schließlich gelang es ihr. Man schrieb das Jahr des Herrn 1245, und es war der Vortag zu Allerheiligen, dem Fest, an dem der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders dünn ist. Morgen, sobald die Stadt erwacht war, würden die Gläubigen sich zum Friedhof begeben, um an den geschmückten Gräbern zu beten. Pilar freute sich schon jetzt auf das lange Läuten am Abend. Immer dann hatte sie das Gefühl, ihre Mutter würde zu ihr sprechen. Obwohl Rena nun schon beinahe sieben Jahre fort war und kaum jemand es wagte, ihren Namen in Heinrichs Gegenwart zu erwähnen, fehlte sie der Tochter mehr denn je.
Besaßen Häuser eine Seele?
Pilar spürte, dass nichts mehr so war, seit Rena nicht mehr bei ihnen lebte. All der Zauber und Glanz, die das Anwesen mit dem stolzen Turm früher besessen hatte, waren verflogen; stattdessen hatte sich in den Mauern ein Gefühl von Verlust eingenistet wie dumpfer Wintermief. Gerade zehn war sie damals gewesen, in jenem fürchterlichen Hungerjahr, als die Donau bis an die Domstiegen angestiegen war und die Ärmsten der Armen aus Verzweiflung begonnen hatten, Brei aus Leinenfäden und Wasser zu essen.
Eines Morgens war die Mutter fort gewesen.
Es gab nur einen Brief von ihr, flüchtig hingeworfene Zeilen, die sie wie ein Kleinod hütete. Geschrieben waren sie auf Papier, jenes rare Material, das man nicht rollen musste wie Pergament, sondern Stoß auf Stoß winzig klein zusammenlegen konnte. Allerdings hatte es den Nachteil, brüchig zu werden, wenn man es immer wieder hervorholte, und Pilar hatte den Brief schon unzählige Male auf- und wieder zugefaltet. Inzwischen fühlte er sich ganz mürbe an. Es spielte keine Rolle, dass sie ihn nicht mehr lesen konnte. Sie kannte jedes Wort:
»Ich muss gehen, mein Kleines, fort von dir für immer, und kann nicht einmal darauf vertrauen, dass du mich eines Tages verstehen wirst. Ich wäre besser niemals nach Regensburg gekommen, wo ich doch immer eine Fremde geblieben bin. Seit dem Tag deiner Geburt habe ich versucht, dir eine gute Mutter zu sein, obwohl mich niemals die Angst verlassen hat, zu versagen. Trotz allem weiß ich, dass du mehr verdient hättest – alles verdient hättest.
Verzeih mir, dass ich nicht dazu in der Lage war!
Sei nicht traurig, Pilar, und behalte mich in guter Erinnerung. Und vergiss vor allem eines nicht: Du bist ein Kind der Liebe, das Beste und Schönste, was zwei Menschen gemeinsam zustande bringen können. Dein Vater und ich haben alles riskiert, damit du geboren werden konntest. Ich wünschte, ich könnte dich weiter aufwachsen sehen, aber ich habe mich anders entschieden.
Denn endlich ist mir klar geworden, wohin ich gehöre. Es war ein langer Weg, den ich zu gehen hatte, voller Hindernisse, Schwierigkeiten und Gefahren. Ich bin auch heute nicht ohne Angst, denn ich weiß, es wird weder einfach noch bequem werden. Aber jetzt bin ich bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen und zu Ende zu führen, was ich einst begonnen habe.
Gott beschütze dich, mein Mädchen...«
In jenem nassen, düsteren Herbst und den darauf folgenden kalten Wintermonaten waren viele in der Stadt verhungert. Pilar hatte es niemals an Nahrung gefehlt, ihr Schmerz jedoch war so übermächtig gewesen, dass sie Angst gehabt hatte, daran zu ersticken. Inzwischen hatte sich die Zeit wie ein Tuch auf sie gelegt. Die Mutter kam nicht zurück, nie mehr, das war ihr längst klar geworden. Manchmal war sie sogar überzeugt, Rena sei nicht mehr am Leben. Aber noch immer kämpfte das Mädchen gegen ein Gefühl an, als rieben die Fäden einer zerrissenen Liebe aneinander. Ob der Vater ähnlich empfand? Bislang hatte sie noch nicht den Mut gefunden, ihn danach zu fragen.
Sie zog laut die Luft ein. Der Kälte und der Stille nach konnte es noch lange nicht Morgen sein. Was hatte sie so früh geweckt? War da nicht eben ein Geräusch gewesen?
Neugierig geworden und inzwischen hellwach, beschloss Pilar, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie tastete nach dem weichen persischen Schal am Fußende, den sie von allen Geschenken ihres Vaters am meisten liebte, schlang ihn eng um sich und stieg vorsichtig aus dem Bett.
Erstes Buch:Der Ruf
Kapitel 1
Regensburg, November 1245
Es waren Laute der Lust, die aus Renas einstiger Kammer drangen. Pilar waren sie vertraut, denn als Kind hatte sie unzählige Male die Nase fest gegen die Eichentüre gepresst, getrieben von dem Wunsch, der Mutter ganz nah zu sein, und der nie ganz versiegenden Angst, abgewiesen zu werden. Rena schien es nichts auszumachen, wenn sie sich in ihrem Bett breit machte, im Schlaf vor sich hinbrabbelte oder zu schnarchen begann, wenn ein Schnupfen ihr Rachen und Nase verstopfte.
Aber es gab auch andere Tage.
Früh lernte Pilar, die Zeichen zu erkennen: das Gähnen des Vaters, mit dem er seinen Rückzugswunsch einzuleiten pflegte, oder die seltsame Unruhe, die Heinrich Weltenpurger plötzlich überfiel und sich bis zur Rastlosigkeit steigern konnte, wenn seine Frau unverbindlich auswich oder so tat, als würde sie sein Verlangen nicht bemerken. Meistens blieb die Kleine dann, wo sie war, und wartete sehnsüchtig, bis sie in der Morgendämmerung endlich doch zur Mutter laufen konnte. Rena ließ sie in der Regel unter die Decke, aber das Kind bemerkte trotzdem ihre Zurückhaltung, die sie wie eine kühle Brise in ihre Schranken verwies.
Pilar liebte ihre Mutter über alles!
Keine andere Frau hatte so seidiges weißes Haar, keine einen so geschmeidigen Körper, der sich beim Gutenachtsagen über das Kind neigte und alles Unheil der Welt zu bannen schien. Wenn sie ihr Canzonen aus ihrer Heimat vorsang, wünschte sich Pilar, die Zeit anhalten zu können. Nie konnte sie genug davon bekommen, denn diese melancholischen Weisen waren alles, was Rena über ihre Vergangenheit erzählte. Ihre Abstammung war tabu in diesem Haus, und das Kind wusste schon früh, dass es Geheimnisse gab, an die keiner rühren durfte. Alles hätte sie getan, um die Mutter froh zu stimmen, die häufig abwesend schien, auf unverständliche Weise in sich gekehrt. So lernte sie bald, Enttäuschungen hinunterzuschlucken und nach außen fröhlich zu tun. Wenn aber die Sehnsucht übermächtig wurde, war es Pilar egal, ob sie vielleicht doch nicht ganz willkommen war. In jenen Nächten fanden ihre Füße wie von selbst den Weg zu dem Zimmer, das für sie Geborgenheit und Glück symbolisierte.
Was sie heute aber hinter der Tür vernahm, klang anders als in ihrer Erinnerung – Stöhnen, Wimmern und Klatschen, unterbrochen von spitzen Schreien. Seitdem sie blind war, hatte sie gelernt, ihre anderen Sinne besser zu nutzen. Schon immer hatte sie Töne geliebt, im Nachhinein jedoch kam es ihr manchmal vor, als hätte sie in der sehenden Zeit alle Geräusche nur wie durch einen Nebel wahrgenommen. Jetzt dagegen drangen sie geradezu in sie ein, und wenn sie nicht angenehm waren, konnte es richtig weh tun.
Und jetzt tat es weh: Was die beiden hinter der Tür trieben, klang, wie sie sich die Paarung wilder Tiere vorstellte. Plötzlich stieg Zorn in ihr auf. Nicht genug, dass Magda Heinrichs Abwesenheit ausnutzte, um sich in Renas Kammer einzunisten! Jetzt wälzte sie sich auch noch mit einem Buhlen im Bett ihrer Mutter, so ungeniert, als sei sie die Hausherrin.
Ein Jaulen ließ die Lauscherin zusammenzucken.
Pilar drückte die Klinke herunter und trat ein. In der jähen Stille vernahm sie den schweren Atem eines Mannes, der offenbar Mühe hatte, seine Erregung zu zügeln und das schnellere Japsen einer Frau.
»Was ist denn, Kleines?« Magda sprach genauso überschwänglich wie sonst nur in Heinrichs Gegenwart, wenn sie ihn mit ihrer Stimme in eine flirrende Wolke hüllen wollte. »Fehlt dir etwas?«
Pilar machte einen Schritt vorwärts. Sie spürte, wie die beiden auf dem Bett zurückwichen.
»Mir geht es gut, aber ich dachte, du bist krank«, sagte sie. »Da waren so seltsame Geräusche, die mich geweckt haben.«
»Du hast Recht, mir war tatsächlich nicht ganz wohl«, sagte Magda schnell. »Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Geh schlafen, Pilar. Es ist noch lange nicht hell.« Dem hastigen Scharren nach versuchte sie, ihren Liebhaber mit Händen und Füßen unter die Decken zu bekommen, bis ihr plötzlich wohl einfiel, dass sie es mit einer Blinden zu tun hatte und sich die Mühe folglich sparen konnte. Sie stand auf und kam näher.
Das Mädchen rümpfte die Nase. Magda roch nach dem widerwärtigen Erbsbrei, der ihre talgige Haut frischer machen sollte. Wie eine Spinne hatte sie sich im Haus ihres Vetters Heinrich eingenistet. Aber die Beute, auf die sie dort seit Jahren lauerte, würde sie niemals bekommen.
Jetzt bewegte sich auch der Mann auf dem Bett, und am unverwechselbaren Geruch nach Leim und feuchtem Filz, der ihm tief in die Haut gedrungen war, erkannte Pilar auch ihn: Matteo aus Fabriano, der für ihren Vater arbeitete. Nur eine Hand voll Eingeweihter wusste, was der welsche Gautscher in der alten Mühle tatsächlich zu schaffen hatte.
Jetzt gehörte vermutlich auch Magda dazu.
»Ich bin zwar blind, aber nicht blöde.« Pilar richtete ihren leeren Blick dorthin, wo sie den Mann vermutete. »Außerdem ist es mir gleichgültig, von wem du dir dein Bett wärmen lässt, solange es nicht ausgerechnet das meiner Mutter ist. Ich schlage vor, du bringst hier alles in Ordnung und machst dann, dass du in deine Kammer kommst. Wenn du schnell genug bist, muss keiner im Haus etwas merken.«
»Aber der padrone – streng, sehr streng!«
Matteo war so aufgeregt, dass er nach Worten suchen musste, und nackt dazu, das merkte sie, als er ihren Arm packte und sie dabei streifte, ein sehniger Mann mit wirren Locken und starken Knochen. Ihre Hände hatten ihn gelesen, als sie einmal versehentlich mit ihm zusammengestoßen war. Viele zerrissen sich die Mäuler über den Lombarden, weil der Fremde offenbar etwas besaß, was Frauen jeden Alters anzog. Sie hätte wetten mögen, dass Magda nicht die einzige war, die ihn in kalten Herbstnächten heimlich empfing.
»Ich bin keine Verräterin, Matteo.« Sie packte seine Hand. »Und meinen Vater lassen wir besser aus dem Spiel. Aber macht schnell. Denn eigentlich hätte der Karawanenzug schon gestern eintreffen sollen.«
»Madonna mia!« Matteo ließ sie los, als habe er sich verbrannt, und versuchte offenbar, sich halb im Laufen die Kleidung überzustreifen. Sie hörte ihn fluchend die Treppe hinunterpoltern und unterdrückte ein Grinsen.
Magda beschäftigte sich indessen mit dem Bett. »Bin gleich so weit, Kleines«, sagte sie, während sie den Strohsack bearbeitete, als gelte es, mit den zerdrückten Halmen auch jedes Restchen Wollust herauszuschütteln, »dann kann ich dir beim Waschen helfen und anschließend dein Haar durchbürsten – so, wie du es am liebsten hast.«
»Das kann ebenso gut Balbina tun. Die hat von allen Mägden die weichsten Hände.«
»Du hasst mich, nicht wahr?« Magdas Stimme war hart geworden. »Weshalb, Pilar? Weil ich sehen kann?«
»Du denkst, Geduld sei ein Ei, aus dem eines Tages ein großer Vogel schlüpft. Aber da irrst du dich.«
»Geduld ist nun mal die Mutter des Erfolgs«, zischte Magda ihr hinterher. »Wir werden schon noch sehen, wer sich irrt!«
Pilar ging hinaus. Nur ein paar Schritte, dann ließ ein Luftzug sie innehalten. Atemzüge berührten sie zart wie Fingerspitzen.
Tariq! Schlief er denn nie?
»Ich sehe nirgendwo deinen Stock, mi niña«, sagte er seufzend. »Eines Tages wirst du dir noch den Hals brechen, wenn du nicht endlich lernst, vorsichtiger zu sein!«
»Musst du mich immer so erschrecken? Manchmal denke ich, du hast die Samtpfötchen von Minka gestohlen!«
»In diesem Haus habe ich gelernt, meine Schritte zu zählen. Brauchst du Hilfe?«
»Unsinn«, erwiderte sie. Was hatte er gesehen? Und gehört? »Aber du kannst hinter mir bleiben, wenn du schon einmal da bist. Damit ich nicht aus Versehen wieder in die falsche Tür renne.«
Früher hatte sie oft auf seinem Schoß gesessen, die Arme um seinen Hals geschlungen, an dem sie geleckt hatte, um herauszufinden, ob die bräunliche Hautfärbung nicht vielleicht doch abging. Sie kannte seinen Geruch, seinen Gang, seine Vorlieben. Tariq war ihr so vertraut wie das Haus, vertrauter in gewisser Weise, als die Mutter es je gewesen war. Und er war – abgesehen von dem zerknitterten Brief – das Einzige, was ihr von Rena geblieben war.
*
Als die schwer beladenen Pferdewagen vor dem Tor hielten, liefen alle hinunter, um den Herrn zu begrüßen, Mägde, Knechte, Kaufmannsgehilfen sowie Hirtz, der in Heinrichs Abwesenheit stellvertretend das Kontor für ihn führte. Ihm folgten die drei Lehrlinge. Die eifrigste von allen aber war Magda, die fast gestürzt wäre, weil sie in der Aufregung vergaß, ihre überlangen Röcke zu raffen. Sie hatte sich ein weißes Tuch eng um den Kopf geschlungen, als könne sie es kaum noch erwarten, endlich das Gebende einer verheirateten Frau zu tragen.
Pilar lächelte ihm vom Treppenabsatz entgegen.
Beinahe hätte er sie in dem ungewissen Licht mit Rena verwechselt. Sie trug ein Kleid mit einem ärmellosen Surcot aus blauer Wolle und war schmucklos bis auf die kleinen Goldkreolen, die er ihr zur Taufe geschenkt hatte. Heinrich spürte ein Brennen in der Brust. Die Erinnerung an seine Frau war plötzlich so stark, dass er sich für einen Augenblick an der Wand festhalten musste. War das wirklich alles vom Leben, was sie ihm übriggelassen hatte? Nur noch von der Vergangenheit zu zehren?
Er zwang sich zu einer fröhlichen Miene.
Immerhin hatte er ein florierendes Geschäft. Und Pilar, die ihn brauchte, auch wenn er sie im kommenden Frühjahr nun endgültig in die Obhut eines Ehemannes geben würde. Seine Tochter würde nicht als Bettlerin in die neue Familie kommen, dafür war gesorgt. Die Mitgift, die er mit Albin Löbel, dem Vater des Bräutigams, ausgehandelt hatte, war mehr als beachtlich, und in schwarzen Stunden argwöhnte Heinrich, sie sei womöglich der wahre Grund für das wachsende Drängen der Löbels. Er hatte allerdings seinen Teil dazu beigetragen, dass sie langsam ungeduldig wurden. Zweimal schon war die Hochzeit verschoben wurden, weil Heinrich sich einfach nicht entschließen konnte. Obwohl die lange Verlobungszeit die Lästermäuler in der Stadt bereits zu Gerüchten animierte, gab es noch immer ein Zögern in ihm, für das er keine vernünftige Erklärung fand.
»Prinzessin!« Ohne die Hand Magdas wahrzunehmen, war er mit ein paar Sätzen bei seiner Tochter, hob sie hoch und drückte sie so fest an sich, dass sie lachend protestierte.
»Du wirst mich noch zerquetschen.« Sein schwerer Ring bohrte sich in ihren Schenkel und sie sog den fremdartigen Geruch ein, den Heinrich verströmte. »Warte, sag nichts! Ich rieche den Fluss, altes Holz, Pferdeschweiß und jede Menge Salz ... Ich wette, du hast dich eine ganze Weile nicht übertrieben gründlich gewaschen.« Ihre Finger tasteten über sein Gesicht. Eine alte Narbe verlief quer über die linke Wange. Sie spürte die vertraute Erhebung durch die ungewohnte Gesichtsbehaarung. Schon als Kind hatte sie sie immer wieder bewundernd berührt. Denn sie wusste, was er dafür riskiert hatte. »Und was für einen stattlichen Bart du bekommen hast! Du willst doch nicht etwa deinem alten Freund Jona Konkurrenz machen?«
»Was nicht das Schlechteste wäre!« Heinrich stellte sie wieder auf die Füße. »Besonders, wenn ich an seine Silbervorräte denke. Manchmal scheint es mir, als führten die Stollen der reichsten Minen direkt in Jonas Truhen.«
Er beugte sich zu ihr herunter.
»Aber meine Hände sind auch nicht leer.« Wie ein Taschenspieler zog er einen dreireihigen Strang aus seinem Mantel und legte ihn ihr um. »Aquamarine! In Prag können die Damen gar nicht genug davon bekommen.«
»Wie gefrorenes Eis fühlen sie sich an.« Pilar berührte die Steine. »Und sie sind fast so groß wie Wachteleier! Danke, aber du sollst mich doch nicht immer so verwöhnen.«
»Ich konnte nicht anders. Sie passen einfach wunderbar zu deinen Augen!«
Heinrich hoffte, dass seine Stimme fest genug klang. Die fortschreitende Krankheit hatte über das einstige Himmelsblau nach und nach einen Schleier gelegt. Jedes Mal, wenn er länger fort gewesen war, erschienen sie ihm noch trüber. Kein Blinder, an dem er ohne Schmerz vorbeigehen konnte, kein leerer Blick, der ihm nicht wie ein vergifteter Pfeil ins Herz gedrungen wäre. Er hätte sich längst damit abfinden sollen, dass sein schönes Kind nun unwiderruflich zu jenen Bedauernswerten gehörte. Und dennoch wollte ihn noch immer die Hoffnung nicht verlassen, eines Tages auf ein Wundermittel zu stoßen, das sie heilen konnte.
»Und das böhmische Silber?« Pilar schien an seinen Geschäften interessierter als an seinen Geschenken. »Hast du den Regensburger Zendal, die einheimischen Sammete und italienischen Goldtücher gut verkauft? Und für die flämischen Brokate bekommen, was du wolltest?«
»Mach dir keine Sorgen, Prinzessin, dein Vater wird zwar langsam alt, aber sein Geschäft versteht er noch immer.« Seine Stimme wurde leiser. »Ist das Stampfwerk aus Italien wohlbehalten angekommen?«
»Vorige Woche«, erwiderte sie ebenso gedämpft und zeigte ihm dabei ihr Profil mit der geraden Nase und dem energischen Kinn, das sie von ihrer Mutter geerbt hatte. »In unzählige Einzelteile zerlegt. Tariq hat die ganze Ladung gleich auf den Wöhrd geschafft. Matteo müsste es inzwischen schon zum Laufen gebracht haben ...«
»Mehr dazu später, wenn wir unter uns sind«, unterbrach er sie. »Glücklicherweise war ich an der Wiener Schiffslände der Erste und bin den anderen vorausgeritten, weil mich die Sehnsucht nach meinem Kind vorwärtsgetrieben hat. Welch scheußliches Wetter wir hatten, Pilar, einfach widerwärtig! Die Schiffsreiter haben mir so Leid getan, dass ich ihnen einen ordentlichen Extrabatzen zugesteckt habe.«
»Dass du nur wohlbehalten wieder zurück bist, Heinrich!«, rief Magda von unten. Wenn sie über die Zurücksetzung verärgert war, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Zufällig hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass wir mit dir rechnen können. Deshalb steht auch deine Lieblingsspeise bereit – frische Wallerpastete.« Sie legte den Kopf schelmisch zur Seite. »Und natürlich gibt es heißes Wasser für einen ordentlichen Badezuber.«
»Was wäre das Haus ohne dich?«, sagte Heinrich, während er hinunterstieg. Sie lächelte unbestimmt, als er etwas in ihre Hand gleiten ließ. »Das Kind und ich müssen dir dankbar sein.«
»Wie immer zu großzügig, Heinrich«, murmelte sie und hielt sie einen Augenblick lang fest. Sie spürte seinen Widerstand. War das alles, was er ihr zubilligte – ein bisschen Hoffnung, ein kleiner Trost? Sie wollte mehr vom Leben. Und jetzt, wo er endlich zurück war, wurde es höchste Zeit, dass er davon erfuhr.
Er machte sich frei, als sei ihm plötzlich zu heiß geworden. »Ich muss noch einmal weg. Wartet nicht auf mich.«
»Jetzt?«, entfuhr es Magda. Unwillkürlich drehte sie bei seinen Worten ihren Rücken der Hauswand zu, die ganz im Dunkeln lag. »Aber es ist doch bald Schlafenszeit!«
Ein ungeduldiges Achselzucken, das ihr ihre Stellung nur allzu deutlich bewusst machte. Sie hoffte, ihr zorniges Erröten verbergen zu können. Magda hasste es, wenn Heinrich sich in der alten Mühle auf dem Wöhrd vergrub. Keine Brücke führte dorthin, nicht einmal ein hölzerner Steg. Egal, welche Jahres- oder Tageszeit, man musste immer mit dem Boot übersetzen. Ebenso war alles, was man brauchte, gleichermaßen mühselig auf die Donauinsel zu schaffen. Jedes Mal, wenn ihr Vetter von dort in die Wahlenstraße zurückkehrte, erschien er ihr völlig fremd – ein Mann, der in einer Welt lebte, zu der ihr jeder Zutritt verwehrt war.
»Nur die ersten fünf Wagen«, rief Heinrich Weltenpurger den Knechten zu, die bereits mit dem Ausladen begonnen hatten. »Schont eure Knochen – an der Schiffslände werdet ihr noch genügend Kraft brauchen!«
Ein flachshaariger Bursche, erst ein paar Monate in Heinrichs Diensten, schien ihn nicht gehört zu haben. Ihn riss der Kaufmann regelrecht von der Plane zurück. »Bist du taub, Junge? Den letzten Wagen rührt mir keiner an, verstanden?«
Er wandte sich suchend um. »Tariq?«
»Señor?«
»Den nimmst du dir allein vor und bringst alles in das oberste Turmzimmer. Aber vorsichtig! Wenn du fertig bist, schließt du ab. Du persönlich bürgst mir für den Schlüssel.«
Der Maure deutete eine Verneigung an. »Wie gewünscht, Señor«, sagte er leise.
*
Er hielt sie seit langem wieder einmal in der Hand, jene leicht vergilbten Blätter, die er sonst in der dicken Ledermappe verwahrte. Die Herrin hatte sie ihm übergeben, bevor sie gegangen war, mit ihrem halben Lächeln, das ihm seit langem vertraut war.
»Dorthin, wo ich künftig leben werde, kann ich sie nicht mitnehmen«, sagte sie. »Einmal schon wären sie fast mein Todesurteil geworden. Aber vernichten kann ich sie auch nicht. Es soll doch nicht alles umsonst gewesen sein!«
Tariq schwieg. Er liebte und verehrte sie, aber er verstand sie nicht. Welchem Gott wollte sie dienen, der solche Opfer forderte?
Sie schien zu wissen, was er dachte.
»Du hast ja Recht, Tariq. Eigentlich gehöre ich nirgendwohin, nicht hierher und auch nicht mehr nach León. Deshalb kann ich ebenso gut zu denen zurückkehren, die ich einst verlassen habe.«
»Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss«, sagte er. »Niemand kann die Zeit zurückdrehen.«
»Deshalb möchte ich, dass du das Geschriebene für mich aufbewahrst. Um es eines Tages Pilar zu geben.« Eine Frau, groß und schlank, voller Feuer. Noch immer so schön mit ihrem weißen Haar und dem stolzen Gang, dass ihr alle Blicke folgten. Tariq vermochte nicht zu begreifen, warum sie sich dafür hasste. »Eine Art Vermächtnis, wenn du so willst. Pilar wird es lesen. Wenn sie alt genug ist, zu verstehen.« Ein Schatten legte sich über ihr Gesicht. »Ich habe es für sie übersetzt. Und mich dabei noch einmal wund gestoßen an den Gefühlen der jungen Frau, die ich damals war.«
»Und der Señor?«
»Heinrich? Ich habe ihm schon mehr als genug zugemutet. Nein, du musst mir versprechen, dass er es niemals zu Gesicht bekommt.«
»Willst du, dass ich auf mein Leben schwöre?«
»Du weißt, dass die Reinen jeden Schwur ablehnen. Es genügt, wenn du es mir versprichst. Du hast mich noch niemals belogen.«
Sie strich sich das Haar zurück. Plötzlich war sie nicht mehr so sicher, wie sie sich vor ihm gab.
»Bitte, sieh mich nicht an wie eine Ehebrecherin! Der Einzige, der mich dessen bezichtigen könnte, wäre Gott, und dieses Vergehen, das ich einmal an ihm begangen habe, will ich ja gerade wieder gutmachen.«
Sie hatte das Wort ausgesprochen, das alles zerstört hatte. Sofort sah er sie wieder vor sich, die biegsame Gestalt seiner Mutter, und er hörte ihre weiche Stimme – bis zu dem Tag, an dem man sie wie eine räudige Hündin in einen Sack gesteckt und fortgeschafft hatte. Am selben Tag hatte die Herrin ihn bei sich aufgenommen. Seitdem gehörte sein Leben ihr.
Bis heute hatte er das Vermächtnis als seinen heiligsten Schatz gehütet. Als das Augenlicht Pilars nach und nach erlosch, war er immer wieder versucht gewesen, es ihr zu übergeben. Hatte sie kein Anrecht darauf?
Er hatte es oft vorgehabt und nie über sich gebracht. Nächstes Jahr, hatte er sich immer wieder gesagt, dann wird sie alt und verständig genug sein. Inzwischen wusste er, dass er sich etwas vorgemacht hatte. Pilar war erwachsen – und blind. Selbst würde sie nie mehr das Vermächtnis ihrer Mutter lesen können.
Wer aber sollte es ihr zu Ohren bringen?
Er beschäftigte sich nicht gern mit dieser Frage, auf die es nur eine Antwort gab. Die Herrin hatte ihm beigebracht, ihre Schrift zu entziffern, jene ungeduldigen, steil hingeworfenen Buchstaben, die kriegerisch wirkten und nichts gemein hatten mit der kalligraphischen Anmut des Arabischen, die er so sehr liebte. Als ob der dauernde Kampf in ihrem Herzen sich auch auf ihre Hand ausgewirkt hätte.
Stand ihm denn überhaupt zu, in dieses Dickicht einzudringen, das so viel Leid über alle Beteiligten gebracht hatte?
Schließlich war er nur ein Diener, der überdies erst dazugestoßen war, als die Geschichte schon längst begonnen hatte. Die Herrin hatte sich ihm in Ermangelung eines anderen Verbündeten anvertraut, aber ihm nicht alles erzählt. Es war die Geschichte ihres Lebens, die zwischen dem gebeizten Leder aufbewahrt wurde. Was, wenn dieses Vermächtnis eines Tages verloren ging? War es nicht seine Pflicht, die Wahrheit an die Tochter weiterzugeben?
Widerwillig öffnete Tariq die Mappe und las die ersten Zeilen. Sofort stand alles wieder vor seinen Augen: das Haus mit den vergitterten Fenstern in der Calle de Conde Luna, in dem sie gewohnt hatte, mitten im Viertel der Silberschmiede. Der Weg zu San Isidoro, den sie nicht mehr hatte gehen können, weil man sie eingesperrt hatte. Ihre Abstecher zum Markt auf der Plaza Mayor, wo sie zwischen gackernden Hühnern und keifenden Bäuerinnen herumgeschlendert war – bis eines Tages ihr Bruder zurückgekehrt war ...
Tariqs Hände zitterten. Schon nach wenigen Seiten musste er die Blätter wieder weglegen. Er kam sich vor wie ein Dieb, der in intime Gemächer eingedrungen war. Was hier geschrieben stand, ging ihn nichts an!
Und doch: Seine niña war drauf und dran, den Falschen zu heiraten. Ebenso wie ihre Mutter den Señor nur geehelicht hatte, weil sie an der Liebe zu einem anderen fast verbrannt wäre.
Tariq hatte schon zu lange gezögert, das wusste er plötzlich.
*
Ein Knarzen weckte sie. Pilar gefiel es, dass die alten Dielen jeden verrieten. Nicht einmal Minka konnte sich auf dem Holz lautlos bewegen.
»Papa?« Sie setzte sich auf. Mit einem Satz sprang die Katze aus dem Bett.
»Ist leider doch sehr spät geworden«, sagte Heinrich, »bitte verzeih! Aber ich wollte dir unbedingt noch gute Nacht sagen.« Er strich über ihr Haar, das lang und dicht wie das ihrer Mutter war, aber dunkel wie Rauch, nicht weiß wie frischer Schnee.
»Du darfst mich doch immer wecken.« Schlaftrunken rieb sie sich die Augen. »Schön, dass du wieder da bist! Ich habe dich schrecklich vermisst.«
Er musste sich abwenden.
Damit hatte vor Jahren alles begonnen – mit Tränen und verklebten Lidern; eine scheinbar harmlose Entzündung, die keiner ernst genommen hatte und die man mit Frauenmilch und gestoßenem Koriander eher beiläufig behandelt hatte. Kinderkram, hatte er gedacht, eine Unpässlichkeit, die schnell wieder vorbei sein wird. Wie hätten sie denn ahnen können, dass eines Tages Blindheit daraus würde?
»Bist du mit deiner Fahrt zufrieden?«, fragte sie sanft, weil sie seine aufkeimende Traurigkeit spürte. »Es ist bestimmt nicht einfach, so lange mit lauter Fremden unterwegs zu sein!«
»Nun ja, weidlich bekannt sind sie mir ja alle aus den Sitzungen der Kaufmannschaft. Aber man lernt immer wieder dazu. Auf schlammigen Straßen und in verwanzten Herbergen zeigen viele erst ihr wahres Gesicht. Der eine oder andere schreckt nicht einmal davor zurück, sich unterwegs mit allen Mitteln für das Amt des Hansgrafen zu profilieren. Und dennoch reist es sich noch immer sicherer gemeinsam in diesen gefährlichen Zeiten.«
»Gab es Zwischenfälle?«, fragte sie. »Seid ihr überfallen worden oder bestohlen?«
Er rieb seinen Bart.
»Zum Glück nicht, aber du hast natürlich Recht, mein kluges Mädchen, so wie früher ist es schon lange nicht mehr«, fuhr er nachdenklich fort. »Damals, als mich Reiselust, Neugierde und Erlebnishunger quer durch Europa getrieben haben. In jenen Tagen war kein Weg mir zu gefährlich, keine Stadt mir zu weit.« Seine Stimme wurde fröhlich. »Inzwischen aber bin ich jedes Mal erleichtert, wenn ich das holprige Pflaster der Steinernen Brücke wieder unter meinen Sohlen spüre. Nicht einmal der unverschämte Zoll des neuen Brückenmeisters kann dann noch meine Laune schmälern. Denn ich weiß, dass ich nach ein paar Schritten bei dir bin.«
»Und doch fährst du immer wieder weg.« Sie berührte seine Hand. »Ich könnte wetten, du planst schon wieder die nächste Reise!«
»Du weißt, weshalb, Pilar. Ich führe mein Geschäft – auf meine Art. Ich vermisse dich auch, wenn wir getrennt sind. Aber ich kann nicht anders.«
»Und weißt du eigentlich, Papa, wie sehr ich dich darum beneide?« Pilar seufzte. »Wäre ich ein Mann und könnte ich noch sehen, so würde ich auch ...« Sie hörte ihn in einem Lederbeutel kramen und versteifte sich unwillkürlich. »Nein, ich glaub es nicht! Du hast dir doch nicht etwa schon wieder ein neues Mittel gegen Blindheit andrehen lassen?«
»Es soll wahre Wunder wirken.« Heinrich hielt ihr ein Fläschchen unter die Nase. »Man hat es mir überzeugend versichert!«
»Riechen tut es äußerst merkwürdig.« Sie schüttelte sich.
»Was spielt das für eine Rolle, Prinzessin, wenn es nur hilft?«
»So wie das sündteure Tollkirschenelixier? Drei lange Tage musste ich mich am Bettpfosten festhalten, weil ich Angst hatte, aus der Welt zu kippen!« Pilar spürte seine Enttäuschung. »Also, was ist es?«, sagte sie. »Hoffentlich keine Krötenaugen, die man dem armen Tier zuerst aus dem Kopf reißen musste, um sie um den Hals zu tragen!«
»Ein Extrakt aus Küchenschelle«, sagte Heinrich, »vermischt mit einer Prise Alraune.« Sie hörte etwas knistern. Er schien die Rezeptur noch einmal zu überfliegen. »Die eine Hälfte musst du trinken, die andere wird zu lauwarmen Augenbädern verwendet. Balbina soll alles vorbereiten!«
»Und danach kann ich garantiert wieder sehen?«
Pilar hasste die plötzliche Bitterkeit in ihrer Stimme. Wahrscheinlich würde das Fläschchen alsbald zu all den anderen nutzlosen Heilsbringern in der Truhe unter dem Fenster wandern – dem vertrockneten Bilsenkraut, dem gestockten Hollerwein, den diversen Safransäckchen, Harzbrocken nebst welken Büscheln Augentrost, dem gestoßenen Smaragdpulver, das scheußlich in der Kehle gekratzt hatte, bis sie erbrechen musste, der geschälten Weidenrinde und all den Onyxsteinen, Amethysten, Bergkristallen, Perlen und Achaten, die ihr niemals Freude bereitet, geschweige denn etwas zur Heilung beigetragen hatten. Wenigstens verdankte sie Minka diesen nimmermüden Anstrengungen ihres Vaters. Irgendjemand hatte ihm eingeredet, man müsse die Pfote einer Katze auf das erkrankte Auge legen. Seitdem hatte sie zwar einen ordentlichen Kratzer neben der linken Braue, aber auch die Gesellschaft eines zutraulichen Geschöpfes, das sich an ihren Beinen rieb und ihr beim Einschlafen Gesellschaft leistete.
»Einen Versuch ist es doch wert«, sagte er vorsichtig. »Du wirst es doch probieren – mir zuliebe?«
»Papa, ich ...«
»Bitte, Pilar! Meinst du, ich würde auch nur einen Moment zögern, dir mein Augenlicht zu schenken, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte?«
Sie spürte seine Tränen auf ihrer Hand.
»Es ist nicht so schrecklich, wie du glaubst«, sagte sie leise. »Jedenfalls meistens nicht. Ich hatte ja Zeit, mich daran zu gewöhnen. Und dann habe ich ja noch die Bilder in mir, die mir keiner nehmen kann. Ich kann mich genau an das matte Gelb der Schlüsselblumen erinnern, an das erste Frühlingsgrün an Bäumen und Sträuchern.« Sie verriet ihm nicht, dass sie seit neuestem manchmal das Gefühl überkam, die Farben würden allmählich verblassen. Von dem Licht ganz tief drinnen, das nur ihr allein gehörte, sagte sie lieber auch nichts. »Außerdem gibt es jetzt Dinge für mich, Papa, die ich früher gar nicht kannte.«
»Was meinst du damit, mein Mädchen?«
»Ich höre, wie der Tag ausatmet, wenn die Abenddämmerung kommt. Ich fühle, wie die Luft vor einem Gewitter knistert. Und ich spüre eigentlich immer, wenn jemand lügt, weil sein Körper sich dann verkrampft und die Stimme plötzlich anders klingt.« Sie kuschelte sich in seinen Arm. »Jetzt will ich aber endlich alles über das böhmische Silber wissen! Hast du genug zusammen, um mit dem Papiermachen richtig zu beginnen?«
Sein Lachen, das sie mehr als alles andere vermisst hatte, machte sie glücklich. »Da spricht die echte Kaufmannstochter! Ja, den größten Teil habe ich beisammen; den Rest wird Jona gewiss zuschießen. Und wenn erst einmal das Stampfrad seine Arbeit tut, dann wird das gleich etwas ganz anderes sein als das mühsame Zerquetschen der Lumpen von Hand, mit dem wir uns bislang abgeplagt haben!«
Für einen Augenblick war sie versucht, ihm zu sagen, dass sie Magda und Matteo im Bett erwischt hatte. Sie musste ja nichts von Renas Kammer erwähnen. Dann jedoch entschied sie sich dagegen. Magda war ihr gegenüber schon reizbar genug. Fand sie jetzt auch noch heraus, dass Pilar sie verraten hatte, würde das die Stimmung im Haus weiter vergiften.
Heinrich war ihr inneres Abschweifen nicht aufgefallen. »Und weißt du, was? Bei passender Gelegenheit bringe ich die Sache bei Gerhard unter den Scheren zur Rede!«
»Du willst mit dem Hansgrafen reden? Ist das nicht ein bisschen verfrüht?«
»Vielleicht, Pilar! Aber ich möchte, dass alles seine Ordnung hat. Es war schon schwer genug, auf der Reise kein Wort über meine Pläne zu verlieren, obwohl Lettl immer ganz besonders neugierig ist! Aber wenn meine Papiermühle erst einmal richtig läuft, dann werden die geschätzten Herren Mercatores Augen machen, Pilar ...«
Erschrocken hielt er inne.
»Du darfst das Wort in meiner Gegenwart ruhig aussprechen«, sagte sie lächelnd. »Ich bin nicht so hilflos und schwach, wie du denkst.«
»Aber das tue ich doch gar nicht!«
Ihr Lächeln wurde zum vergnügten Lachen. »Hast du schon vergessen, was ich vorhin über das Lügen gesagt habe, Papa?«
*
»Im Wasser bewegen sich Schlangen aus Silber / Sie ziehen die Wasserrinne entlang. / Die Kiesel, gleißend im silbernen Wasserlauf / tragen den Glanz von Perlen auf weißer Haut ...«
Heinrich Weltenpurger konnte an keinem Flussufer stehen, ohne an diese Zeilen zu denken. Ein maurisches Liebesgedicht, wenn er sich recht erinnerte. Für ihn war es untrennbar mit Rena verknüpft – wie so vieles. Noch immer trug er den Ring an seiner Hand, der sie beide für immer verband, und er würde ihn bis zum letzten Atemzug nicht ablegen.
Mit feuchten Augen starrte er auf die vertraute Silhouette seiner Heimatstadt, auf die starken Mauern und hohen Türme, die er früher so geliebt hatte, aber das warme Gefühl war längst verschwunden. »Sie hassen mich, Enrique.« Ihre Stimme, die ihn vom ersten Ton an fasziniert hatte, war plötzlich so deutlich in seinem Ohr, als stünde sie neben ihm. »Und dich nicht minder. Niemals werden sie es dir verzeihen, dass du dich für die seltsame Fremde entschieden hast, anstatt eine ihrer Schwestern, Nichten oder Töchter zu freien. Wie viel Hass kann ein Mensch ertragen? Ich bin so müde, Enrique ...«
Rena hat Recht behalten, dachte er. Es war schwierig für sie bei uns im Norden. Einsam war sie, das hat sie äußerlich hart erscheinen lassen. Und die Stadt hat es ihr nicht leicht gemacht. Niemals ist Regensburg ihr auch nur einen Schritt entgegengekommen.
Das Dröhnen in seinem Schädel verstärkte sich. Es half nichts, wenn er unterwegs Badertöchter umarmte oder sich zu fremden Dirnen legte. Denn es war nicht Renas Körper, den er noch immer so schmerzlich vermisste wie am ersten Tag ihrer Flucht.
»Padrone? Hier – die frischen Bögen!« Heinrich schrak zusammen. Er hatte seine Frau so geliebt, dass er sich manchmal insgeheim gewünscht hatte, vor ihr zu sterben. Aber das Schicksal hatte anders entschieden. Sie ist fort, dachte er und spürte die klamme Enge in seiner Brust. Ich habe sie für immer verloren.
»Padrone?« Der Gautscher musterte ihn besorgt.
»Gib schon her!« Ruppig riss Heinrich ihm den Bogen aus der Hand und hielt ihn gegen die Abendsonne. Seit Wochen war der Himmel über Regensburg zum ersten Mal wolkenfrei. Dafür blies ein steifer Ostwind, der im Schornstein jammerte. Die alte Mühle auf der Donauinsel schien sich unter den Böen zu ducken. Zu seiner Rechten spannte sich die Steinerne Brücke über den Fluss, der noch kein Hochwasser führte, aber bereits beachtlich gestiegen war.
»Immer noch viel zu dunkel!« Enttäuscht ließ er es wieder sinken. »Das Papier muss heller werden, verstehst du, so hell wie möglich! Wie oft hab ich dir das schon gesagt?«
Matteo schien unbeeindruckt. »Oben ist es schon viel glatter, du musst fühlen!« Ehrfürchtig glitten die rissigen Hände über den Bogen. »Macht die Stärke! Jetzt kann die Tinte nicht verschwinden. Und siehst du das neue Wasserzeichen – schöne große Muschel von Santo Giacomo? Jeder wird immer gleich wissen, ist unser Papier!«
»Man müsste vielleicht noch etwas anderes verwenden«, murmelte Heinrich, der nicht richtig zugehört hatte. »Ein organisches Material mit noch mehr Glanz. Fürs Erste aber sollten wir versuchen, unsere dringlichsten Probleme zu lösen.« Er ließ das Blatt sinken und ging hinüber zu dem neu installierten Stampfwerk, das jetzt stillstand. »Tut es denn seine Sache?« Er starrte in das dunkle, schnell fließende Wasser zu seinen Füßen. »Ist der Mühlkanal auch wirklich stark genug?«
»Bin zufrieden«, sagte Matteo. »Nur der Stampfhammer könnte größer sein. Macht schneller mehr Papier.«
»Führ mich zu den Lumpen!«, befahl Heinrich.
Dem Stoffhaufen hinter der alten Mühle entströmte ein Gestank, der ihn zurückweichen ließ. »Zum Gotterbarmen!«, entfuhr es ihm. »Das riecht ja fürchterlich!«
»Schlimmer als Schweinestall«, bekräftigte Matteo, der sich ebenfalls zum Schutz seinen Jackenärmel gegen die Nase presste. »Gut, dass selbst Siechenkobel nicht zu nah ist, sonst würden wegen uns noch mehr Leute krank! Ist ohnehin schon schwierig genug, jemand zum Sortieren zu finden. Viele kommen nur ein, zwei Tage, dann wieder Schluss. Heute war kaum jemand da. Nur ein paar Frauen und Kinder.«
»Und die Männer? Blum und Sperling?«
Der Welsche zuckte die Achseln.
»Blum hat neue Arbeit bei Salzstadel«, sagte er. »Mehr Geld und weniger Gestank. Und Sperling will in Zukunft auch dort arbeiten. Schickt Frau als Ersatz vorbei. Aber Frau nicht so stark wie Sperling.«
Heinrichs Gesicht verfinsterte sich.
»Kein Blum und kein Sperling – willst du denn alles alleine machen? Wir brauchen dringend neue Arbeitskräfte!«
»Schwierig, wenn Leute nix verstehen«, sagte Matteo. »Geht vielleicht für Lumpen, aber nicht gut für Gautschen, Schöpfen und Pressen.«
»Das weiß ich«, sagte der Weltenpurger. »Aber kannst du mir mal verraten, wo ich hier in Regensburg ausgebildete Papierhandwerker hernehmen soll?«
»Vielleicht wir besser nehmen Arbeiter aus Fabriano? Könnte meinen Bruder Andrea fragen ...«
»Damit warten wir, bis die Pässe wieder frei sind. Und außerdem geben Fremde gleich wieder Gerede – das hast du doch am eigenen Leib erfahren! Ich werde die entsprechenden Stellen rechtzeitig informieren. Aber dann möchte ich auch, dass die Produktion wirklich anlaufen kann.« Sein Mund wurde weich. »Ich setze ganz auf die Zukunft, Matteo, verstehst du? Was immer auch geschieht, für mich heißt sie Pilar.«
*
Heinrich wollte gerade das Kontor verlassen, als Jona eintraf. Lachend streckte er seinem Besucher die Hände entgegen.
»Überall Tintenspuren«, sagte er, »wie es sich für einen richtigen Pfeffersack gehört. Komm, lass uns nach oben gehen! Riechst du, wie das ganze Haus schon nach gebratener Gans duftet?« Er lud ihn nicht zum Essen ein – er wusste, dass Jona und seine Frau Tamar nur koschere Gerichte berührten, die er persönlich sehr schätzte. Er war immer gern Gast an ihrem Tisch gewesen, früher allerdings häufiger als in letzter Zeit.
»Lass uns lieber hier reden«, sagte Jona und schälte sich aus seinem schweren Mantel. Die Kälte hatte seine Wangen gefärbt. Als er die Kappe ablegte, sah man, wie dicht sein grau melierter Schopf war. »Du weißt, dass ich mich in deiner chamer seit jeher am wohlsten gefühlt habe.« Seine Armbewegung schloss die Truhen, Schränke und die vier jetzt verwaisten Schreibpulte ein. Sogar Hirtz war schon nach Hause gegangen. Auf einem länglichen Eichentisch stand ein Abakus. Jona nahm ihn hoch, bewegte kurz die hellen und die dunklen Perlen auf dem Holzgestell hin- und her und stellte ihn wieder ab. »Erinnert mich daran, wie viele Stunden Simon und ich damals mit unseren Kalkulationen für die Stofflieferungen nach Kiew verbracht haben ...«
Als sei es erst gestern gewesen, stand alles wieder vor Heinrich: jene Glück verheißende Aufbruchszeit, als er, noch blutjung, mit Magdas Vater sowie den jüdischen Brüdern Jona und Simon ben Aaron nach Osten gefahren war, erfolgreiche, aufregende Jahre im Pelz-, Edelmetall- und Bernsteinhandel. Bis zu jener Schreckensnacht, als in einer dunklen Kiewer Gasse ein Dolchstoß das Leben seines Oheims ausgelöscht hatte. Die Narbe auf seiner Wange erinnerte ihn Tag für Tag daran. Er war damals dazwischengegangen, ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen, mit dem Mut der Verzweiflung. Aber es war bereits zu spät gewesen ...
»Du wirst bald wieder genügend zu planen und zu rechnen haben«, sagte Heinrich, »verlass dich drauf!«
»Du weißt, in welche Gefahr du dich damit bringst?«, wandte Jona ein. »Wir sind Eigentum des Kaisers, ebenso wie unser ganzer Besitz ihm gehört. Werden wir nun Partner, so fällst du ebenfalls darunter – mit deinem gesamten Vermögen. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen, Heinrich?«
Da waren scharfe Linien in Jonas Gesicht, die Heinrich nie zuvor bemerkt hatte. Eines Tages wachst du auf und merkst plötzlich, dass du nicht mehr jung bist, dachte er, sondern zur anderen Seite gehörst. Wahrscheinlich geht es Jona nicht anders, wenn er mich ansieht.
»Wir machen das Geschäft zusammen und damit Schluss – du musst nur noch einschlagen! In wenigen Wochen, Jona, können wir so weit sein. Das neue Stampfwerk ist großartig. Kein Vergleich mit dem plumpen Mörser der Spanier!« Schon als er es aussprach, wusste er, dass er das falsche Wort gesagt hatte.
Er erkannte es, weil Jona sich abwandte.
»Simon, nicht wahr?«, sagte Heinrich betroffen. »Tut mir Leid, ich wollte keine alten Wunden aufreißen!«
»Und es ist Spharadim, an das ich meinen Bruder für immer verloren habe.« Jona begann zu zwinkern. »Dabei kann ich ihm nicht einmal vorwerfen, dass er nach León gegangen ist. Kaum ein Handwerk, das uns noch offen steht, kaum ein Handelszweig, in dem wir ungestört operieren können! Was haben wir Juden im Reich zu erwarten nach all dem Schrecklichen, das hier geschehen ist?«
»Der Kaiser hat sich ausdrücklich zu seinen Juden bekannt«, widersprach Heinrich. »Friedrich hat seinen eigenen Sohn mit der Untersuchung der verachtungswürdigen Vorfälle beauftragt.«
»Heinrich, ich weiß, wie du denkst und handelst. Aber du solltest den Tatsachen ins Auge sehen – jetzt erst recht. Offiziell heißen wir Kammerknechte des Kaisers, in Wirklichkeit aber sind wir nichts anderes als seine Sklaven, mit denen er nach Gutdünken verfährt.«
»Es ist auch für uns christliche Kaufleute erheblich schwerer geworden, seit die Mongolen Kiew erobert haben.« Heinrich wog einen Stapel Blätter nachdenklich in der Hand. »Damit ist der gesamte Osthandel zum Erliegen gekommen. All die wunderbaren Dinge, die wir dort früher für günstiges Geld bekommen haben – Pelze, Zinn, Wachs, Edelmetalle! Wie mühsam ist es heute, neue Handelszweige zu beleben. Weißt du, Jona, manchmal beneide ich deinen Bruder regelrecht, dass er im warmen Westen sitzt und nicht mehr herumreisen muss!«
»Beneide ihn nicht!« Jona hatte seine Stimme erhoben. »Auch wenn die Juden in Spanien nicht um ihr Leben fürchten müssen und er neben dem Geldverleih noch seinen Handel mit Gewürzen und seltenen Arzneipflanzen betreiben darf. Du haderst mit Gott, Heinrich, weil dein schönes Kind sein Augenlicht verloren hat – aber mein Bruder muss viel Schlimmeres ertragen.« Er senkte die Stimme. »Simon hat sein Kind für immer verloren.«
Beinahe wären dem Kaufmann die Bögen aus der Hand gerutscht. Simons Ehe mit Riwka war zum großen Kummer beider lange ohne Nachkommen geblieben. So hatten sie in León vor achtzehn Jahren ein neugeborenes Mädchen an Kindes statt angenommen, genau zu der Zeit, als Heinrich in derselben Stadt Rena kennen gelernt hatte. Seitdem schien ihm das Schicksal der kleinen Familie mit seinem eigenen eng verknüpft.
»Esther – ist tot?«
»Fortgelaufen ist sie«, sagte Jona traurig. »Schon vor drei Jahren, als Simon sie einem rechtschaffenen Mann zur Frau geben wollte. Am Tag der Verlobung war Esther spurlos verschwunden. Seitdem haben sie nichts mehr von ihr gehört. Riwka ist krank vor Sorge. Simon hat Angst, dass sie nie wieder gesund wird.«
»Kein Brief? Keine Nachricht – gar nichts?«
»Ein Rabbi will sie im letzten Jahr im Süden gesehen haben, wo sie angeblich mit fahrendem Volk auf dem Markt von Cordoba aufgetreten sein soll. Simons Tochter inmitten von Jongleuren und Gauklern – kannst du dir das vorstellen?« Heinrich dachte an den frommen Mann mit den ernsten Augen und schüttelte den Kopf. »Und sie ist und bleibt seine Tochter, auch wenn sie nicht aus dem Schoß seiner Frau gekommen ist!«
»Welch schrecklicher Schlag für deinen Bruder!«
»Das ist es. Aber wie sagt der Prophet Zecharja? ›Nicht durch Stärke und Macht, sondern durch den Geist leben wir.‹ Und an anderer Stelle steht geschrieben: ›Einer, der lernt, ist eine Wegkreuzung‹. Solange wir also atmen, können wir hoffen – das war und ist meine Devise. Und jetzt zeig mir mal den Bogen!«
*
Alle am Tisch waren schweigsam nach dem üppigen Essen, Heinrich Weltenpurger, Magda, Pilar sowie die Gäste Albin und Martin Löbel. Sogar Pater Rabanus, der sonst immer gern und viel redete, schien vor seinem Weinbecher leicht zusammengesunken.
»Die Köchin hätte nicht so am Beifuß sparen sollen«, sagte Magda seufzend, als schließlich noch eine Platte mit Printenmännern und schmalzgebackenen Martinsküchlein aufgetragen wurde. Martin Löbel nahm sich eine Hand voll, während alle anderen ablehnten. »Dann wäre uns das fette Fleisch besser bekommen. Nächstes Mal wird sie tun, was ich anordne. Sonst kann sie ihr Bündel schnüren.«
»Hat dich ja keiner gezwungen, deinen Teller dreimal zu füllen«, versetzte der alte Löbel. »Und was den Gehorsam betrifft – meine liebe verstorbene Barbara hatte niemals Schwierigkeiten mit den Dienstboten!«
»Du hast auch nicht gerade gefastet«, gab sie schnippisch zurück. Ihr dunkelblondes Haar glänzte wie das Fell eines gesunden Tiers. Ihr Gesicht war nicht ebenmäßig, aber durchaus anziehend, mit vollen Lippen und einer zierlichen Nase. Auf Albins Teller türmten sich Gänseknochen, Kastanien und Krautreste. »Dabei sollten Männer deines Alters besser auf der Hut sein! Sonst sterben sie am Schlag, wie vor drei Tagen der steinreiche Georg Zandt, der keine fünfzig geworden ist. Dem haben all seine Goldtaler nichts genutzt.«
Jetzt starrten alle Männer am Tisch sie an.
Der Scarlatto, aus dem ihr neues Kleid genäht war, machte sie blass. Außerdem wurde ihre Haut fleckig, wenn sie sich aufregte. Und jetzt regte Magda sich auf. Blutrot funkelten bei jeder Bewegung die böhmischen Granattropfen an ihrem üppigen Busen.
Heinrich wünschte sich, er hätte ihr nicht ausgerechnet diesen Schmuck geschenkt. Frauen binden Männer mit Granat an sich, so eine Volksweisheit, an die er sich plötzlich wieder erinnerte. Rot – das war die Farbe für eine Geliebte, nicht aber für eine Verwandte. Rena hätte sie tragen sollen, aber sie hatte schon lange keinen Schmuck mehr angelegt, Jahre bevor sie fortgegangen war. Nur in der allerersten Zeit hatte sie sich widerspruchslos von ihm ausstaffieren lassen mit Edelsteinen, Seide, edlen Tüchern, Spitzen und all den Kostbarkeiten, die er von überall her für sie anschleppte.
Sein Blick glitt zur Decke, die ein gemalter Sternenhimmel schmückte. Damals, als er seine junge Frau im Arm gehalten hatte und die Geburt des Kindes kurz bevorstand, war ihm gewesen, als tanze er direkt hinein. Jetzt kam es ihm manchmal vor, als funkelten sie kalt und höhnisch auf ihn herunter.
Pater Rabanus schien zu spüren, was ihn ihm vorging.
»Eigentlich ist der Martinstag ja nicht zum Prassen gedacht«, sagte er mit seiner tiefen Stimme, die sonst von der Kanzel bis in die hinterste Ecke der Basilika trug. »Sondern als Erinnerung an einen frommen Mann, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Ihm zu Ehren brennen überall die Feuer und werden die Laternen entzündet.« Sein Ton gewann an Schärfe. »Und erinnern uns daran, mit den Armen zu teilen, was der Herr in seiner Güte uns beschert hat.«
»Das Hochamt ist schon eine ganze Weile vorüber«, sagte Martin vorlaut. »Außerdem sind wir Löbels nie knauserig gewesen. Oder warst du mit unseren Martinspfennigen für dein Kloster dieses Jahr etwa nicht zufrieden?«
»War dieser Heilige nicht ein Krieger, der kein anständiges Zuhause hatte?«, fiel sein Vater ein. »Wir bleiben im Winter lieber am Feuer sitzen. Das schont die Knochen – und den Mantel.«
»Eines vergisst du allerdings dabei: Das ganze Leben ist eine Wanderschaft«, erwiderte der Pater. »Oder sollte ich nicht besser sagen: Pilgerreise? Nur wer sich auf Gott zubewegt, darf auf Erlösung hoffen.«
»Pilgern – ist das nicht etwas für Leute ohne ordentlichen Beruf, Gesindel, das etwas auf dem Kerbholz hat?« Albin rümpfte die knollige Nase. Der zurückweichende Haaransatz ließ ihn wie einen Mönch aussehen. Die Augen jedoch waren schnell und hart. »Kaufleute wie wir können es sich nicht leisten, herumzureisen, ohne Geschäfte zu machen, nicht wahr, Weltenpurger?«
Pilar hatte wieder diesen höflichen Gesichtsausdruck, wie immer, wenn sie sich langweilte. Martin, beinahe eine jüngere Kopie seines Vaters, hatte zuvor unter dem Tisch ein paar Mal viel sagend ihre Hand gedrückt, was Heinrich nicht entgangen war. Am liebsten hätte er sie gefragt, was sie davon hielt. Aber die Angst vor einer unverblümten Antwort ließ ihn schweigen.
Er lehnte sich in seinem Sessel zurück.
Die Stimmen wurden leiser, die Geräusche schwächer, beinahe, als ob ihn eine gläserne Wand von allem trennte. Wieder überfiel ihn der schon bekannte Zweifel. Sollte er ihnen sein Mädchen wirklich überlassen – dem schwachen Sohn und dem gierigen Vater? Aber verdiente Pilar nicht die Chance auf ein normales Leben? Albin würde es ihr an nichts fehlen lassen, dafür hatte er gesorgt. Und Martin war unübersehbar verrückt nach ihr. Außerdem war nicht einmal ein Heinrich Weltenpurger unsterblich. Irgendwann würde er abtreten müssen. Dann war es wichtig, dass Pilar ein solides neues Zuhause hatte.
»Sie sieht aus wie ein Stück altes Wachs, du dagegen wie eine Winterrose«, flüsterte Martin in Pilars Ohr. Der Wein, den er schnell getrunken hatte, machte ihn mutig. »Ich bin froh, dass du bald meine Frau bist. Und noch froher, dass wir sie nicht in unser Haus mitnehmen müssen.« Er lachte. »Obwohl ja gemunkelt wird, eure Base verfüge über gewisse Fertigkeiten, die jeden Mann ihren Buckel schnell vergessen lassen ...«
»Die Leute haben immer etwas zu reden. Egal, ob jemand einen hohen Rücken hat oder nichts mehr sehen kann.«
»Das ist doch etwas ganz anderes!« Martin spürte, dass er sie verletzt hatte. »Über dich würde keiner etwas Abfälliges zu sagen wagen. Und wenn doch, dann kriegt er auf der Stelle meine Fäuste zu spüren. Magda dagegen ...«
Pilar rückte von ihm ab. »Was bist du, Martin, ein Tratschweib oder ein Mann?«
»Das würde ich dir nur zu gern beweisen – am liebsten auf der Stelle!« Er war ihr schon wieder ganz nah gerückt. »Sag, wollen wir nicht kurz nach draußen gehen? Die Winterluft würde dir bestimmt gut tun.«
Pilar rührte sich nicht.
Bestimmt würde er im Schutz der Nacht wieder versuchen, seine dicke Zunge zwischen ihre Lippen zu schieben und ihre Brüste zu kneten. Und wer weiß, was er an seinem Ehrentag noch als Geschenk von ihr einzufordern gedachte! Dabei mochte sie eigentlich, wie er roch. Ihr gefielen auch die helle, jungenhafte Stimme und seine Hände, die kräftig und zuverlässig waren, wie die seiner Vorfahren, die noch als Bauern ihr Land bestellt hatten. Aber sobald er sie berührte, versteifte sich ihr Körper. Pilar hoffte immer wieder, daran würde sich etwas ändern, wenn sie erst einmal unter einem gemeinsamen Dach lebten. Sie hatte sogar schon darum gebetet. Manchmal jedoch überwog die Furcht, alles würde auch nach der Trauung so bleiben wie bisher. Sie hasste sich für ihre eigene Feigheit. Verdiente Martin nicht, dass sie ihm sagte, was sie wirklich empfand?
»Ich bin müde«, sagte sie und stand so unvermittelt auf, dass sie ihren Stuhl umstieß.