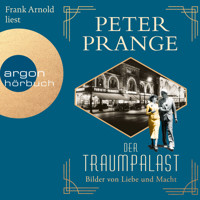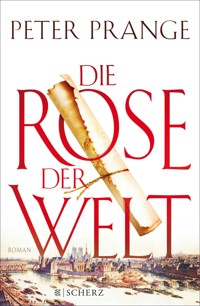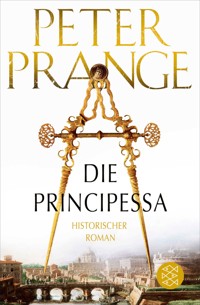9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Künstlerroman und Familiensaga – die einzigartige Karriere der Wiener Musikerfamilie vor dem Hintergrund einer turbulenten Zeit in Wien im 19. Jahrhundert. Wien 1820, ein strahlend schöner Sommertag im Prater. Die ganze Stadt amüsiert sich, nur ein junger Mann sitzt abseits des Trubels einsam und allein am Donauufer. Sein Magen knurrt und für die Nacht hat er noch kein Dach über dem Kopf. Doch er hat einen Traum. Und eine Geige, der er Melodien entlockt, wie die Welt sie noch nicht gehört hat. Noch kann niemand ahnen, dass er einmal als der größte Musiker der Welt gefeiert werden wird, von Frauen geliebt, von Königen und Kaisern verehrt. Sein Name ist Johann Baptist Strauß - heute ein berühmter Komponist und Sproß einer einzigartigen Künstlerfamilie. »Die Strauß-Dynastie« verbindet Familiensaga und Künstlerroman, gewürzt mit einer kräftigen Prise Fabulierlust, Witz und Fantasie und einem hohem Maß an historischer Authentizität. Der Roman erzählt die Legende der berühmten Wiener Musikerfamilie Strauß: die armseligen Anfänge als »Bratlgeiger« von Johann Strauß‘ Vater, die Fehden zwischen Vater und Sohn, die unerbittliche Rivalität der Brüder, die Abgründe von Hass und Neid, von Missgunst und Intrige, die immer wieder in dieser großen Musiker-Dynastie aufbrachen. »Melange im Walzertakt.« (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Prange
Die Strauß-Dynastie
Roman
Das Leben ein Tanz oder Der Tanz ein Leben! Joh. Strauß Vater, op. 49 Der folgende Roman entstand frei nach Motiven aus dem Leben von Johann Strauß Vater, Johann Strauß Sohn sowie Joseph und Eduard Strauß. Dabei wurde hier und da die Chronologie der Ereignisse sowie manche Äußerlichkeit im Detail abgewandelt. Dies geschah, um einen in sich geschlossenen Erzählkreis zu schaffen, der den Geist und die Kräfte erfasst, die den Ereignissen innewohnen und die die weltumspannende Musik der Strauß Dynastie hervorbrachten. Denn die innere Wahrheit – ob einer Person oder Epoche – ist keine Abbildung bloßer Fakten, sondern die Verdichtung von Tatsachen und Legenden, von Geschehnissen und Meinungen, von Hoffnungen, Ängsten und Leidenschaften ...
Prolog
Man schrieb den 22. Oktober des Jahres 1907.
Karl Raus, Fabrikant von Keramikwaren im Wiener Stadtbezirk Mariahilf, blickte auf das Zifferblatt seiner Taschenuhr und wartete, bis der große Zeiger auf zwölf, der kleine auf eins vorgerückt war. Dann klappte er den Sprungdeckel des Gehäuses zu, ließ die Uhr zurück in seine Westentasche gleiten und ordnete die Schreibutensilien auf seinem Pult, auf dem wie immer ein Glas Wasser stand, bevor er mit einem Räuspern zu einem der sorgfältig gespitzten Bleistifte griff – ein Ritual, mit dem er nun schon seit über fünfzig Jahren die Mittagspause beendete und die Arbeit wieder aufnahm. Doch kaum hatte er mit der Zungenspitze einen Finger benetzt, um den vor ihm liegenden Akt aufzuschlagen, wurde er durch ein lautes Rumpeln und Poltern in seiner Konzentration gestört. Er stand von seinem Schemel auf und trat an das Kippfenster seines Büros, um nachzusehen, was da draußen vor sich ging.
Im Fabrikhof hielt soeben ein großer, mit zwei Pinzgauer Pferden bespannter Möbelwagen an. Daneben wartete ein älterer, auffallend elegant gekleideter Herr, Zylinderhut und Stock in der Hand, und schaute sich suchend um. Karl Raus stutzte. Den kannte er doch! Das war ja... Dass der überhaupt noch lebte... Eilig verließ er das Büro und ging hinaus auf den Hof. Der elegante Herr blickte ihn mit erhobener Braue an und kam auf ihn zu.
»Herr Strauß, nicht wahr?«, fragte Karl Raus, nicht ohne Stolz auf sein gutes Gedächtnis. »Johann Strauß, der Walzerkönig!« Das Gesicht des Besuchers verfinsterte sich.
»Sie verwechseln mich«, sagte er knapp, wobei er sich über die Spitzen seines starren, nach früherer Mode seitwärts ausgedrehten Schnurrbartes strich. »Mein Bruder ist schon seit Jahren tot. Eduard Strauß ist mein Name. Hofballmusikdirektor a.D.«
»Aber natürlich, Herr Strauß«, beeilte Karl Raus sich zu sagen, während er fieberhaft überlegte, wen er nun vor sich hatte. Eduard Strauß...? Wer war denn das? Aber ja! Der ›schöne Edi‹... Die Verwechslung war ihm furchtbar peinlich. »Herr Strauß entschuldigen schon, aber eine so außerordentlich begabte Familie wie die Ihre... Womit kann ich dem Herrn Hofballmusikdirektor dienen?«
»Mit Ihren Öfen. Es handelt sich darum, eine größere Menge Papier zu verbrennen«, erwiderte Strauß und zeigte mit dem Elfenbeingriff seines Stocks auf den Möbelwagen hinter sich, der über und über mit verschnürten Paketen beladen war. »Alles Makulatur. Welchen Preis verlangen Sie?«
Karl Raus warf einen Blick auf den Wagen und überschlug das Gewicht der Ladung. Es musste mehrere Tonnen betragen.
»Sagen wir, eine Krone der Zentner?«
Ohne zu feilschen, nickte Strauß mit dem Kopf, und zwei Fabrikarbeiter fingen an, den Möbelwagen abzuladen. Karl Raus, der nicht zum ersten Mal in seinem Betrieb ein solches Geschäft abwickelte, gab Anweisung, für den Kunden einen Lehnstuhl in den Hof zu stellen, denn es war vorauszusehen, dass die Verbrennung einige Stunden in Anspruch nehmen würde. Da er aber nicht nur ein tüchtiger Geschäftsmann, sondern auch ein ordnungsliebender Mensch war, ging er zu dem Wagen, um zu schauen, was für Papiere da in seiner Fabrik verbrannt werden sollten. Wahllos griff er ein Paket heraus und öffnete die Schnürung. Als er den Titel auf dem Notenblatt las, das er auf diese Weise in die Hand bekam, runzelte er die Stirn: An der schönen blauen Donau, daneben ein handgeschriebenes Datum, 1867. Irritiert öffnete er ein zweites Paket. Die Fledermaus. Komische Operette in 3 Akten ... Mit beiden Armen begann er zu wühlen. Radetzky-Marsch, zu Ehren des großen Feldherrn ... Kaiser-Walzer, Der Zigeunerbaron, Seid umschlungen, Millionen ... Dazwischen Briefe, alte Rechnungen und Verträge, schließlich eine vergilbte Urkunde mit dem Wappen des Kaisers und der Unterschrift des Reichskanzlers, des Fürsten Clemens von Metternich!
Karl Raus war bestürzt. Das sollte Makulatur sein? Fragend blickte er seinen Kunden an. Als er dessen Miene sah, begriff er mit einem Schlag, was hier vor sich ging.
»Aber Herr Strauß!«, rief er. »Um Gottes willen! Das können Sie nicht tun!«
Strauß wich dem Blick des Fabrikanten aus. Sein Gesicht war verhärtet, seine Bartspitzen bebten. Das Kinn erhoben, den Kopf leicht abgewandt, eine Hand in der Manteltasche, stand er eine lange Weile da und starrte in die Ferne. Dann warf er den Kopf mit einem Ruck herum.
»Ich muss es tun«, sagte er dumpf. »Ich muss. – Ich will mit dieser Kategorie von Menschen nichts mehr zu tun haben!«
Ohne weitere Erklärung nahm er auf dem Lehnstuhl Platz, der inzwischen, nur wenige Meter von dem mannshohen Ofenrost entfernt, aufgestellt worden war, und sah den zwei Fabrikarbeitern zu, die gleichgültig damit begannen, ein Paket nach dem andern aufzuschnüren und den Inhalt ins Feuer zu streuen. Karl Raus machte den Mund auf, um zu protestieren. Das war doch heller Wahnsinn! Aber ein Blick auf Strauß sagte ihm, dass jeder Einwand vergeblich war. Ohnmächtig zuckte er die Schultern und ging zurück in sein Büro. Das war nicht seine Angelegenheit. Er war nur ein kleiner Fabrikant ...
Karl Raus nahm einen Schluck Wasser und versuchte, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Aber an Arbeit war an diesem Nachmittag nicht mehr zu denken. Immer wieder musste er durch das Kippfenster hinaus auf den Hof schauen. Das also war aus dem ›schönen Edi‹ geworden ... Trotz seiner Eleganz, trotz seiner äußerlichen Haltung schien er ein gebrochener Mann zu sein. Die peinlich gepflegte Erscheinung, der Zylinder, die weißen Handschuhe, der seidene Plastron, alles das stand in einem fast grotesken Gegensatz zu dem ruhelosen Blick unter den schweren, herabhängenden Lidern, zu dem nervösen Tick, sich immer wieder über den Bart zu streichen, während er von seinem Stuhl aus die Verbrennung verfolgte. Ja, Eduard Strauß war ein gebrochener Mann, der an einer Last trug, die zu schwer für ihn war, von der er sich hier mit aller Macht zu befreien versuchte. »Ich muss«, sagte er immer wieder, aufgestützt auf seinen Stock, den Blick starr in die Flammen gerichtet. »Ich muss ...«
Manchmal erwachte Strauß aus seiner unheimlichen Apathie.
Sein Kinn zitterte, Tränen rannen über sein Gesicht. Er stand auf, blickte weg, als könne er es selbst nicht mehr ertragen, machte ein paar Schritte hin und her, wie ein Hund an seiner Kette, oder aber er trat ans Feuer, stieß die Arbeiter beiseite, um mit eigener Hand ein Notenpaket in die Flammen zu werfen, unter wirren, erregten Ausrufen, bei denen Karl Raus entsetzt das Kreuzzeichen schlug.
»Da, du Leichenfledderer! Brudermörder! Ehebrecher! Zur Hölle mit dir! Zur Hölle!«
Wie den Auswurf einer qualvollen, tödlichen Krankheit schleuderte er die Flüche und Verwünschungen aus sich heraus, das Gesicht verzerrt von Hass und Angst und Schmerz, um plötzlich, von einer Sekunde zur anderen, in sich zusammenzufallen, mit zuckenden Bewegungen auf seinen Stuhl zu sinken, wo er sich, am ganzen Leib zitternd, bemühte, seine Haltung wiederzuerlangen, indem er sich fortwährend über die Enden seines Bartes strich, den Zylinder auf den Knien, den Stock unterm Arm. Und während die Flammen in teilnahmsloser Gier verzehrten, was die Arbeiter in den Ofenraum warfen, schaute Karl Raus, halb verborgen hinter dem Kippfenster seines Büros, dieser unheimlichen Hinrichtung zu und erinnerte sich ... Mein Gott! Was für eine verrückte Familie ... Mein Gott! Was für eine verrückte Zeit ...
Eduard Strauß begnadigte nicht ein einziges Blatt. Er verließ die Fabrik erst, nachdem das letzte Paket geöffnet, das letzte Schriftstück vernichtet war. Die Verbrennung dauerte von zwei Uhr nachmittags bis sieben Uhr am Abend. Während dieser fünf Stunden, am 22. Oktober des Jahres 1907, gingen 2.547 Stimmpakete und Partituren in den Flammen auf, Zeugnisse von nahezu einem Jahrhundert – die Zeugnisse der Musikerdynastie Strauß ...
Teil I Der Walzerkrieg
1
Es war ein strahlend schöner Sommertag im Prater, im Jahre 1820. Die Vögel zwitscherten in den Laubkronen der hohen, mächtigen Bäume, in deren Schatten, zwischen Hanswursttheatern und Marionettenbuden, die Wiener ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgingen. Man bestaunte die Taschenspieler, Gaukler und Affendompteure, die vor den Gärten der Wirtschaften und Kaffeehäuser ihre Kunststücke zeigten, genauso wie die vornehmen Kavaliere in weißem Zylinder und Steghosen mit ihren Damen oder die prächtigen Equipagen der Reichen, die vierspännig die Hauptallee entlangrollten. Und über allem wachte, hoch zu Ross und mit derselben gütigen Strenge, mit der Kaiser Franz in der Hofburg regierte, der Prater-General, stets bereit, einem jeden, der mutwillig über die Stränge schlug, fünfundzwanzig abgezählte Schläge mit dem Stock zu verabreichen.
Abseits des Vergnügungstrubels aber, am Ufer eines Donauarms, saß ein junger Mann im Gras und starrte in das grüne Wasser, das in trägen Fluten an ihm vorüberzog. Trotz des herrlichen Tags war ihm alles andere als fröhlich zumute. Sein Magen knurrte, als säße eine Ratte darin, und für die Nacht hatte er noch kein Dach über dem Kopf. Er war so allein auf der Welt wie ein Vogel, der eben aus dem Nest gefallen ist – allein mit seiner Geige, die das einzige war, was er außer den geflickten Kleidern am Leib besaß. Er warf einen Zweig ins Wasser, und während er zusah, wie die Strömung ihn davontrug, hörte er wieder die scharfe, höhnische Stimme seiner Stiefmutter: »Willst wohl auch ein Bratlgeiger werden und fiedeln, wenn anständige Leute was essen? Brav, sehr brav! Ein Bratlgeiger im Biergarten, das tät dir so gefallen, gelt?« Der Name aber dieses jungen Mannes, der hier am Ufer der Donau, mit einem Grashalm zwischen den Lippen und einem mulmigen Gefühl im Bauch, auf das Wasser sah und sich fragte, wie er sich mit seiner Geige durch das Leben schlagen sollte, dieses unbegreifliche, feindliche und doch so wunderbare Leben, in das er, aus welchem Grund auch immer, in einer Nacht des Jahres 1804 geboren worden war – der Name dieses jungen Mannes war Johann Baptist Strauß.
Der Geruch von gebratenen Würsten und Fleisch rief ihn in die Wirklichkeit zurück. Obwohl er nicht einen Kreuzer in der Tasche hatte, nahm er seine Geige und stand auf, um in die Richtung zu gehen, aus der die verführerischen Düfte kamen.
Beim Anblick der zahllosen Menschen, die sich, mit karierten Servietten vor der Brust und Messer und Gabel in den Händen, über ihr Essen hermachten, dass ihnen das Fett von den Mündern troff, wurde das Knurren in Johanns Magen doppelt so laut. Doch konnte es niemand hören, denn von irgendwoher drangen die Fetzen eines aus tausend Kehlen gebrüllten Liedes, dessen Refrain in einem begeisterten Gejohle endete. Da war ja die Hölle los! Johann quetschte sich durch die Menschenmenge, und bald hatte er das infernalische Spektakel entdeckt. Vor einem Musikpavillon standen dicht an dicht lange Tischreihen, an denen Frauen und Männer sich mit lachenden Gesichtern schunkelnd in den Armen lagen. Der Kapellmeister, ein kleiner, magerer Mann mit einem unglaublich großen Schädel, feuerte wie ein Derwisch sein Orchester an, mit drohenden, mit beschwörenden, mit verzweifelten Gebärden, während das Publikum wie mit einer Stimme brüllte:
»Hütteldorfer, jetzt und hier! Pamer spiel, trink noch ein Bier!«
Das also war der ›tolle Pamer‹, der berühmteste Dirigent von ganz Wien! Johann sah ihn zum ersten Mal. Sobald der Refrain verklungen war, schwoll ein Trommelwirbel an, und Pamer, der sich nur noch torkelnd auf den Beinen hielt, leerte unter donnerndem Beifall einen Krug Bier und stellte ihn auf einen Tisch, auf dem schon ein gutes Dutzend leerer Krüge stand. Aufs Saufen verstand er sich offensichtlich I a, aber seine Musik hörte sich an wie ein schwitzender Stubentanz... Kaum hatte er sich den Schaum vom Mund gewischt, kamen heftige Proteste:
»Das waren erst fünfzehn, Pamer!«
»Komm, noch eins! Da capo!«
»Ja, noch eins! Da capo!«
Pamer ließ sich nicht lange um eine Zugabe bitten. Energisch setzte er den nächsten Krug an die Lippen, doch plötzlich, mit einem Mal, er hatte gerade den ersten Schluck hinuntergestürzt, brach er auf dem Podium zusammen. Noch während ein enttäuschtes Ooooh! durch das Publikum ging, geschah etwas Merkwürdiges. Die brodelnde, stampfende Musik brach ab, und im nächsten Augenblick ertönte eine so helle und klare Melodie, dass Johann sich verwundert die Augen rieb. Der Geiger, ein blonder junger Mann in einem abgerissenen Bratenrock, dirigierte nun die Kapelle, das Instrument unterm Kinn, und ein so herrlicher Ländler erfüllte die Luft, dass es Johann vorkam, als habe nach dem schwitzenden Stubentanz von vorhin plötzlich jemand das Fenster auf eine blühende Frühlingswiese aufgestoßen und herein wehe der Duft von frischem Grün.
Vergessen war sein knurrender Magen! Wie gebannt blickte Johann zur Bühne hinauf und lauschte der Musik. Wer war dieser Geiger? Wo hatte er gelernt, so zu spielen? Johann musste ihn unbedingt kennenlernen ...
Joseph Lanner war die Gemütlichkeit in Person. Nur wenn es um Musik ging, da wurde er rabiat! Deshalb war er fast froh, dass Pamer betrunken zusammengebrochen war. Er wusste, eines Tages würde er ihn samt seiner Bier-Hymne von der Bühne prügeln. Und dieser Tag war nah.
Drei Jahre spielte er schon in der Kapelle dieses versoffenen Genies. Drei Jahre – und davon jeder Tag zu viel! Josephs Traum war ein kleines, gemütliches Quartett, zusammen mit den Drahanek-Brüdern, einem Geiger und einem Gitarristen aus Prag, die unter Pamers Notenschinderei ebenso litten wie er ... Wie immer, wenn er die Kapelle dirigierte, war Joseph ganz in diesen Traum versunken, als plötzlich hinter ihm, irgendwo in den Kulissen, eine zweite Geige das Thema seines Ländlers aufnahm und mit einem Triller variierte. Was zum Kuckuck war denn jetzt los? Irritiert drehte er sich um, und ohne sein Spiel zu unterbrechen, bewegte er sich in die Richtung, aus der die Töne kamen.
Joseph traute seinen Augen nicht. Was war denn das für einer? Ein Italiener? In den Kulissen stand ein schmächtiges Bürschchen mit kohlschwarzem Haar und spielte, als ginge es um sein Leben.
Er zappelte am ganzen Leib, warf den Oberkörper zurück, um gleich darauf wie ein Zigeuner in den Brunnen hinunterzugeigen, wobei seine Augen funkelten und sein Gesicht die tollsten Grimassen schnitt. Den hatten sie wohl mit Paprika großgezogen!
»Was zum Teufel machst du da?«, zischte Joseph.
»Geige spielen«, erwiderte das Bürschchen, gleichfalls ohne sein Spiel zu unterbrechen.
»Hör auf! Du spielst ja wie einer, der’s Reißen hat.«
»Geh weiter. Sag doch, dass ich gut bin!«
Verächtlich warf Joseph den Kopf in den Nacken. »Wie heißt denn?«
»Strauß Johann«, antwortete das Bürschchen und strich dabei so kräftig den Bogen, dass seine Geige für einen Augenblick das ganze Orchester übertönte. »Und du?«
»Joseph Lanner. Und jetzt schleichst dich!«
Das Bürschchen ließ sein Instrument nun zärtlich säuseln. »Weißt du vielleicht was für mich?«
»Nein«, knurrte Joseph und wandte sich ab. Doch während er sich zum Bühnenrand zurückbewegte, setzte das Bürschchen zu einem so rasanten Lauf von Doppelgriffen an, dass Joseph Hören und Sehen verging. Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte ihn mit großen Augen an. »Ist das alles?«, fragte er und konnte nur hoffen, dass man ihm nicht anmerkte, wie beeindruckt er war. Statt einer Antwort steigerte das Bürschchen noch einmal das Tempo der Grifffolgen, um im nächsten Moment das Thema mehrstimmig zu variieren. »Was kann der Herr sonst noch? Kopfstehen und Mozart zweistimmig furzen?« Für eine Sekunde sprachlos, sah Joseph auf diese Finger, die schneller als ein ganzer Sack Flöhe über das Griffbrett wirbelten, und vergaß darüber fast sein eigenes Spiel. So gelangweilt wie nur irgend möglich blickte er ihn an und sagte: »So a Schas ...«
Der hatte ihm gerade noch gefehlt!
2
Mitzi hatte einen anstrengenden Tag hinter sich – wie jeden Donnerstag, wenn am Graben Wochenmarkt war. Und wie jeden Donnerstag hatte der Tag viel harte Arbeit gebracht und wenig Vergnügen. Schon in aller Frühe, zu einer Uhrzeit, zu der sie sich sonst noch einmal im Schlaf umdrehte, hatten ihr hintereinander vier Gemüsebauern aus Klosterneuburg ihre Aufwartung gemacht; am Nachmittag hatte sie die Wünsche eines Stallknechts, eines Agrarökonomen und zwischendurch zweier Rekruten befriedigt, und am Abend, zusätzlich zu dem üblichen, überaus regen Hauptgeschäft, einen Gerber mit dunkelbraunen Händen und schier unerschöpflicher Leidenschaft empfangen sowie zwei Viehhändler, die den Abschluss eines für sie beide vorteilhaften Geschäftes unbedingt gleichzeitig mit ihr feiern wollten. Deshalb war sie nun, da sie ein allerletztes Mal an diesem Tag ihr Kleid aufknöpfte, rechtschaffen müde.
Sie hatte sich bis auf ihr Leibchen ausgezogen, und Mimi, ihre beste Freundin, mit der sie am Tag die Arbeit und in der Nacht das Zimmer teilte, lag bereits im Bett, als plötzlich von draußen eine wunderschöne Musik durch das offene Fenster drang. Nanu, was war denn das? Um diese Zeit? Irgendwo spielte eine Geige – nein, jetzt waren es zwei, die eine weich und schmeichelnd, die andere fast so hitzig und leidenschaftlich wie ihr Gerber am Abend. Höher und höher stiegen die Töne hinauf, als wollten sie in den Himmel fahren. Ein Prickeln lief Mitzi über den Rücken. Im selben Augenblick war ihre Müdigkeit verflogen, und mit bloßen Füßen huschte sie ans Fenster.
Woher kam die Musik? Draußen war nichts zu sehen. Dunkel und verschwiegen lag die Straße da, wie jede Nacht. Ein Liebespärchen, eng umschlungen, ging im Mondschein spazieren, und im Schatten der Hauseingänge standen noch ein paar Mädchen und hüstelten den Männern zu, die mit hochgeschlagenem Kragen und in die Stirn gezogenem Hut so taten, als hätten sie es furchtbar eilig ... Aber da! Da kamen sie! Aus der Jungferngasse, die Geigen unterm Kinn.
»So, probier das!«, sagte Joseph und spielte einen höllisch komplizierten Lauf.
Ohne eine Sekunde zu zögern, machte Johann es ihm nach, sodass die Leute stehenblieben und sich nach ihnen umdrehten. Ein paar klatschten sogar Applaus. In den Fenstern tauchten Köpfe auf, Mädchen mit aufgelöstem Haar und Männer in Hemdbrust. Mit einem Schluchzer seiner Geige grüßte Joseph zu einer kleinen Blondine hinauf, die nur mit einem Leibchen bekleidet war, und bekam von ihr eine Kusshand zurück.
»He, ihr zwei«, rief sie. »Herein mit euch, und herzeigen eure Instrumenterln!« Die Straßenpassanten lachten, und ein Offizier schnalzte mit der Zunge. »Na, worauf wartet ihr? Wenn ihr wollt, dürft’s aufgeigen bei mir ...«
Ohne ihr Spiel zu unterbrechen, blickten Joseph und Johann sich an. »Warum nicht?«, grinste Joseph. Johann grinste zurück: »Warum nicht?«
Aber kaum waren sie zur Tür herein, baute sich eine unüberwindliche Festung vor ihnen auf. Da stand die Madame! Ein Massiv aus Fleisch und Fett, mindestens vier Zentner schwer, eingehüllt in einen rosa Morgenmantel.
»Und schon wieder umdrehen«, rief sie ihnen entgegen. »Wir sind ein anständiges Etablissement! Ihr werdet’s uns nicht in Verruf bringen. Raus mit euch!«
Als hätten sie sich abgesprochen, tauchten Johann und Joseph gleichzeitig rechts und links an ihrer Seite durch, sodass die Madame nicht wusste, nach wem sie zuerst greifen sollte. Als sie sich endlich umgedreht hatte, bekam sie nur den verdutzten Türhüter zu fassen, der auf seinem Posten eingeschlafen war und sich noch die Augen rieb.
»Wir sind eingeladen worden, Frau Mutter«, behauptete Johann aus sicherer Entfernung.
»Jetzt hörst aber auf«, schnaubte die Madame. »Ich bin keine Frau Mutter – ich bin eine anständige Person! Raus mit euch!«
Mit einer Geschicklichkeit, die weder Joseph noch Johann ihr zugetraut hätten, griff sie nach einem Teppichklopfer an der Wand und holte damit nach ihnen aus. In Windeseile waren sie die Treppe hinauf, die zu den Zimmern der Mädchen führte, im Nacken das Fauchen und Schnaufen der Madame, die, so schnell es ihre Pfunde erlaubten, hinter ihnen her dampfte.
Mitzi und Mimi erwarteten schon die zwei, die jetzt einen winkligen Gang entlangstolperten, vorbei an zahllosen Türen, aus denen, aufgeschreckt von dem Gepolter, halbnackte Mädchen und ihre Kavaliere hervorschauten und sie mit großem Hallo empfingen.
»Na, was ist? Ihr zwei und ich?«, fragte Mitzi, als sie am Ende des Ganges angekommen waren. »Das wär ein schönes Trio...«
»Oder ist gar ein Quartett angesagt?«, wollte Mimi wissen und warf Johann einen Blick zu, von dem ihm heiß und kalt wurde. »Ich bin gleich dabei!«
Johann kehrte seine Taschen um. »Dazu fehlt uns die Marie.« »Ah geh«, sagte Mitzi, »das Geld...«
Doch konnte sie nicht zu Ende sprechen, denn ächzend und stöhnend nahte die Madame. »Raus mit die Schmarotzer«, rief sie schon von weitem, den Teppichklopfer wie ein fürchterliches Kriegsbeil schwingend, und spähte nach ihren Opfern. »Raus mit ihnen!«
»Schnell«, zischte Mitzi, bevor die Madame sie entdeckt hatte, und hielt die Tür zu ihrem Zimmer auf.
In der nächsten Sekunde waren Joseph und Johann im Innern verschwunden, die Mädchen gleich hinterher, während auf dem Gang die stampfenden Schritte immer näher kamen, wie ein drohendes Gewitter. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, war auch die Madame ans Ende des Flurs gelangt.
»Wo sind’s? Wo sind die zwei?«, keuchte sie, und ihre kleinen, von Fettpolstern und Tränensäcken eingebetteten Augen funkelten böse.
»Jetzt lassen S’ doch«, meinte ein Kunde, der sich eben die Hosenträger über sein Unterhemd streifte. »Die geben den Madeln ja nur ein bissl Musikunterricht.«
Für einen Moment verstummte das Gejohle im Treppenhaus, und alle Blicke waren voller Spannung auf die Madame gerichtet. Aufgelöst, ganz außer Atem stand sie da, mit wogendem Busen und schwitzendem Gesicht, misstrauisch in die Runde lauernd. Würde sie sich geschlagen geben? Nein, der Ausdruck eines grimmigen Wissens trat in ihr Gesicht... Sie presste die Lippen zusammen, und so sicher wie Blücher vor der Schlacht marschierte sie auf Mitzis Zimmertür zu. Vierzig Jahre im Gewerbe – davon über dreißig im aktiven Dienst – hatten den Sieg davongetragen!
Als sie aber die Tür aufriss, verschlug es ihr die Sprache. Keuscher ging es auch im Stephansdom nicht zu! Mitzi und Mimi lungerten auf dem Bett herum, artig wie zwei Nonnen. Von den Schmarotzern keine Spur ...
»Wo sind’s?«
»Fort sind’s«, antwortete Mimi gleichgültig. »Los sind wir’s worden.«
Die Madame traute ihr nicht. Sie kannte ihre Pappenheimer! Bevor Mimi die Wahrheit sagte, wenn es um Männer ging, würde der Bischof auf Fronleichnam ihr Haus segnen... Sie schlurfte ans Bett, immer noch außer Atem, und mit lautem Stöhnen bückte sie sich. Aber auch hier nicht der Zipfel von einer Hose, nur eine dicke Staubschicht und der Nachttopf.
»Ich mag keine Musikanten im Haus«, schnaufte sie, als sie sich wieder aufrichtete, halb und halb beruhigt. »Musikanten sind das Allerletzte! Ich lass mir doch meinen guten Namen nicht von so dahergelaufene ...«
»Die sind doch eh schon fort ...«
Die Madame hatte bereits die Türklinke in der Hand, als sie plötzlich zu dem schmalen, aus rohen Brettern zusammengezimmerten Kasten herumfuhr, der neben dem Bett an der Wand stand. Im nächsten Augenblick flog der Deckel auf, und mit einem Satz sprangen die zwei aus ihrem Versteck hervor, um Hals über Kopf, vorbei an der verdutzten Madame, zur Tür zu stolpern. Schon im Flur, drehte Johann sich um und rief:
»Keine Sorge, Madeln. Wir kommen wieder!«
3
»Klein, aber mein!«, sagte Joseph und hob die Kerze in die Höhe.
Johann sah kaum die Hand vor Augen. Dafür roch es umso vertrauter nach feuchten Wänden und verfaultem Kohl. Erst als die Flamme sich zitternd aufrichtete, konnte er etwas erkennen. Das war also Josephs Wohnung! Direkt unterm Dach und so groß, dass sie mit einem Strohsack, einem Tisch und zwei Stühlen hoffnungslos überfüllt war.
»Besser als unter der Brücke ...«, sagte er und trat ein.
»Genau. Und außerdem hat’s jeden Komfort!« Joseph hielt die Kerze über ein Waschbecken, das auf dem Bretterboden stand. »Schau, Fließwasser, aber nur, wenn’s regnet.«
»Wo kann ich schlafen?«, fragte Johann.
»Nirgends. Schlafen tu ich. Du schaust zu. Bist hungrig?« »Ziemlich ...«
In Wirklichkeit knurrte Johann der Magen bis unter die Achseln. Schon im Prater hätte er am liebsten den Leuten das Essen vom Teller gestohlen – einen solchen Hunger hatte er, den er nur zwischendurch, beim Geigenspielen und bei den Mädchen, für ein paar Augenblicke vergessen hatte. Jetzt aber meldete sich sein Magen mit aller Macht zurück.
»Willst was?«
»Oh, nein! Essen tust du. Ich schau zu.«
Grinsend zog Joseph die Tischschublade auf. Johann lief das Wasser im Munde zusammen: ein Stück Wurst und ein Kanten Brot! Mit einer Mischung aus Ungeduld und Bewunderung sah er, wie Joseph beides in zwei Hälften schnitt.
»Du bist gar kein schlechter Geiger«, sagte Joseph, als sie endlich aßen. »Ein bissl aufgedreht vielleicht, aber nicht schlecht.«
»Das klingt ja wie ein Kompliment«, erwiderte Johann, gierig kauend. »Du bist auch nicht schlecht.«
»Ich? Ich bin der beste in Wien!«
»Du warst es – bis ich gekommen bin!«
Joseph musterte ihn von oben bis unten. »Wo kommst eigentlich her?«
»Eh von da! Aus der Leopoldstadt. Meinem Vater hat dort ein Wirtshaus gehört ...« Johann hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Er wusste, welche Frage nun kam.
»Und was ist er jetzt, dein Vater?«
»Tot«, sagte Johann leise. »Er ist ins Wasser gegangen.«
Er schlug die Augen nieder, und eine Weile aßen sie schweigend weiter. Sein Vater ... Johann sah ihn vor sich, wie er immer am Tisch gesessen hatte, mit seiner grünen Weste und der Lederkappe auf dem kahlen Kopf, die mächtigen Unterarme aufgestützt, von allen Gästen bewundert und gefürchtet. Wenn er sprach, verstummte das ganze Lokal. Und dann, wie die Nachbarn ihn gebracht hatten, mit den Füßen zuerst, die Kleider nass und das Gesicht mit der Kappe verdeckt. Nichts als Schulden hatte er hinterlassen ... Draußen rasselte eine Kutsche vorbei. Als Johann aufblickte, sah er in Josephs misstrauisches Gesicht.
»Du rennst doch von nichts davon, oder?«
»Irgendwie schon ...«
»Wie, irgendwie?«
»Ich war Lehrbub«, sagte Johann. »Bei einem Buchbinder. Eines Tages hab ich ihm gesagt, wo er sich seine Bücher hinstecken soll.«
»Dasselbe bei mir mit einem Handschuhmacher«, lachte Joseph. »Mein Vater wollte, dass ich in Glacé mache. Warum, weiß nur der liebe Gott. Wie’s zum Sterben war, hab ich ihm gesagt, dass ich Musiker werden will.«
»Das hat ihm den Rest gegeben?«
»Aber nein! Kerzengerade auf, und ich hab eine sitzen gehabt.« Dabei rieb er sich die Backe, als würde sie immer noch brennen.
Johann sagte: »Die Kapelle, bei der du spielst ... heißen tut die nicht viel.«
»Pamer? Der ist ein alter Gauner. Aber er ist noch der beste in Wien.«
»Der kann’s Trinken nicht lassen, was? Vibrato wie eine Waschrumpel.«
»Wenn er einen Rausch hat, jammert er, er hätt einen lebendigen Kapuzinerpater verschluckt, und fängt fürchterlich an zu weinen. Außerdem schnackselt er mit allem, was einen Kittel anhat. Der alte Gauner hat Glück bei den Madeln.«
»Und du?« fragte Johann. »Mit wem schnackselst du?«
Joseph zog ein abschätziges Gesicht. »Meine Ansprüche sind zu hoch ...«
Johann schaute sich um. »Ja, das seh ich.«
»Eingebildet bist du nicht, was?«, sagte Joseph.
Johann streckte seine Hände vor sich aus und blickte sie nachdenklich an. »Es steckt ein Zauber in diesen Fingern, mein Freund, ein Zauber ...«
Statt einer Antwort schob Joseph ein Notenblatt über den Tisch. »Na, dann spiel das mal!«
Johann warf einen Blick auf das Blatt. Schönbrunner stand in verschnörkelten Buchstaben darauf, und rechts daneben Mit Gott! Darunter war ein Gewirr von schwarzen Punkten und Pünktchen, die dicht an dicht zwischen waagerechten Linien auf und ab hüpften.
»Wer hat’s denn geschrieben?«, fragte er so gleichgültig wie möglich.
»Mozarts einziger legitimer Nachfolger ...«
»Und wer, bitt schön, soll das sein?«
»Ich!«, behauptete Joseph mit todernster Miene.
Johann schob das Blatt zurück. »Schaut nicht eben schwer aus.« »Dann probier’s! Geh schon, probier’s!«
Johann hielt sich die Hand vor den Mund und gähnte. »Es ist schon spät«, sagte er. »Wir wecken nur das Haus auf.«
»Scheiß auf das Haus! Du willst wohnen bei mir, dann spiel meine Musik!«
Ihm blieb nichts anderes übrig. Er nahm seine Geige vom Tisch und klemmte sie sich unters Kinn. Als er aber den Bogen hob, begannen die Noten auf dem Blatt wie wild vor seinen Augen zu tanzen, als wäre Pamer persönlich in sie gefahren, und er musste den Bogen wieder sinken lassen.
»Doch zu schwierig, was?«
Johann wäre am liebsten im Erdboden versunken. Er machte den Mund auf, um etwas zu sagen, schüttelte den Kopf, druckste noch einmal und wurde rot bis unter die Haarspitzen. Nein, es war unmöglich! Wenn er es sagte, konnte er gleich wieder verschwinden. Aus der Traum – keine Musik, kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen und zu trinken ... Warum musste er diesem verfluchten Kerl begegnen? Er blickte auf seine Finger, in denen angeblich ein Zauber steckte, auf seine Geige, auf die Essenskrümel auf dem Tisch, nur um Joseph nicht anschauen zu müssen. Stammelnd und stotternd stieß er endlich sein Geständnis hervor:
»Ich ... ich kann ... keine Noten ...«
Joseph fiel vor Verblüffung der Kinnladen herunter. »Du kannst keine was?«
»Keine Noten«, wiederholte Johann, so zerknirscht wie ein Sünder im Beichtstuhl.
»Spielt wie ein Gott und kann keine Noten lesen!«
»Nein! Ich spiel wie einer, der’s Reißen hat, und kann keine Noten ...«
Joseph sprang von seinem Stuhl auf. »Ich lern dir’s. In einem Jahr hast es. Bei deinem Hirn ...?«
»In einem Monat«, sagte Johann trotzig, aber immer noch mit gesenktem Blick. Dann schlug er die Augen auf und schaute Joseph an. »Lernst mir’s wirklich?«
Joseph steckte sich den Rest von seiner Wurst zwischen die Zähne, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und griff nach seiner Geige. Dann setzte er den Bogen an. Johann schloss die Augen und lauschte. Noten lesen konnte er nicht, aber sehen, sehen konnte er sie ... Joseph spielte einen Walzer. Oh, was für einen herrlichen, wunderbaren Walzer! Der liebe Gott hatte ihn komponiert! Wie auf Trippelschritten kam das Thema heran und drehte sich einmal im Kreise. Und dann war plötzlich der Prater da: tausend Ringelblumen und Dolden unter einem strahlendblauen Himmel, an dem Schönwetterwolken zogen. Ohne zu überlegen, nahm Johann seine Geige, und als das Thema ein zweites Mal sich näherte, fiel er in die Melodie ein. Im nächsten Augenblick begann es überall im Haus zu klopfen.
»Ruhe da!«
»Frechheit! Fiedeln, wenn anständige Leute schlafen!«
Joseph riss die Tür auf. »Selber Ruhe da draußen!«, rief er ins Treppenhaus. »Und Respekt! Hier spielt ein Genie!«
Dann knallte er die Tür zu und klemmte sich wieder die Geige unters Kinn. Und während draußen das Rufen und Klopfen immer lauter wurde, verschmolzen in der kleinen, nach feuchten Wänden und verfaultem Kohl stinkenden Kammer die Stimmen ihrer beiden Instrumente zu einer jubelnden Hymne an die Musik.
Spät in dieser Nacht aber, als das ganze Haus schlief, schlichen die zwei sich noch einmal fort. Joseph wollte Johann etwas zeigen, wovon ihm die Augen überlaufen würden.
4
Hell wie der Tag erstrahlte der riesige Palast in der Nacht, ein Koloss aus Stein und Glas, dessen Massen sich mit solchem Glanz in den Himmel erhoben, dass selbst der Mond und die Sterne daneben verblassten. Bis zum Schottenfeld, bis hinunter zum Burgtor reichte entlang der Pappelallee die Kolonne der Kaleschen und Coupés, der Landauer und Fiaker, die auch zu dieser Stunde, weit nach Mitternacht, pausenlos vor dem Portal anhielten, wo Hunderte von staunenden Zuschauern, die nicht genug Geld besaßen, um zehn Gulden Eintritt für einen Abend zu bezahlen, mit ihren Ahs und Ohs die Ankömmlinge begrüßten – geheimnisvolle Frauen mit turmhohen Perücken und Masken vor den Gesichtern, Männer in Dreiviertelhosen und Schnallenschuhen –, die lachend und plaudernd im Innern dieses Palastes verschwanden, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der die anderen, die einfachen und alltäglichen Menschen, draußen vor dem Eingang blieben. Denn die hohe Glastür, die zwei livrierte Diener mit einer Verbeugung für die Eintretenden öffneten, war eine ebenso unscheinbare wie unüberwindliche Grenze, ähnlich der Schranke, die in einer Kirche den Altarraum von den Bänken der Gläubigen trennt.
Plötzlich aber – die Türhüter verbeugten sich einmal mehr –, sprangen zwei junge Männer aus der Menschenmenge hervor, der eine in einem abgerissenen Bratenrock, der andere in einer geflickten, um den Leib schlotternden Hose, und ehe jemand begriff, welche Ungeheuerlichkeit hier geschah, waren sie durch den Eingang in den Innenhof gehuscht. Sie liefen die Hintertreppe hinauf, höher und höher, vorbei an eiligen Kellnern, die mit Flaschen und Gläsern, Geschirr und Besteck beladene Tabletts über ihren Köpfen balancierten, bis sie nach über einem Dutzend Absätzen vor eine niedrige, fast unsichtbare Tapetentür gelangten, die Johann erst sah, als sie vor seiner Nase aufging.
»Ist das nicht wunderschön?«, fragte Joseph, andächtig flüsternd.
Johann kniff sich in die Hand, denn er wusste nicht, ob er noch wach war oder schon träumte. Von einem winzigen Balkon aus, der hoch oben, direkt unter der Decke, in den goldenen Stuck eingelassen war, schaute er hinab in eine Welt, die so unwirklich war wie das Paradies. Blumen, Büsche und Bäume wuchsen dort unten, in einem überdachten Saal! Wasserfälle gab es da, die sich über Felsen und Steine ergossen, plätschernde Bäche und verwunschene Grotten, Teiche mit Schwänen, die so lebendig waren wie die auf der Donau! Und gleich daneben, keine zehn Schritte weiter, aßen und tranken Menschen, im Schein von tausend und abertausend Kerzen, an weiß gedeckten Tischen, die sich unter dem Gewicht der Schüsseln und Platten bogen.
»So was hab ich überhaupt noch nie gesehen«, murmelte Johann, der sich nicht sattsehen konnte und dabei das Gefühl hatte, bis zu diesem Augenblick wie ein Maulwurf gelebt zu haben, eingegraben in einem finsteren Stollen, blind in jede Richtung scharrend, nur nicht nach oben, durch die dünne, brüchige Erdschicht hindurch, wo der Tag, die Sonne, das Glück auf ihn warteten.
»Wenn ich traurig bin«, sagte Joseph, »stell ich mir vor, ich spiel da drin. Dann geht’s mir gleich besser.« Plötzlich beugte er sich so weit vor, dass er fast über die Balkonbrüstung fiel, und seine Stimme wurde ganz aufgeregt: »Hast den Metternich gesehen?«
»Wen?«
»Den Metternich!«
»Kenn ich nicht«, sagte Johann. Am anderen Ende des Saals, vor einem Musikpavillon wie im Prater, hatte er eine Gruppe von Frauen und Männern entdeckt, die sich auf seltsame Weise hin und her bewegten, ähnlich wie beim Tanzen, doch so steif, als hätte jeder von ihnen einen Besenstiel verschluckt.
»Kennt er nicht!«, sagte Joseph entrüstet. »Er kennt den Metternich nicht! Den österreichischen Staatskanzler! Den mächtigsten Mann der Welt! Den Fürsten Metternich! – Sag, kennst du dich überhaupt bei irgendwas aus?«
»In der Musik«, sagte Johann, wie aus der Pistole geschossen. »Die du nicht einmal lesen kannst ...«
»Aber spüren. Die da friert mir die Eier ab.«
Joseph schnappte nach Luft. »Einen größeren Ignoranten wie dich gibt’s gar nicht. Weißt nicht, dass die vornehmen Herrschaften nichts anderes tanzen als Menuett?«
Johann hatte den Namen noch nie gehört, aber so, wie sich die Musik anhörte – genauso steif, wie die Männer und Frauen sich zu ihr bewegten – interessierte ihn dieser Tanz nicht mehr als dieser angeblich so wichtige, ihm aber furchtbar gleichgültige Metternich. Ihn interessierte ganz etwas anderes, eine Frage, die ihm beim allerersten Anblick dieser neuen, überirdischen Welt in den Sinn gekommen war und die ihn nicht mehr losließ.
»Warum spielen nicht wir darin ...?«
»Bissl weich auf der Birn, was?« sagte Joseph und tippte sich an die Stirn. »Solche wie wir spielen nicht im Apollo.« Und als ob Johann noch immer nicht begriffen hätte, in was für einem Palast er sich hier befand, zählte Joseph all die Herrlichkeiten auf, die das Apollo zu bieten hatte: fünf Riesensäle, vierundvierzig Gemächer, drei große Glashäuser, dreizehn Küchen und fünfundsechzig Öfen! Siebentausend Gäste konnte das Apollo fassen! »Und die Musik, die macht der Hummel. Der hat noch beim Mozart persönlich gelernt!«
»Ich mein ja nicht heut oder morgen«, sagte Johann. »Irgendwann halt. Warum denn nicht?«
»Und wenn du dann den Metternich triffst, wirst sagen: Entschuldigen schon, aber wer sind Sie? Was machen Sie beruflich?«
»Lach mich nur aus ... Aber ich sag dir was. Wir gründen ein kleines Quartett. Und mit ein bissl Glück kommen wir da auch rein.«
»Deine Aussichten, da zu spielen, sind so groß wie die, dass ich morgen zum Frühstück an Kaviar fress ...«
Doch Johann hörte Joseph gar nicht. »Wirst sehen«, murmelte er, während er den Anblick dieses Paradieses, das zum Greifen nahe und dabei noch weiter fort zu sein schien als selbst das ferne Amerika, mit den Augen in sich aufsog wie ein Schwamm das Wasser. »Ein feines, kleines Quartetterl ...«
5
Die Lage war verzweifelt, vielleicht sogar ernst!
Genau vier Jahre, einen Monat und fünf Tage trat inzwischen das feine, kleine Quartetterl unter dem Namen Das Vierblättrige Kleeblatt auf, doch die Vorstellung, dass solche wie Joseph, Johann und die beiden Drahanek-Brüder jemals im Apollo spielen würden, war absurder und lächerlicher denn je. Eher würde in Österreich der Kaiser abgeschafft oder ein Mensch auf den Mond geschossen ... Statt wie der berühmte Nepomuk Hummel, der angeblich zehn Dutzend goldene Uhren besaß, mit ihrer Musik Schätze und Reichtümer zu verdienen, war es für sie schon ein Glückstreffer, wenn sie beim Bettlerfasching in Lerchenfeld auftreten durften. Mindestens einmal im Monat erschien der Gerichtsvollzieher in der Windmühlgasse, wo Johann und Joseph zusammen hausten. Und hätten die beiden nicht in einem bestimmten Etablissement am Graben Kredit gehabt, wer weiß, ob sie imstande gewesen wären, sich ein Vergnügen zu leisten, das in ihrem Alter so dringend nötig war wie die tägliche Rasur.
Dabei war der chronische Geldmangel in Johanns Augen gar nicht das Schlimmste. Hunger und Entbehrung konnte er ertragen, Demütigungen aber nicht! Und es war demütigend, nach jedem Auftritt mit dem Hut herumgehen zu müssen, um ein paar lumpige Kreuzer einzusammeln! Seltsamerweise aber schien Joseph diese Bettelei nicht im Geringsten zu stören. Vielleicht lag das daran, dass er schon zufrieden war, solange nur ein Glas Bier oder Wein in Reichweite war.
Joseph war überhaupt ein beneidenswert zufriedener Mensch. Ein eigenes Federbett – das war für ihn der Gipfel der Glückseligkeit! Genau das Gegenteil von Johann, der es schon hasste, länger als zwei Minuten auf einem Stuhl stillzusitzen. Manchmal, wenn Joseph, den Hut in der Hand, mit seinen blauen Augen einen Gast ansah, der auf seinem Portemonnaie saß, kamen ihm gehörige Zweifel, ob er sein Glück nicht besser in einem anderen Orchester versuchen sollte, zum Beispiel in dem von Michael Pamer. Der war zwar nicht ganz richtig im Kopf, doch hatte er es inzwischen bis zum Kapellmeister im Sperl gebracht, einem der größten Tanzlokale der Stadt. Joseph war zu gut für diese Welt. Ja, wenn er das Kleeblatt leiten würde ... Aber diesen Gedanken ließ Johann gar nicht erst aufkommen. Joseph war der Chef! Und so welkte das Kleeblatt vor sich hin wie ein Blumenstrauß in einer Vase ohne Wasser, obwohl niemand in Wien seine Geige so herzzerreißend schluchzen lassen konnte wie Joseph und Johann so aufgedreht spielte, als hätte er Pfeffer im Hintern.
Dann aber, nach vier Jahren, einem Monat und sechs Tagen seit Gründung der Kapelle, tauchte endlich ein Silberstreifen am Horizont auf.
Es war an einem Montagnachmittag in Jünglings Kaffeehaus. Auf der kleinen Tanzfläche drehte sich ein Dutzend Paare, und Joseph dirigierte mit der Geige unterm Kinn seine Schönbrunner, als draußen eine Kutsche hielt. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und kamen auf den Eingang des Kaffeehauses zu. Obwohl man durch ein Fenster auf die Straße sehen konnte, bemerkte Johann die zwei zunächst nicht, auch dann nicht, als kurz darauf die Tür aufging und sie das Lokal betraten.
Die Kapelle beendete eben ihren Walzer und verbeugte sich vor dem tröpfelnden Applaus des Publikums, das von der Tanzfläche an die Tische zurückging. Joseph angelte sich einen Krug Bier vom Tablett einer Kellnerin und stieß Johann in die Rippen. Jetzt sah auch er die zwei! Die Frau war blutjung, höchstens zwanzig Jahre, und mit ihren schwarzen Locken hübscher noch als Mitzi und Mimi zusammen. Wer aber war der Mann, der so aufgeregt auf sie einsprach? Der Kerl musste mindestens doppelt so alt sein wie sie. Wie ein Strizzi sah er nicht gerade aus, wie ein gewöhnlicher Gast aber auch nicht ... Aus seinem Gehrock, der ihm in den Hüften bis zum Platzen spannte, ragte ein mörderischer Stehkragen hervor, der ihn offensichtlich stach, denn immer wieder fuhr er sich mit der Hand zum Hals, um sich dort zu kratzen. Jetzt schüttelte die Frau den Kopf, strich sich eine Locke aus der Stirn und hob ihre dunklen Augen, wobei sie zum Podium hinüberlächelte.
»Was sagst?«, fragte Joseph, der das Lächeln natürlich auf sich bezog.
»Nicht übel«, meinte Johann. »Dürft aber alt und reich bevorzugen.«
»Aber nein! Sie macht mir schöne Augen ...«
»Tät ich auch, wenn ich mit so einem alten Bock zusammen sein müsste.«
Joseph war zu sehr beschäftigt, um auf die Bemerkung etwas zu erwidern. »Meine Verehrung«, sagte er gleich mehrmals, indem er sich ein wenig von seinem Stuhl erhob und der Frau Blicke zuwarf. Das konnte er – das musste Johann ihm lassen! Die Frau und ihr Begleiter sahen sich kurz an, dann nickte der Mann, und die beiden kamen ans Podium.
»Gestatten untertänigst, Joseph Lanner«, stellte Joseph sich vor, der inzwischen ganz aufgestanden war und mit seiner Geige unterm Arm einen Diener machte.
»Und ich bin der Strauß Johann«, sagte Johann und beeilte sich, ebenfalls von seinem Stuhl hochzukommen.
»Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Gnädigste ... Fräulein ...?« erkundigte sich Joseph.
»Fräulein! – Ich heiß Anna Streim. Und das da ist mein Vater.«
»Hervorragend ...«, strahlte Joseph. Doch bevor er seiner Zufriedenheit über diesen Umstand weiteren Ausdruck geben konnte, wurde er unterbrochen.
»Ich würd gern sprechen mit euch«, sagte der Mann mit einem Räuspern. Und während er beide Daumen in die Taschen seiner seidenen Weste steckte, auf der eine massive goldene Uhrkette prangte, fügte er, sich ein wenig vorbeugend, hinzu: »Ich hab auch ein Gasthaus. Aber keine Musik. Deswegen bin ich da.«
»Was haben Sie ...?«, fragte Johann, mit einem Mal hellwach.
6
Ja, Joseph Streim hatte ein Gasthaus, und ein äußerst respektables dazu! Hoch oben auf dem Dach, von einem veritablen Kunstmaler entworfen, verkündete mit stolz geschwollenem Kamm ein großer, roter Hahn, dass sich hier eines der ersten Etablissements der Leopoldstadt befand, vielleicht sogar des ganzen Bezirks. Aber das interessierte Joseph Lanner herzlich wenig. Denn Joseph Lanner war verliebt – verliebt in Anna Streim!
Es war schon später Abend, und in der Ecke zwischen Vorratskammer und Kellertreppe war es so dunkel wie in einem Schuhkarton. Verzweifelt suchte Joseph mit dem Mund nach ihren Lippen. Er roch ihre Haut, er fühlte ihren Atem, er hörte das Rascheln ihres Kleids ... Wo zum Teufel war sie? Er drehte sich um, er schnappte nach ihr, aber er schlug nur gegen eine Mauerkante. Plötzlich schmiegte sie sich an ihn, ganz eng, ganz zärtlich, ihr Körper an seinem, und das Blut schoss ihm in die Adern, dass ihm davon schwindlig wurde. Er hörte weder das Tellerklappern aus der Küche, noch registrierte er den Lichtschein, der auf sie fiel, wenn ein Kellner mit dem Fuß die Schwenktür zum Garten aufstieß. Anna! Anna! Er packte sie und presste sie an sich und bedeckte sie mit seinen Küssen, ihren Mund, ihr Gesicht, ihren Hals – was immer er von ihr erwischte.
»Aufhören ... Es könnt uns jemand entdecken ...«
»Anna!«, keuchte Joseph. »Einmal ganz allein sein mit dir!«
Und schon war sie davon.
Sehnsüchtig schaute er ihr nach, wie sie in der Küche verschwand. Was die für ein Temperament hatte ... Das musste das südländische Blut in ihren Adern sein! Joseph hatte gehört, ihr Großvater sei ein spanischer Grande gewesen, der im Duell einen Prinzen erstochen habe und deshalb geflohen sei, um später in Wien als Koch in Stellung zu gehen. Was für ein Schicksal, das sie zusammengeführt hatte ...
Aus dem Garten ertönte Musik. Jetzt machten sie ohne ihn weiter! Joseph nahm einem vorbeikommenden Kellner einen Krug Bier vom Tablett und stürzte ihn in einem Zug hinunter.
»Entschuldige«, sagte er, als er zwei Minuten später wieder auf dem Podium war. »Aber ich bin gestorben vor Durst.«
Johann nickte. Hatte er einen Verdacht? Zumindest ließ er sich nichts anmerken, während er Notenblätter an das Orchester austeilte. Ja, sie hatten jetzt ein richtiges Orchester, das aus einem vollen Dutzend Musikern bestand, mit Joseph als erstem und Johann als zweitem Kapellmeister.
Plötzlich blickte Johann auf. Anna kam in den Garten, eine große dampfende Suppenschüssel vor sich hertragend. Sie war puterrot im Gesicht. Das konnte nicht nur die Küchenhitze sein, das sah ja ein Blinder! Johann pfiff leise zwischen den Zähnen.
Streim, der aufgeregt, mit zu engem Rock und zu hohem Kragen, zwischen den Tischreihen hin und her hastete, um überall gleichzeitig nach dem Rechten zu schauen, dirigierte Anna samt Suppe an Tisch Nr. 11. Aufmerksame, prompte Bedienung, so wusste er, war das Geheimnis des Erfolgs, wenn man die bessere Gesellschaft zufriedenstellen wollte. Und darauf, dass die bessere Gesellschaft bei ihm verkehrte, hielt er sich eine Menge zugute.
»Und jetzt einen Walzer!«, rief jemand auf der Tanzfläche, auf der sich sogar Offiziere der ungarischen Leibgarde befanden.
»Ja, einen Walzer!«
»Die sollen einen Walzer spielen!«
Das war die Attraktion im Roten Hahn! Joseph hob den Taktstock, Johann den Bogen, und dann spielten sie einen Walzer, dass die Offiziere und ihre Mädchen nur so über die Tanzfläche flogen. Sichtlich beeindruckt nickte ein kleiner grauer Herr, der eben erst gekommen war, mit dem Kopf und nahm ein wenig abseits unter einer Linde Platz. Unter dem Zylinder, den er nun lüftete und neben sich auf den Tisch stellte, kam eine spiegelblanke Glatze zum Vorschein, die nicht weniger glänzte als seine flinken kleinen Augen. Während er mit seinem wachen, intelligenten Gesicht aufmerksam zum Podium sah, trommelte er mit den Fingern leise den Takt. Nachdem er so eine Weile zugeschaut hatte, hob er seinen Stock und hielt einen Kellner an.
»Ist nicht mein Tisch!«
»Nein, nein«, schüttelte der kleine graue Herr den Kopf. »Wer ist der Besitzer hier?«
»Herr Streim.«
»Und wo ist der?«
Der Kellner stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte den Hals. Streim war nur ein paar Tische weiter beschäftigt, schwer atmend, doch mit leuchtendem Gesicht. Der kleine graue Herr winkte ihn zu sich.
»Hoffe, es ist alles in Ordnung? Passt alles? Keine Beschwerden?«
»Haben S’ einen Moment Zeit, Herr Streim?«
»Gewiss. Aber wirklich nur einen Moment. Der Betrieb ist außerordentlich enorm ...«
»Man sieht’s«, nickte der kleine graue Herr voller Anerkennung. »Hirsch«, stellte er sich dann mit einer Verbeugung vor, »mein Name ist Hirsch. Fachmann für Saalbeleuchtung, ungewöhnliche Lichteffekte, chinesische und sonstige, nie gesehene Lampions. Auch der Lamperl-Hirsch genannt.«
»Danke«, sagte Streim und machte Anstalten, wieder aufzustehen. Von wegen, ihm hier seine kostbare Zeit zu stehlen! »Ich bin mit allem versorgt.«
»Aber nein!« Der kleine graue Herr hielt ihn am Arm zurück. »Ich habe eine Idee, wie Sie das Geschäft verdoppeln können.«
Geschäft verdoppeln? Da konnte Streim nur lachen! »Das hab ich schon«, sagte er und wies mit dem Kopf zum Podium. »Mit der Musik dort, mit dem Lanner und dem Strauß.«
»Akkurat! Lanner und Strauß ... Hervorragend! Beides wunderbare Musiker. Das ist ja meine Idee!«
»Wie?«
»Solche Musikanten in so einem – mit Verlaub – kleinen Etablissement?« fragte der kleine graue Herr, und plötzlich richteten sich seine Augen, die bislang wieselflink umhergewandert waren, fest auf Streim. »Sie sollten einen größeren Saal nehmen! Ich kenne alle Lokalitäten in Wien und Umgebung. Und ich könnte – als Ihr Agent – was Passendes auftreiben. Sonst?« Ohnmächtig hob er seine Arme in die Höhe. »Die zwei sind sehr gefragt. Was passiert, wenn einer mit einem größeren Saal daherkommt?«
Kleines Etablissement? Größerer Saal? Streim war empört! Allerdings, wenn man die Sache vom kaufmännischen Standpunkt aus betrachtete, rein rechnerisch sozusagen ... Nervös kratzte er sich am Hals. Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Endlich hatte er mit den Bratlgeigern das Geschäft so schön in Gang gebracht, da kam dieser Pfiffikone daher und wollte ihm in die Suppe spucken. So einer gehörte gleich am Eingang wieder nach Hause geschickt!
»Ich hab schrecklich viel zu tun«, stotterte er. »Reden wir ein anderes Mal darüber.«
Während er davoneilte, lächelte der kleine graue Herr mit dem unschuldigsten Gesicht der Welt vor sich hin, und wieder trommelte er mit den Fingern zur Musik. Plötzlich aber, mitten im Takt, verharrte er, und seine Miene wurde ernst. Offenbar dachte er nach, das war nicht zu verkennen. Im nächsten Augenblick ging ein Strahlen über sein Gesicht, und seine Finger begannen auf der Tischplatte regelrecht zu galoppieren.
Das konnte nichts Gutes bedeuten! Streim hatte alles gesehen. Doch Gott sei Dank war auch er nicht von gestern. Er wusste, wie man mit solchen Gestalten fertig wurde, und dampfte zu Ferdl und Poldi hinüber, seine zwei kräftigsten Kellner.
»Seht’s ihr den dort?« raunte er ihnen zu und zeigte mit dem Daumen auf den kleinen grauen Herrn unter der Linde. »Aufpassen auf den! Und ja nicht zu den Musikern lassen!«
7
Soll ich oder soll ich nicht?
Unentschlossen blickte Anna hinter Johann her, der eben mit seiner Geige unterm Arm im Haus verschwand. Typisch, dass ihm und nicht Joseph mitten im Spiel eine Saite gerissen war! Irgendetwas hatte er an sich, das ihr unheimlich war, ja, das ihr Angst machte, obwohl er noch nicht einmal so alt war wie sie. Sie wusste selbst nicht genau, was es war, sie wusste nur, es hatte irgendwie damit zu tun, dass sie immer weiche Knie bekam, wenn er sie mit seinen dunklen, unruhigen Augen anschaute. Das war einer, von dem man besser die Finger ließ ... Ach was, es ging ja nicht ums ganze Leben! Halb und halb entschlossen, stellte sie die Suppenschüssel ab und folgte ihm ins Haus.
Johann stand mit dem Rücken zur Tür im Flur und zog eine neue Saite auf. Die Musik aus dem Garten vermischte sich hier mit dem Klappern und Rufen aus der Küche. Anna zögerte einen Augenblick. Nein, sie würde nur an der Durchreiche ihre nächste Bestellung abholen. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab, strich sich über ihr Kleid und zwängte sich an ihm vorbei. Zufällig, ohne jede Absicht, streifte sie seinen Rücken.
»Oh, spielen Sie nicht?«, fragte sie, mehr erschrocken als überrascht.
Johann drehte sich um und zeigte ihr seine Geige. »Gerissen.«
Anna wusste jede Menge über Geigen und Saiten. Sie wusste, dass es Saiten aus Katzendärmen gab und welche von neugeborenen Lämmern. Sie wusste auch, dass die besten aus Italien kamen, das Stück so teuer wie ein halbes Dutzend Krüge Bier. Das hatte ihr alles Joseph erzählt, und irgendetwas in dieser Art wollte sie sagen. Doch sie tat es nicht. Stattdessen sagte sie, als sie den Mund aufmachte: »Ich mag die Art, wie Sie spielen.«
»Und ich hab geglaubt«, erwiderte er, wobei er einen Wirbel seiner Geige festdrehte, »Sie mögen die Art, wie der Joseph spielt.«
»Auch«, sagte Anna und blickte zu Boden. »Aber ... wenn Sie spielen ... das ist anders, aufregender ... Da krieg ich so ein Kribbeln ...«
Warum sagte sie nur so was? Johann zupfte ein paarmal an der neuen Saite, dann legte er die Geige weg und machte einen Schritt auf sie zu. Nein, sie durfte nicht zu ihm aufblicken. Wenn sie es tat, würde sie in seine dunklen, unruhigen Augen schauen, und dann ... Als sie den Blick hob, sah sie in seine dunklen, unruhigen Augen, und vor Angst und vor noch einem Gefühl, das genauso war wie Angst und gleichzeitig das Gegenteil und wunderschön, wurden ihre Knie so weich, dass Anna glaubte, sie würden jeden Moment einknicken.
»Soll ich Ihnen zeigen«, fragte er, »was mir ein Kribbeln macht?«
Bevor sie antworten konnte, zog er sie zu sich heran und küsste sie auf den Mund. Nein! Sie presste die Lippen aufeinander, so fest sie nur konnte. Wo war Joseph? Sie wehrte sich, sie stemmte sich mit den Fäusten gegen ihn. Er aber hielt sie fest, ließ nicht los, nicht mit seinen Armen und nicht mit seinem Mund. Und während draußen das Publikum so heftig applaudierte, dass Joseph seinen neuen Walzer wiederholen musste, schloss sie die Augen und öffnete die Lippen ...
»Anna! Anna!«
Das war ihr Vater, der aus der Küche nach ihr rief. Dem Himmel sei Dank! Halb ohnmächtig löste sie sich aus Johanns Umarmung und lief davon, fast wie auf der Flucht.
In der Küche herrschte rege Tätigkeit. Zusammen mit der Köchin Therese stand Streim über den großen Arbeitstisch gebeugt, auf dem sich neben einer ganzen Batterie Flaschen Berge von Würsten, Pasteten und Kuchen häuften, und war damit beschäftigt, all die Lebensmittel in einen Korb zu packen.
»Anna! Kruzifix no amal!«, rief er. »Wo bleibst denn?« fragte er über die Schulter, als er merkte, dass sie endlich da war. »Ich schrei mir ja die Seele aus dem Leib. Hör zu, ich will, dass die zwei zufrieden sind.«
»Welche zwei?«
»Welche zwei? Kannst du blöd fragen ... Lanner und Strauß natürlich. Die zwei! Ich möcht sie glücklich und zufrieden. Es könnt einer kommen, der sieht, wie gut sie sind, und ihnen ein besseres Angebot machen. Sie müssen sich hier zu Hause fühlen. Verstehst? In jeder Beziehung!«
»In jeder Beziehung ...?« fragte Anna und tauschte einen Blick mit der Köchin, die ihr verschwörerisch zuzwinkerte.
»Ja«, sagte Streim, sich am Hals kratzend, während er überlegte, was er als nächstes in den Korb tun sollte. »Heut Abend kriegen sie was Feines mit. Für daheim.«
»Nur heut Abend?«
»Von mir aus jeden Abend«, sagte er und entschied sich für ein fettes Stück Speck. »Als Extra-Belohnung. Und ich möcht«, fügte er hinzu, »dass du es ihnen gibst. Und zwar besonders freundlich. Sie sollen spüren, dass sie zur Familie gehören.«
»Ich ... ich werd mein Bestes geben ...«
8
Als die Kapelle den letzten Walzer beendete, saß Carl Friedrich Hirsch, auch der Lamperl-Hirsch genannt, schon in seinem Wagen. Er hatte den Fiaker auf Punkt zwölf Uhr bestellt und dem Kutscher Order gegeben, ein Stück abseits vom Roten Hahn mit geschlossenem Verdeck zu warten.
Nach und nach strömten die Gäste ins Freie, vorbei an dem Einspänner, der vor dem Eingang des Lokals stand, und verloren sich summend und tanzend auf der dunklen Straße, darunter einige auf nicht mehr sicheren Beinen.
»Eine famose Musik ...«
Wortfetzen der Männer und Frauen, die sich voneinander verabschiedeten, drangen zu Hirsch herüber.
»Wir wollen nur mehr Walzer ...«
»Herrlich ...«
»Morgen sind wir wieder da ...«
»Gute Nacht ...«
Hirsch lehnte sich zurück und blickte auf den krummen Rücken des Kutschers, der sich eben mit der Hand in den Nacken fuhr, um eine Mücke totzuschlagen. An diesem Abend würde eine Vorentscheidung fallen – darüber, ob es ein heroischer Entschluss oder ein katastrophaler Irrtum von ihm gewesen war, seinen sicheren Posten in der k.k. Kriegsbuchhaltung aufzugeben, um sich ins freie Unternehmertum zu stürzen, in dem bekanntlich weder Vorschriften noch Paragraphen galten, sondern höchstens die Gesetze des Dschungels.
Hirsch hatte allerdings nachgedacht. Und wenn Lamperl-Hirsch nachdachte, tat er das gründlich und mit dem Rechenstift. Nach seiner Schätzung ging jeder sechste Wiener jeden Abend tanzen – fünfzigtausend Menschen, fünfzigtausend Süchtige, die sich buchstäblich zu Tode tanzten! Tanzsäle waren die Goldgruben Wiens. In der Redoute hatten sie sogar ein Zimmer eingerichtet, in dem schwangere Frauen entbunden werden konnten, wenn beim Tanzen die Wehen einsetzten. Was für ungeahnte Möglichkeiten taten sich da auf ... Nur, man musste sich etwas einfallen lassen. Sonst musste selbst ein Genie wie der Schubert, der vor Musik nur so troff, sich als Schulmeister durchschlagen und verluderte im Café Rebhuhn, ohne je ein Konzert zu bekommen ... Ja, man musste sich etwas einfallen lassen. Darauf kam es an!
Hirsch beugte sich auf seinem Sitz vor. Da waren sie! Sie stiegen gerade in den Einspänner vor dem Gartentor, als jemand aus dem Haus gelaufen kam. Hirsch erkannte die Tochter des Wirts, die jetzt den beiden einen großen Esskorb reichte. Mit Speck fängt man Mäuse, dachte er und legte eine Hand ans Ohr, um besser zu hören.
»Mit den besten Empfehlungen.«
»Für uns?«
»Von zwei eurer glühendsten Bewunderer ...«
»Und die wären?«
»Ich und der Herr Vater.«
»Mit ewiger Dankbarkeit ...«
»Ihr ergebenster Diener ...«
Als sich der Einspänner in Bewegung setzte, tippte Hirsch mit seinem Stock dem Kutscher auf die Schulter.
»Da vorn ... Nicht verlieren, den Wagen!«
»Der alte Streim«, schmatzte Joseph, »ich muss sagen, I a.«
Ja, so ließ sich das Leben aushalten! Johann und er hatten gar nicht erst abgewartet, bis sie in der Windmühlgasse waren, sondern gleich, noch während der Fahrt, den Inhalt des Esskorbs auf ihren Knien ausgebreitet, und aßen nun im flackernden Schein der Kutschleuchte mit den Fingern, was Streim in seiner Fürsorglichkeit für sie eingepackt hatte. Bei dem Schaukeln und Holpern mussten sie allerdings höllisch aufpassen, dass nicht die Hälfte zu Boden fiel.
»Und die Tochter ...?«, fragte Johann und schielte zu Joseph hinüber, der gerade den Boden einer Pastetenterrine ausleckte. »Anna? Auch Ia. Was sagst du?«
Johann zuckte die Schultern, als habe ihn jemand nach dem Weg zur Besserungsanstalt gefragt. »Ich könnt’s nehmen oder lassen ...«
»Ich auch«, sagte Joseph und fuhr mit der Zunge durch die letzten Ecken seiner Terrine. »Aber besser lassen ...«
»Richtig. Das find ich auch ...«
Ein aus tiefer Kehle heraufrollender Rülpser verkündete, dass Joseph die Mahlzeit beendet hatte. Mit fettigen Fingern packten sie die Reste in den Korb zurück, als draußen leise Musik ertönte.
»Du«, sagte Joseph und stieß Johann an. »Hörst was?«
Johann lauschte in die Nacht hinein. Das war doch nicht möglich! Zuerst glaubte er, er hätte sich geirrt. Aber nein, immer deutlicher konnte er den Rhythmus erkennen – mtata, mtata ...
»Das ist ja ein Walzer!«
Joseph ließ das Rollo hoch, stieß das Fenster auf und streckte den Kopf aus dem Wagen.
»Kommt aus dem Apollo«, sagte er.
»Kutscher, langsam!«, rief Johann. »Bleiben S’ stehen, wir wollen zuhören.«
Noch während der Wagen anhielt, sprang Johann auf, um sich ebenfalls hinauszubeugen. Keinen Steinwurf entfernt erstrahlte das Apollo im vollen Lichterglanz. Hunderte Vergnügungssüchtiger pilgerten auf den Eingang zu, der wie jede Nacht von einer riesigen Menschenmenge umringt war, während Equipagen mit livrierten Kutschern auf dem Bock die Pappelallee entlangrasselten. Über allem aber schwebte, hell und klar und unverwechselbar, ein Walzer in der milden Luft der Sommernacht.
»Das kann doch nicht sein!«, meinte Joseph ungläubig. »Die spielen doch keine Walzer im Apollo!«
»Schau«, rief Johann. Er hatte ein Plakat entdeckt, das nicht weit entfernt an einem Baumstamm klebte. »AUFFORDERUNG ZUM TANZ, von einem Herrn von Weber ...«
»Aha – ein von«, sagte Joseph voller Verachtung. »Ein Ihriger also. Ein Aristokratenarsch, der keine eingeschlafene Musik mehr komponieren wollte.«
»Ich hab geglaubt, die spielen nur Menuetts, und jetzt lassen sie sich unsere Musik von einem Ihrigen komponieren!«
Während Johann sprach, setzte sich auf der Allee, keine zwanzig Meter hinter ihnen, ein Fiaker mit geschlossenem Verdeck in Bewegung und rollte langsam auf sie zu.
»Jessas, das schmerzt«, stöhnte Joseph, als der Walzer zum Finale anschwoll. »Weißt, was ich jetzt brauch?«
»Was denn?«
Doch bevor Joseph es ihm verraten konnte, schob sich der Fiaker neben ihren Einspänner und kam mit einem langen brrr zum Stehen. Der Kutscher zeigte mit der Peitsche auf sie und machte dabei ein Gesicht, als hätten sie etwas verbrochen. Joseph und Johann schauten sich an. Im nächsten Augenblick kam unter dem Verdeck ein grauer Zylinder zum Vorschein, gefolgt von zwei kleinen, flinken Augen, die vor Freundlichkeit nur so sprühten, und einem Lächeln, das von einem Ohrläppchen zum andern reichte.
»Wirklich! Die Herren Lanner und Strauß«, rief der kleine graue Herr, der nun aus der Kutsche stieg und dessen Glatze vor freudiger Überraschung so glänzte wie der Mond am Himmel. »Ich war beim Streim heut Abend«, erklärte er. »Gehen wir auf ein Glas!?«
»Er nimmt mir’s Wort aus dem Mund«, meinte Joseph.
Und schon war er aus dem Wagen.
9
»Was heißt das: zwei Kapellen?« fragte Joseph.
Carl Friedrich Hirsch bildete sich ein, ein geduldiger Mensch zu sein. Denn ohne ein dickes Fell hätte er die Jahre im Staatsdienst kaum überstanden. Allmählich aber war er mit seiner Geduld am Ende und er begann, an der Intelligenz von Musikern zu zweifeln, speziell der beiden, mit denen er es gerade zu tun hatte. Seine Worte prallten an ihren Köpfen ab wie an einer Wand. Dabei hatte ihn der Versuch, sie von seiner exzeptionellen, nie dagewesenen Idee zu überzeugen, nicht nur jede Menge Geduld, sondern auch schon ein halbes Dutzend Flaschen Wein gekostet. Nur gut, dass er sie in dieses Souterrainbeisel eingeladen hatte! Sonst würde das Spesenbudget die Rechnung kaum verkraften ...
»Grad wie ich’s sag«, setzte Hirsch gottergeben ein weiteres Mal an. »Ihr nehmt’s noch ein paar Musikanten auf und teilt’s euch. Macht’s zwei Kapellen! Dann könnt ihr auf zwei Kirchtag gleichzeitig spielen.«