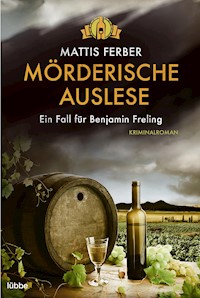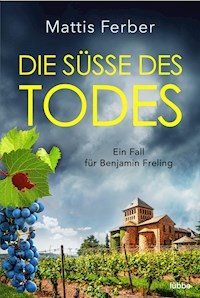
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Benjamin Freling
- Sprache: Deutsch
Ein Kloster im Rheingau, ein mysteriöser Weinkeller und eine Leiche
Im altehrwürdigen Kloster Marienwingert im Rheingau entdecken die Ordensfrauen nach dem überraschenden Tod der Priorin eine Weinsammlung, die weit größer und umfangreicher ist als angenommen. Um herauszufinden, welcher Wert sich in dem Gewölbekeller tief unter der Abtei befindet, engagieren die Nonnen den Sommelier Benjamin Freling. Der Anblick raubt dem Experten zunächst den Atem. Was er hier vor sich hat, ist ein wahrer Schatz an Weinraritäten unvorstellbarer Güte. Doch woher stammten die Weine? Warum wusste außer der toten Priorin niemand davon? War der Tod der alten Nonne wirklich nur ein Unfall? Freling beginnt nachzuforschen, und allzu bald gibt es weitere Tote ...
Dieser Krimi korkt nicht, hier gibt’s reinen Lesegenuss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil IEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnSechzehnTeil IIEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnSechszehnSiebzehnDanksagungÜber dieses Buch
Band 2 der Reihe »Benjamin Freling«
Ein Kloster im Rheingau, ein mysteriöser Weinkeller und eine Leiche
Im altehrwürdigen Kloster Marienwingert im Rheingau entdecken die Ordensfrauen nach dem überraschenden Tod der Priorin eine Weinsammlung, die weit größer und umfangreicher ist als angenommen. Um herauszufinden, welcher Wert sich in dem Gewölbekeller tief unter der Abtei befindet, engagieren die Nonnen den Sommelier Benjamin Freling. Der Anblick raubt dem Experten zunächst den Atem. Was er hier vor sich hat, ist ein wahrer Schatz an Weinraritäten unvorstellbarer Güte. Doch woher stammten die Weine? Warum wusste außer der toten Priorin niemand davon? War der Tod der alten Nonne wirklich nur ein Unfall? Freling beginnt nachzuforschen, und allzu bald gibt es weitere Tote …
Dieser Krimi korkt nicht, hier gibt’s reinen Lesegenuss
Über den Autor
Mattis Ferber ist ein Pseudonym des Autors Hannes Finkbeiner. Er ist Journalist und studierte an der Hochschule Hannover, wo er heute auch als Dozent tätig ist. Finkbeiner schrieb u. a. für die FAZ, Spiegel Online oder das RedaktionsNetzwerk Deutschland und ist für HAZ als Kolumnist tätig.
MATTIS FERBER
DIE SÜSSE DESTODES
Ein Fall für Benjamin Freling
KRIMINALROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Copyright © 2022 by Hannes Finkbeiner
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung von Illustrationen von © www.buersosued.de
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2080-9
luebbe.de
lesejury.de
Teil I
Eins
Die Zündflamme knackte mehrmals hintereinander, erst dann sprang der Gasboiler im Badezimmer knisternd an. Benjamin Freling hörte auch ein Auto, das mit klapprigen Stoßdämpfern über das Kopfsteinpflaster der Breisacher Oberstadt holperte, und die Aggregate seiner drei Weinklimaschränke, die friedlich brummten. Im Stockwerk unter ihm saugte seine Vermieterin Staub. Das Gerät musste defekt sein, so laut wie der Motor kreischte. Entweder das, oder sie mähte den Teppich. Stille zeichnete sich eben nicht durch das Fehlen von Geräusch aus, schlussfolgerte der Sommelier, im Grunde machten Geräusche eine Stille erst vollkommen. Genauer: vollkommen beunruhigend. Wenn er nämlich seine Fantasie anstrengte, konnte er auch Julias Zähne knirschen hören. Julia. Seine Freundin.
Wortlos kam sie in die Wohnküche und stellte ihre Handtasche auf den Tisch, an dessen Ende er saß. Sie streifte ihren beigen Trenchcoat über. Ein Hauch von frisch aufgelegtem Parfüm wehte ihm entgegen, dazu ein Schwung ihres schwarzen gewaschenen Haars. Freling gab keinen Mucks von sich. In diesem Augenblick vibrierte sein Mobiltelefon. Es lag vor ihm, im Display erschien der Name Pana – Frelings bester Freund. Der Sommelier wagte es aber nicht, das Gerät anzufassen. Er ließ es wohlweislich vibrieren, bis sich die Mailbox einschaltete. Julia schob sich ihre Sonnenbrille wie einen Haarreif auf den Kopf und sah schlichtweg umwerfend aus. Stinksauer oder sanftmütig, sie war die schönste Frau der Welt – und somit auch die schönste Restaurantleiterin der Welt, das stand für ihn völlig außer Frage.
Julia zog ihren Autoschlüssel aus der Jackentasche, womit sie alles getan hatte, was zum Gehen getan werden musste. Nur: Sie ging nicht. Der Sommelier befürchtete, dass sie sich gerade in einem dieser klassischen Kompensationsmomente nach einem Streit befanden, in denen alles gesagt war, die Parteien sich sammelten und sich taktische Sachlichkeit und unterschwellige Wut zu einem letzten, erlösenden Wortgefecht zusammenballten. Oder zu einem wochenlangen Schmollknäuel zusammenzogen.
»Und jetzt?«, fragte Julia und blickte ihn dabei so emotionslos an, als würde sie die Nachrichten vorlesen.
Ja, was jetzt?
Der Sommelier stand auf, ging zum Weinklimaschrank und nahm eine Karaffe Rotwein heraus. Ein 2004er Petite Sibérie von der Domaine du Clos des Fées, den sie gestern Abend geöffnet hatten, als das Halbdunkel der Wohnung noch von zig Kerzen und ihren glühenden Herzen erhellt wurde. Nichts davon war an diesem Sonntagvormittag geblieben. Es war grell. Graugrellhell, dann plötzlich wieder finster. Draußen, vor dem großen Panoramafenster seiner Wohnung, zeigte das Maiwetter stete Wandlungsfreude: Wolken stoben über den Himmel, dahinter brach immer wieder die Sonne hervor. Mal nieselte es, dann regnete es Bindfäden. Gerade als sich der Sommelier den Rest Wein eingoss, wurde es wieder dunkel. Ein bedrohliches Dunkel, voll schwarzer kalter Wolken. Ein Dunkel, das jedes Lebewesen ohne Umschweife zurück ins Bett befehligte und nichts weniger signalisierte, als die lebenserhaltenden Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Benjamin Freling ließ den Südfranzosen kurz im Glas seine Runden drehen. Er hatte einen ordentlichen Schluck für heute zurückgehalten, weil er wissen wollte, wie der Tropfen schmeckte, wenn er sich etwas länger an der Luft entwickelt hatte. Julia folgte ihm mit ausdruckslosen Augen. Er steckte seine überaus markante Freling’sche Nase ins Glas und wirklich: Die Jahre und der Luftkontakt hatten das Kraftpaket von Wein zur Altersmilde gerungen, er war nicht mehr verschlossen, sondern schmolz um einen frischen, saftigen und samtigen Kern, hatte einen tiefen und intensiven Duft nach Zwetschgen, Schwarzkirschen und Johannisbeeren. Dahinter blitzten feine Kräuter und edle Gewürze auf. Das liebte er. Ein gereifter Wein, der zum richtigen Zeitpunkt geöffnet wurde, war für den Sommelier ein kleines Mysterium. Er war Zen. Yin und Yang. Pure Poesie. Die perfekte Balance von Millionen Gegensätzen. Und ging es denn um nichts anderes auf der Welt? Um Gleichgewicht im Kosmos und Universum? War das nicht das einzige Höchstmaß an Gerechtigkeit, das den Menschen zuteil wurde? Gleichgewicht?
Genauso hatte er vorhin auch vor Julia argumentiert. Aber Julia war kein grünschnabeliger Philosophieschüler, sondern eine temperamentvolle Frau mit katalanischen Wurzeln. Der Streit hatte begonnen, noch bevor sie ins Bad gegangen war, um sich für den Arbeitstag herzurichten. In Shorts, Socken und Kapuzenpulli hatte sie am Tisch gesessen, mit einem Cantuccino ihren Milchkaffee umgerührt und gefragt, was er heute vorhabe. Freling hatte mit den Schultern gezuckt. Er hatte keine Ahnung. Was sollte man an so einem hässlichen Tag auch schon tun? Lesen? In einer Weinzeitschrift? Einkaufen und kochen? Sollte er eine Runde bei Wind und Wetter joggen gehen? Gegen die Pfunde kämpfen? Oder nochmals ein Nickerchen halten? Alles war denkbar. Verstand sie ihn nicht?
Zehn Jahre lang hatte er wie ein Ackergaul geschuftet, stundenlang, oft sieben Tage die Woche, an langen Abenden, an langen Wochenenden. Zuletzt war er Sommelier und Restaurantleiter im Gourmetrestaurant Freling gewesen, im Luxushotel seiner Familie. Julia war damals noch seine Stellvertreterin. Und jetzt arbeitete er seit dreizehn Monaten eben – nicht. Viele Nächte hatte er damals nur wenige Stunden Schlaf bekommen, jetzt lag er mit Julia so lange in der Koje, bis sie zur Arbeit musste. Und manchmal ging er danach wieder ins Bett. Zeitlebens war er auch ein Hungerhaken gewesen, dünn und schlank, jetzt hatte er einen soliden Schwimmring auf den Hüften und Ansätze zu Pausbäckchen. Legte man also einmal ganz nüchtern und sachlich die letzten Jahre nebeneinander, dann fand gerade nur der nötige Ausgleich der Kräfte seines Lebens statt.
»Auch in Balance, noch mehr als gestern«, flötete Benjamin befriedend, zog schelmisch die Augenbrauen nach oben und hielt ihr das Weinglas hin.
Doch das Manöver verfehlte seine Wirkung. Julia zeigte keine Regung. »Argumentierst du jetzt auch noch wegen deines Bankkontos so? Du warst zehn Jahre in den schwarzen Zahlen, jetzt darfst du zehn Jahre in den roten Zahlen sein?«
Es wurde dunkler im Raum. Das hatte nichts mit den Lichtverhältnissen zu tun. War das die perfide Taktik, die sich seine Freundin im Badezimmer zurechtgelegt hatte? Das Finale des Wortgefechts? Der Sommelier stellte das dünnwandige Weinglas auf den Tisch, wäre es davon nicht zerbrochen, er hätte es liebend gerne auf den Tisch geknallt. Richtig war: Er hatte sich von Julia die letzte Miete leihen müssen, worauf er nicht stolz war. Aber seit einem halben Jahr lebte sie schließlich auch hier. Sie kam und ging, wie sie wollte, hatte einen Schlüssel. Und er war eben knapp bei Kasse – auch und vor allen Dingen, weil sie zusammen hin und wieder Weine entkorkten, die man in ihren Jobs zwingend kennen musste, aber das Budget von Ottonormalbürgern deutlich überschritten.
»Aber gestern Abend hat dir der Sibérie noch gut geschmeckt, oder? Ich habe eben vielleicht kein Geld auf dem Konto, aber …« Benjamin zeigte demonstrativ auf seine drei Weinklimaschränke, die seit nunmehr fünf Jahren für eine gleichmäßige Temperatur sorgten. Elf Grad. Konstant. Da war sie wieder: die Balance.
»Du kannst die Weine nicht mit ins Grab nehmen, Benny.«
»Die Klimaschränke sind besser als jedes Bankkonto«, entfuhr es dem Sommelier, was teils sogar stimmte. Die Wertsteigerung, die mit manchen seiner Bouteillen einherging, war allemal besser als die Nullzinsen auf der Bank.
»Du musst sie verkaufen. Oder trink sie wenigstens, manche Weine sind nicht mehr lange auf ihrem Höhepunkt. Am Ende hast du teuren Essig. Verkauf doch die 1985er S-Cuvée von Salon. Dann hast du genug für eine Monatsmiete, und wir können noch schick zusammen essen gehen. Was hält dich davon ab?«
Was ihn abhielt? Er wusste es nicht.
»Den Salon?«, wiederholte er erschrocken. Wieder begann sein Telefon zu vibrieren, dieses Mal nur kurz. Pana hatte ihm eine Kurznachricht gesandt. Der Sommelier schielte auf den Bildschirm. Ruf mich an, wir haben einen Job für dich, stand da. »Julia, ich muss den Champus nicht verkaufen – ich habe doch einen Job!«, platzte Benjamin raus.
Julia sah ihn verblüfft an. Ihre hochgezogenen Schultern sanken herab, die Wut war gewichen. »Was? Seit wann? Wieso erzählst du mir das denn nicht?«, fragte sie.
Benjamin räusperte sich. »Ich weiß erst seit kurzem davon.«
»Ach«, sagte Julia, die nach dieser unerwarteten Wendung schnell wieder die Fassung gewann, was bedeutete: Ihre Gesichtszüge verhärteten sich erneut. »Und was ist das für ein Job?«
»Erkläre ich dir später«, sagte der Sommelier.
»Bekomme ich wenigstens eine Kurzversion?«
»Och.« Benjamin wedelte abtuend mit der Hand. Erneut brummte sein Handy. Er schielte auf das Display. Du musst ein paar Weine schätzen. Zeit? »Ich muss nur ein paar Weine schätzen, mehr nicht«, fügte er rasch an, als sei das die naheliegendste Sache der Welt.
»Weine schätzen? Für wen? Hier in der Gegend, oder bist du lange weg, oder …«
»Ich erzähle dir alles später, okay?«
Julia schaute ihn an, als wollte sie Kleinholz aus ihm machen. Sie schnappte ihre Handtasche und stapfte zum Ausgang.
Lieb dich, wollte Benjamin Freling rufen. Küsse! Freu mich auf heute Abend! Irgend so was.
Er überlegte noch, was genau angebracht war. Da fiel die Tür donnernd ins Schloss. Zurück blieb Stille. Und ein Teppich, der gemäht wurde.
Benjamin füllte ein zweites Mal an diesem Morgen seinen Espressokocher und stellte ihn auf die Herdplatte. Während er wartete, schnupperte er eine Weile gedankenverloren an der geöffneten Kaffeedose. Mit Tasse, Telefon und Weinmagazin stieg er dann auf die Galerie, wo sich sein Bett befand. Er legte alles auf seinem Nachttisch ab – ein kleines Weinfass, das er vor Jahren in der Garage seines Winzeronkels gefunden hatte –, kroch ins Bett und starrte ein paar Minuten in den launischen Morgen hinaus. Kurz flackerte Sonnenschein über seiner Terrasse. Tausende Regentropfen schillerten an der großen Panoramascheibe. Weit entfernt, über dem Winklerberg, dem vielleicht berühmtesten Weinberg des Kaiserstuhls, braute sich schon das nächste Gewitter zusammen. Benjamin zog sich die Decke bis zur Nasenspitze und angelte dabei nach seinem Telefon.
»Raus aus der Falle!«, hörte er Panas Stimme – Pana war der sprechbare Spitzname von Aigidios Panagiotopoulos, den er während seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann in Berlin kennengelernt hatte. Seit mehreren Jahren betrieb der griechischstämmige Koch mit seiner Verlobten ein Restaurant im Rheingau, eine ehemalige Kapelle, die sie vom Benediktinerinnenkloster Marienwingert gepachtet und umgebaut hatten. »Lara hat dir einen Job besorgt«, fügte sein Freund hinzu, seine Stimme wurde dabei untermalt von scharrenden Füßen – ging er auf Kies? –, gefolgt von einem lauten Knall.
»Was ist da so laut?«, fragte Benjamin, dem die geschäftige Geräuschkulisse seinen eigenen Müßiggang vor Augen führte.
»Arbeit verursacht Geräusch, für Gastronomen auch an Sonntagen, falls du das vergessen haben solltest«, entgegnete Pana spitz und schob etwas milder hinterher: »Nein, bin oben beim Kloster und lade ein paar Kisten ein. Und jetzt steig ins Auto und komm her.«
Benjamin lächelte. »Darf ich vielleicht vorher fragen, um was für einen Job es sich handelt?«
»Lara hat gestern mit der neuen Priorin telefoniert, ist erst seit ein paar Wochen in Amt und Würden, die haben einen Weinkeller und wollen wissen, was das Zeug da unten wert ist – da hat sie gefragt, ob Lara einen Sachverständigen kennen würde …«
»Und dann hat sie mich genannt?«, platzte der Sommelier hervor.
»Nennt man Freundschaft – du hast doch beim letzten Mal gejammert, du hättest nichts zu tun und wärst knapp bei Kasse, oder nicht?«
Der Sommelier seufzte. Das stimmte. Er hatte seinen Freunden von seiner Situation berichtet, als er sie vor drei oder vier Wochen einen Abend besucht hatte. »Ihr habt doch bei euch zig Sachverständige rumspringen, ruf doch bei der Uni Geisenheim an, die können auch …«
»Die können, was du kannst«, unterbrach ihn Pana.
»Was ist eigentlich eine Priorin?«
»In unserer Sprache? Souschefin. Stellvertretende Hoteldirektorin. Oder so ähnlich. Den Finanzvorstand hat sie auch inne. Ist die Nonne mit dem Scheckbuch, sozusagen.«
»Ah.« Der Sommelier überlegte. Die Sonne war längst wieder verschwunden, ihr schillerndes, lebensfrohes Licht einer Ode ans Grau gewichen, die seine ganze Wohnung erfüllte. Er rieb unter der Decke seine kalten Füße aneinander und rümpfte seine Nase. »Was zahlen die denn?«
»Gehaltsverhandlungen musst du schon selbst führen.«
»Pana, ey, es ist gerade so warm in der Falle.«
Der Koch lachte kurz und brach abrupt ab. »Moment. Du liegst nicht wirklich noch im Bett?«
»Natürlich nicht, war nur ein Witz«, murmelte Benjamin, setzte sich so geräuschlos wie möglich im Bett auf, vermied jedes Rascheln der Decke und nahm einen Schluck Kaffee. Da begann es wieder zu regnen, nein, es schüttete, und die Regentropfen prasselten wie Hagelkörner gegen die Fensterscheiben.
»Was zierst du dich dann? Hast du was Wichtigeres zu tun? Die reservieren dir sogar kostenlos ein Zimmer in ihrem Gästetrakt – aber du kannst natürlich auch wieder bei uns auf der Couch pennen, wenn dir das lieber ist.«
»Nein, nein, eure Couch killt meinen Rücken«, log Benjamin. Er hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er sich bei Pana und Lara breitmachte und das Paar um Punkt sieben an sechs Tagen in der Woche durch die Wohnung stürmte, während er schlaftrunken durch seine Lider blinzelte. »Ich penne dann schon im Kloster, aber ehrlich, was soll denn da schon für Wein im Keller liegen? Lohnt sich der Aufwand?«
»Das würde ich auch gerne wissen. Sind einmal durch die Katakomben geirrt. Atmosphäre wie im Gruselfilm. Die Tür zum Weinkeller war verschlossen. Haben aber ganz guten Stoff, glaube ich. Der Bischof von Speyer ist zwei- oder dreimal im Jahr zu Besuch. Deswegen bin ich gerade auch hier oben, ich muss immer für ihn kochen. Das werte Kirchenoberhaupt nippt dann auch tagelang an einer Flasche Wein rum, die offen in der Küche rumsteht, heute ist es ein Bordeaux …«
»Bordeaux hat ja nicht viel zu heißen«, sagte Benjamin. »Was war es denn für ein Bordeaux?«
»Ich kann dir jeden Winzer im Rheingau runterbeten, aber mit Frankreich kannst du mich jagen. Es war ein Wein aus den Achtzigern.«
»Was stand denn auf der Flasche? Kannst du es buchstabieren?«
»Irgendwas mit Trottel.«
»Sehr witzig.«
»Das ist kein Witz!«
Benjamin überlegte. »Meinst du Trottevieille? Aus Saint Émilion?«
»Ja, genau. Ist das gut?«
»Da sind wir schon auf dem Weg zur Spitze«, sagte der Sommelier, dessen Neugier geweckt war. »Was war es für ein Jahrgang?«
»Weiß ich nicht.«
»Eher Anfang oder Ende der Achtziger?«
»Alter! Keine Ahnung – kommst du jetzt? Oder kommst du nicht?«
Zwei
Der Motor ächzte und spuckte, schien an der steilsten Stelle der Gottestalstraße sogar abzusaufen. Benjamin Freling schaltete einen Gang herunter und gab Gas. Sein alter Passat heulte auf und schoss mit einem Ruck auf die rebengesäumte Hügelkuppe des Oestricher Klosterbergs. Der Sommelier betrachtete dabei die Kirche der Benediktinerinnenabtei Marienwingert. Es war ein kaltes Gemäuer, das wie ein Mahnmal vor dem Taunus aufragte. Weniger erhaben als bedrohlich, mehr lauernd als geheimnisvoll. Vielleicht hatte sein erster Eindruck des Sakralbaus mit dem nebelverhangenen Vormittag zu tun, der über das Mittelgebirge kroch. Oder mit dem grauen, teils stark verwitterten Sandstein, aus dem das Gebäude errichtet worden war. Der Sommelier dachte an alte Postkarten, die man aus irgendeiner Kiste auf dem Dachstuhl zog. Als unheimlich hätte er das Kloster in diesem Augenblick sogar beschrieben, vielleicht auch mystisch, aber was wusste er schon davon?
Ende der achten Klasse war er aus dem Religionsunterricht ausgetreten, vordergründig aus Glaubens- und Gewissensgründen, hintergründig auch, um am Donnerstagmorgen eine Stunde im Foyer der Schule rumlümmeln zu können. Kirchen betrat er in den letzten Jahren meistens mit Sonnenbrille im Haar und Reiseführer in der Hand, wenn er zwischen zwei Weingutsbesuchen etwas Zeit für Sightseeing freischaufeln konnte. War er eigentlich schon einmal hier gewesen? Der Sommelier hatte in der Gegend zwei Jahre Weinbau an der Uni Geisenheim studiert, aber er konnte sich nicht erinnern, dass er das Kloster – im Gegensatz zu den berühmten Weingütern der Abtei St. Hildegard oder des Klosters Eberbach – einmal aus der Nähe gesehen hatte. Es schien ihm, dass das Benediktinerinnenkloster wenig mit der Welt zu tun haben wollte.
Kurz vor dem Ziel wechselte die geteerte Straße zu Kopfsteinpflaster, die Fahrbahn säumten zahllose Eichen, am Ende der Allee kam der haushohe steinerne Torbau auf den Sommelier zu, der aus der Gründungszeit des Klosters stammte. Was waren das für drei Statuen, die den Torbogen zierten? Er hatte gestern noch im Internet über seine Auftraggeber recherchiert, aber viele Details schon wieder vergessen. Links des Tors setzte nahtlos der hohe Steinwall an, der zunächst an den südlichen Rebflächen entlangführte, aber angeblich das gesamte Gelände umfasste. Rechtsseitig war neben dem großen Tor für Fahrzeuge eine kleinere, metallbeschlagene Holztür für Fußgänger in den Stein eingelassen, darauf war ein Schild – mit den Gottesdienstzeiten? – angebracht. Daran schloss ein einstöckiges Gebäude an, das wieder in den Steinwall überführte.
Das Tor war geöffnet, der Sommelier fuhr hindurch. Ein Vogelschwarm stob aufgescheucht aus einem Buchsbaum davon und flog wellenförmig die gepflasterte Straße vor ihm entlang. Dahinter breitete sich ein Sprengsel aus gepflegten, barock anmutenden Gärten und zahllosen Steingebäuden aus, allesamt mit schwarzen schiefergedeckten Dächern. Die Gebäude waren allesamt auf die imposante Kirche in ihrem Zentrum ausgerichtet. Das Gotteshaus überragte mit seinen drei Türmen alle anderen Bauten. Links und rechts des Vestibüls strebten zwei Türme mit zahllosen Zwillingsfenstern und mit flachem Abschluss in die Höhe, ein größerer Turm mit achtseitigem Helm erhob sich über dem Chor, an dessen Mauerwerk sich eine Taube mit wild schlagenden Flügeln krallte und erfolglos Halt suchte. Die Spitze bildete eine Wetterfahne.
Die Kirche war aufwändiger gestaltet als die anderen Gebäude, mit Rundbögen, Bündelpfeilern und Halbsäulen, die in verzierten Kapitellen mündeten. Es gab Querhäuser mit Sattel- und Pultdächern, Nischen, Gesimse und Aussparungen – ein geometrisches Spiel aus Licht und Schatten, was die Tiefen noch tiefer und die Höhen noch höher machte. Benjamin fühlte sich klein und unbedeutend in der Gegenwart des Gebäudes, was wahrscheinlich auch eine Intention der Erbauer gewesen war. An den Eingangstoren der Kirche fotografierten sich gerade drei Freundinnen gegenseitig mit ihren Mobiltelefonen, sie trugen Trekkingklamotten und hatten Walkingstöcke in den Händen. Der Sommelier steuerte seinen Wagen auf einen geschotterten Stellplatz und parkte neben einem dunkelblauen Škoda, in dem ein bebrillter Mann geistesverloren seine Armatur anstarrte. Ein Stück weiter stützte ein alter Herr seine Frau, die Mühe hatte, aus dem Beifahrersitz des alten Mercedes aufzustehen.
Gerade wollte Benjamin pflichtbewusst Julia eine Kurznachricht schicken, dass er gut angekommen war – sie hatte ihn gestern mit Liebensentzug bestraft und war nicht mehr nach Breisach gekommen, sie hatten nur noch kurz vor dem Abendservice telefoniert –, da erschien in seinem Seitenfenster plötzlich eine Nonne. Unter ihrer schwarz-weißen Kopfbedeckung lag der Halbmond ihres fahlen Gesichts. Ihre Augen waren wässrig und blass und wurden von harten Zügen untermauert. Schmallippiger Mund, scharfkantige Nase, spitzes Kinn. In der Hand hielt sie ein Klemmbrett. Sie starrte den Sommelier streng an, fast ein wenig missbilligend. Benjamin ließ sein Telefon in seine Jackentasche gleiten und öffnete das Fenster.
»Sind Sie Herr Freling?«, fragte die Geistliche.
»Ja, guten Tag, ich bin …«
»Sie sind zu spät. Ich bin Schwester Edith.«
»Ich wusste nicht, dass wir einen Termin hatten«, sagte der Sommelier verblüfft und stieg aus.
»Ihre Ankunftszeit wurde mir von Herrn Panagiotopoulos als elf Uhr mitgeteilt.« Den Namen von Pana sprach sie dabei mit solcher Geschwindigkeit aus, als wäre Griechisch ihre Muttersprache.
»Das ist richtig, ich hatte Pana gesagt, dass ich um elf Uhr … Aber ich wusste nicht, dass …«
»Unterschreiben Sie bitte hier«, unterbrach ihn Schwester Edith und hielt ihm das Klemmbrett hin, auf dem mit Bleistift eine zweispaltige Tabelle eingezeichnet und anscheinend mit einem Computer der heutige Tag und die Zeit elf Uhr exakt in den Zwischenraum der ersten Zeile gedruckt worden war. Wobei sie die ursprüngliche Uhrzeit wieder durchgestrichen und handschriftlich durch elf Uhr vierzig ersetzt hatte.
»Was ist das?«, fragte er.
»Ich habe eine Stundenliste für Ihre Tätigkeit angelegt.«
»Eine Stundenliste?«
»Ja, ich will, dass Sie dieses Dokument später als Basis Ihrer Abrechnung nehmen.«
»Wir haben ja noch nicht einmal über ein Honorar …«, begann der Sommelier, brach den Satz ab, holte Luft und setzte neu an. »Hören Sie, Schwester Edith«, sagte er, zog die Augenbrauen nach oben, bis sie seinen Haaransatz kitzelten, und lächelte so herzgewinnend, laienfromm und entwaffnend, wie er nur konnte. »Sollen wir zuerst einmal einen Blick in den Keller werfen? Vielleicht kommt die ganze Sache hier ja nicht einmal auf eine ganze Stunde …«
»Ich führe Sie hin. Ich bin aber in Eile, muss in zwanzig Minuten bei der Mittagshore sein. Ich sorge dafür, dass Sie Gastschwester Agnes um halb eins abholt und Ihnen ihre Gastzelle zeigt.«
»Alles klar.«
Die Nonne schwang herum, unter dem Saum ihres knöchellangen Gewandes ragten ihre Füße hervor. Sie trug schwarze Strümpfe und Sandalen und ging stramm über den Kiesweg, der unter ihren Schritten knirschte – hatte Pana hier gestern die Kisten eingeladen? Benjamin folgte der Dame, die nicht ins Zentrum der Gebäude lief, sondern sich nach links wandte und einen Weg durch einen kleinen heckenumzäunten Garten nahm. Sie gingen ein kurzes Stück parallel zu der südlichen Umfassungsmauer, die sich drei Mann hoch neben dem Sommelier erhob und in die nur an einer Stelle ein Gittertor zu den Weinbergen eingelassen war. Schweigend passierten sie ein längliches, hohes Gebäude mit vergitterten Fenstern. Dahinter befand sich wieder ein Garten, eingerahmt durch zweistöckige Bauten mit Kassettenfenstern. Doch anstatt nach oben zu steigen, nahm Schwester Edith eine kurze Steintreppe, die unter das Gebäude führte. Benjamin folgte ihr.
Das Tageslicht wurde fast vollständig verschluckt, kaum dass sie die Kellerräume betreten hatten. Der Sommelier erkannte dunkle Umrisse von Tausenden Flaschen, die leer und gefüllt in Gitterboxen und Regalen lagerten. Französische Weine konnte Benjamin auf den ersten Blick nicht entdecken. Es schienen vielmehr alles dieselben Tropfen zu sein, die einmal zu dem alten Weingut gehört hatten. Man durfte es nicht zu laut sagen, aber er hatte das erste Mal von dem ehemaligen Weingut Marienwingert gehört, als er gestern auf der Internetseite davon gelesen hatte. Sollte er auch diese Weine schätzen? War das der Keller, weswegen er hergekommen war? Er hatte keine Zeit zu fragen, geschweige denn, sich in Ruhe umzusehen, denn die Nonne marschierte unbeirrt weiter und wandte sich rechts. Sie ging einen langen Gang entlang, zu beiden Seiten flirrten Nischen und Türen und Kammern an Benjamin vorbei, bis sie schließlich zu einer steinernen Wendeltreppe kamen, die sich wie ein Brunnenschacht in den Boden schraubte.
Sie stiegen nach unten, mit jedem Schritt wurde es etwas kühler. Der Sommelier zog den Reißverschluss seines Parkas zu. Die Stufen waren schief, hatten unterschiedliche Höhen und waren besonders in der Mitte abgetreten und ausgehöhlt. Das Licht war schlecht, da nur an einem offen verlegten Stromkabel alle paar Meter eine Wandleuchte anknüpfte. Ein Geländer gab es nicht, aber immerhin war ein straffes Seil mit dicken Eisenringen an die Wand montiert worden. Schwester Edith drosselte trotzdem ihre Geschwindigkeit, aber lief immer noch schneller, als Benjamin sich zugetraut hätte. Sie wartete auf ihn am Grund der Treppe. Das Klemmbrett hielt sie seitlich, fest in der rechten Hand, ihren linken Arm hatte sie vor ihrem Bauch angewinkelt, die Hand zu einer Faust geballt. Auf dem Boden neben ihr stand eine große, brennende Grabkerze, daneben eine Marienfigur. Die Metalltür im Rücken der Nonne stand einen Spalt offen, das Schloss war anscheinend in einem Halbkreis herausgeflext worden.
»Oje, was ist denn hier passiert?«, fragte Benjamin.
Schwester Edith senkte ihren Kopf. »Wir haben Schwester Rosalda gefunden, als es für sie bereits zu spät war. Sie hätte in ihrem Alter diese halsbrecherische Treppe nicht mehr hinabsteigen dürfen.«
Benjamin blickte peinlich berührt auf die Devotionalien, tänzelte kurz von einem Bein auf das andere, hatte er mit seiner Frage doch eigentlich auf die demolierte Tür abgezielt. Kerze und Figur waren für ihn zunächst nur, nun ja, Dekoration gewesen. »Oh, das tut mir leid, ich …«, stammelte er, ahnungslos, wie man einer Nonne kondolierte, weswegen er »Mein Beileid« murmelte und schließlich in einen sachlichen Tonus schwenkte: »Das wusste ich nicht, ich meinte eigentlich das kaputte Türschloss.«
»Wir konnten ihren Kellerschlüssel nirgends finden«, entgegnete Schwester Edith, ohne sich umzusehen. »Sie können also den Keller betreten, wie es Ihnen passt.«
Der Sommelier wunderte sich. Warum war die Nonne vor ihrem Tod ohne Schlüssel in den Keller gestiegen? Vergesslichkeit? Aber man fuhr ja auch nicht an den Flughafen, ohne dreimal zu kontrollieren, ob man seinen Ausweis eingepackt hatte. Das tat er zumindest. Und der Weg hier runter war vergleichbar, so abgelegen, wie der Zugang war. Nur reiste man nicht in die Ferne, sondern in die Tiefe. Die Priorin zog die Tür auf. Die Scharniere quietschten und knarzten. Die Nonne ging etwas zur Seite und ließ Benjamin den Vortritt. Mit leicht eingezogenem Kopf ging er durch den halbhohen Torbogen. Es war dunkel, nichts zu erkennen. Er wandte sich um. Schwester Edith drehte an einem Lichtschalter an der linken Seitenwand. Es knackte laut in der Mechanik und wurde Licht.
Der Sommelier fand sich in einem Raum wie in einer Gruft wieder. Leere, ausgemauerte Nischen befanden sich rechts und links. Er kniff die Augen zu, zog den Kopf ein und ging durch einen Durchgang in den zweiten Raum. Lichtnester verteilten sich durch das Gewölbe, es war schummrig, teils finster, weswegen er nach seinem Mobiltelefon tastete und die Taschenlampenfunktion aktivierte. Die Nischen waren nicht mit Särgen gefüllt, nein, hier wurden offensichtlich Weine beigesetzt. In mehreren Reihen übereinander lagerten unzählige Flaschen an den Wänden. Kisten stapelten sich auch auf dem Boden, Großflaschen standen schemenhaft in Durchgängen. Benjamin stockte der Atem. Urplötzlich spürte er die Aufregung in sich aufwallen, eine eiserne Klaue, die seinen Magen walgte.
Kurzatmig leuchtete er hierhin, leuchtete dorthin, er musste die Namen der Weingüter nicht einmal lesen, ein Blick auf die Typografie der Flaschenetiketten oder die Brandzeichen auf Holzkisten genügte völlig. Wie viele Weine lagen hier unten? Zehntausend? Fünfzehntausend? Der Sommelier wischte Staubschichten von Etiketten, nahm die eine oder andere Bouteille heraus, wiegte sie so sanft und behutsam wie ein Neugeborenes in den Händen. Er las die Jahreszahlen – 1899, 1923, 1945, 1961, 1989 –, und erst als von weit her, durch Tonnen von Stein, dumpfe Glockenschläge und schließlich ferner Chorgesang erklangen, bemerkte er, dass Schwester Edith längst verschwunden war.
Drei
Benjamin Freling setzte sich auf die unterste Stufe der Wendeltreppe, stützte seine Ellenbogen auf seinen Beinen ab und starrte durch die offene Kellertür. Er war sprachlos. Überwältigt. Ganz lull und lall. Er kannte natürlich die Geschichten von sagenumwobenen Weinfunden, die für einen Weinliebhaber nicht weniger aufregend waren als die Entdeckung des Bernsteinzimmers für einen Archäologen. Er hatte auch von unzähligen Wein-Schatzkammern gehört, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts gehoben wurden. Wenige waren es nicht gewesen: Hatte sich ein wohlsituierter Haushalt in den Fünfzigerjahren oder früher nur einen kleinen Vorrat an ordentlichen bis sehr guten Bordeaux-Weinen zugelegt, so stiegen je nach Weingut und Jahrgang bald die Preise um das bis zu Vierzigfache. Grund war unter anderem die rasant steigende Nachfrage aus den USA. Eine Entwicklung, die eine Vielzahl an Weinjägern auf den Plan rief. Vorwiegend in England und Frankreich wurden Keller auf links gedreht, allerhand Schätze gehoben und saftige Provisionen eingestrichen.
Natürlich gab es solche Funde auch heute noch, auch wenn sie weniger spektakulär ausfielen. Verwandte lösten die Weinsammlung ihres trinkfreudigen verstorbenen Onkels auf. Hier wurde mal ein schönes Sortiment an alten Portweinen entdeckt, dort ein paar tolle französische Burgunder oder italienische Barolos. Freling hatte auch schon einmal erlebt, dass ihm ein Gast eine 1959er Kiedricher Gräfenberg Riesling Auslese von Robert Weil mit ins Restaurant brachte, um sich zu erkundigen, ob der Wein noch trinkbar sei. Der Sommelier kaufte ihm die Rheingauer Köstlichkeit für fünfhundert Euro ab und verkaufte sie für das Doppelte. Aber was hier unter dem Kloster lag, hatte eine andere Dimension. Er hatte gerade eine Ansammlung der berühmtesten Weine der Welt in Augenschein genommen, von Romanée-Conti, Coche-Dury, Le Pin, Cheval Blanc bis hin zu Margaux, Haut-Brion, Mouton Rothschild oder d’Yquem. Woher stammten diese Weine? Weshalb wussten die Nonnen nicht über den Wert Bescheid? Hatte vielleicht der Kellermeister des Klosterweinguts hier Weine eingelagert? Oder besser gesagt: eine atemberaubende Weinsammlung anlegt?
Von manchen Weingütern hatte Benjamin nämlich auch beispiellose Vertikalen gefunden, also eine ganze Reihe mehrerer aufeinander folgender Jahrgänge. Allein vom Château Lafite hatte er nahezu vierzig Jahrgänge gesehen, darunter sogar 53er, 59er, aber auch Jahrgänge, die bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichten. Aus dieser Zeit gab es freilich nur noch Einzelflaschen, die aber dann aus der Prä-Phylloxera-Phase stammten, bevor die Reblaus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die europäischen Weinanbaugebiete wie ein Krebsgeschwür befiel und systematisch die Rebflächen zerstörte. Weine vor oder aus dieser Zeit waren heute so gut wie nicht mehr zu bekommen. Auch der Sommelier hatte noch nie einen solchen Wein getrunken, weswegen ihm beim Anblick des 1868ers, der in einer samtgefütterten Schmuckschatulle lag, fast die Augen überquollen. Einmal die berühmte Süße des Todes erleben, dafür würde der Sommelier viele Entbehrungen auf sich nehmen: die große, süße Entfaltung eines uralten Weins, bevor er kippte und ungenießbar wurde.
Während der erste und zweite Raum der Gruft geschröpft waren, nur vereinzelt Doppelmagnum-Flaschen herumlagen – hatten die Schwestern etwa einfach in das erstbeste Fach gegriffen, wenn sie einen Wein brauchten, und einen Bogen um Großflaschen gemacht? –, waren die übrigen fünf Gewölbekeller randvoll und wirkten unangetastet. Hier und da fand der Sommelier zwar einen hervorgewölbten Korken oder eine Flasche, deren Inhalt um mehr als ein Drittel geschrumpft war, sieben von zehn Flaschen des 1969er Château Corton Grancey waren auch komplett ausgelaufen, aber trotzdem schienen die Tropfen ideal gelagert. Der Keller war kalt, größtenteils mit großflächigen Platten ausgelegt und wirkte trocken, mit leichter Luftfeuchte. Es roch nach kaltem Stein und abgestandener Luft, aber nicht nach schimmligem Kellermuff. Während drei Gewölbe mit größeren Aussparungen hauptsächlich mit Kisten gefüllt waren, gab es noch zwei Räume mit zahlreichen kleineren Aussparungen, in denen Unmengen an Flaschenweinen liegend gelagert wurden, sodass der Korken nicht austrocknen konnte.
Nur ein einziges Fach in diesen Räumen war leer. Die Staubschicht und die Flaschenabrücke ließen darauf schließen, dass hier erst kürzlich mehrere Weine entnommen worden waren, aber daneben und darüber stapelten sich deutsche Trockenbeerenauslesen von Egon Müller, es gab portugiesischen Madeira und südafrikanischen Constantia sowie allerhand Champagner aus drei Jahrzehnten oder eine bunte Sammlung von Einzelflaschen aus zwei Jahrhunderten. Oder waren sie vielleicht noch älter? Bei manchen Bouteillen waren die Etiketten so vergilbt, dass der Sommelier sie nicht entziffern konnte. Er war im feuchten Traum eines Weinfreaks gelandet.
Auch die Sammlung an deutschen Rieslingen war beeindruckend, stammte aber vorwiegend aus dem Rheingau, aus Rheinhessen oder von der Nahe, es gab Weine von Johannisberg, Breuer, Diel, Emrich-Schönleber oder Dönnhoff. Der Sommelier fand auch eine Jahrgangstiefe von dreiundzwanzig Ars Magna-Rieslingen vom Weingut Wilmerding aus Rheinhessen, die vom Jahr 2000 bis ins Jahr 1977 reichten. Benjamin kannte die Juniorchefin gut, sie hatten gemeinsam Weinbau studiert. Mittlerweile hatte sie den Betrieb übernommen und ihn zu einem der bekanntesten deutschen Weingüter aufgebaut, ohne an der betörenden Qualität der Weine etwas zu ändern. Das ließ sich auch an den Preisen ablesen: Waren die Ars Magna-Rieslinge vor zehn Jahren mit dreißig Euro pro Flasche schon teuer gewesen, lagen sie heute beim Zwanzigfachen. Hatte der Weinsammler lange vor der Fachpresse das Potenzial der Tropfen erkannt?
Benjamin hörte Schritte hinter sich. Er erhob sich schwerfällig. Seine Glieder waren in der Kälte etwas steif geworden. Er blickte gespannt in den Treppenaufgang. Nur kam niemand. Die schabenden Geräusche von Füßen auf Stein nahmen kein Ende, wurden nur lauter. Freling schmunzelte, so stellte man sich den dramatischen Auftritt des Heiligen Geistes vor, mindestens aber eines Untoten oder einer Spukgestalt. Doch die Nonne, die schließlich ums Eck kam, war vielleicht so bleich wie ein Gespenst, ansonsten aber quicklebendig, weit von jedem furchteinflößenden Wesen entfernt und vielmehr feenhaft. Der Sommelier konnte ihr Alter kaum schätzen. War sie dreißig? Vierzig? Älter? Sie hatte keine Falten, volle rosafarbene Lippen, ein rundes Gesicht, eine Stupsnase mit Sommersprossen und freundliche saphirblaue Augen. Ihre Haare waren unter ihrer Haube verborgen, dabei hätte Benjamin zu gerne einen Blick auf ihre Haarfarbe geworfen, ihre Augenbrauen waren nämlich von einem einprägsamen Weißblond.
»Oh, sind Sie schon fertig?«, fragte die Frau erstaunt, als sie Benjamin vor den Türen des Kellers erblickte.
»Ich musste nur kurz durchatmen.«
Die Nonne warf ihm einen mitfühlenden Blick zu. »Es ist sehr eng und stickig dort drinnen«, sagte sie. »Ich bin Schwester Agnes.«
»Benjamin Freling«, erwiderte der Sommelier. »Darf ich gleich mal eine Frage loswerden: Sind die Räume so etwas wie eine alte Totenstätte?«
»Das ist korrekt. Es ist die alte Gruft der Stifterfamilie der Abtei. Wenn sie aber als Begräbnisstätte genutzt wurde, dann ist das Jahrhunderte her. Können Sie schon sagen, ob die Weine etwas wert sind?«, fragte die Gastschwester neugierig.
Der Sommelier lächelte. Er wollte unwillkürlich die Korken knallen lassen, eine der Flaschen 1996er Jaquesson Avize Champ Caïn köpfen, die er gesehen hatte. Rarer Stoff eines außergewöhnlichen Jahrgangs. Er wollte Raketen zünden, mit der Nonne einen Boogie-Woogie tanzen und die fetteste Sause in der Geschichte des Klosters veranstalten. Er war in Goldgräberstimmung, denn das hier war ein echter Knüller. Stattdessen räusperte er sich und antwortete sachlich: »Es sind gute Weine, aber ich muss das genauer prüfen. Wissen Sie, woher die Sammlung stammt?«
»Das müssen Sie besser eine der älteren Schwestern fragen. Die Weine waren bereits hier, als ich vor achtzehn Jahren ins Kloster kam. Das erste Mal war ich auch erst vor acht Jahren hier unten, als mir das Amt der Gastschwester übertragen wurde und ich Schwester Rosalda etwas unter die Arme gegriffen habe.« Sie kniff die Lippen zusammen und schlug die Augen nieder.
»Tut mir sehr leid für Ihre …« Kollegin, war das erste Wort, das Benjamin in den Sinn kam, er stutzte kurz und sagte dann: »Tut mir sehr leid für Ihre Ordensschwester, es sind auch gefährliche Stufen, ausgetreten, abgeschliffen, unterschiedlich hoch, da vertritt man sich schnell.«
»Schwester Rosalda war gut zu Fuß, ich bin jedenfalls öfter ausgeglitten als sie.«
»Ihre …« Wieder lag ihm das Wort Kollegin auf den Lippen, der Sommelier begann zu lachen. »Verzeihen Sie bitte, Schwester Agnes, ich will die ganze Zeit Ihre Kollegin sagen. Ein Kloster ist nicht das Habitat, in dem ich mich üblicherweise aufhalte.«
Die Nonne lächelte. »Kollegin ist nicht ganz falsch. Was wollten Sie sagen?«
»Schwester Edith erzählte mir, dass Sie den Keller aufbrechen mussten, weil Schwester Rosalda keinen Schlüssel bei sich hatte – sind Sie nicht in ihrem Zimmer oder Büro fündig geworden?«
Das Thema schien der Gastschwester nicht zu behagen, der Sommelier glaubte fast, einen gepeinigten Augenaufschlag im Gesicht der Frau zu erkennen. Ihre Stimme schrumpfte kurz zu einem heiseren Flüstern. »Da sprechen Sie was an«, sagte sie und fuhr in normalem Ton fort: »Schwester Rosalda trug ihren Schlüsselbund immer bei sich, sie hatte ihn an ihrem Gürtel befestigt, weil wir noch einige sehr schwere, lange Bartschlüssel haben, die sind für die Habittasche ungeeignet. Wir konnten ihn bislang nirgends finden, ich habe alles abgesucht. Ihr Amtszimmer und ihre Zelle habe ich zuerst auf links gedreht.«
Der Sommelier wollte es der Nonne nicht sagen, aber wer den Schlüssel an sich genommen hatte, hatte sich, bis die Tür aufgebrochen wurde, Zugang zu einer Schatzkammer verschafft. Er sah das leere Regalfach vor sich. »Wusste jemand, dass der Weinkeller existiert? Außer Ihren Ordensschwestern?«, fragte Benjamin.
Die Augen der Nonne irrten kurz umher, sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Haben Sie selbst auch Weine heraufgeholt?«
»Immer öfter in den letzten Jahren.«
»Wie viel Wein trinken sie denn im Kloster?«, erkundigte sich der Sommelier interessiert.
Die Nonne überlegte. »Wir zählen das nicht. Der tägliche Messwein natürlich, aber da reicht eine Flasche mehrere Tage. Und an Sonn- und Feiertagen trinken einige Schwestern ein Glas Wein zum Mittagessen. Hin und wieder holen wir auch einen Wein für den Bischof herauf. Ich schätze, wir brauchen vier, fünf Flaschen die Woche. Wenn Schwester Julanda trinkt, dann meistens eine Flasche mehr.« Die Gastschwester lächelte. »Jeder hat eben seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Warum fragen Sie?«
»Vier Flaschen die Woche also«, murmelte Benjamin gedankenverloren vor sich hin, ging kurz in den Keller und löschte das Licht. Er überschlug dabei die Zahl im Kopf, nahm lieber vier Flaschen als Rechnungsgrundlage und gab dem Jahr auch nur fünfzig Wochen – er wollte seine Nerven schonen. In achtzehn Jahren waren das … sechshundert Kisten oder dreieinhalbtausend Weine. Mit dieser Schätzung lag er wahrscheinlich nicht einmal schlecht. Wenn das Gewölbe voll gewesen war, wäre das die Menge, die in den ersten und in den halben zweiten Kellerraum gepasst hätte. Dreieinhalbtausend. »Warum trinken Sie denn nicht einfach die Weine aus Ihrem ehemaligen Weingut?«, fragte er.
Schwester Agnes blickte den Sommelier entgeistert an. »Die Weine trinken wir natürlich auch, aber nur zu besonderen Anlässen, an Feiertagen. Wir leben schließlich auch noch vom Verkauf dieser Weine, sind die beliebtesten Waren in unserem Klosterladen.«
Der Sommelier verspürte den Drang zu seufzen, aber er beließ seinen Gesichtsausdruck professionell undurchsichtig. »Und Sie holen immer die Weine aus dem zweiten Raum, so Stück für Stück, recht wahllos – korrekt?«
»Nein, natürlich nicht wahllos. Die Weißweine gebrauchen wir für die Messe, die Rotweine behalten wir unseren Gästen vor – oder an Namenstagen auch unseren Ordensschwestern.«
»Ich dachte, Messwein sei immer Rotwein.«
»Wegen Blut Christi? Das denken viele«, sagte Schwester Agnes lächelnd und schob ihre Hände in die Ärmel ihres Gewands. Auch Benjamin bemerkte, dass er allmählich zu zittern begann. Er trug unter seiner Jacke nur ein dünnes weißes T-Shirt und schob die Hände tief in die Taschen.
Die Nonne fuhr fort: »Schon im 15. Jahrhundert wurde Weißwein als Messwein zugelassen, das hatte ganz praktische Gründe. Das weiße Leinen der Altartücher und Kelchtücher war danach nicht mehr so verschmutzt.«
Der Sommelier nickte. »Können Sie sich erinnern, was für Weine Sie heraufgeholt haben? Die Namen der Weingüter vielleicht, Jahrgänge? Haben Sie Buch darüber geführt? Das Leergut werden Sie ja wahrscheinlich nicht mehr haben, oder?«
Die Nonne sah den Sommelier verstört an. »Das Leergut?«
Benjamin konnte ihre Skepsis verstehen. Dabei war die Frage nicht ganz so abwegig, wie sie schien: Um das Leergut in diesem Keller würden sich manche Weinfreaks die Köpfe einschlagen, sie würden die leeren Flaschen auf einer Sänfte in ihre Keller tragen und dort wie Trophäen in einer alarmgesicherten Vitrine ausstellen. Eine Skulptur von Michelangelo, eine Skizze von da Vinci oder ein handgeschriebener Reim von Goethe würde sie wahrscheinlich weniger in Verzückung versetzen als diese staubigen, leeren Bouteillen.
»Nein, das Leergut haben wir nicht mehr«, antwortete Schwester Agnes schließlich. »Es waren aber hauptsächlich französische Weine. Die waren aber nicht immer gut. Manchmal hatten wir so körnigen Kaffeesatz im Glas, manchmal auch Kristalle, sahen aus wie Salz.«
»Klingt wie Depot und Weinstein.«
Die Nonne zuckte die Schultern. »Ich kenne mich damit nicht aus, wir hatten mit unserem Gutsbetrieb so gut wie nichts zu tun. Sind Depot und Weinstein schädlich?«
»Nein, Depot und Weinstein haben vor allem gute Weine, ist ein Qualitätsmerkmal.«
»Oh«, entfuhr es Schwester Agnes.
»Wieso, was haben Sie damit gemacht? Doch nicht etwa weggekippt?«
»Nein, wir haben sie natürlich getrunken. Es wundert mich nur, weil die Weine nicht immer ein Genuss waren, sie rochen manchmal nach …« Die Nonne verstummte verlegen.
Benjamin glaubte, einen Anflug von Schamesröte im Gesicht der Ordensschwester zu erblicken, aber in dieser Düsternis konnte man auch einen Weiß- nicht von einem Roséwein unterscheiden. »Wollten Sie Schweiß sagen?«, fragte er schmunzelnd. »Moschus, Leder, Tabak?«
Schwester Agnes nickte mit zusammengekniffenen Lippen. »Das mag ich nicht so gerne.«
»Das dürften die Bordeauxweine gewesen sein«, überlegte der Sommelier.
Die Nonne zuckte ahnungslos mit den Schultern. »Ich habe deswegen gerne zu den Rotweinen in diesen halbrunden Flaschen gegriffen, die nicht so alt waren. Die haben mich an Himbeeren erinnert. Und die Weißweine waren immer toll, die waren immer so schön nussig, das gefiel mir sehr gut.«
»Das dürften dann die roten und weißen Burgunder gewesen sein«, murmelte der Sommelier und sah die erhabenen Lagen der Côte d’Or im Burgund vor sich, die Weine aus den Mauern am berühmten Weinberg Clot de Vougeots und von den Hügeln des Aloxe-Cortons – edle Tropfen wie Richebourg und Chambertin zum Sonntagsbraten? Erhabener Montrachet zur Morgenmesse? Was wurde in den letzten Jahren hier entkorkt? Die Welt war bisweilen schon ein lustiger Ort. Benjamin lächelte breit. »Ihren Messweinkelch würde ich mir gerne als Andenken mitnehmen.«
Die Nonne zeigte keine Regung. »Soll ich Ihnen Ihre Zelle zeigen?«
»Ja, sehr gern. Bevor ich hier weitermache, muss ich mir dringend einen dickeren Pullover anziehen und Taschenlampen im Tal besorgen. Nur noch eine Frage: Im dritten oder vierten Gewölbe ist ein Fach leergeräumt – haben Sie kürzlich eine größere Menge Flaschen aus dem Keller geholt?«
»Dort hinten war ich seit Jahren nicht. In den letzten Wochen dürfte auch nichts entnommen worden sein, der Keller war nach dem Tod von Schwester Rosalda für knapp drei Monate verschlossen.«
Vier
Nachdem ihn Schwester Agnes herumgeführt hatte, ging Benjamin kurz zu seinem Auto. Die Nonne begleitete ihn noch ein Stück, verabschiedete sich am Rand des Parkplatzes und ging eiligen Schrittes davon. Der Nebel hatte sich mittlerweile etwas verzogen, die Sonne war ein heller Fleck hinter einem Band aus Wolkenschleiern. Er nahm seine Sporttasche vom Rücksitz und blickte kurz auf die Uhr seines Mobiltelefons, da er einen Termin mit Schwester Edith hatte, um über sein Honorar zu verhandeln. In wenigen Minuten trafen sie sich im Speisesaal, weil das Amtszimmer der Priorin in den Klausurbereichen des Klosters lag, zu dem nur die dreiundvierzig Ordensfrauen Zutritt hatten. Wir brauchen diesen abgeschlossenen Bereich, um uns mit unserem geistlichen Leben auseinanderzusetzen, uns mit Zeitfragen und dem Zivilisationsstand zu beschäftigen, hatte Schwester Agnes ihm erklärt. Wie man sich allerdings mit Zeitfragen beschäftigen konnte, wenn man sich hinter Klostermauern verbarrikadierte, war dem Sommelier ein Rätsel.
Zumal bei Einbruch der Dunkelheit das gesamte Gelände endgültig vom Rest der Welt abgeriegelt wurde. Er hatte zwar einen Schlüssel für sein Gästezimmer bekommen, aber das Tor wurde am Abend verschlossen. Marienwingert musste danach einer Festung gleichkommen. Wahrscheinlich lebte die Gastschwester deswegen auch in dem Gebäude, das der Sommelier neben dem Einfahrtstor gesehen hatte. Kurz blickte er zum schiefergedeckten Haus mit Mansardendach, das einsam zwischen Torbogen und Umfassungsmauer stand. Auf einer Gaube hatte es sich eine Handvoll Tauben gemütlich gemacht, die dicht an dicht saßen. Schwester Agnes verschwand in diesem Augenblick in der Tür des Pförtnerhauses, so hatte es die Nonne vorhin genannt und ihm angeboten, wenn er einmal später zurückkehren sollte, könne er einfach ein Steinchen an das vergitterte Fenster werfen. Sie selbst sei immer bis weit nach elf Uhr wach. Benjamin schürzte die Lippen. Er hatte zwar fest vor, mit Lara und Pana abends ein paar Gläser Wein zu trinken, aber für gewöhnlich gingen diese Abende bis in die frühen Morgenstunden. Sollte er morgens um zwei eine Nonne aus dem Bett scheuchen? Wenn ihr Tag um fünf Uhr oder noch früher begann? Sie hatte ihn nämlich auch zum Morgengebet, der Laudes, um fünf Uhr dreißig herzlich eingeladen … Ein Angebot, das er herzlich dankend abgelehnt hatte.
Der Sommelier stieg die Treppe zum Eingang des Gästetraktes nach oben und brachte sein Gepäck in sein Zimmer. Es war ein schlichter, moderner Raum mit Bett, Schreibtisch und Schrank. Jesus hing gekreuzigt an der Wand über dem Bett, eine Bibel lag verheißungsvoll auf dem Nachttisch. Außerdem war eine winzige Nasszelle angeschlossen, mit Toilette, Duschkabine und Waschbecken. Vor allem der tiefe gemauerte Fenstersims verwies noch auf die alte Bausubstanz. Der Sommelier warf einen Blick durch die Kassettenfenster. Unter ihm breiteten sich nicht nur die rebengesäumten Hügel des Klosterbergs aus, wenn ihn nicht alles täuschte, dann befand sich zehn Meter tiefer der Eingang in den großen Weingut-Keller, durch den er vorhin mit Schwester Edith gegangen war.
Der Sommelier zerrte einen Kapuzenpulli aus seiner Tasche, überlegte kurz und zog dann zusätzlich noch ein karamellfarbenes Cord-Sakko hervor. Er musste schließlich gleich Gehaltsverhandlungen führen, war innerhalb eines Tages vom versoffenen Arbeitslosen zum suffgeschulten Solo-Selbstständigen geworden. Ein Hauch Seriosität tat da sicherlich gut. Also zog er sich das Sakko über den Kapuzenpulli, wischte sich einmal durch die Frisur und brach auf. Er hatte zwar noch ein paar Minuten, aber wollte schon einmal in Richtung Speisesaal gehen.
Fast etwas verschmitzt lugte er von einem Flurfenster in einen malerischen Innenhof hinab, der zum Klausurbereich gehörte. Es war ein quadratischer Platz, eingefasst von wuchtigen, gemauerten Arkaden. Die gesamte Mitte nahm eine große Rasenfläche ein, gespickt mit zahllosen identischen Sandstein-Findlingen – war das etwa der Klosterfriedhof? Im Zentrum stand eine hohe Trauerweide. Das Vogelgezwitscher, das aus den Ästen drang, war so laut, dass er es sogar durch die geschlossenen Scheiben hörte. Unter dem Baum saß eine alte Nonne auf einer Bank, eingepackt in einen knielangen Daunenmantel, und stickte mit solcher Inbrunst, dass Benjamin das Gefühl hatte, sie sei am Schöpfungsprozess selbst beteiligt.
Nachdem er die gut zehn Gästezimmer passiert hatte, ging er eine schmale Treppe nach unten und lief einen Gang entlang, dessen Wände gefliest und mit Gemälden und gerahmten Klosterfotos behängt waren. An einer schweren hölzernen Schwingtür blieb Benjamin stehen. Ein Schrubber war wie ein Keil zwischen Türknauf und Wand geklemmt, der Fußboden offensichtlich vor kurzem gewischt worden, aber weitestgehend abgetrocknet. Nur in einigen Mulden des Steinbodens stand noch etwas Wasser. Dahinter befand sich eine größere Küche älterer Bauart. Benjamin erkannte die Kante eines alten Gasherds, darüber stand auf einem Regal ein Arsenal an rußgeschwärztem Kochgeschirr, das mehr an ein französisches Landhaus als an ein Kloster erinnerte. Er blickte kurz auf die Uhr seines Smartphones und stieg dann kurzerhand über das Putzgerät hinweg. Pana hatte ihm geschrieben, ab Nachmittag vor Ort zu sein. Aber die einzige Person, die sich in der Küche aufhielt, war eine junge Nonne mit weißem Schleier, die zwischen Herd und Arbeitsblock kniete. Sie hatte das Sieb eines Bodenabflusses entfernt und schrubbte den Schwimmer.
Als sie ihn erblickte, warf sie ihm einen herzenskalten Blick zu, sah dann ertappt, fast etwas erschrocken über seine Schulter hinweg und wandte sich wieder ihrer Tätigkeit zu.
»Wer nur Befehle ausführt, findet keinen Gefallen bei Gott, der auch das Murren des Herzens wahrnimmt«, hörte er plötzlich eine Stimme hinter sich, die klang, als spreche sie eine universelle Wahrheit aus.
Es war Schwester Edith, die hinter ihm stand. Die junge Nonne verharrte einen Augenblick in der Bewegung, knallte dann die Bürste in einen Eimer mit Putzwasser, dass es nur so spritzte, und rannte wutentbrannt zu einem Seitengang hinaus. Der Sommelier hörte das Wirbeln ihrer Schritte, dann blitzte kurz Tageslicht auf. Wahrscheinlich hatte die Frau eine Tür aufgestoßen. Benjamin konnte es ihr nicht verübeln, die Priorin war Pestheilige und Rattenplage in Personalunion.
»Haben Sie sich in der kurzen Zeit einen Überblick über das Weinsortiment verschaffen können?«, fragte die Schwester und legte eine Ordnungsmappe auf einen alten Hackklotz, auf dem offensichtlich schon allerhand Fleisch zerhackt und flachgeklopft worden war, so rissig, wie das Holz war. Sie zog einen Füllfederhalter aus Plastik aus einem Lederetui, legte das Schreibgerät obenauf und faltete die Hände vor ihrem Schoß. »Können Sie also abschätzen, wie viele Tage Sie für Ihre Arbeit benötigen werden?«
»Es kommt ein wenig darauf an«, begann Benjamin, der sich gerade damit abfand, seine Gehaltsverhandlungen stehend in der Klosterküche zu führen. »Sie haben nicht zufällig eine Bestandsliste? Müsste auch nicht vollständig sein, aber irgendein Dokument, von dem ich wegarbeiten kann, das wäre sehr hilfreich.«
»Nein, damit kann ich Ihnen leider nicht dienen.«
»Dann kostet mich allein die Inventur zwei oder drei Tage. Danach muss ich die ungefähren Werte der Weine ermitteln, das ist vor allem bei den älteren Tropfen keine exakte Wissenschaft, aber ich kann Ihnen sicher eine Richtung nennen.« Der Sommelier holte kurz Luft, entdeckte dann in einem Regal hinter der Nonne, zwischen einem Dutzend Essig- und Ölflaschen, die halbvolle Flasche Château Trottevieille, die Pana während ihres Telefonats erwähnt hatte. Benjamin musste schmunzeln: Der Wein stammte aus dem legendären Jahrgang 1989. »Woher stammt denn die Sammlung?«, fragte er.
»Es war eine Schenkung«, erklärte die Nonne knapp.