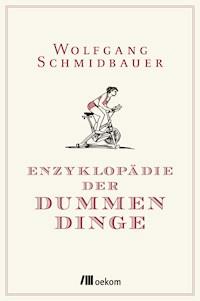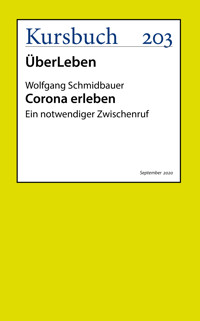9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Jede Erkrankung, vom banalen Schnupfen bis zum tödlichen Herzinfarkt, wird durch die geheimnisvolle Macht des Subjekts mitbestimmt. Aber sein Zugang und sein Einfluß sind nicht rational kontrollierbar, objektiv meßbar. Moralisierende, in Leistungszusammenhänge eingebettete «Übersetzungen» der Krankheit in eine lexikalisch geordnete Organsprache führen zu einer Selbst-Kolonialisierung der Subjekte, die in die Formel mündet «Ich weiß schon, es ist psychosomatisch». Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Fragen, die ein für allemal geklärt und dann abgeheftet werden können, stellen sich die Fragen nach unserem Schicksal und unseren Gefühlsbeziehungen immer wieder neu. Die Schwierigkeiten im Umgang mit eigener und fremder Krankheit liegen darin, daß die für einen möglichst schonenden und hilfreichen Umgang nötige Kreativität durch keine auch noch so brillante chemische, biologische oder psychologische Erkenntnis gewährleistet werden kann. Allenfalls kann man günstigere Bedingungen für diese Kreativität schaffen. Dazu soll diese Kritik der Psychosomatik nützlich sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
Die subjektive Krankheit
Kritik der Psychosomatik
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Jede Erkrankung, vom banalen Schnupfen bis zum tödlichen Herzinfarkt, wird durch die geheimnisvolle Macht des Subjekts mitbestimmt. Aber sein Zugang und sein Einfluß sind nicht rational kontrollierbar, objektiv meßbar.
Moralisierende, in Leistungszusammenhänge eingebettete «Übersetzungen» der Krankheit in eine lexikalisch geordnete Organsprache führen zu einer Selbst-Kolonialisierung der Subjekte, die in die Formel mündet «Ich weiß schon, es ist psychosomatisch».
Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Fragen, die ein für allemal geklärt und dann abgeheftet werden können, stellen sich die Fragen nach unserem Schicksal und unseren Gefühlsbeziehungen immer wieder neu. Die Schwierigkeiten im Umgang mit eigener und fremder Krankheit liegen darin, daß die für einen möglichst schonenden und hilfreichen Umgang nötige Kreativität durch keine auch noch so brillante chemische, biologische oder psychologische Erkenntnis gewährleistet werden kann. Allenfalls kann man günstigere Bedingungen für diese Kreativität schaffen. Dazu soll diese Kritik der Psychosomatik nützlich sein.
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für analytische Gruppendynamik. 1985 Gastprofessor für Psychoanalyse an der Gesamthochschule Kassel; Psychotherapeut und Lehranalytiker in München. Seine bekanntesten Bücher sind: «Selbsterfahrung in der Gruppe», «Die hilflosen Helfer», «Alles oder nichts», «Die Ohnmacht des Helden», «Helfen als Beruf», «Die Angst vor Nähe».
Inhaltsübersicht
Vorwort
Viel Kummer, viel Angst und Mißgunst, viel Erniedrigung, die andere uns und wir selbst uns und anderen zufügen, wären zu vermeiden, wenn wir eine bessere, eine spezifisch auf den Menschen zugeschnittene Krankheits- und Heilungslehre besäßen.
Alexander Mitscherlich[*]
Wo wir uns lebendig fühlen, verschwindet die Subjekt-Objekt-Spaltung, löst sich das distanzierende, analytische Denken in einer emotionalen Ganzheit auf. Immer treibt die Krankheit einen Keil in diese Ganzheit. Aber unser Umgang mit dieser Situation hat sich geändert: während die alte schamanistische und magische Heilkunde diesen Keil zu entfernen trachtet, schlägt ihn die objektivierende, naturwissenschaftliche Medizin noch tiefer ein, um ungestört von den ganzheitlichen Erlebnissen des Subjekts die objektivierbare Hälfte reparieren zu können. Um den Tod zu vertreiben, verbündet sich der Arzt mit seinen Attributen, mit Kälte, Distanz, Maß, Zahl und Funktion.
Die psychosomatische Medizin ist ein Versuch, dieser Ganzheit des erlebenden Subjekts wieder nahezukommen. Aber sie ist auch Medizin, oft naturwissenschaftlich geprägt, und wiederholt deshalb deren objektivierendes Vorgehen. Die Widersprüche und psychologisch faßbaren Belastungen, die auf diese Weise entstehen, will ich hier beschreiben. Der Anspruch, sich ihrer zu bemächtigen, löst die Ganzheit in Bruchstücke auf, wie die magischen Visionen des Märchens oder – aktueller – die touristisch erschlossenen Inseln der Südsee.
Das Subjekt verzweigt sich in seinen gefühlsbestimmten Erlebnissen bis in die letzte Zelle. Jede Erkrankung, vom banalen Schnupfen bis zum tödlichen Herzinfarkt, wird durch die geheimnisvolle Macht des Subjekts mitbestimmt. Aber sein Zugang und sein Einfluß sind nicht rational, kontrollierbar, objektiv meßbar. Man ist an die Unschärferelation der Physik erinnert: die Tiefe der subjektiven Erlebniswelt, ihre heilende (oder zerstörerische) Macht kann sich nicht gleichzeitig mit der Gesetzmäßigkeit des objektivierenden Wissens entfalten. Der in psychosomatischen Überlegungen enthaltene Versuch, Verlorenes wiederzufinden, läuft Gefahr, den Verlust noch zu verschärfen. Moralisierende, in Leistungszusammenhänge eingebettete «Übersetzungen» der Krankheit in eine lexikalisch geordnete Organsprache führen zu einer Selbst-Kolonialisierung der Subjekte, die in die Formel mündet «Ich weiß schon, es ist psychosomatisch». Es ist, als ob wir, des Nebels und der Dunkelheit draußen vor den Fenstern müde, Bilder und Diagramme an die Scheiben malen und nun glauben, wir hätten Klarheit gewonnen.
Mich selbst hat die Arbeit an diesem Text oft sehr betroffen, nicht nur, weil ich eine eigene «banale» Krankheit zum Gegenstand der Analyse machte und vor ihren Verzweigungen erschrak, sondern auch deshalb, weil die Reflexionen zur subjektiven/objektiven Krankheit meine eigene Doppelexistenz als Schriftsteller und psychoanalytischer Therapeut immer wieder berührten. Wie die Heilkunde in einer Spannung zwischen Kunst und Wissenschaft steht, so auch meine bisher bevorzugte literarische Ausdrucksform: das «Sachbuch», dem man im guten Fall eine Synthese von künstlerisch gefälliger Form und wissenschaftlich haltbarem Inhalt zubilligen mag. Im schlechten Fall ist es weder Fisch noch Fleisch. Mir ist deutlicher geworden, daß ich in dem prägbaren Alter von 21 Jahren deshalb aufhörte, meine poetischen Ziele weiterzuverfolgen, weil mich die handgreiflichere Macht wissenschaftlicher Abstraktionen mehr fesselte. Konkret sah das so aus, daß ich die brotlose Kunst des Gedichteschreibens aufgab und anfing, Artikel und Kongreßberichte für ein medizinisches Magazin zu verfassen. Damit setzte ich den Kompromiß fort, den die Entscheidung für das Psychologiestudium bereits enthielt. Ich wählte ein Gebiet, das die Freiheit der Kunst zusammen mit dem Machtgewinn des Wissens verspricht, dann aber Mühe hat, etwas zu halten, von wirkungsloser Spekulation und empirischer Banalität gleichermaßen bedroht.
Ich versuche im Text diesen Widerspruch nicht zu lösen, sondern mit ihm zu leben und ihn schrittweise genauer auszudrücken. So hoffe ich, auf mich selbst anzuwenden, was ich auch im Inhalt empfehle: genaue Beobachtung, Verzicht auf Macht, wo es möglich ist, Selbstbegrenzung in einem ganzheitsbezogenen, ökologischen Sinn. Daß Ökologie ein penetranter Modebegriff geworden ist, sollte uns nicht daran hindern, in dieser Richtung weiterzudenken, eher die Mode zu hinterfragen als uns ihrem Diktat zu beugen. Daß ich mich damals von der Poesie entfernt und der Psychologie zugewandt habe, war weder falsch noch richtig, sondern unausweichlich. Auf vielen, oft verworrenen Wegen, wissenschaftlich wie privat, habe ich doch eine genauere Kenntnis dessen gewonnen, was ich damals nicht wagte zu verfolgen.
Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Fragen, die ein für allemal geklärt und dann abgeheftet werden können, stellen sich die Fragen nach unserem Schicksal und unseren Gefühlsbeziehungen immer wieder neu. Die Schwierigkeiten im Umgang mit eigener und fremder Krankheit liegen darin, daß die für einen möglichst schonenden und hilfreichen Umgang nötige Kreativität durch keine auch noch so brillante chemische, biologische oder psychologische Erkenntnis gewährleistet werden kann. Allenfalls kann man günstigere Bedingungen für diese Kreativität schaffen. Dazu soll diese Kritik der Psychosomatik nützlich sein.
Der Schriftsteller ist einer der letzten einzelgängerischen Produzenten in dieser hochorganisierten Welt. Aber auch er schuldet äußeren Anregungen viel, die er verarbeitet. Ich denke an befreundete Ärzte: Almut Gruber, Lore und Siegfried Gröninger, Hans Kemper, Walter Reiß, Christoph Pirker, Till Bastian, Hubertus von Braunmühl, Jürgen Götte mit denen ich diskutieren und an deren Vorstellungen ich mich teils reiben, teils bilden konnte. Die Namen der Patienten will ich nicht nennen, deren Lebensgeschichte mir zugänglich wurde. Ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich. Sicher hilfreich waren auch die zehn Jahre (1961–1971) intensiver Mitarbeit an dem Ärztemagazin «Selecta». Wenn schließlich ein Medizinkritiker und kein Medizinredakteur aus mir geworden ist, liegt es nicht an einem Mangel an Toleranz und Förderung von seiten meiner damaligen Chefs, Erdmuthe und Ildar Idris. Die Anteilnahme und das Interesse der Kollegen vom Fachbereich I der Gesamthochschule Kassel während meiner Gastprofessur im Sommer 1985 haben mich ermutigt, meinen Überlegungen zu einer Selbstbegrenzung der naturwissenschaftlichen Zudringlichkeit weiter nachzugehen – schließlich gibt es dort auch Pädagogen wie Heinrich Dauber, die das «Recht auf Ungezogenheit» fordern[*].
Mein Lektor Hermann Gieselbusch hat sich in den letzten acht Jahren aufmerksam und tolerant um meine Arbeit gekümmert. Sein geduldiges Ausharren auf seinem sicher oft schwierigen Platz im Verlag hat es ihm ermöglicht, Autoren über längere Zeit zu betreuen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Seine Achtung vor der Subjektivität des Autors in einer Welt, die der Objektivität von Absatz und Umsatz soviel mehr Aufmerksamkeit schenkt, hat mir viel bedeutet und mir geholfen, meinem persönlichen Stil näherzukommen. Gudrun Brockhaus hat viele meiner Gedanken mit mir diskutiert und mir die Schwachpunkte meiner Argumente scharfsinnig gezeigt, ohne daß ich jemals das Gefühl verlor, unterstützt und bereichert zu werden.
München, Herbst 1985
W.S.
Einleitung
«Wenn einer dieser Bekannten aus der Psychoszene mich besucht hat und sagte: ‹Du weißt ja, der Krebs hat psychosomatische Ursachen, und was hat das wohl mit deiner Ehe zu tun …›, dann ist es mir den ganzen Tag schlechtgegangen. Ich soll ausgeglichen und ruhig sein, das ist gut fürs Gesundwerden, sagen alle – aber wie mache ich das?»
Mora (vgl. S. 221ff)
Äußerungen wie diese sind ein Anlaß gewesen, dieses Buch zu schreiben. Es wendet sich an die Opfer solcher Redensarten wie an ihre Urheber. Die psychosomatische Denkweise in der Medizin ist aus dem Ungenügen an der technisch-naturwissenschaftlichen Einseitigkeit entstanden. Die leibseelische Ganzheit, das Subjekt, sollte wieder eingeführt und ernst genommen werden. Aber mir scheint, daß die Psychosomatik das Schicksal jenes frommen Predigers teilt, der zum todkranken, ungläubigen Versicherungsmakler gerufen wird: Am Ende bleibt der Kaufmann gottlos, der Pfarrer aber schließt eine Versicherung ab. Aufgeklärte Mitglieder der Gesundheits- und Sozialberufe wagen inzwischen kaum mehr, durch unbefangenes Schildern ihres Schnupfens, ihrer Angina, ihrer Magenschmerzen oder asthmatischen Beschwerden Zuwendung, Schonung und Rücksicht zu erbitten. «Ich weiß schon, es ist psychosomatisch», sagen sie mit zusammengebissenen Zähnen, um eindringliche Fragen abzuwehren.
Jüngst haben amerikanische Forscher in aufwendigen Doppelblindversuchen nachgewiesen, daß Handauflegen Schmerzen lindert, Blutwerte verändert (den Hämoglobinspiegel) und auch kranke Labormäuse und beschädigte Pflanzen schneller heilen läßt.[*] Ich finde solche Beweisführungen eher komisch: Naturwissenschaftler versuchen, die Wirkungen poetischer Gesten zu objektivieren.
Viele Psychosomatiker beklagen den hartnäckigen Widerstand der Organmedizin gegen ihre Auffassungen. «Neben Bäderkunde ist jetzt ‹Seelenkunde› aller Richtungen gelegentlich als Alibi zugelassen», sagte Alexander Mitscherlich vor fast zwanzig Jahren. «Wahrscheinlich empfinden das die Bosse der 200-, 300-, 400-Betten-Kliniken als Selbstbeschwichtigung und Beweis ihrer Fortschrittlichkeit. Doch keine ins Gewicht fallende Entscheidung in diesen Großbetrieben wird heute unter psychosomatischen Gesichtspunkten getroffen.»[*] An dieser Situation hat sich nicht viel geändert. Die großen Ärztekongresse handeln nach wie vor längst in ihren psychosomatischen Zusammenhängen erkannte Krankheiten wie Magenulkus, Asthma und Rheuma ab, als ob diese Betrachtungsweise bedeutungslos wäre.
Vielleicht ist es an der Zeit, diese Widerstände nicht nur zu beklagen, sondern sie zu analysieren, ihre Entstehungsbedingungen zu untersuchen. Meine Kritik an der Psychosomatik ist kein Versuch, die traditionelle Gleichgültigkeit der (angeblich) naturwissenschaftlichen Medizin mit neuen Argumenten zu stärken, sondern eher einer, zu verhindern, daß die Psychosomatik am Ende das Schicksal der Organmedizin teilt. Alexander Mitscherlich hat sich an die «denkgewohnten Mitmenschen» gewandt, weil er von der Ahnungslosigkeit und Ablehnung der Ärzte genug hatte.[*] Aber selbst wenn die Ärzte von brennendem Interesse an ihr erfüllt wären: die Psychosomatik ist eine zu wichtige Sache, um sie den herrschenden Formen des Expertentums anzuvertrauen.
So versuche ich, mit den Mitteln des Sachbuchs die verschütteten Zugangswege zu einer genauen, autonomen Wahrnehmung des eigenen Körpers in Gesundheit und Krankheit wieder freizulegen. Das heißt, ich spreche auch für einen Verzicht auf Machen und auf Macht, um wieder unverstellt zu sehen und vielleicht eigene Wege zu einer heilsamen Veränderung zu entdecken. Das inhaltliche Material soll diesen Prozeß fördern. Die Untersuchung der Hypochondrie (Kapitel 1) lehrt, wie eine dem unmittelbaren Kontakt mit der sozialen und natürlichen Umwelt entfremdete Subjektivität «draußen», in Krankheitsbeschreibungen, oder «drinnen», im ängstlichen Festhalten von Mißempfindungen einen neuen Halt sucht. Die Betrachtung schamanistischer und magischer Krankheitsauffassungen (Kapitel 2, 3, 4) ermöglicht vielleicht eine kritische Distanz zu unseren machthungrigen Objektivierungen.
Während der Arbeit an diesen Texten wurde mir zunehmend klarer, daß die Vernachlässigung der subjektiven Krankheit und die Gefahren der Psychosomatik nur zum Teil rational aufgeklärt und zum Gegenstand einer sozialpsychologischen Untersuchung gemacht werden können. Diese Gefahren hängen eng mit unserem verzerrten und gefährlichen Wissenschaftsverständnis zusammen – mit der Ausgrenzung und Entmachtung ganzheitlicher Verständnisformen wie der Kunst und der Poesie. Ich versuche, diesen Gesichtspunkt durch die Beschreibung Georg Groddecks und seiner «wilden Psychoanalyse» im Gegensatz zu den modernen, von ihren poetischen Elementen gereinigten Auffassungen der Medizin und Psychologie zu verdeutlichen (Kapitel 5, 6, 7, 8). Denn die Psychosomatik krankt an ihrer Suche nach einer lexikalisch faßbaren, starren «Organsprache», während es nur sozusagen schriftlose, künstlerisch faßbare Organdialekte gibt. Die kaum mehr überschaubare Vielfalt von Psychotherapieformen hängt sicherlich damit zusammen. Wissenschaftler bauen in anderer Weise aufeinander auf als Künstler. Die Möglichkeit, den Sinn von Krankheiten zu erfassen, ihre biographischen und sozialen Bedeutungen zu verstehen, ist nicht ohne einen jeweils nicht objektivierbaren und vorhersagbaren «Neubeginn» (der Begriff stammt von Michael Balint) hilfreich. Wo Psychosomatik anfängt, die Subjekte zu bevormunden und zu unterdrücken, ist Schweigen besser als Reden, Unwissenheit besser als Wissenschaft.
Die Naturforschung in der Moderne machte den Menschen in einer unvorhersehbaren Weise zu einem Gegenstand, der ohne jede Selbstbegrenzung analysiert wurde. «Das ist ein neuer, die Epoche charakterisierender Aspekt: die durch nichts gehemmte Zudringlichkeit. Man wagt diese Leidenschaft, die zu außerordentlichsten Anstrengungen in den Naturwissenschaften und zu gründlichster Veränderung der Welt geführt hat, kaum zu kritisieren. Denn ohne Zweifel handelt es sich um eine Leidenschaft; aber es läßt sich auch nicht leugnen, daß ihre Organisationsstufe ziemlich primitiv ist. Legt man die Entwicklungsstufen der Libido zugrunde, so müssen wir dem Verhaltensstil der Forscher ebenso wie vieler anderer Zeitgenossen entnehmen, daß ihre Leidenschaften voyeuristischer Art sind … Zum Fortschritt der Kultur gehört also auf der Ebene der Affekte und ihrer Gestaltung durch das Kollektiv ein Rückschritt … So daß man zu der betrüblichen Einsicht kommt, aller wissenschaftliche Fortschritt habe nicht eigentlich zur affektiven Entwicklung der Menschheit beigetragen … Die aus den objektivierenden Forschungsverfahren stammenden Einsichten [haben] keine Humanisierung der Menschheit bewirkt. Revolutionen und Kriege sind nicht seltener geworden. Die Medizin verfügt zwar über eine hochentwickelte Methode der Diagnose und staunenswerte operative Techniken, aber auch sie humanisiert sich deswegen keineswegs, vielmehr versteht sie ihre Patienten weniger und weniger.»[*]
In seinen an Aussagekraft von keinem späteren Werk übertroffenen Studien zur psychosomatischen Medizin hat Mitscherlich diese Situation vorausgeahnt. Er hoffte, die Psychoanalyse würde endlich doch durch viele Nadelstiche den Dinosaurus der Medizin in eine andere Richtung bringen. Heute scheint es mir notwendig, auf die Gefahr hinzuweisen, daß dieser Dinosaurus seinen Herrschaftsbereich auch auf Gebiete ausweitet, die ihm bisher verschlossen blieben, nur um der Einsicht in die Grenzen seiner Macht zu entfliehen. In den Kapiteln über «Antipsychosomatik» und in der Dokumentation eines Konfliktes zwischen psychotherapeutischer Autorität und Widerspenstigkeit des Subjekts (Kapitel 9, 10) gehe ich dieser Frage nach. Vielleicht ist es übertrieben, schon jetzt darauf hinzuweisen, wie drohende Gefahren von Umweltverseuchung und Allergie dadurch heruntergespielt werden, daß sich die Psychosomatiker plötzlich in der Rolle von Experten finden, die widerspenstigen Kranken deren nur allzu berechtigte Angst vor den Schattenseiten unseres chemisch so gut versorgten Alltags austreiben sollen. Aber Müdigkeit, depressive Verstimmung, häufige Kopfschmerzen sind nicht immer nur das Leitsymptom gestörter Erlebnisverarbeitung, sondern können auch durch zu hohe Formaldehyd-Konzentrationen in der Atemluft entstehen, um nur ein Beispiel zu nennen.
Seit so viel von AIDS geschrieben und gesprochen wird, mache ich mir Gedanken über die psychosomatische Seite dieser Virusinfektion, die vor allem emotional belastete Randgruppen der Gesellschaft trifft: promiskuitiv lebende Homosexuelle, Fixer, Prostituierte. Eine Lebensform ohne feste Bindungen ist meiner Erfahrung nach stärker von Krankheit bedroht. Die körpereigene Abwehr wird von unserem Erleben intensiv beeinflußt. Um ihre Leistungsfähigkeit geht es bei der heute zum Gespenst stilisierten AIDS, der Analogie zum Waldsterben in der Welt der Krankheit. Denn auch bei den Bäumen ist nicht ein Faktor für die Schäden verantwortlich, sondern das Zusammenwirken vieler schädlicher Einflüsse.
Ich halte es für sinnvoll, diese Vermutung vorsichtig zu formulieren und die grassierenden Schuldzuschreibungen, die jedes mit dem Geschlechtsleben verbundene Leiden auf sich zieht, nicht um eine neue Variante zu bereichern. Andererseits finde ich es blind, wenn in Fernsehdiskussionen immer nur von Viren, Immuntests, T-Lymphozyten die Rede ist und nicht davon, daß es in Afrika schon längst Bevölkerungen gibt, die mit diesem, wie es heißt, tödlich bedrohenden Virus so leben wie wir mit unseren Grippeerregern. Aber hundert Dichter und tausend Psychotherapeuten können Geschichten erzählen, die eindeutig zeigen, daß die Immunabwehr erlebnisabhängig ist – für die Immunologen sind das unwissenschaftliche Erklärungsversuche: das körpereigene System der Krankheitsabwehr funktioniere unabhängig, biochemisch, ohne Einflußmöglichkeiten des Subjekts. Die Tatsache, daß Nervenzellen und Immunzellen aufeinander wirken, ist aber inzwischen auch für Neurobiologen glaubhaft bewiesen: Novera H. Spector von der Universität Alabama hat Mäuse nach dem Pawlowschen Modell dazu gebracht, auf Kampfergeruch allein mit erhöhter Killerzellen-Aktivität zu reagieren, nachdem er vorher einigemal zusammen mit dem (sonst wirkungslosen) Duftsignal ein immunstimulierendes Medikament (Poly-Inosin-Poly-Cytidin-Säure) gespritzt hatte.[*] Seither glauben auch die hartgesottenen Biochemiker an etwas, was jeder unvoreingenommene Beobachter von Menschen schon immer wußte. Die vom AIDS-Virus HTLV III (human T-lymphotrophic virus) befallenen T-Lymphozyten werden in Milz, Lymphknoten und Knochenmark gebildet, die mit Fasern des autonomen Nervensystems reich versorgt sind.
Die AIDS-Debatte zeigt, wie sehr nicht nur das medizinische Denken von einem primitiven Erregermodell beherrscht ist, sondern wie genau dieses Modell die öffentliche Stimmung widerspiegelt. Ganzheit und Subjekt sind in dieser Welt nur Schemen wie die Schatten der Toten in Homers Epen. Da werden Viren und genetische Substanzen ausgebreitet, wird die Panik der subjektiv Gesunden, nach einem Virus-Test jedoch «Positiven» geschürt, die in vielen Diskussionen am Ende schon als AIDS-Kranke dastehen. Die einen Autoren halten sich für liberal, weil sie AIDS zu einer allgemeinen Seuche machen und damit von den Homosexuellen ablenken; die anderen für kritisch, weil sie Tacheles reden und auf die Gefahren des Analverkehrs hinweisen: Im Gegensatz zu den sieben Zellschichten der Scheide sei der nur mit drei Zellschichten ausgekleidete Enddarm von der Natur nicht als Sexualorgan vorgesehen. Über die Gefühle der Betroffenen wird nur wenig gesprochen, schon gar nicht über jene ungeklärten Vorgänge, die zwischen der Infektion, die viele trifft, und dem Ausbruch der Immunschwäche liegen, der nur bei einem geringen Prozentsatz der Infizierten eintritt.
Aber wenn ein Psychosomatiker das Wort nimmt, wird die Lage noch undeutlicher. Hätte er nicht besser geschwiegen mit seinen vagen Versprechungen und seinem handgreiflichen Versuch, die Lücken im naturwissenschaftlichen Gebäude durch seine Vorurteile zu schließen?
«Ich habe im Lauf der Zeit schon sehr viele Patienten, die von Immunschwäche-bedingten Krankheiten wie multipler Sklerose oder gewissen Hauterkrankungen befallen waren, psychotherapeutisch behandelt. Für mich persönlich steht es heute außer Zweifel, daß auch und gerade hier Psychotherapie den Krankheitsverlauf äußerst günstig beeinflussen kann. Man erkennt schon, wenn man sich mit an multipler Sklerose und wahrscheinlich auch mit an AIDS erkrankten Menschen nur sehr oberflächlich befaßt, daß diese unter seelischen Belastungen stehen … Die Viren, die ja allgegenwärtig sind, können erst dann Schaden anrichten, wenn das Immunsystem schon bedeutend geschwächt ist. Sie sind also nicht, wie meist angenommen, selbst für die Schwächung verantwortlich, sondern breiten sich nur auf dem schon bereiteten Boden aus … Ich möchte daher den Forschern dringend raten, die seelische Struktur der betreffenden Personen genauestens zu studieren. Dabei erinnere ich an den aus dem Tierreich bekannten Mechanismus der Selbsteliminierung. Dieser bringt aus der Gruppe ausgeschlossene Tiere dazu, innerhalb kurzer Zeit an einer massiven Infektion von Viren zu verenden, mit denen sie zuvor in Symbiose gelebt haben.»[*]
Chance und Gefahr der psychosomatischen Sichtweise sind in diesen Sätzen von David Jonas (einem Medizinprofessor, der in Wien lehrt) beispielhaft verdichtet: die Erweiterung des Blicks auf ganzheitliche Zusammenhänge, auf die Verschiedenartigkeit der Subjekte – und eine faschistisch anmutende Denkform, in der «promiskuöse Personen» zumindest im Wort der «aus dem Tierreich bekannten Selbsteliminierung» unterworfen und Homosexuelle mit «aus der Gruppe ausgeschlossenen» Personen gleichgesetzt werden.[*] Alexander Mitscherlich hat diese Gefahren vorausgesehen. «Eine nicht zu übertreibende Gefahr jeder die Motivationen des Verhaltens aufspürenden Psychologie liegt darin, daß sie in den Dienst bestehender Institutionen gerät. Sie trägt dann zur Perfektionierung der Techniken bei, mit denen das den anonymen Agenturen ziemlich schutzlos ausgelieferte Individuum manipuliert wird, statt zuerst die kritische Wahrnehmungsfähigkeit des einzelnen für seine Umwelt zu erweitern, so daß er sich selber in seinen Motivationen prägnanter versteht.»[*]
Weil jeder von uns ständig von Krankheit bedroht ist und wir alle im Alltag[*] dazu neigen, Gesundheit für das höchste Gut zu halten, kann die nachdenkliche Betrachtung unseres wissenschaftlichen und sozialen Umgangs mit Krankheiten vielleicht zu einem Modell werden. Selbstbegrenzung und der Verzicht auf die von Mitscherlich erwähnte «Zudringlichkeit» wären Ziele, die uns durch solche naheliegenden Beispiele klarer werden können. Ein heikles, in diesem Zusammenhang aber wesentliches Kapitel ist der Verzicht auf Behandlung (Kapitel 15) – ein Thema, das in unserer Macher-Welt verdrängt wird. Dieser Welt sollte deutlich werden, daß psychosomatische Experten zu jenen Dienstleistungsberufen zählen, deren höchstes Ziel es ist, sich selbst überflüssig zu machen. Sie sind ein Notbehelf und selbst dann nur das kleinere Übel, wenn sie sich an der oben zitierten Warnung orientieren. Denn kein einzelner Psychotherapeut, sei er auch noch so liebevoll, geschickt, lange ausgebildet und sorgfältig überwacht, kann dem in seiner Erlebnisverarbeitung gestörten Menschen alles geben, was dieser bräuchte. Deshalb Hilfe zu verweigern wäre unmenschlich. Jedoch die Begrenztheit und die dieser Hilfe innewohnenden Gefahren zu verleugnen ist genauso verfehlt.
1 Die Hypochondrie
Spricht die Liebe, so spricht
Ach, schon die Liebe nicht mehr.
F. Hebbel, Tagebücher
So wie der Altknecht schon seit jeher die Bewirtschaftung des Gutes führte, mußte nun der Bediente die Kleiderkammer übernehmen, der Schaffner erhielt die Geräte, der Verwalter das Vermögen, und er, der Herr, hatte kein anderes Geschäft, als sich zu heilen.
Um den Zweck völlig zu erreichen, schaffte er sich sofort alle Bücher an, die über den menschlichen Körper handelten. Er schnitt sie auf und legte sie in Stößen nach der Ordnung hin, in der er sie lesen wollte. Die ersten waren natürlich die, die über die Beschaffenheit und Verrichtungen des gesunden Körpers handelten. Aus ihnen war nicht viel zu entnehmen, aber sobald er zu den Krankheiten gekommen war, so war es ganz deutlich, wie die Züge, die beschrieben wurden, in aller Schärfe auf ihn paßten – ja sogar Merkmale, die er früher nicht an sich beobachtet hatte, die er aber jetzt aus dem Buche las, fand er ganz klar und erkennbar an sich ausgeprägt und konnte nicht begreifen, wie sie ihm früher entschlüpft waren. Alle Schriftsteller, die er las, beschrieben seine Krankheit, wenn sie auch nicht überall den nämlichen Namen für sie anführten. Sie unterschieden sich nur darin, daß jeder, den er später las, die Sache noch immer besser und richtiger traf als jeder, den er vorher gelesen hatte.
Adalbert Stifter, Der Waldsteig
Der Essener Kommunikationswissenschaftler Horst Merscheim meint entdeckt zu haben, daß das Fernsehen Krankheiten übertragen kann. In seiner Doktorarbeit zum Thema «Medizin und Fernsehen» schildert er den «Morbus Mohl», benannt nach dem Leiter der ZDF-Gesundheitssendung «Gesundheitsmagazin Praxis», Hans Mohl. Die Krankheit äußere sich darin, daß an Tagen nach der Schilderung von Krankheitssymptomen in Fernsehsendungen die Zuschauer recht zahlreich in die Arztpraxen kämen, weil sie glaubten, sie litten an der Krankheit. Merscheims Arbeit beruht auf der Befragung von 33 Ärzten sowie der Inhaltsanalyse von Medizinsendungen in allen drei Fernsehprogrammen. Danach sorgen viele Sendungen für eine Bedarfsweckung bei den Patienten: Die Besucher in den Sprechzimmern verlangen, angeregt durch die Sendungen, von ihren Ärzten neue Untersuchungsmethoden.
Süddeutsche Zeitung, Nr. 292 (1984), S. 44
Die Meldung über hypochondrische Ängste, die sogenannte «Gesundheitssendungen» bewirken, ist ein Beispiel unter vielen möglichen. Länger bekannt ist der «Morbus clinicus». Gemeint sind Störungen von Medizinstudenten, die nach ihren Vorstudien über Chemie, Physik und Biologie in die klinischen Semester eintreten, d.h. über Krankheiten lesen. Viele von ihnen erkranken dann an sogenannten «eingebildeten Leiden». Diese sind ein fesselndes Beispiel für eine Situation, die gerade deshalb eine genauere Untersuchung verdient, weil in ihr die meist unbesehen geglaubte Formel «Wissen ist Macht» fast in ihr Gegenteil verkehrt wird: Wissen ist Ohnmacht.
Die «Krankheit», welche das Gesundheitsmagazin bei den Fernsehzuschauern oder das Studium der medizinischen Lehrbücher bei den Studenten auslöst, heißt «Hypochondrie». Ähnlich wie Neurose, unter der die alten Ärzte eine körperliche, auf einer Degeneration der Nerven beruhende Krankheit verstanden, ist auch Hypochondrie ursprünglich die Bezeichnung einer körperlichen Krankheit. Der Begriff wurde von Claudius Galenus (129 bis 199 n. Chr.) geprägt, einem der großen antiken Ärzte-Schriftsteller, der über 500 Traktate verfaßte (von denen etwa hundert erhalten sind). Hypochondrium ist die Stelle unterhalb des Brustbeins, der Oberbauch. Solange der Glaube an die überlegene Wissenschaft der antiken Ärzte das Abendland beherrschte, war diese Auffassung der Hypochondrie als eine Form hartnäckiger Leibschmerzen mit Blähungen und/oder Verstopfung allgemein anerkannt. Bis 1900 finden sich entsprechende Aussagen, wobei die Autoren aber immer unsicherer werden, ob es sich wirklich um einen körperlichen Leidenszustand handelt.
In Meyers Konversationslexikon von 1897 (Bd. 9, S. 125f) wird Hypochondrie als «Krankheit der Gebildeten» (Morbus eruditorum) identifiziert und als Gegenstück zur «weiblichen» Hysterie vorwiegend den Männern zugeschrieben. Molières «eingebildeter Kranker» ist ein Mann. In der Beschreibung der Symptome stehen die körperlichen vor den seelischen: Blähungen, Verstopfung, ängstliche Beobachtung des Stuhlgangs. Ein Husten weckt die Angst vor Schwindsucht und führt dazu, daß die Verdauungsbeschwerden plötzlich verschwinden. Die seelischen Schwierigkeiten sind eher die Folge als die Ursache des Krankheitsbildes: Krasse Selbstbezogenheit und Mangel an Leistungsfähigkeit werden betont. Nördliches Klima – vor allem das englische – und Kaffeegenuß gelten als «Risikofaktoren», wie wir heute sagen würden. Die Behandlung ist körperlich (Bäder, mäßige Bewegung, Diät mit Verzicht auf blähende Speisen), aber auch seelisch (Ablenkung, ruhige Sportarten wie Billard und Kegeln).
Entschiedener ist die Position der Encyclopaedia Britannica von 1911 (Hypochondriasis, XIV, S. 207): Hypochondrie gilt als krankhafter Zustand des Nervensystems mit wahnhafter Verkennung des eigenen Gesundheitszustands und Depressionen, die in schweren Fällen die Aufmerksamkeit vollständig absorbieren und den Kranken hindern, seinen Pflichten nachzukommen.
Das «Wörterbuch der Psychiatrie» von 1971, verfaßt von Uwe Henrik Peters, ist bereits sicher, daß Hypochondrie zwar von Galen als organische Krankheit gemeint, aber «später stets mit psychischen Momenten verbunden» wurde. Es sieht in der Hypochondrie keine einheitliche Erkrankung mehr, sondern «ein Symptom bzw. Syndrom, das bei verschiedensten psychotischen und nichtpsychotischen Erkrankungen vorkommt» (S. 204). Da gibt es die traumatische Hypochondrie, die durch äußere, plötzliche Belastungen entsteht (wie eine Kriegsverletzung oder einen Autounfall), die topische Hypochondrie, die an bestimmten Organen ansetzt, und die Hypochondria vaga, auch dichtende Hypochondrie und Grillenkrankheit genannt, bei der die Kranken zwar über Beschwerden klagen, aber keinen Ort für sie finden können («so ein ziehendes Gefühl im ganzen Körper»).
Die geschichtliche Entwicklung der mit dem Hypochondrie-Begriff verbundenen Erscheinungen läßt sich so zusammenfassen: Die Entdeckung, daß es sich «eigentlich» um eine Erlebnisstörung handelt, kam spät. Die für unser Empfinden typischen Hypochonder vermehrten sich heftig, sobald die bürgerliche Gesellschaft mit ihren klaren Trennungen von Vernunft und Unvernunft, Individuum und Gesellschaft, Leistung und Trägheit, Wissenschaft und Glaube auftrat. Die Hypochondrie scheint, ebenso wie die Hysterie, eine Folge jener Umstände zu sein, die auch die Grundlage der technischen Revolution wurden.
Die Gesetze des Zeitgeists sind schwer zu erfassen. Geschichtliche Entwicklungen sind so komplex, daß jeder Ansatz zu einem Verständnis unvollständig bleibt, weil er andere Ansätze ausschließt. Zulässig ist aber sicher die allgemeine Aussage, daß die schärfere Trennung von Körper und Geist in der Philosophie mit einer neuartigen Betonung der «Nervenkrankheiten» einhergeht. Im Mittelalter war das individuelle Wissen dem großen, göttlichen Ordnungssystem unterworfen. Neugier und ungezähmte Erkenntnislust waren verdächtig, ja verboten. Umberto Eco hat diesen Konflikt zwischen den traditionellen Mönchen und den städtisch-bürgerlichen, wissenschaftlichen Strebungen in seinem Roman «Il nome della rosa»[*] veranschaulicht. Aber individuelles Wissen ist auch eine gefährliche, eine überfordernde Gabe. Das bürgerliche Individuum ist die gefährlichste Spezies, die sich im Lauf der kulturellen Evolution herausgebildet hat. Seine schrankenlose Vermehrung, seine Ohnmacht gegenüber den von ihm geschaffenen Strukturen, seine grenzenlose Gier nach Fortschritt und seine panische Angst vor Rückschritt, Trauer oder freiwilliger Unterwerfung werden vermutlich diesen Planeten unbewohnbar machen.
Das Wissen, welches das bürgerliche Individuum über sich selbst anhäuft, überfordert es kaum weniger, als seine Fabriken die Regenerationskraft der natürlichen Umwelt überfordern. Die Hypochondrie ist eine Folge davon. Ich sehe voraus, wie die verschiedenen Machtblöcke und Experten die Studie über die induzierte Hypochondrie durch das Fernseh-Gesundheitsmagazin verarbeiten werden. Der Kommunikationswissenschaftler wird kritisiert werden, weil er vorschnell verallgemeinert und nicht zwischen den nützlichen Folgen von Aufklärung (schließlich sollen doch die Patienten motiviert werden, etwas für ihre Gesundheit zu tun, nicht wahr?!) und den wenigen, sicher nicht durch Fernsehsendungen erkrankten «echten» Hypochondern («als Begleitsymptom einer depressiven oder schizophrenen Psychose bzw. im Rahmen einer soziopathischen Entwicklung …») unterscheidet. Die Fernsehgewaltigen werden sagen, eine dankbar aufzunehmende Anregung, gewiß, aber im Grunde unsinnig übertrieben.
Eine Seite des Problems wird vermutlich niemand erwähnen: die tiefe Störung des Körpergefühls, die solche Reaktionen auf eine Fernsehsendung ausdrücken. Seit es sie gibt, hat die «Nervenheilkunde» den Blick auf die psychologische Mißwirtschaft der bürgerlichen Gesellschaft verstellt, indem sie sich mit den «zu schwachen» Nerven einer auffälligen Minderheit befaßte. Die wahnhaften Hypochonder übertreiben eine allgemeine Entfremdung des Körpergefühls so, daß es jedem auffallen muß. Die spezifische Art des bürgerlichen Wissens wird gerade in den Befürchtungen der Hypochonder deutlich. Es ist ein Wissen, das den körperlichen Bedürfnissen feindlich ist, das sie verzerrt, ihnen eine einseitige Richtung gibt, eine störende und gestörte Härte. Die schönste Beschreibung dieser Veränderung findet sich in Heinrich von Kleists Aufsatz «Über das Marionettentheater», der vom 12. bis 15. Dezember 1810 in den «Berliner Abendblättern» erschien. Die Schattenseiten des Wissens werden hier an verschiedenen Szenen veranschaulicht. An der Makellosigkeit des Tanzes der Marionetten, deren Glieder sich nach dem Gesetz der Schwerkraft bewegen, zeigt Kleist in seinem ersten Beispiel die Unbeholfenheit des von Absicht behinderten menschlichen Tänzers:
Sehen Sie nur die P. an …, wenn sie die Daphne spielt und sich, verfolgt vom Apoll, nach ihm umsieht; die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des Kreuzes; sie beugt sich, als ob sie brechen wollte … Sehen sie den jungen F. an, wenn er als Paris unter den drei Göttinnen steht und der Venus den Apfel überreicht: die Seele sitzt ihm gar (es ist ein Schrecken, es zu sehen) im Ellenbogen … Solche Mißgriffe … sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.[*]
Das zweite Beispiel ist die Geschichte von einem jungen Mann, der in einem großen Spiegel beim Abtrocknen nach dem Bade feststellt, daß seine Geste genau der des «Dornausziehers» entspricht, einer antiken Statue im Louvre.
Ich badete mich … mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ohngefähr in seinem sechzehnten Jahre stehn, und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken … er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe (die Ähnlichkeit seiner Bewegung mit der des «Dornausziehers», W.S.). In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht, doch sei es …, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen: ich lachte und erwiderte, er sähe wohl Geister! Er errötete und hob den Fuß zum zweitenmal, um es mir zu zeigen; doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehn lassen, mißglückte … er hob ihn wohl noch zehnmal: umsonst! er war außerstand, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen – was sag ich? die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, daß ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten: – Von diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblick an ging eine unbegreifliche Veränderung mit dem jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen; und immer ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich wie ein eisernes Netz um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen, und als ein Jahr verflossen war, war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die Augen der Menschen sonst, die ihn umringten, ergötzt hatte.
An anderer Stelle habe ich die Bedeutung des uneinfühlenden, kritischen Beobachters in dieser Szene untersucht.[*] Kleist benützt sie, um die Widersprüche zwischen der natürlichen, nur dem Empfinden folgenden Grazie und dem bewußt herbeigeführten Zweck aufzuzeigen. Er steht damit durchaus in der Tradition Rousseaus, der die frühen Zweifel am Sinn des bürgerlichen Fortschritts besonders klar formuliert hat. Diese Zweifel hielten den Fortschritt nicht auf. Vielleicht haben sie ihn sogar gefördert: die Träume der Romantiker, die «natürlichen» Gärten und Parks im «englischen Stil», die Berichte von den edlen Wilden in Urwäldern und auf palmengesäumten Inseln boten Reservate an, in denen sich eine ihrer werktäglichen Zweckrationalität müde Gesellschaft erholen konnte. Was Kleist nicht sieht, vermutlich weil er es um einer eindeutigeren Aussage willen nicht sehen will, ist die in diesem Widerspruch vermittelnde und kittende Rolle der Professionalität. Der schöne Jüngling ist ein hoffnungsloser Amateur. Der berufsmäßige Schauspieler, Tänzer oder Gigolo unterscheidet sich von ihm eben gerade durch seine Fähigkeit, die anmutige Geste so zu spielen, als ob sie echt wäre. Die industrielle Entwicklung hat hier Verfeinerungen aufgebaut, deren Macht die scheinbare Spontaneität gerade durch völlige Berechnung herstellt: die «Traumfabrik» des Kinos und der Television, in der durch eine Verbindung von Aufzeichnung, Trickkamera und Schneidetechnik ein Anschein von Natur, von Spontaneität erweckt wird, gegen den die Marionetten lahm und leblos wirken, wieviel mehr noch die lebendigen Menschen.
Was ebenfalls unerwähnt bleibt, ist die Rolle des Beobachters. Erlebnisse wie «Echtheit» oder «natürliche Anmut» sind nicht mit Maß und Zahl bestimmbar, sondern nur durch ihre emotionale Wirkung auf den Beobachter. Dessen Vorstellung entscheidet, ob sie entstehen oder nicht. Kleist deutet das durchaus in der Szene mit dem verwirrten «Dornauszieher» an. Bis heute ist der Regisseur die wichtigste Gestalt in den gefrorenen Träumen: Seine suggestive Macht, zu verwirklichen, was in seinem Kopf bereits vorhanden ist, entscheidet über Gelingen oder Mißerfolg einer Kinoproduktion.
Das dritte Beispiel Kleists ist der fechtende Bär. Im Holzstall eines livländischen Rittergutes, mit dessen Söhnen der Erzähler spielerisch gefochten und die er bezwungen hat, steht sein neuer, unbezwinglicher Gegner.
Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze schlagfertig erhoben, und sah mir ins Auge: das war seine Fechterpositur. Ich wußte nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenübersah; doch: «Stoßen Sie! Stoßen Sie!» sagte Herr von G., «und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können!» Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus; der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte, ihn durch Finten zu verführen; der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder mit einer augenblicklichen Gewandtheit auf ihn aus, eines Menschen Brust würde ich ohnfehlbar getroffen haben: der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß … Der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben, Stöße und Finten wechselten sich, mir triefte der Schweiß: umsonst! Nicht bloß, daß der Bär wie der erste Fechter auf der Welt alle meine Stöße parierte; auf Finten (was ihm kein Fechter der Welt nachmacht) ging er gar nicht einmal ein: Aug’ in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht.
Dieses Beispiel ist das letzte der Erzählung: Es zeigt am deutlichsten die Überlegenheit des Instinkts vor der Berechnung. Der Bär fällt auf Finten, das heißt auf Stöße, die ihn verwirren und seine Deckung aufreißen, aber nicht treffen sollen, überhaupt nicht herein. Dadurch ist er dem menschlichen Fechter überlegen, der nicht zwischen «echt» und «unecht» unterscheiden kann, während das Tier in einer Welt lebt, in der das seiner selbst bewußte Wissen fehlt. Daher muß es sich gar nicht um die berechneten Manöver des gegnerischen Fechters kümmern: in seinen Augen liest der Bär, ob er wirklich zustoßen wird oder nicht.
Wir sehen, daß in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. – Doch … findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, daß sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewußtsein hat, d.h. in dem Gliedermann oder in dem Gott.
Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?
Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.
Es ist nicht schwierig, die Folgerungen der beiden Gesprächspartner auf die Problematik der Hypochondrie anzuwenden. Wie das Wissen um die Bewegung die Grazie des Tänzers zerstört, so das Wissen um den körperlichen Vorgang zum Beispiel der Verdauung die natürliche Selbstregulation. Der Stuhlhypochonder ist verstopft, weil er ängstlich auf die pünktliche Entleerung wartet, die – unbeobachtet und unerwartet – von sich aus einträte.
Kleist setzt seine geschichtliche Situation absolut. Nicht jedes Wissen ist der Selbstregulation und der natürlichen Anmut feindlich. Es muß die spezifische Form der bürgerlichen Wissenschaft sein, in der vor allem über Nutzen und Leistung nachgedacht wird. Der Stuhlhypochonder wird nicht deshalb krank, weil er so viel über seine Verdauung weiß, sondern weil dieses Wissen von einem Zwang zur Leistung, zur Normerfüllung durchtränkt und eingeschränkt ist. Der Hypochonder ist im Gegenteil an einem von innen heraus gewachsenen, leistungslosen Wissen um seinen Körper besonders arm. Er muß diesen Mangel durch angestrengtes Nachdenken und vielfältige äußere Informationen ersetzen. Er ist unsicher. Das meiste, was ihm seine Umwelt anbietet, ist geeignet, diese Unsicherheit zu verstärken. Verschiedene Ärzte haben unterschiedliche Meinungen. Jeder bietet neue Dienste an und verzieht das Gesicht, wenn er von der bisherigen Behandlung hört, natürlich will er den Kollegen nicht kritisieren, aber … Der Hypochonder sucht verzweifelt, in dieser Situation seine verlorene Sicherheit wiederzufinden. Alles, was er unternimmt, verstrickt ihn nur noch mehr, wie die magischen Fesseln der Sage, die um so fester werden, je heftiger der Gefangene an ihnen reißt. Womöglich könnte er jede Krankheit haben. Daher seine Bereitschaft, auf Grund kleiner Anlässe wie einer Fernsehsendung zum nächsten Arzt zu gehen, der ihn «durchuntersucht».
Der Arzt und der Hypochonder haben in der gegenwärtigen Situation der Industriegesellschaft einen Kompromiß geschlossen. Der Hypochonder wird jedes Vierteljahr (wenn er den neuen Krankenschein für die Quartalsabrechnung bringt) mit Hilfe von Labor und Computer durchleuchtet und gibt dann für drei Monate Ruhe. Der Zwang, die aufwendigen Diagnose-Maschinen der modernen Arztpraxen auszulasten, wirkt harmonisch mit den immer ausgefeilteren Sorgen der Hypochonder zusammen. Krebs- und Herzangst sind längst an die Stelle der früheren Ängste vor Verstopfung und Schwindsucht getreten.
Nach einer gut belegten biologischen Theorie sind Altern und Tod Folgen der Vielzelligkeit unseres Organismus, der Arbeitsteilung im Körper. Einzeller sind potentiell unsterblich, da bei ihnen keine «Individualität» (im ursprünglichen Sinn der Unteilbarkeit) vorliegt. Die Last des Alters liegt in einer nicht unbegrenzt genauen Vervielfältigung und damit Erneuerung der Gewebe. Veränderungen (Mutationen), schlechte Kopien sozusagen, nehmen überhand, bis – meist durch zusätzlich auftretende Krankheiten – der Organismus erliegt.
Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit und Alterslosigkeit wurzelt in dieser Situation. Falten, graue Haare oder Kahlköpfigkeit, schwindende Koordination der Bewegungen kommen für unser Erleben meistens zu früh. Der Tod wird gefürchtet und nur selten als Erlöser begrüßt. Eine Gesellschaft ohne Hierarchie, in der jedermann, jedefrau die schlichten Kulturtechniken (wie Jagen und Sammeln) beherrscht, legt die Last der Verarbeitung dieses Schicksals den einzelnen Personen fast ungemildert auf. Hilfreiche schamanistische Riten (so nennen wir sie, für die «Primitiven» sind sie ein Teil des Lebens wie Jagd und Fischfang auch) werden von fast allen Mitgliedern der kleinen Sprachgemeinschaft beherrscht und ausgeübt.[*] So ist das Alter, das jeden dem Tod näher bringt, auch der wichtigste Lehrmeister, Kinder und junge Erwachsene vor dem Tod zu bewahren. Alte Frauen sind die Hebammen, alte Männer legen Verbände bei Wunden an und überliefern das Wissen, ob Pflanzen, Schwitzbäder oder Fasten bei verschiedenen Krankheiten helfen. Die Wandlung vom «Laien» zum «Experten» vollzieht sich biographisch innerhalb jeder betroffenen Person, sie wird nicht arbeitsteilig aufgespalten zwischen verschiedenen Personen, die ein Gefälle von Wissen (und Macht) trennt.
Jedoch ist die Machtansammlung, die (um wiederum unsere Begriffe auf sie anzuwenden) Effizienz solcher Gesellschaften gering. Erbärmlich gering, sagten wir früher, in Zeiten ungebrochenen Fortschrittsglaubens. Wohltuend gering, sind wir heute versucht zu sagen, angesichts einer zunehmenden ökologischen Bedrohung, während diese Kulturen viele Jahrhunderttausende im Gleichgewicht mit ihrer Umwelt leben konnten. Weil jeder Angehörige der altsteinzeitlichen Kultur alles sein muß, Jäger und Sammler, Arzt und Patient, Priester und Gläubiger, Richter und Gerichteter, Familienmitglied und Familientherapeut, kann er auch nichts «richtig» sein. Weil es keine Vorratswirtschaft, keine Schrift gibt, bleibt sein Wissen beliebig und vergänglich. Der unmittelbare Druck zum Überleben ist so groß, daß wenig Muße bleibt, sich mit Tätigkeiten abzugeben, in denen unser bürgerliches Lebensgefühl das wahrhaft Menschliche zwingend erlebt.
Verglichen mit der großen Stabilität und geringen Wandelbarkeit der altsteinzeitlichen Kulturen ist die Entwicklung zur arbeitsteiligen Gesellschaft sehr schnell verlaufen. Das liegt daran, daß die Fortschritte sich dann enorm beschleunigen, wenn erst Sperrmechanismen entdeckt sind, die verhindern, daß sie sich wieder auflösen. Der wichtigste dieser Sperrmechanismen war die Schrift. Sie schuf den ersten und grundlegenden Unterschied, mit dem die Völkerkunde lange Zeit Primitive oder Barbaren von Kulturmenschen trennte. Die agrarische Kultur war ungleich dynamischer als die altsteinzeitliche. Uns erscheint sie so starrsinnig und unveränderlich wie die Mauern ihrer Burgen und die Säulen ihrer Tempel. Der Sohn folgte dem Vater, die Tochter der Mutter. Handwerker, Bauer, Pfarrer, Edelmann waren die großen «Stände»; die Sklaven gehörten nicht zu ihnen, sie wurden gehalten wie Haustiere. Persönliche Würde war etwas, was keiner von ihnen erwartete oder forderte. Auch die «Experten für Körperbewußtsein», die uns hier vor allem beschäftigten, waren nach Ständen getrennt.
Das gewöhnliche Volk hatte «natürliche Krankheiten», für die Feldschere und Bader ausreichten. «Bei ihnen gibt es nicht die vielfältigen, komplexen, gemischten Nervenleiden, sondern solide Schlaganfälle und freimütige Tobsuchtsanfälle.»[*] In seinem dreibändigen Werk von 1768 beschreibt der berühmte Arzt Tissot die Krankheiten der Landleute, der Gelehrten und der Personen «von Welt». Sein Grundargument (dem Rousseaus nicht unähnlich) ist, daß sich mit dem Aufsteigen in der Ordnung der Stände die Krankheiten verschlimmern, weil sie sich gegenseitig verbinden und verstärken. Daher ist für den gemeinen Mann der Dr. med. so überflüssig, «wie wenn man einen Dorfknaben, der Religionsunterricht erhalten soll, zum Professor der Theologie schickt»[*].
Es ist sehr schwierig, zu rekonstruieren, wie sich unter den gesellschaftlichen Strukturen der feudalen, ständischen Ordnung die Subjektivität des Kranken entwickelt hat. Die Medizin war stark von Vorstellungen bestimmt, die wir heute als abergläubisch und pseudorational ansehen, vor allem von der Säftelehre. Es gab vier Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde. Ihnen entsprachen Organe im Körper: Knochen und Fleisch der Erde, die Körperflüssigkeit dem Wasser, das Herz (das den Körper erwärmte) dem Feuer und der Atem dem Wind. Diese Vorstellungen sind bereits in altägyptischen Papyrustexten zu finden. Hippokrates hat sie weiterentwickelt und durch anatomische Erkenntnisse ergänzt. Das Gehirn ist «Dolmetscher des Bewußtseins», doch Wahnsinn wird daraus erklärt, daß das geistige Organ von übermäßiger Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte betroffen ist. Eine richtige Mischung von heiß und kalt, feucht und trocken in Speisen, Getränken und klimatischen Bedingungen, stellt die seelische Gesundheit wieder her.[*]