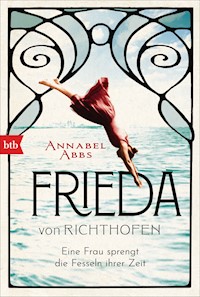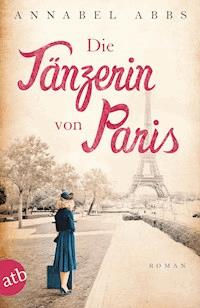
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
Tanz war meine Antwort – auf alles, was das Leben mir abverlangte... Paris, 1928: Lucia ist jung, begabt und wird in der Bohème als Tänzerin gefeiert. Aber ihr Vater ist der große James Joyce, und so modern seine Werke auch sein mögen, so argwöhnisch beobachtet er das Streben seiner Tochter nach einem selbstbestimmten Leben. Dann begegnet Lucia dem Schriftsteller Samuel Beckett, der ihre große Liebe wird. Doch ihre Hoffnungen, sich aus dem Schatten des übermächtigen Vaters zu befreien und ihren eigenen Weg gehen zu können, drohen schon bald zu scheitern. Das tragische Schicksal einer jungen Frau auf der Suche nach Freiheit und Liebe – nach der wahren Geschichte von Lucia Joyce. »Das starke Portrait einer jungen Frau, die sich danach sehnt, als Künstlerin zu leben, und deren Lust am Leben einem entgegenleuchtet.« The Guardian.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Annabel Abbs
Annabel Abbs studierte Englische Literatur und leitete eine große Marketing Consulting Agency, bevor sie zu schreiben begann. Ihre Kurzgeschichten wurden hoch gelobt, und auch ihr Debütroman wurde mehrfach ausgezeichnet. Mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt Annabel Abbs in London und Sussex.
Ulrike Seeberger, geboren 1952, Studium der Physik, lebte zehn Jahre in Schottland, arbeitete dort u.a. am Goethe-Institut. Seit 1987 freie Übersetzerin und Dolmetscherin in Nürnberg. Sie übertrug u.a. Autoren wie Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guiness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Yaël Guiladi und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Tanz war meine Antwort – auf alles, was das Leben mir abverlangte
Paris, 1928: Lucia ist jung, begabt und wird in der Bohème als Tänzerin gefeiert. Aber ihr Vater ist der große James Joyce, und so modern seine Werke auch sein mögen, so argwöhnisch beobachtet er das Streben seiner Tochter nach einem selbstbestimmten Leben. Dann begegnet Lucia dem Schriftsteller Samuel Beckett, der ihre große Liebe wird. Doch ihre Hoffnungen, sich aus dem Schatten des übermächtigen Vaters zu befreien und ihren eigenen Weg gehen zu können, drohen schon bald zu scheitern.
Das tragische Schicksal einer jungen Frau auf der Suche nach Freiheit und Liebe – nach der wahren Geschichte von Lucia Joyce.
»Das starke Portrait einer jungen Frau, die sich danach sehnt, als Künstlerin zu leben, und deren Lust am Leben einem entgegenleuchtet.« The Guardian
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Annabel Abbs
Die Tänzerin von Paris
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Seeberger
Inhaltsübersicht
Über Annabel Abbs
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Historische Anmerkung der Autorin
Nachwort der Autorin
Dank
Anmerkung der Übersetzerin
Impressum
Für meinen Mann Matthew
»Es gibt Sünden (oder lasst uns sie nennen,
wie die Welt sie nennt) schlimme Erinnerungen,
welche der Mensch in den dunkelsten Winkeln
seines Herzens verbirgt.
Doch dort verharren sie und warten.«
JAMES JOYCE, ULYSSES, 1922
Prolog
September 1934, Küsnacht, Zürich
Ich stehe an Deck und schaue auf die Säume aus weißem Schaum, die wir hinter uns herziehen. Zürich weicht am Horizont zurück, und ich warte darauf, dass vor mir Küsnacht erscheint. An den Ufern schütteln die Bäume ihre gekräuselten Blätter ab. Es liegt ein kaltes Schaudern in der Luft, und über den See treibt ein zarter Hauch von Zerfall.
Seit drei Wochen gehe ich zu ihm nach Küsnacht in sein quadratisches Haus mit den Fensterläden. Dreimal in der Woche komme ich mit dem Schiff her und sitze bei ihm. Und immer noch habe ich nicht geredet. Aber heute rührt sich etwas in mir, erwacht etwas, und mein Schweigen bedrückt mich.
Der See leuchtet in der Herbstsonne. Neben der Fähre drehen und wenden sich winzige Fische, ihre glitzernden Schuppen blitzen wie gefallene Sterne. Während ich sie beobachte, spüre ich etwas durch meine Fußsohlen hinaufziehen, meine Waden hinauf. Über das Rückgrat. Meine Hüften wiegen sich, meine Finger beginnen, einen Rhythmus auf die Reling zu tappen. Als wolle mein abgestumpfter Körper wieder etwas Schönes sein.
Heute werde ich reden. Ich werde seine lästigen Fragen beantworten. Und ich werde ihm sagen, dass ich wieder tanzen muss. Ja, ich muss wieder tanzen …
*
Doktor Jung legt seine Fingerspitzen vor dem Mund aneinander, so dass sie seinen säuberlich gestutzten Schnurrbart berühren. »Sie haben ein Schlafzimmer mit Ihrem Vater geteilt, bis Sie achtzehn Jahre alt waren. Wie haben Sie sich umgezogen?« Seine Augen sind wie kleine Lichtkegel, die nie von meinem Gesicht weichen.
»Ich habe in den Kleidern geschlafen.« Ich rutsche unbehaglich hin und her, weiß, welche Fragen als Nächstes kommen werden. Und ich habe sie satt. Gründlich satt.
»Warum haben Sie sich nicht ausgezogen?« Seine Worte hängen in der Luft, während ich mir meinen Nerzmantel enger um die Rippen ziehe. Das übereifrige kleine Hausmädchen hat versucht, ihn mir an der Tür abzunehmen. Hat mir immer wieder gesagt, wie warm es im Zimmer des Doktors sei, dass sie selbst das Feuer angezündet habe.
»Ratten ziehen sich doch für die Nacht nicht um, oder?«
»Ratten?« Doktor Jung schiebt seinen Drehstuhl nach hinten und beginnt im Zimmer auf und ab zu gehen. »Ich freue mich, dass Sie sich endlich zum Reden entschlossen haben, aber Sie müssen sich genauer erklären, Miss Joyce.«
»Wir haben an Hunderten von Orten gelebt … in Zimmern … Wohnungen. Italien, Schweiz, Paris.« Schon jetzt merke ich, wie mein Mund steif wird, als hätte er genug von all dem Reden, genug von den endlosen Fragen des Doktors. Ich fahre mir rasch mit der Zunge über die Oberlippe, ermuntere mich weiterzumachen. »Wir sind an den Square de Robiac in Paris gezogen, als uns reiche Leute Geld gegeben haben – die Mäzene meines Vaters. Davor hat mein Bruder Giorgio uns als Wanderratten bezeichnet.«
»Und Ihr Vater nannte es Exil.« Doktor Jung beugt sich herunter, bringt sein Gesicht auf die gleiche Höhe wie meines. Und ich frage mich, ob er in meine leere, geplünderte Seele blicken kann, ob er sehen kann, wie sie mich ausgeraubt und verraten haben.
»Erzählen Sie mir von ›Ulysses‹. Ich gebe zu, ich bin beim Lesen eingeschlafen.« Er lässt sich vorsichtig wieder auf seinen Stuhl nieder, kritzelt etwas in sein Notizbuch, wendet den Blick wieder zu mir. »Verboten wegen Obszönität. Wie haben Sie sich gefühlt, dass Sie einen Pornographen zum Vater hatten?«
Draußen zieht eine Wolke über den Himmel und verdeckt die Sonne. »›Ulysses‹ …«, wiederhole ich, durchsuche mein mottenzerfressenes Hirn nach Erinnerungen und Hinweisen. Breiter blauer Buchrücken … Goldene Buchstaben … Mama, die es mir aus den Händen reißt. »Meine Mutter hat einmal gesehen, wie ich es in der Hand hielt, und hat es mir weggenommen. Sie sagte, mein Vater hätte eine schmutzige Phantasie, und ich könne es lesen, wenn ich verheiratet wäre. Verheiratet!« Ich lache leise und freudlos.
»Sie haben es also gelesen?«
»Natürlich. Es ist das großartigste Buch, das je geschrieben wurde.« Ich erzähle ihm nicht, dass auch ich die Geschichte langweilig fand, dass die seltsam fremden Figuren mir nichts sagten, dass ich nie bis zu den »schmutzigen Stellen« gekommen bin, von denen alle redeten. Stattdessen platze ich mit meiner Frage über Babbo heraus, jener Frage, die noch immer an mir nagt, nach all den Jahren: »Doktor, ist mein Vater wirklich ein perverser Irrer?«
Doktor Jung schaut mich durch seine Goldrandbrille an. Seine Augen weiten sich, während er geräuschvoll durch die Nase ausatmet. Es herrscht ein langes Schweigen, und währenddessen nickt er sanft mit dem Kopf, als erwarte er, dass ich rede. »Warum fragen Sie, Miss Joyce?«
Inzwischen habe ich mir den Nerzmantel so fest um meinen Körper geschlungen, dass sich mein Brustkorb verengt und mir der Atem stockt. »Ich habe das in einer Zeitung gelesen. Sie haben ihn einen perversen Irren genannt. Und sie haben ›Ulysses‹ als das obszönste Buch bezeichnet, das je geschrieben wurde.« Beim Sprechen löst sich meine Stimme von meinem Körper und schwebt fort, als hätten die Worte, die Laute nichts mit mir zu tun.
»Was meinen Sie, wieso sich Ihr Vater ein Zimmermädchen zur Ehefrau gewählt hat?« Der Doktor lehnt sich über seinen Schreibtisch, schiebt sich die Brille auf die Stirn und macht sich wieder daran, mich eingehend zu mustern.
»Er mag intelligente Frauen nicht. Das hat er mal gesagt.« Ich sage ihm nicht, dass ich genau weiß, warum mein Vater ein Zimmermädchen gewählt hat. Es gibt einfach Dinge, über die man nicht reden kann. Nicht mit fetten Schweizern, die Taschenuhren tragen und die pro Stunde bezahlt werden wie ganz gewöhnliche Prostituierte. Mit überhaupt niemandem.
Doktor Jung nickt und kaut gedankenverloren an seinem Daumen herum, beobachtet mich immer noch, starrt mich an, sucht Zugang zu meiner Seele. Dann nimmt er seinen Füller zur Hand, und ich höre, wie die Feder kratzt, während er in sein Notizbuch kritzelt. Ich streichele über meinen Nerzmantel, so weich, so tröstlich. Wie ein zahmes Hündchen, das sich auf meinem Schoß zusammengerollt hat. Schon jetzt löst sich Mamas Gesicht vor mir auf, schwindet sie – ihre Augenbrauen wie Krähenfedern, ihre dünnen Lippen, ihre flaumigen Wangen mit dem Labyrinth geplatzter Äderchen. »Ich möchte nicht mehr über sie reden. Sie hat mir das alles angetan.« Ich tippe mir dreimal mit dem Zeigefinger an die Schläfe.
Er hört zu schreiben auf und runzelt so lange die Stirn, dass die Muskeln um seine Augen herum schon zucken. »Erzählen Sie mir von Ihrer Beziehung zu Ihrem Vater, ehe Sie sich das Schlafzimmer teilten.«
»Er hat ständig geschrieben. Er hat kaum mit mir geredet, bis ›Ulysses‹ beendet war.« Ich schlage die Augen nieder, schaue auf meine neuen Schuhe aus dem weichsten italienischen Leder, spüre, wie sich meine Zehen darin verkrampfen. Es ist nicht nötig, mehr zu sagen. Noch nicht …
»Sie mussten mit sehr vielen Menschen, wirklichen und fiktiven, um seine Zeit wetteifern.« Jetzt sind Doktor Jungs Augen wie kleine Windräder, die sich in meinen Kopf bohren.
»Ich denke schon.« Ich fahre mit den Fingern durch den Pelz, kämme die Haare und schiebe sie gegen den Strich, während ich an meine gierigen Geschwister denke. All diese Romangestalten, die durch Dublin wandern. Ja, gierige Geschwister waren sie, die mir Babbo wegnahmen. Ich erwidere den Blick des Doktors, entschlossen und selbstbewusst, wie ich hoffe, aber unter dem Mantel rinnt mir der Schweiß langsam zwischen den Brüsten hinab.
»Was hat es überhaupt für einen Zweck, dass ich hier bin?« Diese endlosen Fragen müssen aufhören. Uns läuft die Zeit davon. »Work in Progress« ist noch immer nicht beendet. Babbo braucht meine Hilfe, meine Inspiration. Was nütze ich ihm hier, eingesperrt in der Schweiz? Meine Füße beginnen hin und her zu trippeln, verzweifelte kleine Zuckungen wie keuchende Atemzüge.
»Sie sind hier auf Bitten Ihres Vaters, Miss Joyce. Und da Sie bis heute nicht geredet haben, ist einiges aufzuholen. Erzählen Sie mir von Giorgio.« Doktor Jung verschränkt die Finger, beobachtet mich, wartet.
Als er den Namen meines Bruders ausspricht, überkommt mich eine Welle der Liebe. Zehn Jahre lang waren Giorgio und ich unzertrennlich wie siamesische Zwillinge. Ich mustere meine Hände und erwarte dort noch die weißen Druckstellen seiner Finger zu sehen, wo er mich fest gepackt hatte. Um mich von den halbverhungerten Katzen wegzuzerren, die ich so liebend gern adoptiert hätte, um mich die steilen Straßen von Triest hinaufzuziehen, um zu verhindern, dass ich aus dem Omnibus fiel. Es ist natürlich nichts mehr zu sehen. Nur der glänzende Schatten einer Narbe an meinem Daumen. Aber nun rüttelt etwas anderes an den Rändern meiner Erinnerung. Ich halte inne, erwarte, dass es klare Konturen annimmt. Doch stattdessen verspüre ich einen dumpfen Schmerz, der langsam von meinem Nacken nach oben steigt. Ich reibe mir die Schläfen, während das Schweigen in meinen Ohren dröhnt und der Schmerz in meinem Gehirn aufblüht.
Der Doktor schaut auf die dicke goldene Taschenuhr, die er auf seinem Schreibtisch liegen hat. »Unsere Zeit ist vorbei, Miss Joyce. Aber ich möchte, dass Sie einen Bericht über Ihre Jahre am Square de Robiac schreiben. Können Sie das für mich tun?«
»Für Sie? Ich dachte, diese Gesprächskur wäre für mich?«
»Es ist für mich, damit ich Ihnen helfen kann.« Er spricht langsam, artikuliert jedes Wort, als spräche er mit einem Kind oder einer Irren. Er nimmt die Taschenuhr auf und schaut demonstrativ darauf. »Bringen Sie mir nächstes Mal den ersten Abschnitt Ihrer Erinnerungen mit.«
»Wo sollte ich anfangen?«
»Sie sind jetzt siebenundzwanzig.« Er legt die Taschenuhr wieder hin, zählt mit den feisten Fingern der einen Hand die gespreizten Finger der anderen. »Sie sagten, ein Mr Beckett sei Ihr erster Liebhaber gewesen, das stimmt doch?« Er nickt mir aufmunternd zu. »Fangen Sie mit ihm an. Können Sie sich daran erinnern, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben?«
»Warten Sie«, sage ich und schließe die Augen, als die Erinnerung sich vor meinem inneren Auge zusammenfügt, Stück für Stück sich aus einer sich ständig verschiebenden Dunkelheit hervorquält. Zunächst nur schwach … jetzt hell und scharf. Der Duft von Austern und Eau de Parfum und türkischen Zigaretten und Zigarrenrauch. Das Knallen von Champagnerkorken, das Knistern von Eis in Stahlkübeln, das Klirren und Klingen von Gläsern. Ich erinnere mich an Stellas Kopf mit einem Turban wie ein kleiner gelber Kürbis, die feuchte Wärme von Émiles Atem in meinem Ohr, das strahlende Leuchten von Babbos Augen, als er einen Trinkspruch auf mich ausbrachte, an jedes Wort, das Mama und Babbo sagten. O ja … all diese Worte. Von Geburt und Heirat, von meinem Talent und meiner Zukunft. Damals schien sich das Leben vor mir zu erstrecken, rosig und golden und voller glänzender Möglichkeiten.
Ich öffne die Augen. Doktor Jung hat seinen Stuhl zurückgeschoben, steht an seinem Schreibtisch und klopft mit den Fingern ungeduldig auf das Leder, als trommle er im Rhythmus seiner Taschenuhr.
»Ich weiß, wo ich mit meinen Erinnerungen beginne«, sage ich. Ich werde mit den ersten Anzeichen der Begierde und des Ehrgeizes anfangen, die sich wie gierige Ranken von Unkraut in mein junges Herz schoben. Denn damit begann es. Ganz gleich, was alle anderen sagen, das war der Anfang.
Kapitel 1
November 1928, Paris
»Zwei Genies in einer Familie. Werden wir wohl miteinander konkurrieren?« Babbo drehte den Edelsteinring an seinem Finger, hatte die wässrigen Augen noch auf die Paris Times gerichtet. Er schaute auf das Foto von mir, musterte es, als hätte er mich noch nie zuvor gesehen. »Wie schön du bist, mia bella bambina. Genauso hat deine Mutter ausgesehen, als sie mit mir durchgebrannt ist.«
»Das hier ist meine Lieblingsstelle, Babbo.« Ich nahm ihm die Zeitung aus der Hand und las atemlos aus der Kritik meines Debüts als Tänzerin vor. »Wenn sie ihr Talent erst einmal voll ausgeschöpft hat, werden wir James Joyce vielleicht nur noch als den Vater seiner Tochter kennen.«
»Wie stürmisch dein Ehrgeiz ist, Lucia. Mir hat sich die nächste Zeile ins Gedächtnis gegraben. Du erlaubst.« Er begann in seiner dünnen, näselnden Stimme zu rezitieren: »Lucia Joyce ist die Tochter ihres Vaters. Sie hat James Joyce’ Begeisterung, Energie und eine noch zu bestimmende Menge seines Genies.« Er hielt inne und fuhr sich mit zwei tabakvergilbten Fingern durch das frisch geölte Haar. »Dein Auftritt war ganz und gar erstaunlich. Welcher Rhythmus, welche Vergänglichkeit … ich musste tatsächlich an Regenbogen denken.« Er schloss kurz die Augen, als riefe er sich den Abend in Erinnerung. Dann riss er die Augen auf. »Was schreibt die unanfechtbare Paris Times sonst noch über meine Nachkommenschaft?«
»Sie schreibt: Sie hat sich imThéâtre des Champs-Élysées–der Heimat des Avantgarde-Tanzes in Paris– einen Namen gemacht. Sie tanzt den ganzen Tag; wenn nicht mit ihrer Tanztruppe, dann nimmt sie Unterricht oder tanzt für sich. Wenn sie nicht tanzt, entwirft sie Kostüme, arbeitet Farbzusammenstellungen aus, kreiert Farbeffekte. Zur Krönung des Ganzen spricht sie nicht weniger als vier Sprachen–fließend– und ist groß, schlank und bemerkenswert anmutig, mit braunem, zu einem Bob geschnittenen Haar, blauen Augen und einem makellosen Teint. Was für ein Talent!« Ich warf die Zeitung auf das Sofa und begann im Wohnzimmer herumzuwirbeln, drehte mich in weiten, wilden Kreisen. Der Applaus hallte in meinen Ohren wider, das Hochgefühl durchströmte noch meine Adern. Ich hob die Arme und wirbelte durch den Raum – vorbei an Babbos geliebten Ahnenbildern in ihren vergoldeten Rahmen, rings um die aufgestapelten Bände der »Encyclopaedia Britannica« herum, die auch als Schemel dienten, wenn Babbos Schmeichler kamen, um ihn lesen zu hören, an Mamas eingetopften Farnen vorbei.
»Ganz Paris liest das, Babbo. Über mich! Und«, ich wedelte mit dem Zeigefinger vor ihm herum, »du nimmst dich jetzt besser in Acht!«
Babbo verschränkte seine Füße, lehnte sich träge auf dem Stuhl zurück und beobachtete mich. Er ließ mich nicht aus den Augen. »Wir werden heute Abend bei Michaud essen. Wir werden bis in die frühen Morgenstunden auf dein Wohl trinken, mia bella bambina. Lade deine tanzende amerikanische Freundin ein, uns die Ehre ihrer Anwesenheit zu geben. Und ich lade Miss Steyn ein.« Wieder berührte er sein Haar, strich es mit einem plötzlich geistesabwesenden Ausdruck am Kopf glatt. »Und ich nehme an, du solltest wohl auch den jungen Mann einladen, der die Musik komponiert hat.«
»Ja, wir wollen Émile einladen, Mr Fernandez!« Mein Herz machte einen kleinen Hüpfer, als ich mich auf die Zehenspitzen erhob und eine, noch eine und dann eine dritte Pirouette drehte, ehe ich mich auf das Sofa fallen ließ. Ich schaute zu Babbo. Hatte er bemerkt, wie sich mein Puls bei der Erwähnung von Émile beschleunigte? Aber seine Augen waren geschlossen, und er spielte mit seinem Schnurrbart, drückte die Enden mit seinen Zeigefingern nach unten. Ich fragte mich, ob er wohl an Miss Stella Steyn dachte, die sein Buch illustriert hatte, oder daran, ob er seinen Schnurrbart noch mit Pomade striegeln sollte oder nicht, ehe wir zu Michaud gingen.
»Hat die Zeitung den Komponisten nicht erwähnt – wie hieß er doch gleich?« Babbo schlug die Augen auf und sah mich an, und seine Pupillen schwammen hinter den dicken Linsen seiner Brille wie schwarze Kaulquappen in einem Topf Milch.
»Émile Fernandez«, wiederholte ich. Würde er den weicheren Tonfall meiner Stimme bemerken? Während wir für meine Premiere arbeiteten, waren Émile und ich einander nähergekommen, und ich war mir nicht sicher, wie Babbo reagieren würde. Er war stets sehr besitzergreifend, wenn es um mich ging. Sowohl er als auch Mama brummelten stets, dass man diese Dinge in Irland ganz anders handhabte. Wenn ich ihnen widersprach, dass wir hier in Paris seien und alle anderen Tänzerinnen Hunderte von Liebhabern hätten, seufzte Babbo nur, und Mama senkte die Stimme und zischte: »Schlampen, schamlos, alle miteinander!«
»Ich rufe bei Miss Steyn an, und du kannst bei Mr Fernandez und deiner entzückenden Tanzfreundin anrufen, deren Name mir nicht einfällt.« Er fuhr sich mit der Hand zum Hals und rückte sorgfältig seine gepunktete Fliege zurecht.
»Kitten«, sagte ich und erinnerte mich dann, dass Mama und Babbo sie immer noch hartnäckig Miss Neel nannten. »Du weißt schon, Miss Neel. Wie kannst du ihren Namen vergessen? Sie ist seit Jahren meine beste Freundin.«
»Sie heißt wie das Kätzchen?« Er verstummte und wühlte in der Tasche seines Samtjacketts nach Zigaretten. Wir hörten die schweren Schritte meiner Mutter auf der Treppe.
»Ich denke, es wäre besser, deiner Mutter die Kritik deines Debüts nicht öfter als nötig vorzulesen.« Er hielt inne und schloss erneut die Augen. »Eine ihrer Eigenarten, weißt du.« Er steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und suchte in seinen Taschen nach Streichhölzern. »Tu mir den Gefallen und wirble noch ein letztes Mal für mich, mia bella bambina.«
So schnell ich konnte, vollführte ich eine dreifache Pirouette. Mama mochte es nicht, wenn ich im Wohnzimmer tanzte, und ich wollte nicht, dass ihr Zetern mir die Laune verdürbe.
Atemlos vom Aufstieg zu unserer Wohnung kam sie mit Armen voller Päckchen hereingeeilt, ihr ausladender Busen wogte. Babbo blinzelte und erklärte ihr, wir würden alle »für eine kleine Feier« zu Michaud gehen.
»Soll das heißen, dass Geld mit der Post gekommen ist?« Ich konnte sehen, wie ihre Augen den Raum absuchten, weil sie sicher sein wollte, dass ich keine Möbel umgestellt hatte, wie ich es manchmal tat, wenn sie nicht da war und Babbo mich bat, für ihn zu tanzen.
»Nein, mein Gebirgsblümchen.« Er legte eine Pause ein, um seine Zigarette anzuzünden. »Besser als Geld. Ganz Paris feiert den neuen Star Lucia, und das müssen wir auch tun. Heute Abend werden wir auf sie trinken und uns mit ihr brüsten.«
Mama stand da und hielt noch immer ihre Taschen in der Hand. Nur ihre Augen bewegten sich, verengten sich zu Schlitzen. »Etwa schon wieder deine Tanzerei, Lucia? Also wirklich, das bringt mich noch vor der Zeit ins Grab. Das und der Aufzug, der nie funktioniert, und all die Treppen, die ich hochsteigen muss.«
Ich spürte, wie dicke Luft aufzog, war aber an Mamas Leidensreden gewöhnt, und Babbo zwinkerte mir immer wieder verschwörerisch zu, sobald sie den Kopf abwandte. Also reichte ich ihr die Paris Times und ignorierte ihr Klagen. »Ich werde eine große Tänzerin, Mama. Lies nur.«
»Das mache ich, Lucia, aber erst muss ich meine Taschen auspacken und eine Tasse Tee trinken. Schau dir mal diese schönen Handschuhe an, Jim.« Sie ließ ihre Päckchen auf das Sofa fallen und begann Unmengen von schwarzem Seidenpapier abzuwickeln. Die Kälte, die plötzlich von ihr ausging, fühlte sich an, als wäre eine Windbö durch das Zimmer gefegt. Ich legte die Paris Times auf das Sofa und schlang mir die Arme um die Brust. Konnte sie sich nicht für mich freuen – nur dieses einzige Mal?
Babbo zwinkerte mir erneut zu und stieß dann eine lange Rauchwolke aus. »Das sind wirklich wunderschöne Handschuhe. Und nirgendwo werden sie eleganter aussehen als um den Stiel eines Glases gelegt, in dem Michauds berauschendster Champagner perlt.« Er deutete auf die Zeitung auf dem Sofa. »Lies das, Nora. Darin wird die Begabung unserer bella bambina beschrieben. Es erinnert mich an das Sprichwort vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt.«
»Heilige Muttergottes! Ihr seid wie zwei Kinder, die am Bonbonglas genascht haben.« Sie seufzte und schaute sich ihre neuen Handschuhe an. »Na ja, ich habe keine Lust zum Kochen, und ich denke, bei Michaud wird man meine Handschuhe bestimmt bewundern.« Sie schniefte und langte nach der Paris Times. »Hier sollte Giorgio drinstehen. Warum schreibt keiner über unseren Giorgio?« Sie stieß mit dem Fingernagel gegen die Zeitung.
»Das werden sie tun, Nora. Vielleicht hatte Lucia wieder einen ihrer Kassandra-Augenblicke, einen Traum von Giorgio?« Babbo sah mich erwartungsvoll an, doch ehe ich antworten konnte, fuhr Mama schon mit einem Schwall ätzender Kommentare über »blödsinnige Omen« und »verrückte Kassandras« dazwischen.
»Giorgios Zeit wird kommen, aber heute Abend feiern wir mein Regenbogenmädchen, meine Lichtgeberin.« Babbo blies einen Rauchring, und ich sah zu, wie er sich wabernd verschob und aufstieg, ehe er sich in der Luft auflöste.
»Was soll der Unsinn über Regenbogenmädchen? Erzählt mir nicht, dass die auch in die Zukunft sehen können.« Mama fuhr wütend mit ihren Fingern in die neuen Handschuhe.
»Aus meinem Buch … sie tollen reitend herum im Rausch … denn sie sind die Blüten. Nichts, worüber du dir deinen unbeugsamen Kopf zerbrechen musst.« Babbo starrte zur Decke und seufzte.
»Wieso kannst du nicht mal ein normales Buch schreiben, Jim? Das bringt mich noch um.« Zögerlich streckte sie ihre behandschuhten Finger nach der Paris Times aus. »Zieh was Leuchtendes an, Lucia. Heute Abend wollen wir uns nicht von Miss Stella Steyn in den Schatten stellen lassen. Welche Seite, sagtest du?«
*
Sobald der Oberkellner uns entdeckt hatte, bahnte er sich einen Weg durch die Menschenmenge in unsere Richtung. Mehrere Männer hielten Babbo an, um ihn zu begrüßen oder sich nach »Work in Progress« zu erkundigen. Nur Mama durfte den tatsächlichen Titel des Buches wissen, das Babbo sein »Work in Progress« nannte, und sie hatte schwören müssen, das Geheimnis zu wahren.
Während meine Eltern andere Gäste begrüßten, tauchte hinter mir Giorgio auf. »Tut mir leid, dass ich zu spät komme«, keuchte er. »Ich musste stundenlang auf die Straßenbahn warten. Aber ich habe die Zeitung gesehen – was für eine phantastische Kritik!« Er zog mich an sich und küsste mich auf die Schläfe. »Was für eine schlaue kleine Schwester ich habe! Wollen wir hoffen, dass du schon bald ein Vermögen verdienst und dass es auch reicht, um meine Gesangsstunden zu bezahlen.« Er verzog kurz das Gesicht und wandte den Kopf ab.
»Das wollen wir hoffen«, sagte ich, denn ich wollte nicht angeben. »Es geht wohl nicht so gut mit dem Gesangsunterricht?«
»Nicht gut genug, um Vaters Erwartungen zu erfüllen.« Giorgio nestelte am gestärkten Kragen seines Hemdes herum, und ich bemerkte, dass er dunkle Ringe unter den Augen hatte und ein Hauch Alkohol in seinem Atem war. »Ich muss ihn jeden Tag um Geld bitten, und er schaut mich dann immer an wie ein Hund, den man nicht gefüttert hat. Und seufzt enttäuscht, wie es seine Art ist.«
Ich legte tröstend meine Hand auf Giorgios Arm. Ich hasste es, ihn so entmutigt zu sehen. »Wenn ich anfange, Geld zu verdienen, werde ich dir helfen.«
Aber Giorgio reagierte nicht darauf. Stattdessen fragte er: »Erinnerst du dich an Mr und Mrs Cuddle-Cake?«
Ich lachte. »Die Eltern, die wir uns ausgedacht haben?«
Auf sein Gesicht trat ein Ausdruck der Wehmut. »Ich habe neulich nachts von ihnen geträumt. Sie haben uns endlich adoptiert, und Mr Cuddle-Cake hat mir das Reiten beigebracht.«
»Es ist wohl ein bisschen spät für Phantasie-Eltern.« Ich schaute zu Mama und Babbo zurück, die sich inmitten einer Phalanx von schwarz-weißen Kellnern einen Weg durch das gestopft volle Restaurant bahnten.
»Als wir Kinder waren, waren Mutter und Vater nie da. Und jetzt, da wir erwachsen sind, wollen sie uns nicht in Ruhe lassen. Mr und Mrs Cuddle-Cake wären anders gewesen, oder?«
»Natürlich. Aber die waren auch nicht real.« Ich wollte nicht über die Vergangenheit nachdenken, also zuckte ich übertrieben mit den Achseln und wollte ihn gerade daran erinnern, dass Mama ihn für perfekt hielt, als er sagte: »Sieh nur, sie sind alle da.«
Er deutete zu einem Tisch am Fenster, wo Stella, Émile und Kitten gelassen an der prachtvollen Tafel mit glänzendem Besteck und polierten Gläsern saßen. Der Lichtschein des Kronleuchters fiel auf Émiles strahlendes Gesicht, sein von Pomade glänzendes dunkles Haar und die orangefarbene Lilie, die er sich ins Knopfloch gesteckt hatte, und ich verspürte ein leichtes Flattern in der Brust. Er winkte mir zu, und ich sah, wie sich das Licht in den Farben des Regenbogens in seinen funkelnden Diamant-Manschettenknöpfen brach. Stella saß neben ihm und trug eine pfauenblaue Seidenbluse mit drei verdrehten Bernsteinketten, die ihr bis zur Taille reichten, dazu einen zitronengelben Turban mit Fransen, die über ihren Augenbrauen tanzten. Babbo erschien lautlos hinter uns und musterte sie mit dem forensischen Blick eines Botanikers, der eine ihm unbekannte Orchidee untersucht.
»Ich wünschte, ich könnte mich so kleiden«, flüsterte ich Kitten zu, während sie mir einen Kuss auf meine kalten Wangen gab. Stella strahlte solchen Wagemut aus, eine bohèmehafte Sorglosigkeit, nach der es mich verlangte. Doch Mama bestand darauf, meine Kleidung auszuwählen und zu kaufen, und so war die zwar stets elegant und gut geschneidert, hatte aber nie die Extravaganz der Kleider, die Stella trug.
»Du brauchst dir keine Gedanken über Kleider zu machen, Süße. Nicht nach deinem Debüt und dieser Kritik. Ich bin ernsthaft neidisch. Und du hast noch nicht gesehen, was sie unterhalb der Taille trägt! Haremshosen mit Fransen – sehr unpraktisch, wenn es regnet.« Kitten drückte mir liebevoll die Hand. »Aber was ist mit deinem Bruder? Er wirkt nicht so sorgenfrei wie sonst.«
Ich senkte die Stimme. »Geldsorgen, und ich glaube, er hat es satt, von Babbo abhängig und der Gnade unserer Mäzene ausgeliefert zu sein.«
»Ich bin sicher, alles wird gut, wenn dein Vater erst sein Buch nach Amerika verkaufen kann. Wieso starrt er Stella so an?«
»Sie illustriert ein Buch für ihn, und du kannst sicher sein, dass er einzig und allein daran denkt.« Ich fügte leise hinzu: »Er überlegt sich wahrscheinlich gerade, wie er sie auf Flämisch oder Latein oder mit gereimten Wortwitzen beschreiben kann.«
Ich ließ mich neben Émile auf die Bank gleiten, spürte die Hitze seines festen Körpers neben meinem. Rings um uns wirbelten die Klänge von Reden und Gelächter, das Klirren von Armreifen und Perlenketten, das Scharren der Stühle, das Klappern der Teller und Klirren der Gläser, Messer und Gabeln. Und in meinem Kopf wurde daraus der Applaus meines Debüts, so beglückend wie elektrisierend.
Babbo bestellte Champagner und Austern auf Eis, und sobald unsere Gläser eingeschenkt waren, schob er den Stuhl zurück und stand auf. »Ich trinke auf Lucia – Tänzerin, Sprachgenie, Künstlerin!«
»Dazu noch ihr makelloser Teint und ihre blauen Augen.« Mama erhob ihr Glas, reckte dabei den Hals und drehte den Kopf zum Kronleuchter. Mir kam plötzlich der flüchtige, aberwitzige Gedanke, dass sie eifersüchtig auf mich war. Aber irgendetwas lag in der Neigung ihres Kopfes unter dem Licht. Als wolle sie deutlich machen, dass ich mein Aussehen von ihr hatte. Da fiel mir auf, wie selten ich in letzter Zeit Babbos begehrliche Blicke auf ihr hatte ruhen sehen, wie selten er mit seinem typischen starren Blick der Melodie ihrer Sprache gelauscht hatte. All das war nun mir vorbehalten. Ich schaute über den Tisch, und da war er – hatte das Glas erhoben, blinzelte schwer, und sein Blick pendelte zwischen mir und Stella hin und her.
Der Champagner perlte in unseren Gläsern, das salzgrüne Aroma der Austern schwebte über dem Tisch, und kleine Schwaden von Zigarrenrauch wehten von den Gästen am Nachbartisch herüber, die applaudierten und mich anlächelten. Émiles Oberschenkel drückte gegen meinen, entschieden und voller Gewissheit. Und in diesem Augenblick schien mir, als könnte niemand glücklicher sein als ich, bis in alle Ewigkeit. Ich lehnte mich zu Émile und ließ meine Hand sein Bein hinaufwandern.
»Wo tanzen Sie als Nächstes, Lucia? Wird Josephine Baker die Bühne für Sie räumen müssen?« Stella schob ihren Turban zurecht, spießte dann mit ihrer Gabel eine Auster auf und ließ sie elegant in ihrem Mund verschwinden.
»Das ist eine Wilde, diese Mrs Baker. Tanzt nackt mit Bananen. Die sollte sich schämen!« Mama hob ihre Serviette und schlug sie aus, als hoffte sie damit alle Gedanken an die Tänzerin fortzuschütteln, die Paris mit ihren gewagten Auftritten im Sturm erobert hatte.
»Es heißt, dass sie ein Vermögen verdient«, sagte Giorgio. Er streckte seine Zungenspitze hervor und ließ sie kurz auf der Oberlippe ruhen. »Und anscheinend hat sie das Bananenröckchen inzwischen gegen eine sehr kleine rosafarbene Feder eingetauscht.«
»Sie ist nackt bis auf eine Feder?« Kittens Augen waren schreckensweit.
»Sie ist eine Hure, sonst nichts«, sagte Mama, deren Nasenflügel sich verächtlich blähten.
»Sie ist eine moderne junge Frau, und sie verdient ihr eigenes Geld. Ich sage, alle Achtung!« Stella erhob ihr Champagnerglas, ließ es aber rasch wieder sinken, als sie sah, wie Mama sie wütend anfunkelte.
»Sie hatte schon zwei Ehemänner, und jetzt heißt es, dass sie einen Liebhaber hat. Was für eine Dame ist das, frage ich Sie?«
»Deswegen kann sie nur mit einer Feder bekleidet auf der Bühne tanzen. Wenn sie nicht verheiratet wäre, würde ihr das nicht erlaubt«, sagte Kitten leise. »Mein Vater sagt, die Ehe ist die einzige Möglichkeit für eine Frau, frei zu sein, sogar heute und sogar in Paris. All diese emanzipierten Frauen in der Bohème mit ihren zum Bob geschnittenen Haaren, all der Trinkerei und Raucherei – mein Vater meint, diese Flapper sind eigentlich gar nicht frei.«
»Ich meine, dass es ein verdammt befreiendes Gefühl sein muss, nackt zu tanzen.« Giorgio schnaubte und drückte seine Zigarette aus. »Besonders wenn man damit ein Vermögen verdient. Freier kann man doch kaum sein.«
»Was für ein Unsinn!« Mit leuchtenden Augen stach Stella die Zinken ihrer Gabel in die Luft. »Frauen haben heute eine echte Chance auf Freiheit. Schaut euch doch nur all die Frauen in Paris an, die malen und tanzen und schreiben. Die sind nicht alle verheiratet.«
»Bravo, Stella«, rief ich und klatschte in die Hände. Stella hatte das, was Mama »ein ziemliches Mundwerk« nannte. Noch etwas, das ich an ihr bewunderte und worum ich sie beneidete. Ich wollte gerade sagen, wie frei es sich für mich anfühlte, mich in der Bewegung zu verlieren, wie befreiend das Tanzen war, ganz gleich, ob man reich oder arm war, bekleidet oder unbekleidet, als mir Giorgio das Wort abschnitt.
»Man sagt, sie erhält jede Woche Hunderte von Heiratsanträgen. Vielleicht sollte ich ihr auch einen machen. Was meinst du, Émile?« Er wandte sich zu Émile und klatschte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ich bin der gleichen Meinung wie Kitten. Die Ehe ist der Fels, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut, und die einzige Möglichkeit für uns alle, frei zu sein. So denken wir Juden. Die Ehe ist die Grundlage für alles. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch für eine Ehe mit Mrs Baker zutrifft.« Émiles Hand hatte unter der Tischdecke meine gefunden, und er streichelte während des Sprechens mit dem Daumen über meine Finger. »Was meinen Sie, Mr Joyce?«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Mama auf ihrem Stuhl unruhig hin und her rutschte und auf ihr Champagnerglas starrte. Babbo strich sich gedankenverloren mit den Fingern über das Kinn und glättete sich den Schnurrbart. »Ehe, Religion … Konventionen und Institutionen. Fesseln, die man abwerfen muss.« Er starrte auf den Teller mit den leeren Austernschalen, der vor ihm stand.
»Hört bloß nicht auf Jim. Was weiß der schon von Fesseln, meine Güte.« Mama seufzte kurz, als hätte ihr die Verzweiflung den Atem für einen längeren Seufzer genommen. Ich warf Giorgio einen fragenden Blick zu, aber dem baumelte eine nicht angezündete Zigarette von der Unterlippe, und er suchte gerade nach seinem Feuerzeug.
»Freiheit für Frauen und die Institution der Ehe sind nicht unvereinbar. Aber niemand kann die entscheidende Rolle der Familie in Frage stellen. Schaut euch doch die Joyce’ an.« Stella deutete über den Tisch, der mit Brotkrumen, Aschespuren und halbleeren Gläsern übersät war. »All die Jahre verheiratet, hingebungsvolle Eltern von Lucia und Giorgio. Wären die beiden so talentiert, so klug, wenn sie nicht geheiratet hätten?«
»Dann wären wir Bankerte in der Gosse.« Giorgios Mund weitete sich zu einem Gähnen. Als er es hinter der Faust unterdrückte, trafen sich unsere Blicke, und er zwinkerte mir zu. »Stattdessen sind wir die aufgehenden neuen Sterne auf der Bühne, nicht wahr, Lucia?«
»Nun, ich jedenfalls finde, dass Mrs Josephine Baker eingesperrt gehört. In Irland säße sie längst hinter Schloss und Riegel.« Mama schob ihr Glas von sich und schüttelte knapp den Kopf.
»Genau wie ich, Nora. Genau wie ich.« Babbo sagte das so leise in seinen Krawattenknoten hinein, dass nur ich ihn hörte, denn dann sprang Émile auf und rief: »Genug geredet von Gosse und Gefängnis. Noch ein Toast auf die talentierte und wunderschöne Lucia!« Er hob sein Glas, und wieder riefen alle meinen Namen.
In diesem Augenblick sah ich ihn. Er stand auf der Straße und schaute verstohlen durch das Fenster herein, war so nah, dass er beinahe mit der Nase das Glas berührte. Seine Augen waren hell und neugierig, und er schien Babbo anzusehen, doch dann wanderte sein Blick zu mir. Und in diesem Sekundenbruchteil geschah etwas Außergewöhnliches. Als unsere Blicke sich trafen, gab es eine Verbindung zwischen uns. Zwischen ihm und mir war etwas. Mein Herz tat einen gewaltigen Sprung. Dann senkte er den Kopf, seine Schultern sackten nach vorn, und er verschwand den Boulevard hinauf. Ich spürte, wie Émile wieder auf die Bank zurückglitt und erneut sein Bein gegen meines presste.
»Wo schaut sie denn jetzt schon wieder hin? Lucia? Wir trinken auf dich, und du glotzt einfach aus dem Fenster, als wärst du von irgendwas besessen.« Mama verdrehte verzweifelt die Augen.
Babbo runzelte die Stirn, stellte sein Champagnerglas wieder auf den Tisch und erhob seine Handfläche. »Still, Nora. Sie hat einen hellsichtigen Moment. Ruhe für meine Kassandra!«
»Es hat mich nur jemand durchs Fenster angestarrt«, sagte ich, noch benommen von dieser seltsamen Erfahrung, von der Intensität dieser Augen, dem plötzlichen Rucken meines Herzens. Ich winkte ab und wandte mich Émile zu, hoffte, Babbo damit von weiteren Reden über Kassandra abzuhalten.
»Einer von deinen neuen Anbetern, möchte ich wetten.« Kitten lachte und drückte meinen Unterarm. »Er hat dich wahrscheinlich aus der Zeitung wiedererkannt.«
»Wahrhaftig, der Preis des Ruhms. Ich kenne das nur zu gut.« Babbo sah sich am Tisch um, und seine Brillengläser warfen Lichtspiegelungen auf ein Gesicht nach dem anderen. »Du wirst es aushalten müssen, so gut du kannst, Lucia. Zweifellos stehen sie gleich draußen Schlange und wollen dein Autogramm.«
Würde er tatsächlich draußen warten? Der Mann mit den vogelhellen Augen und der Hakennase und den Wangenknochen wie Fischmessern? Nein. Er war mit der Dunkelheit verschmolzen. Und am Tisch lachten alle über Babbos Witz. Alle außer Émile, dessen Lippen so nah waren, dass seine Stimme mir im Ohr zischte, als er flüsterte: »Deine Bewunderer werden Schlange stehen. Ganz bestimmt!«
Und dann begann Babbo über die unbestreitbare Verbindung zwischen Tanz und Hellseherei zu predigen und erzählte uns von einem obskuren afrikanischen Stamm, dessen Mitglieder tanzten, bis sie Visionen von der Zukunft hatten. Ich wusste, dass seine Augen auf mich gerichtet waren, konnte mich aber nicht auf seine Worte konzentrieren.
»Und ich wette, die waren auch halbnackt«, sagte Mama mit dünner, schwacher Stimme. Erneut lachten alle.
Doch ich konnte an nichts anderes denken als an den Mann am Fenster. Ich spürte, wie sich eine seltsame Rastlosigkeit in mir ausbreitete, als sei tief in meinem Inneren etwas erwacht.
Und jetzt, da ich von der Höhe der Alpen, in der glasklaren, beißenden Luft, die mich hier umgibt, auf all das zurückblicke, erkenne ich, wie recht ich hatte. So unwahrscheinlich es auch damals schien, es erwachte wirklich etwas in mir, entfaltete sich tief in meinem Sonnengeflecht. Da fing es an.
Kapitel 2
November 1928, Paris
»Émile konnte gestern die Augen nicht von dir wenden.« Kitten erhob sich auf die Zehen, und ihre Wadenmuskeln traten wie dicke, verdrehte Seile hervor. »Er wäre eine unglaublich gute Partie, Lucia.«
»Du meinst, wegen seines Geldes?« Ich streckte mein Bein, dehnte mich, bis ich spürte, wie die Muskeln an meinen Knochen zerrten. Blasses Wintersonnenlicht fiel durchs Fenster, warf gezackte Schatten auf den Boden des Tanzstudios. Andere Tänzerinnen wärmten sich auf und wirbelten herum und begutachteten ihre Abbilder in der verspiegelten Wand, während wir auf den Tanzmeister warteten.
»Mein Vater sagt, die Familie Fernandez hat ein Wahnsinnsvermögen. Aber daran habe ich nicht gedacht. Meine Mutter meint, Émile könne der nächste Beethoven sein. Stell dir vor! Er könnte ganze Symphonien nur für dich komponieren.« Kitten reckte ihren Hals, rollte die Schultern und seufzte sehnsüchtig.
»Er ist sehr begabt, aber ich bin mir nicht sicher, dass er ein Beethoven ist«, sagte ich. Émiles Cousin war Darius Milhaud, einer der meistgefeierten Komponisten von Paris, der für seine elegante Verschmelzung von klassischer Musik und Jazz bekannt war. Émile sehnte sich danach, so innovativ zu komponieren wie er, und sprach oft davon, dass er die Strenge von Bach mit der Energie des Jazz in Einklang bringen wolle. Was, wenn Kittens Mutter recht hatte? Ich spürte vor Stolz einen Kloß im Hals. »Ich arbeite ungeheuer gern mit ihm – er ist einer der wenigen Komponisten, die sich freuen, wenn meine Choreographie Einfluss auf ihre Musik nimmt, ja sie sogar bestimmt. Jeder andere Komponist findet, dass die Choreographie die zweite Geige spielen sollte.« Ich rang mit den Händen.
»Oh, ich glaube, bei euch geht es um mehr als eure Arbeit. Und das weißt du auch.« Kitten schaute auf mich herab, ein wissendes Lächeln auf ihren modisch geschminkten Rosenknospenlippen.
»Ich gebe es zu – ich mag ihn sehr. Letzte Woche hat er mich in seinem neuen Auto in den Bois de Boulogne mitgenommen. Wir haben uns stundenlang geküsst.« Ich erinnerte mich an das Kratzen seines stoppeligen Kinns, daran, wie sein Schnurrbart mich an der Nase gekitzelt hatte, wie seine Hände gierig unter mein Kleid gelangt hatten.
»War es ein Vergnügen, Schätzchen?« Kittens Kopf fuhr mit einem Ruck zurück in die Ausgangsposition, ihre Schultern waren gestrafft, bereit für mein nächstes Geständnis. Aber dann hörten wir das Klappern des Klaviers und das kollektive Fußtrappeln der sich sammelnden Tänzerinnen. Monsieur Borlin kam in den Raum gerauscht, in einem weißen dreiteiligen Anzug, die Hände in weißen Glacéhandschuhen, schlug er mit der silbernen Spitze seines Stocks gegen die Seite des Klaviers. Ich atmete aus, erleichtert, Kitten nicht mit meiner Schilderung enttäuschen zu müssen, denn Émiles beharrliche Umarmungen hatten mich seltsam kalt gelassen und höchstens in Erstaunen versetzt. Ich hatte mir so sehr gewünscht, mich ihm wie ein schamloser Flapper hinzugeben. Stattdessen spürte ich, dass mein Blut kühl blieb und mein Inneres sich verschloss wie eine Faust.
»Gleich in die dritte Position«, befahl Monsieur Borlin. »Die Arme weit geöffnet nach oben … die Handflächen heben … und strecken.«
»Ich habe so eine Ahnung, dass Émile dir vielleicht einen Antrag machen wird«, flüsterte Kitten.
»Sei nicht albern! Ich bin arm, ich schiele, und ich bin keine Jüdin.« Ich streckte meine Finger gespreizt zur Decke, reckte mich, bis jeder Muskel und jede Sehne schmerzten. Aber Kittens Worte ließen meine Kopfhaut prickeln. Konnte es sein, dass Émile wirklich so leidenschaftliche Gefühle für mich hegte? Ich dachte an sein riesiges Haus mit der sahneweißen Steinfassade und den reich verzierten Balkonen vor jedem Fenster mit den blauen Läden. An die kunstvoll platzierten Blumen und die in kräftigen Strichen gespachtelten Gemälde, die seine Mutter liebte. An seine bewundernden Tanten und Schwestern, die so viel Aufhebens um mich machten, als wäre ich ein neues Hündchen. Und ich dachte an Émile, an seine Hände, die über die Klaviertasten huschten, an seine zufriedene Fröhlichkeit, seine weichen, liebevollen Augen.
»Sehr schön, Miss Joyce, so halten.« Monsieur Borlin stieß seinen Stock auf den Boden. »Klasse! Bitte sehen Sie sich Miss Joyce an. Beachten Sie die Position ihrer Füße, wie ruhig ihr Körper bleibt. Die Eleganz ihrer Arme.«
»Ich glaube, du irrst dich«, zischte Kitten. »Ich glaube, Émile ist in dich verliebt. Und warum sollte er es nicht sein? Du bist wunderschön, du bist eine der begabtesten Tänzerinnen von Paris, du bist klug – und liebenswürdig. Und dein Vater ist der meistgefeierte Schriftsteller der Welt.«
»Erste Position … die Arme heben, ganz durchstrecken … und weiter hochschieben!« Monsieur Borlin brüllte über die krachenden Akkorde des Pianisten hinweg. »Jetzt das linke Bein ausstrecken … nach oben … höher … höher!« Sein Stock krachte gegen den Ölofen, worauf dieser eine Wolke schwarzen Rauchs ausspuckte. »Und drehen!«
Ich spürte, wie die Muskeln in meinen Beinen brannten und mir der Schweiß auf die Oberlippe trat. Doch ich liebte dieses Gefühl, die Anspannung, die Kontrolle, das Gespür, wie jeder Muskel perfekt eingestimmt war und wie meine brodelnden Gedanken sich bei der Anstrengung beruhigten.
»Émile kann man unmöglich einen Korb geben, Süße.« Kitten verdrehte ihren Kopf, um mich anzuschauen. »Er ist so ein netter Kerl, immer lächelt er. Außerdem sieht er ziemlich gut aus auf seine jüdische Art.«
»Juden heiraten keine Nichtjuden, erst recht nicht, wenn ihr Vater ein bekannter Gotteslästerer ohne einen Centime in der Tasche ist.« Ich hielt meine Augen auf meinen linken Fuß gerichtet, während ich ihn hoch in die Luft reckte, um ihn mit der Kraft meines Willens ruhig zu halten, aber auch um Kittens Blick auszuweichen, während ich die unzähligen Gedanken zu verdrängen versuchte, die wieder begonnen hatten, in meinem Kopf herumzuwirbeln.
»Perfekt, Miss Joyce. Die Zehen weiter raus, Miss Neel. Strecken!« Monsieur Borlin hob seinen Stock und tippte mit der silbernen Spitze auf Kittens linken Fuß. »Weiter strecken, Miss Neel.« Als Monsieur Borlin vorbeigegangen war, senkte Kitten wieder die Stimme. »Wie geht es Giorgio? Der hat mich jedenfalls bestimmt nicht den ganzen Abend angestarrt.«
»Seine Gesangsstunden laugen ihn völlig aus. Babbo hat beschlossen, dass Giorgio ein berühmter Opernsänger werden soll – was Babbo selbst wollte, ehe er Schriftsteller wurde.« Ich schaute auf meinen linken Fuß, der immer noch in der Luft schwebte, und wünschte mir, Giorgio hätte einen anderen Weg eingeschlagen. Ich erinnerte mich noch an den Tag, als wir uns beide in der Musikschule einschrieben, einen Monat nach unserer Ankunft in Paris. Babbo hatte darauf bestanden, auf dem ganzen Weg dorthin zu singen, sogar in der Straßenbahn. Ein paar Monate später beschloss ich, dass es in der Familie Joyce schon zu viele aufstrebende Opernsänger gab, und ergriff die Flucht. Aber Giorgio hielt durch, ja er behauptete sogar, Singen wäre das Einzige, was er könne.
»Ich wette, Giorgios Musiklehrer ist nicht halb so anspruchsvoll wie Monsieur Borlin.« Kitten senkte langsam das Bein, ihr Gesicht war gerötet und mit Schweißperlen übersät.
»Tänzer, entspannen. Wir werden jetzt an Ihrer Improvisation arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie wären kubistische Porträts. Machen Sie aus Ihren Körpern Quadrate, Rechtecke, Linien. Ich möchte, dass Sie dabei der Freude und Seele der Musik Debussys nachspüren, ihren subtilen Rhythmen und ihrem kühnen Ausdruck.« Monsieur Borlin schniefte ein paarmal laut. »Achten Sie auf die Geometrie, die dieser Musik eigen ist. Ahmen Sie sie in Ihren Bewegungen nach. Eben darin werden Sie die Schönheit des freien Tanzes finden, des Modern Dance!«
Ich krümmte meinen Rücken und reichte mit meinen Händen zu meinen Fußgelenken, machte meine Rippen, meinen Bauch, meine Brust ganz flach. Ich konnte hören, wie Monsieur Borlin zwischen seinen Schnaufern rief: »Ein wunderschönes Dreieck, Miss Joyce. Tänzer, schauen Sie sich Miss Joyce’ Dreieck an!« Er schritt durch den Raum, stieß und knuffte Tänzer mit seinem Stock und bellte Anweisungen. »Lassen Sie die Musik durch Ihre Gliedmaßen strömen. Sie sollte die Grundlage für Ihre Formen und Linien sein … Das ist sehr gut, Miss Neel.«
Ich atmete tief und lang, und während ich meine Stirn an die Fußbodenbretter drückte, dachte ich an Émile und an das, was Kitten gesagt hatte. Émile konnte mich niemals heiraten, aber es war erfreulich, bewundert zu werden, und die Wörter »Madame Fernandez« fühlten sich auf meiner Zunge gut an, angenehm elliptisch.
Und dann dachte ich an den Mann mit den vogelhellen Augen, und mein Herz schwang sich auf und stürzte sich wieder hinab. Sollte ich Kitten erzählen, dass mich eine Vorahnung erfasst hatte? Ähnlich wie Babbo glaubte sie tatsächlich an meine hellseherischen Fähigkeiten. Aber selbst sie würde das für lächerlich halten – der flüchtige Blick eines Fremden, was bedeutete das schon? Doch ich erinnerte mich an das seltsame Hüpfen meines Herzens. Viele Jahre zuvor, als Babbo mich zum ersten Mal »seine Kassandra« nannte, hatte Mama mich nach allen Regeln der Kunst über meine »Kassandra-Augenblicke« ausgefragt. Als ich ihr das merkwürdige körperliche Gefühl beschrieb, das jeden dieser Momente begleitete, hatte Babbo seinen Brieföffner in die Luft geworfen und mit vor Aufregung heiserer Stimme gesagt: »Willst du ihr jetzt endlich glauben, Nora?«
Aber ich erzählte Kitten nichts davon. Ich wollte nicht mehr über meine Vorahnungen nachdenken. Manchmal bedrückten sie mich wie Steine auf der Brust. Also schloss ich die Augen. Spürte, wie die Musik mich durchströmte. Hörte, wie Monsieur Borlins Stock auf den Boden, auf das Klavier, auf den Ofen knallte. Schlug die Augen wieder auf.
»Margaret Morris aus London gibt nächstes Wochenende eine Meisterklasse in Bewegung. Wollen wir teilnehmen? Anscheinend ist ihre Trainingsmethode in England der letzte Schrei.« Kitten linste mich unter ihrer Achsel hervor an, und eine Sekunde lang schienen silbrige Tränen in ihren Augen zu schimmern. Aber dann zwinkerte sie, und ich fragte mich, ob sie nur Staub im Auge gehabt hatte.
»Das würde ich gern, Kitten. Und ich habe eine neue Idee für eine Choreographie, die ich dir nach dem Unterricht zeigen möchte.«
Ein neuer Tanz nahm langsam in meinen Gedanken Gestalt an. Ein Gedicht von Keats hatte mich dazu inspiriert, und ich wollte darin schillernde Regenbogen entstehen lassen, vielleicht auch ein paar archaische Elemente von Stammestänzen hineinnehmen, um Babbo bei seinem Buch zu helfen. Es sollte ein wilder Freudentanz werden, der das Publikum von den Stühlen reißen würde. Der Plan war ehrgeizig, mehrere Tänzer wären vonnöten, von denen jeder in einer Farbe des Regenbogens gekleidet sein würde. Ich dachte daran, sie alle miteinander zu verweben, sie zu Knoten und Bändern aus Farbe zusammenzuziehen, dann über die ganze Bühne zu zerstreuen, wo sie sanft wirbeln würden wie zu Boden schwebende Ahornnasen. Ich hatte das Émile gegenüber noch nicht erwähnt, hoffte aber, dass er mir wieder die passende Musik komponieren würde, die vom ruhelosen Rhythmus großer Trommeln getragen werden müsste.
»O ja, bitte! Ich weiß nicht, woher du immer deine Ideen nimmst. Anscheinend hab ich nie welche.« Ihre Worte wurden von der nasalen Stimme Monsieur Borlins übertönt, der uns ermahnte: »Atmen! Vergessen Sie nicht zu atmen!«
Ja, Tanz war meine Antwort. Was immer das Leben mir abverlangte, ich musste weitertanzen.
Kapitel 3
November 1928, Paris
»Du kannst den beiden was zu trinken bringen, Lucia. Es ist nach fünf.« Mama reichte mir eine gekühlte Flasche Weißwein und zwei Gläser. »Er liest jetzt schon beinahe zwei Stunden. Er muss ja völlig ausgetrocknet sein, der arme Kerl.«
»Ist es Mr McGreevy oder Mr McAlmon?«, fragte ich. In den letzten Wochen hatten die beiden Babbo abwechselnd nachmittags vorgelesen. Ich hoffte, dass es Mr McGreevy war. Er war nicht so ein Aufschneider wie Mr McAlmon.
»Keiner von beiden. Jetzt steh auf, und trag den Wein rein, oder die beiden schleichen sich ins Café Francis, und wir sehen sie den ganzen Abend nicht wieder.«
»Ich kann mich nicht rühren. Ich habe heute acht Stunden getanzt. Wir haben für den Film geprobt, von dem ich dir erzählt habe, und mir tut jeder Knochen im Leib weh. Ich bin den ganzen Heimweg gehumpelt.« Ich deutete auf meine Füße, von denen sich kleine Hautlappen gelöst hatten.
»Ach, jammre nicht so rum. Du bist selbst schuld. Der Neue sieht nett aus.« Sie machte eine Pause und deutete mit dem Kopf zu Babbos Arbeitszimmer. »Ire. Spricht Französisch und Italienisch und überhaupt. Es gibt nicht viele irische Männer, die so was können.«
»Wie heißt er?« Ich hievte mich auf die Sofakante.
»Ich kann mich nicht erinnern. Heutzutage hängen deinem Vater so viele Leute an den Lippen. Gott allein weiß, wo die alle herkommen.« Sie seufzte, setzte sich und begann eine Modezeitschrift durchzublättern. »Wenn Gott selbst auf die Erde käme, der säße auch da drin und würde das Buch deines Vaters tippen.«
*
Der Fußboden von Babbos Arbeitszimmer war mit irischen Zeitungen übersät. Bücher waren überall im Raum gestapelt. Babbo trug seine weiße Jacke, die ihn wie einen Zahnarzt aussehen ließ, und hockte da wie immer, die Beine übereinandergeschlagen und die Zehen seines oberen Fußes unter den unteren geklemmt. Ihm gegenüber saß wie ein Spiegelbild ein großer dünner Mann, hatte seine Beine auf genau dieselbe Weise verschlungen, und las laut aus Dantes »Inferno« vor.
Ich erkannte ihn, sobald er aufsah – den Mann vom Fenster. Ich starrte ihn an, täuschte ich mich? Nein, er war es ganz gewiss. Nur waren seine Augen jetzt blaugrüne, unergründliche Tümpel. Er trug eine runde Nickelbrille, genau wie die von Babbo, wenn auch mit sehr viel dünneren Gläsern, und einen grauen Tweedanzug. Und als er mich anschaute, war da ein Schauder des Erkennens zwischen uns.
»Ah, Weißwein. Wunderbar.« Babbo stand auf und nahm mir die Flasche und die Gläser ab. »Das ist meine Tochter Lucia«, sagte er, ehe er sich an mich wandte und hinzufügte: »Mr Beckett ist gerade aus Deutschland gekommen. Wir müssen ihm helfen, sich hier einzuleben, findest du nicht auch?«
»Ja, natürlich. Wo wohnen Sie, Mr Beckett?« Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten, aber ich spürte, wie mein Brustkorb sich mit Luft füllte.
»In der Universität, in der École Normale in der Rue d’Ulm. Ich unterrichte da.« Er sprach mit weichem irischem Akzent, der durch den Raum zu plätschern schien.
»Ist es schön, dort zu wohnen?«
»Das Wasser ist immer kalt, und die Küche ist von Schaben überlaufen. Aber die Bibliothek ist großartig, und ich habe ein Bett und ein paar Regalbretter.« Sein unverwandter Blick ruhte ein paar Sekunden auf meinen Augen, dann schaute er auf seine Füße, und ich bemerkte, dass seine Wangen gerötet waren. Erst später, als ich mich wieder beruhigt hatte, fragte ich mich, ob auch ihn bei unserem ersten Treffen die Gefühle übermannt hatten.
»Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Küchenschaben, Mr Beckett. In Paris gibt es so viele Restaurants. Warum essen Sie heute Abend nicht mit uns? Wir gehen zu Fouquet’s. Lucia, lauf und sag deiner Mutter, dass wir zu Fouquet’s gehen und Beckett unser Gast ist.«
*
Mama wand sich vor dem Spiegel hin und her. »Dieser Hut oder der schwarze, Lucia?«
Ihre Worte schwebten durch die Luft wie Dunst. Ich hörte sie kaum, während ich aus dem Fenster starrte und mir den Hals in Richtung der Rue d’Ulm verrenkte. Wenige letzte Blätter hingen noch an den Zweigen der Bäume. Und darunter warfen die Straßenlaternen ausgefranste Lichtkreise auf die Pflastersteine der Straße. Der Duft gebratener Maronen von den Kohlenpfannen der Rue de Grenelle sickerte durch das schlecht schließende Fenster herein, aber auch das bemerkte ich kaum. Ich bewegte mich wie im Traum, spürte kaum den Boden unter meinen Füßen. Wo ich auch hinsah, erkannte ich nur Mr Becketts Züge – seine Wangenknochen in den kahlen Ästen der Bäume, seine Augen widergespiegelt im dunkler werdenden Wogen des Himmels. Meine Haut kribbelte am ganzen Körper, und ich fühlte mich leicht und angespannt zugleich. Ich sagte tonlos seinen Namen, immer und immer wieder. Beckett. Beckett. Beckett.
»Lucia! Was um alles in der Welt ist bloß mit dir los? Hörst du mich nicht? Ich könnte genauso gut Selbstgespräche führen. Ich hab mich ohnehin für den schwarzen Hut entschieden. Der passt besser zu meinem Mantel.« Mama strich sich ein paar lose Haarsträhnen hinter die Ohren. »Was starrst du so, Mädel? Hol deinen Hut und die Handschuhe.«
Die Tür zu Babbos Arbeitszimmer ging auf, und plötzlich stand Mr Beckett vor mir, er lächelte verlegen, und seine Augen huschten durch den Flur, nahmen alles in sich auf: die griechische Fahne, die wir als Glücksbringer an die Wand geheftet hatten; die Fotos von uns allen, ernst und feierlich in unseren besten Kleidern; die Bücherstapel, die in Miss Beachs Leihbücherei zurückgebracht werden mussten. Während Babbo und Mama sich auf die Suche nach Babbos Spazierstock machten, fragte mich Beckett nach Fouquet’s.
»Ist es ein vornehmes Restaurant? Bin ich passend angezogen?« Ich hörte ein leichtes Beben in seiner Stimme, eine Unsicherheit, die sich auf seinem Gesicht nicht zeigte. Ich musterte ihn von Kopf bis Fuß. Sein Anzug war an den Knien verschlissen und hing an ihm wie an einem Kleiderbügel. An seinem Hemd fehlte ein Knopf. Sein Schlips war so eng um seinen Hals gezurrt, dass es aussah, als liefe er Gefahr, davon erstickt zu werden.
»Wir gehen immer da hin«, stotterte ich. »Es ist auf den Champs-Élysées, also fahren wir wohl mit dem Taxi, denke ich.« Ich merkte, wie mir die Röte in die Wangen stieg und mein Körper zu prickeln begann. Warum konnte ich mich jetzt nicht so in den Griff bekommen, wie wenn ich tanzte? Warum war ich so unbeholfen? So sprachlos?
»Ich habe bessere Anzüge in meinem Zimmer.« Beckett schlug die Augen nieder.
»Sie sehen gut aus«, sagte ich mit lauter, übertriebener Stimme, von der ich hoffte, sie würde das Wummern meines Herzens übertönen. »Genau richtig.«
Als ich mich zur Wohnungstür wandte, spürte ich, wie Becketts Augen an meinem Körper auf und ab wanderten. Ja, es war eine gute Entscheidung gewesen, das kirschrote Kleid mit dem Fransensaum anzuziehen. Es unterstrich meine Tänzerinnenfigur und meine langen, schlanken Beine und ließ meinen Busen so klein und flach erscheinen, wie es gerade Mode war.
Und dann trat er zum Fenster und schaute hinaus, hatte mir den Rücken zugewandt, stand steif und aufrecht da. »Sie haben eine wunderbare Aussicht auf den Eiffelturm, Miss Joyce.«
Ich gesellte mich zu ihm, und zusammen schauten wir auf die Lichter von Paris. Die Stadt schien zu blitzen und zu glitzern mit all den Lichtern der Bars und Restaurants, den zittrigen Straßenlaternen, den hellen Streifen der Autoscheinwerfer. Und über all dem lenkten die Lichter des Eiffelturms unsere Augen gen Himmel. Ich war mir plötzlich des Duftes von Becketts Rasierseife und der Wärme seines Körpers neben mir bewusst. Und meines Herzens, das immer noch gegen meinen Brustkorb hämmerte.
»Das ist der Vorteil, wenn man im fünften Stock wohnt«, sagte ich, und meine Stimme schien die Wände hinauf und über die Zimmerdecke zu hüpfen.
»Was für einen Unsinn du redest, Lucia! Diese schrecklichen Treppen, die ich hochsteigen muss, mit all den Einkäufen, tagaus, tagein.« Mama und Babbo waren hinter uns getreten, hatten einander untergehakt.
»Ah, Sie genießen den Anblick des Eiffelturms, Mr Beckett. Hat Lucia Ihnen schon erzählt, wie wir diesen furchtbaren Turm einmal hinaufgestiegen sind?«
»Nein, das hat sie nicht, Sir.« Beckett wandte mir erwartungsvoll das Gesicht zu.
Ich machte den Mund auf, um zu reden, aber mir fehlten die Worte. Genau wie an dem Tag, als Babbo und ich oben auf dem Eiffelturm standen, uns an den Handlauf klammerten und auf die geschrumpfte Stadt hinabschauten. Damals überkam mich ein Gefühl des Schwindels, das mich auch jetzt ergriff, mich stumm und zittrig machte. Plötzlich wollte ich die Hand ausstrecken und Beckett berühren, mich an ihm festhalten wie damals an jenem Tag an Babbo, Becketts Arm packen, wie ich auf der Spitze des Eiffelturms den Arm meines Vaters gepackt hatte.
»Ich sehe La Tour Eiffel als ein Skelett, einen Kadaver, ein Gerippe, das bedrohlich über uns hängt«, murmelte Babbo und gestikulierte mit seiner Zigarette in Richtung des Fensters.
»Nein, das tust du nicht, Jim«, erwiderte Mama. »Du denkst nie daran. Du denkst nur an Irland, und das weißt du sehr gut. Wir gehen jetzt besser, oder unser Tisch ist weg. Lucia, mach den Mund zu, ehe du noch eine Fliege verschluckst. Ich wünschte, Giorgio wäre hier. Er ist immer unterwegs dieser Tage. Immer bei seinen Gesangsstunden. Ich werde ihn bitten, Ihnen Paris zu zeigen, Mr Beckett.«
Und mit diesen Worten zog sie Babbo auf die Wohnungstür zu und die Treppe hinunter. Ich schaute Beckett mit heißen Wangen an. Ich dachte, ich hätte eine Spur von einem Lächeln auf seinen Lippen entdeckt, aber er sagte nur: »Nach Ihnen, Miss Joyce.«
Ich spürte den nagenden Schmerz der Blase, wo meine Ferse gegen den Schuh rieb. Aber dann dachte ich an Beckett knapp hinter mir, und der Schmerz verging beinahe sofort, als wären meine blasengeplagten, schwieligen Füße verschwunden. Wohin war der Schmerz? Ich versuchte, mich auf meine Ferse zu konzentrieren, die Blase zu spüren, die nur Minuten zuvor gepocht und genässt hatte. Ich spürte nichts. Stattdessen schienen meine Füße zu schweben, zu den Schlägen von Babbos metallener Stockspitze auf den Steinstufen zu tanzen.
Und dann dachte ich an Michaud zurück, wo ich zuerst Becketts Augen durch das Fenster gesehen hatte. Ich erinnerte mich an die Verstrickung unserer Blicke durch das Glas hindurch, den Funken, der zwischen uns übergesprungen war, das unerklärliche Hüpfen meines Herzens. Und hatte Babbo nicht gesagt, dass ich einen hellsichtigen Augenblick gehabt hatte? Hatte er nicht die Hand erhoben, um alle zum Schweigen zu bringen? Er hatte es auch gespürt – die außergewöhnliche Kraft dieses Sekundenbruchteils. Ich fühlte, wie sich mir die Nackenhaare aufstellten. Sollte Beckett mein Schicksal sein?
*
Bei Fouquet’s machten die Kellner viel Aufhebens um Babbo, stießen einander mit den Ellbogen aus dem Weg, damit sie seinen Spazierstock nehmen oder ihn zu seinem üblichen Tisch führen oder ihm die Speisekarte reichen konnten. Beckett schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an, und ich ergriff die Gelegenheit, mich zu ihm hinzulehnen und zu flüstern: »Er ist für sein großzügiges Trinkgeld berühmt … Sie tanzen immer um ihn herum wie dressierte Affen.«
Becketts Augen wurden groß.
»Er hat vermögende Mäzene«, erklärte ich. »Wir waren früher sehr arm, aber jetzt schicken uns ein reicher Amerikaner und eine reiche Engländerin jeden Monat telegrafisch Geld. Also können wir auswärts essen, wann immer wir wollen.« Ich erzählte ihm nicht, dass wir das Geld unserer Mäzene so mühelos ausgaben, dass wir ständig um mehr bitten mussten.
Beckett schaute sich um, und als er sah, dass Mama und Babbo an der Bar mit einem anderen Paar redeten, wandte er sich wieder zu mir und sagte: »Tatsächlich, Miss Joyce?«
Ich nickte, wollte ihm gerade alles vom Square de Robiac erzählen, wie wunderbar es für Babbo war, ein eigenes Arbeitszimmer, für mich, mein eigenes Schlafzimmer zu haben, wie großartig es war, über ein Telefon und elektrisches Licht und unser eigenes Bad mit Messinghähnen zu verfügen, als er abrupt das Thema wechselte: »Ihr Vater sagt, Sie seien eine sehr begabte Tänzerin, Miss Joyce?«
»Ich tanze jeden Tag, den ganzen Tag.« Ich nahm den Hut ab und schüttelte mein Haar aus. Die Nervosität von vorhin verging nun, jetzt, da ich die Hand des Schicksals erkannt hatte, die am Werk war. »Ich lasse mich zur professionellen Tänzerin ausbilden. Tanzen ist das Göttlichste auf der Welt. Tanzen Sie, Mr Beckett?«
Er schüttelte den Kopf.