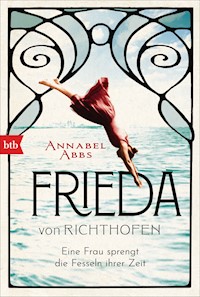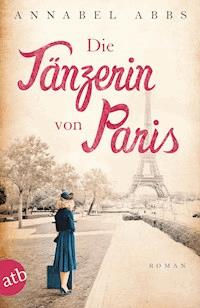6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 1835. London wird geradezu überschwemmt mit aufregenden neuen Zutaten, seltenen Gewürzen und exotischen Früchten. Aber niemand weiß, wie man sie verwenden soll. Als Eliza Acton von ihrem Verleger aufgefordert wird, ihre Gedichte in der Schublade liegen zu lassen und dafür lieber ein Kochbuch zu schreiben, ist sie entsetzt: Ausgerechnet sie, die sie noch nie einen Fuß in eine Küche gesetzt hat? Als aber die Schulden ihres Vaters überhand nehmen und er England und seine Familie verlassen muss, bleibt ihr keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen. Eliza beginnt, Rezepte zu sammeln und sich selbst das Kochen beizubringen. Und sie stellt die junge, mittellose Ann Kirby als Hilfe ein. Eine ungewöhnliche Freundschaft entsteht, die die Grenzen der gesellschaftlichen Klassen überwindet und zum ersten modernen Kochbuch führt. Gemeinsam verändern die beiden Frauen die Kunst des Kochens für immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Die faszinierende Geschichte der Eliza Acton und ihrer Assistentin, die gemeinsam die britische Küche und Kochbücher auf der ganzen Welt revolutionierten.
England, 1835. London wird geradezu überschwemmt mit aufregenden neuen Zutaten, seltenen Gewürzen und exotischen Früchten. Aber niemand weiß, wie man sie verwenden soll. Als Eliza Acton von ihrem Verleger aufgefordert wird, ihre Gedichte in der Schublade liegen zu lassen und dafür lieber ein Kochbuch zu schreiben, ist sie entsetzt: Ausgerechnet sie, die sie noch nie einen Fuß in eine Küche gesetzt hat? Als aber ihr Vater Bankrott anmelden muss, bleibt ihr als Frau keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen. Eliza beginnt, Rezepte zu sammeln und sich selbst das Kochen beizubringen. Und sie stellt die junge, mittellose Ann Kirby als Hilfe ein. Eine ungewöhnliche Freundschaft entsteht, die die Grenzen der gesellschaftlichen Klassen überwindet und zum ersten modernen Kochbuch führt. Gemeinsam verändern die beiden Frauen die Kunst des Kochens für immer.
Zur Autorin
Annabel Abbs ist Schriftstellerin und Journalistin. Ihre Romanbiografie »Frieda« wurde als »Times Book of the Year« ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrem Mann und vier Kindern in London und Sussex.
Annabel Abbs
Miss Elizas englische Küche
Eine wahre Geschichte über eine besondere Freundschaft
Aus dem Englischen von Michaela Meßner
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Miss Eliza’s English Kitchen« bei William Morrow, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Erstveröffentlichung Juni 2022 Copyright © 2021 Annabel Abbs Copyright © der deutschen Ausgabe 2022 btb Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Lektorat: Susanne Wallbaum Covergestaltung: semper smile, München nach einem Motiv von © Trevillion Images/Magdalena Russocka, Trevillion Images/Ilina Simeonova; Shutterstock Klü · Herstellung: sc Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Für meine Tochter Bryony, meine Schriftstellerkollegin und Küchengefährtin
Die Welt schlägt Wunden; zeig das Herz mir, das nicht ein Leid bewahrt wie einen Schatz.
Letitia Elizabeth Landon, Secrets, 1839
Doch ach, der tiefste Gram von allen gedeiht noch immer in tränenloser Qual.
Eliza Acton, Yes Leave Me, 1826
Ich würde vermuten, dass Anon, der so viele Gedichte schrieb, ohne sie zu unterschreiben, oft eine Frau war.
Virginia Woolf, Ein eigenes Zimmer, 1929
Vorwort
Dies ist ein fiktionales Werk. Es stützt sich auf eine Handvoll Fakten, die über das Leben der Dichterin und Pionierköchin Eliza Acton und deren Assistentin Ann Kirby bekannt sind. Zwischen 1835 und 1845 lebten Eliza und Ann in Tonbridge, in der Grafschaft Kent, und schrieben an einem Kochbuch, das als »das größte englische Kochbuch aller Zeiten« (Bee Wilson, The Telegraph), als »das größte Kochbuch in unserer Sprache« (Dr. Joan Thirsk CBE) und als »mein geliebter Begleiter […], erhellend und tonangebend« (Elizabeth David) bezeichnet wurde. Zu seiner Zeit war es ein Bestseller – sowohl international als auch im Vereinigten Königreich –, binnen dreißig Jahren wurden über 125 000 Exemplare verkauft. Eliza Acton hatte großen Einfluss auf spätere Kochbuchautorinnen, darunter Delia Smith, die Eliza Acton als »die beste englischsprachige Kochbuchautorin« beschrieb, »… eine große Inspiration, … ein starker Einfluss«.
Prolog
1861, Greenwich, London
ANN
Bevor Mr Whitmarch das Haus verlässt, um zur Arbeit zu gehen, tut er etwas für ihn höchst Untypisches. Er überreicht mir ein Geschenk. Eingeschlagen in braunes Papier. Ohne Band, nur mit einer Schnur umwickelt. Ein Geschenk ist es trotzdem.
»Das ist für dich, meine Ann«, sagt er, und schon blicken seine wässrigen Augen wieder auf die Taschenuhr. Er nennt mich gern »seine Ann«, doch ich denke, »Mrs Kirby« wäre für eine Bedienstete meines Alters und meiner Erfahrung angemessener. Ich komme natürlich nicht nur den Dienstpflichten nach. Ich halte auch nachts sein Bett warm und flechte die seidig glänzenden Haare seiner mutterlosen Töchter.
Sobald die Schritte seiner Ledersohlen auf dem Marmorboden ganz verklungen sind, betrachte ich das Päckchen neugierig. Ich weiß, es ist ein Buch. Das verraten seine Form und sein Gewicht. Ich löse die Schnur und reiße an dem Papier, in meinem Kopf rast und tanzt es. Als wäre jemand mit einem Schneebesen hineingeklettert und würde mein Hirn schaumig schlagen.
Ist es ein Gedichtband? Oder ein Roman? Oder ein Atlas? Und warum hat er mir überhaupt ein Geschenk gemacht? Das Papier fällt in unschönen Fetzen zu Boden. Das passt gar nicht zu mir, so bin ich sonst nicht, so … Ich halte inne und suche nach dem Wort. Überschwänglich. Ich lächle, denn ich weiß genau, wer mir das Wort überschwänglich beigebracht hat.
Mr Whitmarch weiß, dass ich gern lese, denn er hat mich dabei ertappt. In flagranti. Das erste Mal in seiner Bibliothek, als ich mir seine Landkartensammlung ansah. Dann vor dem Herd, vertieft in einen Gedichtband. Und danach hat er mich mit der Nase in einem Roman erwischt, als ich eigentlich die Dielenböden hätte bohnern müssen, bis sie glänzen. Aber ist das nicht auch der Grund, weshalb er mich so bereitwillig in sein Bett geholt hat? Und warum er mich so zärtlich seine Ann nennt?
Ein leichtes Zucken umspielt meine Mundwinkel, aber dann wird es schneller. Und der Quirl in meinem Kopf hält abrupt inne. Jetzt ist das Einpackpapier ab, es liegt in Fetzen und Streifen zu meinen Füßen. Und das Buch ist ein kolossaler Band, weder Gedichte noch ein Roman. Auch kein Atlas. Ich drehe es um, schnuppere an dem kalbsledernen Einband, taste den Lederrücken ab, der weich ist wie Haut. Dann fahre ich mit den Fingerspitzen über den Einband, über die erhabene Goldschrift des Titels. Mrs Beetons Buch der Haushaltsführung.
Warum sollte ich so ein Buch haben wollen? Enttäuschung macht sich in mir breit, meine Finger rutschen ab, die Seiten knicken, rascheln, zerknittern. Und Worte zucken und wirbeln vor meinen Augen.
Kalbshaxe mit Reis … Tartarensenf … Steckrüben in weißer Soße … Stachelbeerpudding. Meinem Mund entfährt ein höchst unelegantes, schnaubendes Keuchen. Mr Whitmarsh hat mir ein Rezeptbuch gekauft! Dieser Mann ist ein größerer Schelm, als ich dachte.
Meine Finger bewegen sich nicht mehr ganz so hastig, mein Blick gleitet langsamer über die Seiten. Schließlich stehe ich stocksteif da und lese – Wort für Wort – ein Rezept für lebend tranchierten Lachs mit Kapernsauce. Mich packt ein sehr eigenartiges Gefühl, als wäre die Welt stehen geblieben, um mich herum eingefroren. Mein Gehirn, das noch vor ein paar Minuten zu einem Schaumberg aufgeschlagen werden sollte, wird klein und fest und still. Wie eine Haselnuss.
Jedes Wort, jede Zutat, ist mir auf unheimliche Weise vertraut. Ich blättere um. Und lese. Und blättere wieder um. Und wieder. Allmählich, sehr allmählich, dämmert es mir. Das sind meine Rezepte. Und ihre natürlich. Ich erkenne sie wieder, weil ich diese Gerichte gekocht habe. Weil ich meine Anmerkungen dazu auf eine Tafel geschrieben habe. Mit einem Stück Kreide. Tag für Tag. Jahr um Jahr.
Unsere Rezepte sind gestohlen und auf leeren weißen Seiten zusammengetragen worden, ohne ihre eleganten sprachlichen Finten und Wendungen, ohne ihren Witz und Humor. Übrig geblieben sind nur die Gerippe – kalte, uncharmante Auflistungen von Anweisungen und Zutaten – verfasst angeblich von einer Mrs Beeton, wer immer das sein mag. Dabei gehören sie mir und Miss Eliza, die noch nicht lange unter der Erde ist.
Ich lese weiter, lasse mir jedes Gericht einzeln auf der Zunge zergehen: süßes, cremiges Lauchgemüse, junge Palerbsen, in Butter geschwenkt, Baiser, so frisch und leicht wie Schnee. Und kehre ganz allmählich, Rezept für Rezept, in die Küche von Bordyke House zurück. Die Luft geschwängert vom Rauch über dem Bratrost mit den Tauben, vom Duft der Zwiebeln in der Pfanne, der leise vor sich hin köchelnden Pflaumen. Dazu der Gesang all der Gegenstände: das Quietschen der Wasserpumpe, das Spucken der Holzscheite im Herd, das Scheppern der Zinngefäße und das Klappern des Bestecks, das dumpfe Klopfen des Nudelholzes, das endlose Blubbern und Simmern im Suppentopf.
Ich stoße Mr Whitmarks Buch mit meinen gestohlenen Rezepten von mir, sein Geschenk, und bücke mich langsam, knie mich hin, um das Papier vom Boden aufzusammeln.
Und da höre ich sie. Ich erkenne ihren Gang auf den Steinfliesen – so zielstrebig und entschlossen. Sie kommt auf mich zu, die Röcke schwingen um ihre Knöchel. Ihre Stimme, so entschieden wie sanft, ruft: Ann? Ann?
Was dann kommt, kenne ich auswendig: Heute haben wir alle Hände voll zu tun, Ann. Ich warte. Doch es herrscht Stille. Von draußen dringen nur die schwachen Töne einer Taube herein, flachgehobelt vom Wind. Dann kräht der junge Hahn von nebenan aus voller Kehle.
Und ich weiß, was ich zu tun habe.
1
ELIZA
Fischgräten
Mittagsstunde in der Londoner City, das Rattern der Karren und Kutschen auf dem Kopfsteinpflaster, das Geschrei der Obst- und Gemüsehändler, das Gedränge von Schubkarren und Leiterwagen, schmalbrüstige Jungen, die hemdlos und hechelnd wie verhungernde Vögelchen noch den letzten dampfenden Dunghaufen wegschaufeln. Es ist der heißeste Tag des Jahres – zumindest kommt es mir so vor, denn ich glühe, in mein bestes Seidenkleid eingeschnürt wie in ein Korsett. In der Paternoster Road strahlt jeder Backstein, jeder Messingklingelzug, jedes Eisengeländer Hitze ab. Selbst die Holzgerüste, die all die halbfertigen Gebäude stützen, halten die Hitze hartnäckig fest und knarzen vor Durst.
Es ist der wichtigste Tag meines Lebens, daher beobachte ich das Geschehen, um meine in Aufruhr befindlichen Nerven zu beruhigen, und fasse es in Worte. Die meisten Menschen drängt es zu der Straßenseite, wo die größeren Gebäude ihren Schatten werfen. Die Pferde, die sich abrackern, sind triefnass vor Schweiß. Aus den Kutschfenstern flattern aus Pfauenfedern gefertigte Fächer. Die Peitschenhiebe des Kutschers erschlaffen. Und die Sonne ist wie ein gewaltiges goldenes Gestirn in einer Kuppel aus lückenlosem Blau.
Ich halte inne, denn der Rhythmus stimmt noch nicht. Vielleicht ist in fernen Lauben aus Blau angenehmer für Ohr und Herz als in einer Kuppel aus lückenlosem Blau. Ich drehe die Wörter im Mund, lasse sie über meine Lippen gleiten und in meinem Ohr verhallen … ferne Lauben aus Blau …
»Schau, wo du hinläuft, du blöde alte Ziege!«
Ich weiche aus und stolpere, wäre beinahe in einen Karren mit faulem Kohl gelaufen. Plötzlich sehne ich mich nach meinem Zuhause, nach seiner Vertrautheit und Freundlichkeit. Mir ist, als gäbe es in dem großen Scharmützel, das London genannt wird, keinen Platz für mich.
Kurz darauf verlasse ich die schattige Seite der Straße mit ihrem mürrischen Menschengewusel. Im heißen Sonnenlicht halten sich weniger Leute auf, aber der Gestank ist übler: ungewaschene Füße, verfaulende Zähne, menschliche Jauche. Allerlei Abfall lauert unter meinen Füßen, verrottet zwischen den Pflastersteinen: gebleichte Heringsgräten und Herzmuschelschalen, rostende Nägel, ausgespuckte Kautabakpfrieme, eine von Maden überquellende tote Maus, vertrocknete Orangenschalen und Apfelbutzen, auf denen es vor Fruchtfliegen wimmelt. Alles ist entweder knochentrocken oder weich und faulig am Verrotten. Ich halte mir die Nase zu, denn ich habe nicht das Bedürfnis, diesen widerlichen Gestank in Dichtung zu verwandeln.
»Ferne Lauben aus Blau«, murmele ich vor mich hin. Ein Kritiker hat meine erste Gedichtsammlung als klar und elegant beschrieben. Ich kann nicht umhin zu denken, dass ferne Lauben aus Blau ähnlich klar und elegant ist, aber was wird Mr Thomas Longman, der Verleger der gefeierten Poeten, davon halten? Der Gedanke an Mr Longman holt mich aus meiner Benommenheit zurück in die Gegenwart, zu meiner Mission. Ich blicke an mir hinunter und sehe die feuchte Seide, dunkelgrün geädert und mit schwarzen, sich ausbreitenden Flecken unter den Achseln. Warum habe ich mir keine Kutsche genommen? Wenn ich zum wichtigsten Treffen meines Lebens erscheine, werde ich klatschnass sein wie ein fieberndes Kind.
Ein Messingschild kündet von den Büros der Herren Longman & Co, Verleger und Buchhändler. Ich bleibe stehen, hole Atem. Und in dieser Sekunde meines Lebens verdichten sich meine Vergangenheit, die immense Größe des Himmels über mir und die wirre Masse Londons zu einem einzigen zitternden Punkt. Da ist er. Der Augenblick, auf den ich zehn lange Jahre gewartet habe. Meine sternenklare Morgendämmerung …
Ich zupfe die losen Locken von meinem Nacken und schiebe sie wieder unter die Haube. Hastig und besorgt streiche ich über die feuchten Knitterfalten in meinem Kleid und bin – wenn auch zitternd – bereit. Nachdem ich an der einschüchternd langen Klingelschnur gezogen habe, geleitet man mich durch Räume, in denen sich die Wände vor Büchern nur so biegen, zu einer schmalen Treppe. Am Ende befindet sich ein einziges Zimmer. Es ist mit Büchern so vollgestopft, dass meine Röcke fast nicht mehr hineinpassen. Mr Longman – ich nehme an, dass er es ist – sitzt hinter einem Schreibtisch und betrachtet eine entrollte Landkarte, sodass ich nur der üppigen Haarpracht auf seinem Scheitel vorgestellt werde.
Er nimmt keine Notiz von mir, und ich nutze die Gelegenheit, ihn mit dem Blick der Dichterin zu beobachten. Er ist schwer mit Gold behangen. Ein goldener Siegelring an jeder Hand und eine goldene Uhrkette, die bis in die schwarzen Falten seines Gehrocks reicht. Sein Haar ist stählern grau und liegt als dicke Matte über den Schädelplatten. Als er den Kopf hebt, sehe ich sein rotes Gesicht, dessen gesunde Farbe von der Krawatte aus lavendelfarbenem Seidentwill, auf der seine Kinnfalten ruhen, noch betont wird. Seine Augen liegen sehr tief, darüber wölbt sich ein buschiges Brauenpaar.
»Ah, Mrs Acton …« Durch halb geschlossene Lider blickt er zu mir auf.
Ich erröte. »Miss Acton«, erwidere ich und hebe beim Wort Miss herausfordernd die Stimme.
Er nickt, dann schiebt er die Landkarten, Bücher und Tintenfässer beiseite, um einen Kanal zu schaffen, durch den er eine Hand hindurchschiebt. Ich blicke konsterniert auf die blasse, fleischige Handfläche. Soll ich diese Hand schütteln, wie in der Herrenwelt üblich? Er macht keine Anstalten, meine Hand zu seinen Lippen zu führen oder aufzustehen und sich zu verneigen. Und als ich die seine schüttle, beschleicht mich eine seltsame Aufgeregtheit; etwas, das ich mir nicht erklären kann, jagt mir einen leichten Angstschauer ein.
»Sie hätten da etwas für mich, wenn ich mich nicht irre.« Er kramt lustlos in den Papieren, die über seinen Schreibtisch verstreut sind.
»Ich habe es Ihnen schon in meinem Brief erläutert, Sir. Es ist ein Gedichtband, an dem ich zehn Jahre lang fleißig gearbeitet habe. Mein letzter Band ist von Richard Deck aus Ipswich veröffentlicht worden, und Sie haben ihn tatsächlich hier in dieser Buchhandlung verkauft.« Wie ich so rede – flüssiger, als ich mir vorgestellt hatte –, kommt mir ein Bild in den Sinn: wie Miss L. E. Landon aus meinem Gedichtband vorliest, einer wunderhübsch in Seehundleder gebundenen Ausgabe mit meinem Namen in Goldprägung vorn drauf. Das Bild ist so scharf, so hell, ich sehe die Andeutung einer Träne in ihren Augen, den zustimmenden Zug um ihren Mund, sehe, wie ihre zarten Finger die Seiten berühren, behutsam, als wären sie so fein und kostbar wie Gänsedaunen.
Doch Mr Longman reagiert auf eine verwirrende und bestürzende Weise. Augenblicklich verschwindet Miss L. E. Landon aus meinem Sinn, und mein veröffentlichtes Buch gleich mit. Er schüttelt den Kopf, als hätte ich auf unentschuldbare Weise ein paar Tatsachen durcheinandergebracht.
»Ich versichere Ihnen, Sir, er lag bei Longman & Co auf Lager – sowie in vielen anderen angesehenen Buchhandlungen. Er wurde nach einem Monat schon nachgedruckt und …«
Mr Longman unterbricht mich mit einem langen, ungeduldigen Seufzer. Er zieht die Hand wieder vom Schreibtisch ab, um sich mit einem Taschentuch die Stirn zu wischen.
»Ich selbst habe die Subskriptionsverkäufe in Gang gebracht und sogar Bestellungen aus Brüssel, Paris und der Insel St. Helena erhalten. Meine Leser sind überzeugt davon, dass ich einen Verleger brauche, der über so universelle Macht verfügt wie Sie, Sir.« Ich höre meine Stimme und bin überrascht, wie viel Verzweiflung darin mitschwingt. Und wie viel Hochmut. Die Worte meiner Mutter kommen mir in den Sinn … zu versessen auf Anerkennung … zu ehrgeizig … kein Gespür für Anstand …
Aber Mr Longman schüttelt umso nachdrücklicher den Kopf. Er schüttelt ihn so energisch, dass die Kinnfalten hüpfen und kleine Schweißtropfen von seiner Stirn fliegen und sich wahllos über die Landkarten verteilen.
»Dichtung ist nichts für eine Dame«, knurrt er.
Ich bin so sprachlos, dass jeder Zoll in mir erstarrt. Kennt er Mrs Hemand nicht? Oder Miss L. E. Landon? Oder Anne Candler? Ich öffne den Mund, wie um zu protestieren, doch er starrt ausdruckslos in die Luft, als wisse er schon, was ich sagen will, und habe nicht den Wunsch, es zu hören.
»Allerdings, Romane schreiben … das ist eine ganz andere Sache. Liebesromane, Mrs Acton, sind bei den jungen Damen sehr beliebt.« Er zieht das Wort junge in die Länge, hebt und senkt die Stimme. Ich spüre, wie mein Gesicht erneut aufglüht. Und wie Aufgeregtheit und Trotz samt und sonders verschwinden.
»Liebesromane. Hätten Sie da vielleicht etwas für mich?«
Ich blinzle und versuche meine Gedanken zu ordnen. Hat er meinen Brief überhaupt gelesen? Oder die fünfzig Gedichte, die ich ihm vor sechs Wochen in meiner besten, gestochen klaren Handschrift geschickt habe? Falls nicht, warum hat er mir dann geschrieben und mich zu einem Treffen geladen? Zu meinem Kummer schnürt sich mir die Kehle zu, meine Unterlippe zittert.
»Ja«, fährt Mr Longman fort, als spräche er zu sich selbst. »Einen Schauerroman könnte ich mir gut vorstellen.«
Ich reiße mich zusammen, beiße mir auf die Lippe. In mir entzündet sich ein Funke von Wut – oder Ärger? »Einige meiner Gedichte sind jüngst veröffentlicht worden, im Sudbury Pocket Book und im Ipswich Journal. Mir wurde gesagt, sie seien gut.« Mein Anfall von Kühnheit überrascht mich, doch Mr Longman zuckt nur mit der Achsel und seine Augen wandern zu der tiefen, durchhängenden Decke.
»Es hat keinen Zweck, mir Gedichte zu bringen! Niemand will heutzutage Gedichte lesen. Wenn Sie keinen kleinen Schauerroman für mich schreiben können …« Seine Hände liegen geöffnet, in einer Geste der Hilflosigkeit, auf dem Schreibtisch ausgebreitet.
Ich starre auf diese leeren Handteller und fühle mich wie ausgehöhlt, mein Elan, meine Kühnheit – alles dahin. Zehn Jahre harter Arbeit – vergebens. Die Emotionen, die Anstrengung, alles, was ich für das Schreiben meiner Gedichte geopfert habe, alles umsonst. Mir rinnt der Schweiß in Strömen herunter, und ich bin kurzatmig, als habe man mir die Kehle zugeschnürt. Das schmerzvolle Schlagen eines brechenden Herzens ist zum Schweigen gebracht …
Mr Longman kratzt sich geräuschvoll am Kopf und starrt weiter an die Decke. Seine Schuhsohlen klopfen auf die Dielen unter dem Schreibtisch, als habe er meine Anwesenheit vergessen. Vielleicht trifft er aber auch gerade die Entscheidung in der Frage, ob es mir zuzutrauen ist, einen Schauerroman zu schreiben. Ich huste diskret, was sich eher anhört, als hätte ich mich vor Aufregung verschluckt.
»Könnte ich vielleicht meine Gedichte zurückbekommen, Sir?«
Er klatscht in die Hände und springt so unvermittelt auf, dass die Goldketten an seiner Taschenuhr rasseln und die silbernen Schnallen an seinen Schuhen klappern. »Wenn ich es recht bedenke, habe ich derzeit genug Romanautoren. Also bringen Sie mir bitte keinen Groschenroman.«
»Was ist mit meinem Manuskript? Haben Sie es nicht erhalten, Sir?« Kaum hörbar entschlüpfen die Worte meiner Kehle. Ist es möglich, dass er meine Gedichte verloren hat? Dass er sie einfach verschlampt hat und sie jetzt hier irgendwo unter seinen Karten und Papieren liegen? Und dass er mich gleich abspeist … mit leeren Händen? Nicht einmal die Bestellung eines Schauerromans will er mir versprechen? Hab ich es dir doch gesagt, flüstert die Stimme meines Zweifels. Blenderin … Blenderin … Deine mickrigen Gedichtentwürfe sind wahrscheinlich im Feuer gelandet … Ich suche den Raum ab, suche nach einem Feuerrost, nach einem Fetzen meiner Verse in der Asche.
Plötzlich klatscht Mr Longman ein zweites Mal in die Hände. Ich sehe ihn an und frage mich, ob das seine Art ist, jemanden wegzuschicken. Doch er starrt mich, die Hände noch gefaltet, mit leuchtenden Augen an. »Ein Kochbuch!«
Ich runzle verwirrt die Stirn. Der Mann ist nicht nur rüde, er ist auch schwer zu verstehen, denke ich. Wen um Himmels willen glaubt er vor sich zu haben? Ich mag ja fünfunddreißig Jahre alt und unverheiratet sein, mein Kleid mag Schweißflecken haben, aber ich bin keine Hausbedienstete mit Schürze.
»Gehen Sie nach Hause und schreiben Sie mir ein Kochbuch, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Guten Tag, Miss Acton.« Seine Hände patschen auf das Durcheinander auf seinem Schreibtisch, und einen Augenblick lang denke ich, er suche nach meinen Gedichten. Doch dann deutet er zur Tür.
»Ich kann – ich kann nicht kochen«, sage ich lahm und bewege mich wie eine Schlafwandlerin Richtung Tür. Ich bin vor Enttäuschung ganz dumpf im Kopf. Aus mir ist noch der letzte Rest Mut gewichen.
»Wenn Sie Gedichte schreiben können, dann können Sie auch Rezepte schreiben.« Er tippt auf den Glasdeckel seiner Taschenuhr und hält sie sich mit einem verärgerten Grunzen ans Ohr. »Durch diese höllische Hitze habe ich wertvolle Zeit verloren. Guten Tag!«
Plötzlich kann ich nicht schnell genug fort, fort von Londons monströsem Gestank, fort von der Schande, dass man meine Gedichte verschmäht und ihnen etwas so Belangloses und Zweckmäßiges wie ein Kochbuch vorgezogen hat. Ich eile die Stufen hinunter, Tränen schießen mir in die Augen.
Plötzlich dröhnt Mr Longmans Stimme: »Klar und elegant, Miss Acton. Bringen Sie mir ein Kochbuch, so klar und elegant wie Ihre Gedichte.«
2
ANN
Steckrübensuppe
Heute ist der Tag meiner größten Schmach. Ich bin versehentlich eingeschlafen, für gerade mal eine Viertelstunde, aber als ich aufwache, steht der Pfarrer bedrohlich über mich gebeugt. Wie ein schwarzer Schatten.
»Oh, Reverend Thorpe«, stottere ich und komme schwankend auf die Füße. Ich weiß sofort, warum er da ist. In Wahrheit habe ich auf diesen Tag gewartet.
Seine Augen spähen in alle Richtungen, wie Windmühlen. Gut geölte Windmühlen. Er inspiziert unser Cottage: die Spinnweben im Kamin, die Stapel stinkender Lumpen, die zu waschen ich nicht die Zeit finde, die Staubmäuse aus schwarzem Hundehaar, die sich in den Zimmerecken angesammelt haben. Wenigstens ist der Herd sauber gefegt, die Asche vollständig entfernt.
Hinter ihm krallt sich Mam an einem Laken fest, in das sie geknotet ist. Ich erkenne die Knoten – solche macht Mrs Thorpe. Daher weiß ich nun, dass man sie unbekleidet gefunden hat. Wahrscheinlich beim Medwey-Fluss, wo sie sich zu waschen versucht und dann vergisst, ihre Kleider wieder anzuziehen. Allein schon bei dem Gedanken wird mir ganz anders, wo doch all die Kähne dort vorbeifahren und die Männer von der Pulvermühle zusehen …
»Was genug ist, ist genug«, sagt Reverend Thorpe und fährt sich mit einer Hand kreisend über den Bauch, der von Frikadellen und Pasteten und gekochtem Pudding weich und rund geworden ist.
»Ist sie wieder umhergestreunt? Ich hatte sie an mich gebunden, aber ich muss eingeschlafen sein.« Was ich nicht erzähle, ist, dass sie mich in der Nacht immer wieder zum Aufstehen genötigt hat, mal wollte sie dies, mal wollte sie das, zog an den Stricken, zwickte mich, trat mich, zerriss mit den Nägeln ihr Nachthemd.
»Wie lange ist sie nun schon …« Er nickt in Richtung Erdboden, Richtung Hölle, als wollte er sagen, das sei das Werk des Teufels.
Aber ich weiß, dass Gott alle seine Schäfchen liebt, also nicke ich in Richtung Himmel und erwidere: »Seit fünf Jahren ist sie … geistesabwesend.« Dass es schlimmer um sie steht denn je, dass sie seit dem letzten Vollmond ihre eigene Tochter nicht mehr erkennt, erzähle ich ihm nicht.
»Sie muss in ein Irrenhaus, Ann«, sagt er. »Es gibt ein neues, drüben in Barming Heath.«
»Ich werde sie besser an mir festbinden«, sage ich und vermeide es, ihm in die Augen zu schauen. Mein Gesicht ist heiß vor Scham. Hat er sie gefunden oder war es ein anderer? Jemand, der sie zum Pfarrhaus gebracht hat statt nach Hause? Oder ist sie selbst in die Kirche gegangen? Bei diesem Gedanken zieht sich mein Inneres zu einem kleinen Ball zusammen. Allein die Vorstellung, wie sie nackt oder in Unterwäsche und verrückt wie ein Huhn in der Kirche sitzt.
»Was habt ihr heute gegessen, Ann?« Er starrt Septimus an, der ausgestreckt vor dem Kamin liegt, ein Auge offen, das andere geschlossen. Der Pfarrer schaut misstrauisch drein, so als denke er, unser armer, magerer Hund werde als Nächstes in den Topf wandern.
»Besser, als Mam im Armenhaus oder in egal welcher Irrenanstalt zu essen bekäme«, sage ich. Ich setze sie auf den Boden, löse einige der Knoten und hoffe, sie bleibt ruhig. Ich möchte, dass der Pfarrer geht, aber da er die Frage drei Mal wiederholt, zwingt er mich zu einer Antwort.
»Brot und eine Zwiebel jeder, mit einem kleinen Rest Schweineschmalz«, sage ich nach einer Weile. Ich sage nicht, dass das Brot knochentrocken war. Und dass die Zwiebel schon armlange Triebe hatte. »Und eine kleine Steckrübensuppe«, schicke ich noch hinterher.
»Deine Mutter kann in ein Irrenhaus gehen – das kostet nichts, und sie ist gut versorgt. Für deinen Vater hätte ich etwas Arbeit, er kann sich um den Friedhof kümmern.«
Ich sage eine Weile gar nichts, denn die Worte des Pfarrers haben mich verwirrt. Dass er Mam gern los wäre, sehe ich ja ein, aber dass er Pa Arbeit geben will … Der Mann muss ein Heiliger sein, denn es ist gerade mal drei Jahre her, dass er für meinen Bruder Jack eine Stelle in London gefunden hat, in der Küche eines Clubs für Gentlemen, wo er den Spieß dreht. Ich erinnere ihn daran, dass Pa nur ein Bein hat, dass er das andere im Kampf für König und Vaterland verloren hat.
»Ja, ja«, antwortet er und fuchtelt mit seinen weißen Händen herum, als wäre ich ein räudiger Straßenköter. »Gott will nicht, dass deine Mutter nackt durch die Felder rennt. Das ist nicht gut für … für …« Er hält inne, und seine Augen verengen sich. »… für die Moral in der Pfarrei.«
Hat Gott zu ihm gesprochen? Hat Gott sich über Mams Wahnsinn beschwert? Vielleicht hat Gott ihm ja von neulich Abend erzählt, als ich Pa erwischt habe, wie er seine knochigen Finger um Mams Hals krallte und mit beiden Händen zudrückte, als sei sie eine Weihnachtsgans. Er war wütend wie selten und roch dermaßen nach Ale, dass ich den Gestank bei jedem Atemzug roch. Zum Glück war er vom Saufen – und weil ihm ein Bein fehlt – so schwach, dass er wimmernd zu Boden ging. »Sie erinnert sich an nichts, Ann. Nicht einmal mehr an mich … sie hat sich überhaupt nicht mehr im Griff, egal bei was. Sie ist kein Mensch mehr.« Mam indes lag, ein breites, zahnloses Lachen auf dem Gesicht, einfach auf der Matratze, und nichts deutete darauf hin, dass sie gerade von ihrem eigenen Mann gewürgt worden war.
Reverend Thorpe geht rückwärts aus dem Cottage, den Blick gesenkt, um Mam, die über den Boden kriecht, nicht ansehen zu müssen. Ihre Kopfhaut ist wie gelbes Pergament, die Haare schütter und verfilzt. Ich lege sie auf die Matratze und beuge ihre knochigen Gliedmaßen, sodass sie daliegt wie eine zusammengerollte Katze. Das Laken ist ein bauschiges, wirres Knäuel mit dicken Knoten an Schultern, Knien und Hüften; sie sieht darin eher wie ein Bündel Schmutzwäsche aus als wie ein menschliches Wesen. Plötzlich weiß ich, dass nur ich mich um sie kümmern, dass nur ich sie beruhigen kann. »Ich verspreche, dafür zu sorgen, dass sie immer ihre Kleider anhat«, sage ich flehend. »Und ich werde lernen, wie man einen festeren Knoten macht, einen Reffknoten.«
Da hält der Pfarrer inne und sieht sich im Cottage um, als suche er etwas Bestimmtes. Ich sehe seinen Blick über das Regal wandern, auf dem früher Mams Bücher gestanden haben: ihr Gebetbuch, der Band Kochen leicht und einfach gemacht, dann Deutsche Märchen, in weinrotes Leinen gebunden. Das Regal ist jetzt leer. Vollkommen leer. Ich rechne schon mit seiner Frage, warum wir denn kein Gebetbuch haben, keine Bibel. Stattdessen sagt er etwas so Verblüffendes, dass es mir die Sprache verschlägt.
»Ann«, sagt er, »du bist ein cleveres Mädchen. Du hast viele Fähigkeiten. Du könntest als Hausmädchen arbeiten. Oder als Kindermädchen. Würde dir das nicht gefallen?«
Ich blinzle dümmlich.
»Deine Mutter hat dir Lesen und Schreiben beigebracht, nicht wahr?«
Was er sagt, ist die Wahrheit, also nicke ich, und er fügt hinzu: »Wenn du durch und durch ehrlich bist und hart arbeitest, dann könntest du Zofe werden. Ich sehe doch, dass du harter Arbeit nicht abgeneigt bist.«
Ehe ich es verhindern kann, platze ich auch schon mit meinem geheimsten Wunsch heraus. Spreche aus, was mir jede Nacht wie ein flatterndes Band durch den Kopf geht. »Ich träume davon, Köchin zu werden«, sage ich. Natürlich bereue ich es sofort. Aber es ist zu spät, das Gesagte zurückzunehmen, daher zupfe ich mit Eifer einen Zweig aus Mutters Haar.
Reverend Thorpe hustet, kein heiseres, feucht rasselndes Husten wie bei Pa, eher so, als stecke ihm eine Brotkrume im Hals. »Das ist in der Tat ein ehrgeiziger Wunsch«, sagt er nach einer Weile. »Aber vielleicht ginge es privat, in einer kleinen Familie. Vielleicht solltest du erst einmal als Küchenmagd anfangen. Wie alt bist du, Ann?«
»Kommenden Michaelistag werde ich siebzehn.« Ich versuche, selbstgewiss und bestimmt zu klingen, aber meine Gedanken sind bereits auf Wanderschaft gegangen. Vor mir schweben Pasteten mit fester Kruste vorbei, triefende, klebrige Puddings, Geflügel, das an Spießen gedreht wird, Regale mit reifem Obst, dicke Fässer mit süßen Trauben. Gerollte Zimtrindenstücke so lang wie meine Hand – und all die anderen Dinge, von denen Jack mir erzählt hat.
»Du bist schon recht alt, um in Stellung zu gehen, aber ich werde mich trotzdem nach einer Möglichkeit für dich umsehen«, sagt der Pfarrer. »In Gottes Welt muss jeder seinen Beitrag leisten.« Es sollte mich ärgern, mir anhören zu müssen, dass ich das Meinige nicht beitrage, aber ich bin nur halb bei der Sache. Die andere Hälfte ist einfach davongeflogen, in eine Küche, in der ich hacke, schneide und rühre, Schweine auf Spieße stecke und Nieren vom Fett befreie. Ganz wie Jack in London. Er sagt, es gebe dort mehr zu essen, als ich mir jemals ausmalen könnte. Suppentöpfe größer als Milchkannen, Öfen größer als unser Cottage, Speisekammern so groß wie Häuser, Mörser größer als mein Kopf. Und dann grummelt mein Bauch so laut, dass ich mir in die Seite kneifen muss aus Angst, der Pfarrer könnte meinen, ich sei für die Arbeit in einem Privathaushalt zu ungehobelt.
Er bückt sich unter unserem Türrahmen, durch den gerade mal ein Esel passt. »Deine Mutter wird gut zu essen bekommen und gut gepflegt werden. Und du und dein Vater, ihr werdet einen Lohn bekommen. Dann wäre das abgemacht.«
Die Spannung zieht und zerrt an meinen Augen. Kann ich nur Köchin werden, wenn Mam in eine Anstalt gesperrt wird? Habe ich mich damit einverstanden erklärt?
3
ELIZA
Oxford Punch
Während die Kutsche den Weg entlangschlingert und schaukelt, versuche ich mich abzulenken, indem ich die scharlachroten Mohnfelder und großen Heuhaufen betrachte, so prächtig und zerzaust. Krähen fliegen als schwarze Lumpen aus den staubigen Feldern auf. Doch all diese Schönheit verschlimmert mein Elend nur. Während ich früher meine größte Freude daran gehabt hätte, die treffendsten, schwärmerischsten Worte zu finden, um solch eine Szenerie zu beschreiben, scheinen die Eindrücke mich jetzt zu verhöhnen. Außerdem muss ich ständig an die Zuhausegebliebenen denken, die es kaum erwarten können, dass ich ihnen erzähle, wie das Treffen mit dem berühmten Mr Longman verlaufen ist. Seine Ablehnung hat mich auf dieser langen Polterreise stets begleitet. Dichtung ist nichts für eine Dame … niemand will heute Gedichte lesen … und seine letzte, erniedrigende Forderung: Gehen Sie nach Hause und schreiben Sie mir ein Kochbuch, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Ins Geschäft kommen! Genau diesen Satz gedenke ich nicht weiterzuerzählen. Niemandem.
Als die Kutsche sich Ipswich nähert, liegen mir Scham und Scheitern wie ein Backstein im Leib. Der Himmel wird schwärzer, ist jetzt mit Tausenden winziger Silbersternchen gepfeffert. Und als unser Haus aus der Dunkelheit auftaucht – mit dem Kerzenlicht, das in den Fenstern flackert, und den bleichen, das Glas umflatternden Motten –, wäre mir nichts lieber, als vom Erdboden zu verschwinden.
Die Haustür wird aufgerissen, und heraus quellen atemloses Licht und Stimmen und die purzelnden Klänge eines Klaviers.
»Eliza ist da! Sie ist zurück!«
Das Klavier verstummt. Kerzen tauchen auf, flackern in der Nachtluft. Und dahinter die neugierigen Gesichter von Catherine, Edgar und Anna. Selbst Hatty, das Hausmädchen, ist herausgekommen, um mich zu Hause willkommen zu heißen.
Dann folgt Mutter, blinzelt ins Zwielicht. »Eliza, bist du das? Wir warten seit einer Ewigkeit. Schnell, schnell! Sonst bauen noch sämtliche Motten von Suffolk Nester in meinen neuen Vorhängen.«
Ich bin noch gar nicht ganz der Kutsche entstiegen, da geht das Gebettel schon los.
»Was hat Mr Longman gesagt, Eliza? Oh, bitte erzähl doch!«, drängt Catherine. »Erzähl uns alles, von Anfang an.«
»Nein, nicht von Anfang an«, bellt Edgar. »Sonst stehen wir die ganze Nacht hier herum. Komm gleich auf den Punkt – wie war Mr Longman?«
Ein scharfer Schmerz fährt mir in die Rippen. Die Enttäuschung meiner Familie tut noch mehr weh als meine eigene. Bei Mutter wird ein Hab-ich’s-dir-doch-gesagt ebenso dabei sein wie ein stilles Vergnügen an meinem Scheitern, aber nicht bei Edgar. Auch bei meinen Schwestern nicht. Oder bei meinem Vater. Ihre Enttäuschung wird mit Händen zu greifen sein.
»O Edgar, warum musst du immer so ungeduldig sein? Anna, sag Cook, sie soll einen Becher von ihrem besten Oxford Punch bringen, und zwar schnell. John ist immer noch nicht zu Hause, das ärgert mich sehr.« Mutter steht händeringend da. »Er wollte ganz sicher da sein, wenn du kommst.«
Ich bin erleichtert. Am meisten fürchte ich mich davor, Vater von meinem Scheitern zu erzählen. Er hat immer an mich geglaubt, hat meine Bemühungen stets unterstützt. Als ich eine Schule für junge Damen gründen wollte, hat er mir Geld zur Verfügung gestellt. Und er hat meinen ersten Gedichtband finanziert und darauf bestanden, dass Bindung und Papier von bester Qualität sind. »Bestimmt ist er nur von Papierkram aufgehalten worden oder hat seine Schlüssel verlegt«, erwidere ich möglichst unaufgeregt, damit man mir nicht anhört, wie groß meine Erleichterung ist.
»Wie war Mr Longman?«, fragt Edgar gepresst, teilt die Rockschöße und lässt sich auf einen Stuhl sinken. »Ich wette, Mr Longman hält deine Gedichte für weitaus wertvoller als die von diesem Schurken, diesem Lord Byron.« In sprühender Vorfreude reibt er mit den Handtellern über seine Oberschenkel, immer auf und ab. »Sobald der Punsch da ist, bringen wir einen Toast auf dich aus.«
»O nein«, hauche ich, »bitte keinen Punsch, es gibt nichts zu feiern.« Ich blicke hinab auf meine Füße, auf die Spuren von Londoner Dreck an meinen Schuhen, auf die Perlknöpfe, die jetzt eher schwarz sind. Ich finde nicht die passenden Worte. Nichts, womit ich ihre Enttäuschung lindern könnte.
»Die Verleger wollen keine Gedichte mehr«, sage ich schließlich.
»Unsinn!« Edgar springt auf. »Liegt es daran, dass du so stur darauf bestehst, unter deinem echten Namen zu publizieren?«
»Hast du ihm erzählt, dass dein letzter Band nach weniger als einem Monat in die zweite Auflage gegangen ist?«, fragt Catherine sanft.
»Mr Longman hat mir nicht vorgeschlagen, meine Gedichte unter einem Künstlernamen zu veröffentlichen. Er will sie einfach nicht.« Ich drehe die Saatperlen am Hals zwischen den Fingern. Meine Kehle ist heiß und trocken. »Es tut mir leid.«
»Nun ja«, sagt Mutter und bläst stumm die Backen auf. »Ich fand deine Gedichte immer schon zu freimütig, ein wenig unfein, wenn du mich fragst. Ich nehme an, das ist der Grund, warum Mr Longman sie nicht haben wollte.«
Mein Kiefer spannt sich an. Ich sehe an mir hinunter, bemerke die weißen Salzringe unter den Achseln und rieche den Gestank von London an meinen Kleidern und meiner Haut. »Er hat gesagt, niemand will noch Gedichte. Die Leser wollen …«, ich stocke und muss schlucken, »… Romane, Liebesromane, aber vor allem Schauerromane.«
»Kannst du nicht so etwas schreiben, liebste Eliza?«, fragt Catherine.
»Das ist alles Unsinn. Du brauchst kein Geld. Die Gedichte waren einfach … einfach …« Edgars Stimme wird immer leiser, so als sei er sich nicht ganz sicher, was der Sinn meiner Gedichte war.
»Du hast im letzten Band zu viel von dir gezeigt«, setzt Mutter nach. »Sie hatten so etwas Indiskretes, einige Nachbarn haben mich seltsam angeschaut. Du hättest sie nie unter deinem – unserem – Namen veröffentlichen sollen, meine Liebe. Sie waren überdreht, viel zu freizügig.«
»Dann dürfen die Herren Keats und Wordsworth ihre Leidenschaften also freimütig enthüllen, ich aber nicht? Wolltest du das sagen?«
»Ich denke, Mutter möchte nur wissen, ob du dich vielleicht damit zufriedengeben könntest, mit deinem Geschreibsel für dich allein weiterzumachen«, sagt Edgar. »Wahre Dichtung braucht doch kein Publikum, oder?«
Ich suche wütend nach Worten, mit denen ich ihnen erklären kann, warum ich ein Publikum haben will, warum ich meinen eigenen Namen auf meinem Geschreibsel sehen will. Dass es das ist – genau das –, was mir das Gefühl gibt, Teil einer größeren, bedeutungsvolleren Welt zu sein, einer reicheren Welt, in der ich mit anderen verbunden bin, einer Welt, in der ich zähle. Wie kann ich das erreichen, wenn mein Geschreibsel nur mir selbst gilt? Wenn ich ein unbeschriebenes Blatt bin, namenlos?
Mutter legt den Kopf schräg und nickt. »Es hat ein bisschen etwas Prahlerisches, veröffentlicht werden zu wollen. Für eine Dame ist das … nicht wirklich gottgefällig.«
Mein ganzer Körper versteift sich, und ich spüre ein Brennen hinter den Augen. Ich sehe Mr Longmans Worte vor mir schweben … Dichtung ist nichts für eine Dame … Aber dass Mutter jetzt noch mit dem Herrgott daherkommt, dass sie unterstellt, hier habe Gott die Hand im Spiel, das ist zu viel. Ich starre sie zornig an, aber sie hält den Blick fromm gen Himmel gerichtet.
Anna – die liebe, süße Anna – greift nach meiner Hand und drückt sie. »Es gibt noch viele andere Verleger, liebste Eliza. Du musst nicht verzweifeln.«
Ich nicke dankbar, bringe aber kein Wort heraus. Mutters und Edgars Worte, die sich unangenehm mit denen von Mr Longman vermischen, haben meinem Herzen einen Dämpfer gegeben. Und hinter all der Wut, hinter all den Rechtfertigungen, warum ich ein Publikum brauche, versteckt sich der ewige Zweifel. Betrügerin. Betrügerin. Aber da ist noch etwas anderes, ein unklares, dunkles Gefühl. Das Gefühl, etwas verloren zu haben. Es kommt und geht inmitten von Ärger, Enttäuschung und Verzweiflung. Denn was bin ich jetzt? Eine alte Jungfer aus Suffolk, die einen einzigen Gedichtband unter ihrem Namen veröffentlicht hat.
Ich starre auf die Silberschüssel mit dem Punsch, und mein Spiegelbild starrt zurück: ein dunkler Schopf mit grauen Strähnen, ein Faltengitter rund um die Augen. Ich stürze zur Treppe und hinauf in mein Zimmer, sehne mich nach Alleinsein. Ich möchte den Kopf ins Kissen drücken und alles vergessen. Ich zünde eine Kerze an und lege mich auf mein Bett, frage mich, ob ich nicht lieber einen stärkenden Oxford-Punsch hätte trinken sollen. Der Duft von erwärmten Gewürzen und Portwein kriecht unter meiner Tür hindurch, legt sich um mich wie ein Schal aus weichster Lammwolle. Ein Glas Punsch wäre eine Einschlafhilfe gewesen, denke ich. Es hätte geholfen, die Worte der anderen auszulöschen. Aber vielleicht nicht die von Mr Longman, die letztlich hartnäckiger sind, beschämender. Wäre ich ein Mann, er hätte mich niemals mit dem albernen Auftrag für ein Kochbuch abgespeist. Er hat mit mir gesprochen wie mit einer Bediensteten. Nicht einmal einen Roman war ich wert. Oder ein Buch über Botanik oder Lepidoptera.
Wie zum Trost schnuppere ich die würzige Luft, während meine Gedanken auseinanderstieben. Von unten dringt ein langes, hohes Wehklagen herauf. Wie der durchdringende Schrei einer Schleiereule. Ich schrecke ängstlich hoch. Das Haus lebt, Stimmen erheben sich, Türen knallen, ein Windstoß fegt durch den Flur und die Treppen herauf. Als sei ihm Feuer unter die Haut gefahren.
Alle Gedanken an Mr Longman, an die Dichtung, an mich selbst sind vergessen. Ich schnappe mir den Kerzenhalter, laufe zum Treppenabsatz und schaue übers Geländer. Alle sind beim Eingang versammelt, breit angestrahlt von einer Lampe. Was für ein Aufruhr! Vater ist zurück und rennt aufgeregt im Kreis herum. Anna und Catherine schluchzen, Edgar schreit, Mutter greift sich mit beiden Händen an den Kopf, Hatty steht mit offenem Mund da und sieht zu.
Gestiefelte Füße stürmen die Treppe herauf in meine Richtung. Es ist Vater, in wilden Büscheln steht ihm das weiße Haar vom Kopf ab, um den Hals hängt lose die Krawatte, die Augen hinter den drahtgerahmten Brillengläsern blitzen.
»Was ist los?«, frage ich, ebenso verwirrt wie ängstlich.
»Wir sind am Ende, Eliza. Am Ende.« Er macht kehrt und rennt die Treppe wieder hinunter, ins Gesellschaftszimmer, ich – fassungslos – hinterher. Er entdeckt die Schüssel mit dem Punsch, auf dem sich bereits eine dünne Haut gebildet hat, stapft darauf zu, nimmt die Schöpfkelle heraus und trinkt direkt aus dem Gefäß, sodass ihm Punsch übers Kinn und in den Kragen rinnt.
»Wir haben alles verloren.« Noch einmal setzt er mit zitternder Hand die Schüssel an. Rote Flüssigkeit rinnt ihm den Hals hinunter, befleckt sein Hemd, seine Krawatte, die Schöße seines Gehrocks.
»Wie das?« Ich starre ihn an, vermute, dass er sich geirrt hat, dass er betrunken ist oder am Hirnfieber leidet. Jede Woche werden in The Ipswich Journal ein Dutzend oder mehr Konkurse gelistet, aber doch nicht von Leuten wie meinem Vater, einem Gentleman, einem Bachelor of Law des St. Johns’ College der Universität von Cambridge!
»Es ist nicht meine Schuld, Eliza. Ich habe mich mit den Pachtgeldern für The Golden Lion und The Kings’s Head übernommen. Erheblich übernommen. Und nachdem mir noch die acht Scheffel Kohle gestohlen worden waren, hatte ich gar kein Geld mehr. Ich hatte keine Wahl, ich musste mir welches leihen.« Er bedient sich mit der Schöpfkelle aus der Punschschüssel und führt sie zu seinem triefenden Mund.
»Von wem geliehen? Können wir es nicht zurückzahlen?« Ich starre Vater an, und es ist, als hätte ich einen Fremden vor mir, einen mir vollkommen Unbekannten.
»Meine Schulden sind viel zu hoch … sie werden mich für bankrott erklären, mich mit gewöhnlichen Verbrechern einsperren. Wir sind am Ende, Eliza!«
Gerade als ich nach der Schöpfkelle greife, um sie ihm vorsichtig wegzunehmen, platzt Catherine ins Gesellschaftszimmer. »Eliza, komm schnell! Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Ach, was sollen wir nur tun?«
4
ANN
Gewürzte Grütze
Während ich unseren Flecken Land beackere, der nicht größer ist als eine Streichholzschachtel, denke ich über die Worte des Pfarrers nach. Mam ist mit einem drei Meter langen Strick an mir festgebunden. Wir hacken und graben zusammen und versuchen, ein wenig Lauch anzupflanzen. Ich sage zusammen, aber die meiste Zeit muss ich ihr gut zureden, muss bitten und betteln. Mam, knie dich bitte jetzt nicht hin, ja? Mam, bitte zieh nicht so am Strick. Hör auf mit dem Gemaule, Mam! Den lieben langen Tag sage ich Mam, tu dies und Mam, tu das.
Soeben hat sie begonnen, mit ihren vier Zähnen, die so locker geworden sind, dass sie bestimmt nicht mehr lange an ihnen haben wird, an dem Strick zu nagen. Als ich versuche, ihr den Strick aus dem Mund zu nehmen, sehe ich, dass ihre Zunge einen pelzigen Belag hat. Ich schnuppere ihren Atem. Ihr Mund und ihr Zahnfleisch verströmen einen gemeinen, zähen Krankheitsgeruch, aber für einen Arzt haben wir kein Geld. Alles, was Jack uns geschickt hat, geht für Pas neue Krücke drauf, die aus sehr widerstandsfähigem Holz gemacht werden muss. Der Pfarrer sagt, nur wenn seine Krücken von bester Qualität sind, kann Pa auf dem Friedhof arbeiten.
»Kannst du nicht mal stillsitzen, Mam?« Sobald sie daran zieht, schneidet der Strick mir in den Arm. Sie hebt die knochige Hand, als wollte sie mich schlagen. Ich zucke zusammen und will schon Pa zu Hilfe rufen – er liegt auf der Matratze und schläft –, als ich eine vertraute Stimme singen höre. Mein Herz macht einen Sprung. Diese Stimme würde ich jederzeit wiedererkennen. Immer so fidel, so voll guten Mutes. Im nächsten Moment spaziert er schon stolz wie ein Gockel durchs Tor.
»Wer ist da, Ann?« Mams Augen sind schreckgeweitet, ihr Blick schießt von hier nach dort. Ich aber bin so überglücklich, Jack zu sehen, dass ich zu ihm stürze und das Seil vergesse. Mam wird rüde hinter mir hergezogen und beginnt mit ihren Krallen meinen Rücken zu bearbeiten.
»Um Himmels willen«, sagt Jack, dem alles Trällern und Stolzieren vergeht, als er sieht, wie Mam und ich taumeln und torkeln. »Was ist das für ein Seil?«
Ich binde das Seil los und wickle es um ihre Handgelenke, um ihr wildes Gefuchtel zu beenden. Dann erzähle ich Jack, wie ihr Zustand sich verschlechtert hat, dass sie jetzt wegläuft, sich bis zur Unterwäsche die Kleider vom Leib reißt, Kind und Kegel nicht mehr erkennt. Als ich fertig bin, laufen mir Tränen übers Gesicht, und ich kann nur noch schlucken und würgen.
»Mam? Mam?« Jack blickt auf die im Dreck kauernde Frau. »Ich bin aus London zurück und habe dir und Pa ein wenig Geld mitgebracht. Zwei Tage lang bin ich mit einem Viehtreiber und seinen Ziegen gelaufen, nur um … Mam?«
Sie starrt ihn nur ängstlich an. »Ich kenne Sie nicht«, sagt sie und beginnt, mit dem Seil, das um ihre Handgelenke liegt, zu kämpfen. Und als sie die Hände nicht daraus lösen kann, versucht sie davonzuhüpfen, zur Landstraße hinüber. Ich ziehe sie zurück und halte sie fest, während sie weint und sich auf den Kopf schlägt, bis sie sich schließlich still an mich lehnt. Ihre Knochen sind dünn wie die eines Vögelchens, und sie riecht, wie keine Mutter riechen sollte. Da wird mir schlagartig klar, dass sich unsere Rollen ganz und gar umgekehrt haben.
»Ach, Ann«, sagt Jack und schüttelt den Kopf. »Warum muss man sie anbinden wie einen Esel?«
Ich reibe mir mit schmutzigen Fäusten die Augen. Schließlich raune ich: »Der Pfarrer möchte sie in eine Anstalt geben. Er stößt sich dran, wenn sie ohne ordentliche Kleider herumläuft. Er sagt, das sei nicht gut für die Moral in seiner Pfarrei. Deshalb muss ich sie festbinden.«
»Moral!«, schnaubt Jack. »Seit wann hat ein Kirchenmann denn eine Moral?«
»Schweig!«, sage ich. »Er ist ein gottesfürchtiger Mann und hat gute Absichten, sagt Pa.«
»Es gibt nur einen Ort, an dem du Gott finden kannst, und das ist nicht in einer Kirche oder bei einem Pfarrer.«
»Wo denn dann?« Ich richte mich und Mam auf, und Jack hilft uns beiden nach drinnen.
»In einem Kanten Brot«, sagt Jack ohne den Anflug eines Lächelns. »Noch besser: in einer guten Mahlzeit. Bei einem guten, herzhaften Abendessen wird er gern und oft gesehen.«
Seine Antwort und die Verachtung in seiner Stimme verunsichern mich. Hat Mam uns denn nicht dazu erzogen, auf den Herrgott zu vertrauen? Ich bin kurz davor zu sagen, dass er irrt, dass ich mich schon besser fühle, wenn ich nur allein in einer Kirche sitze, bei den geschnitzten Engeln, umgeben vom Geruch der brennenden Kerzen, als ich beschließe, nicht länger über diese Dinge nachzudenken. Mam ist jetzt still wie eine Maus, das ganze Grauen ist vorbei.
»Erzähl mir von London, von deiner Arbeit«, bettle ich. Bis Pa aufwacht oder Ma mit ihrem Genörgel beginnt, oder Septimus losbellt, habe ich Jack ganz für mich, und ich will keine Zeit damit verschwenden, über Gott oder die Kirche, oder sonst etwas zu reden.
»Ich bin jetzt in der Bratküche, ziehe den Tieren das Fell ab und dressiere das Geflügel«, sagte Jack. »Es gibt dort zwei Herde, so groß wie diese Matratze, und Spieße, an denen man ein ganzes Schaf grillen kann.«
»Ein ganzes Schaf …« Ich sehe zartes gegrilltes Hammelfleisch vor mir, das nach Holzrauch und Waldkräutern schmeckt. Mir schießt der Speichel in den Mund. Rasch stelle ich einen eisernen Topf mit Haferflocken und Wasser auf einen Dreifuß über dem Feuer, das niedrig und lustlos brennt. »Erzähl mir von dem guten Essen, das du zubereitest.«
»Also letzte Woche hat ein feiner Herr das Soufflé zurückgehen lassen, und Master Soyer hat uns aufgefordert, es zu probieren.«
»Was ist ein Soufflé?« Ich seufze, denn so klingt das Wort. Sanft und süß wie ein laues Sommerlüftchen. Ich wiederhole das Wort im Stillen: Soufflé. Soufflé.
»Du verquirlst Eier, bis sie leicht sind wie Luft. Und du schlägst Sahne und Butter auf, ganz frisch, und die Butter so hell wie möglich und in sehr kleine Stücke geschnitten. Dann würzt du es. Master Soyer gibt gern italienischen Käse dazu, manchmal auch die edelste dunkle Schokolade. Und dann ab in den Ofen, wo es so hoch aufgeht, dass du es kaum glauben kannst. Und wenn du hineinbeißt, ist es, als hättest du eine Wolke auf der Zunge.« Jack schmatzt laut.
Ich rühre abwesend in der Grütze herum und wünschte, wir hätten ein paar Johannisbeeren, um sie zu süßen. Und als ich an Johannisbeeren denke, tauchen vor meinem inneren Auge allerlei andere getrocknete Früchte auf. Ich habe sie auf dem Markt in Tonbridge gesehen. Große Haufen runzeliger, glänzender Pflaumen und Rosinen, mit einem weißlichen Sirup überkrustete Orangenschalen, Apfelringe wie butterweiches helles Leder.
»Es gibt eine Speisekammer nur für Wild. Goldschnepfen, Waldschnepfen, Fasane, Moorhühner, Perlhühner … Und einen Fliegenschrank, in dem große Rinder- und Rehkeulen gelagert werden. Und Spanferkel und ganze Schafe. Und einen Ofen, auf dem manchmal neun Schmortöpfe gleichzeitig vor sich hin blubbern.« Jack stockt, und sein Blick wandert zur Decke, die Risse und Flecken hat und bis zu der in den Ecken die Ackerwinde hochwuchert. »Du solltest Master Soyer einmal sehen. Er trägt ein rotes Barett und einen Diamantring, so groß wie eine Eichel. Egal, wie heiß die Suppe ist, er langt mit dem Finger hinein, mitsamt dem Diamanten und allem, und leckt ihn ab. Und dann schüttelt er den Kopf über dies und das – mehr Salz, mehr Pfeffer, mehr Cayennepfeffer. Bis es richtig ist.«
»Großartig«, murmle ich und denke, wie dramatisch sich das alles anhört und dass eine Küche wie ein Puppenspiel ist, ein Märchen, und wie gut es sein muss, nicht diesen brutalen Hunger zu spüren, der Pa und Mam und mich überfällt, wenn Essen und Geld sich rarmachen. Und wie gut es sein dürfte, in einem Raum zu sein, der immer warm ist.
»Es gibt viele Mädchen in der Küche, aber nur hübsche. Der Master sagt, er will keine gewöhnlichen Köchinnen in seiner Küche.« Jack stochert in der erlöschenden Asche herum und gähnt.
Ich konzentriere mich auf den Haferbrei, rühre fest in dem Eisentopf. Für einen kurzen Augenblick ist mir, als habe man mir eine riesige Tür ins Gesicht geknallt. Denn ich bin sehr wohl gewöhnlich. Und wie lange nähre ich nun schon diesen kleinen Traum in mir, an Jacks Seite zu arbeiten? Ach, so viele Monate. Abends, wenn ich schlafen gehe, denke ich an Master Soyer in seiner weichen Kochschürze, denke mir mich an seiner Seite, mit dem Schneebesen, dem Schneidmesser, der Rührgabel oder dem Probierlöffel in der Hand. Es wird mir eine Lehre sein. Träume sollten einfach Träume bleiben, sonst nichts. Umso energischer rühre ich die dünne graue Hafergrütze um. Mam schläft jetzt, neben Pa auf der Matratze eingerollt. Friedlich wie zwei Katzen.
»Erzähl mir mehr.« Meine Stimme klingt wie das Quieken einer Maus. Jack verengt die Augen zu Schlitzen und sieht mich eindringlich an, dann nickt er und beginnt all die großartigen Gerichte zu beschreiben, die auf ihrer Reise von der Küche zu den Restaurantbesuchern schon an seiner Nase vorbeigeschwebt sind. In Weinblätter gewickelte Täubchen. Austern in einer knusprigen Teighülle. Ganze Gloucester-Lachse in Aspik. Hummer aus Yarmouth, in Wein und Kräutern gegart. Glasierte Cox-Orange-Tarte. Papierdünne Schichten aus buttrigem Teig, belegt mit Reineclauden, Aprikosen, Pfirsichen, Kirschen, serviert mit einem großen Klacks goldgelber Sahne.
»Schön und gut«, sage ich, »bei uns gibt es heute Hafergrütze mit einer Prise Salz und Pfeffer.« Woraufhin er in seine Tasche greift, ein zusammengefaltetes Stück Ölpapier herauszieht und es öffnet. Mir weht der Duft von Heidehonig entgegen.
»Für dich, Ann.« In seiner schmutzigen Hand liegt ein triefendes Stück Honigwabe, nicht größer als ein Kiebitzei.
Ich klatsche entzückt in die Hände, meine Zunge flattert in freudiger Erwartung. Als wir unsere Hafergrütze essen, behalte ich die zähen Wachsklümpchen so lange wie möglich im Mund, lasse sie darin umherwandern, presse sie gegen die Backenzähne und sauge sie aus, bis sie mir schließlich süß die Kehle hinuntergleiten. Erst als meine Schale saubergewischt und von der Honigwabe auf meinen Zähnen nichts mehr übrig ist, erzähle ich Jack, dass der Pfarrer es gern sähe, wenn ich mir eine Stellung suchte, und dass er meint, ich sei einfallsreich und patent.
»Und wenn Mam gar nicht in diese Anstalt möchte?«, fragt Jack, aber ich antworte ihm nicht. Und ich erzähle ihm nicht, dass Pa versucht hat, Mam, als ich sie für gerade mal eine Stunde allein gelassen habe, zu erdrosseln. Jack stellt seine Schüssel auf den Boden, damit Septimus sie sauber lecken kann. »Und was willst du, Ann?«
»Ich will …« Ich stocke kurz, dann schießt es aus mir heraus: »… Köchin werden.«
»Köchin?« Und schon krümmt er sich und bricht in so wildes Gelächter aus, dass ihm die Tränen übers Gesicht laufen.
»Ja«, sage ich gekränkt. »Eine gewöhnliche Köchin.«
Er deutet auf seine leere Haferbreischüssel und lacht wieder los. Dann wischt er sich die Augen und sagt, es tue ihm leid, aber selbst er dürfe – nach drei Jahren Küchendienst – nicht mehr tun, als den Spieß zu drehen und das Feuer zu schüren. Am liebsten würde ich ihm in Erinnerung rufen, dass ich lesen und schreiben kann und er nicht. Dass ich träumen kann. Und hoffen. Aber ich halte den Mund. Wozu sollte das gut sein?
Mein Blick wandert ganz von selbst zu dem Regalbrett, auf dem früher Mams Bücher gestanden haben. Und da weiß ich plötzlich, dass ich allein bin. Ein seltsames, längst vergessenes Gefühl überkommt mich. Es ist, als stünde ich am Abgrund der Erde. Mutterseelenallein.
5
ELIZA
Brauner Brotpudding
Ich hole meine Bücher von den Regalen, eins nach dem anderen, halte inne, um einen besonders hübschen Buchrücken oder einen Einband aus italienischem Leder mit Prägedruck zu streicheln. Wordsworth, Keats, Shelley, Coleridge – jeden Band einzeln wickle ich in altes Zeitungspapier und packe ihn vorsichtig in eine Teekiste. Dann schaue ich zum nächsten Regal hinüber: die Gesammelten Werke von Anne Chandler, sieben Gedichtbände von Mrs Hemans und drei von L. E. Landon. Ab und zu blättere ich ein wenig, erfreue mich an einem wohlbekannten Vers, spüre, wie aus meinen Schulterblättern Flügel wachsen.
Als meine kleine Bibliothek weggepackt ist, fasse ich unter die Matratze und taste nach einem letzten Band … sauber, elegant und fest in saphirfarbene Seide gebunden. Ich setze mich auf die Bettkante und starre darauf: Eliza Acton, Die Gedichte. Wie schlank und dünn es wirkt! Ich fahre mit dem Finger den Rücken entlang, halte es an meine Nase, atme den trockenen Geruch von Staub und Pergament ein. Dann schlage ich das Buch auf und verspüre dieselbe Befriedigung wie damals, als ich es zum ersten Mal in Händen hielt und verblüfft war, wie sehr die saubere Ordnung der Druckbuchstaben die tintige Sentimentalität meiner Verse verändert hatte. Wie die Form ihnen zu mehr Klarheit verhalf. Ihnen Gewicht und Bedeutung verlieh. Und sie von mir loslöste, die Nabelschnur endgültig durchtrennte. Ich mochte dieses Gefühl damals – und ich mag es auch jetzt. Aber bei genauerem Hinsehen verspüre ich Scham und Schande … Meine ersten Gefühle, und meine letzten, gehörten dir – dir allein –leb wohl!!
Wie jugendlich diese Worte jetzt erscheinen. Vielleicht hatte Mutter recht. Sie sind überdreht, voller Gefühlsüberschwang. Zumindest wirken sie so, jetzt, ein Jahrzehnt später. Meine neuen Gedichte sind besser, geschliffener, ausgereifter. Und doch, Mr Longman … Ich sehe ihn vor mir, wie er mit seinen plumpen, beringten Fingern seine Taschen abklopft, höre das Ticken seiner goldenen Taschenuhr in der Backofenhitze seines Büros widerhallen, sehe den großen polierten Schreibtisch, der wie die Chinesische Mauer zwischen uns stand. Bis heute hat er mir meine Gedichte nicht zurückgegeben. Verloren, ganz bestimmt. Untergegangen in der Flut von Manuskripten – Biografien, wissenschaftlichen Büchern, Gedichten, Schauerromanen –, die täglich von den schweißnassen Fäusten hoffnungsvoller Schriftsteller im ganzen Land kommen.
Ich lasse den Band in die Teekiste gleiten und sehe mich in meinem Zimmer um: der leere Kaminrost, die Damastvorhänge, die von den Haken genommen und zu sauberen Vierecken gefaltet worden sind, der alte türkische Teppich, zusammengerollt und an den Mahagoni-Waschtisch gelehnt. Wir nehmen nur das Allernötigste mit: Betten und Leinzeug, zwei hohe Kommoden, den Küchentisch aus Ulme und den Mahagoni-Esstisch mit den dazugehörigen Stühlen. Alles andere soll versteigert werden: die Drucke und Gemälde, das Kristall, das Silbertablett, die Federmatratzen, die Wanduhren, die Teppiche und Bücher. Nur meine Büchersammlung nicht, um die ich gekämpft habe, indem ich dafür meinen gesamten Schmuck hergab. Zur großen Überraschung meiner Schwestern, die behaupteten, entgeistert zu sein, dass ich gegenüber meiner dreireihigen Perlenkette, meinen Diamantohrringen mit Golddraht und meiner Brosche aus Amethyst und Rosenquarz Büchern den Vorzug geben konnte.
»Eliza! Eliza!« Mutters Stimme schallt aus dem unteren Stockwerk herauf.
Ich lege den Deckel auf die Teekiste, die nun zugenagelt werden kann, und gehe hinunter. Im ganzen Haus herrscht großes Durcheinander, werden Möbel herumgewuchtet, Teppiche zusammengerollt, Porträts und Landkarten von der Bilderleiste abgehängt, Vorhänge abgenommen, wird das Porzellan, werden Bücher, Spiegel und sämtliche Dekorstücke aus meiner Vergangenheit eingewickelt und in Holzkisten verstaut. Das alles wird bald die Häuser anderer Menschen schmücken. Nach Anbruch der Dunkelheit, wenn niemand uns sieht, werden wir zu unserem neuen Zuhause aufbrechen. Wie Diebe in der Nacht.
Mutter taucht auf, sie nestelt an dem Jettkreuz herum, das sie um den Hals trägt. »Cook ist in einem schrecklichen Zustand. Geh schnell hinunter in die Küche, Eliza.« Und schon wendet sie sich ab und bellt einem Jungen, der untätig im Eingangsflur herumsteht, Anweisungen zu.
»In die Küche?« Da bin ich seit vielen Monaten nicht mehr gewesen. Die Küche, die Speisekammern und die Spülküche sind das Reich von Mrs Durham, der Köchin, und die mag keine Besucher. Unsere frühere Köchin war offenherziger, bei ihr durfte ich als kleines Mädchen die Eichenblätter, mit denen die Pasteten dekoriert werden, aus dem Teig schneiden oder die Fäuste in blasige Teighaufen drücken. Mrs Durham dagegen ist entschieden abweisend. Nur Mutter und Hatty haben noch die Erlaubnis, die Hintertreppe hinunterzusteigen. Oder Vater, sollte er den Wunsch verspüren, den Inhalt seines Weinkellers zu inspizieren. Doch der ist längst versteigert. Und Vater ist nach Frankreich geflohen.
Cook sitzt, umgeben von einer bunten Mischung aus Glasgefäßen, Blechbüchsen mit Zucker und Salz, Eierkörben und Zwiebelzöpfen, am Tisch. Zu ihren Füßen stehen Säcke im Kreis – gefüllt mit Mehl, Kastanien, Hopfen.
»Wird das alles nicht gebraucht, Miss Eliza?« Ihre Augen sind rosarot, und über ihr mehlbestäubtes Gesicht ziehen sich Tränenspuren. »Es ist alles so plötzlich gekommen, Miss Eliza. Und wir haben’s in der Anzeige im Ipswich Journal lesen müssen, bevor die Mistress es uns selbst sagen konnte.« Sie zieht ein verschlissenes Taschentuch hervor und schnaubt lautstark hinein.
»Aber Sie kommen doch mit nach Tonbridge. Wir werden eine gute Köchin brauchen für unsere … Fremdenpension.« Ich runzle die Stirn bei diesem Wort, es klingt so neu aus meinem Mund. Fremdenpension. Fremdenpension. Es fühlt sich nicht gut an, und seinen Klang mag ich auch nicht. Ich schüttle den Kopf. Aber jetzt hängt es in der Luft wie eine unreife Frucht, die der Wind nicht vom Ast schütteln kann. »Nur Sie und Hatty haben wir behalten«, setze ich hinzu, denn ich bin mir nicht sicher, ob Mutter ihr irgendetwas erklärt hat. »Weiteres Personal müssen wir uns in Tonbridge suchen.« Falls wir es uns leisten können … Was unwahrscheinlich ist.
Cook nickt und schnäuzt sich noch einmal. »Was soll ich denn zusammenpacken? Ich habe keine Anweisungen erhalten … die Geleeförmchen? Die Kristall-Fingerschalen? Und was geschieht mit all den Gewürzen? Die sind ein Vermögen wert.« Mit bebendem Arm deutet sie über den Tisch, auf die Blechbüchsen und Glasgefäße und Steinguttöpfe. Unversehens gleitet ein Strahl Nordlicht über sie hinweg und erweckt sie zu leuchtendem Leben: Ornamentglasgefäße mit salzigen grünen Pfefferkörnern, Salzkapern, glänzenden Vanilleschoten, rostfarbenen Zimtstangen, alles ein funkelnder Augenschmaus. Jäh funkelt die Schönheit dieser Dinge: die Palette ihrer Farbnuancen – Ocker, Terrakotta, diverse Schattierungen von Erdfarben, Sand und Gras –, das blasse, zitternde Licht. Alle Gedanken an das Betreiben einer Fremdenpension sind verschwunden.
Ich greife nach einem Krug, nehme den Korkdeckel ab. Der Geruch von Rinde, Erde, Wurzeln, Himmel. Und eine Sekunde lang bin ich anderswo. »Der mysteriöse Duft eines geheimen Königreichs«, murmele ich. Der Krug enthält kleine Kügelchen, braun, rund, unexotisch. Wundervoll, dass etwas so Einfaches einen derart betörenden Duft haben kann, denke ich.
»Oh, Miss Eliza. Immer eine Dichterin! Das ist bloß Piment.« Cook lächelt matt und zeigt zur Decke, wo lange Kräuterbündel an einem Rahmen hängen. Rosmarin, Gänsekraut, Salbei, Brennnessel, Waldmeister. »Und was soll ich damit machen? Den ganzen Sommer über hab ich sie gesammelt, und sie sind immer noch nicht ganz trocken.« Sie zeigt zur Decke.