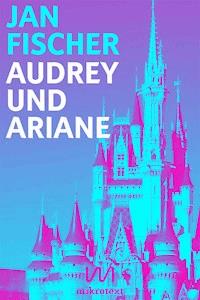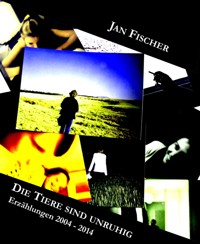
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jan Fischer studierte von 2003 bis 2010 Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. "Die Tiere sind unruhig" ist eine Sammlung seiner Kurzgeschichten aus den letzten 10 Jahren, veröffentlicht zwischen 2004 und 2014. "Meine kürzeren Geschichten sind das größere Problem. Ein paar sind in den entsprechenden Anthologien noch erhältlich, viele nicht, manchmal, weil es die Verlage nicht mehr gibt, weil alle Exemplare verkauft oder verschwunden sind, aus 10 oder 20 anderen Gründen. Ich habe – nicht nur, weil ich es anders schade fände - meine Geschichten immer gerne irgendwo da draußen, wo Leute sie lesen können." (Aus dem Vorwort)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Tiere sind unruhig
Erzählungen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort: Stolpern und Nostalgieanfälle
Am Ende saß ich auf dem Boden, überall aufgeschlagene Belegexemplare um mich herum, mitten in einem harten Anfall von Nostalgie. Ich trug meinen schwarzen Bademantel, in dem ich am liebsten arbeite.
Ich hatte ein Buch gesucht, ich weiß nicht mehr was, ich weiß nicht mehr für was, für irgendeinen Artikel, irgendeine Referenz, die ich gerade brauchte. Stattdessen stieß auf dieses Buch: stattflucht. Wir - der 2003er-Jahrgang des Studiengangs Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim - hatten das Anfang 2004 herausgebracht, einfach, weil wir gerne mal etwas veröffentlichen wollten, eine kleine Werkschau. Weil wir, nachdem wir nun an einer Schreibschule studierten ja wohl auch Autoren waren, und Autoren ohne Bücher sind nur so halbe Autoren, klar.
Es gab sogar eine Release-Lesung, oben, in dem kleinen, stickigen Raum der Kulturfabrik, der ja schon zu meinem zweiten Zuhause geworden war und es die nächsten paar Jahre auch blieb. Es kamen sogar ein paar Leute Lesung. Nicht so viele, und ganz ehrlich gesagt heute auch nicht mehr zu so was gehen.
Ich fand also dieses Buch, von dem ich auch gar nicht mehr wusste, dass ich es überhaupt noch hatte, auf der ersten Seite die Unterschriften aller Autoren, Menschen, die mir heute noch wichtig sind, größtenteils Freunde, und die, das ist das schönste daran, alle irgendwie ihren Weg gehen.
Ich wühlte weiter im Bücherregal, zerrte diese ganzen Anthologien und Zeitschriften heraus, die irgendwann einmal der Meinung gewesen waren, dass es eine gute Idee wäre, einen Text von mir abzudrucken. Ich schlug sie auf, blätterte darin herum, las, erinnerte mich, schlug wieder die stattflucht auf, weil ich wissen wollte, wann das eigentlich gewesen war, mein erster Text, der in einem Buch abgedruckt worden war. Und stellte fest: Vor 10 Jahren.
Ich kann – und möchte auch nicht – hier jetzt die letzten 10 Jahre aufbereiten, es gab ein Studium, es gab Veröffentlichungen, es gab Lieben und Affären, es gab Projekte, die scheiterten und solche, die nicht scheiterten, es gab Freunde und Freundinnen, es gab schwere Zeiten, gute Zeiten, alles dazwischen. Insgesamt: Tolle 10 Jahre, wenn die nächsten auch so würden, wäre ich zufrieden.
Was es aber vor allem gab, in meiner Welt, sind Geschichten. Alles verteilt in diesen Belegexemplaren, die, selbst während ich das hier schreibe, immer noch auf dem Boden herumliegen, kreisrund um dieses Loch verteilt, in dem ich saß und meinen Anfall von Nostalgie verarbeitete. Und in dem ich vor allem dachte: Wäre es nicht nett, diese ganzen Geschichten mal einem Ort zu haben? In einem Band? Nicht, dass ich der Meinung wäre, dass Leute sich so wirklich dafür interessieren würden, aber alleine, weil ich es einen schönen Gedanken finde.
Das Problem ist: Wenn man – ich – zu Verlagen oder Agenturen geht, und versucht, schon veröffentlichte Erzählungen loszuwerden, also sowas sagt wie: Hey, ich hab hier 200 Seiten coole Short Stories aus den letzten 10 Jahren, die sind zwar alle schon in anderen Büchern, aber kann man doch machen, oder?, dann werfen die einen raus. Oder sagen zumindest, dass sowas sich nicht verkauft, aber man sei doch talentiert, das seien doch alles gute Geschichten, man solle doch mal mit etwas längerem ankommen. Zumindest bekomme ich das immer gesagt.
Nunja, mein Längeres tourt gerade durch die langsamen Mühlen des Literaturbetriebs – ich bin vorsichtig optimistisch. Nicht unzufrieden. Alles wird gut.
Meine kürzeren Geschichten sind das größere Problem. Ein paar sind in den entsprechenden Anthologien noch erhältlich, viele nicht, manchmal, weil es die Verlage nicht mehr gibt, weil alle Exemplare verkauft oder verschwunden sind, aus 10 oder 20 anderen Gründen. Ich habe – nicht nur, weil ich es anders schade fände - meine Geschichten immer gerne irgendwo da draußen, wo Leute sie lesen können. Am liebsten, wenn sie einfach zu bekommen sind, idealerweise gratis, zumindest aber billig zu haben und für mich ohne großen Aufwand zu veröffentlichen (ich habe mich dafür entscheiden, für diesen Band ein kleines bisschen Geld zu nehmen, weil ja doch eine Menge Arbeit drinsteckt).
Ich möchte jetzt nicht auf die langwierige E-Book vs. P-Book Diskussion eingehen, und auch nicht auf wie noch langwierigere Diskussion Self-Publishing vs. Verlagsveröffentlichung. Ich veröffentliche, wo ich kann. Wenn man noch meine notorische Ungeduld dazu nimmt und die Zeit, die so ein P-Book braucht, dann schreit vor allem bei diesen Texten alles nach Selbstpublikation. Es sind ja Texte, die schon da sind, die schon durch Lekto- und Korrektoratmühlen gegangen sind.
Allerdings, man kann das nicht anders sagen, sind manche von Texten, vor allem die früheren, holprig. Für Geschichten wie Orangeneis und Zugzielanzeiger schäme ich mich tatsächlich ein wenig, es sind Gehversuche von einem, der kaum krabbeln kann, ständig auf die Schnauze fällt und weitergeht. Das sind – auch nach der Überarbeitung noch - holprige Texte, voller Pathos, bevor ich mich noch einmal darangesetzt habe sogar voller falscher Zeitformen.
Andere Texte, wie Ratten und Kakerlaken, hatte ich seit Jahren nicht gelesen, und stellte fest, dass der Text eine unglaubliche Power entwickelt, dass da einer unbekümmert an seinen Text, sein Riesenthema herangeht und einfach durchbrettert, ohne nach links und nach rechts zu kucken. Würde ich heute nicht mehr hinkriegen, nicht so unbekümmert, nicht so naiv.
Manche Texte mag ich heute noch, manche nicht. Manche sind Experimente, die als Zuchtansatz in einem Laborglas vielleicht mal Sinn gemacht haben – Sleeper, zum Beispiel – hier draußen in der Welt dann nicht nicht so. Aber ich mag immer die Bildwelten, diese Motive, an denen ich mich immer noch abarbeite, die ich ununterbrochen remixe, neu gestalte, ausformuliere: Diese ganzen Tiere, die ständig auftauchen, das ununterbrochene Wegglitschen ins Surreale und Magische, diese Erzählungen, die fast immer von Verlust handeln. Gerade die alten Texte zeigen das sehr roh, sehr brutal. Mir war, bevor ich die Geschichten zusammengestellt habe, gar nicht so klar, dass das ein Ding ist, das ich mache, eines, das man über die Jahre, in so konzentrierter Form, so gut beobachten kann.
Für mich, als derjenige, der den ganzen Kram geschrieben hat, ist die Zusammenstellung vor allem als Prozess interessant – mir war schon klar, dass da in den letzten 10 Jahren etwas passiert ist, aber es ist auch das erste Mal, dass ich das so gebündelt lese, so gebündelt sehe, was da passiert ist, wie oft ich gestolpert bin, wie if ich mich verlaufen habe, wo ich überall war.
Größtenteils finde die Geschichten aber – auch einzeln – gelungen, und das ist tatsächlich etwas, das mir immer schwer fiel, weil es vom Kopf auf das (digitale) Papier doch immer ein sehr weiter Weg ist. Auf Geschichten wie Die Taubenjägerin oder Unter den Türmen hinter der Stadt bin ich stolz, auch, wenn ich genau weiß, dass es da im Getriebe manchmal noch hakt. Aber ich hoffe immer, dass ich der einzige bin, der das sieht. Aber ich bin stolz darauf, dass sie bei renommierten Literaturzeitschriften und Wettbewerben Erfolg hatten, auch, wenn das manchmal einen etwas schalen Nachgeschmack hinterlässt, weil es mir nach wie vor schwerfällt, mich – es gibt Ausnahmen – mit dem anzufreunden, was sich Junge deutsche Literatur nennt, und dem ganzen feuilletonistischen Brimborium darum, der, denke ich, weit entfernt ist von Menschen, die tatsächlich lesen. Aber auch die Diskussion möchte ich hier nicht führen (ich führe sie aber gerne mal abends bei einem Bier).
Der Punkt ist: Ich mag diese Zusammenstellung, ich freue mich, dass das alles mal zusammenkommt. Ich freue mich noch mehr, wenn Menschen sie lesen. Ich freue mich, dass sie da draußen ist, teilbar, kaufbar, lesbar. Ich freue mich, dass mein Nostalgieanfall dazu geführt hat, dass ich endlich diese ganzen Sachen noch einmal gelesen, überarbeitet und teilweise aus lang vergriffenen Büchern abgetippt habe. Und jetzt ist es in der Welt.
Jetzt seid ihr, die Leser, dran.
Orangeneis
Bei der Beerdigung ist die frisch aufgeworfene Erde neben dem Grab zu zu weißen Brocken gefroren. Niemand sieht überrascht aus, kaum jemand traurig. Vielleicht waren sie überrascht, die Nachricht zu bekommen, ich weiß es nicht, vielleicht hatten sie Mitleid geheuchelt, vielleicht wirklich etwas gefühlt: Die Gesichter verraten es nicht.
Niemand sagt es, sie stemmen sich alle gegen den Wind. Auf den schwarzen Mantel ihrer Mutter fällt ein Träne, ein glänzender reflektierender Punkt auf dem schwarzen Stoff.
Als ich sie das erste Mal traf, rissen die Beats ihr die Worte aus dem Mund, die reichten fast nicht bis an mein Ohr, ich tanzte nicht, ich stand einfach nur in den bunten Lichtern.
Woran denkst du?, fragte sie.
Nichts, sagte ich.
Sie sagte: Ich denke an den Geruch von Orangen.
Ich glaubte ihr nicht, ich war abwesend, sah uns beide wie aus einem Raumschiff ohne Antrieb, das mitten in der Nacht an die Grenze des Sonnensystems driftet.
Vielleicht sagte ich etwas, ich sah meinen Mund offen stehen, jedenfalls war ich unbeteiligt am Gespräch, während die Beats silbern um uns herumschossen wie ein Meteroitenschauer.
Willst du tanzen?, fragte sie.
Nach der Beerdigung zieht die Kälte mich mit, der Wind bläst bis auf die Haut, die Menschen, deren Namen ich nicht kenne, nicken mir aufmunternd zu, ich versuche zu lächeln.
Warst du schonmal in einem Raum, der so kalt war, dass dein Blut gefroren ist?
Ich laufe durch die Stadt nach Hause, überall die Menschenflüsse, mein Lächeln funktioniert nicht, in den Schaufenstern stehen Spiegel und spiegeln bis ins kleinste Detail mich.
Ich laufe weiter, bis es Abend wird, immer um meine Wohnung herum, so lange, bis es kein Licht mehr gibt als kaltes Neon, glänzend und fast schwarz.
Wir tanzten. Wir versuchen, in die Musik zu schmelzen, die lauter sein sollte als wir, wir versuchten, wie alle zu werden in einem Augenblick. Der Bass tropfte um uns herum, silbergrau oder schwarz, die Tropfen rannen uns durch die Hände, während die anderen es schaffen, darin zu schwimmen, schafften es, sich im Scheppern der Hi-Hats zu verlieren, während wir mit offenen Münder der Musik entgegen schrien, so laut, dass ich dachte, wir hätten es geschafft, sie zu übertönen.
Als wir gingen, zur mir oder zu ihr durch die engen Kopfsteinpflastergassen, sagte sie: Manchmal wäre ich gerne Malerin. Ich könnte einen Baum malen, einen Orangenbaum, der im Winter Früchte trägt, auf einem Dachboden, wo Licht und Schnee auf ihn fallen.
Das wäre mein Ort, sagte sie, mein einziger Ort.
Spätnachts beginnt es zu schneien, der Schnee legt sich auf das braune Wintergras, auf das verwitterte Holz der Schaukel, die im Wind hin und her knarscht, er legt sich auf die Spielgeräte. Mit dem Schnee wird es kälter, die Kälte zieht sich überall entlang, wie Efeu, der am Ende den Stein sprengt.
Morgen brummte der Kühlschrank durch die Wohnung, Sonnenlicht stand auf der weißen Küchenwand.
Warst du schonmal in einem kalten Raum, der nach Orange riecht?, fragte sie.
Sie goss den Saft ins Glas, an der Oberfläche weiße Blasen, Kodensperlen rannen daran herab. Sie rührte ihren Kaffee um, der Löffel schlug an den Becherrand. Unter dem Glas bildete sich eine Pfütze.
Mach die Augen zu, sagte sie, mach einfach die Augen zu.
Ich hatte den Geruch von Orange in der Nase.
In einem kalten Raum ist es anders, sagte sie.
Warum?, fragte ich.
Weil es einfach so ist, sagte sie.
Treffen wir uns wieder?, fragte ich.
In der Morgendämmerung sehen die Spielgeräte auf dem Spielplatz aus wie Menschen, die auf dem Boden liegen, wie Steinkreuze, wie ein erstarrtes Skelett auf dem Rasen, aus dem gebleichte ragen.
Wir haben uns noch einmal wieder getroffen. Es war auf dem Dach, sie hatte Wind im Haar.
Sie sagte: Ich male nicht laut genug.
Sie flüsterte: Mein Baum ist eingegangen.
Als sie sprang, flog sie durch einen Wirbel auf ihrem eigenen Haar.
Ich stehe am Fenster, als die Sonne aufgeht, der Schnee riecht so frisch, dass er unter den Füßen knirscht, die Kälte schneidet in die Lungen. Orangengeruch wirbelt durch das Fenster.
(2004, erschienen in stattflucht)
Zugzielanzeiger
Thomas will sich von ihr verabschieden. Alexandra steht auf dem Bahnsteig, sie kann nichts mehr sagen. Sie kann nicht verhindern, dass Thomas ihre verkrampften Finger von seiner Hüfte biegt, als der Zug einfährt.
Die Zugtüren zischen, als sie sich öffnen, Koffer und Schuhe klackern über den Beton, ein verschwitzter Mann rempelt Thomas an. Als Thomas einsteigt, dreht er sich nicht um, aber er spürt Alexandra im Rücken, er weiß, dass er nichts hätte tun können, er spürt Alexandra, wie sie dasteht und verlassen wird.
Alexandra kann nur noch hören. Sie hört das elektrische Surren der Bahnhofsuhr, das Klacken des Sekundenzeigers, der bei der vollen Minute ein länger als eine Sekunde auf der 12 steht. Sie kann das Aneinanderklacken der Steine im Kiesbett hören, die von den vibrierenden Schienen in Bewegung versetzt werden. Sie kann das gleichmäßige Rattern hören, als der Zug abfährt.
Thomas ist fort.
Thomas sitzt im Zug, die Sonne wirft helle Flächen auf die grauen Sitze, was hätte ich tun sollen?, denkt Thomas, der Rhythmus des Zuges nimmt den Gedanken auf und wiederholt ihn, was hätte ich tun sollen? Was hätte ich tun sollen?
Heute abend wird Alexandra die Fenster aufreißen, das weiß Thomas, das haben wir immer gemacht, wenn es so heiß war, denkt Thomas. Sie wird vor den offenen Fenstern die Vorhänge zuziehen, damit es dunkel und kühl bleibt, der Ventilator wird trübe in einer Zimmerecke rattern, sie wird in Unterwäsche auf dem Bett liegen, die Luft wird auf ihrem Körper stillstehen. Unten im Hof werden auch morgen die Kinder wieder Fußball spielen, den Ball immer wieder gegen das Garagentor wummern lassen.
Thomas kann die staubigen Sonnenstrahlen sehen, die durch die Vorhänge fallen werden, die Punkte, die die sie auf die Wand werfen, er hat immer versucht, sie zu einem Muster zu verbinden. Die Strahlen fangen in den Punkten an, hat er immer gedacht, und sie laufen alle fort, fort aus ihrem Zimmer. Er kann das Geräusch hören, das ihre Finger machen, wenn sie damit über die Narben an ihren Armen fährt.
Thomas ist allein, als der Schaffner seine Fahrkarte kontrolliert und ihm den Zettel gibt.
Schönen Tag noch, sagt er Schaffner.
Erinnerst du dich?, steht auf dem Zettel. Thomas erinnert sich nicht, aber er weiß, dass der Zettel von Alexandra ist, er weiß, dass ihre Erinnerung ein Stein ist, den sie nicht ablegen kann.
Wir waren im Park, steht auf dem Zettel, erinnerst du dich? Du hast mich gefragt, ob ich das Gefühl kenne.
Kennst du das Gefühl, fragt Thomas.
Du liegst auf dem Rücken, sagt er, und schaust die Wolken an.
Es ist nicht warm, sagt er, noch nicht. Der Wind ist kalt, aber die Sonne scheint durch die Wolken.
Auf der Straße tragen die Leute noch Jacken, sagt er, aber es sind Frühlingsjacken, Märzjacken, und vorne sind sie offen.
Thomas schaut Alexandra an. Sie lächelt.
Wenn du nicht an den Frühling glaubst, sagt er, dann fühlst du es nicht. Man muss den Geruch des Sommers in der Nase haben.
Alexandra richtet sich auf, stützt sich auf die Ellenbogen und blinzelt in die Sonne.
Erinnerst du dich?, steht auf dem Zettel, auf deinem Rücken waren die roten, hellgeränderten Abdrücke der Decke, auf der wir gelegen haben, steht auf dem Zettel, und die der Baumwurzeln unter der Decke.
Thomas hört die Kinder auf dem Spielplatz. Das Geräusch ist leicht und flüssig, weit entfernte Wellenlinien. Die Luft ist sauberer als sonst, als hätte der Regen den Staub, das alles, einfach fort gewaschen. Luft ohne Erinnerung.
Thomas zieht sein Tshirt aus, Alexandra hat ihre Jacke noch nicht ausgezogen.
Erinnerst du dich?, steht auf dem Zettel, du hast mich gefragt, ob mir nicht warm ist.
Es wird warm diesen Sommer, sagt Thomas, wollen wir mal schwimmen gehen?
Ich weiß nicht, sagt Alexandra.
Thomas sieht sie ihre rote Jacke zuziehen, der Geruch von Holzkohle weht von den Grillfeuern zu ihnen rüber, in den Lärm der spielenden Kinder mischt sich eine Frauenstimme.
Es ist Frühling, sagt sie, warum redest du von Sommer, wenn Frühling ist?
Nur so, sagt er.
Thomas zerknüllt den Zettel in der Hand.
Der Zug hält an, Thomas' Körper fällt nach vorne, als wolle er noch weiter fahren. Der Name der Station klingt blechern durch die Lautsprecher, die Zugtüren zischen, ein Mädchen steigt ein und setzt sich ihm gegenüber, sie trägt eine rote Jacke, die rote Jacke, die Alexandra gehört.
Thomas sieht die Jacke zum ersten Mal als Regen auf die Oberlichter der Bibliothek hämmert. Graues Licht fällt auf die grauen Teppiche, die Teppiche schlucken den Schall, die rote Jacke sitzt an einem Tisch weit hinten, alles liegt im gelben Lampenlicht, aus dem Grau und Gelb und dem Braun der Tische sticht nur die rote Jacke hervor.
Thomas kann nicht erkennen, was sie liest, aber ist davon eingenommen, konzentriert, sie vergisst sogar, ihr Haar zurückzustreichen.
Thomas setzt sich neben sie, er will sie ansprechen, aber er weiß nicht, was er sagen soll. Er nimmt Alexandras Hand.
In den Fensterscheiben spiegelt sich das Gesicht das Mädchens, das Thomas gegenüber sitzt. Das Licht von draußen verwischt es ein wenig, Thomas kann nicht entscheiden, ob es Alexandras Gesicht ist oder nicht.
Erinnerst du dich, sagt das Mädchen, an die Bibliothek? Ich dachte, es wäre endlich vorbei. Ich war glücklich, deine Hand nehmen zu können, mit dir weggehen zu können.
Sie zeigt ihm ihre Unterarme, die ganz vernarbt sind, ich dachte, alles wäre vorbei, sagt sie, ich dachte, du würdest verstehen, sagt sie, aber du hast nichts verstanden, du hast mich allein gelassen.
Das Mädchen zieht die Jacke aus, breitet sie über ihrem Schoß aus, sie schaut aus dem Fenster, blinzelt in die Sonne, was hätte ich tun sollen?, sagt Thomas.
Du hättest bleiben können, sagt das Mädchen, du hättest für immer bei mir sein können.
Die Narben an ihren Unterarmen brechen auf, Blut tropft auf die Jacke, Blut tropft auf den Boden, die Zugbremsen kreischen, Metall auf Metall, und Thomas springt auf.
Der Bahnhof ist groß, Menschen treiben durch die Halle, ihr Echo steigt bis hoch zu den Werbetafeln, reibt sich an den Wellblechbögen, verweilt dort kurz und fließt dann fort.
Thomas blickt die Uhren an, er kann das Surren kaum noch hören, die Menschen sind zu laut, die Ansagen sind zu laut, was hätte ich denn tun sollen?, Thomas ist zu laut.
Die Laute werden dann leise, das Licht wird dunkel, die Uhren beginnen, rückwärts zu laufen, und Thomas steht still.
Thomas steht in Alexandras Zimmer, er sieht sich selbst und Alexandra, sie sitzen nebeneinander, er kann ihre Wärme fühlen, er kann ihren Geruch riechen, der sich im Bettlaken verfangen hat. Er nimmt ihre Hand, er streicht über ihre Handgelenke, er kann die Narben an ihrem Unterarm spüren, kleine Erhebungen, er denke: Unregelmäßigkeiten. Man muss aufpassen, sagt Alexandra.
Thomas kann sich aufstehen sehen, er kann sich selbst sehen, wie er aus dem Zimmer geht, Alexandra schaut schaut das Licht an, das durch die Vorhänge fällt.
Thomas hört die andere Stimme, eine laute Stimme, voller Blech von oben: Die Zugzielanzeiger sind zur Zeit leider gestört, ich wiederhole: Die Zugzielanzeiger sind zur Zeit leider gestört.
(2005, erschienen in: Landpartie 05, Glück&Schiller, Hildesheim, 2005)
Schwellenland
Den ganzen Tag schon können sie Polizeisirenen durch das Fenster hören. Die Schiffe liegen immer noch in der Bucht.
Die fahren aus dem Hafen, wegen dem Sturm, hat Thomas gesagt. Es hat keinen Sturm gegeben. Gestern ist es schwüler gewesen. In diesem Land ist Winter.
Man kann im Winter bei offenem Fenster schlafen, steht in Katharinas Notizbuch. Katharina sitzt am Tisch und schaut ihre Notizen durch. Vor dem Fenster ist ein gekrümmter Strand mit Palmen, einer Mole, einem Neonschild, auf dem Coca-Cola steht, Kräne, die um halbfertige Hotels stehen und Straßenkinder, die sich in einem öffentlichen Pool waschen.
Thomas holt seine Kamera heraus. Die Kamera ist älter als er.Er will Katharina fotografieren. Thomas fotografiert nur Schwarzweiss. Das sähe schön aus, meint er. Sie, vor dem Fenster, am Tisch, im Hintergrund das Meer und die Schiffe. Langweilig, aber schön, sagt Thomas. Katharina schreibt es auf.
Gestern sind sie über den Markt gegangen. Vorgestern haben sie am Strand gelegen und ihre Füße in den Indischen Ozean gehalten. Jetzt habe ich alle Ozeane durch, sagte Thomas und hat seinen Fuß fotografiert, der in dem Schlamm steckte, den die Wellezurück gelassen hatte.
Thomas zoomt die Kinder ganz nah heran. Noch nicht einmal aus dem Hotel müsse er gehen, um echte Not zu fotografieren,sagt er, und streicht seine Haare zurück, die vor die Linse fallen. Thomas fotografiert auch die Kinder auf den Bänken ander Strandpromenade, die unter ihrem Pullover etwas einatmen. Klebstoff, sagt Thomas, die wollen keine Fußballler mehr werden. Katharina schaut von ihrem Notizbuch auf.
Er müsse herausfinden, wo die Sirenen herkämen, sagt Thomas, bestimmt könne man dort Fotos machen. Vielleicht habe es eine Schießerei gegeben, vielleicht sogar Tote.
Wir müssen morgen weiter, sagt Katharina. Thomas sagt, dass er sich darauf freue, er fände das Land sehr schön, es sei doch alles so, wie sie es sich vorgestellt hätten. Die Leute seien so arm. Die Fotos seien Tränenedrüsendrücker, vor allem diese Kinder.
Die Kinder wollen Fußball spielen, hat Katharina in ihr Notizbuch geschrieben. Sie mussten sich durch Verkaufsstände mit gefälschten Ebenholzelefanten kämpfen, eine Zigarette mit einem Verkäufer rauchen, der über Bayern München redete, als er herausfand, dass sie Deutsche sind. Sie liefen zwischen den schief gezimmerten Wellblechhütten, hinter ihnen eine Traube Kinder. Sie wollten alle später Fußballer werden, sagten sie, sogar die Mädchen, und streckten ihnen ihre Hände entgegen. Katharina hat ihnenjeweils fünf Rand gegeben. Thomas hat Fotos gemacht, Katharina hat aufgeschrieben, die Kinder fragten, woher sie kämen. Katharina sagte Germany, kniete sich neben die Kinderin den braunen Sand, um zu fragen, wie sie es hier fänden.Thomas sagte, sie solle so knien bleiben, sie sähe aus wie Mutter Theresa. Die Kinder posierten vor der Kamera. Thomas sagte, er hätte schwören können, dass sie absichtlich so elend aussähen. Die Kinder liefen zu ihm, verlangten Geld. Thomas weigerte sich, ihnen welches zu geben.
Kleine Gauner, nannte Thomas sie. Als sie wieder zurückwaren aßen sie mit Mais gefüllte, kleine Kürbisse und Süßkartoffeln im Holterestaurant im obersten Stock. Sie konnten über die ganze Stadt blicken. Ein schwarzes Mädchen trug ihnen das Essen schweigend an den Tisch. Katharina lächelte dem Mädchen zu, aber sie sah nicht auf. Die Fotos seien sicher gut geworden, sagte Thomas. Sie, Katharina, habe so sauber ausgesehen, und die Kinder so schmutzig.
Nach dem Essen bestellte Thomas Cuba Libre. Hinter ihnen spielte ein Pianist, die Bar war voller Stimmen. Thomas erklärte dem Barkeeper, dass in einen Cuba Libre brauner Rum und kein weißer käme, das müsse er doch wohl wissen, der Barkeeper sagte Sorry, Sir, der nächste geht aufs Haus.