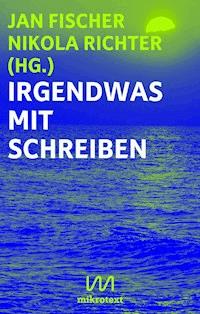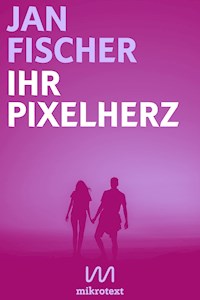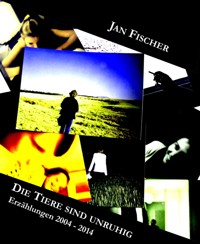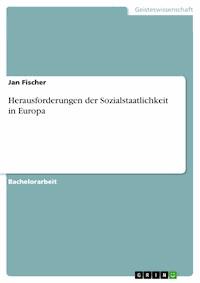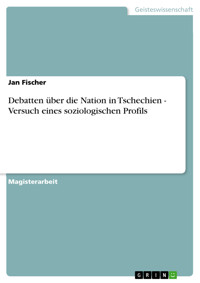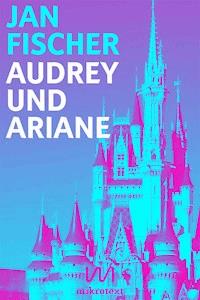3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mikrotext
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Ein Ort
- Sprache: Deutsch
Wie weit muss man sich von zu Hause fortbewegen, um ein Reisender oder eine Reisende zu werden? In sechzehn Kapiteln über diverse Bahnhofstätigkeiten wie das Einkaufen, Abfahren, Schlafen, Essen oder Arbeiten fächert der erste Band der Serie "Ein Ort" den Bahnhof als einzigartigen Schauplatz auf. Jan Fischer versucht, mehr als nur Bahnhof zu verstehen. Gekonnt verwebt er seine persönlichen Beobachtungen mit soziologischer Raum-Theorie von Marc Augé über Georges Perec bis hin zu Alain Corbins Geschichte des Geruchs: ein Text für alle, die das Zugreisen und die Eisenbahn-Romantik lieben und ihren Blick auf Bahnhöfe bereichern wollen. Mit Illustrationen von Inga Israel. „87 Seiten voller scharfer Beobachtungen. Leseempfehlung.“ Leaf and Literature „Das triviale wie melodramatische Bahnhofstreiben.“ Lesart/Deutschlandfunk Kultur „Der Bahnhof-Versteher.“ Hannoversche Allgemeine Zeitung „Jan Fischer hat eine lesenswerte Topologie über den Bahnhof verfasst. Ein Ort, der für jeden anders emotional besetzt ist und von J. Fischer gänzlich unaufgeregt in seiner Gesamtheit erfasst wird. Nach der Lektüre wird man Bahnhöfe definitiv anders wahrnehmen.“ Weltenbummler Mag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Wie weit muss man sich von zu Hause fortbewegen, um ein Reisender oder eine Reisende zu werden? Reicht nicht schon das Durchstreifen eines Bahnhofs, um Neues zu sehen?
In sechzehn Kapiteln über diverse Bahnhofstätigkeiten wie das Einkaufen, Abfahren, Schlafen, Essen oder Arbeiten fächert der erste Band unserer Serie Ein Ort den Bahnhof als einzigartigen Schauplatz auf. Jan Fischer versucht, mehr als nur Bahnhof zu verstehen. Gekonnt verwebt er seine persönlichen Beobachtungen mit soziologischer Raum-Theorie von Marc Augé über Georges Perec bis hin zu Alain Corbins Geschichte des Geruchs: ein Text für alle, die das Zugreisen und die Eisenbahn-Romantik lieben und ihren Blick auf Bahnhöfe bereichern wollen.
Nächste Orte als Buch und E-Book: Sarah Khan über das Wochenendhaus (2019) und Abbas Khider über die Küche (2020).
Jan Fischer
Bahnhof
Ein Ort
ein mikrotext
Erstellt mit Booktype
Coverdesign: Inga Israel
Coverfoto: pixabay.com (Lizenz CC0 1.0)
Covertypo: PTL Attention, Viktor Nübel
Printed in Germany
www.mikrotext.de – [email protected]
ISBN 978-3-944543-66-6
Alle Rechte vorbehalten.
© mikrotext 2018, Berlin
Bahnhof
Inhalt
Impressum
Titelseite
Vorrede
Eintreten
Anhalten
Einkaufen
Bewegen
Abtauchen
Pendeln
Verbieten
Warten
Abfahren
Essen
Arbeiten
Sitzen
Schlafen
Rauchen
Feiern
Heraustreten
Katalog
Lob des Imperfekts (Lesetipp)
Die Stadt der Anderen (Lesetipp)
Audrey und Ariane (Lesetipp)
Jan Fischer
Bahnhof
Ein Ort
Der Bahnhof ist eine Bar, ein Café, ein Restaurant,
neutraler Boden, Wartehalle, Hindernis, Heimat,
Sehnsuchtsort, Hassort, Entspannungsort,
eine Station, ein Weg,
ein Ort, der Menschen nimmt und sie wieder hergibt.
Immer alles gleichzeitig.
Eintreten
Man kann sich vom Haupteingang nähern, am Reiterdenkmal vorbei, die Einkaufsmeile der Stadt mit den vertrauten Logos der Bekleidungsketten im Rücken, in die repräsentativ überdachte Bahnhofshalle mit den Säulen hinein. Die Säulen sind glatt, weiß angestrichen, nur die Kapitelle wirken älter, historisch, wie die einzigen Originalteile in einer Konstruktion aus Plastik. Staubige Metallspitzen sind darauf angebracht. Sie sollen es den Tauben unmöglich machen, sich darauf niederzulassen.
Man kann sich vom Hinterausgang nähern, wo die Partymeile und die Kinos und die Restaurants auf einst versucht utopistische und jetzt verfallene, verlassene oder zu eilig renovierte Sichtbeton-Architektur trifft. Wo sich in den betonierten Abgründen, die ins Untergeschoss führen, Menschen treffen, die die Lokalzeitung „Trinkerszene“ nennt: lautstarke, zu jeder Zeit betrunkene Grüppchen, misstrauisch von der Security beäugt. Sie – befindet die Lokalpresse – „bescheren dem dort ansässigen Einzelhandel Umsatzeinbußen“. Der Einzelhandel sind ein Discount-Supermarkt, ein Ein-Euro-Shop, eine Drogerie und einer der letzten Filmverleihe der Stadt, der auch andere Filme im Sortiment vorrätig hält, aber nur mit Pornofilmen wirbt.
Man kann sich von unten nähern, durch die Passage, die vom Stadtzentrum unter der Halle hindurch führt und von einer eigenartigen Zusammenstellung von Geschäften gesäumt wird: mehrere Nagelstudios, ein Schlüsseldienst, Schuhgeschäfte, in denen alle Schuhe mit Pailletten besetzt sind, ein Kofferladen, in dem Koffer unterschiedlichster Größen wie eine Armee aufgereiht aus dem Schaufenster heraus Passanten beobachten, ein Geschäft, das anbietet, Portraits in Plexiglasblöcke zu gravieren. Die Passage geht kaum merklich in das Gebäude über. Die Farbe des gefliesten Bodens – erst grau, dann in einem schwarz marmorierten beige – ändert sich in einem sanften Farbverlauf. Es gibt eine Stelle mit einer kleinen Höhendifferenz, das ist die Stelle, an der man schließlich im Gebäude steht. Das erste Geschäft ist ein Blumenladen. Es gibt viele Treppen von der Passage in den Bahnhof, alle fünfzig Meter eine, es gibt Aufzüge, man kann in die nächste Etage aufsteigen, wo man will.
Man kann mit der U-Bahn ankommen, von irgendwoher aus der Stadt. Die Linien kreuzen sich im Untergrund. Eine Rolltreppe führt direkt zur Passage ins Untergeschoss, und man kann dann die Passage entlangflanieren und sich seinen Aufstiegspunkt aussuchen oder direkt die nächste Rolltreppe nach oben nehmen.
Man kann sich auch durch Seiteneingänge nähern, es gibt vier davon, und jeder führt durch eigenartig tote Winkel. Durch den Fettgeruch auf der Rückseite einer Fast-Food-Kette und an der Bahnhofsmission vorbei. An einem Imbiss, der zwischen dem Parkhaus und dort schlafenden Obdachlosen günstigen Kaffee und Bratwurst verkauft. An dem Reisebedarfsbuchladen mit seiner irrwitzigen Auswahl an Nischenzeitschriften neben dem seit Jahren nicht funktionierenden Briefmarkenautomaten. Am nur selten genutzten Aufgang zur DB-Lounge und den mit Verbotsschildern beklebten Eingängen zu Verwaltungsbüros vorbei, an den Theken zweier Autovermietungen entlang, eine knallig orange beleuchtet, die andere nicht weniger knallig grün. Hinter den Theken sitzen dort den ganzen Tag gelangweilte Menschen, vermieten keine Autos und scrollen sich durchs Internet.
Man kann, selbstverständlich, auch mit dem Zug ankommen, die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug beachten, aussteigen, den Koffer fest in der Hand, sich umdrehen, während von oben die zweisprachigen Ansagen automatisch und autoritätsgebietend auf einen prasseln. Dann die nächste Treppe suchen und heruntersteigen.
Anhalten
Die Bahnhofshalle ist 182 Meter lang, 24,45 Meter breit, 13,50 Meter hoch. Sie ist fast ein Kubus, das macht 60.000 Kubikmeter Rauminhalt. 250.000 Reisende und Besucher sollen hier täglich durchkommen. Man bräuchte – vorausgesetzt, jeder wäre mit einem halben Kubikmeter Platz zufrieden – etwas mehr als zwei solcher Hallen, um sie alle zu stapeln.
Das Herz der Halle ist ein Schalter, über dem die Worte „Info-Point“ prangen. Immer bilden sich Menschenschlangen davor, je nach Wetterlage länger oder kürzer, die Schlangen ziehen sich in improvisierten Mäandern durch die Halle. In der Halle rauscht es immer. Echos prallen von den Wänden und den Säulen ab: die Gespräche der Menschen, ihr Lachen, das Rattern ihrer Rollkoffer und das Klackern ihrer Schuhe, die automatischen Ansagen, alles kräuselt sich in einem ununterbrochenen Fade-out zur Decke empor.
In der Mitte der Halle, zwischen dem Info-Point und der ersten Treppe nach unten, sind die Echos besonders stark, vielleicht weil dort irgendein akustischer Brennpunkt entsteht, vielleicht weil Geräusche in der Halle einfach besonders gut weitergetragen werden.
Ich steige eine Treppe hinauf, an den Fahrkartenautomaten vorbei, die im Dreiklang des Tintenstrahldruckers den Reisenden ihre Fahrkarten ausspucken.
Die Treppe führt seitlich zwischen den Säulen hindurch auf einen kleinen Balkon, der ein wenig in die Halle hineinragt. Tische stehen dort, die Ausläufer einer Eisdiele, die nach einem italienischen Urlaubsort oder einer Sehenswürdigkeit in Rom benannt ist. Ich gehe zum letzten Tisch am Ende der Reihe, die Bahnhofshalle liegt unter mir. Ich lege Marc Augés 1992 erschienenes Buch Nicht-Orte auf den Tisch. Der Tisch glänzt silbrig und ist durch regelmäßiges Abwischen angekratzt.
„Zu den Nicht-Orten“, lese ich bei Augé, „gehören die für den beschleunigten Verkehr von Personen und Gütern erforderlichen Einrichtungen (Schnellstraßen, Autobahnkreuze, Flughäfen) ebenso wie die Verkehrsmittel selbst oder die großen Einkaufszentren oder die Durchgangslager, in denen man Flüchtlinge kaserniert.“ Die Aufzählung am Ende des Satzes kommt mir merkwürdig zynisch vor, und ich frage mich, warum Bahnhöfe nicht darin vorkommen.
Die Eisdiele serviert etwas, das „Toast Italien“ heißt: ein Toast, in Hälften geschnitten, Rucola, Parmaschinken, arrangiert auf einem lappigen Salatblatt und einem Streifen roter Paprika. Dazu habe ich einen Espresso bestellt. Beides steht auf dem Tisch, ich lege Nicht-Orte daneben, fotografiere das Arrangement, die Bahnhofshalle im Hintergrund. Ich versuche, das Foto über das auf eine Stunde beschränkte WLAN des Bahnhofs auf Facebook hochzuladen, die Fortschrittsleiste bewegt sich nicht, und ich schalte das WLAN wieder aus.
Die Menschen gleiten am Eingang der Bahnhofshalle unter der Abfahrtstafel hindurch und dann verschwinden sie für mich.
Ich kann mir kein einziges der Gesichter merken, keine Frisuren, keine Kleidung. Vielleicht laufen sie einfach aus meinem Blickfeld, um dann irgendwo kurz hinter der Abfahrtstafel eine Kurve zu ziehen. Vielleicht bewegen sie sich den ganzen Tag nur im Kreis, tun nie etwas anderes, als das Schauspiel „Bahnhof“ aufzuführen.
In Edgar Allan Poes Der Mann in der Menge