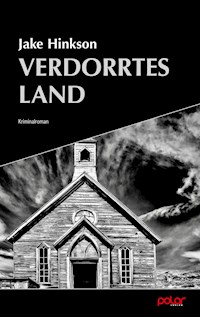11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bis jetzt war die 18-jährige Lily Stevens immer die perfekte Tochter eines Pfingstpredigers, aber ihre abgeschottete Gemeinde in Arkansas ist schockiert, als Lily verkündet, dass sie schwanger ist mit dem Baby von Peter Cutchin, einem jungen Mann aus der Kirche. Als Peter spurlos verschwindet, bevor sie heiraten können, gerät Lilys Leben in noch größere Turbulenzen. Jeder in ihrer Kleinstadt, einschließlich Peters wütender Mutter, denkt, der Junge sei einfach weggelaufen und habe sie im Stich gelassen, aber Lily, wütend eigensinnig und entschlossen, den Vater ihres Kindes zu finden, weigert sich, es zu glauben. Hilfe kommt in der unwahrscheinlichen Gestalt von Allan Woodson, einem Onkel, den ihre Familie nicht anerkennt, der aber vielleicht weiß, wo man mit der Suche nach Peter beginnen muss. Ihre Suche wird sie aus Lilys sicherer Welt der Kirche heraus und in die dunkelsten Winkel der kriminellen Unterwelt an der Grenze zwischen Arkansas und Tennessee führen, wo weder Allan noch Lily die beunruhigenden Geheimnisse vorhersehen können, die sie aufdecken werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DARK PLACES
Jake Hinkson
Die Tochterdes Predigers
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger
Herausgegeben von Jürgen Ruckh
Polar Verlag
Originaltitel: Find Him
Copyright: © Jake Hinkson, 2022
By arrangement with the author. All rights reserved
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2025
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger
Mit einem Nachwort von Peter Henning © 2025
© 2025 Polar Verlag e.K.
Unsere Produkte wurden im Rahmen der Verordnung zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation) einer Risikobewertung unterzogen und erfüllen gemäß Artikel 5 der GPSR die Anforderungen an sichere Produkte.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Hersteller: Polar Verlag e.K, Rippoldsauer Str. 2, DE-70372 Stuttgart, www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Lektorat: Eva Weigl
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Sono Creative / Adobe Stock
Autorenfoto: © Michelle Graves 2015
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, DK 8800 Viborg, [email protected]
Printed in Denmark 2025
ISBN: 978-3-910918-32-0
eISBN: 978-3-910918-39-9
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Danksagungen
»Mit dem Kopf durch die Wand«
Für meine Mutter
Susan Paschal Hinkson
Schon die Kinder erkennt man an ihren Taten
Sprüche 20, 11
Prolog
Als jemand an die Tür von Zimmer 15 klopft, wacht das Mädchen als Erste auf. Immer noch angeschlagen reibt sie in der Dunkelheit ihre verschlafenen Augen, und einen Moment lang kann sie sich nicht erinnern, wo sie ist. Ein Splitter rotes Neonlicht durchbohrt den Vorhang des Motelzimmers, das einzige Licht im Raum. Ein weiteres Anklopfen, lauter als zuvor, lässt sie zusammenzucken. Das Feuerzeug und die verschmurgelte Getränkeflasche rollen von der Tagesdecke und fallen auf den Boden. Ein beißender Gestank hängt in der Luft, wie von einer brennenden Plastiktüte, der anhaltende Geruch von Meth.
Sie flucht und greift nach dem Jungen neben ihr auf dem Bett.
Erneutes Klopfen.
Die Stimme eines Mannes. »Rezeption. Ich muss mit euch beiden reden.« Die Tür befindet sich so dicht neben dem Bett, man könnte meinen, der Mann stünde bereits im Raum.
Das Mädchen rüttelt den Jungen wach.
»Der Typ von der Rezeption steht vor der Tür«, flüstert sie.
»Was?«, fragt der Junge mit halb geschlossenen Augen.
»Der Typ von der …«
Sie wird vom Klopfen harter Knöchel auf die große Fensterscheibe des Zimmers unterbrochen. Der Hall erweckt den Eindruck, als schwanke die ganze Wand.
Das Mädchen steht taumelig auf, stolpert beinahe über den Koffer auf dem Boden und linst durch den gesprungenen Türspion. Der Mann davor steht etwas zur Seite gedreht, sein Gesicht ist im matten roten Schein nur undeutlich zu erkennen.
Als könne er sehen, dass sie ihn durch den Spion anstarrt, klopft er fester gegen die Scheibe.
»Re. Zep. Tion. Zwingt mich nicht, meinen Schlüssel zu benutzen.«
»Du antwortest besser, bevor er noch richtig angepisst ist«, sagt sie zu dem Jungen.
Der Junge steigt vom Bett, er trägt ein weißes T-Shirt und schwarze Boxershorts. Reibt sich übers Gesicht und knipst das Licht im Bad an, damit er sich besser orientieren kann. Dann kommt er herübergeschwankt und blickt durch den Türspion. Als er dieselbe Halbsilhouette sieht wie zuvor das Mädchen, öffnet er langsam die Tür, ohne die Kette abzunehmen.
Er will gerade etwas sagen, als ein Bolzenschneider sich um die gespannte kleine Kette legt und sie durchtrennt. Es klingt wie ein Fingerschnipsen.
Zwei Männer drängen in den Raum, lassen die Tür zum Parkplatz hinter sich offen. Der jüngere der zwei Männer schwingt mit beiden Händen den schweren Bolzenschneider und erwischt den Jungen im Gesicht. Das Knacken von Knochen unter dem Stahl ist so laut, dass man es hört. Der Junge fällt über einen Stuhl und stürzt auf den Boden. Als das Mädchen zu schreien beginnt, packt der ältere Mann sie an der Kehle und stößt sie aufs Bett, setzt sich auf ihre Brust, hebt eine Machete über seinen Kopf und erstickt ihren Schrei zu einem Husten.
»Sei still«, sagt er zu ihr.
Hinter ihnen schlägt der jüngere Mann mit dem Bolzenschneider auf den Jungen ein, bis der sich blutverschmiert in der Ecke zusammenkrümmt und die Hände schützend über den Kopf hebt.
Der ältere Mann zieht das Mädchen mit der Hand fest um ihren Hals von der Matratze und lässt sie zwischen Fenster und Bett zu Boden fallen. Die Tür des Zimmers steht immer noch einen Spaltbreit offen, taucht sie in das rote Neonlicht des »Zimmer frei«- Schildes des Motels.
»Bring ihn ins Bad«, sagt der ältere Mann über seine Schulter.
Der Jüngere wischt sich mit dem Unterarm den Schweiß aus dem Gesicht. »Ins Bad?«
»Ja«, sagt der ältere Mann. Als er die beklommene Reaktion des anderen registriert, dreht er sich um, deutet mit dem Kopf zum Bad, sagt: »Mach schon. Ist okay. Bring ihn da rein und sorg dafür, dass er still ist.«
Der jüngere Mann zieht den Jungen auf die Füße und schiebt ihn auf den orangen Schein aus dem Bad zu.
Der ältere Mann steht über dem Mädchen auf dem Boden.
Sie starrt zu ihm auf, hat Angst, versucht jedoch, ruhig zu bleiben. Atmet durch. »Tut mir leid, Eli.«
»Was genau?«, fragt Eli. Mit der breiten, schwarzen Klinge der Machete klopft er seitlich gegen ihren Kopf. »Hm? Was genau tut dir leid?«
Sie öffnet den Mund, um ihn anzuflehen, doch als sie im schwachen Neonschein zu seinem Gesicht aufschaut, verändert sich ihre Miene. Sie starrt jetzt nicht mehr mit bebenden Lippen. Sie funkelt ihn wütend an.
Sie schluckt und schleudert ihm einen trotzigen Schwall Worte entgegen. »Mir tut leid, dass ich dich je getroffen habe.«
Eli schließt die Augen. Seufzt. Nickt über die Bestätigung eines alten Gedankens, einer alten Vermutung.
Er geht neben ihr in die Hocke, hält die Machete quer über seinem Oberschenkel. Mit einem Blick in ihre verzweifelten Augen sagt er zu ihr: »Mädchen, mein wahres Ich hast du ja noch gar nicht kennengelernt.«
Sie versucht, etwas zu sagen, aber ihre Zähne klappern zu heftig aufeinander. Sie beißt sie fest zusammen.
Er reißt sie an ihrem dünnen, nackten Arm hoch. »Wenn du so unbedingt mit ihm zusammen sein willst«, brüllt er sie an, »dann geh jetzt rüber zu ihm.« Er stößt sie Richtung Bad.
Der jüngere Mann schiebt sie hinein, wischt sich dann wieder Schweiß aus dem Gesicht und fragt: »Was jetzt?«
Eli kehrt zur Zimmertür zurück. Er lässt den Blick über den Parkplatz des Motels wandern, der im Licht des Mondes und der Neonreklame vor ihm liegt, und nachdem er mit der Stille und Ruhe zufrieden ist, die er dort vorfindet, schließt und verriegelt er die Tür zu Zimmer 15.
»Fangen wir mit dem Jungen an«, sagt er.
Kapitel 1
Lily Stevens marschiert aus dem kalten Septemberregen in das Polizeirevier und geht zu dem Mann, der hinter dem Empfang sitzt. Er trägt eine schwarze Uniform, und das grelle Deckenlicht verleiht seinem militärisch kurzen Haarschnitt einen schimmernden Glanz, aber er ist noch jung, vielleicht gerade mal Anfang zwanzig.
Lily wischt ihr triefnasses Gesicht ab und sagt: »Ich möchte mit dem Sheriff sprechen.«
Auf dem Weg von der Bushaltestelle hierher wurde sie von einem unerwarteten Wolkenbruch überrascht, und nun beginnen sich ihre bis zu den Hüften reichenden Zöpfe zu lösen. Würde die Kirchenlehre ihr das Tragen von Make-up erlauben, wäre ihr Gesicht jetzt verschmiert und eher unansehnlich; so aber ist ihre Haut glatt und rosa. Unter ihrem Mantel spannt sich die Umstandsbluse über ihren rundlichen Bauch.
»Wir haben hier keinen Sheriff«, antwortet der junge Beamte. »Haben einen Chief.«
Sie verlagert ihr Gewicht von einem durchnässten Sneaker auf den anderen, der feuchte Saum ihres Jeansrocks klatscht gegen ihre Knöchel. »Okay, in Ordnung, darf ich dann bitte mit dem Chief sprechen?«
Lily beobachtet ihn, wie er sie mustert. Inzwischen ist sie das gewohnt. Wie schnell jemand ihr zu langes Haar und ihren zu langen Rock erfasst, das völlige Fehlen von Make-up oder Schmuck, ihre nicht durchstochenen Ohren. Und dann natürlich ihr dicker Bauch und ihr nackter Ringfinger.
Er sagt: »Darf ich fragen, worüber Sie mit dem Chief sprechen wollen?«
Ein grauhaariger Mann erscheint in der Tür am anderen Ende des Raums. Er trägt ein frisches, weißes Hemd zu einer dunklen Hose; an seinem Gürtel klemmt neben einem Pistolenholster eine Dienstmarke. Seine beiden Hände umschließen einen dampfenden Kaffeebecher.
»Mein Verlobter ist verschwunden.«
Der junge Beamte sagt: »Für einen verschwundenen Freund brauchen Sie den Chief nicht. Darüber können Sie auch mit mir reden.«
»Verlobter.«
»Was?«
»Sie sagten ›Freund‹. Er ist mein Verlobter.«
»Ah, verstanden.«
Der grauhaarige Mann in der Tür bläst Dampf von seinem Kaffee und trinkt einen Schluck.
Lily spricht ihn an. »Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie der Chief?«
Der junge Beamte beugt sich vor. »Hey, Mädchen, Sie können hier nicht einfach …«
»Schon okay, Jason«, sagt der grauhaarige Mann. »Miss, möchten Sie mich bitte nach hinten begleiten?«
Lily wirft dem jungen Polizisten einen kurzen Blick zu – 'ne tolle Hilfe warst du – und folgt dem Chief einen hellen Gang mit nackten, weißen Wänden und poliertem Betonboden hinunter.
Er führt sie zu einer geöffneten Bürotür. »Bitte, nehmen Sie doch Platz. Kann ich Ihnen ein Handtuch geben oder irgendwas anderes anbieten?«
»Nein, vielen Dank«, antwortet Lily und streift ihren Mantel ab. »So nass bin ich nicht. Der Regen hat mich draußen nur überrascht.« Sie nimmt auf einem der schwarz gepolsterten Gästestühle vor dem Schreibtisch Platz, auf dem sich lediglich ein Computer und ein Telefon befinden. »Also, weswegen ich hergekommen bin …«
»Warten Sie bitte einen Moment, bevor Sie loslegen«, sagt er, ohne sich selbst zu setzen. »Sie sind Lily Stevens, richtig?«
Lily starrt ihn an. Die Augen unter ihren feuchten Wimpern sind eisengrau. »Ja. Kennen Sie mich?«
»Es gehört zu meinem Job, zu wissen, wer die Leute in Conway sind, Lily. Ich kenne natürlich nicht jeden in der Stadt, aber die meisten schon. Ihr Daddy ist Prediger, stimmt's? David Stevens. Und ihr seid Pfingstkirchler, habt diese kleine Kirche draußen an der Azalea.«
»Jawohl, Sir. Das ist richtig.«
»Wie alt sind Sie? Siebzehn?«
»Gerade achtzehn geworden.«
»Verstehe. Wissen Ihre Momma und Ihr Daddy, dass Sie hier sind?«
»Nein.«
»Gibt es dafür einen Grund?«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, wenn ich mit jemandem Ihres Alters ohne Begleitung eines Elternteils oder Vormunds spreche, dann ist normalerweise zu Hause etwas vorgefallen. Gibt es etwas, das Sie mir gern sagen möchten?«
Lily richtet sich gerade auf. »Nein. So was ist es nicht. Es geht hier nicht um meine Eltern.«
»Also gut.« Er betrachtet seinen Kaffee. »Entschuldigen Sie mich einen Moment. Muss mal kurz nachschenken.«
Als er das Büro verlässt, atmet Lily tief aus und reibt ihren Bauch. Sie erlaubt es sich, nach vorn zu sinken, und lässt ihre Schultern in dem Versuch kreisen, die verspannten Muskeln in der Mitte ihres Rückens etwas zu lockern. Als jedoch der Chief wieder hereinkommt, setzt sie sich erneut so gerade hin wie in einer Kirchenbank.
Er nimmt hinter dem Schreibtisch Platz. »Also dann. Schießen Sie los.«
»Sie wissen, wer ich bin. Kennen Sie auch Peter Cutchin?«
»Klar, ich kenne Peter. Arbeitet im Corinthian. Seine Momma Cynthia arbeitet unten in dem Blumengeschäft.«
»Er ist verschwunden«, sagt Lily.
»Seit wann?«
»Seit über einer Woche.«
»Er ist seit über einer Woche verschwunden, und warum erfahre ich das erst jetzt?«
»Die Leute glauben nicht, dass er verschwunden ist.«
»Wo soll er denn nach Ansicht der Leute sein?«
»Jeder denkt, er sei einfach abgehauen.«
Der Chief kratzt sich am Ohr. »Ich verstehe.« Er zeigt auf ihren Bauch. »Peter ist der Daddy?«
»Natürlich.«
»Und korrigieren Sie mich, wenn ich danebenliege, aber solltet ihr nicht letzte Woche heiraten?«
»Ja, so war's geplant.«
»Und er ist nicht aufgetaucht …«
»Ich weiß, wie das aussieht«, sagt sie, »aber so ist es nicht.«
»Hm-hm. Was sagt Peters Momma?«
»Sie sagt, er ist abgehauen, weil er mich nicht mehr sehen will.«
Der Chief lächelt betreten. »Aber Sie wollen nicht glauben, dass es so ist.«
»Es ist nicht so! Aber das spielt für sie keine Rolle. Sie hat sowieso nie gewollt, dass wir beide heiraten.«
»Wie kommt's?«
»Sie gibt mir die Schuld, deshalb. Zuerst hat sie ein ziemliches Theater gemacht von wegen ›woher wissen wir denn, dass es Peters Baby ist?‹ Als wäre ich eine … als würde ich mich nur herumtreiben. Das führte dann zu einem mordsmäßigen Streit. Nachdem sich das endlich beruhigt hatte, hat sie ein großes Geschiss darum gemacht, wo Peter und ich nach unserer Hochzeit leben würden. Wir wollten bei meinen Eltern bleiben, damit meine Mutter mir helfen kann, wenn das Baby kommt, aber das kam für Cynthia überhaupt nicht infrage. Sie sagte, ich brauche ›eine härtere Hand‹, als meine Mutter mir geben könnte. Was natürlich zum nächsten mordsmäßigen Streit führte. Nicht nur in unseren Familien, sondern auch in unserer Kirche. Klatsch und Tratsch, Leute ergriffen Partei, alles in allem ein ziemlicher Schlamassel. Ohne diese ganzen Streitereien und verletzten Gefühle hätten wir schon vor zwei Monaten heiraten können.«
»Und jetzt?«
»Jetzt ist er weg, und sie gibt natürlich wieder mir die Schuld. Aber irgendwas stimmt da nicht. Peter würde sich niemals einfach so aus dem Staub machen, ohne irgendwem was zu sagen.«
»Vielleicht ja doch. Soll schon vorgekommen sein.« Der Chief beugt sich vor. »Verzeihen Sie meine Direktheit, Lily, so was ist schon ziemlich oft vorgekommen. Ein Junge schwängert ein Mädchen und verdrückt sich, bevor sie ihm einen Ring an den Finger stecken kann – diese Geschichte ist so alt wie die Zeit. Und Peter, Sie sehen mir meine Offenheit nach, nun, er ist kein schlechter Junge. Aber er war schon immer ein wenig ziellos.«
»Das stimmt für früher«, sagt Lily. »Aber wir werden heiraten und unser Kind in der Kirche großziehen. Das ist alles andere als ziellos.«
»Nur … dass er jetzt weg ist«, sagt der Chief.
Lily starrt auf ihre bloßen Hände herab.
»Du verstehst, was ich damit sagen will?«, sagt der Chief.
»Ja«, erwidert sie, hebt den Blick und sieht ihn direkt an, »aber er hat ja nicht mal seiner Mutter gesagt, wohin er geht. Seiner eigenen Momma nicht. Die zwei stehen sich sehr nahe. Er würde niemals gehen, ohne ihr zu sagen, wohin.«
»Auch das ist schon vorgekommen«, sagt der Chief. »Natürlich gibt es noch die andere Möglichkeit, dass sie es weiß und es Ihnen nur nicht sagen will. Und wieder, auch das wäre nicht das erste Mal.«
»Sie könnten sie doch fragen«, schlägt Lily vor. »Mit mir wird sie wohl kaum reden, aber wenn Sie sie fragen würden …«
Der Chief hätte beinahe etwas gesagt, bremst sich aber im letzten Moment. Er beugt sich vor und berührt sein Telefon. »Also, eigentlich … Sie arbeitet doch nur ein Stück die Straße rauf, oder?«
»Jawohl, Sir.«
Er nimmt das Telefon in die Hand und dreht sich zu dem Computer auf seinem Schreibtisch. Mit einer Hand gibt er eine kurze Google-Suche nach der Telefonnummer des Ye Olde Thyme Flower Shoppe ein. Als er sie hat, ruft er den Laden an.
»Sandy! Jeff Reid am Apparat. Wie geht's dir heute Morgen? Gut … freut mich zu hören. Sag mal, arbeitet Cynthia Cutchin heute Morgen? Gut. Könnte ich sie bitte mal kurz sprechen? Und, Sandy, kann sein, dass ich sie bitten werde, auf einen Sprung rüber ins Revier zu kommen. Wäre dir wirklich sehr verbunden, wenn du sie ein Sekündchen entbehren könntest.«
Warum sollte das nicht länger als ein Sekündchen dauern?, fragt sich Lily.
Der Chief sagt: »Hi, Cynthia. Jeff Reid hier. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Oh, mir geht's gut, vielen Dank. Hören Sie. Ich frage mich, ob Sie wohl kurz aufs Revier kommen könnten. Es ist keine große Sache, aber es gibt da etwas, worüber ich gern mit Ihnen sprechen würde … ja, Ma'am … nein, ich halte es für besser, wenn wir damit warten, bis Sie hier sind. Ich verspreche Ihnen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich muss Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Wird nur eine Minute dauern … also schön. Wir sehen uns dann gleich, danke.«
Er legt auf. »Na gut. Sie wird gleich hier sein.«
Ohne ihre Brust berühren zu müssen, spürt Lily ihren Herzschlag. Schwester Cynthia kommt.
»Wann haben Sie Peter zum letzten Mal gesehen?«, fragt der Chief.
»Letzten Freitag, nach der Schule.«
»Haben Sie sich gestritten?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Was soll denn ›eigentlich nicht‹ heißen?«
»Wir haben uns nicht gestritten, aber er war sehr ruhig. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, dass er mir erzählt, was ihn beschäftigt, aber er wollte nicht reden. Und als ich ihm sagte, er solle mit reinkommen und mit meiner Familie plaudern, wollte er nicht.«
»War das ungewöhnlich?«
Sie rutscht auf ihrem Stuhl herum. »Nun, in letzter Zeit war alles ziemlich angespannt. Sie wissen schon, wegen der Probleme mit seiner Mutter und allem. Aber als er mich absetzte, wollte er nicht mal auf einen Sprung mit rein und meiner Mom Hallo sagen. Ich hab gesagt, das würde blöd aussehen.«
»Was hat er darauf geantwortet?«
»Nichts. Hat einfach gar nichts mehr gesagt.«
»Was hat er gemacht, nachdem er Sie abgesetzt hat?«
»Er ist weiter zur Arbeit. Ich habe am nächsten Morgen bei ihm zu Hause angerufen.«
»Nicht sein Handy?«
»Er besitzt kein Handy. Schwester Cynthia hält nichts davon.«
»Wirklich?«
»Ja.«
»Steht in der Bibel irgendwas gegen Handys?«
»Nein. Die meisten Erwachsenen in unserer Kirche haben eines. Aber Schwester Cynthia hat ihre eigene Auslegung der Heiligen Schrift. Für sie sind Handys quasi das Tor zur Sünde.«
»Schwer, was dagegen zu sagen«, sagt der Chief.
»Sie ist … streng. Strenger noch als die meisten Pfingstkirchler. Sie ist sehr eigen.«
»Aber Peter ist neunzehn, richtig? Macht er immer das, was sie ihm sagt?«
»Na ja, nein, nicht immer. Wie Sie schon sagten, er hat sich ein bisschen herumgetrieben, als er von der Highschool kam, aber er wohnt noch bei ihr, und es ist ihr Haus und es sind ihre Regeln. Das ist ein weiterer Grund, warum ich fand, dass wir bei meinen Eltern wohnen sollten.«
»Besitzen Sie ein Handy?«
»Nein, bei uns haben nur meine Eltern Handys.«
»Aber Sie und Peter, ihr habt beide einen Festnetzanschluss?«
»Ja.«
»Okay. Dann haben Sie also am Samstagmorgen bei ihm angerufen …«
»Und es ist niemand rangegangen. Was schon komisch war. Ich wusste, dass Schwester Cynthia nicht in der Stadt war. Sie war mit anderen Frauen aus unserer Gemeinde letzte Woche auf einer großen Ladies-Revival-Versammlung in St. Paul. Aber es war schon komisch, dass Peter nicht ranging, denn ich hab ziemlich früh angerufen. Ich hab's den ganzen Tag weiter versucht, und dann kam Schwester Cynthia schließlich abends nach Hause und ist ans Telefon gegangen. Sie sagte, in seinem Bett hätte er nicht geschlafen, und sein Auto und sein Koffer seien weg.«
»Hat er ihr eine Nachricht oder irgendwas hinterlassen?«
»Sie würde mir nie irgendwas sagen. Abgesehen von der Tatsache, dass er weg ist und alles nur meine Schuld wär.«
Der Chief kratzt sich wieder am Ohr. »Verstehe«, sagt er. »Tja, dann wollen wir doch mal hören, was sie zu sagen hat, wenn sie hier ist, okay?«
Er nimmt seinen Kaffee, bemerkt, dass der inzwischen kalt geworden ist, und stellt die Tasse zurück auf den Schreibtisch. Dann dreht er sich wieder zu seinem Computer und beginnt, Spam-Nachrichten aus seinem E-Mail-Postfach zu löschen. Ohne sie anzusehen, fragt er: »Wie geht's Ihren Eltern?«
»Denen geht's gut«, lügt sie.
»Hm-hm. In der Kirche wieder alles besser?«
»Ja«, lügt sie.
»Ich weiß nicht viel über die Pfingstkirchler«, sagt er und klickt mit der Maus herum. »Die Frauen in Ihrer Kirche dürfen weder Hosen noch Make-up tragen, richtig? Und ihr schneidet euch nicht die Haare?«
»Genau.«
Er nickt, als hätte sie etwas Interessantes gesagt. »Ich hab hier einen Officer, der ist Mitglied der Assembly of God. Das ist doch auch eine Glaubensgemeinschaft der Pfingstbewegung, glaube ich. Aber seine Frau trägt Hosen …«
»Die sind anders als wir. Die sind Mainstream, irgendwie voll etabliert. Wir sind Oneness Pentecostals. Apostolisch.«
»Und das bedeutet was genau?«
Sie sieht zur Tür. Sie verabscheut die Vorstellung, dass Schwester Cynthia hereinkommt, während sie unbeholfen versucht, einem Außenstehenden ihre Kirche zu erklären. »Wir … wir versuchen einfach genau das zu tun, was die ursprünglichen Apostel in der Bibel getan haben.«
Er dreht sich zu ihr, sieht sie an.
Sie erkennt, dass er damit nichts anfangen kann. »Wir sind einfach strenggläubig«, sagt sie, nur um etwas zu sagen.
Tatsächlich sind Kleidung und Frisuren nur Äußerlichkeiten. Die Dinge, durch die sich die Oneness Kirche von anderen christlichen Vereinigungen unterscheiden, gehen tiefer, sind theologisch komplexer. Diese Unterschiede sind weder für ihre Kirche noch für Lily Nebensächlichkeiten. Und wenn ihr danach wäre, ihm die theologischen Implikationen der einheitskirchlichen Doktrin zu erläutern, könnte sie dies durchaus. Aber dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Im Moment gibt es Wichtigeres, worum sie sich kümmern muss.
»Werden Sie Peter suchen?«, fragt sie.
»Warten wir doch erst mal ab, was seine Momma zu sagen hat.« Der Chief klickt weiter mit seiner Maus herum und starrt auf den Bildschirm. In der gleichen beiläufigen Art wie zuvor sagt er: »Habe Ihren Daddy nie beim Predigen erlebt, aber nach allem, was ich so höre, geht es ziemlich wild zu in euren Gottesdiensten. Viel Herumgehüpfe, Gerede in fremden Zungen und das alles.«
Sie weiß nicht, was sie darauf antworten soll – und weiß im Grunde eigentlich nie, wie sie reagieren soll, wenn Außenstehende so tun, als wäre ein echter Gottesdienst eine Zirkusnummer.
Sie sucht immer noch nach einer Antwort, als der junge Beamte hereinkommt und Schwester Cynthia mitbringt.
Unter besten Umständen war Schwester Cynthia eine blasse Frau, in dieser grellen Beleuchtung war sie jedoch so weiß wie eine Wand. Ihr Haar, braun in jungen Jahren, war schon lange in Farblosigkeit übergegangen und balancierte nun hoch auf ihrem Kopf, an Ort und Stelle gehalten mit Haarnadeln und Haarspray. Ihr teigig weißes Gesicht verfärbt sich rot, als sie Lily sieht.
Der Chief wendet sich ihr zu. »Alles in Ordnung, Cynthia. Nehmen Sie doch bitte Platz.«
Direkt neben Lily steht ein Stuhl. Cynthia setzt sich und legt ihre Handtasche auf dem Schoß ab. Selbst im Sitzen verdeckt ihr langer Jeansrock fast noch ihre Füße.
Sie sammelt offensichtlich ihre Kräfte und fragt: »Ist irgendetwas passiert?«
Mit väterlicher Miene versichert ihr der Chief: »Nein, nein. Lily hier versucht nur, ihren Peter zu finden, und wir haben uns gefragt, ob Sie vielleicht wissen, wo er ist.«
Schwester Cynthia sackt nach vorn und sie umklammert ihre Handtasche, als wäre sie ein Rettungsring. »Oh Gott! Sie haben mir Angst gemacht. Ich dachte schon, Sie würden mir mitteilen, ihm wäre etwas zugestoßen.« Sie reibt ihr Gesicht und wischt eine Träne aus dem Augenwinkel. »Das hätten Sie nicht mit mir machen dürfen, Jeff. Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen können.«
Der Chief entschuldigt sich nicht für seine Gedankenlosigkeit, aber er nickt, um ihr zu zeigen, dass er ihre Beunruhigung versteht. »Ich bin sicher, es gibt kein Grund zur Besorgnis, Cynthia. Wir sind heute Morgen nur hier, weil Lily ein wenig beunruhigt ist. Sie hat seit mehreren Tagen nicht mehr mit Peter gesprochen.«
Schwester Cynthia richtet sich wieder auf und löst den verkrampften Griff um die Handtasche. Sie atmet tief durch. Dann sagt sie: »Nun, er ist irgendwo unten in Little Rock, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht genau weiß, wo er ist. Er … besucht dort unten ein paar Leute.« Sie reibt wieder über ihr Gesicht. »Eine Mutter sollte die Freunde ihres Sohnes kennen, aber ich habe nie einen dieser Freunde aus Little Rock gesehen.«
»Also, Peter ist ja auch kein kleiner Junge mehr.«
»Nein …«
»Er wird Leute kennen, die Sie nicht kennen.«
»Gehe ich von aus.«
»Aber Sie haben schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört? Ist das normal?«
»Früher nicht, nein.« Schwester Cynthia blickt auf ihre Hände und presst ihre kurzen, dicken Daumennägel zusammen. »Aber ich denke, man könnte sagen, die Bedeutung von ›normal‹ hat sich im Verlauf der letzten paar Monate geändert.« Sie nimmt ein kleines Päckchen Kleenex aus ihrer Handtasche und zieht ein einzelnes Tuch heraus. »Er ist davongelaufen, als ich wegen einer Konferenz nicht in der Stadt war. Hat seine Tasche gepackt und ist ohne auch nur ein Wort weggefahren.«
»Wenn er ohne ein Wort gefahren ist, woher wissen Sie dann, dass er in Little Rock ist?«, fragt der Chief.
»Nun, weil er sonst nirgends sein könnte. Die einzigen Leute, die er kennt und die nicht hier leben, sind die … Leute, die er dort unten kennt. Und er verbringt immer mehr Zeit dort unten.« Sie faltet das Papiertaschentuch in der Mitte zusammen. »Er wollte einfach weg von allem hier. Ich schäme mich, das zu sagen, aber irgendwie habe ich mit so was längst gerechnet.«
»Nun, so was ist in Situationen wie dieser durchaus schon passiert«, versichert ihr der Chief.
Schwester Cynthia hebt bestätigend die Augenbrauen, verzichtet aber demonstrativ darauf, sich zu weiteren Bemerkungen über Situationen wie dieser herabzulassen.
»Peter hat sein Zeug mitgenommen?«, fragt der Chief.
»Nur seinen Wagen, unseren kleinen Rollkoffer, ein paar Kleidungsstücke.«
»Okay.« Der Chief steht auf. »Cynthia, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Bescheid geben, sollte er sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besser noch, bitten Sie ihn, mich anzurufen. Ich würde gern ein paar Worte mit ihm reden. Sie können ihm sagen, es wäre nichts Offizielles, nur ein Gespräch von Mann zu Mann. Es wird keine angenehme Unterhaltung werden, aber er soll mich auf jeden Fall anrufen.«
»Danke, Jeff. Der Junge kann eine solche Ansprache von einem Mann vertragen, und soweit es mich betrifft, je strenger, desto besser.«
»Also dann.«
»Ich muss zurück zur Arbeit. Wir machen gleich auf.«
»Natürlich«, sagt der Chief. »Danke, dass Sie gekommen sind, um uns zu helfen, diese Sache zu klären.«
»Das war's?«, fragt Lily ihn.
»Ich denke«, antwortet der Chief, wobei sich eine leichte Gereiztheit in seine Stimme schleicht, »wir haben jetzt für einen Morgen genug Zeit auf diese Angelegenheit verschwendet. Ein neunzehnjähriger Junge, der ein Mädchen geschwängert hat, dann seinen Koffer packt und wegfährt, gilt nicht als vermisst oder verschwunden. Er läuft einfach weg.«
Lily senkt den Kopf, kann weder mit dem Polizeibeamten noch mit Peters Mutter Augenkontakt herstellen. »Ich will doch nur wissen, dass es ihm gut geht.«
Schwester Cynthia putzt sich die Nase und knüllt das Papiertuch zusammen. »Ich auch.« Sie holt tief Luft und fährt fort: »Lily, sieh mich bitte an, Liebes. Niemand liebt diesen Jungen mehr als ich. Niemand könnte es je. Und das hier ist für niemanden schwerer als für mich. So habe ich ihn nicht großgezogen. Das weißt du. Wenn sein Vater noch lebte, würde sich Peter nicht so verhalten. Ich mache mir selbst Vorwürfe, wie er sich entwickelt hat. Es fällt immer auf die Mutter zurück. Besonders wenn sie Witwe ist. Aber ich habe mein Bestes getan.« Sie wirft das Papiertaschentuch in den kleinen Plastikabfalleimer neben dem Schreibtisch des Chiefs. »Aber jetzt muss Peter die Dinge allein in Ordnung bringen, und er muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Weder ich noch du können ihm das abnehmen. Wir können nur dafür beten. Ich kann dir versprechen, dass ich dafür sorgen werde, dass er dich anruft, sobald er sich bei mir meldet.«
Als sie aufsteht, ist Schwester Cynthias Gesicht so regungslos ruhig, dass der Chief die stille Wut in ihren Augen nicht bemerkt. Aber Lily sieht es, bekommt einen flüchtigen Blick auf den ihr bevorstehenden Zorn, und sie weiß, dass es Konsequenzen haben wird, ein Mitglied der Kirche heute hierhergeholt zu haben.
Während der Chief Schwester Cynthia hinausbegleitet, rührt Lily sich nicht. Sie kann nicht glauben, dass dies alles wirklich passiert. Sie werden ihn nicht suchen. Sie denken, es ist allein ihre Schuld, dass er gegangen ist, und das war's dann.
Ihr Blick verschleiert sich, sie kann nicht mehr geradeaus denken vor Beschämung, Verlegenheit und Wut. Es fällt ihr schwer, überhaupt zu denken.
Bis auf eine Sache, ein Gedanke, den sie glasklar vor Augen hat.
Peter ist nicht einfach weggelaufen.
Kapitel 2
Die mit Regentropfen überzogenen Türen des Reviers entlassen sie wieder in einen Tag, der grauer und kälter geworden ist als zuvor. Über ihr schlägt eine feuchte Flagge von Arkansas träge gegen den Fahnenmast. Als sie die Eingangsstufen in den Nieselregen hinaustritt, sieht sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihren Vater aus dem Auto der Familie steigen und zuckt zusammen.
David Stevens trägt ein weißes Hemd und eine dunkelgraue Hose zu seinen guten schwarzen Schuhen. Seit sie ihre Schwangerschaft offenbart hat, hat er mehr oder weniger aufgehört zu essen und zehn Pfund von seiner ohnehin schmalen Statur verloren. Er trägt keinen Mantel, und er wirkt schwach und angegriffen im beißenden Wind.
Während die Regentropfen auf den Pfützen auf dem Beton um sie herumtanzen, kommt er herüber und gibt ihr die Schlüssel.
»Geh und warte auf mich«, sagt David.
»Jawohl, Sir.«
Er steigt die Stufen ins Revier hinauf, und sie geht zum Auto und setzt sich auf den Beifahrersitz. Obwohl sie weiß, dass er wütend ist, bringt sie es nicht über sich zu bereuen, hergekommen zu sein. Sie sieht zum Revier hinüber. Der Chief muss ihn angerufen haben. Natürlich. Als er sich kurz entschuldigte und für eine Minute den Raum verließ, muss er ihren Vater angerufen haben.
Sie zieht ihre Haare nach vorn. Sie sind zu nass und durcheinander, um ihre Finger durchgleiten zu lassen, also umklammert sie sie in ihren kalten Fäusten wie ein Seil.
Als David Stevens schließlich aus dem Revier zurückkehrt, holt sie tief Luft. Er öffnet die Tür und steigt ein, lässt den Motor aber nicht an.
Mit geschlossenen Augen fragt er: »Was in aller Welt hast du dir dabei gedacht?«
»Sie müssen Peter suchen.«
Er dreht sich zu ihr. »Kannst du das bestimmen?«
Sie senkt den Kopf. David war nie ein strenger Vater. Wenn er nicht gerade erfüllt vom Heiligen Geist predigt, ist er entspannt und zurückhaltend. Er besitzt die ruhige, nachdenkliche Ausstrahlung eines belesenen Mannes, eine ungewöhnliche Eigenschaft für einen Prediger, besonders für einen der Pfingstkirche. Sie weiß, dass er lieber in seinem Büro säße und an der Zeitschiene der Missionsreise von Paulus nach Rom im Jahr 61 arbeiten würde, als hier mit ihr zu streiten. Doch genau deshalb, weil er immer schonungsvoll ihr gegenüber gewesen ist, empfindet sie seinen ruhigen Tadel unangenehmer als eine Tracht Prügel. Sie fühlt sich, als hätte sie sein Vertrauen missbraucht.
Leise sagt er: »Lily, eines Tages musst du begreifen, dass die Wurzel aller Dickköpfigkeit der Hochmut ist. Das ist der Grund, warum du es nicht auf sich beruhen lässt. Hochmut. Du willst dich einfach nicht irren. Obwohl es jedem vollkommen klar ist, dass du dich irrst.«
Sie starrt auf ihre geballten Fäuste.
»Deine arme Momma …«, sagt er. »Weißt du eigentlich, wie sehr sie das mitnehmen wird?«
»Daddy …«
»Hör einfach auf. Bitte. Sag nichts. In letzter Zeit weiß ich gar nicht mehr, was als Nächstes aus deinem Mund kommen wird.«
Lily sackt in sich zusammen.
Sie halten vor einer Ampel. Auf der anderen Straßenseite steigen kleine Kinder vor der Feuerwehr aus einem Schulbus. Lily erinnert sich, wie sie in der Grundschule mit ihrer Klasse auf der Feuerwache waren. Das scheint schon vor einer Ewigkeit gewesen zu sein, aber sie begreift, dass es nur sieben oder acht Jahre her ist.
Ihr Vater scheint den Bus nicht zu bemerken, denn auch er ist mit seinen Gedanken in der Vergangenheit. »Du warst so schlau. Gute Noten. Ein wirklich kluger Kopf. Und jetzt …« Er hebt eine offene Handfläche, als wären all ihre Verheißungen gerade aus seiner Hand entschwunden.
Sie kommen am Campus der UCA vorbei, und sie beobachtet, wie zwei Mädchen mit Schirmen und Rucksäcken über den glitzernden grünen Rasen gehen.
David sagt zu ihr: »Schlimmer als in die Schwierigkeiten mit diesem Jungen zu geraten ist nur noch das, was du jetzt machst. Er ist weggelaufen, und du bist hier und sorgst dafür, dass nur ja jeder in der Stadt weiter darüber redet. Ist es das, was du wirklich willst?«
»Nein, Sir.«
»Chief Reid hat mich angerufen, damit ich dich abhole.«
»Dachte ich mir schon.«
»Das hat er nur aus reiner Höflichkeit mir gegenüber getan. Ist dir das bewusst?«
»Jawohl, Sir.«
»Was ist auf dem Polizeirevier passiert?«
»Sie haben Schwester Cynthia nach Peter gefragt.«
»Du hast sie dorthin zitieren lassen …«
»Sie ist gekommen, um zu reden. Nur ein paar Minuten.«
»Du weißt schon, dass das Konsequenzen haben wird, oder? In der Kirche? Wenn sie erst einmal jedem erzählt hat, dass sie deinetwegen aufs Polizeirevier kommen musste, was meinst du, wird dann passieren?«
Lily bewegt sich nicht, sagt nichts.
»Das hier«, sagt er, »das, was du heute hier getan hast, was meinst du, sagt das über mich?«
»Es sagt gar nichts über dich.«
»Alles, was du tust, sagt etwas über mich, Lily. Ich glaube es einfach nicht, dass ein so aufgewecktes Mädchen wie du das vergessen haben kann.«
Sie senkt wieder den Kopf.
»All die Teenagermädchen, die heutzutage schwanger herumlaufen«, sagt er, »und keinen Menschen interessiert es. Niemand zuckt auch nur mit der Wimper. Aber dich werden sie ansehen. Und weißt du auch, warum?«
»Weil ich deine Tochter bin.«
»Weil du meine Tochter bist, ganz richtig. Vielleicht ist das nicht fair, Lily, aber so ist es nun mal. Die Tochter des Predigers kann immer noch ein Skandal sein, selbst in der heutigen Zeit. Verstehst du das?«
»Jawohl, Sir.«
»Was hat Schwester Cynthia gesagt, nachdem man sie dorthin zitiert hat?«
»Dass Peter nach Little Rock gefahren ist.«
»Weiß das nicht jeder?«
»Ich jedenfalls nicht«, sagt sie.
David stöhnt. Nach einer Weile fährt er rechts ran, zieht den Schalthebel in Parkstellung und bedeckt seine Augen mit der Hand.
Er weint nicht, aber Lily spürt die Beschämung auf ihrer Haut wie eine Brandwunde. Ihr ganzer Körper schmerzt. Sie wendet sich von ihm ab und schaut aus dem Fenster.
. . .
Als sie nach Hause kommen, werden sie von ihrer Mutter an der Tür erwartet.
Ihr Vater sagt: »Sie ist zum Polizeirevier gegangen, um sie zu bitten, Peter zu finden.«
Das Gesicht ihrer Mutter wird aschfahl. »Nein, das hat sie nicht.«
»Doch, hat sie.«
Ihre Mutter sieht aus, als wäre sie geohrfeigt worden. »Die ganze Stadt, Lily … diese ganze Stadt wird reden.«
Lily kann bereits spüren, wie ihre Mutter die Beherrschung zu verlieren beginnt. Peggy Stevens kann die Beherrschung verlieren, besonders dann, wenn das Problem damit zu tun hat, andere Leute zu enttäuschen oder zu erzürnen. Diese Angst geht auf Peggys eigene Kindheit zurück, als ihr Vater, selbst ein Pfingstprediger, aus seinem Kirchenamt gedrängt wurde. Man hatte Lily nie erklärt, warum genau ihr Großvater seine Kirche verloren hatte. Wie so viele Vorgänge in der Welt war es als Geheimnis behandelt worden, das zu gegebener Zeit gelüftet werden soll. Was immer jedoch damals passiert war, Folge davon ist, dass die Erwartungen anderer Menschen für Peggy Stevens wie eine beständig brennende kleine Flamme sind, als könnte ihre Missbilligung jederzeit auflodern und ihr Haus niederbrennen.
Lily geht an ihr vorbei zur Couch und setzt sich. Während ihr einfühlsamerer Vater mit ihrer ängstlichen Mutter spricht, legt sie die Hände auf ihren Bauch und wartet darauf, gescholten zu werden.
Peggy fragt ihren Mann: »Was hat die Polizei gesagt?«
»Jeff Reid war ganz freundlich«, sagt David. »Sagte, er hätte mir die Verlegenheit gern erspart. Aber er sei nicht derjenige, um den man sich Sorgen machen muss. Sie wollte, dass sie Schwester Cynthia aufs Revier holen.«
Peggy hebt die Hand an den Mund und dreht sich zu ihrer Tochter um. »Ach, Lily …«
Lily nickt ihrer Mutter zu, fast als hätte sie Mitleid. Peggy weint nicht, starrt sie nur an, als würde sie versuchen, mit einer Tragödie klarzukommen. »Er taugt einfach nichts, Lily«, sagt sie. »Siehst du das denn nicht? Er taugt einfach nichts.«
»Ob er was taugt oder nicht, hat überhaupt nichts damit zu tun«, sagt sie.
»Was soll das denn heißen?«, fragt David.
»Er ist der Vater meines Kindes. Wieso bin ich die Einzige, die das interessiert? Ihr, Cynthia, die Polizei. Niemand interessiert sich dafür, dass der Vater meines Babys einfach so von jetzt auf gleich verschwunden ist. Ihm ist etwas zugestoßen.«
»Was soll ihm denn deiner Meinung nach zugestoßen sein? Zwei Tage, bevor er dich heiraten sollte, hat er seinen Koffer gepackt und die Stadt verlassen. Kommst du nicht von allein dahinter, was das bedeutet?«
»Ich weiß, was es nach Meinung aller anderen bedeutet. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wie es aussieht. Und es ist nicht so, dass ich so total blind vor Liebe wäre zu denken, er könnte mich niemals verlassen. Ich war nur lange genug verknallt, um schwanger zu werden. Von dieser Krankheit bin ich kuriert. Aber ich weiß auch etwas, das sonst niemand zu begreifen scheint. Peter würde sein Baby nicht verlassen. Nach allem, was mit seinem eigenen Daddy passiert ist, würde er seinen Sohn niemals im Stich lassen. Das würde er nicht tun. Etwas stimmt da nicht.«
Außer sich dreht Peggy sich zu David um und hebt die Hände. Würdest du sie bitte zur Vernunft bringen?
»Was, wenn du dich irrst?«, fragt er seine Tochter. »Denk bitte nur mal für einen Moment an diese Möglichkeit. Was ist, wenn die einfachste Antwort die richtige Antwort ist? Was, wenn der Junge einfach nur kalte Füße bekommen hat und weggelaufen ist, so undenkbar es auch immer sein mag, was dann?«
Lily massiert ihren Bauch. »Dann müssen wir ihn finden, bevor das Baby kommt«, sagt sie. »Er hat mir etwas versprochen, und er hat seinem Sohn etwas versprochen. Vielleicht interessiert das sonst keinen Menschen, mich aber schon. Ich beabsichtige, dafür zu sorgen, dass er zu seinem Wort steht. Ich werde nicht einfach nur so hier herumsitzen und darauf warten, dass ich eine weitere unverheiratete, minderjährige Mutter werde.«
. . .
Später kümmert sich ihre Mutter um das Abendessen, während ihr Vater nach nebenan in die Kirche geht, wo er sich mit Bruder Josiah Williams trifft. Josiah überlegt, in das Apostolic Bible Institute nach St. Paul zu gehen, und er sucht deswegen den Rat des Predigers. Er muss Peggy versprechen, zum Abendessen zurück zu sein, aber Lily weiß, dass er wahrscheinlich bis zur Schlafenszeit in der Kirche bleiben wird.
Sie geht auf ihr Zimmer und schließt die Tür. Ihr Schlafzimmer sieht genauso aus wie schon seit langer Zeit, dennoch erscheint ihr in diesem Moment alles ein wenig seltsam, so als würde sie es einem Fremden zeigen. Ein Bett mit einer mintgrünen Tagesdecke. Ein Schreibtisch mit ihren Schulbüchern. Ein Toilettentisch mit ihren Kämmen, Spangen und Haarklammern. Sie weiß, dass viele Mädchen Schmuck und Make-up auf ihren Toilettentischen haben, und während sie ebenfalls weiß, dass sich viele ihrer Freundinnen aus der Kirche insgeheim wünschen, sie könnten Make-up und Ohrringe und solche prahlerischen Dinge tragen, hat sie sich immer gesagt, dass sie froh sein kann, sich nicht damit abgeben zu müssen. In dieser Hinsicht war sie der perfekte gottesfürchtige pfingstkirchliche Teenager. Sie hat sich nie dafür interessiert, was irgendwer von ihr dachte. Sie hat ihr langes Haar immer voller Stolz getragen, wie eine christliche Rüstung, wie um der Welt zu sagen: Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst davor, anders zu sein.
Sie nimmt ihr Haar nach vorn und bürstet es aus.
Ich mag dein Haar sehr, hatte er zu ihr gesagt. Es war überhaupt das Erste gewesen, was er ihr jemals gesagt hatte, das durchblicken ließ, dass er sie mochte. Sie kannten sich schon seit Jahren, aber eines Abends nach der Kirche hatte er sie zu lange angestarrt und gesagt: Ich mag dein Haar sehr.
Sie wirft die Bürste zurück auf den Tisch. Sie ist wütend. Wütend auf sich, weil sie sich von diesem bescheuerten Jungen den Kopf hat verdrehen lassen. Wütend auf ihn, weil er zu schwach ist, seiner Mutter die Stirn zu bieten. Ohne Schwester Cynthias Uneinsichtigkeit hätten sie schon vor zwei Monaten heiraten können. Und jetzt ist auch noch der Polizeichef genauso stur und uneinsichtig wie alle anderen hier …
Sie weiß, dass sie eigentlich beten sollte, aber sie ist derzeit sogar ein bisschen sauer auf den Herrn, weil er so still bleibt. Sie will beten, mit dem Herrn sprechen und ihn um Hilfe bitten, Peter zu finden, aber sie kann es nicht. Es ist wie mit Daddy. Sie kann mit ihrem Vater nicht mehr richtig reden, und beten kann sie auch nicht.
Aber sie weiß, dass sie eigentlich sollte. Sie weiß, dass Jesus darauf wartet, von ihr zu hören. Sie kniet sich hin, legt die Ellbogen aufs Bett und verschränkt ganz fest die Hände.
Sie beginnt, »Bitte, Herr Jesu Christ«, doch dann klopft jemand an die Tür.
Sie schaut auf. »Wer ist da?«
»Ich«, antwortet ihr Bruder.
»Geh weg.«
»Lass mich rein. Ich muss mit dir reden.«
Sie erhebt sich, eine Hand auf ihrem Bauch, und öffnet die Tür.
Adam blickt über ihre Schulter, als wolle er sehen, ob noch jemand in ihrem Zimmer ist.
»Mit wem redest du?«
»Ich habe gebetet, Hohlkopf. Was willst du?«
»Warum motzt du mich so an?«, sagt er. »Ich hab nix gemacht.«
»Nichts. ›Ich habe nichts gemacht‹.«
»Egal. Kann ich reinkommen?«
»Warum?«
»Weil ich mit dir reden möchte.«
»Seit wann das denn?«
Ihr kleiner Bruder hatte schon seit Jahren nicht mehr um Erlaubnis gefragt, zum Reden in ihr Zimmer kommen zu dürfen. Er ist selbst für einen Fünfzehnjährigen klein und dünn, und sein schmales Gesicht wirkt auf eine finstere Art grüblerisch. Er hat ständig schlechte Laune, seit er in die Pubertät gekommen ist. Vorher waren sie Freunde gewesen, und er hatte immer zu ihr aufgesehen. Sie war diejenige in ihrer Familie gewesen, die ihm beigebracht hatte, seine Schuhe zu binden und zu pfeifen. Sie hatten immer zusammen gespielt, hatten sich in ihren Zimmern gebalgt. Als ihr Körper jedoch begann, sich zu entwickeln, schreckte er angeekelt zurück. Wenn er mal einen kurzen Blick auf ihren BH-Träger erhaschte, fühlte er sich gleich unbehaglich. Und als sich dann seine eigene Stimme veränderte, als sich sein eigener Körper zu entwickeln begann, schien er noch am gleichen Tag zu beschließen, dass man sich mit ihr nicht mehr ernsthaft unterhalten konnte. Rückblickend denkt sie, dass sie ihn deswegen seinerzeit vielleicht zu viel aufgezogen hat.
»Lass mich nur eine Sekunde rein«, sagt er. »Ich muss mit dir reden.«
Sie tritt zur Seite, und er betritt das Zimmer. Er trägt ein weißes Anzughemd und seine Hände stecken in den Taschen einer Kakihose. Jungs der Oneness-Pfingstler haben sowieso kein besonderes Händchen in Kleidungsfragen, aber Adam wird noch mehr als die meisten deswegen aufgezogen. Er fällt einfach überall auf, wirkt überall unbeholfen.
Er sieht sich kurz im Raum um, als käme er vom Gesundheitsamt. »Was machst du gerade?«
»Hab ich doch schon gesagt. Ich habe gebetet. Ich habe eine Unterhaltung mit Jesus unterbrochen, um mit dir zu reden. Bislang scheint das ein großer Fehler gewesen zu sein.«
Er nickt. »Du hast schon größere Fehler gemacht.«
»Warum verschwindest du nicht aus meinem Zimmer, bevor ich deinem großen Fehler von Gesicht eins verpasse?«
Er nickt wieder. »Okay, aber ich hab was gehört, von dem ich fand, dass ich es dir erzählen sollte.«
»Was?«
»Etwas über Peter.«
»Was? Was über Peter?«
»Ach, jetzt bist du interessiert.«
»Hör auf damit, Adam. Komm mir nicht blöd.«
»Ich erzähl keinen Scheiß.«
»Dann sag mir, wovon du redest.«
»Kennst du Chance Berryman?«
»Chance Berryman – nein, nicht richtig, warum?«
»Aber ein bisschen kennst du ihn schon?«
»Ich meine, ich war in der Neunten, als er schon in der Zwölften war. Wir kennen uns vom Sehen, aber wir haben nie mehr als höchstens mal ein, zwei Worte miteinander gewechselt. Er war immer ein Raufbold, also hab ich einen Bogen um ihn gemacht. Besonders, nachdem er Greg Hughes fast umgebracht hätte.«
Das war vor einigen Jahren gewesen. Eines Tages nach der Schule war Lily dem Rudel Schüler gefolgt, die zum Rand des Parkplatzes liefen. Als sie über die Schultern der Kids vor ihr linste, sah sie, wie Chance Berryman einen Jungen namens Greg Hughes zu Boden schlug. Ein paar Mädchen kreischten, als Chance auf Greg stieg und anfing, sein blutverschmiertes Gesicht auf den Asphalt zu schlagen. Der Sicherheitsdienst der Schule kam schließlich aus dem Gebäude gerannt und zog Chance fort, allerdings erst, nachdem er dem anderen Jungen auf Dauer ein Augenlicht genommen hatte. Chance flog von der Schule und verbrachte dafür einige Zeit im Jugendgefängnis. Lily hatte keine Kenntnis, was seitdem aus ihm geworden war.
»Er und Peter sind befreundet«, sagt Adam.
»Nein, sind sie nicht. Wo hast du das denn gehört?«
»Chance hat's mir gesagt.«
»Was? Wann?«
»Heute Nachmittag. Er war mit einem anderen Mann zusammen, einem älteren Typen. Chance hat so einen großen roten Ford Raptor. Die haben mich auf dem Heimweg gesehen, daraufhin neben mir gehalten und mich gefragt, ob ich dein Bruder wäre. Als ich Ja sagte, haben sie mich gefragt, ob ich Peter gesehen hätte.«
»Was hast du geantwortet?«
»Was glaubst du denn, was ich gesagt habe? Ich hab Nein gesagt.«
»Was wollten sie denn?«
»Sie wollten wissen, wo Peter ist. Chance sagte, er müsse mit ihm reden. Hat mir gesagt, ich soll Peter sagen, er soll ihn anrufen.«
»Und was dann?«
»Dann nichts. Sie sind weggefahren.«
Lily setzt sich auf ihr Bett.
»Das heißt nicht, dass sie befreundet sind«, sagte sie. »Es heißt nur, dass sie sich kennen. Viele Leute kennen sich. Vielleicht wollte Chance sich nur irgendwas von ihm ausleihen.«
Adam beobachtet sie mit einem leichten Lächeln auf seinen schmalen Lippen.
»Warum lächelst du?«, fragt sie.
»Tu ich nicht«, sagt er.
»Doch, tust du. Warum lächelst du? Findest du das alles witzig?«
»Irgendwie schon, ja.«
»Warum bist du so gehässig?«
»Ich bin nicht gehässig. Das wäre unchristlich. Ich denke nur gerade, dass man erntet, was man sät.«
»Du bist krank, Adam. Weißt du das? Du bist einfach ein gehässiger kleiner schräger Vogel.«
»Wenigstens bin ich kein Hurenbock.«
Lily fühlt sich, als hätte er ihr Wasser ins Gesicht geschüttet, aber bevor sie etwas sagen kann, dreht er sich um und geht, schlendert den Flur hinunter, um seine Mutter zu fragen, was es zum Abendbrot gibt. Sie starrt eine Weile die leere Tür an, weiß, dass sie wegen seiner Sticheleien und Beleidigungen sauer auf ihn sein sollte. Aber in diesem Moment ist ihr das alles ziemlich gleichgültig.
Im Moment will sie nur wissen, warum Chance Berryman mit Peter reden will.
Kapitel 3
Eine Woche zuvor
Freitagabend im Corinthian Inn.
Um zehn Uhr ist der Parkplatz halb leer. Nur das gelegentliche Rauschen eines vorbeifahrenden Sattelschleppers draußen auf der Interstate unterbricht die Stille.
Peter Cutchin streift ziellos durch die Flure des Hotels. Es ist wenig los heute. Der hintere Anbau ist leer. Im Hauptgebäude des Hotels mit seinen fünfzig verfügbaren Zimmern und Suiten sind keine zwei Dutzend Gästezimmer belegt. Peter bleibt stehen, um eine leere Tüte Reese's Pieces vom langweilig grauen Teppichboden aufzuheben und wirft sie in den Mülleimer. Das war's dann auch schon an Arbeit, die er bislang heute Abend getan hat.
Er geht an dem langen Glasfenster vorbei, durch das man auf den Pool-Bereich sehen kann, der um diese Uhrzeit allerdings geschlossen ist. Er sollte vor Beginn der Frühschicht das Wasser ablassen und wieder auffüllen, aber das hat Zeit. Das Corinthian Inn wurde in den 1980ern von einem ehrgeizigen Träumer erbaut, der hoffte, dass Conway, Arkansas, ein bevorzugtes Reiseziel werden würde. Heute jedoch kommen nur noch wenige Leute her, daher sind die meisten Gäste des Inns auf der Durchreise nach woanders, zum Beispiel rauf in die Ozarks oder runter nach Mississippi oder Texas. Als das Corinthian in den Besitz des gegenwärtigen Eigentümers wechselte, Mr. Baker, war der ursprüngliche Traum längst einer Reihe härterer Realitäten gewichen.
Peter geht nach vorn zur Rezeption, um mit dem einzigen anderen Mitarbeiter der Spätschicht zu reden. Auch wenn beide die Standarduniform des Corinthian tragen, weißes Anzughemd und blaue Hose mit schwarzen Schuhen, unterscheiden sie sich dennoch erheblich. Allan – groß, mittleres Alter, rundlich, glatzköpfig – steht inzwischen seit einer Stunde hinter der Rezeption und liest ein dickes Buch mit dem Titel Modernismus – die Verlockung der Ketzerei. Peter – kleiner, jünger, dünner, volles Haar – hat bereits drei Runden durch das ganze Hotel gedreht.
Peter lehnt sich lässig gegen die Wand und schaut Allan beim Lesen zu.
»Gutes Buch?«, fragt er.
»Ja.«
»Worum geht's?«
»Es geht darum, dass man Leute nicht beim Lesen stört. Ich leih's dir bei Gelegenheit.«
»Danke.«
»Kein Problem.«
Peter setzt sich. Nach einem Moment beginnt er auf dem Stuhl zu wippen.
»Hey«, sagt er, »kann ich dich mal was fragen?«
»Wenn's denn sein muss.«
»Häh?«
»Ich versuche gerade, diese Abhandlung über den Modernismus zu lesen, Peter …«
»Ich weiß, aber kann die Abhandlung über Modernismus nicht warten? Ich wollte dich was fragen. Wegen Lily.«
Allan legt ein Lesezeichen in sein Buch.
»Lily?«, fragt er.
»Ja.«
»Was ist mit ihr?«
»Findest du es richtig, wenn ich sie heirate?«
»Kriegst du kalte Füße?«
»Nein. Aber die Hochzeit ist schon in ein paar Tagen. Das beschäftigt einen dann schon, verstehst du?«
»Jede Wette.«
»Also, was meinst du? Mache ich das Richtige?«
»Jesus, Mann, woher zum Teufel soll ich das wissen?«
»Weil du ein Mann von Welt bist. Du bist schon rumgekommen, hast was erlebt. Du bist … wie alt? Fünfzig?«
»Fünfzig? Ich dreh dir gleich den Hals um. Hier und jetzt.«
»Hey, war nur Spaß.«
»Ich bin gut erhaltene zweiundvierzig, vielen Dank. Und man hat mir gesagt, ich sehe keinen Tag älter aus als fünfunddreißig.«
»Wer hat das gesagt?«
»Verschiedene Herren aus einer breiten Palette an Dating-Apps. Aber zurück zum Thema …«
»Du bist ungefähr so alt wie meine Mutter.«
»Ach, halt die Klappe. Liebst du Lily?«
»Ja, natürlich.«
»Willst du sie heiraten?«
»Das ist das Richtige. Es ist das Richtige für das Kind.«
»Tja, das ist ein Thema für sich. Du könntest dem Kind auch noch ein Vater sein, wenn du nicht mit Lily verheiratet bist.«
»Das sieht Lily aber ganz anders.«
»Vielleicht überlegt sie es sich noch mal.«
»Lily überlegt es sich nicht noch mal.«
»Sicher?«
»Ja. Mit ihr zu diskutieren ist genauso, wie mit dem Wetter zu diskutieren. Es hat einfach keinen Sinn.«
»Also, unter dem Strich steht doch: Willst du sie denn heiraten?«
Peter denkt darüber nach. Schließlich nickt er. »Ja«, sagt er. »Ja, ich will sie heiraten.«
»Na super, wo ist dann das Problem?«
»Alles ist das Problem. Mal davon abgesehen, wie sehr ich Lily liebe, ist praktisch alles ein Problem. Meine Mutter spricht nicht mal ihren Namen aus. Wir wollen in der Kirche heiraten, weißt