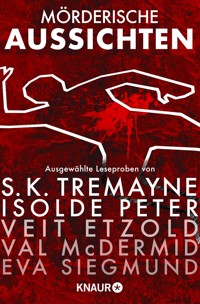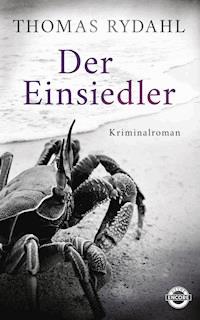Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Eine dunkle Zeit – ein begnadeter junger Dichter – eine wahre Geschichte? Folgen Sie Hans Christian Andersen in diesem atmosphärisch-fesselnden historischen Krimi bei den Ermittlungen zu einem Mord-Fall, der ihn zu seinem Märchen »Die kleine Meerjungfrau« inspiriert haben könnte. Kopenhagen 1834: Hans Christian Andersen träumt davon, als Dichter zu Ruhm zu gelangen – stattdessen verhaftet man ihn wegen Mord-Verdachts. Eine junge Prostituierte, bei der er am Vorabend gesehen worden war, wird tot aus dem dreckigen Wasser des Kanals gezogen. Zwar wird der Dichter auf Bitten eines Mäzens wieder auf freien Fuß gesetzt, doch ihm bleiben nur drei Tage, seine Unschuld zu beweisen. Mit der Hilfe von Molly, der Schwester der Ermordeten, macht Andersen sich auf die Suche nach dem wahren Mörder und findet heraus, dass es offenbar ein weiteres Opfer gibt. Gemeinsam sind Andersen und Molly einer ungeheuerlichen Geschichte auf der Spur … Thomas Rydahl und A. J. Kazinski haben mit »Die tote Meerjungfrau« einen historischen Krimi geschrieben, der die Leser tief in die Zeit Hans Christian Andersens eintauchen lässt, als Kopenhagen und ganz Dänemark schwer unter den Folgen der Napoleonischen Kriege zu leiden hatten. Der Mord an einer Prostituierten könnte Andersen zu »Die kleine Meerjungfrau« inspiriert haben. Für alle Fans der Märchen von Hans Christian Andersen finden sich viele weitere Anspielungen in diesem mitreißenden historischen Krimi.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Rydahl / A. J. Kazinski
Die tote Meerjungfrau
Kriminalroman
Aus dem Dänischen von Günther Frauenlob und Maike Dörries
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine dunkle Zeit – ein begnadeter junger Dichter – eine wahre Geschichte?
Folgen Sie Hans Christian Andersen in diesem atmosphärisch-fesselnden historischen Krimi bei den Ermittlungen zu einem Mordfall, der ihn zu seinem Märchen »Die kleine Meerjungfrau« inspiriert haben könnte.
Kopenhagen 1834: Hans Christian Andersen träumt davon, als Dichter zu Ruhm zu gelangen – stattdessen verhaftet man ihn wegen Mordverdachts. Eine junge Prostituierte, bei der er am Vorabend gesehen worden war, wird tot aus dem dreckigen Wasser des Kanals gezogen.
Zwar wird der Dichter auf Bitten eines Mäzens wieder auf freien Fuß gesetzt, doch ihm bleiben nur drei Tage, seine Unschuld zu beweisen. Mit der Hilfe von Molly, der Schwester der Ermordeten, macht Andersen sich auf die Suche nach dem wahren Mörder und findet heraus, dass es offenbar ein weiteres Opfer gibt. Gemeinsam sind Andersen und Molly einer ungeheuerlichen Geschichte auf der Spur …
Inhaltsübersicht
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Teil II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Letztes Kapitel
H. C. Andersen führt von 1825 bis zu seinem Tod 1875 akribisch Tagebuch.
Doch anderthalb Jahre fehlen.
1834, als er aus Italien zurückkehrt, hört er plötzlich mit dem Schreiben auf.
Niemand weiß, warum.
Dieser Roman beginnt dort, wo Andersen aufhört.
Teil I
X
13.–18. September 1834
Kapitel 1
Dieser Mann ist ungewöhnlich. Ein gewöhnlicher Mann hätte ihr die Kleider vom Leib gerissen, sie mit starker Hand herumgezerrt. Die Hose aufgeknöpft und ihren Blick nach unten ins Dunkel gezwungen, in der Erwartung, der Anblick würde sie begeistern. Ein gewöhnlicher Mann würde sie vor Müdigkeit, Trunkenheit, Geilheit nicht einmal sehen oder wissen, dass ihr Name Anna lautet und sie eine sechsjährige Tochter hat, Mariechen, auf die jetzt die Tante im Nebenzimmer aufpasst. Für einen gewöhnlichen Mann ist sie nichts anderes als ein feuchtes Loch.
Nein, dieser Freier ist nicht gewöhnlich.
Er hat immer seine Kleider angelassen, sie nie angefasst und ihr nicht gezeigt, was er in der Hose hat. Er ist weder reich noch arm, vielleicht ein Student, eine Art Dichter, hat sie gehört, auch wenn er nur wenig sagt. Sie kennt nur seinen Nachnamen. Andersen.
An diesem Abend riecht er auch ungewöhnlich gut. Seit ihrem letzten Treffen hat er seinen Schnäuzer wachsen lassen. Das macht ihn männlicher, denkt Anna, traut sich aber nicht, ihm das zu sagen. Er ist Ende zwanzig, vielleicht ein wenig älter, das ist schwer zu sagen. Er hat sich auf die Bank an der Wand gesetzt und seine Schere und das farbige Papier hervorgeholt. Wie immer will er sie nur betrachten und einen Scherenschnitt von ihr machen. Manchmal blickt er mit seinen großen Augen auf, kurz, fast verlegen, bevor sein Blick sich wieder auf die Schere und das farbige Papier senkt. Er ist ganz in seiner Arbeit versunken. Kleine Papierschnipsel rieseln zu Boden. Die Schere zuckt hin und her und greift auf eine Weise ins Papier, wie sie es bei niemandem zuvor gesehen hat. Nicht einmal bei ihrem Onkel, der Schneider war. Sie bewundert, wie er das Schöne hervorholt und alles andere verschwinden lässt. Was schließlich entsteht, ist eine papierdünne Ausgabe von Anna mit offenen Haaren und atemberaubenden Formen. Verschwunden ist alles Hässliche, die Spuren, die Annas Freier in ihren Augen hinterlassen haben, der fehlende Schneidezahn, die Sorgenfalten auf ihrer Stirn, die angstvollen Fragen, was aus ihrem Mariechen werden wird und ob sie ihr ein besseres Leben ermöglichen kann, als sie selbst es führt.
Es kommt vor, dass Andersen sie um etwas Besonderes bittet. Könnten Sie Ihre Arme und Hände zur Decke ausstrecken? Könnten Sie Ihr Bein so anheben wie eine Ballerina im Theater? Dann tut sie, was er will. Sie versucht es wenigstens. Für das Geld, das er ihr gibt, macht sie sonst beinahe alles. Aber er will nie, dass sie ihren Unterrock fallen lässt, will ihre Scham nicht sehen, nur ihre Brüste, ihre Formen. Sie hat ihn direkt gefragt, ob sie das letzte, entscheidende Stück Stoff ablegen soll? Aber das wollte er nicht. Annas jüngere Schwester Molly hält ihn für unnatürlich. Einem Mann, der nicht trinkt und nicht mit Frauen schläft, kannst du nicht trauen, sagt sie. Worauf du aber vertrauen kannst, ist, dass ein Mann, der trinkt und mit Frauen schläft, dir irgendwann wehtut. So sind alle Männer.
Anna streckt sich, schiebt ihre Brüste vor und stemmt die Hände auf die schmalen Hüften. Er schaut hoch, mustert ihren weißen Busen, der sich leicht bewegt.
Draußen auf der Straße ertönt das Lied des Nachtwächters. Hört, ihr Leut’, und lasst euch sagen, vom Turm die Glock hat neun geschlagen! Immer derselbe Nachtwächter, sie haben ihre festen Stadtteile. Und die Ulkegade braucht einen standhaften Mann, der sich nicht scheut, zwischen zwei Streithähne zu treten, besoffene Seeleute zu besänftigen, einbeinige Diebe zum Richterstuhl zu führen und Ordnung im Chaos zu schaffen. Das sogenannte gute Ende der Gasse darf sich Holmensgade nennen. Als würde das Gesindel und sündige Pack deshalb verschwinden.
»Autsch«, entfährt es Andersen. Sein Finger zuckt zurück. Blut tropft auf den Boden.
»Lassen Sie mich mal sehen«, sagt sie und beugt sich vor.
Er blickt entsetzt auf und steckt sich den Finger in den Mund. »Nein, nein«, sagt er.
»Aber Sie bluten.«
»Ich muss gehen, es ist schon spät, viel zu spät«, sagt der Mann unglücklich wie ein Kind.
»Müssen Sie zurück zu Ihrer Familie?«, fragt sie und legt ihr Korsett an, während sie sich den großen, hageren Mann mit einer hübschen, blassen Frau vorstellt, ein Kind an jeder Brust.
Er antwortet nicht, steht auf und legt seinen Scherenschnitt in eine schwarze Ledermappe. Seine Locken berühren fast die Zimmerdecke, so groß ist er. Sein Körper erinnert sie an den Affen mit den langen Armen, den sie einmal im Vergnügungspark gesehen hat.
»Für Ihre Mühen«, sagt er und drückt ihr eine warme Münze in die Hand, ein Tropfen Blut folgt dem Geld. »Und für Ihre Vertraulichkeit«, fügt er hinzu.
Sie nickt, hat das Gefühl, sich verbeugen zu müssen. »Darf ich mal sehen?«, fragt Anna und überrascht sich damit selbst. Sie bittet die Männer, die sie aufsuchen, sonst niemals um etwas.
Auch Andersen ist überrascht, ja geradezu erschrocken. »Sehen?«
»Mich«, sagt sie und nickt in Richtung Ledermappe, die er fest mit seinen langen Fingern umklammert, wie eine Beute.
»Nächstes Mal, nächstes Mal. Ich bin nicht zufrieden, noch nicht«, sagt Andersen. »Aber das liegt nicht an Ihnen. Nur an mir, nur an mir.«
Er öffnet die Tür und sieht nach draußen auf den Gang. Wie die meisten anderen Kunden möchte er nur ungern den anderen Männern begegnen, die zu ihr kommen. Dann grüßt er zum Abschied. Er setzt keinen hohen Hut auf, wie die feinen Herren, nur eine weiche Mütze aus schwarzer Seide, die ein bisschen zu klein wirkt, bestimmt im Ausland gekauft, vielleicht in Frankreich. Anna erinnert sich dunkel an einen französischen Freier, der vor vielen Jahren bei ihr gewesen war. Er hatte eine ähnliche Kopfbedeckung getragen und sie damals mit französischen Geldscheinen bezahlt, die längst ihren Wert verloren hatten.
Andersen duckt sich unter dem Türrahmen hindurch und geht. Sie hört seine Schritte auf den Holzdielen. Dann ist er weg.
Ihr ist leicht ums Herz, der dünne Dichter war ihr letzter Kunde. Jetzt kann sie zu Molly gehen und zu Mariechen, die hoffentlich schon schläft.
Sie zieht ihr Kleid wieder an und fegt die Papierschnipsel zusammen, die wie Schneeflocken herumliegen, hier eine Brust, dort ein Bein. Andersen war anfangs nicht zufrieden und hatte immer wieder von vorn begonnen. Anna steckt die Münze in ihre Geldbörse und denkt an die Suppe mit Grünkohl und Fleisch, die es unten an der Ecke für sechs Schilling zu kaufen gibt.
In diesem Moment klopft es an der Tür. Ein Geräusch, an das sie sich nie gewöhnen wird. Ein neuer Freier, neue Widerwärtigkeiten, Männer, die ihre Finger in sie hineinbohren wollen, sich mit ihrem Urin waschen, mit Gürteln geschlagen werden wollen. Für gewöhnlich rufen sie ihren Namen, aber jetzt bleibt es still. Vielleicht ist der Dichter noch einmal zurückgekehrt, hat etwas vergessen.
»Herr Andersen, sind Sie das?«
Keine Antwort. Stattdessen klopft es noch einmal. Sie legt ihr Ohr an die Tür. Hört jemanden da draußen. Sie könnte die Tür geschlossen lassen, sagen, dass sie bereits Feierabend gemacht hat. Andererseits denkt sie an das Geld, das sie so dringend für die Judashöhle gebrauchen könnten, die Molly und sie kaufen wollen. Die Gaststätte liegt eine knappe Stunde vom westlichen Stadttor entfernt. Sicher nicht die schönste Schankstube in Seeland, aber sie ist bei Reitern und Reisenden beliebt, da der frühere Besitzer nie jemanden wegschickte. Wer auch immer dort übernachten wollte – und wenn es Judas persönlich war –, bekam dort einen Strohsack und ein Glas Bier, solange er einen Schilling in der Tasche hatte. Außerdem ist es die einzige Gaststätte, die Molly und sie kaufen können. Frauen dürfen keine Gaststätten besitzen, der jetzige Besitzer aber ist bereit, den Namen von Annas und Mollys verstorbenem Vater in die Papiere einzutragen, um diese Vorschrift zu umgehen. Sie haben bereits hundert Reichstaler angezahlt, für die sie ein halbes Jahr gespart hatten. In dieser Zeit haben sie beinahe jeden Freier hereingelassen, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Sie muss aufmachen.
Im Licht der Öllampe unter der Flurdecke sieht Anna eine junge Frau, sie trägt ein sauberes Kleid und hat ein hübsches Tuch um die hellen Haare gebunden. Diese Art von Frauen kommt sonst nicht in dieses Haus. Niemals. Hat sie sich verlaufen, oder sucht sie ihren Ehemann? Ist das Frau Andersen, die ihrem Mann gefolgt ist?
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt Anna.
»Erlauben Sie, Fräulein Hansen?«, fragt die Frau und zeigt in Annas Kammer.
Die Frau ist schön – wie eine Pariserin. Anna legt es nicht auf ein Gespräch auf dem Flur an, wo jeder sie hören kann. Ein paar der Dirnen, vor allem Sofie, haben so wenige Freier, dass sie sich die Langeweile damit vertreiben, den anderen zu lauschen. Anna zieht die Tür auf und tritt zur Seite.
Die Frau schlüpft hinein, sieht sich in der Kammer um, tritt ans Fenster und zupft die Gardine zurecht, obwohl sie bereits zugezogen ist. Anna ist die Nervosität ihrer Freier gewohnt, sie kennt ihre Angst, im Hurenhaus gesehen zu werden.
»Suchen Sie Gesellschaft? Ich habe leider nur noch wenig Zeit. Eine Viertelstunde, vielleicht.« Anna bleibt an der Tür stehen. Sie hat nur selten weibliche Kundschaft, aber es kommt vor, und sie empfängt sie gerne. Sie riechen besser als die Männer, und sie sind großzügiger. Aber sie leiden auch an Schamgefühlen, dabei wollen sie oft nur in den Arm genommen und ein bisschen gestreichelt oder ein klein bisschen gekitzelt werden. Ganz anders die Männer, sie sind schamlos und laut und rücksichtslos wie Vieh vor der Schlachtung.
Die Frau bleibt in den Schatten stehen und flüstert. »Lassen Sie mich Ihre Brüste sehen.«
Anna ist nicht dumm. »Das macht acht Schilling.«
»Sie bekommen fünf Reichstaler«, sagt die Frau wieder mit Flüsterstimme.
Fünf Reichstaler. Ein kleines Vermögen. Damit könnten sie bald die nächste Rate zahlen. »Sie reißen mir aber nicht mein Kleid kaputt«, sagt Anna und denkt an einen früheren, reichen Freier, der glaubte, sich alles erlauben zu dürfen.
»Machen Sie sich keine Sorgen.«
Anna schiebt die Träger ihres Kleides über die Schultern und löst ihr Korsett, sodass ihr Busen zum Vorschein kommt. Die Frau sieht sie an. Mustert ihre Taille, ihre Brust, wie ein Schlachter ein Rind auf dem Viehmarkt taxiert.
»Kommen Sie mit mir in meine Kutsche. Sie wartet an der nächsten Straßenecke.«
»Ich kann nicht weg, gute Frau, es tut mir leid. Es ist zu …«
Die Frau legt Anna einen Finger auf die Lippen. »Sie bekommen Ihr Geld unten.«
»Ich werde erwartet«, sagt Anna und verrät damit mehr, als sie es sonst tut. Aber vielleicht hat eine Frau ja Verständnis für ihre Situation.
»Ich zahle Ihnen noch mehr, wenn Sie mitkommen«, sagt die Frau und zeigt Anna sogar einen richtigen Geldschein. Sie wurde noch nie zuvor mit einem Schein bezahlt, außer von jenem Franzosen. »Der gehört Ihnen, wenn Sie mitkommen«, flüstert die Frau. Ihr Atem ist nah und warm.
Anna zögert, sie braucht das Geld. Noch einmal schaut sie in Richtung Tür. In der Kammer am Ende des langen Flures schläft ihr Mariechen, gut behütet von Molly. Anna und Molly haben einander das Versprechen gegeben, nie mit einem Freier auf die Straße zu gehen. Unter keinen Umständen. Mit den Dirnen auf der Straße geschahen die ungeheuerlichsten Dinge, und weder die Nachtwächter noch die Polizei kümmerten sich darum. Als Dirne war man vogelfrei. Hier im Haus aber passten die Frauen aufeinander auf. Ein Hilferuf blieb nicht unerhört.
»Es tut mir leid«, flüstert Anna. »Ich kann nicht. Ich darf nicht.«
Die Frau wendet verärgert den Blick ab. »Dann machen Sie weiter«, sagt sie und zeigt auf Annas Busen.
Anna nimmt das Korsett ab und schiebt die Unterröcke zu Boden. Sie setzt sich auf das Bett, wie es die meisten Männer lieben. Mit halb gespreizten Beinen, die Brüste leicht mit den Armen nach oben gedrückt, sodass sie sich prall aneinanderlehnen, wie zwei Betrunkene auf dem Nachhauseweg.
Die Frau setzt sich neben Anna. Fährt mit dem Handrücken über Annas Brust. »Wie alt sind Ihre Brüste?«
Zuerst ist Anna verwirrt. Haben Brüste ein anderes Alter als der Körper, an dem sie sitzen? Sie wachsen ja erst später, aber meinte die Frau wirklich das?
»Ich bin achtundzwanzig«, antwortet Anna, die zwölf Jahre nicht abgezogen, die es gedauert hat, bis ihr Busen keimte.
Die Frau nimmt das Tuch aus ihren Haaren, schiebt sich ein paar Strähnen zurecht und sucht in ihrer Tasche nach etwas. »Mögen Sie Parfüm? Gefällt Ihnen mein Duft?«
Die Frau hält Anna ihr Tuch hin und nickt auffordernd. Dies scheint ein Befehl zu sein, nicht einfach eine Aufmunterung. Das Tuch riecht nur schwach, süß und auch irgendwie sauer, wie Honig, gemischt mit etwas anderem, Ranzigem, vielleicht Lebertran.
»Ein merkwürdiger Geruch«, sagt Anna.
»Ich nenne ihn Engelsatem. Er stammt von den Wilden in Westindien.«
Anna steckt die Nase in den Stoff.
»Ich kann nicht …«
Plötzlich legt die Frau ihre Hand fest auf Annas Hinterkopf und drückt ihre Nase in das Tuch. Warum ist dieses Parfüm so wichtig? Anna schnappt nach Luft und spürt Ameisen in ihre Lungen krabbeln. Oder etwas, das sich so anfühlt. Sie will Molly rufen, oder eine der anderen, egal wen, verliert aber die Gewalt über Körper und Stimme.
Das Gesicht der Frau verschwindet wie ein Docht in einer Flamme.
Kapitel 2
»Ist Mama zu Hause?«, fragt Mariechen noch halb im Schlaf.
Sie heißt Mariechen, weil sie klein für ihr Alter ist. Sie bekommt zu wenig zu essen, und ihr Vater, der in Annas und ihrem Leben keine Rolle mehr spielt, ist auch klein. Außerdem gibt es im Hurenhaus noch eine andere, größere Marie, eine unangenehme Frau.
»Sie kommt gleich«, antwortet Molly und lauscht dem Nachtwächter. Es muss bald zehn sein. Anna sollte längst fertig sein. Seit sie die Anzahlung gemacht haben, hat sie mehr Freier angenommen. Das sollte ich ebenfalls tun, denkt Molly, auch wenn Anna immer sagt, das sei nicht nötig, und behauptet, das Ganze setze ihr weniger zu. Große Schwestern könnten mehr einstecken als kleine. Molly weiß ganz genau, dass Anna lügt. Außerdem hat sie das Mariechen zu versorgen. Ich sollte auch mehr arbeiten, denkt sie. Morgen. Morgen wird sie ihre Tür ein- oder zweimal öfter aufmachen, ihre Seele einkapseln, wo niemand sie erreichen kann. Sonst kommen sie und Anna und das Mariechen niemals hier weg. Sie müssen das Hurenhaus hinter sich lassen, den Kuhstall über ihnen, den ewigen Gestank nach Mist, Liederlichkeit und Erbrochenem.
»Tante?«
Molly sieht zu der Kleinen hinüber, die sich halb aufgerichtet hat. »Was ist?«
»Ich muss dich etwas fragen. Und ich will eine ehrliche Antwort von dir«, sagt das Mariechen mit einem Blick, dem Molly nichts entgegenzusetzen vermag.
»In Ordnung, die sollst du bekommen. Aber dann musst du schlafen.«
Mariechen bereitet ihre Frage vor. Das braucht Zeit. Molly sieht, wie der kleine Kopf arbeitet, um die richtigen Worte zu finden. Molly kämmt sich in der Zwischenzeit mit den Fingern die schon wieder verfilzten Haare. Ihre Trumpfkarte, was die Männer angeht, aber schwer zu bändigen. Sie dreht sich einen Knoten im Nacken und steckt ihn mit der langen Haarnadel fest, die sie von Anna bekommen hat. Die hat die Nadel von einem chinesischen Seemann erhalten, der keinen hochbekommen hat. Anna wollte keine Bezahlung, solange der Chinese nicht konnte, weshalb er ihr die Haarnadel geschenkt hat. Sie ist lang und flach wie ein Messer und rot und schwarz wie die Uniform der Soldaten. Anna ist überzeugt, dass diese Haarnadel Molly noch einmal das Leben retten wird. Eine Hure ist nackt und hat nichts, womit sie sich verteidigen kann, doch Molly hat jetzt immer ein Ass in den Haaren. Einen Hurensäbel, wie Anna ihn nennt.
»Komm schon, mein Schatz«, sagt Molly. »Du musst schlafen.«
»Und du sagst wirklich die Wahrheit?« Mariechen sieht sie misstrauisch an.
»Ja, versprochen«, antwortet Molly.
»Gibt es Prinzessinnen? Also, echte?«
Molly lächelt und setzt sich auf die Bettkante. Das Stroh sticht ihr in die Pobacke. Sie streicht Mariechen die Haare aus der Stirn und versucht, die blonden Locken hinter die kleinen Ohren zu schieben. Es schmerzt sie, dass Marie die Stadt noch nie wirklich gesehen hat, aber sie achten darauf, dass sie in der Kammer bleibt oder wenigstens im Haus, da der König in den letzten Jahren mit Hurenkindern bös umgesprungen ist. Im letzten Monat haben sie Karen ihre beiden Jungen weggenommen. Karen hat geschrien und sich auf den Vogt des Königs und die Soldaten gestürzt, um ihre Kinder festzuhalten, aber sie wurden aus der Stadt gebracht. Manche Leute sagen, sie kämen als Dienstboten zu Familien auf dem Land.
»Ja, Marie. Es gibt echte Prinzessinnen. Und jetzt musst du schlafen.«
»Hast du schon mal eine gesehen?«
»Das habe ich, ja«, antwortet Molly, was die Wahrheit ist. Sie hat mal eine der goldenen Kutschen durch die Stadt fahren sehen. Hinter den weißen Gardinen hatte Molly ein Gesicht gesehen, ein Augenpaar, das sie verwundert und fragend angestarrt hatte. Kann man wirklich so im Dreck leben? Nein kann man nicht, hätte Molly ihr am liebsten geantwortet. Aber so ist das Leben, wenn man arm ist und sich in den Falschen verliebt. Liebe ist gefährlich. Das weiß Molly nur zu genau. Und das würde sie Mariechen gerne zuflüstern. Damit sie es ebenfalls weiß und auf sich aufpasst. Man muss sich vor den Männern hüten. Männer sind gefährlich, das Gefährlichste auf der Welt. Du verliebst dich in sie und wirst verlassen, so wie Molly. Und dann kannst du nur noch aus deinem Dorf weggehen. Niemand will dich, wenn du entjungfert bist, besudelt. Dann interessieren sich nur noch die Seeleute für dich, die Soldaten, Scharlatane und Freibeuter, mit ihren klimpernden Münzen in der Tasche. Und der Abschaum, die Stotterer mit faulen Zähnen oder Studenten mit krankhaften Fantasien. Wie der Dichter, der eben zu Anna in die Kammer geschlichen ist. Dieser Andersen. Molly hat Anna gewarnt, dass sie vor so einem Mann auf der Hut sein soll. Solche Männer sind gefährlich. Molly erinnert sich an einen Jungen zu Hause in Onsevig, der begonnen hatte, Tiere aufzuschlitzen. Er hatte sogar einer Amsel die Flügel abgebrochen. Irgendwann wurde er festgenommen, weil er ein Mädchen aus dem Nachbardorf misshandelt hatte. Er hatte sie grün und blau geschlagen und ihr die Arme gebrochen. So kann es auch mit dem Dichter gehen. Noch reicht es ihm, ins Papier zu schneiden. Aber was wird in einem Monat sein oder beim nächsten Vollmond? Wird er dann mehr wollen? So etwas kommt vor. Dieser Andersen hatte auch Molly gebeten, ihm für seine seltsamen Schnipseleien Modell zu stehen, aber sie hatte ihn abgewiesen. Sie kam mit solchen verkorksten Seelen nicht zurecht, hatte lieber irgendeinen Idioten als einen eingebildeten Dichter.
Molly gibt Mariechen den Rest des warmen Biers zu trinken. Die Kleine schluckt gierig. In ihrem Dorf auf Lolland konnte man das Wasser trinken. Hier geht das nicht, hier trinken alle, Kinder wie Erwachsene, Milch mit Branntwein oder warmes Bier.
»Gute Nacht, mein Engelchen.«
Das Mädchen kauert sich wie ein kleiner Vogel auf dem Bett zusammen. Viel zu mager. Sie muss raus aus diesem Haus. Wenn sie erst ihre eigene Gaststätte haben, können sie auch etwas mehr Speck in ihre Suppe schneiden. Dann müssen sie keine Angst mehr vor dem Vogt haben und das Mariechen wie eine Puppe unter dem Bett verstecken.
Im selben Moment hört sie den Nachwächter. Hört, ihr Leut’, und lasst euch sagen, vom Turm die Glock hat elf geschlagen! Elf der Jünger blieben treu …, ruft er über das Hufgeklapper eines unruhigen Pferdes und das Gegröle des Trunkenboldes Otto unten in der Kneipe hinweg. Elf? Kann das sein? Anna arbeitet doch sonst nicht so lang.
Molly steht auf und lauscht an der Tür. Annas Kammer ist am Ende des Flures.
Ist noch jemand gekommen? Ein verzweifelter Junggeselle mit einem letzten Schilling in der Tasche? Andererseits ist Monatsmitte – nicht die Zeit, in der den Tagelöhnern oder Knechten aus den Dörfern vor der Stadt das Geld ausgegangen ist. Ende des Monats versuchen sie manchmal, den Preis zu drücken, dann kriegt man sie schwer in den Griff. Aber in der Regel hatte Anna selbst mit diesen Kerlen keine Probleme.
Anfangs, wenn die Kleine schlief, hat Molly Anna um Rat gefragt, sie wollte alles lernen, was man als Dirne wissen musste. Heute weiß sie, dass sie die dümmsten Fragen gestellt hat, die man nur stellen kann. Es ist unwesentlich, was den Männern gefällt oder warum sie so gerne überall geleckt werden … Anna hatte ihre Fragen trotzdem geduldig beantwortet, wodurch Mollys Neugier nur noch größer geworden war. Erst Monate später hatte Molly herausgefunden, dass ihre große Schwester keine sonderlich gute Dirne war. Aber sie hatte, besonders seit die Kleine auf der Welt war, große Brüste, was ihr gleichermaßen Segen und Fluch war. Ohne sie hätte sie zu den Ärmsten im Hurenhaus gehört, ja, in der ganzen Stadt. Und ohne diese Brüste wären sie vor drei Jahren, als Molly ihre Anstellung als Hilfsschwester im Krankenhaus verloren hatte, alle verhungert. Molly hatte ihr verfluchtes neues Gewerbe selbst lernen müssen. Ein verfluchtes Gewerbe, aber auch ein Handwerk wie alle anderen. Je tüchtiger man war, desto schneller waren die Freier zufrieden und wieder verschwunden. Sie hatte sich Ratschläge von den anderen leichten Mädchen geholt. Wie man das Glied der Männer hielt und rieb, damit sie schnell zum Höhepunkt kamen, was man mit dem Mund machte und wie man es vermied, schwanger zu werden. Sollte man sich mit Malzbier oder morgens und abends mit Lederbalsam vom Schuhmacher einreiben, wie Salomine es behauptete?
Monate später hatte Molly Anna beigebracht, wie man die Freier täuschte, wie man sich kleidete, damit die Brüste am besten zur Geltung kamen und welche Freier man annehmen sollte. Das Glück wendete sich ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Die Kleine wuchs heran. Sie begann zu laufen, bekam Zähne, sagte Mama und Tante und lernte zu stöhnen wie ein besoffener Kapitän, dass Anna und Molly sich vor Lachen nicht mehr halten konnten und die Kühe oben zu brüllen begannen.
Molly gleitet in einen weißen Nebeltraum, bis die Glocken der Holmenskirche sie aus dem Schlaf reißen. Sie steht auf und legt noch einmal das Ohr an die Tür.
Kein Laut. Anna muss fertig sein.
Ein Schauer läuft ihr über den Rücken, als ihr endgültig klar wird, dass etwas passiert sein muss. Was, wenn dieser Andersen seine Schere zu etwas anderem als seinen Scherenschnitten benutzt hat? Sie wirft einen kurzen Blick auf das kleine Mädchen. Die Augen der Kleinen zucken unter den Lidern hin und her.
Molly schlüpft auf den Flur und huscht an Sofie vorbei, die dünn wie ein kranker Vogel zwischen den Beinen eines Soldaten kniet. Sofie ist bei der Geburt ihrer toten Zwillinge im Schritt komplett aufgerissen und anschließend falsch zusammengewachsen. Jetzt kann sie ihr Geld nur noch mit dem Mund verdienen. Molly biegt um die Ecke zu Annas Kammer. Klopft vorsichtig an.
»Anna«, sagt sie leise, falls ihre Schwester in den Armen eines Freiers eingeschlafen ist. So etwas ist schon vorgekommen, Anna ist um diese Uhrzeit oft sehr müde.
Keine Antwort.
Sie öffnet die Tür. Als sie das leere Bett in der kleinen Kammer sieht, verliert sie das letzte bisschen Ruhe. Die Türklinke gleitet ihr aus der Hand, sie macht auf dem Absatz kehrt und rennt wieder an Sofie und dem Soldaten vorbei. Dann bleibt sie stehen, geht zurück. »Hast du Anna gesehen?«, fragt sie. »Sofie, wo ist Anna?«
Sofie befreit sich aus den Hosen des Soldaten. Ihre Lippen sind nass. »Was?«, keucht sie.
»Verdammt, antworte mir, es ist wichtig. Wo ist Anna?«
Der Soldat sieht sich verwirrt um, zu besoffen, um einen Satz herauszubringen.
»Was?«, lallt Sofie. Sie scheint noch mehr getrunken zu haben als ihr Freier.
»Verdammt«, schimpft Molly und stürmt über die Treppe nach draußen auf die Straße, wo sie nach Annas blonden, zu einem Knoten hochgesteckten Haaren Ausschau hält.
Auch nach dem Dichter sucht sie. Diesem Andersen. Aber es sind zu viele Menschen auf der Straße. Auch so spät am Abend wimmelt es auf der Ulkegade vor Menschen, Molly kann die Leute in der Dunkelheit kaum unterscheiden. Sie schiebt sich an einem Bettler ohne Arme vorbei, passiert die Schenke, in der sich zwei Leute prügeln. Ein junger Mann heult vor Schmerz, weil seine Nase gebrochen ist. Ein Bäcker preist seine süßen Teilchen an. Hinter ihm hat eine Tonne Branntwein Feuer gefangen. Ein alter Mann schreit einem Jungen hinterher, der ihm die Uhr gestohlen hat. Eine Kuh brüllt. Molly biegt in die Vingårdstræde ab. Ein paar Seeleute tanzen im Kreis, ihre Mützen wippen auf ihren Köpfen.
Etwas entfernt entdeckt sie den Nachtwächter. Sie läuft zu ihm.
Er sieht müde aus, nickt ihr aber kurz zu, bis er in ihr die Dirne erkennt und weitergeht.
»Sie müssen mir helfen«, sagt Molly.
»Rede, Dirne, ich muss in die Admiralsgade, da hat sich ein Mann erhängt.«
»Ich weiß nicht, ich … meine Schwester ist weg. Sie ist … sie ist mit einem Mann verschwunden, einem seltsamen Mann.«
»Davon gibt es viele. Ist sie … ein leichtes Mädchen, wie du?«
»Ja, ja, aber … so ist sie nicht …«
»Dann wird sie schon wieder auftauchen, wenn der Herr sich beruhigt hat.«
»Nein, so ist es nicht. Das spüre ich …«
Aber der Nachtwächter ist bereits gegangen und hinter einem Karren mit stinkenden Kuhhäuten verschwunden. Molly hält sich die Nase zu und sieht sich um.
»Anna!«, ruft sie, als sie eine blonde Frau in der Gasse hinter dem Hotel du Nord verschwinden sieht. »Anna!«
Die Gasse steht voller Holzkisten, Balken und Tonnen. Jemand hat einen kaputten Pferdewagen dort abgestellt. Es ist düster, lediglich aus einem Fenster etwas entfernt dringt ein schwacher Schein. Sie geht weiter in die Gasse hinein. Im Dunkel erkennt Molly mehrere ineinander verschlungene Paare. Erregte Gesichter, nackte Brüste und Schultern, ein paar haarige Ärsche, unter dem Stoff der Röcke verschwundene Männerköpfe.
Sie sieht einen Mann in dunklem Frack, der sich über ein grünes Kleid beugt.
»Anna?«, fragt sie und schiebt den Mann weg, damit sie die Frau sehen kann.
»Hau ab, Schlampe«, ruft der Mann. Seine Zähne sind blutrot.
Die Frau sieht Molly ausdruckslos an. Es ist nicht Anna.
Molly läuft zurück zur Vingårdstræde und lässt ihren Blick über das Gewimmel der Menschen schweifen. Überall Chaos und Lärm. Nachts, wenn die Stadttore geschlossen sind, wird Kopenhagen zum Gefängnis. Ohne die richtigen Papiere kommt dann niemand mehr hinaus oder herein. So wird sie Anna niemals finden, das ist ihr klar. Es gibt viel zu viele Gassen, Keller, Hinterhöfe und Straßen, in denen sie verschwunden sein kann. Es ist nicht wie zu Hause in Onsevig, wo der Gasthof vor Sonnenuntergang schließt. Dort weiß man immer, wer sich wo befindet. Plötzlich muss sie an Mariechen denken und hastet zurück zum Hurenhaus. Sofie ist noch immer mit dem Soldaten beschäftigt.
Die Kleine schläft zum Glück. Sie atmet ruhig, unbekümmert, nichts ahnend von dem Verschwinden ihrer Mutter. Mollys Magen krampft sich zusammen. Anna würde Marie oder sie niemals vergessen. Sie würde um diese Uhrzeit nicht nach draußen auf die Straße gehen, nicht einmal um einen Freier zu suchen, Tabak zu rauchen oder sich einen Schnaps zu holen. Und Sofie hätte Anna gesehen, wenn sie mit dem Dichter gegangen wäre.
Aber wenn Anna nicht durch die Haupttür verschwunden war, wie dann? Molly schlüpft noch einmal aus ihrem Zimmer und wirft einen Blick ins Treppenhaus. Über den Kuhstall? Unmöglich, denkt sie, stürmt aber trotzdem nach oben. Die Tür zum Stall ist offen. Das ist sie sonst nie. Der Hausbesitzer, Herr Müller, hat Angst, dass die Dirnen Milch stehlen. Eine der drei Kühe sieht Molly müde und resigniert an. Die Luke am Giebel steht offen, das Hebewerk, mit dem Müller die Kühe nach oben zieht, muss benutzt worden sein. Der große Haken, der sonst immer oben eingehängt ist, ist nicht zu sehen. Molly geht an den Kühen vorbei zur Giebelöffnung. Unten am Ende des Seils hängt der Haken mit dem Lederriemen, den Müller um die Kühe spannt, wenn sie zum Schlachten abtransportiert oder gegen ein Stück Land in Amager eingetauscht werden. Hat der Dichter, Andersen, Anna auf diese Weise herabgelassen? Aber warum sollte jemand Anna entführen? Molly dreht sich um und entdeckt die Spuren in dem alten, am Boden klebenden Stroh. Exakt solche Spuren hatten sie zu Hause immer auf dem dreckigen Küchenboden, wenn sie und Anna abends ihren betrunkenen Vater ins Bett geschleift hatten.
Mit einem Mal wird Molly alles klar. Ihr ist, als krallte sich eine eiserne Faust um ihr Herz. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Ein fürchterliches Verbrechen. Jemand hat Anna durch den Stall geschleift.
Sie ist tot. Maries Mutter ist tot.
Und damit ist Mollys einzige Hoffnung zerplatzt.
Kapitel 3
Irgendetwas stimmt nicht, denkt Anna, als sie wach wird. Dann erst spürt sie, wie ihr Kopf dröhnt. Der Puls hämmert hinter ihren Augen und in ihrem Zahnfleisch.
Als sie die Augen öffnet, steht alles kopf. Sie ist an den Füßen aufgehängt und schwingt von einer Seite zur anderen wie der Klöppel einer Kirchenglocke. Die Arme sind so fest auf dem Rücken zusammengebunden, dass es ihr fast die Schultern auskugelt. Ihr auseinandergezerrter Körper schreit vor Schmerz. Anna will um Hilfe rufen, aber die Töne ertrinken in dem Stoff, den man ihr in den Mund gedrückt und am Hinterkopf festgebunden hat. Sie versucht es noch einmal, so laut sie kann.
Der Raum ist lang gestreckt. Die Decke hoch. Daran ist das Seil befestigt, an dem sie hängt. Rechts und links stehen Tonnen und Säcke. Vor ihr befindet sich ein offenes Tor. Dahinter der Himmel, von Sternen erleuchtet. Sie kann das Meer erahnen, es glitzert im Mondlicht, und mitten darauf ein Schiff unter vollen Segeln.
Sie friert, obwohl es sommerlich warm ist.
Jemand kommt eine Treppe herunter.
Eine Silhouette vor dem nächtlichen Himmel.
Es ist die Frau, die Anna besucht hat. Sie ist so schön, so vornehm. In den Händen hält sie einen kleinen Porzellanteller mit zierlichem, blauem Muster. Auf dem Teller liegen zwei schmale Messer, wie der Schlachter sie nutzt, wenn er das Fleisch zerteilt. Die Messer passen nicht zu der Frau, dem hellen Sommerkleid und dem sanften Blick. Sie lässt sich vor Anna nieder und sieht ihr in die Augen.
»Du wirst so schön werden. Du wirst die Erste sein. Es ist genau, wie Schneider es sagt, wir gestalten die Welt nach unseren Wünschen«, flüstert die Frau und streichelt Annas Brust.
Anna will verstehen, was da vor sich geht. Sie kennt keinen Schneider, will um ihr Leben flehen, für ihre Tochter. Aber die verzweifelten Laute ersticken in dem Stoff. Die Frau atmet tief ein, wählt ein Messer aus und steht auf. Anna versucht vergeblich, sich zu befreien. Dann spürt sie, wie die Haut aufschreit und das Fleisch ächzt, als das Messer dicht neben ihrer Brust tiefer und tiefer in sie dringt. Sie will nach unten sehen, das heißt, nach oben zu ihrem Körper, doch ein Schwall ihres eigenen Blutes überflutet ihr Gesicht.
»Mitgefühl nutzt nichts«, sagt die Frau. Es ist, als zögere sie, überrascht von dem Anblick von Annas blassem Fleisch, vielleicht kann sie noch von ihrem Vorhaben abgebracht werden, einsehen, dass es eine fürchterliche Idee ist. »Mitgefühl nutzt nichts«, wiederholt sie, »es ist der Untergang der Menschheit.« Anna schreit, schreit in den Stoff hinein, schreit und weint, als die Frau erneut zusticht. Anna sieht zu Boden. Dort liegt ein großer, runder, schwarzer Spiegel. Darin sieht sie ihr eigenes Gesicht, losgelöst von ihrem Körper wie ein Geist. Da plötzlich trifft ein Tropfen das Spiegelglas und schlägt darin Wellen. Es ist kein Spiegel, in den sie blickt, es ist eine Blutlache.
Kapitel 4
Hinter den Fenstern passiert etwas, das interessanter zu sein scheint als der Text, den Hans Christian vorträgt. Immer mehr der feinen Herren richten ihre Blicke auf die Straße.
Hans Christian räuspert sich und fährt fort: »Am Freitag, dem siebzehnten März, erwachte ich um Mitternacht und lag bis morgens wach, ohne wieder einschlafen zu können …«
»Uns geht es ganz anders, Andersen«, ruft einer aus den hinteren Reihen. »Wir können uns nicht wach halten.«
Gelächter brandet bei den gut fünfzig Männern in dem großen Saal auf.
Nur Edvard Collin ist jünger als Hans Christian, der in einem halben Jahr dreißig wird. Die anderen im Raum sind gestandene Männer aus der besseren Bürgerschaft, Ärzte, Professoren, Geschäftsleute. Viele von ihnen haben Hans Christian mit Almosen unterstützt, seit er vor etwas mehr als fünfzehn Jahren in die Stadt gekommen ist. Besonders die Collins haben ihm geholfen. Edvard, der gute Edvard, und sein stattlicher Vater hatten ihn aufgenommen wie einen herrenlosen Hund. Und genau das war das Problem. Als sie sich seiner annahmen, war er vierzehn und sprudelte vor jugendlicher Kraft und frischer Hoffnung. Jetzt ist die Kraft fort, die Hoffnung geschwunden, ihre Geduld aufgebraucht. Er spürt das ganz genau. Sein großes, dramatisches Werk von Agnete und dem Meermann hatte in einem Fiasko geendet, die Kritiker hatten ihn geschlachtet, und Monrad, der Schlimmste von ihnen, hatte mit seiner durchdringenden Stimme gesagt, das Stück sei ein jämmerliches Streben nach Tiefe. Auf der Rückreise aus Italien hatte sich Hans Christian geschworen, seinen Traum, Schriftsteller zu werden, ein für alle Mal an den Nagel zu hängen. Es sollte Schluss sein mit der unendlichen Nutzlosigkeit.
Hans Christian spürt, wie sich ein Schweißtropfen von seinem Haaransatz löst und über die Stirn rinnt. Er fährt mit seinem Text fort, was soll er sonst tun? »Wir stiegen zu den Ruinen von Tiberius’ Villa hinauf«, liest er und hebt dabei die Hand, um zu zeigen, wie großartig die Ruinen sich in den italienischen Himmel recken. Aber ohne Erfolg. Knapp die Hälfte seiner Zuhörer ist aufgestanden und an die Fenster getreten, die zur Straße hinausgehen. Dabei ist da draußen nur das Klappern von Hufen auf Pflastersteinen zu hören, aber nicht einmal mit einer solchen Banalität kann er konkurrieren.
Hans Christian wirft einen Blick auf seinen Text, seine Reise nach Italien. Er hatte keine Lust zu dieser Lesung, aber er hat nicht ablehnen können. Wegen des bescheidenen Honorars, das er für die Miete braucht. Honorar? Sie nennen es so, damit er nicht das Gesicht verliert, im Grunde ist es aber nicht mehr als ein Almosen. Er weiß das so gut wie der Rest der Gesellschaft. Er fängt Edvards Blick ein und sieht darin Mitleid und Irritation. Edvard ist wie ein Bruder für mich, pflegt Hans Christian zu sagen, um alle zu beruhigen. Dabei ist er mehr, viel mehr, viel bedeutender.
Bei seiner Rückkehr aus Italien – die Worte der Kritiker noch im Ohr – hatte Edvard ihm vorgeschlagen, doch für Kinder zu schreiben. Sie lieben alle Arten von Geschichten, hatte Edvard gesagt. Ohne jeden Zweifel meinte sein Freund es nur gut, aber Hans Christian hörte etwas anderes heraus. In den wohlmeinenden Worten steckte mehr als nur ein Funke Wahrheit. War er nicht gut genug, für Erwachsene zu schreiben, blieben ihm nur die Kinder. Aber Hans Christian hat für Kinder nicht viel übrig, ihre Boshaftigkeit und wilde Natur, das ewige Popeln in allen nur erdenklichen Körperöffnungen stößt ihn ab. Selbst als Kind mochte er keine anderen Kinder, und in der Schule ergriff er am liebsten die Hand der Lehrer. Nein, die Entscheidung war schon vor langer Zeit gefallen. So etwas wollte er niemals schreiben. Da würde er lieber zurück nach Odense gehen, lieber alles aufgeben und verschwinden. Seinem Vater war es ebenso ergangen. Er hatte immer von einem anderen Leben geträumt, war klug gewesen, zu klug für einen Schuhmacher, und doch war dies sein Leben geblieben.
Mit Ausnahme von Edvard sehen jetzt alle nach draußen auf die Straße. Eine Kutsche hat vor dem Collin’schen Anwesen gehalten. In der klaren Luft hört er das Wiehern der Pferde. Hans Christian dreht sich zum Fenster und sieht einen Polizisten durch das Tor treten und auf das Haus zukommen.
Irgendwo weit entfernt klopft die Wirklichkeit hart an die Tür. Sie wird geöffnet, und Hans Christian ist zum Warten verurteilt. Er kann nicht mehr weitermachen. Energische Schritte hallen durch den Vorraum. Dann sind sie auf der Treppe zu hören. Alle Blicke sind auf die Tür des Salons gerichtet.
Sie schwingt auf, und ein Polizist mit schwarzem Hut tritt ein.
»Hans Christian Andersen?«, fragt der Polizist, und plötzlich starren ihn alle an wie die Kugel, die auf die Kegel zurollt.
Der Polizist schiebt sich durch das murmelnde Publikum, das zur Seite tritt und das Drama gespannt verfolgt. Schließlich steht er vor Hans Christian, der noch immer sitzt und seine Papiere umklammert.
Hans Christian schluckt seine Spucke herunter, sieht auf seinen Reisebericht aus Italien, dann zu Edvard, der fragend mit den Schultern zuckt. War es so schlecht, dass er festgenommen werden muss?
»Sind Sie Hans Christian Andersen?«, fragt der untersetzte Polizist und legt eine Hand auf den Knüppel an seinem Gürtel. Der Mann ist genau wie die anderen Polizisten, die Hans Christian in Kopenhagen erlebt hat. Großzügig teilen sie Schläge und Ohrfeigen aus, bis die Delinquenten in der Gosse liegen. In Odense war die Polizei freundlicher und spielte sich nicht auf, wenn man für seine Sache sprechen konnte. »So antworten Sie doch, Mann«, schimpft der Polizist.
»Ja.«
»Dann muss ich Sie bitten, mit mir zu kommen.« Der Polizist legt Hans Christian eine Hand auf den Arm.
Hans Christian sieht noch einmal zu Edvard hinüber. »War es wirklich so schlecht?«, fragt er.
Edvard tritt vor. »Guter Mann, worum geht es hier überhaupt?«
Der Polizist scheint Edvard Collin zu kennen und lässt Hans Christian augenblicklich los. Wieder ein trauriger Beweis für Hans Christians Position am unteren Rand der Gesellschaft. Man darf ihn behandeln wie ein Straßenkind, das an der Stadtmauer entlangschleicht, auf der Jagd nach allem, was von den Wagen der Bauern herabfällt.
»Befehl des Polizeidirektors, Herr Collin«, antwortet der Polizist. »Er will mit Andersen reden.«
»Worüber?«, fragt Hans Christian mit bebender Unterlippe, seine Gedanken stolpern bei dem Versuch, alle seine Handlungen Revue passieren zu lassen. Hat er etwas Falsches getan, etwas Falsches geschrieben, hat jemand erfahren, was er nur seinem Tagebuch anvertraut?
»Worüber?«, wiederholt Edvard. Ein Raunen geht durch das Publikum. »Worüber will Cosmus Bræstrup mit Herrn Andersen reden?«
Dem Polizisten ist sichtlich unwohl. »Es tut mir leid, ich habe lediglich Order erhalten, Herrn Andersen zu holen.«
Hans Christian stammelt linkisch einen Protest, er will nirgendwohin mitgehen. Soll er wirklich abgeführt werden wie ein Kind, das etwas verbrochen hat? Die Erinnerung an einen Tag, an dem er in der Näherei in Odense arbeitete, kommt in ihm hoch. An die kräftigen Arbeiter, die ihn demütigen wollten und mit einem Mal behaupteten, er sei ein Mädchen, eine Jungfrau. Er hatte geschrien, als sie ihm die Hose runterzogen und ihn vor den Blicken der anderen Jungs entblößten. Damals war er nach Hause zu seiner Mutter gelaufen, die ihm versprochen hatte, dass er nie wieder zurück in die Näherei musste. Dasselbe Verlangen hatte er jetzt. Er wollte weg, für immer verschwinden.
»Der Zeitpunkt ist äußerst ungünstig, ich kann meine Zuhörer nicht einfach verlassen.«
»Der Polizeidirektor wartet nicht. Wir müssen gehen«, sagt der Polizist, packt erneut Hans Christians Arm und zieht ihn vom Stuhl.
Das Publikum tritt zur Seite, die Erwachsenen, gestandene Männer, sehen ihn bartzwirbelnd an, einer kneift sein Auge um sein Monokel zu. Hans Christian weicht ihren Blicken aus, seine Augen sehen zu Boden, während er aus dem Saal gezogen wird.
Wie ein gemeiner Verbrecher.
Vielleicht wird er aus Kopenhagen ausgewiesen, rausgeschmissen? Am Fuß der Treppe wartet das Hausmädchen mit seinem Mantel. Der Polizist hält nicht mit seiner Verachtung hinterm Berg. Im Ärmel ist ein Loch, außerdem ist der Mantel für die Jahreszeit viel zu warm, aber seit dem Winter hat er sich keinen neuen leisten können.
»Sie müssen doch irgendetwas sagen können? Ist jemandem, den ich kenne, etwas zugestoßen?«, fragt Hans Christian.
Sie gehen durch den prächtigen Hof mit den stattlichen Bäumen und treten durch das Tor des Collin’schen Anwesens auf die Straße. Auf dem Kutschbock sitzt ein älterer Polizist. Oben an den Fenstern stehen die Männer und verfolgen den letzten Akt der Andersen-Tragödie. Der Polizist gibt dem Kutscher ein Zeichen, und als sie eingestiegen sind, fahren sie los. Über die Norgesgade und dann über den Kongens Nytorv, wo sie um ein Haar zwei herrenlose Hunde überrollt hätten.
»Fahren wir nicht zum Gericht?«, fragt Hans Christian.
»Der Polizeidirektor ist am Tatort«, ruft der junge Polizist.
Tatort? Die Worte ergeben für Hans Christian keinen Sinn. Er sieht über den Platz auf die Frauen mit ihren Sonnenschirmen, dazwischen herausgeputzte Kinder mit Hüten. Sie fahren in Richtung Holmens Kanal. Gestank schlägt ihnen entgegen. Dieser Abschnitt des Kanals ist die Kloake der gesamten Stadt. Hier mündet alles, was gegessen oder getrunken wurde und über die Gossen hierhergelaufen ist. Der Schandfleck der Stadt. Besonders an warmen Sommerabenden wie heute gemahnt alles auf sehr greifbare Weise an die Vergänglichkeit. Hans Christian hält sich die Nase zu, die Polizisten hingegen lassen sich nichts anmerken.
Am Ufer des Kanals ist eine Menschenmenge zusammengelaufen. Junge Leute, Rabauken, ein paar Frauen, die sich unter ihren Schals verstecken, ein Malergeselle mit Farbklecksen auf dem Gesicht, ein paar Händler mit Hühnern und Gänsen in Käfigen, jeder kämpft in dieser Stadt um einen Schilling. Seit dem Staatsbankrott ist es noch schlimmer geworden, jetzt muss man doppelt so hart für dreimal so wenig arbeiten.
Unten am Wasser geht etwas vor, das alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die Leute weichen zurück, als die Kutsche kommt. Sie lassen die Polizisten und Hans Christian aussteigen. Er wird durch die Menschenmenge gestoßen, bis er vor einer stattlichen Gestalt steht, der eine alte Obstkiste notdürftig als Podest dient.
Das muss Polizeidirektor Cosmus Bræstrup sein. Er ist groß, die Stiefel glänzen, das schwarze Haar steht wirr vom Kopf ab. Er hat den Helm abgenommen. Seine Nase ragt wie der Schnabel eines Habichts hervor.
Der junge Polizist schiebt ihn weiter. Hans Christian sucht verzweifelt nach einem Ausweg, einer Lücke in der Menschenmenge, durch die er entkommen und im Gewirr der Gassen der Stadt untertauchen kann. Er hat nichts getan, es ist ungerecht, denkt er und steht gleich darauf am Rand des Kanals und kann nicht mehr weg.
»Das ist er, das ist er!«, hallt es aus der Menschenmenge. Eine Frauenstimme schneidet sich durch die vielen Rufe und den Lärm der Stadt. Beim Klang der Stimme dreht Hans Christian sich um. Er kennt sie. Auch das Gesicht kommt ihm bekannt vor, er hat schon einmal mit ihr gesprochen. Es ist die Schwester der Dirne. Ihre Wangenknochen sind ausgeprägter, das Kinn stärker, aber die Augen, die ihn wütend anstarren, gleichen denen ihrer Schwester. Sie muss Anfang zwanzig sein. Ein Schwall roter Haare quillt unter ihrem billigen Hut hervor und fällt ihr auf die Brust. Das Kleid ist verführerisch weit ausgeschnitten, noch dazu fehlt ein Knopf, unten der Saum ist vom Dreck mehrerer Tage verklebt.
Die Augen erinnern ihn an den Tag, an dem er sie gefragt hatte, ob er ihr Gesicht und ihren Körper mit seiner Schere aufs Papier bannen dürfe. So voller Abscheu und Verachtung. Sie hatte ihn fortgeschickt, ihm nachgeschrien, er solle seine Schweinereien woanders machen. Jetzt strahlt ihr Blick dieselbe Wut aus. Aber kann man ihn deshalb festnehmen?
»Das ist der Scherenmann. Der war es, der hat es getan«, ruft die Schwester und zeigt auf ihn.
Der Polizeidirektor dreht sich um und sieht Hans Christian an.
»Ich habe nichts verbrochen«, sagt Hans Christian. »Das muss ein Missverständnis sein.«
»Missverständnis? Sie sind gesehen worden, da bestehen keine Zweifel.« Cosmus Bræstrup steigt von der Obstkiste herab und mustert Hans Christian mit routiniertem Blick.
»Gesehen? Ich kann überall gesehen worden sein«, sagt Hans Christian und spürt förmlich, dass die Frau noch immer auf ihn zeigt.
Die Aufmerksamkeit des Polizeidirektors richtet sich wieder nach unten auf den Kanal. »Nun bringen Sie die Frau schon an Land!«, ruft er ungeduldig.
Erst weiß Hans Christian nicht, wer gemeint ist oder wovon der Mann spricht. Dann fällt sein Blick auf ein kurioses Boot mit Hebewerk, eine Art Kran, der über die Kaimauer ragt und etwas hochzieht. Wie ein Reiher, der einen Aal aus dem Schlick holt. Zwei Männer bedienen den bedrohlich schwankenden Kran. Dann sieht Hans Christian die tote Frau unten im Wasser. Ihr Gesicht ist nur zu erahnen, Polizei und Dirne haben sie aber trotzdem erkannt. Der Leichnam hängt allem Anschein nach an irgendetwas fest. Ein anderer Mann beugt sich über die Reling und schlägt mit einer Axt auf ein Tau ein. Als es reißt, wippt der Kran nach hinten und zieht die tote Frau rasch in Richtung Himmel.
Ein Seufzen geht durch den Pöbel oben am Kai.
Am Ende des schwarzen Taus hängt ein hübsches, weibliches Wesen mit geschlossenen Augen. Am Körper kleben Abfall und Kot aus der Kloake, und in den schulterlangen Haaren glitzern Muschelschalen. Strickreste, Tang und Kleiderfetzen haben sich um Unterleib und Beine gewickelt und sie zusammengeschnürt. Das Wasser tropft von der Toten auf den Boden. Der Oberkörper ist blass und weiß, scheint aber mit einem hübschen Muster geschmückt, bis ihm, ja, bis allen auf dem Kai bewusst wird, dass es Messerstiche sind, sie misshandelt und ermordet wurde.
Der Schrei der Schwester schneidet sich durch das Gemurmel. »Was hat er getan? Was hat er mit meiner Anna gemacht?« Dann ersticken ihre Worte in Tränen. Hans Christian taumelt. Trauer und Schmerz überkommen ihn, der Wind fühlt sich schlagartig kälter an, rauer.
»Sagen Sie mir, Herr Andersen, kennen Sie diese Frau?« Der Polizeidirektor spricht nicht zu ihm, sondern ruft über die Menge hinweg. »Sie müssen sie sich schon ansehen, bevor Sie mir eine Antwort geben.«
Hans Christian braucht sie nicht anzusehen. Es ist einer der Nachteile der Künstlerseele, dass man von Details, von Schönheit besessen ist und dies einen prägt wie andere Leute ihr hitziges Temperament. Er braucht ihre geschlossenen Augen nicht zu sehen, die auf ihrem Gesicht verteilten Sommersprossen, die Schultern und Hüften, um sie zu erkennen.
»Sehen Sie sie an, Herr Andersen«, ruft Cosmus Bræstrup, aber seine Stimme enthält mehr als nur die Aufforderung, einen Blick auf die Tote zu werfen. Er soll sie nicht nur ansehen, er soll sehen, was er ihr angetan hat. Hans Christian hebt den Blick. Die tote Anna hängt noch immer über dem schwarzen Wasser der Kloake. Der Kranführer weiß noch nicht recht, wie er die Leiche an Land hieven soll. Im gleichen Moment sieht Hans Christian, dass es nicht Anna ist. Sie ist es und sie ist es auch nicht. Nur wenige kennen ihren Körper so gut wie er, der ihn wieder und wieder in Papier ausgeschnitten hat. Etwas ist verändert, er weiß nur noch nicht, was.
»Ich sag doch, dass der das war. Dieser Kerl ist ein Monster«, faucht die Schwester jetzt ganz in seiner Nähe.
»Ich habe sie nie angefasst«, sagt Hans Christian. Die Worte haben kaum seine Lippen verlassen, da scharen sich die Menschen schreiend und schimpfend um ihn, als wollten sie ihn in den Kanal stoßen. Mehr kann er nicht sagen. Da spürt er etwas Warmes, Feuchtes im Gesicht. Spucke rinnt seine Wange herab, und er sieht den Schaum am Mund der Schwester.
»Verfluchter Mörder!«, schreit sie, bis sich der Polizeidirektor mit Macht zwischen sie und Hans Christian schiebt.
»Bringen Sie ihn weg«, sagt Cosmus Bræstrup zu zwei anderen Polizisten.
Sie gehorchen, im Gegensatz zu Hans Christians Beinen.
»Ich habe nichts Verbotenes getan«, flüstert Hans Christian und spürt, wie sie ihre kräftigen Hände unter seine Achseln schieben und ihn wegtragen. Es tut weh, als sie ihn auf den Boden der Kutsche werfen. Er hört die hinter ihm herschreienden Männer und Frauen, ja sogar Kinder.
»Hund!« – »Mörder!« – »Monster!«
»Kopf ab!«, brüllt einer, und mehrere stimmen ein. »Kopf ab! Kopf ab!«
Die Menschen schreien, einige lachen. Es ist ein Theater, ein Spektakel mit ihm als Schurken. Hans Christian richtet sich auf und lässt seinen Blick über den Pöbel schweifen. Warum er das tut, weiß er nicht, er hätte liegen bleiben sollen. Er sieht an sich herab und bemerkt erst jetzt das Feuchte, Warme zwischen seinen Beinen.
Das Weinen beginnt an den Lippen. Die Ungerechtigkeit lässt seine Unterlippe beben, erst danach kommen die Tränen. Warum ist Gott so wütend auf ihn? Was hat er getan, um all das zu verdienen? Er wollte immer nur das schönste Lied singen, das man singen kann, das Beste schreiben, was man mit einer Feder zu Papier bringen kann, wollte tanzen und unterhalten. Wie kann das falsch sein? Es war doch Gott zu Ehren, nicht um seiner selbst willen, dass er sein Elternhaus und die sorgenden Arme seiner Mutter als Vierzehnjähriger verlassen hatte und allein nach Kopenhagen gereist war, um den Schöpfer mit Worten und Gesang und anmutigen Bewegungen der Beine zu ehren. Aber alles, was er unternahm, war abgewiesen worden. Und das hier scheint Gottes endgültiger Abschiedssalut zu sein. Es gibt keine Hoffnung mehr. Dies ist die letztgültige Demütigung, in aller Vollendung.
»Es ist vorbei, Mutter«, flüstert er und senkt den Kopf, damit niemand sein schmerzverzerrtes Gesicht sieht, über das immer alle gelacht, das sie verhöhnt, bespuckt und angeschrien haben. Und noch ehe die Woche vorbei war, würde dieses Gesicht nun auf einer Zeichnung in der Zeitung prangen. Unter der Überschrift: Miserabler Dichter zum Tode verurteilt. Das letzte Wort über ihn würde das Fallbeil des Henkers auf dem Richtplatz in Amager sprechen.
Kapitel 5
Madame Krieger kommt schon seit Monaten in den Botanischen Garten. In einer ruhigen Ecke hat sie einen Apfelzweig angespitzt, in einen frisch eingekerbten Weißdornzweig gesteckt und sie fest miteinander verbunden. Sie sind tatsächlich zusammengewachsen. Es kam ihr wie ein Wunder vor, unglaubwürdig, als Schneider davon erzählt hatte, aber jetzt sieht sie es mit eigenen Augen. Am Weißdornstrauch wachsen tatsächlich Äpfel. Zwei Dinge sind zu einem dritten geworden. Es ist genau, wie Schneider es gesagt hat: Wir dürfen keine Angst davor haben, die Welt nach unseren Wünschen zu gestalten.
Madame Kriegers Gedanken gehen von dem Weißdorn zu dem Tuch.
Sie versteht noch immer nicht, wie sie es bei der Dirne vergessen konnte. Es war alles bis ins letzte Detail geplant gewesen. Und trotzdem hatte sie einen Fehler gemacht. Sie spürt noch das Grauen, als sie realisiert hatte, dass das Tuch noch in der Kammer der Toten lag. Es kann sie entlarven. Alles kaputt machen. Vielleicht lassen sich die Initialen am Rand des hellblauen Seidenstoffs zu ihr zurückverfolgen. Bleib ruhig, ermahnt sie sich selbst. Niemand wird sich dafür interessieren. Die Leiche der Dirne wird nie gefunden werden. Sie ist längst ins Meer getrieben, und solange es keine Leiche gibt, ist sie nicht tot. Bloß verschwunden, wie so viele andere. Bei leichten Mädchen wie ihr kommt das oft genug vor. Sie verlassen die Stadt, verschwinden, gehen zugrunde.
Sie pflückt einen Apfel und beißt hinein. Er ist nicht rot, noch blass und unreif, aber ohne Zweifel ein Apfel.
Ein Apfel an einem Weißdornzweig. Ihr Experiment ist gelungen, Schneiders Welt wächst heran. Erst im Kleinen, bis sie schließlich das Ganze neu erschaffen. Man kann zwei Zweige zusammenwachsen lassen. Es ist die Zeit der Wunder.
Etwas bringt sie dazu, ihren Blick auf den Apfel zu richten. Ein Wurm ragt aus dem weißen Fruchtfleisch heraus. Sie hat ihn durchgebissen, den Kopf gegessen.
Madame Krieger beugt sich über den Busch und spuckt aus, bis der seltsam salzige Geschmack weg ist. Dann wischt sie sich die Lippen ab und sieht sich um. Botanische Gärten sind gut besucht, besonders an Spätsommertagen. Überall hinter den Hecken sind Sonnenschirme und hohe Hüte zu sehen. Kinderlachen erschallt. Ganz in der Nähe steht ein Paar. Die Frau hängt am Arm ihres Liebsten. Sie betrachten ein Goldfischbecken. Der Blick des Mannes ruhte etwas zu lange auf ihr, als die beiden kurz zuvor an ihr vorbeigegangen waren. Aber das macht ihr nichts aus. Im Gegenteil.
Entfernte Stimmen verraten ihr, dass etwas geschehen ist. Am Ausgang brüllt jemand laut und rudert wild mit den Armen. Ein Matrose. Andere zeigen mit dem Finger auf etwas. Ist es Neugier, die sie in dieselbe Richtung treibt? Angst?
Madame Krieger verlässt den Garten und lässt sich von dem Strom der Menschen in Richtung Holmens Kanal mitreißen. Alle folgen demselben Weg, die Menschenmenge ist aufgewühlt.
In Gedanken geht sie noch einmal alles durch: Niemand hat sie das Hurenhaus betreten sehen, auf der Straße hatte es von Betrunkenen nur so gewimmelt, und erst als sich zwei Preußen und ein italienischer Zirkusartist zu prügeln begannen, war sie durch die Tür ins Haus geschlüpft. Die westindische Mixtur hatte ihre Wirkung getan. Die Hure war schwer zu tragen gewesen, schwer wie ein Netz Aale. Über die Treppe nach oben in den Stall, wo ihr der Gestank der Tiere, den sie noch nie gemocht hatte, fast die Besinnung geraubt hatte. Aber die Kühe waren ruhig geblieben, hatten sie aus ihren dummen Augen nur neugierig angestarrt. Am Ende des engen Stalls hatte die Luke offen gestanden, und Madame Krieger hatte sich und die Hure nach unten herabgelassen. Von dort hatte sie die Bewusstlose zu dem Karren geschleppt, der im Dunkeln wartete, und sie mit einem alten Segeltuch abgedeckt. Das Ganze hatte weniger als zehn Minuten gedauert. Niemand hatte sie aus dem Hinterhof rollen sehen. Erst vor der Hauptwache war ihr aufgefallen, dass ihr Halstuch fehlte. Das hübsch gemusterte Tuch. Mit ihren Initialen.
Es herrscht wildes Durcheinander, die Erregung der Menschen wird immer greifbarer.
Madame Krieger ist auf dem Weg über den Kongens Nytorv, als eine Gruppe Männer an ihr vorbeihastet. Dann geht sie an einem Händler vorbei, der Kaninchen und Rüben vom letzten Jahr verkauft. Er ruft seinem Sohn hinterher, der so schnell in Richtung Kanal läuft, dass er die Mütze auf seinem Kopf festhalten muss. »Was ist da los, was ist das für eine Aufregung?«, will der Händler wissen.
»Sie haben jemanden gefunden! Im Kanal«, antwortet der Sohn.
Plötzlich hört sie es überall.
Eine Tote. Eine Frau.
Die Worte wabern durch die Menge, zwischen den Händlern hindurch, den beiden Freundinnen, die Seite an Seite gehen, den distinguierten älteren Herren.
Eine Frau. Im Wasser.
Madame Krieger will kehrtmachen und in die andere Richtung davongehen. Weg. Sie weiß, dass Brandstifter es lieben, sich die Hände an ihrem Werk zu wärmen, und dass die Polizei die Täter oft unter den Zuschauern findet, die am meisten Neugier zeigen. Sie will sich nicht nähern.
Madame Krieger bleibt bei einer dicken Frau stehen, die Tinte und Federn aus einem Koffer verkauft. Sie sieht an ihr vorbei in Richtung Kanal. Einige Männer sind dabei, etwas auf die Kaimauer zu ziehen, während andere die Schaulustigen zurückzudrängen versuchen. Einige junge Menschen haben sich an den Rand der Mauer gelegt, um nichts zu verpassen. Die Aufregung ist nicht zu übersehen. Der Polizeidirektor scheint über den Leuten zu schweben, er gibt seinen Männern Befehle und dirigiert einen Karren zur Kaimauer, der von zwei Schwestern aus dem Krankenhaus geschoben wird. Eine trägt die schwarze Tracht einer Nonne.
Sie muss zum Kanal gehen, wenn sie mehr wissen will. Von dort, wo sie jetzt steht, sieht sie nur die Rücken der Leute. Vielleicht geht sie gar kein Risiko ein. Vielleicht ist es auffälliger, wenn sie sich als Einzige nicht für den Wirbel an der Kaimauer interessiert. Und warum sollte jemand glauben, dass sie, eine junge, hübsche Frau aus gutem Hause, etwas damit zu tun hat?
Der Kran knarrt, als Madame Krieger sich in die vorderste Reihe der Schaulustigen schiebt. Dann sieht sie die blasse Gestalt, die in Seile verwickelt über dem Wasser hängt.
Sie ist schockiert, entsetzt, Angst überkommt sie.
Das muss Anna sein. So viele Leichen treiben nun wahrlich nicht im Kanal herum.
Dann wird es wieder laut. Der Pöbel ruft etwas. Eine simple Forderung an den Polizeidirektor: »Kopf ab! Kopf ab!«
Sie sieht sich um, alle schauen in ihre Richtung. Wissen sie etwa, dass das ihr Werk ist? Aber die Menschen meinen nicht sie, sondern jemanden, der hinter ihr steht.
»Bringen Sie ihn weg!«, ruft der Polizeidirektor.
Madame Krieger dreht sich um und sieht den geschlossenen Wagen der Polizei. Die Leute bewerfen den Wagen mit Abfall, sie spucken aus, während der Polizeidirektor eine Schneise für die Pferde freikämpft. Madame Krieger erblickt den Mann hinter den schmalen Gitterstäben des einzigen Wagenfensters. Er sieht bizarr aus, ein Gesicht, an das man sich erinnert, wenn man es ein Mal gesehen hat. Und genau das hat Madame Krieger getan. Ein Mal. Es ist der Freier, der an jenem Abend bei der Hure war. Sie hatte darauf gewartet, dass er ging. Hatte zwischen der Böttcherwerkstatt und dem Haus des Leichenbestatters gestanden und zu den Fenstern aufgeblickt. Sie erinnert sich an seine Verlegenheit und Nervosität, als er hastig das Weite suchte. Sein Gang war linkisch wie der eines dummen Jungen, der zu Hause rausgeschmissen worden war. Die Situation war ihm sichtlich unangenehm, er versteckte sich in seinem Mantel wie ein Vogel unter seinen Flügeln.
»Das ist der Scherenmann! Er hat meine Schwester umgebracht!«
Der Ruf kommt von einer der Dirnen. Sie mag einmal eine schöne Bauerstochter gewesen sein, mit dicken, roten Locken, jetzt ist sie nur noch eine gewöhnliche Dirne mit einer geschmacklosen Vorliebe fürs Liederliche. Ihr Kleid steht offen, eine Einladung. Auch diese Frau kennt sie. Es ist Annas Schwester. Sie hatte die beiden gemeinsam beobachtet. Hand in Hand, zwei Dirnen, die sich fest aneinandergeklammert durchs Leben vögelten. Die Frau zeigt auf den Mann im Wagen. Sie muss ihn genau wie Madame Krieger gesehen haben, als er das Hurenhaus verlassen hatte.
Madame Krieger sieht zu dem Wagen hinüber, der sich endlich in Bewegung setzt, und versucht, ihr Glück zu begreifen. Ihr Glück im Unglück.
Es ist Pech, dass die Leiche der Dirne in die falsche Richtung getrieben wurde, in den Kanal hinein. Dabei hatte Madame Krieger die Strömungsrichtung mehrfach getestet. Mit Tonnen, die dasselbe Gewicht wie eine Frau hatten. Säcken mit Zweigen. Sogar einen toten Hund hatte sie ins Wasser geworfen. Es war alles nach Norden getrieben, aus dem Hafen hinaus aufs offene Meer. Vielleicht hatte die Tote sich genau in der Fahrrinne befunden, als der lange, flache Kahn, der jeden Tag mit Müll und Geröll beladen hin- und herfuhr und jetzt im Kanal lag, kam. Vielleicht war sie im Kielwasser des Schiffes in den Kanal gesogen worden. Wie Kinder, die einem Straßenmusikanten folgen.
Muss sie sich Sorgen machen?
Versucht da jemand, ihren Plan zu durchkreuzen?
Man könnte es glauben, wäre das Glück nicht soeben in Gestalt dieses merkwürdigen Mannes zu ihr zurückgekommen.