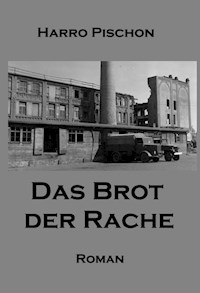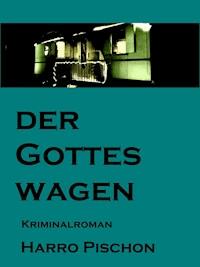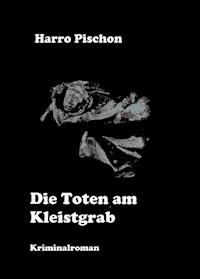
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Beate Lehndorf ermittelt in ihrem ersten Fall: Am Kleistgrab in Berlin-Wannsee werden zwei Tote gefunden, fast wie vor zweihundert Jahren Kleist und Henriette Vogel. Sie wurden ermordet. Vom Motiv der Eifersucht verlagern sich zunehmend die Ermittlungen auf das rätselhafte Manuskript einer Kleist-Tragödie, das wieder aufgetaucht sein soll. Literaturwissenschaftler, Theaterdirektoren, Verleger und Sammler geraten in Verdacht. Beate Lehndorf lernt in Berlin einen Psychiater und Kleistforscher kennen. In Thun in der Schweiz lösen sie das Rätsel, ohne den Täter schon zu kennen. Der spielt inzwischen ein mörderisches Spiel bis zum Finale in der Schorfheide in Brandenburg. Ein weiterer Handlungsstrang zeigt das Schreiben und Lieben Heinrich von Kleists bei seinem Aufenthalt in Thun 1802 und 1803.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harro Pischon
Die Toten am Kleistgrab
Kriminalroman
2013
Für Rike
Laß uns
Die schöne Stunde innig fassen. Möge
Die Trauer schwatzen und die Langeweile,
Das Glück ist stumm. - Wir machen diese Nacht
Zu einem Fest der Liebe, willst du?
Die Familie Schroffenstein, V,1
Das Leben hat doch immer nichts Erhabneres, als nur dieses, dass man es erhaben wegwerfen kann. - Mit einem Worte, diese außerordentlichen Verhältnisse tun mir erstaunlich wohl, und ich bin von allem Gemeinen so entwöhnt, daß ich gar nicht mehr hinüber möchte an die andern Ufer, wenn Ihr nicht da wohntet.
An Ulrike von Kleist, 1. Mai 1802
Inhaltsverzeichnis
1 Sonntagmorgen 10. Juni
2
3 Montag
4
5 Montagnachmittag
Februar 1802
6 Dienstag
7 Dienstag
8 Mittwoch
März 1802
9 Mittwoch
10 Donnerstag
Er
11
März 1802
12
13
14 Freitag 15. Juni
Ende März 1802
15 Montag 18. Juni
16 Dienstag 19. Juni
17
Anfang April 1802
18 Mittwoch 20. Juni
19 Donnerstag 21. Juni
Ende April 1802
20 Die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag
21 Donnerstagmorgen 21. Juni
22 Donnerstagmittag
23 Freitag 22. Juni
Er
24 Freitagnachmittag
Anfang Mai 1802
25 Samstag
26 Montag 25. Juni
27
28
29
30 Dienstagvormittag 26. Juni
Mitte Mai 1802
31
32
33
Juni 1802
34 Dienstagnacht und Mittwochmorgen
35 Mittwoch 27. Juni
36
Ende Juni 1802
37
38
39 Donnerstag 28. Juni
Er
40
August 1803
41
42 Montag 2.Juli
43
44
45 Dienstag 3. Juli
46
47
48
49
50
Nachbemerkung des Autors
1 Sonntagmorgen 10. Juni
Als Isabel aus dem Bahnhof trat, läutete es von irgendeinem Kirchturm fünf Uhr. Über dem Wannsee lag noch Nebel, aber der Himmel war klar. Es würde ein schöner Tag werden. Doch sie würde, zuhause angekommen, die Vorhänge zuziehen und Schlaf suchen, Vergessen. Wütend stieß sie den Schlüssel ins Fahrradschloss, warf das Schloss in den Korb und fuhr vom S-Bahnhof hinunter zur Königstraße, vorbei am Gartenlokal und der Schiffsanlegestelle.
Da hatte sie stundenlang mit Alex geredet, gescherzt, geflirtet - und dann kam diese Blondschnecke, diese Hungerharke, klimperte ihn ein paarmal mit ihren künstlichen Wimpern an und verschwand mit ihm. Der Teufel soll sie beide holen!
Sie überquerte die Königstraße und bog in die Bismarckstraße ein, blieb auf dem Gehweg, um das Kopfsteinpflaster zu vermeiden, näherte sich den vornehmen Ruderclubs und dem dazwischen eingezwängten Kleistgrab. Letztes Jahr hatte sie darüber ein Referat halten müssen. „Sie wohnen doch in derselben Straße, Isabel“, hatte Markwart gesagt, “da bietet es sich doch an, über Kleists Ende und seine Grabstelle zu berichten.“ Die Todessehnsucht und Todesseligkeit Kleists waren ihr fremd geblieben. So fremd wie die Liebe und der autosuggestive Selbstmord Penthesileas. Auf der Lektüre dieses Dramas hatte Markwart bestanden. Ein wenig meinte sie nach dem Referat verstanden zu haben: Mit 34 Jahren glaubte Kleist, für ihn sei „auf Erden nichts mehr zu lernen und zu erwerben übrig“. Er hatte den Eindruck, dass alles, was er unternehme, scheitert. Bis er schließlich der unheilbar kranken Henriette Vogel sagte, „ihr Grab sei ihm lieber als die Betten aller Kaiserinnen der Welt.“
Isabel hatte ein nachgestelltes Bild gezeigt, wie die beiden in einer Erdkuhle liegen. Sie seufzte – und bremste scharf ab. Sie stand unmittelbar an dem Schild „Zum Kleistgrab“. In Gedanken hatte sie hinübergeschaut zu dem kürzlich renovierten Grab, das nun von der Straße aus gut zu sehen war. Was war das? Am Gitter der Umrandung lehnte etwas Weißes und etwas Schwarzes. Pennten da welche am Grab? Sie ließ ihr Fahrrad stehen und näherte sich vorsichtig. Tatsächlich, da lagen eine weißgekleidete Frau und ein Mann im schwarzen Anzug, fast genauso wie Kleist und die Vogel. Isabel sah sich um, niemand sonst war zu sehen, nicht auf der Straße, nicht auf den Wegen, nicht auf dem Wasser. Die beiden hatten sich nicht bewegt. Der Mann war über den Schoß der Frau gebeugt, in einer obszönen Pose. Isabel sah auf der linken Brust der Frau einen tiefroten Fleck.
Sie schienen beide tot.
Isabel ging ein paar Schritte zurück, atmete schnell. Dann kramte sie ihr Handy hervor. Was wählte man in einer solchen Situation? 110 – die Polizei? Oder die Feuerwehr? Sie wählte 110 und berichtete atemlos, wo sie war und was sie sah. Nachdem sie ihren Namen gesagt hatte, wurde ihr bedeutet, sie solle bleiben und auf die Streife warten, die gleich vorbeikomme.
2
„Mister Sandman, bring me a dream, make him the cutest, that I've ever seen...“ Dieser Klingelton ist unmöglich, dachte Beate Lehndorf beim Aufwachen. Noch dazu am Sonntag, einem dienstfreien Sonntag, wenn Ausschlafen angesagt war. Benni muss mir bald einen anderen einstellen, ich habe keine Lust, mich mit diesen Dingern abzugeben. Sie lächelte, weil sie an ihren früheren Leib- und Magenspruch dachte, wenn es um Handys ging: Nur Dienstboten sind immer zu erreichen. Aber eine Kriminalhauptkommissarin ohne Handy ging inzwischen gar nicht mehr.
„Was gibt's?“, krächzte sie verschlafen. Und es folgte das übliche Wo? und Ich komme! Sie würde später Petra anrufen, dass sie sich um Ben kümmern solle. Beide waren das schon gewohnt. Nur dass sie wieder nicht dazu kam, den versprochenen Sonntagsausflug zum Tempelhofer Feld zu machen und mit Benni auf der ehemaligen Startbahn zu skaten.
Nach wenigen Minuten stieg sie in ihren alten verblichenen Golf, der sie aber noch nie im Stich gelassen hatte. Am Insulaner vorbei fuhr sie zur B1, die nach Wannsee führte. Am frühen Sonntagmorgen war fast niemand unterwegs. Sie schob eine CD ein und hörte Kantaten mit dem Countertenor Andreas Scholl. Zwei Tote am Kleistgrab? Hatte da ein Liebespaar dem Dichter nachgeeifert? War es die Inszenierung eines Doppelmörders? Die Leitstelle hatte natürlich keine genauen Angaben machen können.
Beate hatte im letzten November von der Renovierung des Kleistgrabs gelesen. Sie wusste, dass er 200 Jahre vorher zusammen mit einer Frau aus dem Leben geschieden war. Aber als Autor war er ihr nicht nahe. Wohl kannte sie aus der Schulzeit „Michael Kohlhaas“, den damals – für eine Dresdner Schule - radikalen Kämpfer gegen das feudale Unrecht seiner Zeit. Und jüngst war sie im Theater gewesen und hatte den „Zerbrochenen Krug“ gesehen, mit Edgar Selge, den sie mochte. Seine Figur des einarmigen Tauber im „Polizeiruf“ mit ihrer mürrischen Eigenbrötlerei hatte sie erheitert. Als nackter Dorfrichter Adam auf der Garderobentheke, umringt von den auf Einlass wartenden Zuschauern, hatte er sie zum Lachen gebracht.
Sie bog nach der Bahnunterführung am Wannsee in die Bismarckstraße ein. Nach wenigen hundert Metern hielt sie hinter den Streifenwagen und den Dienstwagen der Spurensicherung. Am frühen Sonntagmorgen war es in der Straße noch ruhig, ohne Neugierige. Sie bog in den schmalen Pfad zum Grab ein. Die Blitzlichter des Polizeifotografen flammten immer wieder über die anderen weißgekleideten Spurensucher des Tatorttrupps. Menzel war auch schon da. Oberkommissar Wolfgang Menzel, ihr Kollege, 45 Jahre alt, Bremer, und immer in feinstes Tuch gekleidet. Er konnte nur schwer mit der Tatsache umgehen, dass eine Frau ihm vorgesetzt war. Vielleicht war er deshalb seit langem hinter Beate her.
„Morgen, Wolfgang, was wissen wir?“
„Guten Morgen, Frau Hauptkommissarin, Traber ist noch dran.“ Josef Traber, der Gerichtsmediziner, war über die Toten gebeugt und sprach in ein Diktiergerät. Beate wusste, dass es keinen Zweck hatte, ihn zu stören. Er hätte nur die Falten in seinem Gesicht durch das Hochziehen der Brauen vermehrt und ihr einen unwilligen Blick aus seinen Echsenaugen zugeworfen.
Überraschend stand er auf, drehte sich um und sprach Beate an: „Jedenfalls ist es nicht das, wonach es aussieht.“
Menzel mischte sich ein: „Also kein gemeinsamer Freitod, wie bei Kleist.“
Die Echsenaugen hefteten sich kurz auf Menzel, als ob sie sagen wollten, er solle seinen Ehrgeiz nicht so lärmend offenbaren.
„Das Arrangement legt es nahe. Die Frau lehnt am Gitter und hat eine Schusswunde in der Brust. Der Mann hat eine tödliche Wunde in der rechten Schläfe. Er liegt auf dem Schoß der Frau und neben seiner rechten Hand eine Pistole.“
„Aber es ist fast kein Blut zu sehen“, staunte Beate Lehndorf.
„Sie sagen es, Frau Hauptkommissarin.“
„Also ist dies nicht der Tatort, nur der Ablageort.“
„Eben dies.“
„Und der Mörder wollte es so aussehen lassen, wie den historischen Freitod“, fügte Menzel hinzu, um wieder ins Gespräch zu kommen.
„Oder die Mörderin“, sagte Beate. „Jeder der beiden kann einen eifersüchtigen Partner gehabt haben.“
„Wie der Gatte von Henriette Vogel“, schmunzelte Traber, „der aber wohl unschuldig war. Sie entschuldigen mich, morgen wissen wir mehr.“ Er schloss seine altmodische Arzttasche und schritt zur Straße.
„Wer hat die beiden eigentlich gefunden?“, wollte Beate wissen.
„Ein junges Mädchen auf dem Heimweg“, sagte Menzel, „wir haben sie erst einmal nach Hause geschickt, sie wohnt ein paar Häuser weiter. Sie hat aber nichts weiter gesehen, schon gar keinen Verdächtigen.“
Beate trat vor die Toten. Die Frau war noch jung, zwischen 25 und 30 Jahren vielleicht, ausnehmend hübsch, eine beeindruckende Figur – Beate seufzte etwas - blonde, lockige Haare, das weiße Kleid altmodisch, es erinnerte an ein Kostüm, hochgeschlossen, schmale Taille und
unten weit geschnitten. Ihr Gesicht hatte einen Ausdruck der Verwunderung, der Überraschung. Der Mann lag inzwischen neben ihr, er war deutlich älter, um die fünfzig, leicht korpulent, wohl frisierte, graue Haare.
„Weiß man, wer sie sind?“, fragte Beate. Menzel schüttelte den Kopf. „Sie haben keine Papiere bei sich.“
„Wie sind sie hierher gebracht worden?“ - „Es gibt nur zwei Möglichkeiten: über die Bismarckstraße oder auf dem Wasser.“
„Und auf dem Weg am Seeufer?“
„Man kommt zwar von hier zum Seeufer hinunter, da steht auch eine Bank, aber man kommt nicht weiter. Das Grundstück ist von den beiden Ruderclubs eingeschlossen. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Gymnasien, die hier rudern, sich weigerten, einen Weg am Ufer freizugeben.“
Beate hob den Kopf, als nähme sie Witterung auf. „Ja, wir sind hier in Zehlendorf, dem reichen Südwesten Berlins.“
„Außerdem ist es reichlich schwierig, die Stufen von da unten zu überwinden“, Menzel wies auf die Treppen auf dem gewundenen Pfad vom Ufer. „Ich nehme an, sie wurden von der Straße hierher geschafft.“
„Und selbst das ist für eine Person nicht leicht zu bewerkstelligen. Vielleicht mit einer Schubkarre.“ Beate seufzte. „Es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn in einer Nacht zum Sonntag jemand etwas gesehen hätte, einen Kombi oder Van.“
„Es sei denn, jemand war auf dem Nachhauseweg wie die kleine Isabel, aber früher.“
„Also müssen die Anwohner befragt werden. Du organisierst das?“
Menzel nickte, er konnte jemand aus der Abteilung beauftragen. Viel schwieriger war die Identifizierung der Toten. Da sollte sich die Frau Hauptkommissarin mal etwas einfallen lassen. Er würde ja die Presse...
Beate wandte sich zu Menzel: „Ich werde Fotos der Gesichter an die Presse geben. Irgendjemand wird sie bestimmt kennen. Kann auch sein, sie werden schon vermisst.“
Inzwischen waren die Träger der Gerichtsmedizin angekommen und hoben die Toten in die Transportbehälter, die Frauen und Männer der Kriminaltechnik waren noch nicht fertig, sodass der Fundort noch gesichert werden musste. Die beiden Kommissare gingen zu ihren Autos. Beate telefonierte vor dem Abfahren mit ihrer Nachbarin. So schnell würde sie heute nicht nach Hause kommen. Aber Benni war einiges gewohnt und mit seinen fünfzehn Jahren alt genug.
3 Montag
Schon am Sonntagabend wurde durch einen Anruf die Identität der Opfer geklärt. Die Zeitungsboten auf den Straßen und in Restaurants hatten die Montagsausgabe verkauft, mit dem Aufruf sich zu melden, falls jemand eine der abgebildeten Personen kennt. Beim Landeskriminalamt rief Melanie Mattwey-Dehmel an und erkannte ihren Mann auf dem Foto, den Literaturwissenschaftler Richard Dehmel. Sie erkannte auch die getötete Frau, bei der es sich um die Schauspielerin Katharina Czerny handele, sie spiele des Öfteren am Anton-Tschechow-Theater, Angehörige seien ihr nicht bekannt. Melanie Mattwey-Dehmel wurde gebeten, am Montag zur Identifizierung ihres Mannes in die Rechtsmedizin zu kommen. „Also geheult hat se nich gerade“, meinte Klaus Zepf, der diensthabende Kommissar, als er Beate informierte.
Um 10:30 Uhr traf sich Beate mit Melanie Mattwey-Dehmel in der Turmstraße am Eingang zum Gerichtsmedizinischen Institut. Aus dem Taxi stieg eine sehr gepflegte Frau Mitte fünfzig, groß, rot gefärbte Haare, dezenter Goldschmuck. Sie wirkte beherrscht, kontrolliert. „Bringen wir es hinter uns“, sagte sie zu Beate, nachdem diese sie begrüßt hatte. Sie gingen in einen vorbereiteten Raum, in dem der Wagen mit der zugedeckten Leiche stand. Josef Traber, der Rechtsmediziner, nickte Beate zu, warf einen prüfenden Blick auf die Ehefrau und hob das Tuch ein wenig an, sodass das Gesicht zu sehen war. Ohne eine Miene zu verziehen, sah Mattwey-Dehmel ihren Mann an, nickte kurz und verließ den Raum. Beate folgte ihr und fragte auf dem Flur: „Ich brauche Ihre ausdrückliche Bestätigung. Ist es Ihr Mann?“
„Ja, das ist Richard“, sagte Melanie Mattwey-Dehmel. „Wie ist er gestorben? Hat er sich selbst getötet? Nachdem er....?
„Die Ergebnisse der Obduktion liegen noch nicht vor. Aber es bestehen durchaus Zweifel an einem Selbstmord.“
Die Lider der Mattwey-Dehmel flatterten.
„Muss ich die Czerny auch noch identifizieren?“
„Nein, das müssen Sie nicht. Wir werden herausfinden, ob es Angehörige oder andere Menschen gibt, die ihr nahestanden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich noch mit Ihnen sprechen könnte. Sie können uns wichtige Hinweise geben.“
„Ich habe meine Stunden ohnehin für heute abgesagt, hätte also Zeit. Ich bin Gesangslehrerin. Wo sprechen wir?“
„Am besten fahren wir ins Präsidium, ich kann Sie gerne mitnehmen.“ Beate führte sie zu ihrem alten Golf.
„Im Fernsehen fahren Kommissare immer die neuesten Modelle. Ist das Ihr Dienstwagen?“, fragte die Mattwey-Dehmel maliziös.
„Ah, Sie vergessen den Kieler Tatort, da fährt der Kommissar einen alten Passat privat wie im Dienst – so wie ich“, konterte Beate. „Haben Sie kein Auto?“
„Doch, aber im Stadtverkehr ist es mir zu mühselig. Da nehme ich lieber ein Taxi. Oder lasse mich von der Polizei fahren.“
Beate registrierte wohl, wie Melanie Mattwey-Dehmel versuchte, herablassend zu sein. Entweder kompensiert sie den Schock der Konfrontation mit ihrem toten Gatten oder sie hält mich für unbedarft, dachte sie.
Am Fehrbelliner Platz angekommen, wo auch die Mordkommission 115 im LKA beheimatet war, gingen sie in das Büro von Beate.
„Möchten Sie etwas trinken?“, fragte Beate.
„Nur wenn der Kaffee besser ist als in Fernsehkrimis“, spielte die Mattwey-Dehmel weiter.
Beate spielte mit. „Die Automaten mit dem Spülwasser gibt es wirklich nur in mäßigen Krimis. Pads machen auch ordentlichen Kaffee.“ Sie füllte frisches Wasser ein und bereitete zwei Tassen zu.
„Was hat Ihr Mann mit dem Kleistgrab zu tun?“, fragte sie.
„Nun, er ist Literaturwissenschaftler an der FU Berlin und stellvertretender Vorsitzender der KGB.“
„Der was?“
„Der Kleist-Gesellschaft-Berlin. Richards Spezialgebiet war Kleist, insbesondere die Dramen. Ich nehme an, Sie kennen wenigstens den „Zerbrochenen Krug.“
Beate sagte zu dieser Unverschämtheit nichts, neigte nur den Kopf. „Und Frau Czerny? In welchem Verhältnis stand sie zu Ihrem Mann?“
„Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben sich in letzter Zeit wohl öfter getroffen. Was sich dabei abgespielt hat, weiß ich nicht.“
„Nun, sie war eine junge, sehr hübsche Person.“
„Wenn Sie glauben, ich sei eifersüchtig gewesen, dann irren Sie gewaltig. Richard und ich wussten, was wir aneinander hatten. Das kann eine kleine Schauspielerin nicht ändern.“
„Und doch wurden beide als Liebespaar im gemeinsamen Tod dargestellt.“
„Ich habe dafür keine Erklärung.“
„Frau Mattwey-Dehmel, unter diesen Umständen könnte man Sie für verdächtig halten.“
„Sie irren auch hier. Ihr Verdacht steht Ihnen doch auf die Stirn geschrieben. Meinen Sie etwa, ich falle auf Ihre aufgesetzte Freundlichkeit herein?“
„Was haben Sie gestern Abend und in der Nacht gemacht?“
„Sie dürfen mich auf Ihre Fall-Tafel schreiben. Ich war zu Hause – allein. Mich nach einem Film zu fragen ist sinnlos. Ich habe Musik gehört und habe gelesen. Gegen Mitternacht bin ich zu Bett gegangen.“
„Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mattwey-Dehmel. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung.“ Beate begleitete sie zur Tür und sah ihr nach, wie sie aufrecht den Gang hinunterschritt. Warum zeigt sie kein Gefühl?, dachte sie. Verbirgt sie ihren Hass, ihre Eifersucht und ihre Kränkung, um sich nicht zu verraten? Oder muss sie dominieren? Sie wird uns noch beschäftigen.
4
Das Taxi fuhr weiter und sie ging in ihr Haus nahe der Krummen Lanke. Melanies Wut war verraucht. An ihre Stelle trat eine tiefe Erschöpfung. Wie hatte sie gekämpft um diesen Mann. Seit Wochen, ach was, seit Monaten, war er nicht mehr ansprechbar gewesen, nicht mehr da gewesen, auf Dienstreisen – angeblich, und immer in der Nähe dieser kleinen Schauspielernutte. Anfangs hatte sie ihn noch zur Rede gestellt: „Was hast du mit dieser jungen Schnepfe? Bin ich dir nicht mehr gut genug?“ Er hatte immer abgewiegelt, war ausgewichen: „ Mach dir keine Sorgen. Es geht nicht um eine Affäre. Es geht um mehr. Ich bin an einer Sache dran, größer als alles, was ich in meinem Leben geschafft habe. Sei geduldig!“
Ausreden. Die alte Leier. Er konnte das Älterwerden nicht ertragen. Seine sexuelle Unbeholfenheit wollte er immer aufs Neue bei einer Liebschaft überwinden. Nun war es zu Ende. Und doch wusste sie, dass die Wut nicht vorbei war, dass sie die Kränkung nicht überwunden hatte, dass die Erschöpfung wieder diesem Brennen weichen musste.
Sie setzte sich an den Flügel und schlug die Eingangsakkorde an, atmete tief und mit der Kraft einer alten Sehnsucht sang sie die Arie der Susanna aus „Le nozze di Figaro“:
Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella,vieni ove amore per goder t'appella...
Noch war ihre Stimme biegsam und kraftvoll, noch war ihr Körper ansehnlich. Sie würde es allen noch zeigen.
5 Montagnachmittag
Um 14 Uhr fand die Lage statt. Beate Lehndorf und Menzel informierten ihre Gruppe über den Erkenntnisstand, der nur aus der Identität der Opfer bestand und einigen Hinweisen auf ihre Tätigkeit. Das Hauptproblem im Augenblick war das offensichtliche Arrangement am Fundort, dem Kleistgrab. Wer hatte ein Interesse und warum, nicht nur die beiden zu töten, sondern sie derartig auszustellen? Für eine Irreführung - einem vorgeblichen verabredeten Selbstmord - war das Vorgehen doch zu durchsichtig. Am naheliegendsten war eine Eifersuchtstat, da der Literaturwissenschaftler mit der Schauspielerin ermordet wurde. Hier kam als erste die Ehefrau in Frage, aber auch einen Liebhaber der Schauspielerin könnte die Beziehung der beiden verletzt haben.
„Als erstes müssen wir die Opfer kennenlernen, ihre Beziehungen, ihre Kollegen, ihre Arbeit. Ich selbst werde mich um Dehmels Umfeld kümmern, du Wolfgang erkundest den Hintergrund der Schauspielerin. Außerdem müssen die Anwohner in der Bismarckstraße befragt werden, ob sie etwas wahrgenommen haben. Ihr kennt den vollen Namen von Andi..“ „An die Arbeit“, ertönte die gewohnte Antwort im Chor.
Menzel ging zu Beate. „Und ich sage dir, es war die Ehefrau. Ein Lebensgefährte der Czerny würde keine Kleistinszenierung veranstalten. Der würde höchstens den alten Knacker aus dem Weg räumen. Diese Ausstellung am Tatort zeigt doch, dass sich seine Frau geärgert hat.“
Beate schluckte den Ärger über Menzels selbstgefällige Gewissheit hinunter. „Du magst ja Recht haben, aber erstens brauchen wir Fakten und Beweise und zweitens ist mir die Erklärung doch zu vordergründig. Die Frau ist intelligent, sie würde es uns nicht so einfach machen.“
„Eifersüchtige Frauen sind nicht intelligent“, versetzte Menzel.
„Finde etwas über die Czerny heraus, wir müssen mehr wissen.“
„Es ist Zeitverschwendung, aber du hast das Sagen“, meinte Menzel. „Wenn ich Recht behalte, kostet es dich ein Essen bei „Wegner“ in der Dahlmannstraße.“
„Und was kostet es dich, wenn du nicht Recht behältst?“
„Dann darfst du dir ein Restaurant aussuchen.“
„Oder ich darf frei über den Abend verfügen – und alleine bleiben.“
„Warum bist du so kratzbürstig?“
„Ich bin nicht kratzbürstig, ich bin nur nicht interessiert.“
Menzel sah sie an, seufzte und wandte sich zum Gehen. Warum mussten Frauen immer so viele Widerstände aufbauen, bevor sie sich einlassen konnten?
Februar 1802
Heute würde er sich trauen. Kleist stand am Aareufer in Scherzligen und blickte auf das Holzhaus auf der Insel. Es lag genau an der Spitze, die Terrasse bot den Blick über den See auf die Berge. Ein verwinkeltes, liebenswürdiges Häuschen. Ob jemand darin wohnte?
Kleist ging vorsichtig über die vereiste kleine Brücke auf die Insel hinüber, klopfte und rief. Nichts rührte sich. Er sah sich um, auf der anderen Flussseite befand sich eine Fischerkate. Er ging hinüber, hier stieg Rauch aus dem Schornstein.
Als er klopfte und hallo rief, öffnete eine junge Frau die Tür und fragte nach seinem Begehr. Kleist fragte, ob das benachbarte Haus zu mieten wäre. Die Fischerstochter rief nach hinten ins Haus: „Vater, chömed emol. Ein Herr fragt nach dem Haus.“
Kurz darauf erschien der Fischer in hüfthohen Stiefeln. „Was wünschen der Herr?“ - „Ich möchte gerne wissen, ob das Haus da drüben zu mieten ist, und an wen ich mich wenden soll.“
„Ja, da wohnt gerade niemand. Das Inseli gehört einem Berner Landvogt, Gatschet heißt er, Niklaus Gatschet. Wohnen Sie in Thun?“
„Ja, nahe beim Scherzliger Tor“, sagte Kleist.
„Dann fragen Sie am besten in Ihrem Haus, der Gatschet ist bekannt. Woher kommt der Herr, wenn ich fragen darf?“
„Aus dem Königreich Preußen, Heinrich von Kleist mein Name.“
„Herr von Kleist, wenn Sie das Häuschen mieten, biete ich Ihnen an, dass meine Tochter Ihnen im Haus zur Hand geht. Sie haben Sie schon gesehen.“
Noch am selben Tag stand Kleist vor dem Haus des Landvogts und gab dem Mädchen seine Karte. Sie bat ihn in die Eingangshalle. Kurz darauf erschien Niklaus Gatschet, ein fünfzigjähriger, korpulenter Mann mit freundlichen, gutmütigen Augen. „Herr von Kleist, was verschafft mir die Ehre?“ Kleist fragte, ob er das Haus auf dem Inseli mieten könne, er habe den Fischer gefragt, der ihn an den Herrn Landvogt verwiesen habe.
Gatschet lachte. „Das Inseli, ja das gehört uns, genauer gesagt meiner Frau. Sie hat die Insel von ihrem Vater geerbt, einem DeLosea. Deshalb heißt sie offiziell die Delosea-Insel.
Das Haus steht zur Zeit leer. Wie lange möchten Sie es haben, Herr von Kleist?“
Kleist vereinbarte eine Mietzeit von sechs Monaten ab März. Der Landvogt fragte ihn noch, was er denn in Thun zu tun gedenke. Kleist erzählte, dass er ursprünglich vorhatte, ein Landgut zu erwerben, um Bauer zu werden. Die politischen Verhältnisse und Turbulenzen hätten ihn aber davon Abstand nehmen lassen. Nun wolle er die schöne Landschaft genießen und wohl auch Muße gewinnen, um sich seiner schriftstellerischen Passion zu widmen.
„Ein Drama habe ich soeben in Thun fertiggestellt, an weiteren Ideen und Projekten möchte ich arbeiten.“
„Vom Bauer zum Schriftsteller, das ist ein weiter Weg, Herr von Kleist.“
„Ich möchte in meinem Leben, dass mir drei Dinge gelingen: ein Kind, ein schön Gedicht und eine große Tat. Vielleicht kann ich die letzten beiden vereinigen.“
Gatschet gab keinen Kommentar ab. Er ging zum Fenster und sah hinaus.
„Und wie gefällt Ihnen Thun, Herr von Kleist, obwohl es ja Winter ist?“
„Die Natur, Herr Landvogt, sieht unter den Schneeflocken aus wie eine 80-jährige Frau, aber man sieht ihr doch an, dass sie in ihrer Jugend schön gewesen sein mag.“ Kleist liebte diese Formulierung, er hatte sie schon in mehreren Briefen angebracht. Sie tat ihre Wirkung auch bei Gatschet, der nun sicher war, einen angehenden Schriftsteller vor sich zu haben.
Sie vereinbarten einen wohlfeilen Mietpreis, Kleist erhielt den Schlüssel und erwähnte das Angebot einer Haushaltshilfe durch die Fischerstochter. Gatschet beglückwünschte ihn: „Das Mädeli ist tüchtig und sehr angenehm im Umgang. Viel Glück und Erfolg, Herr von Kleist.“
6 Dienstag
Menzel parkte seinen Dienstwagen in der Dorotheenstraße, auf der Rückseite des Anton-Tschechow-Theaters. Hier parkte er oft, wenn er eine Aufführung besuchte, es sei denn, er riskierte die Fahrt mit der S-Bahn und nahm ausfallende Züge, gesperrte Teilstrecken und Verspätungen in Kauf.
Im Gegensatz zu seiner Chefin war Menzel häufiger Theaterbesucher. Die Czerny hatte er als Käthchen von Heilbronn gesehen, auch wenn er mit ihrer bedingungslosen Zuneigung nichts anfangen konnte. Er war realistisch genug, solche Gefühle von keiner Frau zu erwarten. Aber die Figur der Czerny war mehr gewesen als ein naives Kleinstadtmädchen, das den strahlenden Ritter bewundert. Sie liebte ernsthaft.
Wie kam sie an die Seite von Dehmel – als Tote?
Menzel ging am Festungsgraben die Treppe hinauf bis zum Vorzimmer und durch die geöffnete Tür. Lässig lehnte die rothaarige Sekretärin in ihrem Stuhl und lachte sympathisch ins Telefon. Er zückte seinen Dienstausweis, sie hob die Augenbrauen und brach das Gespräch ab. „Oh, der Herr Kommissar.“ Sie griff nach dem Ausweis.
„Herr Menzel, richtig?“
„In der Tat, und mit wem habe ich das Vergnügen?“
„Sind Sie zum Flirten gekommen, oder wollen Sie zu Herrn Preuß?“
„Zuerst zu Herrn Preuß, bitte.“
„Gehen Sie nur rein, er erwartet Sie. Bis später dann.“
Aufgeräumt und mit leicht gerötetem Gesicht betrat Menzel das Zimmer des Intendanten und schloss die Tür hinter sich.
„Na, hat Flirte-Dörte bei Ihnen zugeschlagen?“
„Äh, nein, keineswegs, Herr Preuß. Sie wissen, weshalb ich hier bin?“
„Ja, die arme Katharina. Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist so rätselhaft, wie sie auf einmal am Kleistgrab landen konnte. Der Presse habe ich entnommen, dass es kein Doppelselbstmord gewesen sein soll?“
„Wir haben begründete Zweifel. Können Sie mir sagen, ob Sie von einer Verbindung Frau Czernys mit Herrn Dehmel wissen?“
Der Intendant legte sein Gesicht in Falten.
„Also von einer Verbindung weiß ich nichts, aber sie kannten sich zweifellos.“
„Würden Sie mir diese Bekanntschaft beschreiben? Seit wann kannten sie sich?“
„Nun, es war, wenn ich mich recht erinnere, bei der Premierenfeier zum „Käthchen“. Wir saßen alle in der Kantine, das Team, Presseleute, ein paar VIPs und auch Dehmel vom KGB. Von der Kleist-Gesellschaft-Berlin“, ergänzte Preuß schmunzelnd, als er das verblüffte Gesicht Menzels sah.
„Dehmel war ja Spezialist für die Dramen Kleists. So ließ er sich die Premiere des „Käthchens“ natürlich nicht entgehen. Ja, und dann sah ich ihn neben Katharina sitzen und angeregt mit ihr plaudern.“
„Das war alles?“
„Nicht ganz. Später verlagerte sich die Feier auch nach draußen. Und da saßen sie dann plötzlich alleine und dicht beieinander.“
„Wie ging das weiter?“
„Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß nur von der Premierenfeier.“
„Was wissen Sie über das Privatleben von Frau Czerny?“
„Herr Kommissar, ich bin Intendant und kein Beichtvater. Was meine Schauspieler privat machen, interessiert mich nicht. Sie sollen spielen und ein gutes Team bilden. Katharina war keine Diva. Sie war beliebt, selbstbewusst und konnte Menschen für sich einnehmen.“
„Also keine Feinde oder Rivalinnen?“
„Nein, wir hatten keine Kampfbesetzungen in der letzten Zeit.“
Menzel spürte, dass Preuß ihm nicht mehr sagen konnte oder wollte. Aber er gab noch nicht auf.
„Gibt es denn jemand, der sie näher kannte oder häufig mit ihr gespielt hat, sodass er vielleicht mehr weiß?“
Der Intendant breitete theatralisch die Arme aus.
„Aus der letzten Zeit fällt mir als Erster natürlich der Graf ein.“
„Graf Wetter vom Strahl – wer hat den noch einmal gespielt?“
„Ein Connaisseur, sieh an! Das ist Heiko Harmsen. Moment, der müsste im Augenblick beim Proben sein.“
Er ging zur Tür: „Dörte, kannst du mal anrufen, ob Heiko eben hochkommen kann? - Wollen Sie solange etwas trinken, Herr Kommissar?“
„Ja gerne, einen Kaffee.“
„Und mach doch dem netten Kommissar einen Kaffee, Dörte, aber nicht zu heiß!“
Kuez darauf kam die Sekretärin mit dem Kaffee und kündigte den Schauspieler an, der gerade Pause hatte. Sie schüttelte ihre rote Mähne und lächelte Menzel zu. Der dachte schon an später, wie er sie um eine Verabredung bitten könnte.
Ein feingliedriger, großgewachsener Mann betrat das Zimmer. Er hatte lange, blonde Haare, die ihm in die Stirn fielen und von der Probe noch schweißnass waren. Zwei energische Falten von den Mundwinkeln zur Nase prägten sein Gesicht. Seine klaren Augen blickten fragend.
„Heiko, der Kommissar untersucht den Tod von Katharina und wollte dich etwas fragen. Setz dich doch.“
„Bitte, was kann ich für Sie tun?“
„Herr Harmsen, Herr Preuß hat mir von der Premierenfeier berichtet, dass sich dort Frau Czerny und Herr Dehmel kennengelernt hätten.“
„Ob sie sich dort kennengelernt haben, weiß ich nicht. Aber sie sprachen sehr intensiv miteinander an diesem Abend.“
„Was heißt sehr intensiv? Haben sie diskutiert, geplaudert, geflirtet oder gar mehr?“
„Ich habe ja nicht zugehört, aber das war schon mehr als plaudern, dazu waren sie zu dicht aneinander.“
„Haben Sie die beiden auch später noch einmal zusammen gesehen?“
„Doch, ja, manchmal nach Vorstellungen saßen die beiden in der Kantine oder im Garten.“
Menzel versuchte einen Überraschungsangriff, da das Gespräch auch mit dem Schauspieler recht vage blieb.
„Herr Harmsen, waren Sie eifersüchtig auf Herrn Dehmel?“
Harmsen schaute Menzel verdutzt an. Wollte er Zeit gewinnen? Dann prustete er laut los.
„Ich? Eifersüchtig? Wegen Dehmel? Nein!“
„Warum ist das so abwegig? Frau Czerny war ja nun durchaus nicht unansehnlich und wie mir Herr Preuß gesagt hat, auch kooperativ und beliebt.“
Der Intendant schaltete sich ein, da sich Menzel zu blamieren drohte.
„Herr Kommissar, schalten Sie mal Ihre Menschenkenntnis ein. Es gibt ja Gründe, dass eine attraktive Frau nicht zur Eifersucht Anlass gibt.“
Menzel machte ein ratloses Gesicht.
„Nun, Herr Kommissar, Sie wissen sicher, dass es Menschen mit unterschiedlicher geschlechtlicher Orientierung gibt.“
Menzel lief rot an und machte sich zum Rückzug bereit.
„Entschuldigen Sie bitte und vielen Dank für die Auskünfte.“ Er wandte sich zum Gehen und verließ schnell das Theater, ohne sich noch um die rothaarige Sekretärin zu kümmern. Aber das Eifersuchtsmotiv war keineswegs aus dem Rennen, wenn auch der Spielpartner von der Czerny erst einmal ausschied. Und was hieß schon ausschied. Wer weiß, was ihm diese Schauspieler vorgeflunkert hatten. Harmsen homosexuell? Ob das auch stimmte?
7 Dienstag
Beate genoss den Vormittag zu Hause. Benni war in der Schule. Die Kollegen im Amt hatten Bereitschaft. Um 11 Uhr sollte sie in der Kleistgesellschaft sein, um mehr über Richard Dehmel zu erfahren. Versonnen blickte sie über die Vorgärten in der Eythstraße. Gerne hätte sie wieder in einem eigenen Garten gepflanzt und gegraben. Aber das eigene Haus und der Garten waren Vergangenheit. Seit sechs Jahren wohnte sie mit Benni in der Mietwohnung, nachdem sie seinen Vater verlassen hatte. Dessen ständige Beziehungen zu jüngeren Frauen, die er geheim zu halten versuchte, wollte sie irgendwann nicht mehr erdulden. Seitdem fürchtete sie das Verlassenwerden und ließ sich nicht auf eine Beziehung ein. Selten landete ein Mann in ihrem Bett, den sie aber auf Abstand zu halten wusste oder gleich wieder ausbootete.
Sie lief zum S-Bahnhof Priesterweg, vorbei an der ausgedehnten Schrebergartenkolonie. So viel Zeit, um ein Koloniegärtchen zu bewirtschaften, würde sie nie haben. Um in die Georgenstraße zu kommen, war die S-Bahn bequemer als das Auto. Sie konnte mit zwei Linien direkt zur Friedrichstraße fahren. Die S2 kam, nach einer Weile tauchte sie in den Tunnel und hielt wenig später in der Friedrichstraße. Wer von den Fahrgästen hatte noch Erinnerungen an den ehemaligen Kontrollpunkt? Längst hatten die Imbissläden den Bahnhof erobert und der frühere Tränenpalast bildete sich langsam zum Museum zurück. Beate fröstelte immer ein wenig, wenn sie durch den Bahnhof ging, als ob sie der Wirklichkeit nicht traute und jeden Augenblick ein graugrün Uniformierter hinter einer Säule hervorkommen könnte.
Beate lief an der S-Bahn entlang in Richtung Kupfergraben, bis sie das Gebäude erreichte, in dem die Kleistgesellschaft untergebracht war. Das Anton-Tschechow-Theater war nur einen Steinwurf entfernt.
Am Empfang zeigte sie ihren Dienstausweis. Die fünfzigjährige, stark geschminkte Sekretärin seufzte: „Schrecklich, die Geschichte mit Herrn Dehmel. Ja, Herr von Bramstedt erwartet Sie im zweiten Stock.“
Beate fuhr mit dem Fahrstuhl und trat in das Büro des Vorsitzenden. Der groß gewachsene Sechzigjährige mit kunstvoll gewellten grauen Haaren ging auf sie zu:
„Frau Kommissarin, ich begrüße Sie und bedaure den Anlass zutiefst. Die Anrede ist korrekt?“
„Nicht ganz, aber das geht schon in Ordnung“, lenkte Beate ab. „Erzählen Sie mir etwas von Herrn Dehmel. Womit hat er sich beschäftigt, was war seine Rolle hier in der Kleistgesellschaft?“
„Wie Sie sicher schon herausgefunden haben, Frau äh, Hauptkommissarin? - , war er mein Stellvertreter und gehörte zum engeren Kreis des Vorstands.“
Beate nahm den Ablenkungsversuch des Herrn von Bramstedt zur Kenntnis und ermahnte sich, nicht darauf einzugehen.
„Die Tätigkeit in einer Gesellschaft wie der unseren bietet nicht sehr viel Nahrung für Eitelkeit und Konkurrenzgebaren. Wir ernten keine Lorbeeren für unseren Dienst an Kleist. Insofern sind wir alle gleichberechtigte Diener und Beförderer einer Sache.“
„Und was hat Herr Dehmel befördert?“
Der Vorsitzende hob die buschigen grauen Augenbrauen.
„Herr Dehmel hat sich besonders um die Dramen Kleists bemüht, das war sein Forschungsschwerpunkt.“
„Hat er in der letzten Zeit an etwas Besonderem gearbeitet oder eine bestimmte Publikation vorbereitet?“
„In der Tat, Frau Kommissarin. Ich weiß nicht, inwieweit Sie über die dramatischen Arbeiten Kleists....“
„Gehen Sie am besten vom Stand der Unschuld aus“, versuchte Beate zu scherzen.
„Also noch Jungfrau, was Kleist angeht“, setzte Bramstedt noch eins drauf und fand seinen Witz überaus köstlich. „Dehmel kümmerte sich in letzter Zeit vor allem um eine Tragödie, die nur als Fragment überliefert ist: „Robert Guiskard“.
„Und wer war das?“
„Robert Guiskard war der Herzog der Normannen, die ja am Anfang des zweiten Jahrtausends in Sizilien herrschten. Er wollte Konstantinopel erobern und belagerte die Stadt.“
„Eine Tragödie geht immer schlecht aus...“
„Ja, ja, am Schluss liegen alle tot auf der Bühne“, lachte der Vorsitzende. „Aber da das Ende nicht erhalten ist, wissen wir nicht, ob er auch an der Pest starb, die im Lager der Normannen grassierte.“
„Und weshalb blieb der Text Fragment?“
„Nun, das ist eine komplizierte Geschichte. Kleist selbst hat jedenfalls erklärt, er habe das Manuskript verbrannt und hat später nur einige Szenen in einer Zeitschrift veröffentlicht.“
„Einen Zusammenhang mit der Inszenierung am Kleistgrab sehen Sie nicht?“
Von Bramstedt sah Beate verwundert an.
„Das ist eine ganz andere Geschichte, das Ende mit Henriette Vogel. Nein, ich sehe zu seiner Arbeit keinen Zusammenhang. Und offen gestanden kenne ich auch die Frau nicht, die bei ihm gefunden wurde. Wie hieß sie noch gleich?“
„Czerny, Katharina Czerny.“
„Ja, doch, gewiss, die Schauspielerin von gegenüber. Ich habe sie als Käthchen leider nicht gesehen. Tja, es sieht ja alles nach einer Eifersuchtsgeschichte aus, nicht wahr?“
„Oder es soll so aussehen.“
„Frau Hauptkommissarin, Sie erstaunen mich. Aber so hinterhältig müssen Kriminalbeamte wohl denken. Sie wollen sich also mit dem Eifersuchtsmotiv nicht zufriedengeben?“
„Es ist ein nahe liegendes Motiv, aber nicht das einzige oder wichtigste. Deshalb ermitteln wir ja.“
„Sehr gut, sehr gut, ich bin beeindruckt. Nun, Frau Hauptkommissarin, kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein?“
„Ich würde gerne einen Eindruck von den Räumlichkeiten der Kleistgesellschaft gewinnen und vor allem vom Zimmer oder vom Schreibtisch des Herrn Dehmel.“
„Oh, da muss ich Sie enttäuschen. Dehmel hat zwar eine kleine Präsenzbibliothek bei uns, aber geschrieben hat er nur auf seinem Notebook. Und das hat er immer mit nach Hause genommen. Aber ich zeige Ihnen gern die Bibliothek, vielleicht treffen Sie ja noch einige Mitglieder. Ich glaube, Herr Wolters müsste noch da sein, der kannte Dehmel wohl am besten.“
Sie gingen eine Etage hinunter, durch einen Saal, in dem etwa sechzig Plätze für kleinere Veranstaltungen waren, in die Bibliothek. Als von Bramstedt die Tür öffnete, schlüpfte ein etwa 40-jähriger Mann hastig in sein Jackett, als hätte er die beiden kommen hören, und signalisierte Aufbruch.
„Herr Wolters, haben Sie einen Augenblick, hier ist Frau....“
„Tut mir leid, ich habe einen Termin in der Universität, ich muss jetzt gleich....“
Beate versuchte zu lächeln: „Herr Wolters, nur zwei Minuten fürs erste. Können Sie mir etwas sagen über die letzten Arbeiten von Herrn Dehmel? Wenn es länger dauert, mache ich gerne einen Termin mit Ihnen.“
Thorsten Wolters atmete scharf ein und runzelte die Stirn. „Nein, nein, das muss nicht dauern. Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Richard hat über „Guiskard“ mit niemandem geredet. Ich weiß, dass er daran gearbeitet hat, mehr auch nicht.“
„Und privat kannten Sie ihn auch nicht genauer?“, versuchte es Beate.
„Nein, tut mir leid, wir hatten privat nichts miteinander zu tun. Sie entschuldigen mich jetzt.“ Eilig verließ Wolters den Raum.
„Tja, weg ist er“, kommentierte von Bramstedt, „ich habe noch einige Telefonate zu erledigen. Vielleicht wollen Sie sich noch umsehen. Da drüben sitzt auch Herr Beauchamps, wenn Sie mit jemand reden möchten.“
Der Vorsitzende verabschiedete sich und ließ Beate alleine.
In der Bibliothek standen einige Tische, aber auch bequeme Sessel. In einem saß ein fünfzigjähriger, schlanker Mann mit randloser Brille. Er trug Jeans und ein weißes Baumwollhemd mit hochgekrempelten Armen. Am Hals trug er eine hellbraune Halskrause. Neben ihm lehnten zwei Krücken. Er hatte die Szene beobachtet und lächelte amüsiert. Beate fand ihn sympathisch. Sie ging auf ihn zu.
„Guten Tag, ich bin Beate Lehndorf.“
„Von der Mordkommission. Danke.“
„Wofür danke?“
„Dass Sie mir Ihren Namen verraten. Sie hätten ja auch amtlich bleiben können: 'Hauptkommissarin Lehndorrf vom Landeskrriminalamt und werrr sind Sie?'“, schnarrte der Mann satirisch.
„Und wer sind Sie?“, gab Beate zurück und dachte, dass dies heute der erste Mann sei, der Humor hatte.
„René Beauchamps“, sagte der Mann, „und bevor Sie sich wundern, ich bin kein Franzose, sondern ein Spross Berliner Hugenotten.“
Beate blickte zu den Krücken und wunderte sich über ihre Direktheit: „Und die hier? Krankheit oder Unfall?“
„Verkehrsunfall, ein betrunkener Autofahrer hat mich vor zwei Monaten gerammt. Neues Hüftgelenk, Beine gebrochen, Schleudertrauma. Deshalb habe ich noch Zeit, um mich einem Hobby zu widmen.“
„Sie sind also kein Literaturwissenschaftler?“
„Nein, nein. Ich bin Psychiater. Es dauert noch etwas, bis die Schmerzen wieder erträglich sind und ich voll arbeiten kann. Kleist interessiert mich seit meiner Jugend.“
Beate hatte sich in den benachbarten Sessel gesetzt, ohne an die Privatheit dieser Geste zu denken. „Und gibt es etwas, womit Sie sich im Augenblick besonders beschäftigen?“
„