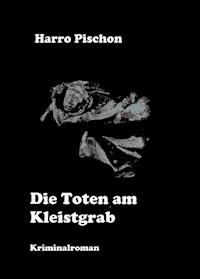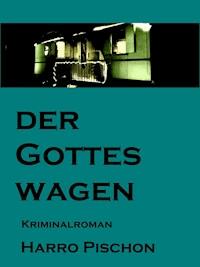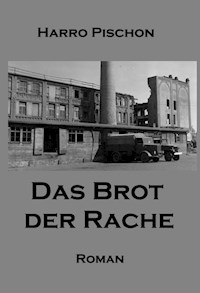
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Jahren 1945 und 1946 zieht die Stadt Nürnberg Menschen aus ganz Europa an: In einem Internierungslager der US-Army für SS-Angehörige warten mehr als 10.000 Männer von überall her auf ihre Untersuchung. Aus Italien, aus Litauen und Polen kommen jüdische Partisanen, KZ-Häftlinge, Angehörige der Jewish Brigade Group, die zu der Gruppe NAKAM (d.h. Rache) gehören. Sie wollen die Deutschen büßen lassen für den Holocaust, für den Tod von sechs Millionen Juden. Es gibt zwei Pläne, einen Plan A (Tochnit Aleph) und Plan B (Tochnit Bet), von denen nur der letztere zur Ausführung kommt: das Vergiften des Brots für das Lager in Nürnberg-Langwasser. Der Roman bewegt sich in fünf Erzählsträngen auf das Ereignis im April 1946 zu: Der Weg eines Kriegsheimkehrers von Kroatien nach Nürnberg, die Arbeit eines Nürnberger Kommissars, die Odysse eines Wilnaer Ghettobewohners durch deutsche Konzentrationslager, die Entwicklung eines jüdischen Partisanen bis zum Gründer und Leiter der Gruppe NAKAM und schließlich die Tätigkeit der Rächergruppe in Nürnberg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Brot
der Rache
Selbst, wenn man alle Dokumente studieren würde, wenn man sich alle Berichte anhörte, alle Lager und Museen besuchen und alle Tagebücher lesen würde, käme man nicht einmal in die Nähe jenes Tors zur ewigen Nacht. Das ist die Tragik, die der Überlebende erkennt.
Er muss eine Geschichte erzählen, die nicht erzählt werden kann. Er muss eine Botschaft überbringen, die nicht überbracht werden kann…
In diesem Sinne hat der Feind (ironischerweise) sein Ziel erreicht. Da er das Verbrechen über alle Grenzen hinweg ausweitete und da es keine Möglichkeit gibt, diese Grenzen anders als durch Sprache zu überschreiten, ist es unmöglich, die ganze Wahrheit über seine Verbrechen mitzuteilen.
Elie Wiesel: Fragen, die unbeantwortet bleiben, zit. nach Tom Segev, S. 216
Weh über uns! Wir Jidden können auch, wir können, ach!
Wir können widerstehn und töten auch! Wir auch! Auch wir!
Wir können aber etwas, was ihr Deutschen nie
Und nimmer fertig bringt auf dieser Erd:
Den Nächsten leben lassen. Ihr? Ihr schlachtet hin ein Volk
Das wehrlos seine Blicke hoch zum Himmel schickt. Ach ihr
Das könnt ihr eben nicht: NICHT morden.
Aus: Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
ABBAS BERICHT
1
Exkurs über Franz Murer
2 Abbas Bericht – Fortsetzung
LEBKES WEG
1
DIE RÜCKKEHR
1
2
3
DER KOMMISSAR
1
2
ABBAS BERICHT 3
4
5
LEBKES ERZÄHLUNG
DER KOMMISSAR 3
4
WALTERS RÜCKKEHR 4
5
6
7
ABBAS BERICHT 6
7
LEBKE 3
Zwischen Himmel und Hölle
WALTERS RÜCKKEHR 8
DER KOMMISSAR 5
6
7
8
9
10
LEBKE 4
Der letzte Kreis der Hölle
Exkurs über Erwin Dold
ABBAS BERICHT 7
WALTERS RÜCKKEHR 9
10
11
12
DER KOMMISSAR 11
WALTERS RÜCKKEHR 13
14
DER KOMMISSAR 12
13
14
15
16
17
18
19
ABBAS BERICHT 8
9
DIE RÄCHER
1
2
3
4
TOCHNIT BET
Die Rächer
Der Kommissar
1
2 Bericht eines Nachtwächters am Schleifweg
Im Lager
DER VERRÄTER
NACHWORT
Vorwort
Dies ist ein Roman, eine Fiktion. Aber der übliche Passus, dass sowohl die Handlung als auch die handelnden Personen frei erfunden sind, trifft hier nur zum Teil zu.
Etliche Orte und Ereignisse sind historisch, auch damit verknüpfte Personen. Im Mittelpunkt steht der Anschlag einer jüdischen Rächergruppe – NAKAM – auf ein amerikanisches Internierungslager für SS-Leute und höhere NS-Chargen in Nürnberg, im heutigen Ortsteil Langwasser. Dieser Anschlag fand am 14. April 1946 statt, indem Brote mit Arsenik vergiftet wurden. Danach erkrankte eine große Zahl von internierten Deutschen. Sie wurden in Militärkrankenhäusern behandelt. Aber hier beginnt auch schon die Fiktion auszufransen, denn ob es Todesopfer gab und wenn ja wie viele, ist nicht mit Gewissheit zu sagen. Die Rächer lebten jahrzehntelang in dem Glauben, sie hätten mit ihrer Aktion „Erfolg“ gehabt. Vieles spricht dagegen.
Es gab auch neben diesem Plan B (Tochnit Bet) den Plan A (Tochnit Alef), der ganze Großstädte ausrotten sollte, um den Holocaust zu rächen, der ebenso wenig wie der Massenmord an Juden auf Individuen, auf Personen Rücksicht genommen hatte. Plan A wurde nirgends realisiert.
Es gab auch als einen Ursprungsort die Stadt Wilna im heutigen Litauen (heute Vilnius), das jüdische Ghetto, den Gebietskommandeur der SS Franz Murer und die Todesstätte Ponary, in der zehntausende Juden ermordet wurden. Und es gab die jüdischen Widerstandskämpfer und Partisanen, die zionistische Jugendorganisation haschomerhazair,deren einer Führer Abba Kovner war, der spätere Gründer und Leiter der Nakam-Gruppe. Es gab auch die Konzentrationslager, in denen Betriebe Häftlinge als Zwangsarbeiter von der SS „bezogen“, wie zum Beispiel Stutthof bei Danzig oder eines der kleineren Lager in Württemberg, wo die „Operation Wüste“ stattfand, der Abbau von Ölschiefer, um noch Treibstoff zu gewinnen. Es gab auch den Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg, der am 20. November 1945 begann, es gab eine Jewish Brigade Group in Norditalien, jüdische Soldaten in britischen Uniformen, wobei hier schon wieder die einen das Hauptquartier in Tarvisio ansiedeln, die anderen im nahegelegenen Pontebba. Es gab auch die bricha, eine Organisation, unterstützt von der Brigade und von der Jewish Agency, der Vertretung der Juden in Palästina, die versuchte, Juden nach Palästina zu bringen.
Alles das gab es, wenn auch nicht jedes Wo oder Wie authentisch und verbürgt ist. Wie so oft leben solche Ereignisse durch die Geschichten, die darüber erzählt wurden. Auch die Aktion des vergifteten Brots ist in vielen Geschichten und Büchern erzählt. Dieser Roman konnte nur geschrieben werden, weil schon Geschichten existieren, er versucht nicht wie andere vor ihm, allen Personen, so weit sie historisch sind, andere Namen zu geben. Aber jeder weiß, der einmal über Nakam gelesen hat, wer Abba Kovner war, dass er es war, von dem der Ausspruch überliefert ist, dass die Juden sich nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen und dass er am Ende des Krieges und nach dem Ende vom Gedanken an Rache besessen war. Auch der Kommandeur der Nürnberger Nakam-Gruppe, Joseph Harmatz, behält seinen Namen. Er hat in seinen Erinnerungen („From The Wings“) seine eigene Geschichte erzählt, von der etliche Geschichtenerzähler mehr oder weniger profitiert haben. Ein Mitglied der Nürnberger Gruppe hat seinen Vornamen Lebke (Levke, Leipke) behalten, nicht aber seinen Familiennamen. Zwar ist der wirkliche Lebke inzwischen gestorben, aber seinen Namen möchte ich schützen. Auch sein Leidensweg durch deutsche Lager ist frei erzählt. Immerhin wurde ihm die zweifelhafte Ehre zuteil, noch im Jahr 2000 vom Oberlandesgericht in Nürnberg angeklagt zu werden. Die Anklage wurde später fallen gelassen, wegen Verjährung und der besonderen Umstände. Aber er wurde durch ein Buch von zwei Nürnbergern dem Vergessen entrissen und rief damit die Justiz auf den Plan. Auch die zwielichtige Figur des Verräters ist authentisch, wiewohl der Umfang seiner Taten zweifelhaft ist. Auch er hat einen anderen Namen im Roman, weil die Fiktion keinen Anspruch auf historische Wahrheit erhebt.
Andere Figuren wie der Nürnberger Kommissar haben einen Platz in der wirklichen Geschichte, sind aber tatsächlich völlig frei erfunden, ebenso wie der zum SD gezogene kleine Soldat Walter Grund, der sich nach Beendigung des Krieges absetzt und von Kroatien nach Deutschland alleine zurückmarschiert, um in Nürnberg in eben dem Internierungslager zu landen.
Andere Personen wiederum, die nur kleinere Rollen spielen, aber in dem Geflecht von Rache, Unrecht und der Suche nach Menschlichkeit eine Stimme haben, haben wirklich gelebt und gehandelt. So der unfreiwillige Lagerkommandant Erwin Dold oder der auch von Harmatz genannte Ludwig Wörl. Es gibt in dieser Geschichte noch andere Einzelne, die menschlich, oft tapfer bis zur Selbstverleugnung geblieben sind, inmitten des Grauens. Sie sind es wert in Erinnerung behalten zu werden, so wie Unmenschen wie Franz Murer nicht in Vergessenheit geraten dürfen.
Dies ist ein Roman, eine Fiktion auf den Schultern anderer Geschichten, dabei neue Geschichten erzählend, mit den bekannten verwebend, abwägend, wenn es gelingt, nachdenkend über das Unglück, das Menschen aus unserem Land, unserer Kultur über jüdische Menschen gebracht haben, über unerträgliche Grausamkeiten, über die Gegenwehr, den Widerstand und über die Antwort der Rache. Der programmatische Buchtitel des „Nazijägers“ Simon Wiesenthal lautet: „Recht, nicht Rache“. Aber er muss in seinem Buch oft erkennen, dass das Recht nicht immer auf der Seite der Opfer steht.
Erzählen ist Erinnern. Manès Sperber wollte „nur ein Erinnerer sein“. Wie Siegfried Lenz in seiner Laudatio für Sperber sagte, ist Erinnern immer auch Auflehnung gegen das Vergessen, gegen die Gleichmütigkeit der Geschichte, die über alles hinweggeht. Erinnern ist auch eine besondere Form der Liebe zu denen, deren Opfer vergeblich war, die stimmlos geblieben sind. Erinnern ist dazu das Bewahren von mutigen Menschen in schwierigen Zeiten, von solchen, denen die Menschlichkeit oft sogar mehr galt als das eigene Leben. Und Erinnern ist der Schmerz beim Erkennen von Irrtümern, der heilsame Schmerz.
Außer Joseph Harmatz hat keiner der Rächer etwas veröffentlicht über seine oder ihre Erlebnisse, Motive, Zweifel. Selbst die mündlich mitgeteilten Erinnerungen sind nicht verlässlich. Alles, was wir haben, sind Geschichten - so wie diese.
ABBAS BERICHT
1
Wilna, du friedliche Insel inmitten des Krieges, zwischen Russen und Deutschen, du „Jerusalem Litauens“, wie dich Napoleon 1815 genannt hat. 200 000 Menschen leben 1939 in deinen Mauern, ein Drittel davon Juden. Es gibt viele Fraktionen: die Zionisten, die Kommunisten, die Bundisten, die Orthodoxen und die Assilmilierten, die Litauer oder Polen sein wollten. Alle misstrauen sich gegenseitig, haben ihre eigenen Regeln und Rituale. Am 15. Juni 1940 marschieren die Russen in Wilna ein. Sie brauchen nur einzumarschieren, niemand wehrt sich. Sie lösen die Regierung auf, besetzen die Rundfunkstationen und – sie verbieten die zionistischen Jugendorganisationen, meine „Junge Garde“ und die „Betar“. Wir tauchen unter und treffen uns in Kellern. Es gibt heftige Diskussionen: Stalin befiehlt allen Flüchtlingen, die sowjetische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Wenn Juden sowjetische Staatsbürger werden, sind sie keine Flüchtlinge mehr, haben auch keinen Anspruch auf Ausreisepapiere nach Palästina. Sind sie keine Staatsbürger, können sie jederzeit vom NKWD verhaftet werden. Die meisten von uns lehnen die Staatsbürgerschaft ab und vertrauen auf ihr Glück. Danach werden Dutzende von Juden verhaftet, verurteilt und nach Sibirien abgeschoben, so auch der Betar-Führer Menachem Begin.
Im Juni 1941 greifen die Deutschen die Sowjetunion an, noch mehr Flüchtlinge suchen in der Stadt Zuflucht, verstopfen die Straßen nach Osten. Die Wehrmacht besetzt kurz darauf Wilna.
Anfang September 1941 räumen die Deutschen das alte Ghetto, verhaften jeden Juden, den sie erwischen und bringen sie in den nahe gelegenen Wald nach Ponar. Das Ghetto wird für seine neuen Bewohner vorbereitet, für dreißigtausend Juden statt tausend.
Verantwortlicher für das Ghetto ist ein SS-Offizier, der Standartenführer Franz Murer, ein fanatischer Antisemit. Er lässt die jüdischen Ghettobewohner arbeiten, sie sollen Munition oder auch Kleidungsstücke herstellen, Mützen, Mäntel, Stiefel. Der Winter steht bevor. Am Eingang zum Ghetto gibt es strenge Kontrollen, damit keine Lebensmittel oder andere Gegenstände ins Ghetto gebracht werden. Oft übernimmt Murer selbst die Durchsuchung und beteiligt sich an den Prügelstrafen, wird etwas gefunden. Seine Befehle werden von der litauischen Polizei, von der SS und den Einsatzgruppen ausgeführt.
Murer ernennt einen Judenrat, die für Ordnung sorgen soll und eine Art Selbstverwaltung darstellt. Außerdem gründet er auch eine jüdische Polizei und macht Jakob Gens zum Polizeichef. Gens diente in der litauischen Armee und verkehrte in den höchsten Kreisen. Er hätte nicht ins Ghetto gehen müssen, hätte nur seinen Namen ändern müssen, aber er ging freiwillig. Etliche junge Juden meldeten sich zum Polizeidienst, darunter auch eine Reihe von Mitgliedern der Jungen Garde. Sie sahen ihre Aufgabe darin, das Überleben der Juden durch Kleidung und Nahrung zu gewährleisten, bis der Krieg vorbei war. Ich glaubte nie an diese Form des gewaltlosen Widerstands, so wie sich die Deutschen gebärdeten.
Am 23. Oktober 1941 gehen die Arbeiter wie immer außerhalb des Ghettos arbeiten. Die zurückgebliebenen Familien sollen sich im Hof des Judenrats einfinden. Dann stürmen litauische Soldaten das Ghetto, schleifen jeden aus den Häusern, den sie erwischen. Am Ende des Tages werden sie viertausend Juden getötet oder verschleppt haben. Es war eine durchsichtige Aktion mit dem Ziel, Unfrieden zu stiften zwischen den Privilegierten mit Arbeitsscheinen und denen, die keine hatten.
Diese Aktionen wiederholen sich in der kommenden Zeit mehrfach, immer werden neue Arbeitsscheine verteilt, immer werden die Straßen und Häuser gestürmt und untersucht. Angeblich wurden die Bewohner „in den Osten umgesiedelt“. Es tauchen sogar Briefe mit estnischen oder weißrussischen Marken auf, die kurze beruhigende Botschaften enthalten. Wir sehen das als Fälschungen an. Einige von der Jungen Garde, die sich dafür eignen, sind auch Kuriere außerhalb des Ghettos, wie Lebke, der zufällig über das Aussehen eines blonden, kräftigen Deutschen verfügt und, wie er uns grinsend offenbart, noch nicht einmal beschnitten ist, weil er als Frühgeburt zu schwach war.
Ich bin seit November in einem Kloster außerhalb der Stadt untergetaucht, zusammen mit sieben weiteren Zionisten. Wenn wir draußen auf den Feldern arbeiten, tragen wir Nonnentracht.
Eine junge Jüdin besucht mich im Kloster und erzählt von einem Mädchen, das Massenerschießungen im Wald außerhalb von Wilna beobachtet und erlebt hat. Gens hat sie zum Schweigen verdonnert. Wir gehen ins Ghetto zum Krankenhaus und bitten das Mädchen Sara zu
erzählen.Lastwagen haben sie in den Wald gebracht. Auf einer Lichtung standen etwa 100 Menschen, sie wurden in Zehnergruppen aufgeteilt. Soldaten holten jeweils eine Gruppe, führten sie in den Wald, dann hörte man Schüsse. Als Saras Gruppe an der Reihe war, mussten sie ihre Kleider ausziehen und auf einen Haufen legen. Dann standen sie vor einer Grube mit leblosen Körpern. Die Russen hatten diese Gruben für Treibstofftanks ausgehoben. Dann kam der Befehl: „Auf die Knie!“, und es wurde geschossen. Sara wurde am Arm getroffen und wachte später auf, zwischen lauter Leichen. Sie wartete noch stundenlang, bis das Gegröle der litauischen und deutschen Soldaten aufhörte. Dann kroch sie über Gesichter, Arme und Körper von Leichen, zog sich aus der Grube, versteckte sich im Wald und schleppte sich endlich nach Wilna.
Exkurs über Franz Murer
1947 wird Franz Murer, der ehemalige stellvertretende Gebietskommissar von Wilna, auf seinem Hof in Admont in der Steiermark von den Engländern verhaftet. Sie liefern ihn an die Russen aus, auf deren Gebiet Wilna liegt. In der Sowjetunion wird er 1949 wegen „Mordes an sowjetischen Bürgern“ zu 25 Jahren Kerker verurteilt.
1955 verpflichtet sich die UdSSR im Rahmen des Staatsvertrages, alle Kriegsgefangenen nach Hause zu schicken. Dazu gehören auch Strafgefangene wie Franz Murer, wobei die Republik Österreich allerdings zugesagt hatte, solche Personen vor österreichische Gerichte zu stellen.
Der Heimkehrer zog sich auf seinen Hof zurück und wurde ein angesehenes Mitglied der ÖVP.
Simon Wiesenthal war der Meinung, es sei unerträglich, dass ein Mörder nach nur sieben Jahren Haft wieder in Freiheit sei. Die Justizbehörden erklärten Wiesenthal, russische Gefängnisse seien dreimal so hart wie österreichische, mithin habe Murer schon 21 Jahre abgebüßt. Neu verhandelt würde gegen Murer nur, wenn neue Tatbestände zutage kämen. Wiesenthal bot in der Folge siebzehn Zeugen für persönliche Morde Murers auf. Das Justizministerium reagierte nicht, Jahre hindurch, auch nicht auf zahlreiche in- und ausländische Eingaben. Wiesenthal tat das, was ihm immer wieder als „Nestbeschmutzung“ ausgelegt worden ist: Er ging an die Öffentlichkeit.
1963 geruhte die Justiz, einen Prozess gegen Franz Murer vor dem Grazer Geschworenengericht anzusetzen. Am vierten Prozesstag saßen Wiesenthal und der Zeuge Jakob Brodi zusammen im Grazer Hotel Sonne. Brodi war Zeuge für den Mord Murers an seinem Sohn David. In Wilna hatte die SS vor den Toren des Ghettos zwei Gruppen gebildet. In einer waren die Arbeitsfähigen, darunter Josef Brodi, in der anderen sein Sohn David. Sie waren für den Transport nach Ponary bestimmt. Während die beiden Gruppen noch warteten, versuchte der siebenjährige David zu seinem Vater hinüberzuschleichen. Ein Deutscher entdeckt und erschießt den Jungen. Auf Bildern hatte Jakob Brodi zweifelsfrei Franz Murer als Schützen erkannt.
Brodi sagte jetzt zu Wiesenthal: „Ich höre, dass Murers Söhne und seine Frau in der ersten Reihe sitzen und sich über die Zeugen lustig machen.“ Wiesenthal nickte.
„Ihnen wird das Spotten vergehen, wenn ich in den Zeugenstand gerufen werde. Ich bin nicht hergekommen, um auszusagen, sondern um zu handeln.“ Er öffnete seine Weste und packte den Griff eines im Hosenbund versteckten Messers. „Murer hat vor meinen Augen mein Kind getötet. Jetzt werde ich ihn vor den Augen seiner Familie töten. Aug um Auge!“
Wiesenthal brauchte aber die Zeugenaussage. „Wir können unser Ziel nicht erreichen, wenn wir Rache und Vergeltung zulassen. Wenn Sie Murer töten, sind Sie selbst ein Mörder!“
Dann dachte Wiesenthal an seine Tochter und sagte mühsam: „Ich habe auch geweint, Herr Brodi, als ich von Ihrem Jungen gelesen habe.“
Jakob Brodi legte das Messer auf einen Sessel und weinte. Am nächsten Tag las er mit tonloser Stimme seine Aussage vor.
Ein paar Tage später fällten die Geschworenen ihr Urteil: „Nicht schuldig“.
Unter Hochrufen, von einem Blumenmeer empfangen, verließ Franz Murer das Gerichtsgebäude. Ein weiteres Verfahren hat nicht stattgefunden, trotz Aufhebung des Freispruchs durch den Obersten Gerichtshof.
Franz Murer wurde 82 Jahre alt. Als er 1994 starb, wohnte er komfortabel in Gaishorn am See in der Obersteiermark. Zuletzt war er Bezirksbauernvertreter der ÖVP.
2 Abbas Bericht - Fortsetzung
Einige Tage später berufe ich ein Treffen der Jungen Garde ein. Wir sind etwa zwölf Männer und Frauen in einem Keller. Ich zittere vor Zorn und rede:
„Man hat unsere Lieben in den Tod geschickt. Wir müssen der hässlichen Wahrheit ins Gesicht sehen – man hat unsere Freunde nicht nur deportiert. Und doch wollen viele die Wahrheit noch nicht glauben. Was ist die Wahrheit? Dass unsere Freunde, unsere Verwandten, die man angeblich deportiert hat, nicht mehr am Leben sind. Man brachte sie nach Ponar – in den Tod.
Und das ist noch nicht alles. Die ganze Wahrheit ist noch viel schlimmer. Die Vernichtung von Tausenden ist nur der Anfang. Sie werden Millionen von uns vernichten, sie werden uns ausrotten, vollständig ausrotten!
Gibt es irgendeinen Ausweg für uns? Nein! Wenn dies hier systematisch geschieht, dann ist der Gedanke an Flucht eine Illusion. Wohin sollen wir noch fliehen? Die Alten, die Kinder und die Kranken lassen wir zurück, sie werden sterben. Und wir Jungen? Eines Tages sind wir selbst entwurzelt, gebrochen, überfordert. Es gilt also: Flucht ist kein Ausweg!
Gibt es eine Aussicht auf Rettung? Wenn ich ehrlich bin, nein! Es wird keine Rettung geben. Vielleicht für zehn oder hundert Juden. Aber für unser Volk als Ganzes, für die Millionen von Juden in den von Hitler-Deutschland besetzten Gebieten gibt es keine Chance.
Was gibt es dann für einen Ausweg? Nur einen – den bewaffneten Widerstand. Das ist die einzige Möglichkeit für unser Volk, seine Würde zu bewahren.“
Ein junger Mann steht auf und erinnert mich und die anderen daran, dass wir Zionisten seien, dass Europa nicht unser Problem sei. „Dass wir überhaupt hier sind, ist ein Unfall. Unser Platz ist in Israel. Dafür leben wir. Wir glauben an den Kampf. Aber nicht hier, in Israel! Dazu kommt, dass wir alleine sind, schwach und wehrlos. Die Deutschen dagegen sind sehr stark. Eine Revolte wäre doch glatter Selbstmord!“
Eine Gardistin, Ruzka, hält dagegen: „Wenn dich später ein israelisches Kind fragt: 'Was hast du getan, als man unsere Leute zu Tausenden, zu Millionen abschlachtete?' Wirst du ihm sagen: 'Ich habe mich selbst gerettet? Ich habe mich versteckt und damit verhindert, dass man mich wie alle anderen ermorden konnte?“ Und sie fuhr fort: „ Unsere Geschichte darf nicht nur aus einer Tragödie bestehen. Sie muss auch von Selbstverteidigung und Widerstand handeln!“
Andere reden von der Kollektivstrafe der Nazis, die für jeden toten Deutschen hundert Juden umbringen und bezweifelten das Recht, das Leben anderer Menschen, anderer Juden, zu gefährden. Es gibt eine wilde Diskussion, alle springen auf und schreien durcheinander. Ich hebe meine Hand: „Was wir auch tun, wir werden auf jeden Fall sterben. Wir sterben, wenn wir feige sind und wir sterben, wenn wir mutig sind.“
Ich verlasse das Kloster, die Mutter Oberin begleitet mich ins Ghetto. „Ich will im Ghetto an deiner Seite kämpfen“, sagt sie. „Ihr seid ein edles Volk. Obwohl du Marxist bist und keinen Glauben hast, bist du Gott näher als ich.“
Nach einer Woche schicke ich sie wieder zurück ins Kloster. Draußen ist sie uns wichtiger, damit wir eine Verbindung haben.
Ich bleibe im Ghetto, wohne in einem Zimmer mit Ruzka und Vitka. Es gibt viel Gerede über uns drei. „Da geht Abba mit seinen zwei Frauen“, heißt es oft.
Am Silvesterabend findet eine öffentliche Versammlung statt. Gens erzählen wir, die Gruppe brauche einen Saal, um Silvester zu feiern. Aber ich habe den Termin gewählt, weil die Deutschen feiern und trinken und dann nichts bemerken, auch nicht, dass der Zweck ein Aufruf zur Revolte ist. „Wir müssen ihr Selbstbewusstsein und ihren Patriotismus stärken und den Hass auf den Feind schüren“, war die Devise.
Es kamen etwa hundertfünfzig Menschen, sie redeten nicht, lachten nicht, warteten. Als ich den Saal betrat, hatte ich ihre ganze Aufmerksamkeit. Sie staunten, dass ein Zionistenführer sich nicht abgesetzt hatte, nach Palästina oder Russland, dass er hier in Wilna bei ihnen war. Meine Rede:
„Jüdische Jugend – glaubt nicht denen, die euch täuschen. Von den achtzigtausend Juden in Wilna sind noch siebzehntausend übrig. Unsere Eltern und Geschwister wurden vor unseren Augen abgeschlachtet. Wo sind all die Männer, Frauen und Kinder geblieben? Keiner von denen, die man durch das Ghettotor hinausführte, ist zurückgekehrt. Die Wege der SS führen alle nach Ponar, führen in den Tod.
Gebt eure Illusionen auf. Ponar ist kein Durchgangslager. Jeder wird dort umgebracht. Hitler hat die Absicht, alle Juden in Europa zu vernichten. Die Juden Litauens machen den Anfang.
Lasst uns nicht zur Schlachtbank gehen wie die Lämmer. Wir sind nicht stark, aber für unsere Schlächter kann es nur eine Antwort geben: Widerstand, Kampf.
Es ist besser, als freier Mensch im Kampf zu sterben, als durch die Gnade seiner Mörder weiterzuleben. Wir werden kämpfen bis zum letzten Atemzug.“
Alle springen auf. Durch die Wände dringt der Gesang der Soldaten, das Horst-Wessel-Lied und das umgedichtete Heckerlied: „Wenn's Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s nochmal so gut.“
Hirsch Glick stimmt im Saal sein Lied an, das den Gesang
der Deutschen übertönt, denn alle singen mit:
Sog nit kejnmol as du gejsst dem letstn weg, chotsch himlen blajene farshteln bloje teg, - kumen wet noch undser ojsgebenkte scho, 'ss wet a pojk ton undser trot - mir sajnen do! Fun grinem palmenland bis wajtn land fun schnej, mir kumen on mit undser pajn, mit undser wej, un wu gefaln is a schpriz fun undser blut, schprozn wet dort undser gwure, undser mut. 'Ss wet di morgensun bagildn unds dem hajnt, un der nechtn wet farschwindn mitn fajnt. Nor ojb farsamen wet die sun un der kajor,
LEBKES WEG
1
Der britische Armeelastwagen hielt in der Ortsmitte von Tarvisio. Der Fahrer zeigte den Berg hinauf: „Dort ist das Hauptquartier der Jewish Brigade.“ Lebke lachte vor Vergnügen, als er schon im Ort uniformierte junge Männer mit dem Davidstern am Ärmel entdeckte. Sie gingen fröhlich umher, nur wenige hatten noch die flachen britischen Helme auf, die meisten trugen Baskenmützen oder gar keine Kopfbedeckung. Es gab sie also wirklich, eine jüdische Armee.
Es war Ende Mai, die Tage schon warm. Lebke öffnete seinen schweren Militärmantel, steckte seine Kappe in die Tasche und machte sich an den Aufstieg. Er ermüdete schnell, war geschwächt durch die letzten beiden Jahre, in denen er von Lager zu Lager getrieben wurde, bis er zuletzt in Schwaben gelandet war. Als er über den Dächern von Tarvisio angekommen war, setzte er sich an den Straßenrand und schaute übers Tal. Der Krieg war vorbei, aber nicht das unfassbare Unrecht an seinen Brüdern und Schwestern, an seinem Volk, jeder schleppte es wie eine tiefe Wunde mit sich. Sie brannte durch den Körper und wurde durch die Bilder, die sich ständig aufdrängten, immer neu aufgerissen. Wie konnten sie damit weiterleben? Was konnten sie tun?
Der Abend brach herein, Lebke stand auf, knöpfte seinen Mantel wieder zu und machte sich weiter auf den Weg. Ob er Leute aus Wilna wiedersehen würde, dem Ort, an dem seine Reise begonnen hatte? Die schlammige Hauptstraße war von tiefen Furchen der Lastwagen durchzogen. Da kam von oben eine schmale Gestalt entgegen, sie trug russische Stiefel und einen langen Ledermantel. Als sie aneinander vorbeigingen, musterte ihn der junge Mann aufmerksam. Dann leuchteten seine Augen plötzlich auf und er schrie: „Lebke, du bist es!“ Sie fielen sich in die Arme, lachten und schrien. Es war Abba, der Gründer und Kommandeur der jüdischen Partisanenorganisation in Wilna. Bei der Liquidation des Ghettos konnte er mit etlichen Kämpfern in die Wälder entkommen. Sie hatten nichts mehr voneinander gesehen oder gehört.
Lebke schluchzte: „Ich hab mich gefragt, ob ich noch jemand aus Wilna treffe – und jetzt kommst du daher!“
„Wie bist du hergekommen?“, fragte Abba.
„In Österreich hat mich ein Engländer in seinem Lastwagen mitgenommen und über die italienische Grenze geschmuggelt. Und davor – das ist eine lange Geschichte.“
„Komm mit“, sagte Abba, „ ich zeig dir erstmal einen Schlafplatz. Und dann ist noch ein gutes Dutzend Freunde von Haschomer Hazair da. Die werden staunen!“ So stiegen sie beide wieder zu den Gebäuden des Hauptquartiers hoch.
Am Abend saß Lebke mit all den Freunden und Überlebenden aus Wilna, Kovno oder Krakau in einem Hinterzimmer eines Albergos. Sie aßen, tranken Wodka und diskutierten genau über die Frage, was zu tun sei. Abba war auch der Führer dieser Gruppe, es schälten sich zwei Aufgaben heraus: Überlebende der Shoah nach Palästina zu schleusen und – Rache an den Deutschen zu nehmen. Lebke hörte, dass in der Brigade Listen kursierten von Naziverbrechern, von SS-Schergen. Etliche - nicht Abba - waren dafür, diese namentlich bekannten Mörder zu liquidieren.
„Sie sollen wissen – auch in ihrer letzten Minute – dass ihr Tun nicht ohne Sühne bleibt!“
Über weitere Pläne wurde nicht gesprochen, aber es schien Überlegungen zu geben. Lebke musste nicht nachdenken, er schloss sich der Gruppe an. Endlich war er nicht mehr ganz alleine auf sich gestellt, fühlte sich fast ein bisschen zu Hause.
Auf dem Weg ins Quartier ging er neben Joseph Harmatz aus Wilna, der sagte: „Morgen, Lebke, erzählst du deine Geschichte. Abba hat immer so viel zu tun, ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Aber wir haben im Moment viel Zeit.
DIE RÜCKKEHR
1
Zum letzten Mal ging er das Geviert seiner Wache ab. In der Mitte wartete der Rucksack, sein Gefährte für den Weg nach Hause. Sorgfältig hatte er im Laufe von Wochen zusammengetragen, was er brauchte fürs Überleben: Ein Messer, einen Kompass – wenigstens den, denn Karten konnte er nicht entwenden – ein Fernglas, ein Sturmfeuerzeug und Streichhölzer, denn das Feuerzeugbenzin würde zur Neige gehen. Einen Aluminiumkochtopf, eine Feldflasche mit Wasser, eine Rolle Draht und eine mit Schnur. Ein Säckchen mit Salz, eins mit Zucker und natürlich Brot, Brot, Brot. Was er an Kleidung brauchte, hatte er am Leib: die Uniformjacke, den Mantel, die Mütze in der Tasche. Den Helm würde er ebenso wegwerfen wie den Karabiner. Allenfalls die Pistole würde er behalten, mindestens, solange er noch auf Partisanengebiet war. Wer gerade welches Gebiet beherrschte, war nicht vorhersehbar: die Titopartisanen, die Tschetniks, selbst die Ustaschaleute garantierten nicht mehr, sich als Verbündete zu verhalten, jetzt, nach der Niederlage. Und Wölfe oder gar Bären kümmerten sich schon gar nicht um einen Kapitulanten. Gestern Abend hatte der Zugführer die Kapitulation verkündet, am 10. Mai. „Wir werden geschlossen und ehrenhaft in britische Gefangenschaft gehen!“, war sein Appell gewesen. Aber hinunter nach Rijeka waren es 30 Kilometer. Vielleicht erwarteten sie auf dem Weg schon Partisanen. Und woher wussten sie, dass die Engländer in der Hafenstadt noch das Heft in der Hand hatten, es nicht an die Titoisten übergeben hatten? Dann würden sie eher geschlossen in den Tod gehen.
Walter dachte nicht lange darüber nach, ob er nun ein Deserteur war. Selbst wenn ihn durch Zufall eine deutsche Einheit auf seinem Weg aufgriffe, könnte er immer sagen, dass alle anderen aufgerieben worden waren. Ob ihn „seine“ Leute verfolgten? Er hatte eine Stunde Vorsprung vor dem Wachwechsel. Eher würden sie annehmen, dass ihn Partisanen gekidnappt hatten. Vielleicht sollte er seinen Helm liegen lassen, als ob er ihn bei einem Angriff verloren hätte. Er legte den Helm umgedreht hinter den Stein, wo sein Rucksack verborgen war. Den schulterte er und ging zuerst vorsichtig, dann immer rascher auf der Höhenlinie nach Nordwesten. Die Nacht war klar, er konnte die Felsen sehen, die Sträucher. Erst weiter hinten begann der Wald, den er aufsuchen würde, wann immer es ging.
Mit allen notwendigen Umwegen hatte er etwa 800 Kilometer Weg vor sich. Aber er war mit seinen 35 Jahren Entbehrungen gewohnt, war immer viel gelaufen, nicht nur in den knapp zehn Monaten, die er jetzt beim SD war. Nicht freiwillig, beileibe nicht. Er hatte gehofft, das Kriegsende zuhause zu erleben, war er doch immer wieder zurückgestellt worden, weil er kriegswichtige Arbeit leistete. Er war Konstrukteur und technischer Zeichner bei Siemens und fertigte die Produktionszeichnungen für Flak-Scheinwerfer, für Geschützlafetten und anderes militärische Gerät an. Im Frühherbst 44 aber war es so weit: Sein Chef, Manfred Wagner, rief ihn zu sich. „Grund, ich kann Sie leider nicht mehr halten. Das hier ist ein Gestellungsbefehl vom SD, dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Melden Sie sich noch heute in der Süd-Kaserne in der Frankenstraße.“ Walter Grund schluckte. Ausgerechnet in die „SS-Kaserne“, wie sie im Volksmund hieß! Am Ende landete er als Aufsicht in einem Konzentrationslager! Dann schickten sie ihn nach Jugoslawien zur Partisanenbekämpfung. Schlimm genug, musste er mit der Einsatzgruppe E und im Einsatzkommando 16 an einigen Strafaktionen gegen die Zivilbevölkerung teilnehmen, ganze Dörfer in Kroatien entvölkern. Vielleicht hätte er noch gegen Soldaten gekämpft, aber wehrlose Zivilisten, gar Frauen und Kinder zu erschießen, das ging ihm zu weit. Das kleine Dorf in einer Mulde tauchte vor seinen Augen auf. Er war zur Sicherung eingesetzt, musste zusehen, wie seine Kameraden, nie mehr danach hatte er diese Bezeichnung wieder verwendet, wie sie Dorfbewohner außerhalb der Häuser zusammentrieben, wie sie in die Häuser eindrangen, schossen, wie sie die Zusammengetriebenen in eine Scheune pferchten, die Türen verschlossen und die Scheune anzündeten, anzündeten wie das ganze Dorf. Die mordlüsternen Schreie der SD-Soldaten mischten sich mit den entsetzten, todesängstlichen der Bewohner. Bei einer anderen Gelegenheit musste er mit in das Dorf gehen. Er „säuberte“ allerdings kein Haus, musste aber mit seinem vorgehaltenen Gewehr schießen, unter der Aufsicht des Untersturmführers. Er schoss konsequent darüber.
Nur einmal schoss er gezielt, als das Lager von Partisanen überfallen wurde und er in Beschuss geriet. Er wusste sein Leben nicht anders zu retten, als dass er auf das Mündungsfeuer in einem Gebüsch zielte. Als der Überfall vorüber war, suchte er nach der Leiche und fand einen jungen Kerl, noch keine zwanzig, der an einem Lungensteckschuss verblutet war.
Er zog sich noch weiter zurück, sonderte sich ab. Nur Erich suchte immer wieder seine Nähe, vertraute ihm anscheinend und flüsterte ihm mehrmals seine Bereitschaft zu, mit ihm gemeinsam „abzuhauen“. Erich, wie er ein „Spätberufener“, so nannten die anderen spöttisch Leute wie sie beide, die zuletzt noch eingezogen wurden, Erich war Ingenieur und erzählte oft von Flugmotoren, ja von Strahltriebwerken, an denen er gebaut hatte. Er war ein hagerer, nervöser Enddreißiger mit Halbglatze. Angeblich hatte ihn ein Konkurrent denunziert, weil er die Sinnlosigkeit solcher V-Waffen erwähnt hatte.
Walter hielt nichts von einer gemeinsamen Flucht. Das Risiko der Entdeckung war für zwei Männer viel größer, sie machten mehr Lärm, sie fielen eher auf, sie konnten in Konflikte geraten über den Weg. Er war es gewohnt, alleine zu entscheiden. Erich blieb, wo er war.
Walter wusste, wenn er sich Nordnordwest hielt, würde er, auf dem Höhenzug bleibend, zum Krainer Schneeberg kommen, dem Sneznik. Noch eilte er durch den Wald, um Abstand vom Lager zu gewinnen. Er war ausgeruht, er war satt, die Reise hatte begonnen.
2
Immer der Höhenlinie entlang durch den Wald. Mochte es nicht die Richtung sein, er wagte nicht, den Wald zu verlassen. Der Kompass würde ihm helfen, nicht allzu weit abzukommen. Nach dem Sneznik wagte er im Dunkeln ein kleines Feuer zu entfachen, nachdem er eine Mulde gefunden hatte. Er nahm nur trockenes Holz, damit es nicht so qualmte. Auf einen Stock spießte er Schnecken und ein paar Heuschrecken, die er gefunden hatte. „Proteine, Proteine“, murmelte er vor sich hin, um den leisen Ekel zu überwinden und hielt den Stock übers Feuer. Dazu gab es einen „Salat“ aus den Blättern von Waldveilchen und von wilden Erdbeeren und ein paar Bissen von dem kostbaren Brot. Die Feldflasche war bald leer, er musste sie auffüllen. Sorgfältig löschte er das Feuer, häufte Erde auf die Glut und hüllte sich in seinen Mantel. Er fiel in einen leichten Schlaf, in dem er noch alle Geräusche in seiner Umgebung wahrnahm und überprüfte, ob sie Gefahr bedeuteten.
Es wurde nur zögernd heller, als er sich wieder auf den Weg machte. Durch die Bäume sah er auf der Rechten ein Tal, mit fruchtbaren Feldern, zum Teil überschwemmt. Kurz träumte er davon, sich zu waschen, seinen Wasservorrat aufzufüllen, wischte die Phantasie beiseite und lief weiter durch den Wald. Aus den Bäumen wuchsen immer wieder mächtige Felsberge hervor, er musste oft absteigen, eine Senke durchqueren, wieder aufsteigen, stieß auf eine kleine Straße, die er meiden musste. Und dann, auf einmal, stand er in einem winzigen Tal vor einem Flüsschen. Vorsichtig blickte er um sich, bevor er den Wald verließ und huschte dann zum Ufer, hielt seine Feldflasche ins Wasser. Er sah, dass das Flüsschen nicht tief war und watete gleich darauf hinüber und eilte zwischen die schützenden Bäume.
Entlang einer Straße und einer Bahnlinie wandte er sich zunächst nach Westen, bevor er wieder nach Norden abbiegen wollte. Als der Weg an Höhe verlor, hielt er inne und suchte nach einem Aussichtspunkt. Dort holte er sein Fernglas hervor und schaute ins Tal. Er blickte auf ein Städtchen mit einem Bahnhof, einem Fluss … natürlich, das war die Pivka, und außerhalb des Städtchens erkannte er ein Haus mit einem Mühlrad, den Eingang zur berühmten Adelberger Höhle. Der Name fiel ihm nicht mehr ein, Pos…, Pos...Plötzlich krachten Schüsse. Sie kamen von einem Platz am Stadtrand, den er nicht einsehen konnte. Schnell zog er sich weiter in den Wald zurück, um nicht auf seinem Beobachtungsposten erkannt zu werden. Schreie drangen an sein Ohr, wütende, hasserfüllte und flehende, bittende. Er fürchtete, die titoistische „Volksbefreiungsarmee“ hatte irgendwelche Gegner massakriert, und das waren alle, die nicht zu ihnen gehörten: Deutsche sowieso, Ustaschas, Tschetniks, wer auch immer. Hastig versuchte er, sich von der Stadt zu entfernen.