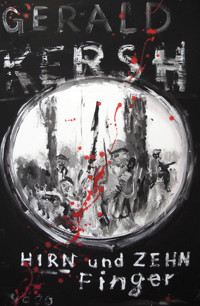Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PULP MASTER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pulp Master
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Als in der von deutschen Truppen besetzten Tschechei der SS-Obergruppenführer und General der Polizei von Bertsch von einem vorbeifahrenden Motorradfahrer niedergeschossen wird, setzt das Dritte Reich 800.000 Reichsmark Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Als in der Nähe des kleinen Dorfes Dudicka ein verlassenes Motorrad am Uferrand geborgen wird, entsendet die Gestapo den berüchtigten SS-Offizier Heinz Horner, um eine Untersuchung einzuleiten und die Dorfbewohner Horners Repressalien auszusetzen. Vor historischem Hintergrund schuf der großartige Gerald Kersh 1943 unauslöschliche Bilder vom Hereinbrechen des Schreckens über eine unschuldige Dorfgemeinschaft, die bis heute nichts von ihrer dramatischen Wucht und Sprachkraft verloren haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Metzger, Metzger, schlachte den Ochsen
2. Der wunderbare Blumenregen
3. Giftiges Fallobst
4. Horners Kreis
5. Marek hebt ein Boot aus der Taufe
6. Die andere Seite Christi
7. Jene, die von den Göttern verstoßen wer
8. Die Brüder Svatek
9. Der kleine schwarze Engel
10. Auftakt zu Pommers Beförderung
11. Oberst Petz zerlegt eine Gemeinschaft
12. Echo
13. Ein geringfügiger technischer Fehler
14. Unnötiger Lärm
15. Die Ouvertüre zum Untergang
16. Das Kommende wirft seine Schatten vora
17. Der Graben
18. Die verwinkelte Höhle
19. Nacht bricht herein
20. Feuer und Asche
21. Das Ende, das keines ist
Nachbetrachtungen
Anmerkungen
Bibliographie
Impressum
Zum Autor
Zur den Übersetzern
Pulpmaster Backlist
Gerald Kersh
Die Toten schauen zu
Im Gedenken an die ermordeten Männer von Lidice, für ihre Frauen und Kinder, deren Schicksal schlimmer ist als der Tod. Für den Kampfgeist aller, die am Leben sind und auf Freiheit hoffen
1. Metzger, Metzger, schlachte den Ochsen
»Solange ein Schuss ins Schwarze treffen kann, seien Sie auf der Hut!« Petz, eine Zigarre zwischen den Fingern, stand in einem Kreis aus Asche. Spröde, düster und doch mit Feuer im Blick, mit umschatteten Augenhöhlen, dem kurzen grauen Haar und dem Schnurrbart, der die Farbe und den metallischen Glanz von Anthrazit hatte, schien er sich geradezu in die Nacht gebrannt zu haben. Selbst seiner Stimme haftete das Knistern glühender Asche an. Er sagte: »Äste von Bäumen werden zu Knüppeln – seien Sie nie ohne Helm! Mit einer Schnur kann man strangulieren – schützen Sie Ihre Kehle! Wo immer ein Dach ist, von dem ein Stein fallen kann, ist Vorsicht geboten! Zehenspitzen sind zum Anpirschen da – gestatten Sie sich niemals einen Tiefschlaf! Vorsicht auch vor fremden Frauen, dunklen Torwegen und menschenleeren Straßen. Nächte mit mondlosem Himmel sind gefährlich – seien Sie immer in Begleitung!«
Er hielt inne. Zigarrenasche fiel auf den Teppich. Petz’ Hand musste gezittert haben. Der Rauch seiner Zigarre stieg einige Zentimeter gerade nach oben, bevor er sich unruhig zu kräuseln begann, um sich dann mit dem grauen Schleier zu vereinigen, der träge durch den Raum schwebte. Seit Mitternacht schon wurde geraucht. Zerdrückte Zigarettenstummel und aufgeplatzte Zigarrenenden füllten die Aschenbecher. In Sachsners Untertasse hatte sich eine stinkende gelbbraune Brühe aus türkischem Tabak und verschüttetem Kaffee gesammelt, worin sich Spuren von verbranntem Zigarettenpapier allmählich auflösten. Finger waren gelb geworden, Augen hatten sich gerötet und Kinnpartien schimmerten bläulich, Wangen waren eingefallen und Lippen aufgesprungen, Zungen fühlten sich pelzig an. Nur Bertsch saß da, noch immer rosig-frisch, und zeichnete etwas auf einen Block Löschpapier.
Begonnen hatte Bertsch mit einem geometrisch nahezu exakten Quadrat. Anschließend hatte er sich dessen Seiten gewidmet, mehr Quadrate angefügt, sich auch deren Seiten gewidmet, Quadrate in Quadrate gepackt, mit stockendem Atem stets das Zusammentreffen zweier Linien vermieden und akribisch ein wirres, irres Muster gerader Linien hervorgebracht. Er war darin vertieft – das Muster schien ihn in Harnisch zu bringen und gleichzeitig zu fesseln. Er konnte nicht aufhören. Immer blieben vier Linien übrig – er war getrieben weiterzumachen, Quadrat an Quadrat zu setzen, schneller und schneller. Seit Stunden machte er das nun schon. Alle beobachteten ihn. Es bedeutete, dass Bertsch nachdachte.
Bertsch summte leise vor sich hin.
Petz kam zum Schluss:
»Slawen sind Sklaven. Der Obergruppenführer hat recht.« »Wie immer«, fügte er hinzu, als Bertsch ihm plötzlich das große, weiche Gesicht zuwandte und ihn ansah. »Hat wie immer recht. Aber ... «
»Aber was genau?«, fragte Bertsch.
»Wir sollten besondere Vorkehrungen treffen«, erwiderte Petz.
»Oberst Petz, Sie sind ein wenig abgespannt«, sagte Bertsch mit großer Liebenswürdigkeit und Petz setzte sich, als hätte man ihm einen heftigen Schlag verpasst, und schwieg.
»Ich gehe konform – «, begann Sachsner.
»Es wäre mir eine Ehre, dürfte ich kurz das Wort an Sie richten«, sagte Bertsch. Sachsner klappte den Mund zu.
Und dann – während er in aller Seelenruhe das bekritzelte Löschpapier zerriss – sagte Bertsch mit einem Lächeln: »Es liegt doch auf der Hand. Die Zeit wird diese Generation auslöschen. Wir werden der Zeit assistieren. Ausgezeichnet! Erstens: Wir schöpfen den Rahm ab und dekantieren ihn. Zwangsverpflichtung zu Schwerstarbeit. Zweitens: Die Alten und mit ihnen die alten Erinnerungen sterben von allein. Drittens: Die Kinder sind unser. In zehn Jahren sind die Tschechen erledigt. Eine neue Generation wird da sein, gezüchtet, um zu gehorchen. Vortrefflich! Sie können ein Kind lehren, Sie anzubeten wie Jesus Christus. Schön. Schön! Aber das war nicht unser Thema. Unser Thema war und ist, sich das Gesindel zum gegenwärtigen Zeitpunkt untertan zu machen.
»Wenn Sie einen pflichtvergessenen Rekruten in der Truppe haben, was tun Sie? Ganz einfach, Sie zwingen ihn in die Knie. Sie machen ihm klar, dass das Leben nicht lebenswert ist, solange er die ihm erteilten Befehle nicht präzise befolgt. Sie verhelfen ihm zu der Einsicht, dass es sich nicht lohnt. Sie heizen ihm ein, bis er um Gnade schreit. Wenn nötig, töten Sie ihn, als Lehrstück für andere. Er gehorcht oder er stirbt. Ja? Gut. Nun, für ein Volk gilt das Gleiche.«
Bertsch nahm eine Zigarette aus seiner Packung. Petz, Sachsner und Breitbart beugten sich vor, jeder ein brennendes Streichholz in der Hand. Bertsch ließ sich von Breitbart Feuer geben und fuhr fort:
»Niemand ist allein. Jeder Schweinehund hat einen Kameraden oder ein Liebchen oder eine Frau oder ein Kind oder einen Bruder oder eine Schwester oder einen Vater, eine Mutter, einen Schatz – weiß der Teufel was alles. Egal, wen oder was ein Mann liebt, es ist stets sein wunder Punkt, werte Freunde. Ein Mann verkraftet den eigenen Tod. Das ist leicht. Aber machen Sie ihm bewusst, dass jeder in seiner Familie eine Geisel ist, ein Garant seines Gehorsams! Sie machen es ihm bewusst und sehen den Unterschied! Er wird spuren und Gefallen daran finden. Nun, das habe ich unter logischen Gesichtspunkten in Bohdan herausgearbeitet. Ist Bohdan noch ein Begriff? Es gab da dieses Grummeln innerhalb der Arbeiterschaft. Die Produktion lief schleppend. Sie sagten, sie könnten die Arbeit in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen. Also pickte ich mir eines schönen Tages hundert heraus, wahllos, und ließ sie aufknüpfen. Ich wurde Zeuge, wie ein junger Bursche hervortrat und darum bat, man möge ihn anstelle eines anderen hängen, irgendeiner, der eine kranke Frau und sechs Kinder hatte. Ein ungebundener Mann geht auf in seinem Opfermut! Also ließ ich hundert Mann aufhängen und fragte den Rest: ›Schafft ihr jetzt die Arbeit in der vorgegebenen Zeit?‹ Sie schafften es noch immer nicht. Also dezimierte ich sie um weitere einhundert. Kurzum ... Hören Sie: Am Anfang waren es fünfhundertfünfzig Arbeiter. Sie sagten, sie könnten die anfallende Arbeit einfach nicht schaffen. Aber die gleiche Arbeit wurde getan, nachdem ich zweihundert von ihnen hatte aufhängen lassen. Verstehen Sie? Dreihundertfünfzig erledigten Arbeit, die fünfhundertfünfzig nicht hatten erledigen können. Und warum? Weil ich sie das Fürchten lehrte.
»Diese dreihundertfünfzig hatten allesamt Familienangehörige. Ich hatte sie in der Hand. Ich erklärte ihnen einfach: ›Kein kommodes Eben-mal-so-Aufknüpfen in eurem Fall, Freunde. Aber – du da drüben!‹ Ich rief es einem Burschen namens Prokop zu. ›Du hast eine Mutter zu ernähren, nicht wahr? Und eine Schwester, nicht wahr?‹, sagte ich. ›Eine hübsche Schwester, nehme ich an. Eine kleine, dunkelhaarige Schwester, beinahe erwachsen, oder? Nun, Prokop, das ist wirklich sehr verantwortungsbewusst von dir.‹ Und dann packte ich ihn am Kragen und ich sagte: ›Nur zu. Mach etwas. Nur ein Zucken mit der Wimper. Ein scheeler Blick. Nur ein einziges Wort. Ich gebe dir mein Ehrenwort als deutscher Offizier und Ehrenmann, dass ich dir nichts tun werde. Dir nicht, Prokop, mein lieber kleiner Freund. Und, willst du die Arbeit einstellen?‹
»Er erwiderte: ›Nein, mein Herr‹, und ich sagte zu ihm: ›Wenn du willst, lauf davon. Man wird dich nicht bestrafen. Wohin möchtest du gehen? Sprich es aus.‹ Ich sagte: ›Dir wird nichts geschehen, Prokop, mein Junge. Aber ... da ist diese entzückende kleine Schwester, die du hast, Prokop, mein lieber Freund. Sie ist ein recht hübsches kleines Mädchen, deine Schwester. Und dann deine Mutter ... so reizend, so gut. Kann sie tanzen?‹
»Dieser Prokop sagte: ›Nein, mein Herr‹, und ich sagte: ›Wir könnten ihr das Tanzen beibringen, am Ende eines Telegrafendrahtes, Prokop. Nun, Prokop?‹
»Er sagte: ›Bitte, ich möchte wieder an die Arbeit gehen, mein Herr.‹
»Ich sagte: ›Ich bin mir nicht sicher, ob das Reich Männer für sich arbeiten lassen sollte, die nicht gewillt sind zu arbeiten. Bist du gewillt, Prokop? Bist du bereit?‹
»›Ja, mein Herr‹, sagte er, und er schwitzte Blut und Wasser. ›Ich bin gewillt und ich bin bereit.‹
»›Dann bitte darum‹, sagte ich. Und er ging auf die Knie. Ich verabreichte ihm eine Tracht Prügel und schickte ihn zurück an die Arbeit, ihn und seine Kameraden. Gott, was haben diese Slawenfratzen rangeklotzt! Also denken Sie immer an das Bohdan-Prinzip. Machen Sie es anschaulich. Hängen Sie eine Familie auf oder, wenn nötig, zwei, ohne jegliche Rücksicht auf Alter oder Geschlecht. Seien Sie sich stets bewusst, dass Menschen schwach sind, wenn es um Gefühle geht. Sie versuchen immer, jemanden zu beschützen. Ich verbürge mich mit meinem Leben dafür, dass der tschechische Widerstand innerhalb eines Jahres total in Trümmern liegen wird. Ich bin Oberst Petz außerordentlich dankbar für seine Fürsorglichkeit. Vorsicht ist immer geboten. Selbst eine Ratte beißt, wenn sie in die Enge getrieben wird. Aber selbst eine Ratte wird sich die Zähne nicht an einer eisernen Faust ausbeißen wollen.
»Schön. Schön. Der Befehl wird in ein paar Stunden rausgehen. Es gibt keinerlei Anlass zur Sorge. Die Slawen sind unter Kontrolle. Die Umerziehung ist nur noch eine Routinesache. Die Brände sind gelöscht. Die Zähne gezogen. Die Krallen gefeilt. Das Halsband ist angelegt und fest genietet. Jetzt geht es nur noch darum, den Knall der Peitsche und die Anstrengungen der Arbeitstiere zu koordinieren.«
Alle erhoben sich.
»Oberst Petz«, Bertsch legte dem ausgelaugten Mann eine wohlwollende Hand auf die Schulter, »ein Geheimnis der Unterwerfung von Tieren besteht in der Zuversicht, mit der man sie angeht. Nicht wahr?«
Er wartete die Antwort nicht ab, sondern lächelte und sagte: »Sie sind müde, mein armer Freund. Erholen Sie sich. Machen Sie sieben Tage Urlaub. Suchen Sie sich ein paar nette Mädels. Trinken Sie etwas Wein. Entspannen Sie sich, Petz, entspannen Sie sich. Ich schicke Sie für eine Woche nach Berlin.«
Mit leutseliger Ignoranz gegenüber Petz’ Dankesbezeigung ging Bertsch zur Tür. Sachsner öffnete sie für ihn. Draußen stampften Schritte vorbei, knallten Hacken zusammen.
»Es wird bereits hell«, sagte Bertsch.
Er stand auf der obersten Stufe zwischen den reglosen Wachposten, Breitbart, Sachsner und Petz neben sich. Geradezu phänomenal, wie gelassen und frisch Bertsch im Gegensatz zu den anderen aussah. Er senkte den Blick und holte tief Luft. »Ah, es tut gut durchzuatmen!« Ein wunderschönes pastelliges Licht überzog den Himmel. In niedriger Höhe zogen kleine rosafarbene Wolken vorbei, getrieben von einem entfernten Wind. Frei nach Goethe deklamierte Bertsch: »Ach ... könnte man dem enteilenden Augenblick nur zurufen: ›Verweile doch, du bist so schön!‹«
In diesem Moment fuhr ein Mann auf einem Motorrad vorbei. Es gab ein knallendes Stottern, gefolgt von einem Donnerschlag, als das Motorrad beschleunigte. Sperlinge stoben unter Gezwitscher hoch; Tauben tauchten herab und stiegen mit schlagenden Flügeln wieder auf. »Halten Sie den Mann auf!«, sagte Bertsch und setzte sich auf die oberste Stufe. Sein Gesicht war blau angelaufen. »Er hat auf mich geschossen«, sagte er, und dann fing er in einer dünnen, hohen Stimme an zu schreien.
Die ganze Stadt schien hochzufahren, hellwach und mit lautem Rufen. Sirenen stimmten ein in Bertschs Geheul. Der verkrampfte Mund in seinem massigen, runden Gesicht sah nicht größer aus als das Griffloch einer Okarina. Da war nur eine Schusswunde in seinem Körper, direkt unterhalb des Bauchnabels. Konnte eine kleine Kugel so viel anrichten bei einem so großen Mann? Ein Arzt hetzte herbei. Er zog eine Spritze auf und leerte sie in Bertschs Arm, der dicker war als eine Nackenrolle. Bertsch verstummte. Mehr Ärzte kamen herbei. Wo steckte die Kugel? Ein berühmter Chirurg lokalisierte sie. Sie hatte Bertschs Rückgrat zerschmettert. »Nur ein Wunder Gottes kann ihn noch retten«, sagte der Chirurg.
Wagen rasten durch die Straßen. Die Telegrafendrähte rund um den Globus wurden in Schwingungen versetzt und summten. Fernschreiber ratterten, Lochstreifen wurden gestanzt ... B ... E ... R ... T ... S ... C ... H ... Bertsch – Bertsch – Bertsch – Bertsch!, keuchten die Expresszüge, die es bergab auf nahezu hundertfünfzig Stundenkilometer brachten, Anschlag-auf-Bertsch! Anschlag-auf-Bertsch! Und das Signal der Züge kreischte. Prag blaffte Berlin an. Berlin brüllte zurück. Eine Armee von Kripobeamten schwärmte aus. Man kämmte die Stadt durch wie Haare auf einem Kopf, stülpte sie von innen nach außen wie eine Hosentasche, rupfte sie wie Federvieh und häutete sie bei lebendigem Leibe. Flugzeuge jagten im Tiefflug über die Straßen. Die Röte des Tagesanbruches wich dem Blaugrau des Morgens. Eine andere Röte verdunkelte Bertschs blaugrauen Uniformrock. Wie ein Wirbelwind erfasste Zeter und Mordio ganz Böhmen und Mähren, ergriff alles, vom Kirchturm bis zum Staubkorn. Zweihundertfünfzigtausend Reichsmark Belohnung für die Ergreifung des Mörders von Bertsch, dem Obergruppenführer und General der Polizei.
Mörder? Ja. Schlaff, eine leere Hülle wie seine abgelegten Hosen, so lag er im Sterben. Nur ließ man ihn nicht. Man hatte Horner eingeflogen. Bertsch sah hoch in seinem Todeskampf, sah Horners Gesicht. »Lasst mich sterben«, sagte er. Und dann: »Rettet mich!«
Horner antwortete: »Reißen Sie sich zusammen und versuchen Sie, klar zu denken. Sie können nicht sterben und Unerledigtes zurücklassen. Na los, sprechen Sie, Bertsch. Denken Sie nach. Ihre Akten über diese drei Dörfer sind nicht vollständig. Nehmen Sie sich zusammen, Bertsch. Halten Sie durch! Geben Sie uns eine grobe Einschätzung ... «
»Die kleinen, roten Äpfel«, sagte Bertsch.
»Kleine rote Äpfel«, sagte Heinz Horner und machte sich Notizen.
»Ja? Wie ein Huhn, wie ein Kohlebergwerk! Tanzen, tanzen über dem Nichts! Mit einem Telegrafendraht und die Wellen, die Wellen ... «
Heinz Horner erkannte, dass Bertsch phantasierte, und sagte: »Fettes Schwein.« Er rüttelte Bertsch an der Schulter. Bertsch versuchte, ihn zu beißen. Einer der drei namhaftesten Chirurgen der Welt sagte: »Sie tun ihm furchtbar weh.« Horner zuckte mit den Achseln und Bertschs Qual war solcher Gestalt, dass selbst eine kleine Störung in Form eines Achselzuckens ihn aufheulen ließ wie einen Hund.
»Wenn Sie reden, Bertsch, bekommen Sie etwas Morphium«, sagte Horner. »Los. Die Sache mit den drei Dörfern! Die Eisenbahngeschichte! Die – «
»Sein Name war Prokop«, sagte Bertsch.
»Prokop.«
Zwölf Stunden später starb Bertsch.
Heinz Horner verkündete:
»Es werden achthunderttausend Reichsmark als Belohnung ausgesetzt für die Information, die zur Ergreifung des Mörders von Max von Bertsch, SS-Obergruppenführer und General der Polizei, führt.«
Die Tschechoslowakei gab sich unbewegt und verschlossen wie ein slawisches Gesicht.
»Wer dem Verbrecher Unterschlupf gewährt oder ihn anderweitig unterstützt oder Informationen zurückhält, die zu seiner Verhaftung führen könnten, wird erschossen, zusammen mit seiner gesamten Familie – Männer, Frauen und Kinder.«
Die Tschechoslowakei verfiel in Schweigen.
Zu Petz sagte er: »Bertsch hat da einen Namen erwähnt: Prokop. Kennen Sie einen Prokop?«
»Es muss Zehntausende Prokops geben«, sagte Petz. »Wir haben Zehntausende Schuss Munition«, entgegnete Heinz Horner. Er ließ einen kleinen, schweren Gegenstand auf der Handfläche seiner Rechten hin- und herrollen. »Die Kugel aus einer Maschinenpistole«, sagte er. »Sie kommt geradewegs aus Bertschs Bauch. Sie sagt uns nichts. (Was hat der geschrien, nicht wahr?) Und dann der Mann auf dem Motorrad ... das Licht war schwach, niemand hat sein Gesicht gesehen. Und das Motorrad selbst ... «
»Eine schwere Maschine, dunkelgrau«, sagte Petz.
»Mir bekannt.«
»Ich lasse alle Motorräder überprüfen.«
»Versteht sich, Oberst Petz, versteht sich. Und jedes kürzlich neu lackierte. Und jedes reparierte. Und jeden Mann, der fähig ist, eins zu fahren. Und jeden Mann, der eilig irgendwohin zu wollen scheint. Und den ganzen Rest. Das nennt man tägliches Einmaleins. Nun gehen Sie und lassen Sie mich nachdenken.«
Heinz Horner saß da und dachte nach. Am besten dachte er bei einem Glas schwachen Tee nach. Horner war ein gewissenhafter Mensch, ehrgeizig, präzise, man schätzte ihn wegen seines ruhigen Geschicks und seiner kühlen Neugier, seiner zähen Ausdauer und seiner Tatkraft, die keinen schonte. Inmitten einer Gruppe gewöhnlicher Menschen wäre er niemandem aufgefallen. Etwas Steifes umgab das Modell der randlosen Brille auf seiner Allerweltsnase, Bescheidenheit lag in der Form seines kleinen schwarzen Schnurrbarts. Die Furchen auf seiner Stirn und der zurückweichende Haaransatz hätten von den alltäglichen Sorgen eines Familienvaters herrühren können. Er wirkte kleiner, als er war, und es haftete ihm die ärmliche Distinguiertheit eines Dorfschullehrers an, der sich in der geordneten Zweitklassigkeit eingerichtet hatte und dennoch stets ein wenig gequält aussah: das gleiche spießige Gebaren, die Attitüde der kleinkarierten Respektsperson und der abschätzige, belehrende Ton. Einige Jahre zuvor hatte ein sozialdemokratischer Journalist geschrieben:
Hans Christian Andersen hätte ein Märchen aus einem Kaufhaus daraus machen können, wie zwischen einer mit Stecknadeln gespickten Schneiderpuppe ohne Kopf und einer Schaufensterpuppe für billige Anzüge von der Stange eine Pappmaschee-Leidenschaft entbrennt ... wie beide am Ende heiraten und in einem Bett, das als STILVOLL: EINMALIGE GELEGENHEIT angepriesen wird, eine unscheinbare Puppe zeugen, die zwar gehen und sprechen kann, aber über kein Herz verfügt ... Dieser Journalist erhängte sich 1934 in Dachau, aber er hatte in Worte gefasst, was viele Menschen über Horner dachten.
Dumpf, fade, gewöhnlich, leidenschaftslos – Heinz Horner saß steif auf dem Stuhl des Toten und nippte an seinem Tee. Jenseits aller Hörweite gingen Männer auf Zehenspitzen, sprachen im Flüsterton. Horner nieste, einmal. Es klang, als sause eine Sichel nieder. Er lächelte, einmal, und als er lächelte, tat sich etwas in seinem Gesicht. Es nahm etwas von einem solide eingerichteten Zimmer an, in dem ein Verbrechen verübt worden war. Fältchen zeigten sich rund um seine Augen, hinter seinen Brillengläsern wurde es beängstigend schummrig, wie bei den Fenstern eines verlassenen Hauses, wo tief in der Nacht ein Licht zu flackern beginnt ... jemand Gefährliches verbirgt sich dort. Hinter diesen Augen loderte etwas, was nicht hätte lodern sollen. Und wenn Heinz Horner lachte, machte seine Kehle klick! – man fühlte sich an das Ticken einer unsichtbaren Uhr in einem totenstillen Gang erinnert.
Spät in der Nacht kam ein Bote. Unweit eines Dorfes, an einem kleinen Fluss, war ein herrenloses Motorrad aufgefunden worden.
Der Name des Dorfes war Dudicka.
Horner presste seinen Daumen auf einen schwarzen Knopf, wie ein Mann, der ein Insekt zerquetscht. Ein Summer ertönte. Es hörte sich an wie eine Wespe.
Petz kam herein.
»Dudicka?«, fragte Horner. »Bevölkerung?«
* * *
Die Bevölkerung von Dudicka war in dieser Nacht um zwei gewachsen. Die Ehefrau von Roman Kafka hatte Zwillingen das Leben geschenkt. Jetzt waren es vierhundertundfünf Menschen in dem Dorf – einem kleinen Flecken, der sich in die vom Fluss Dudicka beschriebene Hundskurve zwängte: neunzig kleine Häuser und eine Kirche. Der unberechenbare Abfallwagen der Geschichte hatte in Dudicka die eine oder andere Kuriosität abgeladen, aberwitzige und dubiose Fragmente einer grauen Vorzeit. So erzählte man, der blinde König Johann von Böhmen sei durch Dudicka gezogen, nur sei er noch nicht blind gewesen, denn er habe ausgerufen: »Wie friedlich, wie schön«, und nach einem Mädchen geschickt, an dem er Gefallen gefunden hatte. Möglich also, dass königliches Blut im Dorf zirkuliere. Fernerhin habe der Heerführer Žižka, mit dessen Haut man später eine Trommel bespannte, in Dudicka übernachtet und den Ort gesegnet. Als ziemlich gesichert gilt, dass Masaryk, der Verfechter der Unabhängigkeit, in Dudicka weilte und es geradezu liebte, zwischen den Walnussbäumen umherzuspazieren. Diverse Dorfbewohner begegneten ihm – einem feinen älteren Herrn von empfindsamer Gelassenheit und mit Augen, so tief und klar wie ein ruhiges Gewässer, der einer von ihnen war und zugleich ein jeder von ihnen.
Rund zweihundertfünfzig Jahre lang hatte die Familie Balaban in Dudicka Glas hergestellt. Die Balabans gab es dort noch immer. Auch Jan Balaban und seine drei Söhne bliesen unter Einsatz ihrer alten Werkzeuge Flaschen und Kelche, die zart waren wie Seifenblasen, ohne jedoch entsprechend vergänglich zu sein. Ein Balaban-Glas war im Dunkeln zu erkennen: Es meldete sich mit einem Seufzen, mit einer wehmutsvollen Melodie, die nachklang. Ein ungarischer Adliger – ein Esterházy –, der in einen von Balabans klaren Kelchen geblickt und ihn mit dem Finger zum Seufzen gebracht hatte, meinte: »Ihr müsst dieses Glas aus Tränen erschaffen haben.« Das war im Jahre 1800. Dieser Ausspruch blieb hängen: Tränenglas. Ein Fabrikant aus Dresden bot dem alten Jan Balaban ein kleines Vermögen für sein Geheimnis. »Es gibt kein Geheimnis«, sagte der.
Der Fabrikant nahm einen Balaban-Kelch genau in Augenschein. Glas, feines Glas, aber eben nur Glas. »Es ist in unserem Atem«, sagte Balaban. »Tinte ist bloß Tinte, ein Federhalter ein Federhalter, Papier nur Papier: Es ist Gottes Stimme, die das Wort formt. Glas ist nur Glas, mein Herr. Alles andere steckt im Atem und im Handgelenk und im Auge.« Seine eigenen Augen waren rot entzündet. Der Dresdner sagte: »Fünfzigtausend Mark, keinen Pfennig mehr.«
»Ich weiß von keinem Geheimnis«, sagte Balaban. Der Fabrikant zog ab und ließ eine Serie teurer Gläser herstellen, die aussahen wie die der Balabans – aber nichts brachte sie zum Seufzen. Und so blieb Balaban arm und wurde alt. Sein Söhne wuchsen heran, ausgezeichnete Kunsthandwerker, jeder ein starker Mann mit einer leichten Hand. Doch etwas war verloren gegangen. War etwas aus dem Rohmaterial entwichen? Oder aus dem Holz für die Pottasche? Die Balabans konnten ein Glas blasen, so klar wie ein Stern und graziler als eine Blüte, doch ließ man es klingen, waren keine Tränen darin, nur ein zitterndes Seufzen hinter dem zarten Klang des Tons.
Karel Marek, der Lehrer, hatte irgendwann eine Geschichte geschrieben, die in einer Zeitung abgedruckt wurde. Im Wesentlichen ging es um Folgendes: Ein Mann, der etwas Geld geerbt hatte, brachte in der Stadt einen ganzen Tag mit Einkäufen zu. Auf der Heimfahrt machte er zufällig die Bekanntschaft eines in einen weiten schwarzen Umhang gehüllten Mitreisenden, den eine gewisse Kälte umgab. Unser Mann begann zu erzählen, machte viel Aufhebens von seinem Glück und zeigte dem schwarzumhüllten Fremden, was er so erstanden hatte. »Dieser Anzug hält laut Garantie zehn Jahre ... Diese Stiefel kann man garantiert zwanzig Jahre tragen ... Die Lebensdauer dieser Uhr ist für ein halbes Jahrhundert bescheinigt ... Und dieser Hut ist eine Anschaffung fürs Leben ... Ich habe zwölf Hemden aus bestem, stärkstem Leinen ... und ich werde mir einen Weinkeller anlegen, voll mit Wein, der in fünfzehn bis zwanzig Jahren ein Vermögen wert sein wird. Bin ich nicht der glücklichste Mensch von allen? Ich, Oleg Petera?« Der Fremde in dem dunklen Umhang sagte: »Ja, Oleg Petera, und seit heute Morgen warte ich auf dich.« »Und wer sind Sie?«, wollte Petera wissen. Mit grenzenlosem Erbarmen in der Stimme erwiderte der Fremde in dem schwarzen Umhang: »Ich bin der Engel des Todes.«
Diese Geschichte wurde zusammen mit einem Bild abgedruckt. Karel Marek schrieb Hunderte solcher Geschichten, doch keine Zeitung interessierte sich dafür, und so lagen sie in seinem Schrank und setzten Staub an.
Otakar Blazek, der Metzger, machte eine Sorte Wurst, für die er in der ganzen Gegend berühmt war. Ein anderer Blazek — Josef — war Wirt der Gaststätte von Dudicka. Roman Kafka gehörte der Tabakwarenladen.
Zwei Männer, geboren und aufgewachsen in Dudicka, waren jetzt Anwälte in Prag. Seit Beginn des Jahrhunderts war es in Dudicka nur zu einem einzigen Verbrechen gekommen – der Mann, dem der Dorfladen gehörte, ein gewisser Vojtech, hatte sich sinnlos betrunken und versucht, seine Frau zu erwürgen, woraufhin sein ältester Sohn ihn mit einem Messer erstach.
Was den Rest anbelangte, lebte man in Dudicka von den Obsthainen, den Walnussbäumen, den Schweinen und dem Wald. Es gab einen Steinbruch, in dessen Geröll der Lehrer auf eine Reihe von Fossilien gestoßen war. Der Priester hatte dazu bemerkt: »Kleine Kriechtiere und Fische, Insekten, selbst Gräser und Kräuter – kein Blatt lebt und stirbt, ohne dass sein Leben und Sterben festgehalten werden.«
Dudicka hatte einen Bürgermeister und einen Dorftrottel, einen reichsten Mann und einen ärmsten, einen Geizkragen und einen Freigebigen, anständige Mädchen und weniger anständige, treue Ehefrauen, untreue Ehefrauen, pflichtbewusste Söhne und leichtsinnige Söhne, ein oder zwei Heilige und einen oder zwei Tunichtgute, faule Männer, arbeitsame Männer. Sie waren Menschen wie andere Menschen auch. Sie wollten zwischen den Extremen leben. Sie hatten Gutes erfahren und Schlechtes. Dudicka war ein Ort wie zehntausend andere.
* * *
Heinz Horner stellte sein Teeglas ab. Petz und Sachsner sahen über seine Schulter hinweg auf die Karte, die vor ihm ausgebreitet lag. Horner hielt einen dicken, stumpfen Bleistift zwischen den Fingern. Die schimmernde Spitze aus Graphit sah feucht aus im Licht, wie die Nase eines Jagdhundes. Sie nahm Witterung auf, fing sacht an zu beben, folgte einer Spur – jagte einen Fluss entlang, einen Nebenarm hinauf, verharrte, nur kurz, schoss wieder davon, folgte der leichten Biegung eines anderen Flusses und war am Ziel.
Mit zwei Fingern seiner Linken betätigte Horner sanft zwei Knöpfe, einen schwarzen und einen weißen. Zwei Summer, der eine schrill, der andere dumpf, erklangen in einem schmerzhaften Misston.
Petz sah Sachsner an. Sachsner sah Petz an.
»Noch zwei Stunden bis Tagesanbruch«, sagte Horner.
Feinsäuberlich zeichnete er einen Kreis um das Dorf namens Dudicka. Männer setzten sich in Bewegung. »An die Arbeit«, sagte Heinz Horner.
2. Der wunderbare Blumenregen
Etwas ganz Wundervolles ereignete sich in der Morgendämmerung von Dudicka. Zwei Menschen gestanden einander ihre Liebe, und als sie es taten, erblühte der Himmel wie ein Apfelbaum in einer Überfülle dahinschwebender rosafarbener Blüten.
Der junge Mann war Max Marek, der Name des Mädchens lautete Anna Horak. Sie hatten den Großteil ihrer Kindheit zusammen verbracht, im Hause Karel Mareks, des Lehrers. Max war sein Neffe und er hatte unverkennbar das Gesicht der Mareks – ein eigenartiges, anziehendes Gesicht, hässlich und angenehm zugleich, von eigentümlichem und dennoch passendem Schnitt. Es war eine dieser ungewöhnlichen slowakischen Mischungen, die man als Komposition betrachten sollte. Die Gesichtszüge – jeder für sich genommen grob – fügten sich zu etwas Harmonischem und unbeschreiblich Sympathischem zusammen. Dazu passte der ernste, nachdenkliche Ausdruck wie Wolken zu einer Gebirgslandschaft passen. Ein Grinsen oder Zwinkern hätte es, einem Granatsplitter gleich, entstellt. Es war dafür geschaffen, nichts als aufrichtiges Gefühl auszudrücken, und zwar nur in Maßen. Seine hellen, grauen Augen waren stets weit geöffnet, wie die Geschäftsbücher eines ehrbaren Kaufmanns. Ein ungebührliches Wort aus diesem Munde mit seinem ehrlichen, entschlossenen Zug und man wäre versucht gewesen, sich zu kneifen und sich zu fragen, ob man träume: Man wäre zutiefst erschrocken angesichts des Unwahrscheinlichen, als hätte er eine gespaltene Zunge hervorschießen lassen und gezischelt. Hier war ein redlicher Mensch, grundsolide in seinen vortrefflichen Anlagen. Von der Gestalt her ein Bauer, gekleidet jedoch wie ein ordentlicher Städter, in einem Anzug aus grauem Stoff, worauf die Wahl gefallen war, weil er vermutlich lange halten und der Staub ihm nichts würde anhaben können. Der Mann musste umsichtig sein, sein Geld zusammenhalten, zusehen, dass ein Hemd bei täglichem Gebrauch eine Woche lang tragbar blieb und ein Anzug ein Jahr, musste zweimal überlegen, bevor er in die Straßenbahn stieg, die bescheidenen Mahlzeiten mit Brot ergänzen, sich um eine kleine Schrift bemühen, um Papier zu sparen, und so viele Rasuren wie möglich aus einer Klinge herausholen.
In Prag, wo er Medizin studierte, teilte er sich mit einem ebenso mittellosen Studenten der Rechtswissenschaften eine Mansarde, nicht größer als eine Hundehütte. Er führte insgeheim Buch über die Zuwendungen, die er von seinem Onkel Karel erhielt. Noch drei Jahre und dann war er Arzt. Er würde sich auf Neurologie spezialisieren, Großartiges leisten, viel Geld verdienen und den alten Mann mit Geschenken überhäufen. Wer hatte ihn denn als Waise aufgenommen, mit Liebe und Zärtlichkeit groß gezogen und zur Universität geschickt? Onkel Karel. Ab und an ließ Max seiner Phantasie freien Lauf: Eines Tages würde er Karels Geschichten aus dem Schrank stibitzen, alle, sie einem Verleger schicken und dafür bezahlen, dass sie in einem schönen Einband veröffentlicht würden. Onkel Karel bekäme dann ein Paket: Ein Dutzend Exemplare der Gesammelten Erzählungen von Karel Marek ...
Aber zuerst die Ausbildung. Er arbeitete mit fieberhafter Geduld; büffelte, wie es charakteristisch ist für einen ernsthaften Studenten; befestigte Listen mit Fachausdrücken und akribisch gezeichnete Schaubilder an die niedrigen Wände seiner Mansarde; bestand Examina; gab sich Träumen hin, von spektakulären wissenschaftlichen Entdeckungen und Dankesbekundungen (seine Methode der Entspannung); entwickelte die Bereitschaft zu konzentriertem Arbeiten. Er arbeitete mit Beharrlichkeit und Instinkt. Ungeachtet seiner selbstbestimmten, auf ein festes Ziel ausgerichteten Hingabe an das Studium war er beliebt. Seinen großen Händen, die vom festen Zupacken vieler Generationen kündeten, war eine unerwartete Feinfühligkeit eigen: Behutsam fanden sie ihren Weg. Er konnte ein Telefonbuch in Stücke reißen oder die Asche einer Zigarette aufnehmen, ohne dass sie zerfiel. Sein Verstand war genauso. Max besaß eine Stärke, ein Zartgefühl und eine Offenheit, die anderen Achtung abverlangten. Und er verfuhr großzügig mit dem, von dem er meinte, es hergeben zu können – seine Begabung für präzise und leicht verständliche Ausführungen und die Zeit, die er sich für Erholung und Amüsement zugestand. Max hatte keine Widersacher und in seinem Leben nie jemanden unsympathisch gefunden. Mit Ausnahme einer Person – eines Mädchens.
Und das ist eine merkwürdige Geschichte. Das Mädchen, das er als unsympathisch empfunden hatte, war Anna Horak.
Am Beginn ihrer Beziehung stand Kampf. Anna war fünf, Max sechs. Annas Vater war Vojtech Horak – der Mann, der von seinem Sohn niedergestochen wurde, weil er sich betrunken und die Mutter misshandelt hatte. Ein heißer Windstoß blindwütiger Gewalt schien die Familie Horak zu zerstören wie ein Feuer trockenes Gras zerstört. Vojtech Horak starb. Dann wanderte Josef, der Sohn, ins Gefängnis und starb. Die Mutter wurde aufs Krankenlager geworfen und starb. Anna blieb allein zurück. Karel Marek, damals ein Junggeselle mittleren Alters, nahm sie auf und adoptierte sie: eine Tochter für ihn und eine Spielkameradin für den kleinen Max. Sechzehn Jahre war das jetzt her. Als Kind war Anna unscheinbar gewesen mit ihrem flachen Gesicht, dem strähnigen Haar und den kleinen Augen. Die Stirn niedrig, die Schultern hochgezogen, die Gliedmaßen zu schmal, der Mund zu breit, die Linie ihrer Augenbrauen wies nach unten, ihre Nase nach oben; ihr Sprechen war schleppend, ihr Naturell hitzig und sie scheute die Gesellschaft anderer.
Karel war sanftmütig wie einst ihre Mutter, er war aber auch stark. Anna hatte ihre ersten fünf Lebensjahre in einer unberechenbaren Atmosphäre aus Gewalt einerseits und kläglicher Rechtfertigung und stets gebrochenen Versprechungen andererseits verbracht. Die Gemütsruhe Karel Mareks, des Lehrers, irritierte sie: Sie widerstrebte ihr anfänglich. Und Max’ gut gemeinten Annäherungsversuchen begegnete sie mit Misstrauen ... ein Lächeln bedeutete für sie das Präludium zu einem Schlag, das wehrlos machen sollte: Ist der andere so groß wie man selbst, schlägt man zuerst – so lautete das Grundprinzip. Über Jahre kämpfte sie mit Max. Dann wurde sie ihm eine Schwester. Er ging fort, auf die höhere Schule, und als er zurückkam, hatten sich die Dinge verändert.
Irgendein Zauber war am Werke gewesen. Max hatte sich zu entwickeln begonnen. Er war dem Knaben entwachsen, war männlich geworden, stämmig, ernsthaft, klug und ruhte in sich. Sein Haar – bisher kaum als solches zu bezeichnen gewesen – war jetzt braunes Haar.
Auch Anna schien unter einen rätselhaften Einfluss geraten zu sein. Sie war in die Höhe geschossen und hatte auch sonst ausgelegt. Ihre Augen waren groß. Ihr Mund war noch immer breit, nur war irgendwie mehr Gesicht darum herum und ihr Haar war nicht mehr strähnig, sondern glatt und ordentlich und richtig schwarz. Sie hatte große Brüste und einen ganz bestimmten Duft.
Sie begegneten einander mit steifer Höflichkeit. Etwas stand zwischen ihnen. Auch mangelte es ihnen an Gesprächsstoff. Sie wünschte, er würde wieder verschwinden. Er meinte, sie löse irgendwie Unbehagen bei ihm aus, mochte sie nun erst recht nicht und gab sich unterkühlt-förmlich.