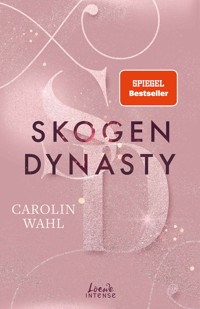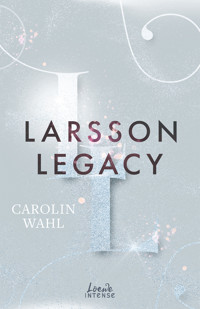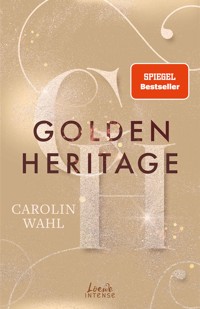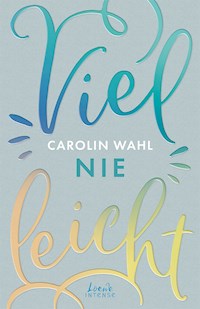4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubendes Fantasy-Epos voller Magie, Liebe und Abenteuer
In einer Welt, in der Frühling, Sommer, Herbst und Winter über die Träume mit den Menschen verbunden sind, liegt das Schicksal der vier Jahreszeitenvölker in den Händen der Traumknüpferin Udinaa. Doch als Udinaa – halb Mensch, halb Göttin – erwacht, zerbricht ihr Traum in Abermillionen magische Splitter. Jeder einzelne dieser Splitter verleiht, einmal gefunden, dem Träger die Macht der Götter. Als die Traumsplitter in die Hände eines Verräters fallen, scheint ein gewaltiger Krieg unausweichlich. Einzig Kanaael, der Prinz der Sommerlande, und Naviia, eine junge Clansfrau aus dem Wintervolk, vermögen den Lauf des Schicksals noch zu wenden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 845
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Tief verborgen im Nebel liegt die geheimnisvolle Insel Mii, der Mittelpunkt der Welt der Vier Jahreszeiten. Seit Jahrhunderten schläft dort die Traumknüpferin Udinaa, die durch ihre Träume die Welt im Gleichgewicht hält. Doch nun sind die Vier Jahreszeitenvölker in Aufruhr: Dörfer brennen, Menschen werden ermordet, und Gerüchte über einen drohenden Krieg machen die Runde.
Kanaael De’Ar, der charismatische Prinz der Sommerlande, möchte Udinaa beschützen, denn sollte sie erwachen und ihr Traum zerbrechen, ist die Welt der Vier Jahreszeiten in Gefahr. Die Splitter von Udinaas Traum verleihen jedem, der sie findet, die Macht der Götter, und wenn sie in die falschen Hände geraten, werden die Kriegsgerüchte zur brutalen Wirklichkeit.
Gleichzeitig macht sich am anderen Ende der Welt das junge Wintermädchen Naviia O’Bhai auf die beschwerliche Reise in die Sommerlande. Ihr Schicksal ist eng mit dem Kanaaels verbunden, und auf die beiden wartet ein gewaltiges Abenteuer voller Gefahren, Liebe, Magie und tödlicher Intrigen. Als das Unfassbare geschieht und Udinaa durch einen schrecklichen Verrat tatsächlich geweckt wird, müssen Kanaael und Naviia über sich selbst hinauswachsen, um die Welt der Vier Jahreszeiten zu retten.
Die Autorin
Carolin Wahl wurde 1992 in Stuttgart geboren und studiert inzwischen Geschichte und Germanistik. Egal ob als Autorin oder als Leserin, Literatur ist ihre große Leidenschaft, und für ihre Texte wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Traumknüpfer ist ihr erster Fantasy-Roman. Die Autorin lebt derzeit in Edinburgh und München.
Carolin Wahl
Die
Traumknüpfer
Roman
Wilhelm Heyne Verlag
München
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe 03/2016
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2016 by Carolin Wahl
Copyright © 2016 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafikdesign, München
Karte: Andreas Hancock
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-16951-0V001
www.heyne.de
Dieses Buch soll für all diejenigen sein,
die einen Traum haben.
Und für meinen Papa – der von sehr weit oben
diese Geschichte liest.
Prolog
Der Wind trug den Geschmack von Regen durch die Straßen von Lakoos, während die untergehende Sonne die Wüstenstadt in blutrotes Licht tauchte und in den verglasten Türmen des Palasts schillerte. Lakoos, die Hauptstadt der Sommerlande. Das pulsierende Zentrum der Macht und größer als alles, was die Länder der Vier Jahreszeiten gesehen hatten.
Niemand schien auf Nachtwind zu achten. Er war ein Geist, ein verlängerter Schatten der engen Häuserfassaden, die dicht aneinandergereiht die steinigen und ebenso verschlungenen Wege durch die Stadt ebneten. Das Herz der Wüste wurde sie auch genannt, und Nachtwind wusste, warum. Nirgendwo sonst trafen Abgesandte aus den Vier Ländern so häufig ein wie hier. Die Stadt blühte und das, obwohl sie abgeschlagen den fast südlichsten Punkt auf der Weltkarte bildete.
Auch heute herrschte dichtes Gedränge – schließlich wurde eine Gesandtschaft aus Syskii erwartet, und bei einem solchen Ereignis zeigte sich die herrschende Familie De’Ar besonders spendabel. Trotz des vorangegangenen Gewitters war es schwül, und die Hitze schien sich wie ein Teppich über die Stadt gelegt zu haben. Viele der Schaulustigen hatten Fahnen mit dem purpurfarbenen und sichelförmigen Halbmond, dessen Bauch den sandfarbenen Untergrund berührte, bei sich. Das Wappen der Familie De’Ar und gleichzeitig das machtvolle Zeichen der Wüstenstadt.
In den Straßen herrschte eine ausgelassene Stimmung: Armreifen klirrten, Gelächter war zu vernehmen, und der Duft von gebratenen Schalentieren und Süßspeisen lag verführerisch in der Luft.
Nachtwinds Weg führte ihn durch das Gassenlabyrinth, hinauf zum goldenen Vorplatz der Götter, der festlich geschmückt worden war und den Beginn des goldenen Viertels markierte, in dem auch der Acteapalast lag. Suvs Tempel ragte über den anderen Gebäuden auf, direkt unterhalb der Hauptstraße, die geradewegs zu den gewaltigen Palasttoren führte. Nachtwind war kein Gläubiger, er lebte nach seinen eigenen Regeln, und einem Gottesdienst hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr beigewohnt. Er hasste das Gefühl von Machtlosigkeit, und das verspürte er immer in der Nähe dieser seltsamen Götterstatuen, der betenden Gläubigen und der starren, einfarbigen Maske des Hohepriesters. Gesichtslos waren die Gottesdiener, maskenverhüllt, weil sie als Sprachrohr galten. Sie besaßen weder einen eigenen Namen noch eine eigene Identität. Und sie waren Nachtwind nicht geheuer.
Sein Blick huschte zu den Wachen, die sich über den großen Platz verteilt hatten. Ihre schwarze Kleidung war bodenlang, die Gesichter unter schweren Tüchern kaum auszumachen. Lediglich die Augenpartie lag frei, sodass man die dunkel getönte Haut darunter nur erahnen konnte. Er zählte ein halbes Dutzend – von den Wächtern, die sich ohne erkennbare Wappen und Bekleidung auf dem Platz aufhielten und alles beobachteten, ganz zu schweigen. Sicherheit war das oberste Gebot an einem Tag wie heute.
Plötzlich erklang eine hohe Mädchenstimme. Ihr Gesang hob sich deutlich aus der Menge ab, die schlagartig verstummte. Suchend blickten sich die Wachen um, und Nachtwind entdeckte ein junges Ding mit braunen lockigen Haaren und leuchtenden mandelförmigen Augen. Um sie herum hatte sich ein Kreis gebildet, und viele der Menschen wichen zurück und starrten das Mädchen mit offenen Mündern an. Sie sang. Sie wagte es, in der Öffentlichkeit zu singen, obwohl das unter Strafe stand.
Sie ist ein einfaches Mädchen, das seine Freude über den Festtag zum Ausdruck bringen will, und ganz gewiss keine Seelensängerin, dachte Nachtwind und wandte sich in jenem Moment ab, als die Wachen das Mädchen erreichten, ihm ins Gesicht schlugen und es fortzerrten. Bald darauf waren sie von der verstummten Menge verschluckt und außerhalb seines Sichtfelds. Er ahnte, wohin man sie bringen würde, und hoffte für sie, dass sie den Schmerzen der Peitsche standhalten würde.
»Bhea hava, mein Freund!«, erklang es zu seiner Rechten.
Er wandte den Kopf und erblickte einen in Lumpen gehüllten Bettler, der mit seiner schwieligen Hand einige Münzen in die Luft warf und wieder auffing. Scheinbar zufällig lehnte er an einer der unzähligen Fassaden.
Nachtwind versteifte sich augenblicklich. Zwei der Münzen schienen in der Luft zu tanzen. Ihre Flugbahn war ein hoher Bogen, doch sie verlangsamten sich, drehten sich zu einer imaginären Musik, ehe sie wieder in der Hand des Bettlers verschwanden. Auf seinem Handrücken zeichnete sich das Wappen der Wüstenstadt ab, aber die Farbe war frisch aufgetragen. Dieser Mann befand sich erst seit Kurzem in Lakoos.
Von einer inneren Unruhe getrieben, schoss Nachtwinds Blick hinauf zu dem Gesicht des Mannes. Auch seine Haut war tief gebräunt, einzelne Strähnen des nackenlangen, mokkafarbenen Haars hatte man geflochten, und der Bart ließ ihn älter erscheinen, als er war. Doch es war nicht das Gesicht des Bettlers, das ihn nun erstarren ließ, sondern seine Augen. Sie waren eisblau.
»Es war niemals vorgesehen, dass ich es allein durchführe, nicht wahr? Er hat uns beide hierhergeschickt. Es ist eine Prüfung«, sagte Nachtwind, zog sich den Schal von Mund und Nase und entblößte eine Narbe, die quer über sein Gesicht verlief.
Sein Gegenüber verzog keine Miene.
»Woher wusstest du, welchen Weg ich wähle? Wie ich zum Palast gelangen werde?«
Nun lächelte der Bettler geheimnisvoll. »Du spielst gern mit dem Feuer, Nachtwind. Dein Ruf eilt dir voraus. Ich dagegen ziehe es vor, nicht gesehen zu werden. Du, mein Freund, wickelst deine Aufträge vor den Augen deiner unwissenden Zuschauer ab. Es war leicht, dich aufzuspüren.« Die Stimme war tief und kehlig, der leichte Akzent in seiner ansonsten makellosen Aussprache deutete darauf hin, dass er ebenfalls aus den Herbstlanden stammte.
»Und obwohl du deine Aufträge im Stillen ausführst, hast du dich mir zu erkennen gegeben. Du hättest deinen Vorteil ausnutzen können, doch das hast du nicht getan. Entweder bist du dumm oder einfach sehr von dir überzeugt. Wie lautet dein Name?«
»Saaro A’Sheel.«
»A’Sheel? Wie Ashkiin A’Sheel, der Heerführer der Schwarzen Armee?«
Ein Schmunzeln huschte über das Gesicht des Bettlers. »Ich sehe, der Ruf meiner Familie eilt wiederum mir voraus. In der Tat, mein älterer Bruder war der Heerführer der Schwarzen Armee, aber er ist kein Krieger mehr. Jedenfalls steht er nicht mehr im Dienst von Meerla Ar’len.«
Die Herrscherin der Herbstlande. Somit hatte Nachtwind Gewissheit. Die eisblauen Augen und der Akzent waren ein Indiz für die Herkunft des Bettlers. Ebenso wie er selbst stammte er wohl aus Syskii, den Herbstlanden. »Unsere Begegnung ist also keineswegs zufällig.«
»In der Tat war sie von Anfang an geplant.«
»Wir haben also wirklich denselben Auftraggeber. Er hat dich ebenfalls hierhergeschickt.« Wie er vermutet hatte. Ärger wallte in ihm auf. Wie es aussah, mangelte es demjenigen, der für ihr Treffen verantwortlich war, an Vertrauen zu seinen Künsten.
Nun entblößte Saaro eine Reihe gepflegter Zähne, die nicht in das Bild eines armen Mannes passten. Abschätzig blickte er Nachtwind an. »Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Buch zu stehlen, und der Regen hat dich überrascht, habe ich recht? Eigentlich habe ich mehr von dir erwartet.«
Nachtwind schnaubte. »Du wirst mir jedenfalls nicht zuvorkommen.«
Trotz seiner hünenhaften Gestalt beachtete ihn keiner der umstehenden Menschen. Es schien fast so, als wäre er für das bloße Auge unsichtbar. Und vielleicht war er das auch. Die Anwesenheit des zweiten Diebs war der letzte Beweis, den er benötigt hatte, um zu wissen, wie wertvoll die Chronik des Verlorenen Volks für seinen Auftraggeber war. Zuerst hatte er seinen Auftrag für einen Scherz gehalten – wer zahlte so viel Geld für ein einfaches Buch? Doch dann hatte er sich umgehört … Lakoos’ Bibliothekskatakomben waren berühmt. Manche glaubten, die Bibliothek sei so alt wie die Götter selbst, andere behaupteten, die meisten Bücher seien aus den Flügelfedern ihrer Kinder geschrieben worden. Schon vor Jahrhunderten, im Zeitalter der Finsternis, hatten Menschen versucht, die Existenz der Halbgötter abzuerkennen. Es war ihnen bis heute nicht gelungen.
Im Herzen des Sommerpalasts der Familie De’Ar befand sich ein Schmuckstück, das Kriege heraufbeschwören konnte. Und doch wussten nur wenige von der Chronik, die er dem Sommervolk entwenden sollte. Gerüchte gab es allemal, doch sie waren haltlos und frei jeden Beweises.
»Und du bist zu jung, um den Weg in die Katakomben zu finden«, fügte Nachtwind hinzu und sah dem vermeintlichen Bettler geradewegs in die Augen. »Was weißt du über das Buch?«
»Nicht mehr, als ich wissen muss.«
»Du fragst dich nicht, was für einen Wert es für unseren Auftraggeber hat?«
Saaro lächelte. »Das ist mir ziemlich gleichgültig. Geld ist Geld.«
Einen Moment lang musterten sich beide schweigend.
»Mir jedenfalls wurde eine großzügige Belohnung versprochen, sollte ich es schaffen, das Herzstück der Familie De’Ar zu entwenden«, fuhr sein Gegenüber fort.
Die Chronik des Verlorenen Volks war ein Mythos ebenso wie ihr Inhalt, und doch gab es kaum ein Buch, das besser bewacht wurde.
»Wenn wir die Chronik entwenden, wird das einen Stein ins Rollen bringen, der die Welt der Vier Jahreszeiten erschüttern könnte. Möchtest du diese Last wirklich auf deinen jungen Schultern tragen, Saaro?«
»Dieses Risiko gehe ich ein, alter Mann.«
Er ließ sich von den Worten nicht provozieren und nickte seinem Gegenspieler zu. Möglicherweise würden noch Jahre vergehen, ehe die Auswirkungen dieses Diebeszugs die Welt ins Wanken brachte. Aber es würde geschehen. Und bis es so weit war, würde er sich von der versprochenen Entlohnung ein schönes Leben machen.
Nachtwind stülpte sich seinen Schal über das Kinn, verbarg die Zeichnungen, die das Leben in seinem Gesicht hinterlassen hatte, und nickte dem vermeintlichen Bettler zu. Saaro A’Sheel nickte ihm mit einem überlegenen Lächeln zu, und kurz darauf waren beide Diebe in der feiernden Menge verschwunden.
Erster Teil
Wieder zogen sich die Tiere in die Wälder zurück, denn Unheil lag schwer und klagend in der Luft. In allen vier Reichen vibrierte der Untergrund, und die Welt war in schutzlose Dunkelheit gehüllt. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer von Hauptstadt zu Hauptstadt, vom hintersten Winkel des Winterlandes bis hin zu den prächtigen Palästen der Herbstwelt.
Aus dem Süden näherte sich ein Donnergrollen, Sommergott Suv war erzürnt, und seinem Zorn waren die Bewohner der Wüstenstädte hilflos ausgeliefert.
Auszug aus: Die Chronik des Verlorenen Volks (Seite 12, 4. Absatz)
1
Entdeckungen
Lakoos, Sommerlande
Die düsteren Träume lagen schwer in der Luft. Wie ein Dunstschleier strömten sie aus den Schlafkammern des Kellers und erfüllten den Korridor, durch den Kanaael De’Ar schlich. Er spürte jeden Traum, der sich innerhalb der Mauern des Acteapalasts befand, während er die leeren Gänge im Obergeschoss durchquerte. Von draußen drang Mondlicht durch die verglaste Frontseite des seitlichen Flügels, wo der Westturm begann, und seine nackten Füße trugen ihn schnell seinem Ziel entgegen.
Anders als Träume der Hoffnung, die eine leichte Aura besaßen, mit Versprechungen lockten oder Zuversicht vorgaukelten, umschmeichelten ihn die düsteren Träume auf eine Art, der er sich nur schwer entziehen konnte. Abgründe öffneten sich hier vor Kanaael, denn es waren die Götter selbst, die ihre Hände nach den Träumenden ausstreckten – und er hatte die Gabe, einen Blick auf diese Welt zu erhaschen.
Als er in der Ferne Schritte vernahm, presste er sich gegen eine der zahllosen Marmorsäulen, die den prachtvollen, mit mehreren Wandteppichen und offenen Feuerstellen ausgestatteten Flur säumten. Sein Herz schlug ihm plötzlich bis zum Hals. Er durfte nicht gesehen werden. Nicht nach dem, was heute in den Tiefen des Palasts geschehen war.
Das Feuer in den von der gewölbten Decke hängenden Schalen warf lange Schatten auf die goldenen Wandvorhänge, die das Familienwappen der De’Ars zeigten. Er schloss die Augen und lauschte. Die Menschen im Palast träumten Dinge, die nicht für einen zwölfjährigen Jungen bestimmt waren, doch Kanaael war zu neugierig, um diesem inneren Drang zu widerstehen. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen, lockten ihn die Träume an. Es war schwer, dem befriedigenden Gefühl zu widerstehen, das sich jedes Mal einstellte, sobald er in einen Traum eingesogen wurde. Ein Bad in purem Licht. Erfüllung. Danach fühlte er sich stark und unbezwingbar. Sein Gehör war geschärft, jeder zarte Duft brannte sich förmlich in seine Nase, und er konnte die Menschen um sich herum spüren, noch ehe er sie vor sich sah.
Er versteckte seine Gabe, seit er in den Traum einer seiner Ammen eingedrungen war und sie am nächsten Morgen auf den innigen Kuss mit einem der Stallburschen angesprochen hatte. Noch heute erinnerte er sich an ihre Standpauke. Sie hatte geglaubt, er habe die beiden beobachtet. Und er hatte es für klüger befunden, sein kleines Geheimnis für sich zu behalten.
Die Schritte näherten sich, und Kanaael zog sich tiefer in den Schatten der Säule zurück, bis schließlich einer der Diener seines Vaters an ihm vorbeieilte und kurz darauf durch eine silberne Tür in den Ostflügel verschwand.
Die letzten Tage waren aufregend gewesen, die Gesandtschaft aus Syskii hatte Lakoos in eine blühende Stadt verwandelt. In den Gesichtern der Menschen vor den Toren des Palasts hatte man Freude und Zuversicht lesen können. Sie hatten seinen Namen gerufen und den seines Cousins Keedriel. Trotz seiner jungen Jahre wusste Kanaael, dass er einmal über das Sommervolk herrschen würde wie sein Vater und sein Großvater.
Die Schritte des Dieners verklangen hinter der verschlossenen Tür. Trügerische Stille senkte sich über den schlafenden Palast. Um Kanaael herum waberten die Träume. Mit geschlossenen Augen sah er sie fast noch deutlicher vor sich. Wie ein blasser, silberner Nebel hingen sie in der Luft, manche glühten heller, in frühlingshaften Farben, andere schimmerten in einem matten, zartroten Licht. Der Traum, den er suchte, war allerdings nicht dabei.
Er hatte Gerüchte über zwei syskiische Diebe aufgeschnappt, von denen einer in den Bibliothekskatakomben gefangen genommen worden war. Sein Vater machte ein großes Geheimnis um die Bücher, die in den dunklen, kühlen Räumen der Katakomben aufbewahrt wurden. Stets erhielt er ausweichende Antworten von seinen Lehrern, wenn er die Bibliothek zur Sprache brachte, und die Aufzeichnungen und Träume der Menschen im Palast hatten ihm auch keine Auskünfte geliefert. Es wurde nicht über die Bücher gesprochen. Niemals. Es war genauso wie mit dem Singen. Es war schlichtweg verboten.
Doch heute könnte Suv ihn mit etwas Glück gesegnet haben. Neben den aufregenden Ereignissen, die sich auf dem goldenen Vorplatz der Götter abgespielt hatten, waren Stimmen um den Diebeszug der beiden Fremden laut geworden.
Und es gibt nur einen Mann, der meine Fragen beantworten kann, dachte er, und ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen, das jedoch gleich darauf wieder verblasste, als er sich auf die Träume konzentrierte.
Laarias Del’Re, der Haushofmeister seines Vaters, engster Vertrauter und bester Freund schon von Kindesbeinen an. Er war für die Koordination der Wachen und mögliche Gefahren verantwortlich. Und sein Traum würde Kanaael Aufschluss über die Diebe geben … sollte er denn von ihnen träumen.
Entschlossen ging er in Richtung des südöstlichen Trakts weiter. Noch vor wenigen Wochen hatte er Träume aus den Schlafkammern der Dienerschaft hier oben nicht spüren können, und jetzt gelang ihm dies mühelos über eine Distanz von zwei Stockwerken hinweg. Er bewegte sich lautlos und geschmeidig. Das harte Training, dass er vor Kurzem begonnen hatte und dessen Abschluss die Feierlichkeiten der Urzah, der Anerkennung zum Mann, bildeten, machten ihn in vielerlei Hinsicht geschickter.
Er bog nach links ab, in den Bauch des sichelförmigen Palasts, da die Räumlichkeiten seiner Mutter stets gut bewacht waren und er vermeiden wollte, ausgerechnet von ihr oder ihrer Dienerschaft entdeckt zu werden. Hinter einem der goldenen Wandvorhänge, die auch hier die kahlen Stellen zierten, war eine Treppe eingelassen, eine Abkürzung für Bedienstete des Hofs. Vorsichtig schob er den Vorhang zur Seite – und hielt inne.
Der Traum, den er suchte, befand sich unmittelbar vor ihm. Kanaael spürte die Unruhe, die er ausstrahlte, und schloss die Augen.
Jetzt sah er seine Farbe. Die Umrisse des Gebäudes wirkten verschwommen, und alles bis auf die Farben der Träume war grau. Als hätten die Götter der Welt ihre Farben gestohlen. Direkt vor ihm zuckte ein wilder Traum, seine rote Aura erschien angesichts der blassen Umwelt noch intensiver. Nur ein Mann kann heute so unruhig schlafen …
Wie ein fadenartiger Nebel wies der Traum Kanaael den Weg durch den Palast, und er brauchte ihm lediglich im Geist hinterherzulaufen. Die Stille war ohrenbetäubend. Er ging die Bedienstetentreppe hinab. Einmal um die Ecke. Den grauen Flur entlang. Nach links. Eine weitere Abzweigung. Schließlich gelangte er an eine massive Doppeltür. Feine Verzierungen, die die Geschichte des Sommervolks erzählten, waren hineingeschnitzt, und die Schlafkammer lag nur einige Räume und ein Stockwerk von seinem Vater entfernt. Sein körperloser Geist trat durch die Tür und fand den Freund seines Vaters, wie er sich im Schlaf hin und her wälzte. Die Laken seines massiven Holzbetts waren zerwühlt, Kissen lagen auf dem mit Teppich ausgelegtem Boden. Sein Körper änderte unruhig immer wieder seine Position, die Lider zuckten unter dem schweren Traum. Vorsichtig trat Kanaael näher heran. Der rote Dunst tanzte um Laarias, das geräumige Schlafgemach war voll davon.
Neugier ergriff ihn. Laarias musste von den Ereignissen des Tages träumen – so aufgewühlt hatte er den stets so beherrschten und unauffälligen Haushofmeister seines Vaters noch nie gesehen. Er folgte dem Nebel, der aus dem Mund kroch, während die Lautlosigkeit ihn beinahe erdrückte. Dann tauchte er ein.
Licht erfüllte Kanaael, und seine Atmung beschleunigte sich. Ein Schweißfilm hatte sich auf seine Stirn gelegt. Nach und nach verblasste die grelle Helligkeit, seine Augen gewöhnten sich endlich an die intensiveren Farben in seiner Umgebung, und schließlich sah er, was Laarias sah.
Er hatte recht behalten. Der Haushofmeister träumte von den Ereignissen des Tages. Gerade befanden sie sich in den Katakomben. Er erkannte es an den hohen Buchreihen, dem modrigen Duft und den vielen Fackeln, die das düstere Gewölbe im Keller des Acteapalasts erhellten. Laarias trug eine hellbraune, mit goldenen Mustern verzierte Sarkos-Tunika, die an der Seite mit roten Bändern geschlossen wurde und von dem seltenen Boctaostoff der Seidenweberin hergestellt worden war. Es war die offizielle Kleidung des Haushofmeisters der suviischen Herrscher, und sie verlieh seinem freundlichen Auftreten die nötige Würde. Mit verschränkten Händen stand er vor vier Wachen, die die Köpfe trotzig nach oben reckten. Ihre Mienen drückten Missbilligung aus. Zwei von ihnen hielten ihre Schwerter so krampfhaft umklammert, dass Kanaael glaubte, ihre Handrücken weiß hervortreten zu sehen.
»Ihr habt sie entkommen lassen! Ausgerechnet heute! Was macht das für einen Eindruck auf die Gesandtschaft? Sie werden uns für unfähige Tölpel halten …«
Kanaael ging näher an das Geschehen heran, unsichtbar für alle Anwesenden, denn er war kein gewollter Bestandteil dieses Traums. So viel hatte er bereits gelernt. Er war lediglich Beobachter.
Wen habt ihr entkommen lassen?, fragte er stumm.
»Was, wenn die Gesandtschaft von dem Diebstahl wusste?«, warf eine der Wachen ein.
»Ihr solltet vorsichtig mit Euren Worten sein, Peerkan«, sagte Laarias nun etwas ruhiger. »Das wird die Gesandten der Herbstlande verärgern. Nachdem wir bereits versagt haben …«
»Aber die Diebe stammen ebenfalls aus Syskii. Zumindest ließ ihr Aussehen darauf schließen. Ein sehr merkwürdiger Zufall, wenn Ihr mich fragt.«
»Ich werde es im Hinterkopf behalten. Habt Ihr Nachrichten aus dem Palastgarten?«
Ein anderer Wächter schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Also sind sie tatsächlich entkommen.« Ein Seufzen.
Bei Suv, ich bin zu spät! Sie haben sich bereits über die Diebe unterhalten! Ich muss wissen, wer sie sind … Was sie gestohlen haben …
Eisige Kälte kroch Kanaaels Glieder empor, und ein Frösteln durchlief seinen Körper, während er Laarias weiter anstarrte, der nichts davon bemerkte.
Ich muss wissen, was hier heute geschehen ist. Ich brauche Antworten!
Die Geräusche verstummten.
Ich bin zu spät eingetaucht! Bitte …
Alle Farben wichen aus den Gegenständen, die Kleidung des Haushofmeisters verlor ohne Vorwarnung die hellbraune Tönung. Die Goldstickereien wurden ganz blass ebenso wie die roten Bänder.
Was geht hier vor?
Als würden die anwesenden Männer spüren, dass jemand in der Nähe war, wandten sich alle in seine Richtung, doch sie blickten ihn nicht direkt an, sondern sahen durch ihn hindurch. Kanaael spürte, wie er erbleichte. In den Augen der Männer lag ein gequälter Ausdruck, ihre Züge verkrampften sich, als hätten sie starke Schmerzen, und nach und nach begannen sie sich zu krümmen. Sein Blick flog zu Laarias. Grau. Wie eine verwelkte Frühlingsblume.
Ohne einen Hauch von Leben, schoss es ihm durch den Kopf. Ein Beben durchlief seinen schmächtigen Körper, während er zu begreifen versuchte, was er sah.
»Kanaael?«
Eine weibliche Stimme, von überall und nirgends zugleich.
Schlagartig wurde Kanaael aus dem Traum gerissen. Schmerz. Ein Prickeln auf seinem Rücken, wie tausend kleine Nadelstiche. Und Schwärze. Dann ein grelles Licht.
Ohne Vorwarnung kehrte sein Geist in seinen Körper zurück, und er keuchte vor Qual auf. Kleine goldene Blitze explodierten um seine Augen, und im ersten Moment fehlte ihm jede Orientierung. Dann erinnerte er sich. Er stand noch immer an der Treppe, die in die unteren Stockwerke hinabführte.
Erschrocken zuckte er zurück und riss gleichzeitig die Augen auf, während er abrupt den weichen Stoff des Vorhangs losließ. Dann drehte er sich ertappt zu seiner Mutter um. Wie im Protokoll festgehalten, wurde sie von zwei finster dreinblickenden Wächtern begleitet, die sie in einem Abstand von drei Fuß flankierten.
Mit einer fahrigen Geste schickte seine Mutter Pealaa De’Ar, Herrscherin des Sommervolks, sie fort und wartete, bis sie außer Hörweite waren. Wie üblich trug sie eine dunkelblaue, weit fallende Robe. Er wusste, dass sie das Gewand eilig über ihr Nachtkleid gestreift hatte. Das hatte sie bereits getan, als er ein kleiner Junge gewesen war. Ihre dunklen Locken waren zu einem kunstvollen Zopf geflochten, der ihr bis zur Hüfte reichte, und ihre Haltung war würdevoll wie immer, das Kinn leicht erhoben. Sobald die Männer nicht mehr in der Nähe waren, musterte sie ihn mit einem besorgten Ausdruck, und er zog den Kopf ein. Sie durfte nicht erfahren, was er getan hatte.
»Du solltest längst schlafen. Was tust du hier? Ist alles in Ordnung?«
Kanaael hielt den Kopf gesenkt. »Ich hatte Hunger.«
Er spürte, dass sie ihn durchdringend ansah, denn seine Lüge war einfallslos. Andererseits führte die Treppe hinter dem Vorhang auch zu den Küchenräumen im Untergeschoss.
»Und deswegen schleichst du nachts durch die Gänge? Du hättest Mondfrieden schicken können.«
Bei der Erwähnung seines Kammerdieners verzog Kanaael das Gesicht. Der alte Kauz hatte immer ein Auge auf ihn, wie ein Schatten lauerte er überall. Zu seinem Glück besaß der alte Diener einen tiefen Schlaf.
»Oder hat es mit den Ereignissen der letzten Tage zu tun?«, fuhr Pealaa fort.
Er hörte das leise Lächeln in ihrer Stimme, wagte es jedoch noch immer nicht, sie anzusehen. Vor seiner Mutter etwas zu verbergen war genauso sinnlos, wie eine Gebetsstunde im Suv-Tempel zu schwänzen.
»Also?«
Kanaael nickte zögerlich und hob den Blick. Im selben Moment riss Pealaa die kohlschwarzen, schräg stehenden Augen auf und starrte ihn mit einem Blick an, den er nicht zu deuten vermochte. Grob griff sie ihm unter das Kinn, hob es ruckartig in den Lichtschein des knisternden Feuers und unterzog ihn einer eingehenden Musterung.
»Deine Augen …«, hauchte sie. »Sie haben die … Farbe … sie schillern in den vier Farben der Götter.«
»Mutter …«, setzte er flehend an. Ihm wurde schlagartig heiß und kalt gleichzeitig.
»Hörst du sie?«
Ohne Zweifel meinte sie die Träume. Ein Kloß im Hals machte es ihm unmöglich zu antworten. Woher wusste sie davon? Etwas an der Art, wie sie ihn anblickte, jagte ihm gewaltige Angst ein. So hatte sie ihn noch nie zuvor angesehen. Ungeschickt versuchte er sich dem Griff seiner Mutter zu entwinden. Vergeblich. Um sie herum schienen die Träume lauter zu werden, ihre Aura war überall. Albträume und Hoffnungen sammelten sich in der Luft um Kanaael.
»Hörst du sie?« Auf einmal war ihr Gesicht ganz nah.
»Ich weiß nicht …«, begann er, wurde jedoch von Pealaa unterbrochen, die ihre schlanken Finger in seinen Oberarm krallte.
»Du kannst sie hören, nicht wahr? Sie liegen in der Luft, sie locken dich an … Ach, ich hätte es ahnen müssen, ich hätte … deine Augen …«
Auf einmal wirkte sie ganz verloren. In diesem Moment hatte sie die Hülle der Herrschergattin abgelegt, alles an ihr kam ihm fremd vor. Furcht und Schreck standen ihr ins Gesicht geschrieben. Stumm starrte er zurück, während eine Gänsehaut seine Arme überzog.
Lange sah sie ihn an und sagte nichts, und das machte ihn noch nervöser. Schließlich holte sie tief Luft, ihre Haltung war nun wieder die einer Königin, gefasst und beherrscht. Eine erlernte Fassade.
»Du wirst mir alles erzählen, Kanaael. Aber nicht hier. Die Wände haben Ohren, es ist zu gefährlich.« Sie wandte sich den im Hintergrund stehenden Wächtern zu. »Schickt nach Nebelschreiber. Sagt ihm, ich bin unten im Garten, er wird wissen, wo er mich finden kann. Ich muss mit meinem Sohn reden. Allein.«
Der gebieterische Unterton und ihre würdevolle Haltung straften ihren panischen Blick Lügen, doch nur Kanaael erkannte die Angst in ihren Augen. Angst vor ihm? Ohne zu zögern, führte ihn seine Mutter die Treppe hinunter, Gänge und Korridore entlang. Überall begegneten ihnen Angestellte, die das Essen für den kommenden Tag vorbereiteten oder sich um die Wäsche kümmerten. Einige warfen sich als Zeichen des Respekts auf den Boden und berührten mit Stirn und Nase den Untergrund. Andere, die in der Hierarchie höher standen oder aus einflussreichen Familien an den Hof gekommen waren, um politisch aufzusteigen, verbeugten sich lediglich.
Pealaa zerrte ihn hinaus, durch den prächtigen, unter Glas liegenden Garten, der fast doppelt so groß war wie die Palastanlage selbst und die Rückseite weitflächig einschloss. Ein Zischen ging durch die eigens aus Keväät angelieferten und eingepflanzten Bäume, der Duft von Frühling war allgegenwärtig und weckte in Kanaael stets Fernweh. Im Garten gab es für jedes der Vier Länder eine eigene Abteilung. Die weiten, sattgrünen Landschaften der Frühlingswelt hatten ihn schon immer wie magisch angezogen.
Nun rauschte in der Ferne ein Sandsturm an den hochragenden Mauern der Wüstenstadt entlang, durch die eingelassenen Öffnungen an den oberen Fenstern heulte der Wind. Tagsüber waren die Glaskuppeln des Gartens mit Tüchern überdeckt, damit die Pflanzen nicht ungeschützt der Hitze ausgesetzt waren, doch nachts strahlte der volle Mond auf die zauberhafte Landschaft des Frühlings.
Sie näherten sich dem Springbrunnen, der vor Jahrhunderten den Frieden zwischen Herbst- und Sommervolk besiegelt hatte. Die silberfarbenen Fontänen ragten in den klaren Nachthimmel. Verschlungene Äste und Blätter formten einen alten Baum, den Lebensbaum Sys der Herbstgöttin. Ein Symbol ihres Volks und ein Zeichen der Verbundenheit. Es war also kein Wunder, dass die Herrscherfamilie Ar’Len das Symbol in ihr Wappen aufgenommen hatte.
Das Wasserplätschern übertönte nun alle anderen Geräusche, und Kanaael begriff, warum seine Mutter ihn hergebracht hatte. Niemand sollte ihre Unterhaltung mit anhören.
Pealaa De’Ar blieb vor ihm stehen und wandte sich ihm zu. »Hör mir gut zu, mein Sohn. Hör mir genau zu«, flüsterte sie eindringlich. Ihre versteinerte Miene erschreckte ihn. Sein Herz hämmerte schnell gegen seine Rippen. »Die Welt ist gefährlich, Kanaael, die Welt ist grausam. Ganz besonders zu jemandem wie dir. Deine Gabe bedeutet den Tod, mein Liebling, du darfst sie niemandem offenbaren. Niemals.«
»Wie meinst du das?«
»Ich liebe dich. Egal, was kommen mag. Das sollst du wissen. Du bist nicht allein, und wir schaffen das!« Sie schlang die Arme um ihn und presste ihn an sich, so fest, dass er ihren heftigen Herzschlag spüren konnte. Sie hatte keine Angst vor ihm. Sie hatte Angst um ihn.
»Eure Hoheit!«
Kanaael drehte sich zu der Stimme in seinem Rücken um und erblickte Nebelschreiber, Fallah, erster Diener seiner Mutter. Angestellte im Palast besaßen keinen eigenen Namen, sondern nur solche, die man ihnen gegeben hatte.
Nebelschreiber trug einen hellbraunen Überwurf über seinem weißen Leinenhemd und den weiten Hosen. Er war nicht formell gekleidet – wahrscheinlich hatte man ihn gerade geweckt. Das lockige braune Haar war zu mehreren Zöpfen geflochten, die von grauen Strähnen durchzogen wurden. Auch sein Blick wirkte gehetzt. Er hastete den Kiesweg entlang, und der dunkle Bartschatten ließ ihn müde erscheinen. »Eure Hoheit, was hat das zu bedeuten?«, fragte er, als er sie erreicht hatte, und sah von einem zum anderen.
Pealaa griff abermals unter Kanaaels Kinn, hob es gegen das Mondlicht und winkte Nebelschreiber wortlos heran. Zögernd trat er einen Schritt näher und sog scharf die Luft ein. »Bei Suv und den heiligen Göttern!«, entfuhr es ihm. »Er hat …«
»Was können wir tun?«, unterbrach ihn Pealaa.
»Ich brauche erst Gewissheit, Eure Hoheit. Ich muss seinen Rücken sehen.«
»Meinen Rücken?«
Kanaael versuchte zu begreifen, was vor sich ging. Die plötzliche Furcht, die seine Mutter ausstrahlte, verängstigte ihn selbst. Hilfesuchend griff er nach ihrer Hand. Sie trat hinter ihn und legte einen Arm um seine Schulter.
»Wenn Ihr gezeichnet seid, dann wissen wir, was zu tun ist.« Nebelschreiber wirkte nun angespannt, geradezu konzentriert. »Ihr werdet dann aber auch mein Geheimnis kennen.« Er blickte hinter Kanaael zu dessen Mutter. »Eure Hoheit, das kann ich nicht zulassen. Ihr seid die Einzige, die über meine Herkunft Bescheid weiß. Wir werden wohl oder übel das Risiko eingehen und ihm Raschalla geben müssen.«
Die Pflanze des Todes? »Wovon redet ihr?«, fragte Kanaael.
»Nebelschreiber, du machst ihm Angst!« Seine Mutter fasste ihn bei den Schultern und drehte ihn zu sich herum. »Mein Liebling, du hast eine Gabe in dir, die sehr gefährlich ist. Für dich und für andere. Wenn irgendjemand davon erführe, würde man dich töten. Hast du jemals mit irgendwem darüber gesprochen?«
Bis auf die Auseinandersetzung mit der Amme … »Nein.«
»Suv sei Dank!« Fast schon ungläubig schüttelte Nebelschreiber den Kopf. »All die Jahre und niemand hat etwas gemerkt. Wir können froh sein, dass er keinen Schaden angerichtet, dass ihn niemand, der die Zeichen lesen kann, mit entblößtem Rücken gesehen hat …« Er wandte sich Kanaael zu. »Und Raschallawird Euch nichts anhaben können, wenn Ihr tatsächlich ein Traumtrinker sein solltet. Ihr werdet lediglich vergessen, und Eure Kräfte werden schwächer, aber nicht versiegen – wenn Ihr denn zum Verlorenen Volk gehört, mein Prinz. Deswegen muss ich sehen, ob Ihr ein Gezeichneter seid, denn nur Kinder des Verlorenen Volks sehen andere Gezeichnete. Für das bloße menschliche Auge ist nichts zu erkennen.«
Die Worte des Fallah ergaben keinen Sinn. All die Bezeichnungen klangen fremd in seinen Ohren, Kanaael hatte noch nie etwas davon gehört. »Ich bin … ein Gezeichneter? Das Verlorene Volk?«
»Das ist mehr, als er wissen sollte«, zischte Pealaa über seinen Kopf hinweg. »Nun sieh dir schon seinen Rücken an!«
Nebelschreiber tat, wie ihm befohlen. Seine kalten, schweißnassen Finger erzeugten in Kanaael eine Übelkeit, die er sich nicht erklären konnte. Sacht schob der Diener sein Nachthemd nach oben und fuhr unsichtbare Linien auf seinem Rücken nach. Erneut spürte er das leichte Prickeln der Nadelstiche auf seiner Haut. Kanaael konnte ihn fluchen hören. Schließlich trat Nebelschreiber einen Schritt zurück und ließ das Hemd fallen. Kanaael spähte über die Schulter und sah, wie Nebelschreiber abermals bedauernd den Kopf schüttelte.
»Es tut mir leid, Eure Hoheit. Aber Euer Sohn ist ein Traumtrinker.«
Laute Stimmen erschollen aus dem vorderen Teil des Gartens, Schritte, die rasch näher kamen. Befehle wurden gerufen.
Pealaa De’Ar stellte sich vor Kanaael, sodass er nicht sehen konnte, wer sich vor ihnen auf den Boden warf. Er hörte nur die aufgelöste weibliche Stimme: »Ihr seid in Gefahr, Eure Hoheiten. Es gab einen Angriff auf Laarias Del’Re, man hat ihn im Schlaf attackiert. Er liegt im Sterben …«
Kanaael spürte, wie ihm alles Blut aus den Wangen wich und seine Beine ungewohnt kraftlos waren. Unmöglich. Wer sollte Laarias Del’Re, einen der am besten bewachten Männer des Landes, angreifen können? Es sei denn …
Ein Gedanke keimte in ihm auf, so abscheulich, dass er es nicht wagte, ihn zu Ende zu spinnen …
Tiefe Schwärze griff nach seinem Geist, vernebelte seine Gedanken und raubte ihm die Luft zum Atmen. Noch ehe er begriff, wie ihm geschah, stürzte er zu Boden und verlor das Bewusstsein.
2
Verloren
Ordiin, Winterlande
Acht Jahre später
Bitter und undurchsichtig klangen die Erinnerungen an die Bilder, die Naviia O’Bhai im Schlaf gesehen hatte, in ihr nach. Ihre Gedanken kreisten um den Traum, der sie nun schon seit Wochen heimsuchte. Sie erinnerte sich nicht an Einzelheiten, nichts schien greifbar zu sein. Alles war verschwommen.
Grübelnd versuchte sie sich zu entsinnen, welche Details sie dieses Mal bewusster wahrgenommen hatte, aber ohne Erfolg. Es war mehr das Gefühl einer tiefen Vertrautheit, die sie jedes Mal verspürte, wenn sie erwachte. Trotzdem gab es eine Ausnahme. Etwas, an dem sie sich festhalten konnte. Eine Person, die sich in ihr Bewusstsein geschlichen hatte, und auch das Einzige, was sie von dem Traum behielt. Sie erinnerte sich an den jungen Mann mit den wilden Augen, die in allen Farben zu schillern schienen, und an den ernsten Ausdruck, der sich in Entsetzen verwandelte, wenn er sie erblickte. Und dann war da das Nichts.
»Wir hätten uns in dem Gasthaus einmieten sollen«, murmelte Jovieen O’Jhaal in den dicken Schal hinein, der sein Gesicht fast gänzlich verhüllte, doch Naviia konnte seine Worte deutlich verstehen. Der Hauch eines Vorwurfs schwang in ihnen mit. Umso mehr ärgerte sie sich darüber, den Weg von Galmeen nach Ordiin nicht allein zurückzulegen.
Jäh verblasste die Erinnerung an den Traum, und sie wurde sich erneut ihrer Umwelt bewusst. Ruhe und Kälte hingen im Schatten des massiven Talveen-Gebirges, das wie eine dunkle Festung in den wolkenverhangenen Himmel ragte und die nördliche Grenze der Winterlande markierte.
Jovieen zog die Nase hoch, seine Brauen waren von Schnee bedeckt, und die klaren hellblauen Augen blickten sie im Schein der Lampe furchtsam an. »Dieser Abend ist mir nicht geheuer.«
»Dir ist nie etwas geheuer. Du fürchtest dich auch vor kleinen Nagetieren, die aus dem Gebüsch springen.«
»Das war bloß einmal, und du hast im Grunde genauso viel Angst wie ich. Du bist nur zu stolz, es zuzugeben.«
Naviia tat seine Bemerkung mit einer Geste ab. Ihr Vater hatte darauf bestanden, dass ihr ein männlicher Begleiter zur Seite stand. Zwar waren Frauen in Talveen, das im Volksmund auch Winterlande genannt wurde, aufgrund der Eigenständigkeit der Clans sehr selbstständig und nicht auf eine schützende Hand angewiesen. Da sie aber noch nicht volljährig war, blieb ihr nichts anderes übrig, als sich dem Wunsch ihres Vaters zu beugen. Die Wahl ihres Begleiters war ausgerechnet auf den tollpatschigen und ängstlichen Jovieen gefallen, der Sohn des besten Freunds ihres Vaters. Schon als kleines Mädchen war sie ihm körperlich überlegen gewesen.
»Wir hätten trotzdem in Galmeen bleiben sollen.«
»Sei nicht albern, Jovieen. Der Markt hat die Kosten für eine Unterkunft in die Höhe getrieben, bei unseren mageren Verkäufen hätten wir uns gar keinen Schlafplatz leisten können. Außerdem sind wir allein; hier ist weit und breit keine Menschenseele.«
Ihr Begleiter hob die hellen Brauen, was ihn noch ängstlicher aussehen ließ. Seine Hand wanderte zu dem dicken Wollschal und zog ihn herab. »Eben das kommt mir komisch vor.«
»Du machst dir mal wieder viel zu viele Gedanken«, entgegnete sie.
Dabei konnte Naviia durchaus nachvollziehen, warum er sich sorgte. Die Nahrungsmittel waren knapp, die Menschen lebten in ständiger Kälte, und so kurz vor den Dunkeltagen konnte es manchmal zu Diebstählen kommen. Doch seine übertriebene Panik verschlechterte ihre Laune.
Heute war das Geschäft besonders schleppend gelaufen und das, obwohl sie außergewöhnlich viele Hraanosfelle bei sich gehabt hatte. Ihr Vater hatte die Tiere geschossen, damit sie über die Dunkeltage genügend Kerzen und andere Lebensmittel als Fleisch für ihre kleine Hütte am Stadtrand beschaffen konnten. Sie teilten sich die Arbeit, die anfiel, um in der kältesten Region des Landes zu überleben. Und es war ein Kampf. Jedes Jahr aufs Neue.
Naviia schloss für einen Moment die Augen. Wie jedes Mal, wenn sie sich in einer größeren Stadt aufhielt, war es ihr unangenehm gewesen, durch die breiten, teils gepflasterten Gassen zu marschieren. Sie war nicht daran gewöhnt und würde sich auch nie an das seltsame Gefühl gewöhnen, das sich jedes Mal einstellte, sobald sie die Tore einer Großstadt passierte. Hier war nichts wie in ihrem kleinen Dorf. Jeder schaute nur auf sich selbst, und es gab keinen echten Zusammenhalt, keine Gemeinschaft: Niemand half seinem Nächsten über die Dunkeltage hinweg.
»Die Dunkeltage werden dieses Jahr härter als sonst«, hörte sie sich sagen und fragte sich im selben Moment, warum sie freiwillig ein Gespräch begann.
»Wie kommst du darauf?«
»Es waren mehr Leichen in der Stadt.«
Sie schwiegen für einen Augenblick und hingen ihren Gedanken nach. Schließlich fragte sie: »Erinnerst du dich noch daran, wann du deine erste Eisleiche gesehen hast?«
Jovieen schüttelte den Kopf. »Nein, und du?«
»Natürlich.«
»Und?« Er sah sie an.
»Was – und?«
»Wie war es?«
»Es war ein Tag wie heute. Die Kälte war bis in die entlegensten Winkel der Stadt gekrochen. Ich bin mit Vater dorthin gereist, um Felle zu verkaufen, und plötzlich lag sie einfach mitten auf der Straße. Die Menschen sind über sie hinweggestiegen, als wäre sie gar nicht da. Ihre Lippen waren blau, die Augen weit aufgerissen und so … leer.« Naviia stockte und versuchte, ihrer Stimme einen neutralen Ton zu verleihen. Sie wollte sich keine Blöße geben, nicht vor Jovieen. »Und sie war mager, fast ein Skelett. In ihren grauweißen Haaren hatten sich kleine Eiskristalle gebildet, und niemand hat von ihr Notiz genommen.«
Ebenso wenig wie von ihnen heute. Eine lange Schlange hatte sich vor dem örtlichen Fleischer gebildet, Kinder spielten zwischen den dunkelblauen Gerim-Roben der wohlhabenderen Bürger Galmeens, die ihre dick gefütterte Winterkleidung stets mit einem Zeichen des Reichtums zu überspielen versuchten. Sie wollten unter keinen Umständen zeigen, dass sie unter dem teuren Material doch nur dieselben Lederanfertigungen trugen wie alle anderen. In der nördlichsten Großstadt des Landes hatte kaum jemand Interesse für ihre Felle gezeigt. Dabei hatte sie nur noch heute die Möglichkeit zum Verkauf gehabt. Die zwölf Felle, die übrig geblieben waren, lagen jetzt hinten auf dem massiven Holzschlitten, den ihr Vater einst zu seiner Vermählung mit ihrer Mutter als Geschenk erhalten hatte und der nun von Nola, ihrem Yorak,durch die Winterlandschaft im Norden Talveens gezogen wurde. Ein typisches Merkmal für den Körperbau des Tiers war der kurze, massige Rumpf mit seinen relativ langen Gliedmaßen, der immer den Anschein verlieh, als wären seine Beine Stelzen. Dazu hatte es einen erhöhten Widerrist, der das Reiten auf dem Yorak erschwerte, aber nicht unmöglich machte.
Außer dem knirschenden Schnee unter Naviias Lederschuhen war kein Laut zu vernehmen, und sie war froh, dass die schmale Passstraße in ihr kleines Dorf bereits von einigen Händlern befahren worden war, denn jede Kraftanstrengung war ein Angriff auf ihre spärlichen Energieressourcen, und sie wusste, dass es in den letzten Wochen der Dunkeltage auf jede Reserve ankam.
»Glaubst du nicht, wir haben einen ungünstigen Zeitpunkt für die Rückreise erwischt?«
»Weshalb sorgst du dich eigentlich so? Wir haben eine gute Ausbildung genossen. Ich jedenfalls weiß mich zu wehren, wenn es drauf ankommt.« Naviia deutete an die Stelle ihres breiten Gürtels aus Hraanosleder, an der ihr Langdolch in einer kleinen verschließbaren Halterung angebracht war.
»Ich meine nicht die Kinder, die für ihre Familie etwas erbeuten wollen. Hast du nicht die Geschichten über die Jäger der Nacht gehört?«
»Nein, welche Jäger?«, fragte sie unwirsch und blieb dann stehen, damit Nola aufschließen konnte. Der Schnee knirschte lauter unter ihren Sohlen, als sie schneller ging.
»Im Süden des Landes sollen Männer aufgetaucht sein. Dunkelhaarig, braun gebrannt. Sie tragen keine Stadtwappen, und ihre Kleidung gibt auch keine Auskunft über sie, aber sie sind vermummt. Angeblich ziehen sie von Dorf zu Dorf und töten unschuldige Menschen.«
Naviia unterbrach ihren Begleiter mit einem spöttischen Lachen und erntete dafür einen entrüsteten Blick. Jovieen zog sich seine Kapuze über die weißen Haare und verschränkte beleidigt die Arme vor der Brust. An seinem Kinn ließ sich bereits der erste Bartwuchs erahnen, aber mit den herrschaftlichen Bärten des Ordiinclans war er noch nicht zu vergleichen.
»Es ist wahr!« Jovieen machte eine ungestüme Geste, um seine Worte zu unterstreichen. »Die Wanderer haben es erzählt! Und sie sagen, dass die Jäger der Nacht auf dem Weg zu uns sind … dass es das Beste sei, zu fliehen.«
»Ich habe selten so einen Unfug gehört. Vermummte schwarzhaarige Männer, die Dörfer überfallen, in denen längst nichts mehr zu holen ist? Wir leben in Talveen, wir kommen nicht aus Suvii oder Keväät. Ich kann verstehen, wenn sich das Sommervolk Sorgen macht, aber wir? Bei uns gibt es nichts.«
»Du wirst dich früher oder später noch an meine Worte erinnern!«
Würde er denn nie damit aufhören? Abgesehen vom wandernden Volk, das durch alle Vier Länder zog und Geschichten aus der Ferne mitbrachte, gab es solche Männer in den Winterlanden nicht. Sie würden auffallen wie ein bunter Farbstrich im Schnee. Nichtsdestotrotz hinterließen Jovieens Worte ein unangenehmes Gefühl in ihrem Magen. Sollte es diese Männer geben, dann konnte es nur einen Grund haben, weshalb sie nach Talveen reisten. Ein Verdacht keimte in ihr auf.
Was, wenn sie hinter mir her sind? Hinter mir und Vater …?
Ihre Hand glitt zu dem sichelförmigen Anhänger um ihren Hals, und sie spürte eine tief verborgene Angst in sich aufsteigen. Sie war mehr, als sie zu sein vorgab. Ihr Vater hatte ihr stets eingebläut, dass es irgendwann so weit sein konnte. Doch niemals hatte sie damit gerechnet, tatsächlich betroffen zu sein. Sie lebten im nördlichsten Dorf Talveens – wer sollte sie dort je finden?
Durch die dichten Bäume rechts von ihr nahm sie unvermittelt ein Glimmen wahr, schwach zwar, aber trotzdem deutlich zu sehen. Sie erschrak. Hinter dem Wald lag ihr Dorf Ordiin, in dem fünfzig Familien mit ihren Kindern und weiteren Verwandten lebten. Neben der Jagd verdienten sich die Menschen dank der vielen tollkühnen Reisenden, die sich ins Gebirge wagten und im Dorf eine letzte warme Mahlzeit und eine windgeschützte Unterkunft suchten, ihren Unterhalt. Wegen des breiten Karrens waren sie gezwungen, die mühsamere Strecke zu nehmen, die einmal um den Wald herumführte, obwohl es kleinere Trampelpfade durch den dichten Baumbestand gab. Vor Jahrzehnten hatte man das Dorf inmitten des Walds gegründet und für den aussichtsreichsten Siedlungsplatz einiges an Holz gerodet. Jetzt verfluchte sie den ungünstigen Standort.
Vögel kreischten auf, Schatten flogen mit harten, schnellen Flügelstößen in die Höhe und über sie hinweg, fluchtartig gen Süden. Alarmiert legte Naviia den Kopf in den Nacken und sah am Himmelszelt gewaltige schwarze Rußwolken, die mit den tief liegenden Wolken verschmolzen. Das war kein einfaches Lagerfeuer, das da brannte.
»Bei den Göttern!«, entfuhr es ihr.
»Die Jäger«, raunte Jovieen, der ihrem Blick gefolgt war.
»So weit im Norden, das ist doch lächerlich.« Aber sie bemerkte das Beben in ihrer Stimme selbst. Mit heftigem Herzklopfen trieb sie das Tier an. Zitternd beschleunigte Jovieen seine Schritte und strauchelte prompt.
»Reiß dich gefälligst zusammen! Mit so was machst du Nola nur nervös, und dann scheut sie noch!«, fuhr sie ihn an, um ihre eigene Furcht zu überspielen. Sie wusste selbst, wie biestig sie klang, aber darauf konnte sie gerade keine Rücksicht nehmen.
»Aber …« Jovieen sah sie mit seinen weißblauen Augen angsterfüllt an. »Woher willst du wissen, dass es nicht doch die Jäger der Nacht sind?«
»Das weiß ich nicht! Aber von deinem Gerede wird die Situation auch nicht besser«, erwiderte sie verbissen und starrte in die Dunkelheit. Der Neuschnee machte sie viel langsamer, und als ihr der plötzlich auffrischende Nordwind Tränen in die Augen trieb, stülpte sie sich den dicken Schal über Mund und Nase.
Die Stille, die nun zwischen ihr und Jovieen stand, war unangenehm. Dennoch war Naviia froh, dass er schwieg. Seine Worte hätten ihre Unruhe nur verstärkt. Den Gedanken daran, dass man sie finden könnte, ließ sie nicht zu.
Als plötzlich Ruß in der Luft lag, verschwand die klirrende Klarheit der Winterlandschaft schlagartig. Sie waren noch einige Hundert Schritte von den Holztoren des Dorfs entfernt, und erst nach der nächsten Biegung waren endlich die drei Lehmtürme Ordiins zu sehen: Süd-, Ost- und Westturm. Solange sich Naviia erinnern konnte, waren sie der größte und einzige Schutz gegen Eindringlinge gewesen – und bis auf ein paar harmlose Diebe hatte es nie welche gegeben.
Während der Dunkeltage, wenn die Sonne nur selten und als dünner Lichtstreifen am Horizont auftauchte, gaben ihr die massiven Türme ein Gefühl von Sicherheit. Einen Nordturm hatte man nicht erbaut, denn hinter der nördlichen Umzäunung erhob sich das massive schwarze Gestein des Talveen-Bergs, das sich drohend wie eine göttliche Faust über dem Tal aufbäumte. Und dann war da noch der Pass, der direkt ins Ungewisse führte.
Nun standen alle drei Türme in Flammen. Gierig züngelten sie an den Holzdächern empor, schossen einige Armlängen hoch in den Himmel und machten beinahe die Nacht zum Tag. Verzweifelte Schreie drangen an ihr Ohr, vermischten sich mit dem Weinen von Kindern.
Naviia wechselte einen entsetzten Blick mit Jovieen. »Pass du auf die Ware und Nola auf!«, rief sie ihm zu, ließ die Zügel fallen und rannte los. Ihr Herzschlag dröhnte in ihren Ohren. Was war geschehen? Diebe, die vor dem Beginn der Dunkeltage noch die letzten Vorräte stehlen wollten? Oder doch die Jäger der Nacht?
Mit einem Blick erfasste Naviia das weit geöffnete Tor und den winzigen Marktplatz, auf dem sich die meisten Menschen versammelt hatten. Sie sah die Frau des Clanführers mit offenen Haaren – was unter anderen Umständen sicherlich für viel Gesprächsstoff gesorgt hätte –, wie sie verängstigte Kinder zusammentrieb, und die alte Heilerin, die sich am Rahmen ihrer Haustür abstützte und immer wieder den Kopf schüttelte. Nur die drei Türme brannten. Einige Männer in langen Unterhosen und offenbar hastig übergeworfenen Felltrachtenoberteilen hatten Ketten gebildet und reichten Wassereimer vom Marktplatzbrunnen bis zu den ersten Männern bei den Türmen durch, die das Feuer mit Schnee und Wasser zu löschen versuchten. Naviia sah zu der kleinen Hütte am Rand der Siedlung, die man zwischen den einzelnen Holzhütten ausmachen konnte. Ihr Zuhause, das sie gemeinsam mit ihrem Vater bewohnte. Und es brannte nicht!
Den Göttern sei Dank, vielleicht habe ich mich wirklich nur getäuscht …
»Navi!«, erklang in diesem Moment eine junge Männerstimme. Dann tauchte eine schlaksige Gestalt am Tor auf, mit kürzer geschnittenen hellblonden Haaren, die Schritte weit ausholend. Daniaan O’Raak, ihr bester Freund. Auch er war nicht ausreichend gegen den heftigen Wind geschützt, was dafür sprach, dass sie alle von dem Feuer überrascht worden waren.
»Dan, was ist geschehen?«, rief sie ihm entgegen.
»Keiner weiß es genau. Plötzlich haben die Türme gebrannt, gleichzeitig. Die Wächter konnten sich das auch nicht erklären, vielleicht waren sie einfach nachlässig …« Nach wenigen Schritten war er bei ihr, und sie musste den Kopf heben, um ihm in die Augen sehen zu können, denn er überragte sie um eine Armlänge und war zwei Winter älter als sie.
»Das waren sie noch nie.«
»Taloon hatte heute Dienst.« Mehr brauchte er nicht zu sagen, denn jeder im Dorf wusste, dass er gern mal einen über den Durst trank.
»Er hat seine Probleme doch längst in den Griff bekommen, dachte ich?«, warf sie ein.
Wem willst du etwas einreden?, schien Daniaans Blick zu sagen, aber er schwieg. Sein Aussehen brachte ihm bei nicht wenigen der jüngeren weiblichen Dorfbewohner Bewunderung ein, und als Sohn des handelsstärksten Clanmitglieds galt er überdies als gute Partie. Allerdings nicht bei Naviia. Dafür kannten sie einander viel zu lange. Außerdem wusste sie, dass ihr Vater eine solche Beziehung nicht billigen würde. Es lag nicht daran, dass er Daniaan nicht schätzte, sondern an ihrem Geheimnis, in das sie nicht einmal ihren besten Freund einweihen durfte.
»Ist jemand verletzt?«, wollte Jovieen wissen, der neben sie getreten war und die schmale Brust herausdrückte, während er Dan eindringlich ansah.
Doch nicht jetzt, dachte Naviia wütend und presste die Lippen zusammen. Die Feindseligkeiten der beiden hatten schon zu der einen oder anderen Rauferei geführt. Aus den Ställen, in denen man die Tiere untergebracht hatte, erklangen nervöse Brülllaute.
»Nein, niemand … nicht dass ich wüsste«, antwortete Daniaan nach kurzem Zögern. Er musterte sie besorgt mit seinen wolkengrauen Augen, und sie schüttelte unmerklich den Kopf.
»Wenigstens eine gute Nachricht. Hast du etwas gesehen?«
»Nein.«
»Gar nichts?«, hakte Jovieen nach.
Daniaan schüttelte den Kopf, winzige Schneeflocken hatten sich in seinem neuerdings kurzen Haar verfangen. »Nein, ich habe meiner Mutter in der Wohnstube beim Aufräumen geholfen. Du weißt ja, wie meine Schwestern sein können. Deswegen habe ich nichts mitbekommen.«
Naviia ahnte, worauf diese Unterhaltung hinauslaufen würde, und wandte ihre Aufmerksamkeit den Geschehnissen im Dorf zu. Einige Dorfbewohner traten auf den Vorplatz, auch Frauen mit schreienden Kindern auf den Armen, und in ihren Gesichtern spiegelte sich deutlich der Schrecken der Nacht wider. Ein paar Jungen halfen den Männern, die bereits abflauenden Feuer zu löschen. Der Gestank von verbranntem Stroh und Holz war unerträglich, und dichter Ruß erschwerte die Sicht. Doch sie erkannte, dass von dem Feuer keine tatsächliche Bedrohung ausging. Im Gegenteil: Die hohen Flammen waren kleinen, vereinzelten Feuerzungen gewichen, und die Arbeit der Männer trug rasch Früchte.
»Ich bin froh, dass du wohlbehalten wiedergekommen bist, ich wollte meine Familie suchen und allen beim Aufräumen helfen. Mein Vater ist sofort in die Nacht verschwunden, und meine älteste Schwester ist mit ihm gegangen.«
»Natürlich. Ich werde Nola …« Erschrocken drehte sich Naviia um und suchte nach ihrem Tier. Es stand noch immer ein gutes Stück vor den Toren der Siedlung, die Ohren nervös angelegt. Auf dem Karren dahinter stapelte sich die unverkaufte Ware. Ärger wallte in ihr auf. Auf Jovieen, weil er ihr einfach ohne nachzudenken gefolgt war, und auf sich selbst, weil sie wegen seines törichten Geschwätzes so große Angst gehabt hatte. Heute war einfach nicht ihr Tag. »Jovieen! Du hast Nola allein gelassen …«
Sie spürte, wie Daniaan sanft an ihrem schweren Zopf zog. Wie alle Mädchen und Frauen aus dem Volk des Winters trug Naviia ihr weißblondes Haar bis zur Hüfte und stets geflochten.
»Sei nicht so streng mit ihm, kleine Hranoos«, neckte er sie, was ihr sofort ein Lächeln entlockte. In Daniaans Nähe zu sein war, wie nach Hause zu kommen. Es fühlte sich gut an.
»Ich kann sehr wohl für mich selbst sprechen«, brummte Jovieen. »Und es ist dein Tier, du hättest selbst auf sie aufpassen können.«
»Ich weiß«, seufzte sie. Er hatte ja recht. Es war ungerecht, ihren Ärger jetzt an ihm auszulassen.
Jovieen zuckte bloß mit den Schultern und stampfte Richtung Marktplatz, die Schultern eingezogen und die Hände tief in den Taschen vergraben. Nachdenklich blickte Naviia ihm hinterher. »War ich zu hart?«
»Willst du eine ehrliche Antwort? Für einen Jungen war dein Ausbruch sicherlich noch milde. Für eine Frau würde ich fast sagen, dass du es übertrieben hast. Aber wir kennen dich ja und lieben deine temperamentvolle Art. Ich bin mir sicher, er versteht das.«
Sie seufzte. »In Ordnung. Danke für deine Ehrlichkeit.«
»Ich bin immer ehrlich.« Er lächelte sie auf eine so vertraute Art an, dass ihr ganz warm wurde.
»Wolltest du nicht zu deiner Familie?«
Zu ihrer Überraschung schüttelte Daniaan den Kopf. »Es ist schneller ruhiger geworden, als ich erwartet habe. Wenn du möchtest, helfe ich dir, Nola nach Hause zu bringen und die Felle aufzuhängen.«
»Das wäre natürlich großartig. Danke.« Sie lächelte zu ihrem besten Freund auf, der ihr Lächeln erwiderte, während sie sich in Bewegung setzten. In seinen Sturmaugen lag eine Zuneigung, die wie ein warmes Gebräu ihr Innerstes erreichte und sie augenblicklich ruhiger werden ließ. Stets war Daniaan an ihrer Seite gewesen. Bei ihrer ersten Jagd, ihrem ersten Schultag, dem ersten Fest für Tal, ihren Wintergott. Wie ein Schatten war er immer in ihrer Nähe gewesen und hatte über sie gewacht.
Er ging etwas zu dicht neben ihr her, sein doppelt beschichteter Handschuh streifte ihren.
Mittlerweile hatten sie den Wagen erreicht. Behutsam klopfte sie gegen Nolas Flanke und warf einen Blick zurück auf das Dorf. Das Tiergeheul und das Weinen der Kinder ebbte langsam etwas ab, und die Rauchsäule wirkte um einiges kleiner als noch vor wenigen Augenblicken.
»War es sehr anstrengend mit ihm?«, fragte Daniaan und sah sie von der Seite an.
Naviia wusste sofort, von wem er sprach. »Jovieen hat sich bemüht.«
»Er mag dich, weißt du?«
»Ach was«, sagte sie unangenehm berührt und nahm die Handschuhe ab, um Nola besser streicheln zu können. Sie wandte ihr den Kopf zu, und ihre braunen, weisen Augen schienen wie so oft einen Blick auf ihre Seele zu erhaschen. Obschon Nola ein Weibchen war und kein prächtiges Geweih oder eine so ausgeprägte Muskulatur besaß, etwas, worauf man normalerweise achtete, liebte sie das Tier dennoch abgöttisch. Vielleicht, weil es die einzige persönliche Verbindung zu ihrer Mutter war, da sie Nola noch vor Naviias Geburt bei einem Händler in Galmeen ausgesucht hatte. Rasch verdrängte sie ihre nostalgischen Gefühle und führte Nola mitsamt dem Karren in Richtung des Tors. Immer noch stieg schwarzer Rauch von den einzelnen Türmen empor, doch die Feuer waren alle erloschen. Der Geräuschpegel in der Siedlung nahm deutlich ab, und vereinzeltes Lachen klang bis zu ihnen hinüber.
»Ich meine das ernst«, sagte Daniaan.
»Ich ebenso«, erwiderte sie und vermied es, ihn anzusehen.
»Hast du gesehen, wie er mich angeschaut hat? Ich glaube, er würde mich erdrosseln, wenn …« Verlegen brach er ab und fuhr sich mit einer Hand in den Nacken.
»Wenn was?«, hakte sie nach.
Daniaan zog die Augenbrauen zusammen, schwieg aber.
»Sag bloß, er würde sich aufregen, wenn du mir in irgendeiner Weise näherkommen würdest.«
Verblüfft stellte sie fest, dass Daniaan errötete. Ein O’Raak errötete nicht! Jovieens kindliche Zuneigung war ihr bereits aufgefallen, doch dass Daniaan womöglich mehr für sie empfand als Freundschaft, durfte sie unter keinen Umständen zulassen. Er würde sie verachten, wenn er herausfand, wer … nein, was sie war.
»Mach dich nicht lächerlich«, grunzte Dan und sah plötzlich sehr konzentriert in die Ferne.
Der Widerhall von Angst klang laut in ihr nach. Sie wollte ihren Freund unter keinen Umständen verlieren, und deswegen durfte er niemals von ihrem Geheimnis erfahren.
»Ich bin froh, dass ich dich habe«, sagte sie unerwartet ernst.
»Wieso?«
»Na ja, weil du der Einzige bist, der mir etwas bedeutet. Abgesehen von Vater.« Und dem Clan, der so etwas wie ihre Familie war. Eine große, starke Familie. Sie sah Dan in die Augen. »Du bist mein bester Freund. Du kennst mich besser als irgendwer sonst aus dem Clan. Du weißt, Tal meint es nicht besonders gut mit mir. Ich will den Göttern keinen Vorwurf machen, es ist der Lauf des Lebens, dennoch schmerzt es sehr.«
»Schieb deinen Kummer nicht auf die Götter, Navi. Du bist reich gesegnet. Du bist gesund. Du bist stark. Dass deine Mutter so früh die Welt der Sterblichen verlassen musste, hat nichts mit dir zu tun.«
Naviia wurde schwer ums Herz. Wenn es doch nur der Tod ihrer Mutter wäre. Ihr Schmerz ging so viel tiefer. Die heimlichen Gebete, die fremden Riten. Wie gern würde sie sich als vollwertiges Mitglied des Clans fühlen, doch stets war sie anders. Anders als die Menschen, die sie liebte.
»Ich passe immer auf dich auf. Egal, was kommen mag, bei mir bist du sicher. Ich mag dich. Wie meine kleine Schwester.«
Lediglich zwei der Dorfältesten begrüßten sie mit einem leichten Kopfnicken, als sie vorbeigingen, ansonsten nahm niemand Notiz von ihnen. Kinder tollten herum, und ihr lautes Lachen erfüllte das Dorf mit Leben, obwohl es viel zu spät war und sie längst in den Betten liegen sollten. Aber angesichts der Ereignisse in dieser Nacht drückten wohl alle ein Auge zu. Als sie durch die Gruppe von Holzhäusern schritten, die unter dem Gewicht des Schnees fast zusammenzubrechen drohten, entdeckte Naviia ein paar Mädchen, die in einer Traube zusammenstanden, die langen weißblonden Haare notdürftig zusammengebunden, und neugierig zu ihnen herüberstarrten. Schnell senkte sie den Kopf und ging weiter, ohne nochmals in die Richtung der Mädchen gesehen zu haben. Sie hörte, wie Daniaan ein Lachen unterdrückte.
»Die würden sich die Mäuler erst dann nicht mehr zerreißen, wenn wir beide verheiratet wären.«
Naviia erschrak über seine Worte, und auch Daniaan schien erst der Sinn hinter diesem belanglos dahingesagten Satz aufzugehen. Wieder verfielen sie in Schweigen, dieses Mal fiel es unangenehmer aus. Endlich erreichten sie die schmale Holzhütte. Armdicke Eiszapfen hingen vom Vordach, das den Eingang gegen den eisigen Nordwind schützte, und der Geruch des Feuers hing schwer in der Luft.
Naviia bemerkte Jovieen, der drei Häuser weiter gerade in eine hitzige Diskussion mit seinem Vater vertieft war, der ihn mit seiner gewaltigen Körperlänge überragte. Jhanaael O’Jhaal war ein ruhiger, besonnener Mann, mit einem Bart, der geflochten bis an das untere Ende seines stattlichen Bauchs reichte. Die Männer, die hier im Norden lebten, trugen ihre Bärte meistens länger als in den anderen Ländern. Aus Stolz, weil es ein Zeichen von Macht war und weil er wärmte.
Als ihr Blick den von Jhanaael O’Jhaal kreuzte, nickte ihr der Freund ihres Vaters zu, um gleich darauf weiter auf Jovieen einzureden. Der wirkte wie ein Häufchen Elend, und Naviia verspürte sogleich Mitleid mit ihrem tollpatschigen Begleiter.
»Ich glaube, ich hätte mich noch bei ihm bedanken sollen. Für seine Hilfe heute.«
Daniaan folgte ihrem Blick und schüttelte dann den Kopf. »Nein, er wird das schon wissen. Du packst an, weil es selbstverständlich ist, und erwartest selbst keinen Dank. Für ihn wird es dasselbe sein.«
»Meinst du?«, fragte Naviia zweifelnd, während sie die ersten Felle von dem Karren hob und auf dem kleinen Vorbau vor dem Haus ablegte. Die Vorstellung eines warmen Bads weckte ungeahnte Kräfte in ihr, obwohl sie seit dem Morgengrauen auf den Beinen war.
»Ganz bestimmt. Ich bringe Nola nach hinten in den Stall. Wir treffen uns drinnen, einverstanden?«
Geschickt griff Dan nach den Zügeln und erwiderte Naviias Nicken. Anschließend spannte er Nola aus, die zufrieden schnaubte, die Ohren aufmerksam gespitzt und mit den Vorderhufen scharrend.
Naviia hob das zweite Bündel Felle vom Karren, schob mit der Schulter die morsche Holztür auf, die ihr Vater schon während der letzten Dunkeltage hatte auswechseln wollen, und betrat den in Finsternis getauchten Wohnraum. Öl und Kerzen waren teuer, und man bekam sie nur in den Städten weiter im Süden. Da ihr Vater allerdings sehr viele Tiere jagte, konnten sie auch mit Tierfetten heizen. Größtenteils diente es ihnen aber als Nahrung. Gerade über die Dunkeltage war fettreiches Essen unverzichtbar. Naviia war froh, dass sie hier im Norden frei sein konnten. Die Clans lebten in Dörfern, zahlten zwar Abgaben an größere Städte, mit denen sie ein Kriegsbündnis ausgehandelt hatten, aber sie lebten nach ihren Regeln. Die Kinder gingen zur Schule, lernten Schrift und Sprache ebenso wie alle Dialekte der Vier Länder. Im Süden, über das Frühlingsmeer und noch weiter in den Sommerlanden, waren die Bedingungen anders, das wusste Naviia. Es gab keine selbst versorgenden Clans, sondern eine einzige Familie, die über ein ganzes Land herrschte.
»Vater?«, rief Naviia nun in die Stille hinein und legte die Felle in eine Ecke. Dann spannte sie eine Leine, um sie daran aufhängen zu können.
Naviia schrie auf, als sie sich an der Kante des Esstischs stieß. Mit einem Fluch auf den Lippen wandte sie sich dem kleinen Nebenraum zu, der ihnen als eine Art Küche diente. Mit beiden Händen tastete sie nach der schalenförmigen Lampe, die auf der von ihrem Vater erbauten Holzanrichte aus Lehmholz lag, und stieß mit dem Handrücken immer wieder gegen Kochtöpfe und Tonkrüge, die niemand weggeräumt hatte.
Natürlich nicht … als wäre ich nicht die letzten zwei Nächte unterwegs gewesen.
Schließlich fand sie, wonach sie gesucht hatte, und entzündete die schmale Lampe mit dem silbernen Haken.