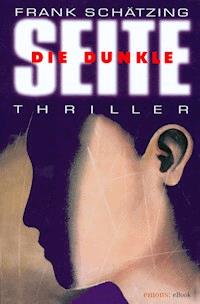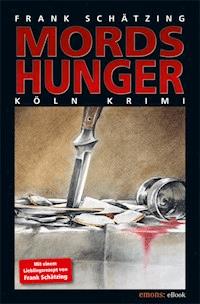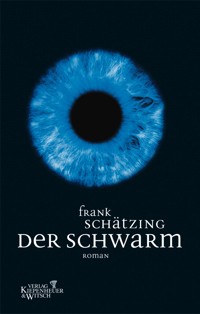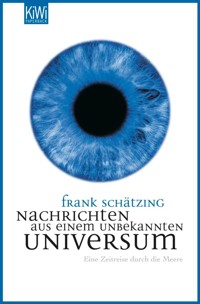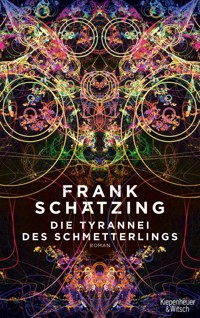
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frank Schätzings atemberaubender Thriller über eines der brisantesten Themen unserer Zeit: künstliche Intelligenz. Kalifornien, Sierra Nevada. Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter Personalknappheit zu kämpfen. Doch der Einsatz an diesem Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften Umständen in eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., einem Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg führt ihn an die Grenzen des Vorstellbaren – und darüber hinaus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 967
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Frank Schätzing
Die Tyrannei des Schmetterlings
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Schätzing
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Schätzing
Frank Schätzing ist einer der meistgelesenen Romanautoren Deutschlands. Er gilt als Visionär, dessen Szenarien oft nur einen Herzschlag von unserer täglichen Lebensrealität entfernt liegen. Viele seiner Bücher wurden internationale Bestseller.
»Tod und Teufel«, 1995
»Lautlos«, 2000
»Der Schwarm«, 2004
»Limit«, 2009
»Breaking News«, 2014
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter Personalknappheit zu kämpfen. Doch der Einsatz an diesem Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften Umständen in eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., einem Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley.
Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg führt ihn an die Grenzen des Vorstellbaren – und darüber hinaus.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung und Zwischentitel: buerogroll.com
Coverillustration: Uwe Bröckert
ISBN978-3-462-31833-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Teil I: Feinde
Afrika …
Teil II: Sierra
In der Schlucht …
Der Wind …
Hinter Clapine …
Teil III: Die Toten
Als Elmar Nordvisk …
Es herrschte kein …
Offenbar ist alles …
Teil IV: Ripper
Wach zu liegen …
Pier 78 …
Teil V: 453
0 …
An Bord …
Teil VI: Der Kristallwald
Pulsschläge …
Literatur
Dank
Für Sabina
Mein Schwarm. Mein Schmetterling. Mein Alles.
Die erste ultraintelligente Maschine ist die letzte Erfindung, die der Mensch je machen wird.
(Nach Irving John Good)
Afrika.
Die durchweichte Zeit.
Von April bis Oktober verflüssigt sich die Luft. Wie schwarzblaue Planeten hängen die Regenfronten dann über den Bergen und treiben Richtung Savanne, belebt von geheimnisvollem Leuchten. Windgeister fegen durch einen postatomar gelben Himmel, Vorboten der baldigen Flut. Die Wasserplaneten rücken träge nach, verschlucken Horizonte und Blicke, saugen den Tag in sich auf, bis sie zu einem einzigen, alles umschließenden Schwarz verschmolzen sind.
Ein Grollen wird durch die Wolke gereicht.
Es zieht von Osten nach Westen, als gäben titanische Wesen Kommandos aneinander weiter, die Jenseitigen, Nhialic selbst vielleicht, nun in der Gestalt Dengs. Vereinbarte Zeichen, mit der Reinwaschung der Welt zu beginnen, doch der erste Guss bewirkt wenig. Der rissig gebackene Boden scheint nicht fähig, die Tropfen zu schlucken. Dick und zitternd balancieren sie im Staub, entformen sich jäh und hinterlassen schnell verblassende Flecken auf dem lehmigen Krakelee. Ein eher armseliges Schauspiel angesichts der imposanten Drohkulisse, dann endet der kurze Schauer so plötzlich, wie er eingesetzt hat.
Jedes Geräusch erstirbt.
Es folgt die Stille vor der völligen Auslöschung.
Ein Ozean stürzt herab.
Binnen Minuten verwandeln sich unbefestigte Straßen in Schluchten, als sei das Land aufgeplatzt und kehre sein Innerstes nach außen. Tonnen zähen, roten Schlamms quellen hervor, blasig vom Dauergeprassel. Aus Wiesen und Viehgründen drängen Seen, ausufernde, brodelnde Flächen, auf denen Spritzwasserblüten sprießen, dicht an dicht. Was Teil fester Landschaft war, wird zur Insel. In den Elementen wütet jetzt Mascardit, der Große Schwarze, der Tod und Fruchtbarkeit bringt, niemals das eine ohne das andere. Gleich einem rasenden Organismus schießt und windet sich die Flut zwischen Gehölzen und Trockenwäldern hindurch, alles Verdorrte mit sich reißend. Dem Verfall preisgegeben, wird die alte Welt hinweggespült, jede vertraute Struktur aufgelöst, jede Gewissheit getilgt, bis zum Moment spontaner Neuordnung.
Manchmal regnet es tagelang ohne Unterlass.
Dann plötzlich klafft das triefende Wolkengebräu auseinander, so wie jetzt, da makelloses Blau den Himmel zurückerobert. Ein Blau von solcher Tiefe und Intensität, dass die Männer im Schlamm sich unwillkürlich ducken und an ihre Heckler & Koch Gewehre klammern, als könne das Blau sie einsaugen und in die jenseitige Dimension speien.
In Nhialics Reich.
Nhialic, den Menschen entrückt, nachdem Urgöttin Abuk den Himmel von der Erde trennte und niedere Gottheiten ermächtigte, die Geschicke der Dinka zu leiten – man könnte auch sagen, sie hat die Gewalt des Hochgottes unterlaufen, indem sie ihn bestahl, um den Menschen mehr zu geben, als er ihnen zugedacht hatte. Womit sie ihn beschämte und Nhialic beleidigt von dannen zog, aber als Regengott Deng mischt er sich immer noch ein, zum Segen und Verderben aller.
Fast könnte man die Geschichten glauben.
Major Joshua Agok ist Anglikaner und glaubt an Jesus, was nach westeuropäischem und amerikanischem Verständnis akute Arbeitslosigkeit für heidnische Gottheiten bedeutet, doch den Dinka ist das Entweder-oder des christlichen Monotheismus fremd. Die Missionare, die am Weißen Nil vor über hundertfünfzig Jahren Seuchen zum Opfer fielen, die späteren katholischen Verona-Patres und britischen Anglikaner, schließlich die Abgesandten der Presbyterian Church of America – sie alle haben nie begriffen, dass man an Jesus glauben und ihn zugleich problemlos ins Familienbild niedriger Gottheiten und verehrter Ahnen einpassen kann. Die Alten waren immer schon da. Sie würden den Neuzugang misstrauisch bis freundlich beäugen, ihn gewähren lassen, aber warum sollten sie seinetwegen gehen?
Verschwindet eine Kuh, wenn man eine Kuh hinzukauft?
Agok zwingt sich, den Blick aus der blauen Kuppel zu lösen.
Wir verlieren uns in Mythen, denkt er.
Und warum? Weil wir uns selber nicht mehr glauben können. Aber an irgendetwas muss man glauben. Es steht viel Gutes in der Bibel, und wer würde widersprechen, dass die Natur von Geistern belebt ist, die Seelen der Verstorbenen in ihr wirken, dass tatsächlich alles, was geschaffen wurde, materieller Ausdruck einer Welt von Geistern ist, die solcherart in unsere Dimension wechseln. Nur, was immer uns Verstand gegeben hat – es kann nicht gewollt haben, dass wir ihn nicht benutzen, um endlich diesen unseligen Bürgerkrieg zu beenden. Andernfalls wäre alles umsonst gewesen. Was wir erlitten und an Leid zugefügt haben, um unsere Vorstellungen von Freiheit durchzusetzen.
Ebendiese Vorstellungen sind jetzt das Problem.
Agok schaut hinter sich.
Kreaturen aus Lehm, blitzende Augen in Schlammgesichtern. Als habe die Erde selbst sich erhoben. Die Legende vom Golem, daran muss er denken, als er seine kleine Streitmacht überschaut. Einhundertzwanzig Golems, bis an die Zähne bewaffnet. Verschwindend wenige gegen Olonys Miliz, die das Gebiet kontrolliert, doch die Besten, die sich finden ließen. Ein Volk, dem man Gewehre in die Hand gedrückt hat, um für seine Unabhängigkeit zu kämpfen, wird nicht zur schlagkräftigen Armee, bloß weil man einen Kreis um es zieht und das Ganze Staat nennt. Aber diese Jungs sind wirklich gut. Agok selbst hat sie ausgesucht, jeden Einzelnen von ihnen. Mit konzentrierten Mienen hocken sie im Unterholz, beschattet von Tamarindenbäumen und Akazien. Solange die Sonne ihr glühendes Intermezzo gibt, bietet das Laubdach Schutz; den Regen konnte es nicht von ihnen fernhalten. Während der Wolkenbrüche ist es ziemlich gleich, wo du dich aufhältst. Die Feuchtigkeit kommt von allen Seiten, entsprechend sind sie nass bis auf die Knochen, und der rote Schlamm tut das Seine, um sie wie eine Horde lauernder Erdgeister aussehen zu lassen.
Eine kurze Atempause, denkt Agok.
Nicht eingeplant, nicht unwillkommen.
Dann werden sie den Wald verlassen und auf Olonys Stellungen vorrücken.
Der Moment, dem sie entgegenfiebern, seit die Helikopter sie vor zwei Tagen abgesetzt haben, mitten im Niemandsland.
Zu Fuß haben sie sich durch den lichten, unterholzreichen Wald bis hierher durchgeschlagen. Abseits der Lehmstraßen, die ohnehin unpassierbar sind um diese Jahreszeit. So hoch oben, im Grenzgebiet zum Norden, hat der Regen die Menschen fast vollständig isoliert. Auf dem Landweg werden die Ortschaften und Gehöfte während der kommenden Monate nicht zu erreichen sein. Im ganzen Staatsgebiet gibt es nur rund fünfzig Kilometer asphaltierte Straße, vornehmlich dazu dienend, der fernen Hauptstadt ein bisschen urbanes Flair zu verleihen. Als sie vor sechs Jahren dort die Unabhängigkeit feierten, galt der von Hütten umstandene, lärmige, bunte Marktflecken mit seinen planlos hineingewürfelten Repräsentationsbauten plötzlich als Hotspot. Ein Staat wurde geboren, und jeder wollte Geburtshelfer spielen. Im Sahara Resort Hotel, der einzig repräsentablen Adresse am Platz, drängten sich Diplomaten, Ölmagnaten, Waffenhändler, Blauhelme, NGOs und Prediger, im Gepäck Pläne für Krankenhäuser, Universitäten, Flughäfen, Ölpipelines und Missionsstationen. Wie durch Zauberhand avancierte der kümmerliche Bestand an Kraftfahrzeugen über Nacht zur Musterschau japanischer Geländewagen mit Satellitenantennen. Alles schien möglich. Alleine das Öl würde Milliarden Dollar in die Staatskasse spülen, und Hunderte Millionen an Entwicklungsgeldern lagen in europäischen Hilfsfonds bereit. Die Abspaltung von der Diktatur im muslimischen Norden, die den schwarzafrikanischen Süden so lange ausgebeutet hatte, ohne für dessen Bewohner auch nur den kleinen Finger krumm zu machen, war erreicht, nach Jahrzehnten blutiger Auseinandersetzungen. Der Diktator eilte demütig zur Unterzeichnung des Friedensvertrags und versprach beste Beziehungen zum neuen Nachbarland. Er hatte Kreide gefressen, dass es aus den Mundwinkeln staubte, schließlich lag gegen ihn ein internationaler Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, da konnte es nicht schaden, zur Abwechslung den Versöhner zu geben.
Was für eine Chance wir hatten!, denkt Agok.
Und dann haben wir es vermasselt.
Er lugt um den Stamm der Akazie, die ihm Deckung gibt. Vor ihnen erstreckt sich die Savanne. Ein karg bewachsener Rapport aus Buschwerk und einzeln stehenden Bäumen, durchsetzt von strohgedeckten Rundhütten, die den nomadisierenden Viehhirten für die Dauer der Regenmonate als Behausung dienen. Noch letzten Monat sah es hier aus wie auf dem Mars, jetzt treiben leuchtend grüne Matten aus den vollgesogenen Böden, die Baumwipfel belauben sich im Zeitraffertempo, Blüten explodieren in vielfarbiger Pracht, eine Travestie der Schöpfung. Der Geruch frischen Regens zieht heran. Über den Bergen haben sich neue Wolkenungeheuer aufgetürmt und jagen Vogelschwärme vor sich her.
Agok genießt diesen Moment, in dem die Luft von einer Reinheit ist, wie man sie während der Trockenzeiten nie erlebt. Fast schmerzhaft drängt sie in die Lunge. Er schaut zu, wie erste Schwaden aus der Ebene steigen und der Wald um sie herum zu dampfen beginnt. Die Mittagssonne sticht aus dem Zenit und entfacht einen rauschhaften Tanz der Moleküle, entreißt das Wasser den Böden, kaum dass der Himmel es hineingepumpt hat. Die Verdunstungshitze ist enorm. Bald wird die Savanne aussehen wie eingesponnen, und dann werden Agok und seine Männer Phantome sein.
Der Dunst und der Regen werden sie verbergen. Ihre einzige Chance auf offener Fläche.
Die trennt sie noch vom eigentlichen Einsatz. Fünf Kilometer liegen zwischen ihnen und der Stadt, die Olonys Kämpfer besetzt halten, einer Agglomeration von Baracken und Containern am Rand einer riesigen Ölförderanlage, die in der Ebene haftet wie aus einer anderen Welt hineintransplantiert. Der Fluss, den sie auf dem Weg dorthin überqueren müssen, dürfte seit Kurzem auf mehrfache Breite angeschwollen sein, wuchernde Randbewaldung verwehrt den Blick auf das Ölfeld dahinter. Alles, was Agok sieht, sind lose verteilte Viehherden und einzelne Wildtiere, die in Erwartung des nächsten Gusses Baumgruppen ansteuern, ein paar Antilopen, ein Elefantenpaar samt Jungen, die es sich im Schatten eines Baobabs gemütlich gemacht haben und mit den Stoßzähnen an der Rinde kratzen.
Von den paar Satellitenfotos, die ihnen die Amerikaner zur Verfügung gestellt haben, wissen sie in etwa, wie der Warlord seine Leute verteilt hat. Gerade genug Information, um den Typen aus dem Weg zu gehen. Sie offen zu bekämpfen, wäre glatter Selbstmord, ebenso gut könnten sie sich hier gegenseitig an die Bäume knüpfen und stürben mit Sicherheit einen gnadenvolleren Tod. Selbst für das Empfinden hartgesottener Söldner ist Olony ein Teufel, dessen Leute Ortschaften überfallen, Frauen schänden, foltern und verstümmeln, ihre Babys in brennende Häuser werfen und die älteren Kinder in militärische Ausbildungscamps verschleppen. Dort bringt man ihnen bei, allem und jedem mit Verachtung zu begegnen, zwingt sie, Menschenfleisch zu essen, zu vergewaltigen, Gliedmaßen abzuhacken. Wer daran nicht zugrunde geht, wird mit einer Knarre belohnt und in den Kampf geschickt. Tausende Kinder sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs verschwunden und als traumatisierte Killer wieder aufgetaucht – auf beiden Seiten.
Wir müssen dem ein Ende machen, denkt Agok.
Wie konnten wir nur so verrohen?
Buschtrommeln zu Glockengeläut, Hupkonzerte, überall Musik. In den Straßen wurde getanzt und der Name des ersten frei gewählten Präsidenten skandiert, ein Charismatiker, listenreich, studiert und weltgewandt. Seinen Stetson, den George W. Bush höchstpersönlich ihm geschenkt hat, trägt er wie eine zweite Hirnschale. Die Straßenlaternen sind mit der neuen Nationalflagge geschmückt, Fassaden verschwinden unter Plakaten der Regierungspartei, die eben noch eine Rebellenarmee war. Plastikblumen säumen den Weg zum Flughafen, wo stündlich Gäste eintreffen, Repräsentanten Chinas, der EU, Amerikas, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga. Dreißig Staatschefs haben sich angesagt, Ban Ki Moon entsteigt seiner Maschine und lacht in die Kameras. Dem Kreisverkehr im Stadtzentrum entwächst ein Pfahl, schwarz lackiert und gekrönt von Leuchtbuchstaben: »Wir waren gemeinsam unterdrückt, jetzt sind wir gemeinsam frei. Fröhliche Unabhängigkeit für alle!«
Nie wird Agok den Tag vergessen.
Fröhliche Unabhängigkeit, denkt er jetzt bitter. Aufbruch! Ein so wunderbares, großes Wort. Oder ein von der Kette gelassener Hund. In Afrika die Chiffre dafür, alte Rechnungen zu begleichen. Stoß uns das Tor zur Zukunft auf, und wir schaffen es, beim Hindurchgehen in der finstersten Vergangenheit zu landen. In den Köpfen gärt der Sündenfall. Es geht um verletzten Stolz und Viehdiebstähle, um Weidegründe, Wanderwege, abgewetzte Mythen. Nhialic hatte zwei Söhne, Dinka und Nuer. Beiden versprach er ein Geschenk. Dinka sollte eine alte Kuh erhalten, Nuer ein Kalb. In der folgenden Nacht ging Dinka in den Stall und forderte mit Nuers Stimme das Kalb ein, das ihm auch prompt ausgehändigt wurde. Als Nhialic sah, dass er seinem abgewichsten Sprössling auf den Leim gegangen war, packte ihn göttlicher Furor. Nuer, verfügte er, solle Dinka bis in alle Ewigkeit das Vieh stehlen dürfen, und wegen solchem Scheißdreck gehen wir einander an die Gurgel!
Die alte Frage, wer angefangen hat.
Keiner, und da liegt der Hund begraben. In unserer dumpfen Erinnerung waren wir immer nur Opfer.
Olony einen Dämpfer zu verpassen, wird den Bürgerkrieg nicht beenden. Er ist ein Schlächter unter vielen, doch eine erfolgreiche Offensive würde signalisieren: Wir können vielleicht nicht gewinnen – ihr aber auch nicht.
Also macht endlich Frieden!
Agoks Leute sind Saboteure. Ausgebildet von US-Militärstrategen, die ihnen gezeigt haben, wie man ein System infiltriert und von innen heraus zum Einsturz bringt. Mit Sprengstoff, Brunnenvergiftung, Desinformation. Mit der Waffe nur dann, wenn es unvermeidbar ist, also werden sie alles daransetzen, jeder direkten Konfrontation aus dem Wege zu gehen. Und natürlich wissen sie, dass es trotzdem dazu kommen wird und dass ihre Aussichten, den Einsatz zu überleben, alles andere als rosig sind.
Aber es gibt eine Chance.
Auf jeden Fall eine Chance, ordentlich Schaden anzurichten.
Geduldig sieht Agok zu, wie die Wolken heranrücken. Seine Männer sind jetzt dicht um ihn geschart, ein rot getünchter Organismus, der synchron atmet, bebt und wartet. Bei jeder Bewegung platzen kleine Krusten von ihren Kampfmonturen ab, wo die Sonne den Schlamm getrocknet hat. Dem Augenschein nach hocken sie im Matsch, tatsächlich schwimmen sie auf Öl. Der ganze Süden schwimmt auf Öl. Gründet auf Erzen, Diamanten, Gold und Silber. Fast ein Wunder, dass die Regierung des jungen Staates überhaupt ein Jahr gehalten hat, bis der Vizepräsident – ein Nuer – putschte. Seitdem kämpft die halbe Armee auf der Seite des Präsidenten – ein Dinka – und die andere Hälfte auf der Gegenseite. Die Bündnistreue unterliegt Schwankungen, gegen die der lokale Wetterbericht anmutet wie Gottes ehernes Gebot. Olony etwa: bis vor Kurzem noch der Regierung ergeben, General der Streitkräfte, doch Ergebenheit wird stündlich neu verhandelt. Jetzt kämpft er für den abtrünnigen Vize.
Vielleicht aber auch nur für sich selbst.
Wir sind alle aus dem Busch gekommen, denkt Agok, ohne Vorstellung, was uns von unseren Peinigern unterscheidet.
Jetzt immerhin wissen wir es.
Nichts.
Wir haben den Blutzoll für die Unabhängigkeit entrichtet, um zu erkennen, dass uns sonst keine gemeinsamen Werte einen. Wie auch, da sich Bündnisse aus Stämmen formieren, die historisch in Dauerfehde liegen. Dieser Kontinent gebiert die Rebellion mit der Zwangsläufigkeit, mit der Sonnenlicht Schatten produziert, als könnten wir nur in ewiger Opposition Selbstwertgefühl entwickeln, und nie wird irgendetwas spürbar besser. Na ja. Vielleicht für die, die uns die Waffen liefern. Geld zustecken. Machtwechsel befördern gegen Schürfrechte und Bohrlizenzen. Rebellion und Korruption ergeben einen Kreis. Vor Generationen wurden wir versklavt, heute versklaven wir uns selbst und tun einander umso schlimmer an, was fremde Unterdrücker uns antaten. Nicht der zornigste Regen wird die Ströme von Blut aus dem Boden spülen können, die alleine zwischen Dinka und Nuer vergossen wurden.
Aber vielleicht gewinnen wir ja heute eine kleine Schlacht, um eine große zu beenden.
Er gibt seinen Männern das Zeichen.
Geduckt, die Gewehre im Anschlag, treten sie aus dem Schutz des Waldes hinaus auf die Ebene.
Über ihnen treibt am Rand der grollenden Wasserfront, in der es jetzt fahl aufleuchtet, die Sonne dahin. Ihre Strahlen fressen sich ins dräuende Schwarz, als hätten sie die Kraft, es zu zersetzen. In einer letzten Demonstration ihrer Macht zieht sie den Dunstvorhang höher und schließt ihn über den Köpfen der Soldaten. In den Schwaden spielt ihr Licht verrückt, ein Flirren und Gleißen, dann verschluckt die riesige Wolke sie mit banaler Beiläufigkeit und entzieht der Welt alle Farben.
Schlagartig kühlt es ab.
Der Dunst wird dichter. Die Savanne wandelt sich zur Scherenschnittkulisse, ein Diorama vieler hintereinandergelegter Schichten. Abstufungen von Grau erzeugen eine theaterhafte Tiefe. Die Antilopen, die am linken Rand des Blickfelds unter die Bäume ziehen, Weißohr-Kobs mit charakteristischer Färbung und Satyrhörnern, sind zu Antilopenskizzen geworden, bloßer Umriss, eigenschaftslos. In der Waschküche fällt es schwer, Entfernungen abzuschätzen, aber Agok kennt die Gegend. Unweit von hier ist er aufgewachsen, einer der Gründe, warum er den Einsatz leitet. Die Wegmarken sind ihm vertraut, allen voran die kolossalen Baobabs, die Affenbrotbäume. Mit ihren ausladenden Stämmen und eigenartig verdrehten Ästen könnte man sie für aus dem Boden brechende Riesenkraken halten, deren erstarrten Armen kleine und immer kleinere Arme und Ärmchen entwachsen. Viele tragen seit Kurzem Blätter, was sie etwas mehr nach Bäumen und weniger nach fremdartigen Kreaturen aussehen lässt, doch der Eindruck des Bizarren bleibt.
Der Teufel selbst, sagt die Legende, habe die Baobabs gepflanzt, mit den Wurzeln nach oben.
Warum? Weil der Teufel so was eben tut.
Agok verzieht die Lippen. Tatsächlich ist das einzig Teuflische am Baobab die Eigenheit seiner Blüten, einen intensiven Verwesungsgestank auszuströmen. Den lieben die Flughunde, die nachts in Schwärmen zur Bestäubung anrücken.
Er kontrolliert die Ausrüstung an seiner Koppel: Messer, Trinkflasche, Munition. Das Feld der Soldaten zieht sich auseinander, so haben sie es zuvor besprochen. Jeder nutzt die nächstliegende Deckung. Huscht ein Stück voran, verharrt im aufschießenden Gras, hinter Büschen, am Fuß einer Akazie. Läuft geduckt weiter. Trotz der Lasten, die sie mit sich tragen, Sprengstoff und Zünder, Granaten, Proviant, bewegen sie sich mit lautloser Eleganz. Über ihnen wuchert und quillt die apokalyptische Wolke, windet sich in Krämpfen, senkt sich herab, durchzuckt von elektrischer Aktivität.
Die ersten Tropfen klatschen in die Ebene.
Sofort nimmt die Sicht rapide ab. In der Ferne kann Agok die verwaschene Silhouette der Elefantenfamilie ausmachen, bevor der Dunst sie auflöst. Die Männer kommen schnell voran. Noch wenige Hundert Meter, bis sich das Gelände sanft hebt, um gleich wieder zum Fluss hin abzufallen. Auf der Kuppe verfilzt sich dichte, hochwachsende Vegetation. Agok hegt keinen Zweifel, dass Olonys Einheiten am gegenüberliegenden Ufer in den Büschen liegen, aber trotz ihrer enormen Mannstärke können sie nicht überall zugleich sein. Es wird unbewachte Passagen geben. Wege für Phantome, um sich durchzumogeln.
Um die Milizionäre dann von hinten zu überfallen –
Nein, ruft er sich zur Ordnung. Auch wenn der Gedanke verlockend ist, wir werden uns an den Plan halten und den offenen Kampf meiden.
So lange es irgend geht.
Der Regen nimmt an Heftigkeit zu, schraffiert die Männer rechts und links von Agok. Verwischt Landschaft, Menschen, Tiere zu einem monochromen Aquarell, ineinanderfließende Schatten auf der jetzt grauen Leinwand des Nebels. Am Fuß der Anhöhe zeichnet sich ein gewaltiger Affenbrotbaum ab, dessen Alter tausend Jahre oder mehr betragen dürfte. In einer titanischen Geste umarmen seine Krakenäste die Wolken, die ihm den Speicher füllen. Baobabs sind lebende Reservoire, sie horten Unmengen Wasser für die Trockenzeit. Dann kommen die Elefanten und brechen die Rinde auf, schlagen große Hohlräume in den Stamm, um an die feuchten Fasern zu gelangen. Ihr Zerstörungswerk verwandelt die Baobabs in Brut- und Wohnhöhlen für andere Geschöpfe, so wie in jedem Wesen hier etwas Parasitäres nistet, seine Tunnel und Gänge in fremdes Gewebe gräbt und seinen Wirt langsam von innen verzehrt.
Natürlich kennt Agok auch diesen Baobab, dessen Stamm an der Basis gut und gerne dreizehn Meter umfasst. Er hält darauf zu, während immer dichterer Regen die Sicht verschlechtert und der Boden sich mit einer zähflüssigen, schmatzenden Schicht bedeckt.
Etwas lässt ihn innehalten.
Die Flut hat inzwischen wasserfallartige Dimensionen angenommen. Sie rauscht in seinen Ohren und im Hirn, überlagert alle sonstigen Geräusche, doch inmitten des Getöses glaubt Agok – nein, er ist sich völlig sicher! –, einen schwachen Schrei gehört zu haben.
Mehr den Ansatz eines Schreis, sofort erstickt.
Ein Mensch hat geschrien.
Und jemand – etwas – hat ihn abgewürgt.
Er blinzelt, wischt das Wasser aus den Augen. Es gibt hier Löwen, doch Angriffe sind selten. Auch Leoparden und Hyänen treiben sich in der Savanne herum, jagen Zebras, Büffel und Kobs, versuchen mitunter, Jungtiere aus den Viehherden der Nomaden zu reißen. Immer mal kommt es zur Tragödie, doch allgemein bleiben die Wildtiere unter sich. Jeder wird satt – bis auf die Menschen, da das nie endende Schlachten die Bauern daran hindert, Getreide auszusäen. In einem der fruchtbarsten Landstriche Afrikas droht eine Hungersnot historischen Ausmaßes, doch die Tiere kommen über die Runden.
Wo sind seine Männer?
Da. Die paar jedenfalls, die er noch sehen kann. Sie tauchen auf, tauchen ab. Einer geht gleich vor ihm, verschwommen wie ein Tintenklecks vor der ausladenden Masse des Affenbrotbaums.
Und verschwindet.
Einfach so, begleitet von einem dumpfen Schmatzen, als werde etwas Weiches und Feuchtes auseinandergerissen.
Agok fährt herum, dem uralten Impuls folgend, sich einer möglichen Bedrohung von hinten zu versichern, den Abstand zu etwaigen Verfolgern abzuschätzen, obschon der Mann ja direkt vor ihm –
Was? Angegriffen wurde?
Adrenalin schießt in seine Muskeln. Sein Stammhirn bietet in rasender Folge schematische Entscheidungsmuster an, den ganzen evolutionären Katalog. Agok ist stolz auf seine Reflexe. In jeder vertrauten Situation würde er zielgerichtet vorgehen, nur dass nichts hier irgendein Ziel erkennen lässt – falls überhaupt etwas eine Reaktion erfordert, oder stresst er sich einer Sinnestäuschung wegen?
Was genau hat ihn eigentlich alarmiert?
Gar nichts. Der Schrei? Ein Ara. Der Mann vor ihm? Hat sich fallen lassen. Gleich wird er aufspringen und weiterhasten, getreu der Strategie, die Agok den Kerlen eingetrichtert hat.
Er wartet.
Niemand springt vor ihm auf.
Dafür dringt aus dem Nebel ein neuerlicher Schrei, lang gezogen und kaum zu ertragen. Ein Ausdruck äußersten Grauens, hochgeschraubt zu einem schrillen Geheul, bevor er abrupt endet. Im selben Moment lässt die Heftigkeit des Regens nach, und Agok kann es hören –
Hört es in aller Deutlichkeit.
Das andere Brausen.
In einer Aufwallung von Angst, die dem distanzierten Teil seiner selbst peinlich ist, beginnt er zu rennen, dem Affenbrotbaum entgegen, rutscht aus und schlägt der Länge nach in den Matsch. Der Aufprall presst die Luft aus seinen Lungen. Er versucht hochzukommen, doch der Untergrund bietet keinerlei Halt. Für Sekunden hat Agok das schreckliche Gefühl, die aufgedunsene Erde krieche wie eine hungrige, blinde Wesenheit an ihm empor, schlinge klebrige Extremitäten um seinen Leib und ziehe ihn tiefer hinein in ihr regenfeuchtes Inneres. Dann gelangt er auf die Beine, stolpert weiter in Richtung des Baobabs und des dahinterliegenden Saumwaldes. Die Ahnen wispern in seinem Kopf, streiten, was wohl der sicherste Platz für ihn wäre, die undurchdringliche Vegetation auf der Kuppe, nein, besser die von den Elefanten in den Affenbrotbaum gehauene Höhlung, auch wenn er da in der Falle sitzt, aber alles hier scheint zur Falle geworden zu sein, während das Brausen –
Es ist nicht einfach nur ein Brausen.
Es ist die Summe vieltausendfacher Präsenz – eine Art Flattern, nur nicht wie von Vögeln – andere, fremdartige Schwingungen, abnorme Muster – anschwellend –
Er rennt schneller.
Was immer da kommt, rast mit der Gewalt einer sich verschiebenden Grenze durch die Nebelschwaden heran, die jetzt kurz aufklaffen wie nach dem Willen eines überirdischen Regisseurs, der will, dass Agok einen Blick erhascht, und sich wieder schließen, weil sein Verstand kaum in der Lage wäre, den Anblick zu verarbeiten und er wahrscheinlich verrückt darüber würde. Die Schreie seiner Männer kommen nun von überallher. Agok hört sie sterben, verliert erneut den Halt und sieht im Fallen die Schwaden auseinanderwirbeln und das Laubdach des Affenbrotbaums freigeben. Die äußeren Geflechte sind durchsetzt von Kokons, unglaublich fein gesponnenen Kunstwerken, deren Erbauer die Blätter mit eingearbeitet haben: Weberameisen, die ihre Nester in Büschen und Baumkronen errichten. Jeder Kokon birgt ein ganzes Volk, geschart um seine Königin. Manchmal überfällt ein Volk das andere, dann fressen sie die Artgenossen auf, und es erscheint Agok im Straucheln wie die Versinnbildlichung seines eigenen, sich zerfleischenden Volkes – mit dem Unterschied, dass die kalte Intelligenz der Ameisen Sieger kennt und der Kontinent, auf dem er das Pech hatte, geboren zu werden, nur Verlierer.
Er fängt sich, ringt nach Atem. Taumelt dem Stamm entgegen, der mit jedem Schritt, den er darauf zutut, seitlich entrückt, ein höhnisches Verwirrspiel. Modernder Pflanzenmatsch setzt Opiate von erstickender Süße frei, der Aasgestank des Baobabs schwappt auf ihn hernieder. Er halluziniert, vielleicht dreht er aber auch schlicht durch vor Angst. Die Natur und ihre Phänomene sind ihm seit Kindheitstagen vertraut, was bringt ihn so aus der Fassung? Was kann es anderes sein als der Einbruch des Unvertrauten, bar jeder Referenz, und damit die Abwesenheit all dessen, was sich je in seiner Erfahrungswelt spiegelte, sodass nichts bleibt außer dem Empfinden völligen Ausgeliefertseins? Endlich streichen seine Finger über die schartige Rinde, und er dreht sich im Kreis, richtet sein Heckler & Koch mal hierhin, mal dorthin. Die Nebelstrudel sind voll huschender Schatten, unbenennbare Dinge, die schneller ihre Position wechseln, als das Auge zu folgen vermag. Die Luft schwingt von Schüssen und Geheul. Blindlings feuert er in den Regen, leert sein Magazin, greift nach einem neuen, das ihm entgleitet, fällt auf die Knie und sucht es wie von Sinnen zwischen den Wurzeln des Baobabs. Winzige Beine und Fühler streifen seine Finger. Tasten umher, huschen geschäftig darüber hinweg. In feuchten Abgründen wimmelt und krabbelt es. Am Rande seines Gesichtsfelds scheint sich etwas Großes zu bewegen. Als er hinschaut, ist da nichts und doch in der Vorstellung alles.
Fäulnis und Leben sind eins.
Der Boden atmet, gepanzerte Heerscharen folgen erratischen Plänen, zwischen vom Sturm abgerissenen Blättern schillern die Leiber aasfressender Käfer. Gottesanbeterinnen lauern auf Beute, reglos. Sie werden noch an derselben Stelle sitzen, wenn wir einander ausgelöscht haben, denkt Agok. Und keine Zeit wird vergangen sein. Der Regen wäscht jede Zeit hinweg. Meine Existenz wird weniger als ein Wimpernschlag gewesen sein.
Etwas klatscht neben ihm gegen den Stamm.
Er wendet den Kopf.
Starrt das Ding an, und wahrscheinlich starrt es seinerseits ihn an. Falls das Augen sind. Genau lässt sich das nicht sagen.
Nie zuvor hat er etwas Derartiges gesehen.
Die Dinger sind überall.
Seine Knöchel treten hervor. Er umkrallt das Gewehr, als sei es ein Geländer, die einzig verbliebene Barriere zwischen ihm und dem Abgrund, der an ihm zerrt. Mit der Beharrlichkeit eines automatischen Funkfeuers sendet sein Verstand Signale aus: Kauere dich zusammen. Schütze den Kopf mit den Armen. Versuche, in die Höhlung zu gelangen.
Doch er ist viel zu verblüfft, um den Blick abzuwenden.
Hebt den Arm, um das Ding vom Baum zu wischen.
Es springt ihn an.
Agok schreit auf, als es sich in seine Nase verbeißt und sich blitzschnell über den Wangenknochen windet. In Panik versucht er, es von seinem Gesicht zu ziehen. Es stülpt sich über seine linke Augenhöhle, reißt den Augapfel heraus und arbeitet sich in seinen Schädel. Halb wahnsinnig vor Schmerz und Entsetzen taumelt Agok umher, seine Beine zucken, rücklings stürzt er in die modernde Höhle des Baobabs.
Das Letzte, was er registriert, ist die Woge glühender Pein, als weitere der Dinger auf seinem Körper landen und beginnen, ihn aufzufressen.
In der Schlucht schwebt ein blutiger Engel.
Nicht ganz fünf Meilen hinter Flume Creek, dort wo die Felswände senkrecht abfallen und sich der North Yuba River tief am Grund durch den blanken Stein frisst, bevor ihn eine eng gestaffelte Folge von Katarakten in jene Bestie verwandelt, die zu reiten Wildwasserkanuten von überallher lockt, ist er mit seinen zerfetzten Flügeln einem Touristenpaar aus Bakersfield erschienen, das vor lauter Schreck prompt kenterte.
Erscheinungen himmlischer Wesen gefährden die Verkehrssicherheit, denkt Luther Opoku.
Stell dir vor, heutzutage ginge einer übers Wasser.
Saftige Geldstrafe.
Von Luthers erhöhter Warte aus ist die Tote weniger gut zu erkennen als vom vierzig Meter tiefer gelegenen Fluss. Das liegt daran, dass sie beim Sturz in den Baum, der auf halber Höhe aus der Wand wächst, fast durch das ganze Geäst gebrochen ist, bis sie sich in den unteren Zweigen derart verfing, dass sie nun mit ausgebreiteten Armen und Beinen über dem Flusslauf zu schweben scheint. Die Äste haben sie blutig geprügelt und ihr die Bluse vom Leib gerissen, deren zerfledderte Überreste oberhalb der Schultern ins Laub drapiert sind und sich im Wind blähen, sodass man darin mit einiger Phantasie ein kraftloses Flattern erkennen kann, einen zum Scheitern verurteilten Befreiungsversuch.
Die Befreiung übernehmen jetzt andere. Die des Körpers, um genau zu sein. Der Geist dürfte sich schon vor Stunden seiner irdischen Fesseln entledigt haben.
Luther biegt die Zweige auseinander und schaut nach unten. Die Hangkante ist von brusthohem Gestrüpp bestanden, kalifornischer Lorbeer und ein bisschen Quercus. Wo die Barriere Lücken lässt, kann er die Männer des freiwilligen Bergungsteams sehen, wie sie – an Seilen gesichert – die Leiche aus dem Geflecht lösen und mit geübten Handgriffen vertäuen, um sie nicht noch an den Fluss zu verlieren. Er hört einen Akkord splitternder Äste, als der Körper kurz wegsackt, das Ächzen der Flaschenzüge.
Eine Fuchsschwanz-Kiefer, denkt Luther. Nadeln spitz wie Stilette.
Ein aufgespießter Engel.
Ruth Underwood geht neben ihm in die Hocke. Ihre rotblonde Mähne, die sie von hinten aussehen lässt wie die Mutter aller California Girls in einem Drogentraum Brian Wilsons, wird fahl, als sie in die Schatten abtaucht, die das Sonnenlicht noch nicht hat vertreiben können. Der Tag verspricht wolkenlos zu werden. Binnen Kurzem werden die Schatten abgeflossen sein und ihre Geheimnisse mit sich genommen haben, Geisterbilder der Tragödie, gewoben aus Mondlicht. Mitunter, wenn Luther alleine in den Wäldern unterwegs ist, könnte er schwören, im Seufzen des Windes und vielstimmigen Flüstern des Laubs, in all den verschwörerischen kleinen Lauten, die zusammen Stille ergeben, Echos aus einer Zeit zu vernehmen, als Urgewalten den riesigen Granitblock namens Sierra Nevada auftürmten, und im kaleidoskopischen Spiel des Lichts auf dem Waldboden nehmen die Toten Gestalt an.
»Kaum zu glauben«, sagt Ruth und hält einen frisch gebrochenen Ast hoch. »Die ist ungebremst in die Büsche gerannt.«
Luthers Blick weilt auf der gegenüberliegenden Anhöhe. Die Tannen erwecken den Eindruck einer verschwiegenen Gesellschaft. Dicht an dicht stehen sie, soweit das Auge reicht, gekrönt von den pastellenen Felsen der Sierra Buttes, Zacken einer gewaltigen, fernen Krone.
»Wer rennt denn im Stockdunkeln auf einen Steilhang zu?«, sagt er mehr zu sich selbst.
»Jemand, dem man hätte sagen sollen, dass da einer ist?«
Der Griff der Dienstwaffe drückt gegen Ruths Rippen, als sie sich vorbeugt und die Schneise in Augenschein nimmt, die in die Büsche gerissen wurde.
»Hier waren zwei, so viel steht fest.«
Ihre Uniform ist so grün wie das Moos, auf dem sie hockt. In wenigen Wochen, wenn die Bewohner von Sierra County Luther Opoku zu ihrem neuen Sheriff gekürt haben, wird Ruth seine jetzige Position als Undersheriff übernehmen. Der Wohlklang des Ranges »zweite Kommandierende« verliert dramatisch angesichts der Tatsache, dass sie und Luther kaum jemanden zu kommandieren haben. Das Department umfasst keine zehn Mitarbeiter, selbst wenn sie Kimmy mit einrechnen. Die Disponentin arbeitet halbtags und ist streng genommen gar kein richtiger Deputy, neuneinhalb also, verantwortlich für dreieinhalbtausend verstreut lebende Einwohner, die jeden erdenklichen Grund finden, das Gesetz in Anspruch zu nehmen, zu beugen oder zu brechen, und da sind die ganzjährig auftretenden Touristenschwärme, Durchreisenden und illegalen Immigranten, die an versteckt liegenden Creeks Marihuana züchten, noch gar nicht berücksichtigt. Sie sind ein Provinzbüro, das alle Spuren staatlicher Vernachlässigung aufweist. Die Behörde eines Countys, in dem der Begriff Provinz hätte erfunden worden sein können, ausgestattet mit vorzeitlichen Rechnern und Streifenwagen, die keine Minute in The Fast and the Furious überstehen würden und zur Hälfte dringend reparaturbedürftig sind. Vor dem Hintergrund ihrer eingeschränkten Kapazitäten ist es der reine Luxus, dass sie zu zweit hier aufkreuzen. An einem Tatort, der vielleicht nur Unfallort ist, andererseits, warum hastet jemand in stockdunkler Nacht durch eine Wildnis, in der schon bei Tag jeder Schritt wohlüberlegt sein will? Wie passt der Geländewagen dazu, der ein Stück höher an einer Douglasie hängt? Oben verläuft der Golden Chain Highway, eine gut ausgebaute Bundesstraße, die im Grenzland zu Nevada entspringt und sich fast dreihundert Meilen bis runter nach Oakhurst windet. Über weite Strecken schmiegt sie sich an den Lauf des Yuba River und weicht nur gelegentlich davon ab, als sei sie bemüht, aus der Luft ein eigenständiges Bild abzugeben. An solchen Stellen entspringen unbefestigte Pfade, verlaufen entlang des Flusses, enden meist an Fischerhütten und Geräteschuppen oder führen zurück auf die Hauptstraße.
Was hat den Fahrer veranlasst, mit hoher Geschwindigkeit in einen unbeleuchteten, abschüssigen Forstweg einzubiegen, der noch dazu einen Abgrund säumt?
Und wo ist der Fahrer jetzt? Oder die Fahrerin?
Unten im Kieferngeäst?
War sie betrunken?
Oder zugedröhnt. Den Kopf vernebelt von Gras, das in Kalifornien Mitte der Neunziger für medizinische Zwecke legalisiert wurde, mit dem Effekt, dass plötzlich mächtig viele Leute gesundheitliche Probleme verspürten und zum Arzt liefen. Entlang der Küste von Venice Beach bis San Francisco tummeln sich Quacksalber zu Tausenden, die gegen Entrichtung von vierzig Dollar klangvolle Malaisen diagnostizieren und die Bescheinigung ausstellen, gegen deren Vorlage man in den Ausgabestellen bereitwillig versorgt wird. Kalifornien schwelgt im Green Rush, als hätte es nie ein anderes Heilmittel gegeben. So viel legales Cannabis ist im Umlauf, dass man verwirrt nach dem zusätzlichen Planeten Ausschau hält, auf dem es angebaut wird, doch so weit muss man gar nicht gucken. Es reicht ein Blick ins Hinterland. Ins Central Valley, in die Nationalparks, in die Provinzen der Sierra Nevada, wo dem legalen Handel durch illegalen Anbau in großem Stil auf die Sprünge geholfen wird. Auch damit müssen sie sich hier herumschlagen: neuneinhalb Gesetzeshüter gegen den langen Arm des organisierten Drogenhandels. Weder die Typen von der DEA noch das FBI reißen sich darum, bei jedem Fall illegalen Anbaus gleich zu Hilfe zu eilen, solange nicht zweifelsfrei bewaffnete Banden am Werk sind. Das Problem mit der Zweifelsfreiheit ist, dass sie oft erst durch ein Loch in der Stirn offenkundig wird.
Luther hockt sich neben Ruth, die aus immer neuen Perspektiven Gebüsch und Boden fotografiert. Seit ihrer Ankunft hat sie die Handycam nicht aus der Hand gelegt.
»Kampfspuren?«, fragt er.
»Schwer zu sagen.« Sie wischt sich mit dem Unterarm über die Nase. »Bei einem Kampf wäre der Untergrund stärker aufgewühlt. Die hier dürften von unserem gefallenen Engel stammen.«
Unterhalb der lädierten Zweige ist der Boden furchig aufgerissen. Spuren eines Menschen, der so schnell in die Buschbarriere gelaufen ist, dass er sie durchbrochen hat.
»Dann hätten wir noch ihn.«
Ein grobes Muster ist in eine der Furchen gedrückt. Outdoor-Profil, Männerschuhgröße. Jedes Detail hat sich im feuchten Boden konturscharf erhalten. Ein Prachtexemplar von Abdruck, die Sorte, bei der Spurensicherer in Champagner baden.
»Sieht aus, als hätte er einfach dagestanden«, sagt Luther.
»Und runtergeglotzt, ja.«
»Seine Spur liegt über ihrer. Sie war vor ihm an der Kante.«
»Nicht unbedingt. Er kann auf sie gewartet haben.«
»Und dann?«
»Hat er ihr Flugstunden gegeben.« Sie fotografiert das Stiefelprofil. »Ich meine, dabei könnte er in ihre Abdrücke gelatscht sein, oder?«
Luther kaut an seiner Wange.
»Das ergibt wenig Sinn, Ruth. Wenn du ordentlich Tempo draufhast, teilst du die Hecke wie das Rote Meer, aber jemanden hindurchstoßen? Das wäre in Kampf ausgeartet. Und wie du selber sagst –«
»Kein Kampf.«
»Außerdem, so hoch sind die Büsche nicht.«
»Höhe liegt im Auge des Betrachters.« Sie steht auf und klopft sich den Dreck von den Latexhandschuhen. »Du bist eins neunzig, Luther.«
»Der Schuh gehört zu keinem kleinen Mann.«
»Worauf willst du hinaus?«
»Na, komm schon. Wenn ich versuchen würde, dich da runterzubefördern, was täte ich?«
»Es wäre jedenfalls das Letzte, was du tätest.«
Ich würde dich darüber hinwegwerfen, denkt er.
Ruth checkt den Batteriestand der Handycam. Zurück im Licht, bringt die Sonne ihre Haarspitzen zum Glühen. Das Deputy-Hemd spannt sich über ihre knochigen Schultern, im V des offenen Kragens zeichnen sich unter Myriaden Sommersprossen Brustbein und Rippenansätze ab. Alles an ihr wirkt auf eigentümliche Weise rau und prototypisch, als habe sie die Vorlage für ein gefälligeres Serienmodell geliefert, das nun durch Werbespots und Vorabend-Soaps geistert, während ihr die letzte Politur versagt blieb. Vor fünf Jahren ist sie zu Luthers Team gestoßen, präziser gesagt zu Carl Mara, dem amtierenden Sheriff, auf Luthers Betreiben hin. Da war sie einundvierzig und trug schon eine Härte in ihren Zügen, wie man sie oft bei Menschen findet, denen so lange etwas Entscheidendes vorenthalten wurde, bis sie begannen, es sich selbst vorzuenthalten.
Luther überlegt. »Kann er sie im Baum gesehen haben?«
»Von hier oben?« Sie schüttelt den Kopf. »Wir sehen sie ja selber kaum. Für die Logenplätze musst du runter zum Fluss. Und dann nachts? Keine Chance.«
»Was, wenn er ins Geäst geleuchtet hat?«
»Ja, bloß, der Scheinwerfer, mit dem sie Batman rufen, steht in Hollywood.«
Er muss sich eingestehen, dass sie recht hat. Die Leuchtkraft keiner handelsüblichen Taschenlampe hätte ausgereicht, um die tieferen Schichten der Kiefer zu durchdringen und die Frau darin zu erkennen. Selbst jetzt blitzt das Weiß ihrer Bluse nur sporadisch durch die Äste.
»Also konnte er bestenfalls vermuten, wo sie war.«
»Jedenfalls schien es ihm nicht geraten, Hilfe zu holen.«
»Nein. Er wollte was anderes.«
Ruths Pupillen weiten sich in Erwartung. »Und was?«
Ein Rumpeln und Knirschen nähert sich über den Forstweg. Steinchen, Äste und abgestorbene Kiefernnadeln werden zermalmt und in den feuchten Boden gepresst. Durch die Lücken zwischen den eng stehenden Bäumen kann Luther den Krankenwagen sehen, der über den Waldweg heranrollt und ruckartig zum Stehen kommt. Eine grauhaarige Frau klettert aus dem Fond und drückt einem der beiden Sanitäter einen absurd großen Arztkoffer in die Hand.
»Haben die sie noch alle beisammen?«, sagt er mit gefurchten Brauen. »Wieso parken die nicht oben auf dem Highway?«
»Weil wir die Zufahrt noch nicht abgesperrt haben.«
»Und warum –«
Den Rest der Frage spart er sich. Warum wohl? Weil sie zu wenige sind.
»Luther? Huhu! Ich fragte, was?«
»Was, was?«
»Was wollte er, wenn nicht Hilfe holen?«
Er löst seinen Blick von dem Sanitätsfahrzeug und atmet tief durch. Falls sie auf dem Forstweg gerade Spuren unkenntlich gemacht haben, kann er das jetzt auch nicht mehr ändern.
»Sich vergewissern, schätze ich. Dass sie tot ist.«
Langsam geht er hangaufwärts. Der dichte Teppich aus Nadeln und verrottenden Blättern federt seine Schritte ab. Unter dem Laubdach duftet es nach den Regengüssen der vergangenen Nacht, nach Ozon und ätherischen Ölen. Spaliersträucher, Wildblumen und Farne wuchern zwischen Geröll und scharfkantigem Bruchstein, niedrig wachsender Lorbeer und Nusseibe bilden ein filziges Durcheinander. Man muss schon sehr genau hinsehen, um die geknickten Äste auszumachen, anhand derer sich der Weg des Engels zurückverfolgen lässt – zu dem Wagen, der vor der Douglasie hängt. Vor ihnen liegt eine offene Fläche, gespickt mit rundlichen weißen Steinen. Unübersehbar ziehen sich Furchen durch den Schlamm, kleine Gräben, in denen noch das Wasser steht.
»Die ist gerannt, Luther. Den ganzen Weg runter bis zur Kante.«
Geschlittert, ausgerutscht, gesprungen. Verloren in einem triefenden schwarzen Loch. Ihre Fersen haben sich in die Erde gebohrt und sie aufgerissen, als sie dem Canyon wie blind entgegenstolperte. Sie hat in Kauf genommen, sich die Knöchel zu brechen, die Haut von den Knochen zu fetzen, nur um am Ende von ihrem eigenen Schwung in den Tod getragen zu werden, in einer Wolke aus splitterndem Holz. Die Sträucher haben den dahinterliegenden Abgrund so vollständig verborgen, dass nicht mal der Vollmond ihr hätte zeigen können, was sie erwartete.
Nämlich Leere.
Luther stellt sich vor, wie sie ins Bodenlose stürzt. Ihre Verwirrung, hochschlagende Panik. Der Schock, den einen fatalen Schritt zu viel nicht rückgängig machen zu können, oder vielleicht doch, durch schnelles Aufreißen der Lider – Hoffnung, ein tanzender Funke, vom Wissen erstickt, dass dies kein Traum ist, während der Moment, in dem ihre Füße auf Grund hätten treffen müssen, um den Sturz zu überleben, verstreicht. In rasendem Fall verglühen ihre Optionen. Ihr Schrei explodiert zwischen den Wänden des Canyons, durcheilt die Nacht, jagt über das Dunkel der Berge dem Ozean entgegen und darüber hinweg, umflutet den Erdball, um auf sich selbst zu treffen –
»Luther?«
Er starrt zwischen die Furchen. Noch mehr Spuren, weniger tief, dafür klarere Ränder. Womöglich von dem Mann, dessen Fußabdruck sie an der Kante gefunden haben.
»Willst du eine Theorie auf die Schnelle, Sheriff, mein Sheriff?«
»Raus damit.«
»Nehmen wir an, beide saßen im Wagen –«
»Bekamen Streit.«
»Und zwar richtig.« Sie nickt. »Mit Handgreiflichkeiten und dem ganzen Getöse. Er oder sie setzt die Kiste vor den Baum. Sie springt raus, schlägt sich blindlings in die Büsche, er –«
»Was machen sie eigentlich auf dem Forstweg?«
»Dazu müsste man wissen, wo der hinführt.«
»Genau.« Luther sieht sie an. »Wäre doch eine super Idee, das rauszufinden.«
»Und wer passt dann auf, dass du hier nicht alles platt trampelst?« Ruth schaut zur Straße. »Wo bleibt überhaupt die Highway Patrol?« Arbeitsteilung. Der Sheriff untersucht die Todesumstände, die Highway Patrol den Hergang des Verkehrsunfalls. Sie tritt an den Rand des Canyons. »Und ihr? Kommt ihr da unten noch mal in die Gänge?«
»Obacht, Ruth!« Die Stimme des Bergungsleiters wird vom Stein gedämpft und zugleich reflektiert, wodurch sie auf eigentümliche Weise jenseitig klingt. »Nicht, dass wir dich als Nächstes aus dem Baum pflücken müssen.«
»Leck mich, Dexter!«
»Danke, mein Job kennt Grenzen. Die Dame ist reisefertig, okay? Wir ziehen sie hoch. Ihr könnt sie in Empfang nehmen.«
Reisefertig –
Vor acht Jahren, in einem anderen Leben, verließ eine andere Dame, für die das in gewisser Weise auch zutraf, Luthers Haus. Sie trug einen Koffer und wäre gerne in Empfang genommen worden, als sie zwei Stunden zuvor – nicht ohne anstandshalber geklingelt zu haben – den immer noch in ihrem Besitz befindlichen Schlüssel aus der Handtasche gekramt und hereinspaziert war. Vielleicht hoffte sie darauf, überredet oder in sonst welcher Weise überzeugt zu werden, die Koffer gar nicht erst zu packen, aber Luther war nicht dort. Wut und Gekränktheit, destilliert zu kindischem Trotz, hatten ihn auf Extra-Patrouille getrieben, obschon Carl Mara persönlich anbot, die Fahrt zu übernehmen, damit sein Undersheriff zu Hause seinen Kram regeln konnte. Luther indes fand, wer gepackte Koffer aus dem gemeinsamen Heim zu tragen beabsichtigte, verdiene das volle Maß seiner Missachtung, sodass er – als Jodie den Kofferraum ihres Cherokee belud – am entgegengesetzten Ende des Countys einen Fall von häuslicher Gewalt schlichtete.
Jetzt, da der Engel im Moos liegt – so sanft hineingebettet, als bestünde Gefahr, er könne erwachen und sich erschrecken –, fühlt Luther einen Stich. Es schmerzt, als habe jemand an den Splitter in seinem Herzen gerührt und ihn um eine Winzigkeit gedreht. Seine Kehle schnürt sich zusammen, dann ist der Moment vorüber. Gewohnheit sediert. Wiederkehrend wie ein Komet stellt sich der Schmerz ein – ein Komet, dessen Kreisbahn über die Jahre ausgeleiert ist, was die Abstände seines Erscheinens zwar größer hat werden lassen, ohne dass indes Hoffnung bestünde, er werde irgendwann ganz verschwinden.
Keine Vergebung, keine Erlösung.
Luther zieht seine Latexhandschuhe straff.
Ihre Augen sind bernsteinfarben. Sie könnten Glasimitationen sein, wie sie da knapp an seinem Kopf vorbeistarren. Der Regen hat ihr dunkelbraunes Haar an die Kopfhaut geklebt, ein Boyfriend Cut, Modell Halle Berry. Zierlich, ist Luthers erster Eindruck, als sein Blick den ausgestreckten Körper erwandert, durchtrainiert, der zweite. Muskulös sogar, kleine, anmutige Muskeln. Perfekt proportioniert, es ließe sich Attribut an Attribut reihen, würde man nur genug Zeit mit diesem Körper verbringen, der dem Jodies auf frappante Weise ähnelt. Fast eine Erleichterung, dass Lippen, Kinnpartie und Wangenknochen auf mexikanische Gene schließen lassen. Ihr Alter? Ungewiss. Irgendwo im Schwerefeld der dreißig. Zu entstellend sind die Kratzer und Striemen, deren meiste sie sich im Laufen eingehandelt haben dürfte. Er versucht darin zu lesen, sieht Zweige zurückschnellen und Dornen in ihre Haut treiben. Die ernsthaften Verletzungen verdankt sie wahrscheinlich der Fuchsschwanz-Kiefer, in die sie gestürzt ist. Deren Äste haben klaffende Wunden gerissen, in denen Fliegen und winzige Maden häuslich geworden sind und emsig fortführen, was Bakterien schon vor Stunden in Angriff genommen haben. Grüne Stilette spicken ihr Fleisch, über Stirn und Wangen verlaufen haarfeine Schnitte, die heftig geblutet haben, sodass sie eine rostige Maske zu tragen scheint, aus der die Augen unnatürlich herausleuchten. Totenflecken und aufprallbedingte Blutergüsse gehen ineinander über, das linke Bein – vielleicht gebrochen –
Nein, ganz sicher gebrochen.
Aber woran ist sie gestorben?
Luther fährt in die Taschen ihrer Jeans, hebt ihre Hüfte an und untersucht auch die Gesäßtaschen. Noch ist die Leichenstarre auf Augenlider und Gesichtsmuskeln beschränkt, sodass ihr Körper nachgiebig reagiert. Nichts als ein paar Dollar in Scheinen. Ihr rechter Fuß ist nackt, der linke steckt in einem schlammverschmierten Turnschuh – das Pendant dürfte am Grund der Schlucht liegen. Er wendet den Kopf und erblickt ein Paar stockartige Beine, gehüllt in Strumpfhosen von lebensnegierendem Graubraun, wie Marianne Hatherley sie zu tragen pflegt. Der Sanitäter platziert ihren Arztkoffer im Gras und hebt zwei Finger zum Gruß.
»Hi, Luther.«
»Hi, Ted.« Luther richtet sich auf, womit er gewaltig über die maushaarige Frau hinauswächst. »Guten Morgen, Marianne.«
»Wüsste nicht, was an dem Morgen gut ist.«
»Freut mich auch, dich zu sehen.«
»Ja, ja.« Sie schnaubt. »Hast du nichts Besseres zu tun, als meine Arbeit zu machen?«
Luther verordnet sich ein Lächeln. Die Gerichtsmedizinerin ist gar nicht so alt, wie sie scheint – noch unter siebzig, glaubt er sich zu erinnern –, sieht aber aus, als sei sie selbst ein Fall für den Forensiker. Sie hat einen käsigen Teint und riecht nach lange nicht gewechselter Kleidung. Zwischen ihren Fingern klebt der Rest eines Schoko-Donuts. Ohne Luther noch eines Blickes zu würdigen, öffnet sie ihren Koffer.
»Ihr wälzt Theorien ohne Inaugenscheinnahme des Corpus Delicti. Das ist unverantwortlich. Ich hab’s von oben gehört.«
»Wieso?«, sagt Ruth. »Wir haben nur über sie gesprochen.«
»Ihr habt über sie gefachsimpelt, als sie noch im Baum hing.«
Ruths eisblaue Augen wandern an Mariannes Körper hinab. Luther nickt hoch zum Forstweg.
»Komm. Wir schauen uns mal den Wagen an.«
Die Fahrertür des Geländewagens steht offen. Die Beifahrertür hingegen ist verriegelt, woran Ruths Theorie gleich wieder zu zerschellen droht. In ihrem Szenario springen beide Protagonisten wutentbrannt ins Freie, statt umständlich über den Sitz des anderen nach draußen zu kriechen. Den Wagen hat offenbar nur eine Person verlassen.
»Unverantwortlich!« Ruth macht ihrem Ärger Luft. »Was lassen wir uns noch gefallen von der kleinen Feldratte?«
»Sie versteht ihr Handwerk«, sagt Luther.
»Das verstehen andere auch. Wir hätten Carl fragen sollen. Carl ist immer gut für eine erste Expertise.«
Luther geht um den Geländewagen herum und sucht den Boden ab.
»Erste Expertise, du sagst es.«
»Ehrlich, Luther, mir ist es hoch wie breit, wie gut Marianne ihr Handwerk versteht und ob sie kraft ihrer Hände Scheiße in Gebäck verwandeln kann, solange es in ihrem sogenannten Institut geschieht. Wir haben einen Sheriff-Coroner, wer braucht eine pöbelnde Vogelscheuche?« Sie holt tief Luft. »Noch dazu eine, die am Tatort frisst.«
Weil der Sheriff vor lauter Rheuma in keinen Streifenwagen mehr kommt, denkt Luther, und raus schon gar nicht, aber er spart sich die Belehrung. Ruth würde Carl Mara auf dem Rücken hertragen, nur um jeden Kontakt mit Marianne Hatherley zu vermeiden.
»Siehst du?« Ruth schaltet ihre Handycam auf Video-Modus. »Dazu fällt dir nichts ein.«
»Doch. Keiner ist so gut darin, den Todeszeitpunkt festzustellen.«
»Gilt das auch für ihren eigenen?«
»Ruth –«
»Kannst du sie nicht mal fragen? Ich wüsste einfach gern, wann die Sonne wieder heller scheint und die Rehlein und die Häslein zurück aus dem Wald kommen –«
Er untersucht den Boden vor der Fahrertür. Hoch über ihren Köpfen verschränken sich Kiefern, Tannen und ein paar Schwarzeichen zu einer dämmrigen Kathedralkuppel, die den Regen weitgehend abgehalten hat. Was durchgedrungen ist, haben herabgefallene Nadeln absorbiert, weshalb der Grund hier weniger schlammig ist als unten am Hang. Ungünstig für Spurenleser, aber dann entdeckt er ein paar zerwühlte Stellen. Was er sieht, zementiert seinen Verdacht, dass der gefallene Engel am Steuer gesessen und den Geländewagen vor die Douglasie gesetzt hat, um dann in aller Hast die Flucht zu ergreifen. Das Handschuhfach steht offen. Betriebsanleitung, Stift, Papier, Arbeitshandschuhe und eine Stablampe verteilen sich im Fußraum, als habe jemand achtlos alles nach draußen befördert. Er schaut in die Türfächer, sucht nach Kleinigkeiten, die Hinweise auf die Identität der Toten liefern könnten, lässt die Heckklappe aufschwingen und wird konfrontiert mit Leere.
»Wir brauchen hier noch jemanden!«
Geht hoch zur Hauptstraße, öffnet die Tür des Streifenwagens und ruft über Funk die Einsatzzentrale in Downieville.
»Wo bleibt die Verstärkung, Kimmy?«
»Hm, ja. Das ist nicht so einfach, Luther.« Kimmy Vogels Stimme tremoliert im Country-Modus, ein sicheres Indiz dafür, dass sie vergangene Nacht im Yuba Theatre die Dolly Parton gegeben hat. Die Sierra-Variante Dolly Partons, um genau zu sein. Mit weniger Helium in der Stimme, dafür gelingt ihr die Unmöglichkeit, noch mehr an der Pathosschraube zu drehen als ihr großes Vorbild aus den Smoky Mountains. Luther weiß nicht, ob das für oder gegen eine Zweitkarriere als Sängerin spricht, und gerade ist es ihm herzlich egal.
»Wir haben hier ein Auto voller Fasern, Haare, Fingerabdrücke, weiß der Teufel was. Hat Tucker nicht gesagt, er will so schnell wie möglich herkommen?«
»Ja, weißt du, Tucker – also, der hat gerade durchgerufen.«
Luther wartet. Er mag Kimmy, an manchen Tagen liebt er sie geradezu. Sie wäre ein Geschenk des Himmels, hätte sie nicht die Angewohnheit, jede Information zu zerdehnen wie eine Staffel Game of Thrones.
»Ich höre.«
»Ines Welborn hatte doch ihre Katze als vermisst gemeldet.«
»So?«
»Du weißt schon, die getigerte.«
Ines Welborn, Betreiberin eines Bed & Breakfast in Goodyears Bar, einem Siebzigseelenkaff westlich von Downieville, umgeben von Wäldern. Was wenig beschreibt, da praktisch alles in Sierra umgeben von Wäldern ist.
»Ach, ja«, sagt er.
»Weil, sie hat ja auch noch die schwarze«, beeilt sich Kimmy klarzustellen. »Also genauer gesagt, ist die ein Kater, aber egal. Die getigerte ist jedenfalls verschwunden, und –«
»Können wir das beschleunigen?«
»Und jetzt hat Ines ihren Nachbarn beschuldigt, die Katze getötet und auf seinem Grundstück vergraben zu haben.«
Luther kratzt seinen Nacken.
»Welchen Nachbarn? Doch nicht etwa Billy Bob Cawley?«
»Moment, Luther.« Er kann das Klicken der Maus hören, als sie das Protokoll auf ihren Bildschirm ruft. »Doch, Billy Bob.«
Cawley, ein indianischstämmiger Frührentner, kümmert sich um den kleinen Friedhof hinter der Kirche, auf dem Folksängerin Kate Wolf begraben liegt. Was Goodyears Bar insoweit als Attraktion verbucht, als Emmylou Harris Kate Wolfs Songs gecovert hat.
»Billy Bob killt keine Katzen«, sagt Luther.
»Ines sagt, doch.«
»Wie kommt sie denn darauf?«
»Weil Billy Bob es herumerzählt hat und jetzt einen Rückzieher macht, er habe Ines nur damit ärgern wollen, aber Tucker ist dort und meint, Billy Bob verstricke sich irgendwie in Widersprüche –«
»Und wo sind die anderen?«
»Pete ist in Alleghany, herrenloses Fahrzeug, und danach zum Pass Creek-Campingplatz, wo eingebrochen worden sein könnte. Oder auch nicht. Troy müsste auf dem Weg nach Sattley sein, im Cash Store macht einer Randale, der nicht von hier ist, und belästigt die Leute. Der ist wahrscheinlich nur betrunken, will aber nicht gehen –«
Betrunken um acht Uhr dreißig. Man wird über die Jahre mit allerlei Frühstücksgewohnheiten vertraut.
»Und Robbie?«
»Brennender Müllcontainer.«
»Wie bitte? Dafür ist Calfire zuständig.«
»Ja, das stimmt, Luther, die kümmern sich ja auch jetzt drum. Robbie ist inzwischen unterwegs nach Sierraville, da ist nämlich was Komisches passiert, obwohl – komisch ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, immerhin ein Notruf, damit soll man nicht scherzen, jedenfalls, der Anrufer meinte, er sei vorhin aus dem Snackshop gekommen, als drei Männer langsam an ihm vorbeifuhren und ihn angeschrien hätten.«
Luther schluckt die Nachfrage herunter und übt sich in Gelassenheit.
»Du kriegst auch noch dein Fett weg«, schiebt Kimmy pampig hinterher.
»Redest du mit mir?«
»Nein, das haben die geschrien!« Sie kichert. »Ach Gott, du dachtest, ich hätte – das war jetzt gut, als ob ich – egal. Jetzt hat er Angst, wegzufahren. Er kennt die Männer nämlich gar nicht, sagt er –«
»Schon gut. Wo ist Jamie?«
»Wahrscheinlich in Bassetts.«
»Wahrscheinlich?«
»Kate Buchanan rief an und bat uns, nach dem Hauptwasserhahn zu sehen. Sie ist ein paar Tage rüber zu ihrer Schwester nach Plumas und meint, sie hätte vielleicht vergessen, ihn abzudrehen.«
Bassetts liegt keine vier Meilen entfernt.
»Gut. Sag Jamie, er soll dem verdammten Hahn den Hals umdrehen und augenblicklich herkommen.«
»Würde ich ja gern«, versichert ihm Kimmy so larmoyant, dass man die Pedal Steel dazu wimmern hört. »Aber ich kann ihn nicht erreichen. Du weißt doch, sein Funkgerät –«
Ist kaputt, richtig. Seit drei Wochen.
»Alles klar. Kimmy, sei so lieb und treib irgendeinen von denen auf, ja? Egal, wen. Und frag nach, wo der Kollege von der Highway Patrol – warte mal –«
Ruth kommt den Weg hoch, das Mobiltelefon in der Rechten. Ihr Gang hat etwas Lauerndes. Alles an ihr wirkt wie im Feuer gehärtet. »Hab das Kennzeichen gecheckt.«
»Und?«
»Der Wagen ist auf einen Laden in Palo Alto zugelassen. Nordvisk Incorporated.«
»Der Hightech-Riese.« Luther hebt die Brauen. »Sieh mal an. Ein Firmenwagen also?«
»So schaut’s aus.«
»Okay. – Kimmy? Noch was. Sieh zu, dass du einen Termin mit Phibbs zustande bringst, tunlichst in einer Stunde in meinem Büro. Ich brauche alles über eine Firma aus Palo Alto, Nordvisk Incorporated –«
»Nord –«, wiederholt Kimmy in Schreibtempo und verstummt.
»V. I. S. K«, schaltet sich Ruth ein.
»V. I. S. K«, wiederholt Luther. »Außerdem soll er sich schlaumachen, was gestern Abend und während der Nacht in der Gegend so los war. Du weißt schon, Partys, Besäufnisse, Streitereien, hat jemand was gehört oder gesehen, das Übliche – ach ja, ist Carl da?«
»V. I. S – K«, buchstabiert Kimmy. »Äh, wer?«
»Der Sheriff, Kimmy.«
»Nein, tut mir leid, Luther.«
»Du weißt nicht zufällig, wo er ist?«
»Doch. Weiß ich. Beim Arzt.«
Luther beendet das Gespräch und schaut Ruth an. »Ein Firmenwagen der Nordvisk-Gruppe in Sierra?«
»Was genau machen die überhaupt?«
»IT-Branche.« Er überlegt. »Ziemliches Kaliber. Kürzlich kam bei NBC was über frühe Formen von Intelligenz –«
»Im Ernst? Sie haben was über Kimmy gebracht?«
Er versucht, seine Erinnerung aufzufrischen. Beim Zappen hängen geblieben, bevor ihm die Augen zufielen.
Nein, nicht frühe Formen von Intelligenz.
Frühe Formen künstlicher Intelligenz.
Sie gehen zurück zum Geländewagen, während Luthers Blick jeden Stein und jede Tannennadel abtastet. Schon an der Einmündung zum Forstweg, wo der Boden dem Regen stärker ausgesetzt war, sind ihm Reifenspuren aufgefallen, die vom Fahrzeug der Toten stammen könnten. Bemerkenswert daran ist, dass sie in den Weg hinein- und augenscheinlich auch wieder heraus- und zurück auf den Highway führen. Was sich schlecht mit dem Umstand verträgt, dass der Wagen an der Douglasie klebt.
»Ziemlich viele Reifenspuren«, meint Ruth.
»Dachte ich auch gerade«, sagt Luther.
»Hier waren zwei Fahrzeuge, und damit meine ich nicht unseren Krankenwagen. Zwei mit ähnlichem Profil. Tippe, der zweite Wagen gehört Mister Schuhgröße achtundvierzig.« Sie zeigt Richtung Canyon. »Wenn wir hier alles haarklein unter die Lupe nehmen, werden wir Spuren von dem Kerl finden, die wieder bergauf führen, wetten? Nachdem sie abgestürzt ist, hat er sich auf den Rückweg gemacht.«
»Du meinst, nachdem er sie den Hang runtergejagt hatte.«
»Aber, aber.« Ruth hebt spöttisch die Brauen. »Derlei Einlassungen ohne Intimkenntnis des Corpus Delicti? Das ist unverantwortlich, Luther, höchst fahrlässig, wo bleibt übrigens Tucker?«
»Ermittelt in einer Mordsache.«
»In einer –« Ruth starrt ihn an. »Was, der auch?«
»Schlimme Geschichte.« Luther nickt. »Eine Leiche, wahrscheinlich vergraben im Garten von Billy Bob Cawley. Tucker nimmt ihn gerade in die Mangel.«
Er zieht seinen Hut tiefer in die Stirn und geht zurück zu der Toten.
Dr. Marianne Hatherley war mehr als zwanzig Jahre lang forensische Pathologin beim FBI, bevor sie sich ihrer Wurzeln besann und zurück an den Ort ihrer Kindheit kehrte.
Nicht, dass diese frühe Phase ihres Lebens von besonderen Freuden geprägt gewesen wäre, ebenso wenig wie die Zeit in Washington ihre Erinnerungen ins Goldbad getaucht hat, und schon gar nicht verdankt sich ihr Entschluss familienbedingten Sehnsüchten. Nach Mariannes Auffassung ist Familie etwas, das praktisch alle namhaften Literaten zu Tragödien inspiriert hat, in deren Verlauf genetisch bedingte Verworfenheit mit deprimierender Regelmäßigkeit in ein abscheuliches Ende mündet. Sich selbst nimmt sie von ihrer Verachtung nicht aus. Der Ehrlichkeit halber, lautet ihr Credo, sollte man schon in sehr jungen Jahren Abstand von der Vorstellung nehmen, besser geraten zu sein als die eigenen Erzeuger, und die Hatherley’sche Genealogie umfasst nun wirklich nichts, das man in Leder gebunden auf dem Nachttisch liegen sehen möchte. Soweit Marianne ihre Abstammungslinie zurückverfolgen kann, erblickt sie einen Haufen elender Taugenichtse, die allesamt dieselbe verkorkste Helix aneinander weitergereicht haben, wie also könnte sie besser sein? Woran auch der Umstand nichts ändert, dass sie es als Einzige in ihrer Sippschaft zu akademischen Weihen gebracht hat. All die gescheiterten Goldgräber, inzestuösen Hühnerzüchter und verlogenen Baptistenprediger vor Augen, die sie durch ihre Kindheit geprügelt haben, hätte sie zwar Anlass zu ein bisschen Selbsterhöhung, doch am Grunde allen Bemühens schillert nun mal der Charakter.
Und der ist in Mariannes Verständnis ihrer Person schlecht, weil er erbbedingt nicht anders sein kann.
So begegnet sie Darstellungen, sie habe nie geheiratet, mit den Worten, niemand habe ein Aas wie sie heiraten wollen, und schöpft aus ihrer selbst diagnostizierten Unzulänglichkeit die Freiheit, jedermann zu begegnen wie ein offenes Messer. Als nun ihr Vater vor acht Jahren voll wie ein Fass zum Angeln ging und der Zwölf-Kilo-Karpfen, den er prompt am Haken hatte, die größeren Kräfte entwickelte, wurde in Goodyears Bar das elterliche Haus frei. Da niemand sonst Anspruch darauf erhob, befand Marianne zwanzig Jahre FBI als ausreichend und Sierra als arm genug an sozialen Herausforderungen, um sich nicht jeden Tag darüber grämen zu müssen, ihnen nicht gewachsen zu sein. Sie eröffnete eine bescheidene Praxis für Allgemeinmedizin, von ihr spöttisch Institut genannt, und arbeitet seither dem Sheriffbüro als Gerichtsmedizinerin zu, und wenn sie dort überhaupt jemanden mag, dann Luther Opoku. Nur seinetwegen ist sie noch bereit, an Leichen herumzudoktern. Was sie natürlich nie zugeben würde, lediglich ihrer besten und mutmaßlich einzigen Freundin hat sie je davon erzählt, aber Luther weiß es auch so.
Deine einzige Freundin hat gequatscht, denkt er.
Beim Metzger, ohne dass ich darum gebeten hätte.
Die Sheriffwache ist spärlich besetzt. Jamie Withy – von Kimmy gestellt, als er nach Abdrehen des Buchanan’schen Wasserhahns Stärkung im Two Rivers Café suchte, und umgehend zur Absturzstelle beordert – fügt die Fragmente des Berichts zusammen und hat kurzzeitig die Telefonzentrale übernommen. Kimmy ist Milch holen gegangen, nachdem Luther ins Schwarz seines Kaffees geblasen und beiläufig gefragt hat, ob welche da sei, der Sheriff krankgeschrieben. Carls kleines Reich mit dem antiken Schreibtisch und den gerahmten Auszeichnungen steht offen. Obwohl Luther in wenigen Wochen dort residieren wird, strahlt es ultimative Verlassenheit aus.
»Deine Underwood mag mich nicht besonders«, eröffnet Marianne das Gespräch, als sie mittags aufkreuzt. Es klingt wie in sehnsüchtiger Erwartung, dass Luther ihr beipflichten möge.
»Wir können uns zu Carl setzen«, schlägt er vor.
»Ist mir übrigens auch egal.« Marianne folgt ihm. »Ich mag sie nämlich schon dreimal nicht.« Sie zieht einen der Besucherstühle heran und sinkt wie eine graue, zerzauste Feder darauf nieder.
»Kaffee?«
»Seh ich so aus, als wollte ich heute Nacht an der Decke tanzen?«
Luther lacht. »So stark ist der nicht. Jamie hat ihn gekocht.«
»Ach!« Marianne schaut mit gefurchter Stirn nach draußen, wo Jamie im Schein des Computers mit vor Konzentration gespitzten Lippen die Ermittlungsdetails zusammenfügt. »Dann muss es allerdings eine verdammt schlaffe Brühe sein.«
»Was hast du für mich?«