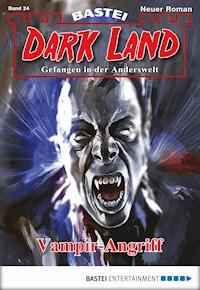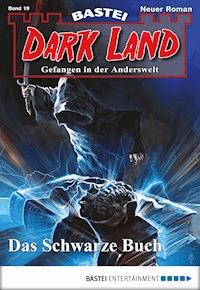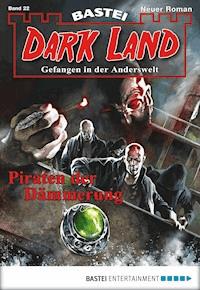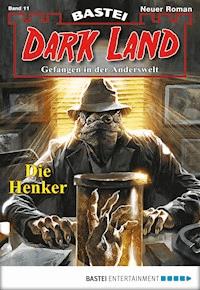1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die UFO-AKTEN
- Sprache: Deutsch
Als es im beschaulichen Butte La Rose, Louisiana, zu merkwürdigen Todesfällen kommt und Menschen verwirrt umherirren, setzt Senator Campbell seine erfahrene Mitarbeiterin Lydia Jones auf den Fall an. Nachdem sich Lydia überraschend nicht mehr meldet, sollen Cliff Conroy und Judy Davenport die Ermittlungen übernehmen und die verschwundene Kollegin finden. Der Weg führt die zwei Bundesmarshals in die Sümpfe und Bayous - und damit auf die Spur eines Geheimnisses, das dort seit vielen Jahren ruht. Dieses Mysterium aufzudecken, bedeutet womöglich, der Lösung aller bisherigen Rätsel näher zu kommen als je zuvor!
Das wissen jedoch auch ihre Gegenspieler - und das Ding im Sumpf weiß sich zu wehren .. mit Mitteln, wie alle Beteiligten sie noch nie gesehen und am eigenen Leibe erfahren haben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Das Ding im Sumpf
Leserseite
Vorschau
Impressum
Rafael Marques
Das Ding im Sumpf
Festplatz »Bayou La Rose«
Butte La Rose, Louisiana, 07. August 1850, 22:39 Uhr
Die Stimmung war ausgelassen. Rhythmische Klänge hallten durch die warme Sommernacht, Menschen tanzten unter den Blätterdächern der Mangrovenbäume oder unter freiem Himmel. Es war sternenklar, ganz so, als wollte jemand die Feiernden mit einem glitzernden Firmament beschenken. Hier, tief in den Bayous und umgeben von nichts als Wald, sollten die Menschen einmal ihre Probleme vergessen und sich nur im Takt der Musik bewegen.
Alles schien so ausgelassen, so unbeschwert, trotz der unruhigen Zeiten, in denen die Männer und Frauen lebten, vor denen sie sich nicht einmal in den tiefen Sümpfen Louisianas verstecken konnten. Bis zu dem Moment, als alles anders wurde – als das grelle pulsierende Licht am Himmel erschien ...
Festplatz ›Bayou La Rose‹
Butte La Rose, Louisiana, 07. August 1850, 22:45 Uhr
Aveline Jones sah es als Erste.
Sie war die eigentliche Initiatorin der Feierlichkeiten, die von nun an jedes Jahr auf dem neu errichteten Festplatz auf einer Landmasse südlich von Butte La Rose stattfinden sollten. Nicht nur die Bewohner des kleinen Örtchens am Ufer des Atchafalaya Rivers waren hier zusammengekommen, sondern auch jene der umliegenden, weit verstreuten Dörfer.
Über zweihundert Menschen sangen, tanzten, lachten und aßen, während Aveline einige Meter neben der Bühne saß und freudestrahlend im Rhythmus klatschte. Dass sie sich einige Tage zuvor den Fuß gebrochen hatte, war zwar enttäuschend, vertrieb ihre gute Laune jedoch nicht.
Und so gefror ihr das Lächeln förmlich auf den Lippen, als sie den grellen Schein am Himmel wahrnahm. Zuerst dachte sie an eine Sternschnuppe, eine Art Zeichen Gottes, der die feiernden Gläubigen auf diese Art grüßen wollte. Einige Sekunden später bemerkte sie die seltsam runde Form des glühenden, schwach pulsierenden Objekts. Was dieses Ding auch war, eine Sternschnuppe auf keinen Fall.
Als sie nach ihren Krücken griff und sich mühevoll aufrichtete, war die Musik bereits verklungen. Nicht nur die Künstler, auch die Tanzenden blickten gebannt in Richtung Himmel, ohne dabei einen Ton von sich zu geben. Niemand wusste, was da über ihre Köpfe schwebte, aber jeder von ihnen ahnte, dass es etwas Besonderes sein musste.
Mit einem lauten Summen rauschte das glühende Etwas über Aveline hinweg und verschwand aus ihrem Blickfeld. Nur die Rauchfahne, die es hinter sich herzog, war noch zu erkennen. Ein beißender, widerlicher Geruch breitete sich auf dem Festplatz aus, der einige Leute sogar husten ließ.
Etwa fünf Sekunden später erfolgte der Aufschlag. Für einen Moment schien die Erde zu erbeben, bis Aveline merkte, dass ihre Knie mehr zitterten als der Boden. Sie drehte sich um und sah den schwachen Lichtschein, der durch die dicht an dicht wachsenden Mangrovenbäume kaum noch zu erkennen war.
»Was war das?«, hörte sie einen Mann rufen.
»Oh Gott, es riecht so furchtbar.«
»Es ist ein Zeichen, ein Zeichen!«
Bald war sie schon gar nicht mehr in der Lage, die vielen Stimmen richtig zuzuordnen. Stattdessen konzentrierte sie sich nur noch auf Philippe, ihren Mann, der mit schnellen Schritten zu ihr eilte und wie so oft über ihre Stirn strich. Er war hochgewachsen, stämmig und doch so einfühlsam. Als Bootsbauer war er einer der wichtigsten Männer im Ort.
»Ist dir auch nichts passiert?«, fragte er sie in ehrlicher Sorge.
Die 34-jährige Künstlerin schüttelte den Kopf. »Nein, aber ... Etwas ist da abgestürzt. Nur Gott weiß, was.«
»Hast du etwas erkennen können?«
Aveline berichtete ihm von der runden, mehrere Meter breiten Form des Objekts, das nun irgendwo in der Nähe im Wasser lag und sicher bald im Sumpf versinken würde. Einige Männer schienen das nicht einfach hinnehmen zu wollen. Sie rotteten sich zusammen, rüsteten sich mit Fackeln und Lampen aus, wohl um nach dem Ding im Sumpf zu suchen.
»Wir müssen wissen, was es ist«, erklärte Jacques Trudeau, als er an Philippe herantrat. Jacques war Fischer und der beste Freund ihres Mannes, leider aber allzu oft ein ziemlicher Heißsporn. Das hatte ihm in der Vergangenheit einigen Ärger eingebracht, doch diesmal schien Philippe gewillt zu sein, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen.
Avelines Herz pumpte wie wild. Sie sah ihren Mann direkt in die Augen und wusste die Antwort auf ihre Frage, ohne dass sie sie jemals aussprach. Er würde die anderen Männer begleiten, um herauszufinden, was da in den Tiefen des Waldes leuchtete und ob es eine Gefahr für die Bewohner des Ortes bedeuten konnte. Etwas sagte ihr, dass sie ihn aufhalten musste, nur sprach sie es niemals aus. Sie ließ Philippe gehen, ebenso wie die anderen Männer.
Keiner von ihnen kehrte jemals zurück ...
Catahoula Levee Road
Drei Meilen nördlich von Catahoula, Louisiana, 25. August 2022, 23:53 Uhr
Es war kurz vor Mitternacht, als die erste Böe den Truck erfasste. Bill Newcomb fluchte, riss das Lenkrad herum, und nur mit all seiner Erfahrung gelang es ihm, seinen Tanklaster wieder in die Spur zurückzubringen.
Er schwitzte bereits seit einer halben Stunde Blut und Wasser, dass ihn das Gewitter nicht noch erwischen würde. Durch eine technische Verzögerung war er dazu gezwungen worden, drei Stunden im Werk in Arnaudville auszuharren. Anderenfalls hätte er den mit Chemikalien gefüllten Tank schon längst an seinem Ziel in Morgan City abgeliefert, wo die Wissenschaftler Gott weiß was mit dem Zeug anstellen würden. Ihm war es grundsätzlich egal, was er da eigentlich transportierte, solange er selbst damit nicht in Berührung kam. Und die Bezahlung stimmte schließlich.
Was ihm allerdings ganz und gar nicht gefiel, war der Umstand, dass er die wie auch immer geartete Flüssigkeit unbedingt noch in dieser Nacht bis zu der an der Mündung des Atchafalaya Rivers gelegenen Stadt bringen sollte. Es war ein heftiges Gewitter mit Hagel und Böen vorausgesagt, und nach dem Wolkenfilm, den er kurz vor dem Start eingehend studiert hatte, würde er von dem Unwetter voll getroffen werden.
»Pech für dich, Kumpel«, war der Kommentar seines Chefs gewesen. Berufsrisiko, hätte er wahrscheinlich auch sagen können, denn das traf es ziemlich gut. Nicht, dass er nicht davon ausging, auch im schlimmsten Sturm den Laster auf der Straße halten zu können, nur musste er bei solchen Gewittern mit allem rechnen. Unter anderem auch damit, dass andere Fahrer nicht so umsichtig waren wie er.
Genervt stellte er das Radio ab und krampfte seine Hände noch fester um das Lenkrad. Erst war es nur der Wind gewesen, jetzt sah er im Licht der Scheinwerfer auch den Regen heranpeitschen. Es war, als würde er gegen eine Wand aus Wasser fahren, so hart klatschten die Tropfen gegen die Scheibe. Selbst die Wischer waren kaum in der Lage, die Massen an Niederschlägen zur Seite zu wischen.
Er betätigte bereits die Bremse, als das geschah, was er nur in seinen schlimmsten Albträumen befürchtet hatte. Wie ein greller, überirdischer Strahl raste der Blitz aus den düsteren Wolkenmassen hervor und verfehlte den Laster nur um wenige Zentimeter. Trotzdem schrie Bill geblendet auf und riss die Arme vor die Augen. Er hörte noch das Bersten von Holz, dann bohrte sich etwas mit immenser Kraft von der rechten Seite in die Reifen seines Trucks.
Instinktiv griff er nach dem Lenkrad, ohne wirklich etwas sehen zu können. Wieder schlingerte der Laster über beide Spuren der Straße, nur gelang es ihm diesmal nicht, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Als Bill das Steuer herumriss, durchstieß die Front bereits die Leitplanke. Metall und Aluminium gaben ein quietschendes Geräusch von sich, als sie aufeinandertrafen, doch das war nichts gegen den Aufschlag im Wasser des parallel fließenden Flusses, der augenblicklich die Scheibe zerbersten ließ.
Bill stieß noch einen erstickten Schrei aus, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Little Atchafalaya River
Südlich von Butte La Rose, Louisiana, 27. August, 14:19 Uhr
»Etwas langsamer, Nelly. Ich glaube, ich habe da etwas gesehen.«
Nelly Crow, die am Heck des Bootes saß und den Motor bediente, stieß ein lautes Seufzen aus. »Was ist es wohl diesmal?«, fragte sie genervt. »Noch ein Rabe?«
Leonard Jackson warf ihr einen bösen Blick zu, sagte aber nichts. Anscheinend wusste er nur zu gut, dass er seinen Kredit als geschulter Ornithologe langsam aufbrauchte, wenn er weiter irgendwelche Raben oder Krähen für Schwarzgeier hielt, denen ihre gemeinsame Suche in den Sümpfen Louisianas tatsächlich galt.
Zwar galten diese Vögel als nicht gefährdet, im Bereich des Cow Island Lakes war der Bestand jedoch nach Studien der Universität von New Orleans in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen. Nun lag diese Studie auch schon wieder drei Jahre zurück, weshalb sich Leonard dazu entschlossen hatte, der Entwicklung einmal auf den Grund zu gehen. Er selbst arbeitete eigentlich als Buchautor und Naturschützer, der seine Aktionen allein durch Spenden finanzierte.
Nelly studierte Sportpsychologie und versuchte, sich in den Semesterferien etwas in Leonards Gruppe hinzuzuverdienen. Der Job war vor allem durch ihre Freundin Tamara Cole zustande gekommen, die so etwas wie die rechte Hand des angeblich so gebildeten Ornithologen war. Dementsprechend enthielt sie sich eines Kommentars, als Nelly ein weiteres Mal seufzte.
Immer wieder verscheuchte sie die unzähligen Mücken, die trotz des Insektensprays unentwegt um ihren Kopf summten. Ein Kampf gegen Windmühlen, was Tamara im Gegensatz zu ihr längst eingesehen hatte. Kein Wunder, schließlich stammte sie aus einem Dorf in der Nähe und kannte die Sümpfe und ihre Eigenheiten seit frühester Kindheit.
Das Boot schaukelte leicht, als Leonard sich aufrichtete. Er war zwanzig Jahre älter als Tamara und Nelly, etwas übergewichtig, dafür aber anscheinend umso mehr mit Entschlossenheit gesegnet. Mit seiner Hornbrille und dem bunten Hemd wirkte er nun wirklich nicht wie ein Umweltaktivist, der er seiner eigenen Aussage nach war. Zumindest, was seinen Internet-Auftritt anging, stimmte das sogar.
Nun, solange die Bezahlung stimmte, war es Nelly herzlich egal, ob ihr Chef wirklich die Welt retten oder lediglich ein paar milde Spender abzocken wollte. Viel mehr störten sie die mörderische Hitze, die schwüle Luft und der modrige Gestank, der aus den Sümpfen über den Little Atchafalaya River trieben. Er war die einzige Verbindung zu dem von Mangroven umgebenen Cow Island Lake, an dem sich eine kaum bewaldete Landmasse anschließen sollte.
Immer wieder hörte sie seltsame Laute aus den sich westlich von ihr ausbreitenden Mangroven. Schrille Schreie, manchmal auch ein seltsam verzerrtes Krächzen, als wäre gerade ein Raubvogel über seine Beute hergefallen. Auch ihren Begleitern waren die Geräusche nicht verborgen geblieben, besonders Tamara warf immer wieder einen irritierten Blick in Richtung des Waldes.
»Was kann das sein?«, fragte Nelly schließlich.
Ihre dunkelhäutige Freundin zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Seltsam ist es schon. Leonard meinte, einige Vögel könnten krank sein.«
»Krank?«
Natürlich dachte sie sofort an den schweren Unfall, der am Tag zuvor durch die Medien gegangen war. Inmitten eines schweren Gewitters hatte ein Blitz einen Baum gespalten, der auf eine einsame Straße gestürzt war und dort einen Tanklaster getroffen hatte. Dieser war dadurch in den parallel verlaufenden Fluss gestürzt, wobei nicht nur der Fahrer gestorben war, sondern auch tausende Liter einer angeblich harmlosen Chemikalie ausgelaufen waren. Die Behörden versuchten wohl, die Verbreitung der Flüssigkeit einzudämmen, da laut Berichten jedoch von keinem größeren Schaden für die Umwelt auszugehen sei, betrieb man dabei keinen allzu großen Aufwand.
»Ja, krank«, erwiderte Leonard, der sich mit dem Fernglas in der Hand zu ihnen umdrehte und sich vorsichtig wieder niederließ. »Fehlalarm.«
Nelly verdrehte innerlich die Augen. Nicht zum ersten Mal musste man diesem Kerl die Antworten förmlich aus der Nase ziehen. Da die merkwürdigen Geräusche nicht nachließen, sondern eher noch anschwollen, entschied sie sich dazu, sein Spiel mitzuspielen und noch einmal nachzufragen.
»Was heißt das genau?«
»Dass eine für die Tiere unbekannte Substanz in das hiesige Ökosystem gelangt ist und dabei enorme Schäden anrichten kann – ganz egal, ob die Behörden behaupten, die Chemikalie wäre völlig harmlos. Der Laster wird ja wohl kaum Hustensaft transportiert haben. So etwas gelangt natürlich in den Nahrungskreislauf, wenn nicht sofort, dann in einigen Wochen oder Monaten. Um ehrlich zu sein, interessieren mich die Laute auch viel mehr als die Schwarzgeier.«
Nelly grinste schelmisch. »Weil du keine findest?«
Die Stichelei brachte ihr einen Schulterstoß ein, der sie fast aus dem Boot befördert hätte. Tamara schrie selbst überrascht auf, griff nach ihrer Freundin und sorgte so dafür, dass sie zumindest einigermaßen trocken blieb.
»Das auch«, gab Leonard Jackson überraschend ehrlich zu. »Andererseits ist es schon ziemlich auffällig, warum die Behörden das Ausmaß des Schadens herunterzuspielen versuchen. Es wird quasi nur noch über den toten Fahrer berichtet, dass seine Witwe an der Trauerfeier teilnimmt und sein Hund nicht mehr fressen will. Alles nur, damit niemand nachfragt, was es mit der ausgelaufenen Flüssigkeit auf sich hat. Wenn es uns gelingt, nachzuweisen, dass die Chemikalie bereits innerhalb von nicht einmal achtundvierzig Stunden einen drastischen Schaden an Flora und Fauna angerichtet hat, wäre die Finanzierung meines Projekts für die nächsten Jahre gesichert.«
Daher weht also der Wind, dachte sich Nelly ihren Teil. Es ging wieder mal ums liebe Geld. Aber da sie auch nur wegen selbigem an dieser Bootsfahrt teilnahm, verkniff sie sich diesmal einen Kommentar.
»Ist das nicht gefährlich?«, fragte Tamara, die in Leonards Gegenwart immer etwas eingeschüchtert wirkte.
»Solange wir vorsichtig vorgehen, nein. Schon bei dem leisesten Anzeichen von Gefahr werden wir uns zurückziehen, aber vorher natürlich alles auf Video aufnehmen. Tamara, würdest du die Filmaufnahmen übernehmen?«
»Sicher.«
Während Tamara die Kamera aus ihrem Rucksack hervorzog, sorgte ein weiterer schriller Schrei dafür, dass sich Nellys Blick wieder auf die Mangrovenbäume richtete. Etwas wühlte sich mit brachialer Gewalt durch das dichte, aus Büschen und ineinander verschlungenen Bäumen bestehende Unterholz.
Selbst Nelly erkannte sofort, dass es sich bei dem Geschöpf um einen Schwarzgeier handelte. Nur verhielt sich dieses Tier völlig irrational. Nicht nur, dass es immer wieder seinen Schnabel in die bereits völlig zerfetzten Flügel stieß, es stieß auch unentwegt seltsame Schreie aus, als würde ihm ein Kloß im Hals sitzen.
Einige Meter flatterte es noch über den Fluss, bevor es wie vom Blitz getroffen in das trübe Brackwasser stürzte und leblos an der Oberfläche trieb. Ob es tot war oder nicht, war aus Nellys Position nicht zu erkennen.
»Wir müssen näher heran!«, rief Leonard und zog einen Plastiksack aus dem Rucksack hervor. Kurz darauf streifte er sich auch zwei Plastikhandschuhe über. »Ich muss den Kadaver sichern, um Gewebeproben nehmen zu können.«
Nelly war die Sache zwar nicht ganz geheuer, trotzdem startete sie den Motor und lenkte das Holzboot in Richtung des im braunen Wasser treibenden Körpers. Eine Strömung war in diesem Bereich des Flusses – wie in großen Teilen der Bayous – kaum vorhanden, weshalb sie sich keine Gedanken darüber machen mussten, dass das Tier schnell abgetrieben worden wäre.
»Langsamer ...«, flüsterte Leonard, was er ihr auch mit diversen Handzeichen bedeutete.
Das leblose Tier war inzwischen fast in Griffweite, sodass der Ornithologe bereits seine Hände nach ihm ausstreckte. In diesem Moment kam wieder Leben in den Schwarzgeier, der wie ein Kastenteufel in die Höhe schoss und nach Leonards Hand zu schnappen versuchte.
Irgendwie gelang es dem Vogel, sich an dem Plastikhandschuh zu verhaken, woraufhin Leonard erschrocken zurücktaumelte und rücklings ins Boot fiel. Während Nelly verzweifelt versuchte, ein Kentern zu verhindern, griff Tamara nach einem in ihrem Rucksack steckenden Buschmesser und schlug mehrfach auf das wie von Sinnen agierende Tier ein. Blut und Federn wirbelten durch die Luft, bis es ihr gelang, ihm mit einem letzten Hieb den Kopf abzutrennen.
»Was war das?«, schrie Leonard erschrocken, wobei er den Kadaver von seiner Brust stieß.
Tamara legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Es ist vorbei«, erklärte sie. »Ist dir was passiert?«
Der Naturschützer blickte auf seine zerfetzten Plastikhandschuhe. »Ein paar Schürfwunden vielleicht, nichts Ernstes. Würdest du das Tier jetzt einpacken?«
»Ja, ja, und dann wirst du erst mal desinfiziert.«
Trotz des Schreckmoments musste Nelly angesichts des seltsamen Gesprächs lächeln. Die beiden unterhielten sich nicht gerade wie ein Wissenschaftler und dessen Assistentin, sondern eher wie Geschwister. Möglicherweise lief zwischen ihnen auch mehr, ein Thema, dem Tamara stets gekonnt auswich.
Bevor ihre Freundin den Kadaver einpackte, zog sie sich selbst Plastikhandschuhe über. Anschließend holte sie Tupfer und Alkohol aus der Notfalltasche hervor und versorgte die Wunden des Ornithologen. »Wir sollten jetzt zurückfahren und das Tier untersuchen«, versuchte sie auf ihren schwer atmenden Chef einzureden.
»Nicht so schnell. So schwer bin ich auch nicht verletzt. Ich denke, wir sollten uns zumindest mal in dem Gebiet umsehen.«
Tamara atmete schwer. »Das gefällt mir nicht, Lenny.«
Der Angesprochene richtete sich wieder auf und sah sich in Richtung des Waldes um, in den nun wieder Ruhe eingekehrt war. Es war beinahe schon zu still, als würde die Tierwelt für einige Minuten den Atem anhalten – oder als ob dieser Vogel das letzte lebende Wesen in diesem Gebiet gewesen wäre.
»Wegen des Tiers oder der Legende?«, fragte er.
»Wegen beidem.«
»Was für eine Legende?«, mischte sich Nelly wieder in das Gespräch ein. Im Gegensatz zu ihrer Freundin stammte sie nicht aus der Gegend und hatte in den vergangenen drei Wochen auch noch nichts von irgendwelchen alten Geschichten über die Bayous von Butte La Rose gehört.
Tamara sah sie so ernst an, dass ihr ein Schauder über den Rücken lief. »Im Jahr 1850, kurz vor dem Bürgerkrieg, ist hier etwas in die Sümpfe gestürzt«, begann sie zu berichten. »Das Ding im Sumpf