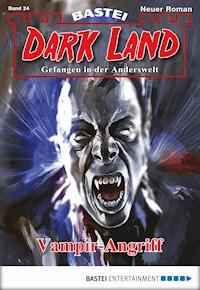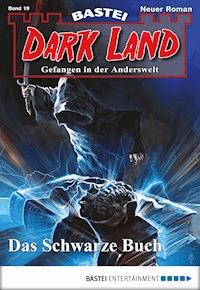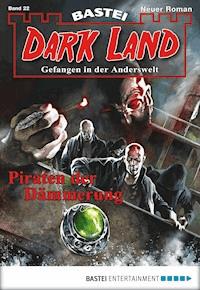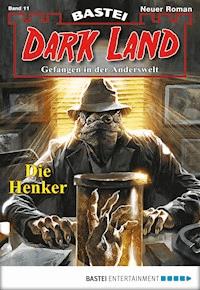1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die UFO-AKTEN
- Sprache: Deutsch
Nadine DuBois ist von ihrer Vergangenheit traumatisiert und hält im Jahr 2012 an der University of Dallas einen Vortrag über die Macht der kindlichen Fantasie. Dass sie dabei eigene Erinnerungen mit philosophischen Theorien vermischt, um diese zu verarbeiten, ahnt niemand der Anwesenden. Auf dem Heimweg von der Vorlesung wird Nadine plötzlich von einem maskierten Angreifer attackiert und findet sich bald darauf in einem Hotelzimmer eines Mannes mit schwarzem Anzug wieder.
Zwölf Jahre später erwacht Nadine erneut aus einer tiefen Bewusstlosigkeit, nun scheinbar in einem Krankenhaus. Bei dem Anzugträger handelt es diesmal um Jeremy McKay. Der NSA-Agent verfolgt einen genau durchgetakteten Plan. Diesen zu durchbrechen, soll die Mission von Cliff und Judy sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Plan der NSA
UFO-Archiv
Vorschau
Impressum
Rafael Marques
Der Plan der NSA
Gorman Lecture Center, University of Dallas
Dallas, Texas, 13. Juli 2012, 09:22 Uhr
Cindy, ihre beste Freundin, griff nach ihrer Hand. »Du packst das, da bin ich mir sicher«, flüsterte sie ihr freudestrahlend ins Ohr. »Tritt dem Professor in den Hintern!«
»Dir geht es ja nur um ein tolles Foto.«
Betroffen zog sich die 21-Jährige mit dem pechschwarzen Pferdeschwanz zurück und begann, mit gesenktem Blick Däumchen zu drehen. »Bin ich so leicht zu durchschauen?«, fragte sie mit perfekter Unschuldsmiene.
»Miss DuBois, würden Sie uns bitte die Ehre erweisen?«
Ein Raunen ging durch den Hörsaal. Andere junge Menschen in ihrer Situation hätten in diesem Augenblick sicherlich unter Herzklopfen gelitten, sie aber nicht. Schließlich war Nadine DuBois nicht wie die anderen, ganz und gar nicht ...
Selbst Cindy, die sich so gerne an sie heranwarf, blieb für sie nur ein Schatten, so wie alle anderen Personen in diesem Raum.
Dabei kämpfte sie darum, dass sich das änderte. Jeden Tag aufs Neue, mit all ihrer Kraft. Niemand in dem Hörsaal ahnte etwas davon, und wem hätte sie auch erzählen können, dass sie monatelang von ihrem eigenen Vater im Keller ihres Elternhauses gefangen gehalten wurde?
Schatten, ja, das passte sehr gut. Die Körper ihrer Kommilitonen blieben noch vorhanden, während deren Gesichter zu einem unförmigen, dunklen Fleck verschwammen, aus dem nicht einmal mehr die Augen herausstachen. Nadine konnte sich nichts vormachen – so sehr sie auch versuchte, ein normales Leben zu führen, sie würde niemals einen Ausweg aus ihrem Trauma finden.
Aber das musste sie auch nicht. Wer wirklich zählte, war Emmy. Ihre Cousine, die für sie schon immer wie eine Schwester gewesen war und der sie verdankte, heute vor all den Studenten und ihrem Professor stehen zu dürfen. Ohne sie wäre Nadine niemals stark genug gewesen, zu überleben und sich so weit zusammenzureißen, dass sie sogar studieren ging und mit einem Mann zusammenlebte.
Emmy war diejenige von ihnen beiden, die den Preis für diese Freiheit zahlte, das durfte sie niemals vergessen. Ein Teil von ihr war für sehr lange Zeit im Wunderland zurückgeblieben. In den Jahren nach ihrer Befreiung hatten sie dort noch viel Zeit miteinander verbracht, inzwischen, seit ihrem Umzug nach Dallas, wurden ihre Besuche seltener. Außerdem kostete es ihre Cousine viel Kraft, sie wieder in ihre Welt zu holen.
Umso erleichterter nahm sie zur Kenntnis, dass sich ihr Zustand nach all den Jahren tatsächlich langsam besserte. Auch dank der Hilfe von Dr. Palance, der sich um Emmy kümmerte, als wäre sie seine eigene Tochter, war es ihr endlich gelungen, das Krankenhaus zu verlassen und einen ersten Schritt in ein eigenständiges Leben zu gehen. Nadine wollte sie dabei nach Kräften unterstützen, sie dachte sogar daran, ihr Studium für ein Semester ruhen zu lassen, um mehrere Wochen am Stück bei ihr zu verbringen – auch wenn sie eigentlich froh gewesen war, nicht mehr in Cypress Tree wohnen zu müssen.
»... können wir heute die kindliche Fantasie mit völlig anderen Augen betrachten«, fand sich Nadine, die gleichzeitig völlig in Gedanken versunken war, mitten in ihrem eigenen Vortrag wieder. Selbst die PowerPoint-Präsentation hatte sie gestartet, ohne wirklich darüber nachzudenken. Sie diente eher der Verdeutlichung dessen, zu was Kinder mit ihrer Vorstellungskraft in der Lage waren ... oder vielmehr sie selbst, denn die teilweise handgezeichneten Bilder waren unter anderem von ihr selbst angefertigte Illustrationen des Wunderlands.
»Allein von der Bedeutung für die geistige Entwicklung eines Kindes einmal abgesehen sollte der Effekt des ›Magischen Denkens‹ auf die therapeutische Arbeit nicht ignoriert werden«, fuhr sie fort, wobei sich in ihrem Inneren ein Gewitter zusammenbraute. »Die Kraft, mit den Gedanken allein die Präsenz körperlicher und seelischer Gewalt abzustoßen oder gar zu ignorieren, muss dem psychologischen Konzept der Konfrontation mit dem geistigen Trauma gegenübergestellt werden. Die Frage ist hierbei, welcher Ansatz für die Entwicklung eines Kindes förderlicher erscheint: Der Wahrheit ins Auge zu sehen und damit lernen zu leben oder seinen Geist völlig von dem traumatischen Ereignis abzuschotten und so die direkte Auseinandersetzung zu vermeiden.«
Was rede ich da? Merken sie etwas? Versteht jemand, dass ich von mir selbst spreche?, kam es ihr in den Sinn.
Nadines Gesicht blieb eine Maske, ihre Mundwinkel zuckten nicht einmal, als sie verstand, dass es sich bei dem Vortrag, den sie im Verlauf der letzten Woche feinsäuberlich ausgearbeitet hatte, eigentlich um einen Erfahrungsbericht handelte. Vielleicht sogar um einen Schrei danach, jemanden zu finden, mit dem sie über all die Schrecken ihrer Kindheit reden konnte. Darüber, dass sie von ihrem eigenen Vater in einer Zelle gehalten worden war und dabei zusehen musste, wie ihr Bruder und ihre Cousine einen fürchterlichen Tod starben. Oder, dass sie nur überlebt hatte, weil sie in eine ferne Welt geflüchtet war und dass es sich dabei um mehr handelte als bloße Fantasie1.
So gerne würde sie darüber reden – mit jemand anderem als Emmy ...
Die Worte sprudelten weiterhin aus ihrem Mund hervor, allein die Schatten vor den Gesichtern ihrer Kommilitonen verschwammen. Neidische Blicke trafen sie, andere schienen beeindruckt von ihrer Redegewandtheit und der scheinbaren Selbstsicherheit. In manchen Pupillen bemerkte sie auch ein düsteres Funkeln, das sie an jenes in den Augen ihres Vaters erinnerte, nachdem er ihr sein wahres Gesicht gezeigt hatte.
Besonders ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit auffallend kindlichen Zügen, der in der ersten Reihe saß, stach dabei hervor. Er hieß Brian, war zwei Jahre älter als sie und galt allgemein als Sonderling in dem Kurs, da er mit niemandem sprach und alle nur beobachtete. Auch diesmal suchte er nicht den Kontakt zu seinen Sitznachbarn und stierte nur sie an.
Mit allergrößter Willenskraft gelang es Nadine, sich nicht länger auf ihn, sondern auf das Ende ihres Referats zu konzentrieren. Selbst ihre abschließende Schlussfolgerung, die die Grundlage für eine folgende Diskussionsrunde bilden sollte, wurde von dem Professor nickend zur Kenntnis genommen. Gregson, der sich sonst so streng und unnahbar gab, war von ihrem Redestil und dem Inhalt ihres Vortrags derart angetan, dass er in den abschließenden Applaus mit einstimmte, indem er auf sein Pult klopfte.
Cindy streckte beide Daumen hoch und grinste von einem Ohr zum anderen, als Nadine an ihren Platz zurückkehrte. Anscheinend hatte sie die ganze Zeit über – wie es so ihre Art war – mit ihrer besten Freundin mitgelitten und war entsprechend erleichtert, dass alles so gut gelaufen war. Insofern war es nicht einmal überraschend, dass sie ihr um den Hals fiel, als sie sich gerade wieder auf ihrem Platz niederlassen wollte.
Eine Freundin zu haben, war eben etwas Besonderes. Echte Freunde teilten alles miteinander, selbst ihre intimsten Geheimnisse, nur würde Cindy niemals eine solche Rolle einnehmen, denn Nadine dachte gar nicht daran, ihre düsteren Erinnerungen mit ihr zu teilen ...
Chemsearch Boulevard, nahe der University of Dallas
Dallas, Texas, 13. Juli 2012, 22:29 Uhr
Es war wieder einmal spät geworden, später, als es Nadine eigentlich recht war. Abgesehen davon, dass sich der Abendkurs dank einiger ausschweifender Vorträge und Gregsons anschließender öffentlicher Beurteilungen ziemlich in die Länge gezogen hatte, war es Cindy noch gelungen, sie zu überreden, etwas Zeit mit ihr in ihrem Wohnheim zu verbringen. Sicher hätte sie sich insgeheim gewünscht, dass sie dort auch übernachtete, doch Nadine wollte unbedingt zurück nach Hause. Wenn sie etwas hasste, dann, in einer fremden Umgebung zu schlafen.
Cindy war ein nettes Mädchen, das ebenso mit tiefergehenden Problemen kämpfte. Zumindest hatte sie etwas in der Richtung angedeutet, als kurzzeitig ihre überfreundliche Maske gefallen war. Sie suchte ebenso verzweifelt nach jemandem, dem sie ihr Herz öffnen konnte, nur wollte Nadine nicht diejenige sein, so leid ihr ihre Freundin auch tat. Sie kämpfte ja selbst schon zu sehr mit ihrem Schicksal, von dem ihrer Cousine ganz zu schweigen. Immer wieder hatte sie sich vorgestellt, nicht mit Cindy, sondern mit Emmy zusammenzusitzen. Bald würde das hoffentlich wieder Realität werden.
Inzwischen lag der Besuch bei der sichtlich enttäuschten Cindy hinter ihr. Völlig allein schritt sie über den Bürgersteig des Chemsearch Boulevards, der mehr oder weniger direkt in Richtung Grauwyler Heights führte. In jenem Viertel von Dallas stand das Haus ihres Mannes Steven, der wahrscheinlich auch in wenigen Minuten von der Arbeit zurückkehren würde.
Steven war ihr erster Freund gewesen, ein Rucksacktourist, dem sie zufällig an ihrem letzten Schultag in Newton über den Weg gelaufen war. Für ihn war es wohl Liebe auf den ersten Blick gewesen, für sie dagegen die Gelegenheit, einen Schlussstrich unter ihr altes, bedrückendes Leben zu ziehen und noch einmal neu anzufangen. Sie mochte ihn, er war ein netter Kerl, der nicht klammerte und ihr die Freiheit ließ, die sie brauchte, um durchzuatmen. Sicher ahnte er, dass es da etwas in ihrer Vergangenheit gab, über das sie nicht reden wollte. Nadine war ihm sehr dankbar dafür, dass er nicht weiter nachbohrte und sie nur dann in den Arm nahm, wenn ihr auch danach war.
Der Gedanke an ihren Ehemann wärmte sie, dennoch störte sie etwas. Nicht der kühle Abendwind oder die Tatsache, dass das letzte Restlicht der untergegangenen Sonne kaum in der Lage war, den Schein der Straßenlaternen zu durchdringen. Stattdessen wurde sie das Gefühl nicht los, verfolgt zu werden.
Mal wieder, dachte sie und erschauderte. Manches änderte sich wohl nie. Schon in ihrer Schulzeit in Newton war sie immer mal wieder der Ansicht gewesen, einen Schatten beobachtet zu haben, der verschwand, sobald sie sich umdrehte. Manchmal wurde ihre Paranoia so schlimm, dass sie mit verzerrten Zügen einem Phantom hinterherjagte, nur um kurz darauf vor einer mehrere Meter hohen Mauer zu stehen.
Diesmal war es anders, das spürte sie. Instinktiv presste sie die Handtasche noch enger an ihren Körper und beschleunigte ihre Schritte. In den letzten Wochen hatte es auf dem und in der Nähe des Campus einige beunruhigende Vorfälle gegeben. Studentinnen, die in der Dunkelheit allein unterwegs gewesen waren, berichteten von einem Maskenmann, der ihnen auflauerte, sie beobachtete und sogar verfolgte. Einmal wollte eines der Opfer sogar ein Messer in der Hand dieser Gestalt gesehen haben. Genau deshalb hatte Nadine eigentlich nicht so viel Zeit bei Cindy verbringen wollen, und aus diesem Grund machte sich ihre Freundin sicher große Sorgen um sie.
Ich bin stark, flüsterte sie sich in Gedanken zu. Ich habe überlebt, nichts hält mich auf.
Es waren leere Worte, mit denen sie sich anfeuerte. Ihre Wirkung verpuffte schnell, ganz im Gegensatz zu jenen ihrer Cousine, der sie verdankte, noch am Leben zu sein. Ohne ihre einfühlsame Stimme wäre sie in diesem verfluchten Keller zugrunde gegangen, weshalb sie sich nichts mehr wünschte, als in wenigen Schritten zu Emmys Haus zu laufen und sie in die Arme schließen zu können.
Ein dumpfer Knall ließ sie erstarren. Auf der Stelle fuhr sie herum, doch mehr als einen Schattenriss, der im Schatten eines Baumes verschwand, bekam sie nicht zu Gesicht. Der Stamm war allerdings nicht dick genug, um einem Menschen komplett Deckung zu bieten. Trotzdem fehlte von der vermeintlichen Gestalt jede Spur.
Nadines Herzschlag beschleunigte sich. Auch, weil das Rauschen des Highways näher rückte, der sie von Stevens Haus trennte. Eine düstere Unterführung musste sie noch überstehen, und angesichts ihres Zustandes fragte sie sich bereits, wie sie diesen mehrere hundert Meter langen Tunnel hinter sich bringen sollte, ohne vor Angst zu vergehen.
Ihre linke Hand zitterte, als sie die Tasche öffnete und ein kleines, schwarzes, klobiges Gerät hervorzog. Den Elektroschocker zwischen den Fingern zu spüren, gab ihr immerhin einen Hauch von Sicherheit zurück. Wenn hier tatsächlich jemand auf sie lauerte, würde sie ihm zeigen, dass sie kein jammerndes Opfer war. Niemals wieder würde sie sich so leicht überwältigen lassen wie von ihrem Vater. Vielleicht wollte sie insgeheim sogar, dass sich der Verfolger endlich aus seiner Deckung wagte und ihr die Gelegenheit gab, ihn mit dem Taser zu traktieren, bis er jämmerlich daran zugrunde ging. So, wie sie es gerne mit ihrem Vater gemacht hätte, wenn er nicht so feige gewesen wäre ...
Was denke ich da?
Nadine erschrak vor ihren eigenen Fantasien. Es war dieser mörderische Trieb, vor dem sie sich fürchtete. Eine geradezu hündische Angst stieg in ihr auf, als sie daran denken musste, diesen Drang, jemand anderem etwas Schreckliches anzutun und dabei zuzusehen, wie er langsam starb, von ihrem Vater geerbt zu haben. Böse Gene, die auch in ihr schlummerten, und jetzt, im Angesicht der Gefahr, plötzlich zum Vorschein kamen. Wenn sie diesen Schritt ging, war sie nicht besser als dieser Mann, der sie so lange im Keller seines Hauses eingesperrt und dabei beobachtet hatte, wie sie langsam den Verstand verlor.
»So bin ich nicht!«, presste sie unter Tränen hervor. »Nein, so ...«
Ihre Worte brachen ab, als sie ein harter Schlag knapp unterhalb des Nackens traf. Sie schrie auf, fiel nach vorne und riss schützend die Arme vors Gesicht. So prellte sie sich nur die nackten Ellenbogen, als sie wuchtig zu Boden stürzte. Stöhnend wälzte sie sich auf den Rücken, bis sie verschwommen eine Gestalt wahrnahm, die direkt über ihr stand.
Angesichts ihrer düsteren Gedanken hatte Nadine kurzzeitig die Welt um sich herum vergessen und so ihre Deckung aufgegeben. Dies wusste diese verfluchte Gestalt für sich auszunutzen, die sich nun an ihrer hilflosen Lage ergötzte.
Der Elektroschocker war ihr aus den Fingern gerutscht, wo er lag, sah sie nicht. Ihr Blick war allein auf den Fremden mit der weißen Maske und dem schwarzen Hoodie gerichtet, in dessen rechter Hand ein Küchenmesser mit breiter Klinge aufblitzte.
Der Atem des Maskenmannes ging schwer, als wäre es für ihn das Höchste der Gefühle, eine wehrlose junge Frau vor sich liegen zu sehen. Doch obwohl Nadine seine Augen nicht erkennen konnte, glaubte sie, an seiner Haltung Mordlust abzulesen. Diesmal würde er sich nicht damit zufriedengeben, sein Opfer erschreckt zu haben. Er wollte mehr, viel mehr. Ihr Leben!
»Geh weg!«, schrie Nadine und tastete vergeblich nach dem Schocker.
Dabei bemerkte sie aus den Augenwinkeln, wie sich die Gestalt des Maskenmannes anspannte. Mit einem leisen Schrei riss er sein Messer in die Höhe, ließ es auf ihre Brust niederfahren und ...
Unbekannter Ort
13. Juli 2012, 22:29 Uhr
Nadine schrie, fasste sich an die Brust und versuchte, die Klinge hervorzuziehen, die sich in ihren Körper gebohrt hatte. Zu ihrer Überraschung glitten ihre Finger ins Leere. Da war nichts, gar nichts, ebenso wenig wie um sie herum. Unter sich spürte sie einen kalten Boden, ansonsten befand sie sich in einer stockdunklen Umgebung.
War das das Jenseits? Hatte der Mann mit der Maske sie getötet und ihr Geist befand sich nun an einem Ort weitab von Raum und Zeit, in den die Seelen der Toten eingingen und ihre ewige Ruhe fanden? Wenn ja, fürchtete sie sich schon jetzt vor dieser immerwährenden, einsamen Existenz.
Nur ... warum atmete sie noch? Warum spürte sie Wärme und Kälte, Angst und Verzweiflung? Und wieso schmeckte sie Blut, nachdem sie sich gerade auf die Lippe gebissen hatte? An einem Ort wie dem Jenseits hätte sie doch nicht einmal einen Körper haben dürfen.
Oder ...?
Zitternd zog sie die Beine an und drückte ihr Gesicht gegen die Knie. Geistesabwesend fuhr sie sich durch die dunkelblonden Haare und war überrascht, als sich einige von ihnen lösten und über ihr Gesicht rieselten. Diese Tatsache machte ihr endgültig klar, dass sie weder tot noch vom Jenseits aufgenommen worden war. Trotzdem lag sie nicht mehr auf dem Bürgersteig, und auch von dem Maskenmann fehlte jede Spur.
Wie war das möglich?
Wieso lebte sie noch?
»Was ist hier los?«, schrie sie, ohne eine Antwort zu erhalten. »Hallo? Hilfe! Hilfeee, bitte ...«
Ihre Schreie gingen bald in ein wehleidiges Jammern und Schluchzen über, bis sie zur Seite kippte und sich wie ein Embryo zusammenrollte. Sie schloss nun die Augen und suchte nach dem Weg durch den endlosen Tunnel, den ihr Emmy damals gezeigt hate. Auch ohne sie wollte sie das Wunderland erreichen und in das Dorf der Elfen und Trolle zurückkehren.
»Emmy«, flüsterte sie dabei immer wieder. »Bitte, zeig mir den Weg! Warte auf mich! Lass mich nicht allein!«
Derweil liefen ihr Tränen über die Wangen, bis sie irgendwann die Kräfte verließen und sie in die gnädige Bewusstlosigkeit hineinglitt.
Dunbar Motel, Zimmer 12
Sunnyville, Texas, 14. Juli 2012, 01:59 Uhr
Ein leises Stöhnen drang aus dem Mund der jungen Frau, als sie wieder erwachte. Zunächst fühlte sie nichts, als wäre sie nur Gast in diesem Körper. Ihr Atem, ihr Herzschlag, ja selbst die latenten Kopfschmerzen nahm sie nur sehr gedämpft wahr. Sie wusste lediglich, dass sie lebte, und diese Tatsache allein genügte ihr bereits, um kurz darauf ein weiteres Mal einzuschlafen.