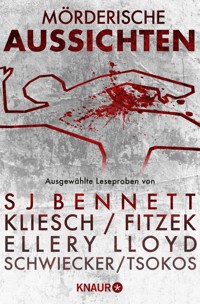Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Fälle Ihrer Majestät
- Sprache: Deutsch
Eine Tote am Pool, ein verschwundenes Gemälde und schockierende Drohbriefe – die neue Herausforderung für die Queen! »Die unhöfliche Tote« ist der 2. Teil der humorvollen cosy Krimi-Reihe mit Queen Elizabeth als heimlicher Detektivin. Queen Elizabeth ist wirklich not amused über den Ausgang des Brexit-Referendums. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann, sind weitere Sorgen – wie zum Beispiel das Fehlen eines ihrer Lieblingsgemälde oder eine Leiche, die am Pool von Buckingham Palace liegt … Die Tote war eine langjährige Haushälterin, und hartnäckige Gerüchte über deren Unbeliebtheit verlangen nach diskreten Nachforschungen. So lässt die Queen wieder einmal nur vordergründig die Polizei und ihre Offiziellen agieren, im Hintergrund aber setzt sie ihre kluge Assistentin Rozie und ihre eigenen grauen Zellen ein. Als sich herausstellt, dass im Hofstaat seit längerer Zeit Drohbriefe kursieren, nimmt der Fall eine bedenkliche Wendung. Und was geht eigentlich in den geheimen Tunneln unter Londons Königspalästen vor ...? Ihren ersten Fall lösen Queen Elizabeth und ihre Sekretärin Rozie im cleveren cosy Krimi »Das Windsor-Komplott«. Auch der 2. Band von S. J. Bennetts hinreißender Krimi-Reihe "Die Fälle Ihrer Majestät" sprüht vor Charme und britischem Humor.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
S. J. Bennett
Die unhöfliche Tote
Die Queen ermittelt
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kurz nach dem ärgerlichen Brexit-Referendum fällt der Queen plötzlich das Fehlen eines Lieblingsgemäldes auf – und als wäre das nicht genug, wird am Swimming Pool von Buckingham Palace die Leiche einer langjährigen Haushälterin gefunden! Gerüchte über deren Unbeliebtheit verlangen nach diskreten Nachforschungen – und so lässt die Queen nur vordergründig die Polizei und ihre Offiziellen, im Hintergrund aber ihre kluge Assistentin Rozie agieren. Als sich herausstellt, dass im Hofstaat seit längerer Zeit Drohbriefe kursieren, nimmt der Fall eine bedenkliche Wendung. Und was geht eigentlich in den geheimen Tunneln unter Londons Königspalästen vor ...?
Inhaltsübersicht
Vorwort
Teil 1
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 2
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Teil 3
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Teil 4
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Dank
Dieser Roman wurde vor dem 9. April 2021 geschrieben, als Prinz Philip mit 99 Jahren starb. Ich widme ihm dieses Buch mit großer Zuneigung und Respekt dafür, wie er sein Leben gemeistert hat. Und nicht ganz ohne Nervosität. Hätte er gelacht und den Roman mit herzlicher Entrüstung aus dem Fenster geworfen? Ich hoffe es.
Teil 1
Sangfroid
Oktober 2016
»Ich werde Eurer erlauchten Lordschaft zeigen, wozu eine Frau fähig ist.«
Artemisia Gentileschi, 1593 – ca. 1654
Prolog
Sir Simon Holcroft war kein Schwimmer. Als Pilotenschüler in der Royal Navy, was ungefähr tausend Jahre zurücklag, war der Privatsekretär der Queen immer wieder ins Wasser geworfen worden. Er wusste sich, wenn nötig, aus einem im Atlantik versinkenden Hubschrauber zu befreien, doch in einem überdachten Pool seine Bahnen zu ziehen, reizte ihn ganz und gar nicht. Aber als er sich dem stattlichen Alter von vierundfünfzig Jahren näherte, war sein Taillenumfang fünf Zentimeter weiter, als er sein sollte, und sein Arzt zeigte sich mit seinem Cholesterinspiegel unzufrieden. Einer musste nachgeben, und das war nicht der Knopf am Hosenbund.
Sir Simon fühlte sich müde. Er fühlte sich schlapp. Auf der langen, unbequemen Autofahrt zurück aus Schottland gestern war er zu dem Schluss gekommen, zu viele Dundee Cakes gegessen und der Queen nicht oft genug angeboten zu haben, sie auf ihren Querfeldein-Spaziergängen zu begleiten. Und als er in seinem Cottage ankam, das zum Kensington Palace gehörte, war ihm klar, dass er sich einen Tritt geben musste, um aus diesem Tief herauszukommen.
Die letzten paar Wochen in Balmoral waren blutig gewesen. Es war, als hätten die Mücken ihre ganz eigenen Highland Games abgehalten. Morgens war er mit Prinz Philip die Einzelheiten des Sanierungsprogramms für den Buckingham Palace durchgegangen, abends hatte er mit seinen Höflingskollegen die letzten Vorschläge und Fragen des Duke am Telefon besprochen und auch selbst einige hinzugefügt. Wenn sie bis zur fälligen Präsentation im Parlament nicht alle ihre Hausaufgaben gemacht hatten, würde der sprichwörtliche Teufel los sein.
Elan war, was er brauchte. Frische. Und so schien ihm trotz fehlender Begeisterung das Schwimmbad im Buckingham Palace die beste Lösung zu sein. Die Belegschaft mied es, wenn die königliche Familie da war. Wobei für Sir Simon das Problem darin bestand, dass er, wenn die Familie nicht da war, in der Regel eben auch nicht da war. Und umgekehrt. Als er sich an diesem Abend jedoch im entlarvenden Ganzkörperspiegel seines Schlafzimmers betrachtete, fasste er den Entschluss, das Risiko einzugehen und sich in aller Frühe ins Wasser zu wagen. Er betete, mit seinem von Mücken zerstochenen, die Nähte seiner Vilebrequin-Badehose auf die Probe stellenden Körper nicht auf einen eifrigen jungen Stallmeister in bester körperlicher Verfassung oder, schlimmer noch, den Duke selbst nach einem frühmorgendlichen Bad zu treffen.
Sir Simon machte sich rechtzeitig auf den vierzigminütigen Weg durch Hyde und Green Park, eine der wenigen absolut grünen Strecken durch Londons Innenstadt, um bereits um 6:30 Uhr im Buckingham Palace zu sein. Dummerweise hatte er seine Badehose schon angezogen, was sich als leicht unangenehm erwies. Er parkte seinen Aktenkoffer auf dem Schreibtisch in seinem Büro, hängte die Anzugjacke auf einen hölzernen Bügel und zog seine Budapester aus. Die Seidenkrawatte, heute mit winzigen rosa Koalas, rollte er sorgfältig auf und legte sie in den linken Schuh. Dann schulterte er seinen Rucksack mit dem Badetuch und machte sich auf Strümpfen auf den kurzen Weg zum Nordwest-Pavillon. Mittlerweile war es 6:45 Uhr.
Der von John Nash entworfene Pavillon mit Blick auf den Green Park war ursprünglich ein Gewächshaus und Sir Simon der Meinung, er hätte es auch bleiben sollen. Seine Mutter war eine große Botanikerin gewesen, und für ihren Sohn waren Gewächshäuser Wunderstätten der Natur, beheizte Pools dagegen eher billig und geschmacklos. Aber der Vater der Queen hatte damals in den 1930ern den Umbau beschlossen, für das Schwimmvergnügen seiner kleinen Prinzessinnen, und so gab es ihn nun, diesen Pool mit seinen griechischen Säulen außen und den leicht lädierten Art-déco-Kacheln innen, der wie so vieles im Buckingham Palace, was der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, dringend ein Update benötigte.
Um in den Poolbereich zu gelangen, musste man das Hauptgebäude nicht verlassen, sondern ging durch eine normale Tür, an der Instruktionen klebten, was im Falle eines Feuers zu tun war, dazu die Erinnerung daran, dass niemand allein schwimmen sollte, was er ignorierte. Die Luft im Korridor hinter der Tür war bereits unangenehm feucht und Sir Simon froh, dass er seine Krawatte im Büro gelassen hatte. Im Männer-Umkleideraum zog er Hemd, Hose und Strümpfe aus und hängte sich sein Badetuch über den Arm. Auf einer der Bänke stand ein Kristallglas. Komisch, war die Familie doch gestern Abend erst aus den Highlands zurückgekommen. Offenbar hatte die jüngere Generation noch eine kleine Feier veranstaltet. Im Poolbereich war eigentlich alles Glas verboten, aber man sagte den Prinzen und Prinzessinnen nicht, was sie im Zuhause ihrer Granny zu tun und zu lassen hatten. Sir Simon nahm sich vor, nach seinem Bad eine der Haushälterinnen zu informieren.
Er duschte schnell, ging Richtung Pool, durch dessen Fenster man auf die Platanen im Park hinaussah, und bereitete sich innerlich auf den Schock vor, den das kühle Nass seinem allzu ausladenden Körper bereiten würde.
Doch der Schock war ganz anderer Natur.
Zunächst weigerte sich sein Gehirn zu verarbeiten, was er da sah. War das eine Decke? Eine Lichtspiegelung? Da war so viel Rot. So viel dunkles Rot auf dem gefliesten grünen Boden. Und mitten im Rot ein Bein, nackt bis zum Knie, ein Frauenbein. Das Bild brannte sich in seine Netzhaut ein. Er kniff die Augen zusammen.
Sein Atem kam schnell und stoßweise, und Sir Simon trat zwei Schritte vor. Dann noch zwei, und er stand im geronnenen Rot und starrte auf das Schreckensbild vor ihm.
Eine Frau in einem hellen Kleid lag auf der Seite in einer dunklen Lache. Die Lippen blau, die Augen weit offen und leer. Der rechte Arm war in Richtung der Füße ausgestreckt, die Hand weit geöffnet. Alles war voll mit geronnenem Blut. Der linke Arm deutete zum Rand des Pools, wo die Blutlache endete. Sir Simon spürte, wie ihm das eigene Blut in den Ohren pochte, eins, zwei, eins, zwei.
Behutsam kniete er nieder und legte widerstrebend zwei Finger an den Hals der Frau. Da war kein Puls, und wie sollte das auch möglich sein? Bei diesen Augen? Er verspürte den Drang, die Lider zu schließen, dachte aber, dass er das lieber nicht tun sollte. Ihr Haar lag ausgebreitet um ihren Kopf, ein in Rot getränkter Heiligenschein. Sie wirkte überrascht. Oder bildete er sich das nur ein? Und so klein und zerbrechlich, dass er sie, lebte sie noch, leicht hätte aufheben und in Sicherheit bringen können.
Er erhob sich, spürte einen scharfen Schmerz im Knie, versuchte das klebrige Blut von seiner Haut zu wischen und fühlte etwas Körniges. Er sah genauer hin und entdeckte kleine Splitter eines dicken Glases. Und so rann denn sein eigenes frisches Blut aus ein paar Schnitten in seinem Knie und vermischte sich mit ihrem. Jetzt sah er sie, die Überbleibsel eines zersprungenen Glases, wie eine kristallene Ruine in einer tiefroten See.
Er kannte das Gesicht, kannte das Haar. Was machte sie hier, mit einem Whiskyglas? Sein Körper war wie erstarrt, doch er zwang ihn zurück ins Hier und Jetzt, um Hilfe zu rufen. Auch wenn es zu spät war.
Kapitel 1
Drei Monate früher …
Philip?«
»Ja?« Der Duke of Edinburgh hob eine halbe Braue vom Daily Telegraph, der an einem Honigglas auf dem Frühstückstisch lehnte.
»Du weißt schon, das Gemälde.«
»Welches? Du hast siebentausend«, sagte er, einfach nur, um schwierig zu sein.
Die Queen seufzte innerlich. Sie hatte sowieso sagen wollen, welches. »Das von der Britannia. Das immer vor meinem Schlafzimmer hing.«
»Wie, das schreckliche kleine Ding von dem Australier, der keine Schiffe konnte? Das?«
»Ja.«
»Ja?«
»Ich habe es gestern in Portsmouth entdeckt, im Semaphore House. In einer Ausstellung maritimer Kunst.«
Philip sah demonstrativ auf die Kommentarseiten seiner Zeitung und stöhnte. »Das passt. Für eine Yacht.«
»Du verstehst nicht. Ich habe den Startschuss zur neuen Digitalstrategie der Navy gegeben, und zu dem Anlass haben sie ein paar Bilder in den Empfangsbereich gehängt.« Die Digitalstrategie war eine komplizierte Geschichte und sollte die Royal Navy auf den neuesten technischen Stand bringen. Die Ausstellung hatten sie einfach gehalten. »Hauptsächlich graue Schlachtschiffe. Dazu eine J-Class-Yacht unter Segeln in Southampton, weil da immer eine ist. Und daneben unsere Britannia, von 63.«
»Woher weißt du, dass es unsere war?« Er hob den Blick immer noch nicht.
»Weil sie es war«, sagte die Queen mit leicht scharfem Unterton, weil sie sein fehlendes Interesse plötzlich seltsam betrübte. »Ich kenne meine Bilder.«
»Da bin ich sicher. Alle siebentausend. Also, dann sag den Stabsfexen, die sollen es rausrücken.«
»Das habe ich.«
»Gut.«
Die Queen spürte, dass es in seinem Artikel im Daily Telegraph um den Brexit ging und ihr Mann deshalb so gereizt war. Cameron weg. Die Partei in Auflösung. Die ganze Sache so teuflisch verpfuscht …
Da war ein einzelnes Gemälde von einem unbedeutenden Maler, aus einer Zeit lange bevor das Land in den Gemeinsamen Markt aufgenommen worden war, kaum von Bedeutung. Sie sah hoch zu den Landschaften von Stubbs mit ihren wundervollen Pferden, die die Wände ihres privaten Esszimmers schmückten. Philip selbst hatte seine Frau hier vor vielen Jahren gemalt, beim Lesen der Zeitung, und man konnte durchaus sagen, dass er besser war als der Maler der Britannia. Aber das Bild war ihr einmal sehr lieb und teuer gewesen.
Und das auf eine Weise, die sie nie jemandem gestanden hatte. Sie wollte dieses Bild zurück.
Ein paar Stunden später kam Rozie Oshodi ins Arbeitszimmer der Queen, das sich im Nordflügel befand, um die roten Schachteln mit den Arbeitspapieren Ihrer Majestät zu holen. Rozie war nach einer kurzen Karriere in der Army und bei einer Privatbank erst vor wenigen Monaten als stellvertretende Privatsekretärin in die Dienste der Queen getreten. Sie war noch relativ jung für die Position, hatte bislang aber bewundernswerte Leistungen erbracht, einschließlich, und vielleicht besonders, was die eher unkonventionellen Aspekte betraf.
»Gibt es etwas Neues?«, fragte die Queen und sah von ihrer letzten Unterschrift auf.
Gestern hatte sie Rozie mit der Aufgabe betraut, herauszufinden, wie das Gemälde der ehedem königlichen Yacht an seinen jetzigen Ort gelangt war, und für seine schnelle Rückgabe zu sorgen.
»Ja, Ma’am, aber nichts Gutes.«
»Oh?« Das kam überraschend.
»Ich habe mit dem zuständigen Offizier der Marinebasis gesprochen«, erklärte Rozie, »und er meint, es handelt sich um eine Verwechslung. Der Maler müsse mehrere Versionen der Britannia auf ihrer Australienreise angefertigt haben. Das fragliche Exemplar sei der Ausstellung vom Second Sea Lord als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden. Es gebe keine Plakette oder sonst einen Hinweis auf seine Herkunft. Das Bild stamme aus der Sammlung des Verteidigungsministeriums und hänge seit Jahren im Büro des Second Sea Lord.«
Die Queen betrachtete ihre stellvertretende Privatsekretärin nachdenklich durch ihre Gleitsichtbrille.
»Tut es das? Ich habe es das letzte Mal in den 1990ern gesehen.«
»Ma’am?«
Hinter der königlichen Brille glomm Streitlust auf. »Der Second Sea Lord hat keine zweite Version. Er hat meine. In einem anderen Rahmen. Und er hat sie schon seit langer Zeit, wie ich jetzt von Ihnen erfahre.«
»Ah … Ja, ich verstehe.« Aber so, wie Rozie sie ansah, war klar, dass sie es nicht tat.
»Fahren Sie noch einmal hin und finden Sie heraus, was da vorgeht, ja?«
»Natürlich, Ma’am.«
Die Queen trocknete ihre Unterschrift mit der Löschwiege und schob das Blatt wieder in die rote Schachtel. Ihre stellvertretende Privatsekretärin nahm den Stapel mit den Schachteln an sich und ließ ihre Chefin grübelnd zurück.
Kapitel 2
Der Palast ist eine Todesfalle.«
»Ach, kommen Sie, James. Sie übertreiben.«
»Keineswegs.« Der Kämmerer blickte den Privatsekretär finster über dessen alten Schreibtisch hinweg an. »Wissen Sie, wie viel vulkanisiertes Gummi man hier gefunden hat?«
»Ich weiß nicht einmal, was das ist.« Sir Simon hob die linke Braue und signalisierte sowohl Neugier als auch Belustigung. Als Privatsekretär war er dafür verantwortlich, die offiziellen Besuche der Queen und den Austausch mit der Regierung zu organisieren, tatsächlich aber interessierte er sich für alles, was sie betreffen mochte. Und sollte Buckingham Palace eine Todesfalle oder dergleichen sein, gehörte das zweifellos mit in diese Kategorie.
Sein Besucher, Sir James Ellington, war für die königlichen Finanzen verantwortlich. Er arbeitete seit Jahren mit Sir Simon zusammen, und es war nicht ungewöhnlich, dass er forschen Schritts die zehn Minuten von seinem Schreibtisch oben im Südflügel zu Sir Simons großzügigem Büro mit den hohen Decken im Erdgeschoss des Nordflügels eilte, um sich über das neueste Fiasko zu beklagen. Hinter der unerschütterlichen Miene eines jeden englischen Gentleman lauert ein Mensch, der darauf brennt, hinter vorgehaltener Hand mit spitzer Zunge seiner Verärgerung über etwas Ausdruck zu verleihen. Sir Simon entging jedoch nicht, dass sein Gegenüber ernsthaft besorgt war, was das vulkanisierte Gummi anging. Warum auch immer.
»Gummi wird mit Schwefel behandelt, um es zu härten«, erklärte Sir James, »und man produziert damit Kabelummantelungen. Wenigstens war das vor fünfzig Jahren noch so. Und sie erfüllen ihren Zweck, zersetzen sich aber mit der Zeit, durch Luft, Licht und so weiter. Sie werden spröde, morsch.«
»Ein bisschen so wie Sie heute Morgen«, sagte Sir Simon.
»Hören Sie auf. Sie haben ja keine Ahnung.«
»Und … Was ist das Problem mit unserem spröden, vulkanisierten Gummi?«
»Es zerfällt. Die Stromleitungen hätten schon vor Jahrzehnten erneuert werden müssen. Das wissen wir seit Langem, aber als wir im letzten Monat das Leck oben unter dem Dach hatten, sind wir gleich auf ein ganzes Bündel gestoßen, das sich durch einfache Berührung praktisch auflöste. Was bedeutet, dass die Verkabelungen im Schloss nur mehr zufällig zusammenhalten. Zweihundert Kilometer davon. Ein falscher Kontakt und … pfffft!« Sir James vollführte mit seiner rechten Hand eine elegante Geste, um eine Rauchwolke oder eine kleinere Explosion anzudeuten.
Sir Simon schloss kurz die Augen. Es war nicht so, dass sie nicht von der Feuergefahr wussten. Die Katastrophe in Windsor Castle 1992 – fünf Jahre hatte es gedauert und mehrere Millionen Pfund verschlungen, die Schäden zu beseitigen. Jeden Sommer hatten sie seither Buckingham Palace für Besucher geöffnet, um wenigstens einen Teil der Kosten wieder hereinzubekommen. Als sie anschließend, der Sicherheit halber, auch im Buckingham Palace die Elektroinstallationen überprüften, stellte sich heraus, dass die Situation hier noch gefährlicher war. Die Pläne zur Sanierung wurden vorangetrieben, stießen aber immer wieder auf neue Komplikationen.
»Was machen wir also?«, fragte er. »Siedeln wir sie um?«
Es war nicht nötig zu sagen, wer da womöglich umziehen musste.
»Das sollten wir wahrscheinlich, und zwar pronto. Sie wird natürlich nicht wollen.«
»Natürlich nicht.«
»Wir haben den Gedanken im letzten Jahr schon einmal vorgebracht, und ihre Begeisterung hielt sich in Grenzen«, sinnierte Sir James düster. »Ich kann es ihr nachfühlen. Wenn sie umzöge, müsste es nach Windsor sein, damit sie ihren Terminen nachkommen kann. Die Autobahn hinaus aus der Stadt würde mit Botschaftern, Ministern und Gästen der Gartenpartys verstopft sein, und das Schloss selbst müsste völlig umorganisiert werden. Nein, nein, sie wird hier brav weitermachen. Solange der Buckingham Palace nicht unbewohnbar ist …«
»Aber das ist er, sagen Sie«, warf Sir Simon ein.
Sir James seufzte. »Richtig.« Er hob den Blick gen Himmel. »Der Palast sollte nicht mehr bewohnt werden. Wäre er ein Reihenhaus in Birmingham, würden die Behörden eine amtliche Mitteilung an die Haustür kleben und der Familie jeden Zutritt verbieten, bis alles in Ordnung gebracht wäre. Aber dies ist ein Palast, der gebraucht wird, also geht es nicht. Der Sanierungsplan, der ihr erlaubt, während der Arbeiten hierzubleiben, ist so gut wie fertig, was die Sache allerdings ein, zwei Millionen teurer werden lässt. Oh, übrigens, fast hätte ich es vergessen. Sie kennen doch Mary, meine Sekretärin? Die äußerst tüchtige, die alle E-Mails rechtzeitig beantwortet, das Sanierungsprogramm bis ins Detail kennt und fast schon was Geniales hat?«
»Ja?«
»Sie hat gekündigt. Ich habe es im Einzelnen nicht mitbekommen, aber sie war heute Morgen völlig in Tränen aufgelöst. Also …«
Er wurde von Rozie unterbrochen, die mit den Schachteln hereinkam und sie auf die Marmorplatte des Konsolentischs neben der Tür legte, damit das Kabinettsbüro sie später abholen konnte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Sir Simon.
»Weitgehend. Wie finde ich heraus, ob wir in den Neunzigern dem Verteidigungsministerium eines der Gemälde der Queen ausgeliehen haben?«
Angesichts dieser wenig interessanten Frage stand Sir James auf und verabschiedete sich.
Rozie sah ihm neugierig hinterher. Sir Simon beugte sich vor, legte die Fingerspitzen gegeneinander und konzentrierte sich auf das neue Thema. Er war gut darin, von einem Problem zum anderen zu wechseln – wie eine Turnerin am Stufenbarren, hatte Rozie oft schon gedacht, oder ein Eichhörnchen beim Hindernislauf.
»Hmm. Sprechen Sie mit dem Royal Collection Trust«, schlug er vor. »Die kümmern sich um ihre private Sammlung und andere Dinge der Krone, glaube ich. Warum wollen wir das wissen?«
»Die Chefin hat das besagte Bild in Portsmouth gesehen«, erklärte Rozie. »Das Verteidigungsministerium behauptet, es gehört ihnen. Aber sie sagt, es war ein persönliches Geschenk des Malers an sie. Man sollte doch annehmen, dass sie weiß, wovon sie spricht.«
»Das sollte man. Wie lautet die Entschuldigung des Ministeriums?«
»Sie behaupten, es gibt zwei davon.«
Sir Simon ließ einen leisen Pfiff hören. »Mutiger Schachzug. Können wir den Künstler befragen?«
»Nein, daran habe ich schon gedacht, aber er ist tot. Er hieß Vernon Hooker. Starb 1997.«
»Hat er viele Schiffe gemalt?«
»Hunderte. Wenn Sie ihn googeln, sehen Sie es.«
Rozie wartete, während Sir Simon den Namen in seinen Computer eingab und instinktiv zurückzuckte.
»Großer Gott. Hat er je einen Fuß auf ein Schiff gesetzt?«
Rozie war keine Expertin für maritime Malerei, doch Sir Simons Reaktion überraschte sie nicht. Vernon Hooker gefiel es, seine Objekte in leuchtende Farben zu kleiden, unter grandioser Missachtung von Licht und Schatten. Die Bilder schwelgten in weit mehr Smaragdgrün, Stahlblau und Lila, als man es von Szenerien erwarten würde, die hauptsächlich aus Meer und Himmel bestanden. Aber nun, ein anderer Lieblingsmaler der Queen war Terence Cuneo, dessen Bilder von Zügen und Schlachtszenen auch kaum einfarbig zu nennen waren. Und zu ihrer Überraschung hatte Rozie feststellen müssen, dass für Hookers Arbeiten allgemein hübsche Summen bezahlt wurden. Es waren echte Sammlerobjekte.
»Die haben wahrscheinlich recht, oder?«, schloss Sir Simon mit einem weiteren Blick auf seinen Bildschirm. »Das Ministerium, meine ich. Es gibt Dutzende von den verdammten Dingern. Ich wette, dieser Hooker hat mehr für eine seiner königlichen Yachten im Neon-Stil eingestrichen, als er für eine stinknormale Meereslandschaft bekommen hätte. Er scheint Unmengen davon produziert zu haben.«
»Sie ist unerschütterlich. Und tatsächlich habe ich keine andere Britannia finden können.«
»Wie gesagt, reden Sie mit Neil Hudson beim Trust. Fragen Sie, ob wir das Bild womöglich ausgeliehen haben. Zwanzig Jahre sind lange genug, da kann das Ministerium es allmählich wieder zurückgeben.«
»Okay.« Rozie wechselte das Thema. »Warum sah Sir James so geknickt aus? Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges unterbrochen.«
»Nein, nein, nur die gewohnte Klage über seine existenzielle Verzweiflung. Es ist die verflixte Sanierungsgeschichte, zudem hat seine Sekretärin gekündigt, und man hat eine Vulkanisierung oder so was entdeckt. Die Verkabelung ist marode und der Palast offenbar eine Todesfalle.«
»Gut zu wissen«, sagte Rozie aufgeräumt und ging zur Tür. »Klingt teuer.«
»Das wird es. Der Voranschlag liegt längst über dreihundertfünfzig Millionen. Das Parlament muss ihn im November absegnen, und sie haben nicht mal genug, um sich die eigenen Bezüge zu erhöhen.«
Sie blieb auf der Schwelle noch einmal stehen. »Tja, aber das hier ist das zweitbekannteste Gebäude der Welt.«
»Aber … dreihundertfünfzig Millionen.« Sir Simon verschränkte die Arme vor der Brust und sah verzagt auf seinen Computer. »Irgendwie klang dreihundert noch nicht ganz so schlimm.«
»Auf zehn Jahre verteilt«, erinnerte sie ihn. »Und es kommt schon wieder herein, es steht im Budget, wie bei Windsor. Die Rechnung für die Renovierung des Parlamentsgebäudes belief sich auf vier Milliarden, wie ich zuletzt gehört habe.«
Die Miene des Privatsekretärs hellte sich etwas auf. »Sie haben völlig recht, Rozie. Achten Sie nicht weiter auf mich, ich bin urlaubsreif. Wie können Sie noch so voller Energie sein?«
»Frische Luft und Sport«, sagte sie bestimmt. »Sollten Sie auch mal probieren.«
»Etwas mehr Respekt, junge Dame. Ich bin für mein Alter sehr fit.«
Rozie, die wirklich äußerst fit war, nicht nur für ihr Alter – sie war dreißig –, schenkte ihm noch ein nettes Grinsen und verschwand in ihr Büro nebenan.
Er versuchte es sich nicht anmerken zu lassen, aber ihre Bemerkung machte ihm zu schaffen. Sie war eine große, attraktive junge Frau mit einem kurzen, präzise geschnittenen Afro, einer athletischen Figur und einer Fitness, die seit ihrer Zeit in der Royal Horse Artillery kaum nachgelassen hatte. Er dagegen war ein Vierteljahrhundert älter, und seine Knie waren nicht mehr das, was sie mal gewesen waren. Auch sein Rücken nicht. Als junger Hubschrauberpilot und Diplomat im Auswärtigen Dienst war er durchaus sportlich gewesen, ein Ex-College-Ruderer, der auf dem Rugbyfeld seinen Mann stand und ein teuflisch guter Kricketspieler war. Aber über die Jahre war sein Claret-Konsum gestiegen, während die Zeit, die er für Rudern, Rugby und Kricket erübrigte, immer weiter zurückging. Er musste wirklich etwas für sich tun.
Kapitel 3
Rozie setzte sich an ihren Schreibtisch und klickte auf eine Bilderserie, die sie auf ihrem Laptop gespeichert hatte. Sie hatte den zuständigen Offizier der Marinebasis in Portsmouth gebeten, ihr ein Foto des Gemäldes der Britannia zu schicken, damit sie wusste, worüber sie redeten. Das Bild zeigte die königliche Yacht unter voller Beflaggung, umgeben von kleineren Schiffen und mit einem flachen Stück Land im Hintergrund. Sie fragte sich kurz, warum der Chefin so viel daran lag. Schließlich gehörten ihr Leonardos und Turners, und Rozie musste an den kleinen, wunderschönen Rembrandt in Windsor Castle denken, für den sie mit Freuden ihren Mini verkaufen würde.
Der Offizier war ziemlich bestimmt gewesen. Der Second Sea Lord, ein Vizeadmiral, der für die Personalfragen in der Navy verantwortlich war, hatte verschiedene Gemälde in seinem Büro hängen, alle ganz vorschriftsmäßig vom Verteidigungsministerium bezogen. Leihgaben von Dritten wurden genau verzeichnet und stets im erdenklich besten Zustand zurückgegeben. Das fragliche Bild war keine Leihgabe. Es musste einfach zwei davon geben. Da war man sicher.
Nur war die Chefin ebenso sicher, dass dem nicht so war.
Rozie rief den Händler des Malers in Mayfair an, der sich keiner weiteren Britannia-Gemälde seines verstorbenen Klienten bewusst war. Aber er schlug vor, dass sie mit Hookers Sohn sprach.
»Don ist der Experte, was die Arbeiten seines Vaters betrifft. Er ist Ende sechzig, blitzgescheit. Er lebt in Tasmanien. Da ist es jetzt Abend, aber ich bin sicher, er unterhält sich gerne mit Ihnen.«
Rozie dachte, was für ein großzügiges Angebot das doch sei, erinnerte sich dann aber, für wen sie den Anruf machte. Nein, der Sohn des Malers würde wohl tatsächlich nichts dagegen haben, sich mit ihr über das kleine Problem der Queen zu unterhalten. Im Allgemeinen waren die Leute gerne behilflich, wenn sie hörten, wer da anklopfte.
Don Hooker reagierte genau so, wie es der Kunsthändler versprochen hatte.
»Die königliche Yacht in Hobart, bei der Regatta? Oh, ja, das kenne ich. Das war 1962 oder 63, irgendwann um den Dreh. Ihre Majestät war auf einer ihrer Reisen. Ich weiß noch, wie Daddy mir die Geschichte erzählt hat. Er war so stolz auf das Bild! Er war ein großer Anhänger der Monarchie, mein Dad, und da kam sie, diese wunderschöne Lady, die mit ihrer Yacht um die Welt fuhr. Er verfolgte die gesamte Berichterstattung, und alle mussten mit ihm zuhören. Wobei, um ehrlich zu sein, Rozie, ich war damals noch grün hinter den Ohren und fand das alles weniger interessant. Aber Dad liebte es. Er hatte eine Karte an der Wand hängen, auf der er ihre Route mit kleinen grünen Nadeln markierte. Er sammelte Postkarten, Tassen, was es gab. Er sagte, sie sehe so glücklich aus auf dieser Reise, und er wollte, dass sie etwas hatte, was sie immer daran erinnern würde. ›Ein Stück von diesem Glück‹, so drückte er es aus. Er malte das Bild nach einem Foto in der Zeitung, die Farben fügte er selbst hinzu, wissen Sie … Und er bekam ein dickes britisches Danke auf dem Briefpapier des Palastes, mit einem großen roten Wappen. Da stand, die Queen habe die Britannia noch nie so farbenfroh gesehen. Es war das einzige Bild, das er von ihr gemalt hat. Den Brief haben wir wahrscheinlich noch irgendwo in Dads Archiv. Ich kann nachsehen, wenn Sie wollen …«
Als Rozie ihn ein weiteres Mal anrief, war sich der Offizier in Portsmouth nicht mehr so sicher, was seine Theorie mehrerer Versionen des Bildes anging.
»Vielleicht haben wir eine Kopie?«, sagte er. »Ich stimme zu, es ist eine äußerst ungewöhnliche Situation, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich nicht um eine Leihgabe des Palastes handelt.«
Sir Simon würde die Queen als Nächster sehen, und er brachte die Chefin auf Rozies Bitte hin bei der Gelegenheit auf den neuesten Stand.
»Sie sagt, es ist keine Kopie, sondern das Original«, informierte er Rozie nach seiner Rückkehr. »Finden Sie heraus, wie die an das Bild gekommen sind, und sagen Sie ihnen, sie sollen aufhören zu mauern. Sie ist ziemlich angefressen.«
»Wie kann sie sagen, dass es das Original ist?«, wollte Rozie wissen. Schließlich hatte die Queen das Bild nur ein paar Minuten bei schlechter Beleuchtung in der provisorischen Ausstellung des Marine-Hauptquartiers gesehen. Bei dem Besuch selbst war es um etwas anderes gegangen.
»Keine Ahnung. Aber sie ist sich sicher.«
Wenn es so war, würde Rozie die Sache in Ordnung bringen.
»Nur ein bisschen näher ins Licht.«
Die Queen änderte die Neigung ihres Kopfes ein wenig, ihr Hals wurde langsam steif.
»So?«
»Sehr schön, Ma’am, perfekt.«
Sie schloss kurz die Augen. Es war angenehm und friedlich im Yellow Drawing Room. Hinter den schweren Netzvorhängen schimmerte die Sonne auf der goldenen Statue der Siegesgöttin auf dem Victoria Memorial – dem Geburtstagskuchen, wie die Wachen es nannten. Warme Strahlen fielen auf ihre linke Wange. Wenn man nur diese verflixte Pose nicht beibehalten müsste, könnte man leicht ein kleines Nickerchen machen.
Aber sie musste so sitzen bleiben. Die Queen konzentrierte sich auf die neunstufige chinesische Pagode in der Ecke, die fast bis zur Decke reichte. Ihr Urgroßonkel, George IV., hatte sich nicht mit halben Sachen zufriedengegeben.
»Bekommen Sie, was Sie brauchen?«
»Absolut. Es dauert nicht mehr lange. In ein paar Minuten können Sie Ihre Schultern entspannen.«
Lavinia Hawthorne-Hopwood stand an ihrer Staffelei und machte vorbereitende Skizzen für eine Skulptur. Sie war eine umsichtige Künstlerin. Sie wusste, was so eine Sitzung für ihr Modell bedeutete, und versuchte die Anstrengung zu minimieren. Das war einer der Gründe, warum die Queen gerne mit ihr arbeitete. Es war nicht ihr erstes »Rodeo«, wie Harry es nannte. (Was für ein großartiger Ausdruck dafür. Die Queen liebte Rodeos und dachte immer, unter anderen Umständen hätte sie da erfolgreich sein können.)
»Woran arbeiten Sie gerade?«
»Die Augen, Ma’am. Das ist immer das Schwierigste.«
»Verstehe.« Durchs Fenster sah sie mehrere Leute, die vor dem Tor des Palastes für Fotos posierten. Einer schien Tanzbewegungen zu machen. Tat er das für eine dieser Social-Media-Verrücktheiten, von denen Eugenie ihr erzählt hatte? Die Queen beugte sich etwas vor, um ihn besser in den Blick zu bekommen.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Ma’am …«
»Was?« Die Queen wurde aus ihren Gedanken gerissen und begriff, dass sie ihre Position verändert hatte. Lavinia hatte ihre Arbeit unterbrochen. »Tut mir leid. Ist es so besser?«
»Danke. Nur noch etwa eine Minute, und … So. Fertig. Puuh! Möchten Sie ein Glas Wasser?«
»Ein Schluck Tee würde helfen.«
Eine Tasse mit Untertasse erschien neben dem Ellbogen der Queen, gehalten von Sandy Robertson, ihrem Pagen. Ein willkommener munter machender Schluck Darjeeling, und sie streckte sich diskret und rieb sich ihr steifes Knie, während die Künstlerin ihre Skizzen durchsah.
Nicht weit entfernt standen zwei Videokameras auf Stativen und ein Mikrofon, um die Sitzung aufzunehmen. Ein kleines Dreierteam in Funktionsshirts und Baumwollhosen bewegte sich leise zwischen ihnen und den ihnen zugewiesenen Plätzen an der Wand gegenüber hin und her. Ein schlaksiger junger Mann in der rot-blauen Uniform des königlichen Haushalts stand dabei, um ihnen zu helfen und sie in Zaum zu halten. Sie drehten eine Dokumentation: Die Kunst der Queen oder etwas in der Art. Über den Titel war noch nicht entschieden worden. Es ging nicht nur um das, was ihr gehörte, sondern auch um das, was sie zur Kunst beitrug.
Heute filmten sie die Anfänge des letzten Kunstwerks, dem sie zugestimmt hatte: einer Bronzebüste. Es sollte auch noch jemanden geben, der die Dokumentation filmte, überlegte sie, um das Ganze abzurunden. Und jemanden, der über das Filmen der Dokumentation der ersten Skizzen schrieb … und immer so weiter. Sie war es gewohnt, dass man sie beobachtete, und mittlerweile auch, dass sie offenbar so faszinierend war, dass selbst ihre Beobachter beobachtet wurden.
»Wird sie lebensgroß, die Büste?«, fragte sie Lavinia.
Sie kannte die Antwort auf die Frage, wusste aber auch, dass die Kameras etwas Small Talk brauchten, und der sollte sich nicht um Lavinias gerade überstandene, fürchterliche Scheidung drehen oder darum, dass man ihren Sohn im Internat wegen Drogenhandels verhaftet hatte. Die arme Frau hatte Anspruch auf ihre Privatsphäre.
»Ja«, sagte Lavinia und betrachtete ein paar Skizzen auf dem Tisch neben ihrer Staffelei. »Wobei, etwas größer. Sie wollen, dass Sie herausragen in der Royal Society.«
»Hmmm. War die letzte auch größer?«
»Ich denke schon, Ma’am, so aus der Erinnerung. Mochten Sie sie?«
»Oh, ja. Ich fand sie ziemlich gut. Es ist Ihnen gelungen, mich nicht so …« Sie blies die Wangen auf und brachte Lavinia damit zum Lachen. »Nicht so wie meine Ururgroßmutter aussehen zu lassen. Schwer. Mit Hängebacken. Alt.«
Lavinia trat zurück an ihre Staffelei. »Mein Ziel ist, Sie leuchten zu lassen. Auch in Bronze. Also gut, sind Sie wieder so weit, Ma’am? Wenn Sie den Kopf so drehen könnten, dass Sie meine Hand hier ansehen. Noch etwas mehr. So ist es schön …«
Die Künstlerin bemühte sich bei ihrer Arbeit um ein leichtes Gespräch. Die Sitzungen waren ergiebiger, wenn sie sich mit ihren Modellen unterhielt, als wenn sie schwiegen. Die Miene der Queen – bei ihr war es ganz besonders so – hellte sich auf, wenn sie angeregt wurde. Im Ruhezustand konnte sie recht düster dreinblicken, was den falschen Eindruck erweckte.
»Haben Sie in letzter Zeit eine interessante Ausstellung besucht?«, fragte Lavinia und bedauerte es gleich. Sie hätte sie nach einem Pferderennen fragen sollen.
Aber die Queen schien das nicht zu stören.
»Wir werden im nächsten Jahr eine ausrichten, auf die ich mich schon sehr freue«, sagte sie. »Canaletto in Venedig. Wir haben doch einiges von ihm.« Womit sie die größte Sammlung weltweit meinte. »George III. hat die Bilder in einem Schwung von Joseph Smith gekauft. Er war damals Konsul in Venedig. Ein langweiliger Name für einen interessanten Mann, wie ich immer denke.«
Lavinia schluckte. »Mein Gott.«
Die Queen musste lächeln. Sie hatte kürzlich erst eine angeregte Unterhaltung mit dem Direktor ihrer Gemäldesammlung zu dem Thema geführt. Nach Jahrzehnten des Zusammenlebens mit ihnen kannte sie ihre Canalettos sehr gut, obwohl sie ihre selbst erlebten Bilder bevorzugte. Die Reise von Ancona nach Venedig an Bord der Britannia1960 – oder war es 1961 gewesen? –, der Besuch mit Philip auf der uralten kleinen Insel Torcello, die Gondelfahrt im Mondlicht …
Sie dachte zurück an jene frühen königlichen Reisen auf der königlichen Yacht. Italien, Kanada, die pazifischen Inseln … Die Britannia war nach dem Krieg ausgestattet worden, in einer Zeit der Entbehrungen, und ihr Inneres war eher praktisch als extravagant. Aber das hatte dem Temperament der Queen weit besser entsprochen als all das Gold und die Grandezza heute. Wie glücklich sie gewesen waren, sie und Philip und die Mannschaft. Bis in die fernsten Ecken des Globus waren sie gefahren. Es gab so wunderbare Erinnerungen. Das »schreckliche kleine Ding« beschwor einige von ihnen auf ganz einzigartige Weise herauf.
»Ich habe gerade eines meiner privaten Bilder in einer Ausstellung der Royal Navy gesehen«, sagte sie. Es machte ihr immer noch zu schaffen.
»Oh, das ist schön«, sagte Lavinia leicht geistesabwesend.
»Eigentlich nicht. Ich habe es ihnen nicht ausgeliehen. Das letzte Mal, als ich es gesehen hatte, hing es noch gegenüber von meiner Schlafzimmertür.«
Lavinias Kopf ruckte erschreckt hoch. »Du meine Güte.«
»Genau«, stimmte die Queen ihr zu.
»Wie ist es dann in die Ausstellung gelangt?«
»Das ist eine sehr interessante Frage.« Und eine Minute später fügte sie hinzu: »Ich denke, wir sind jetzt fertig.«
Ihr Ton war freundlich, aber bestimmt. Die Künstlerin hob den Blick und sah auf die Uhr. Die Stunde war um, auf die Minute, und ihr Modell nahm bereits die diamantenbesetzte Tiara herunter, der sie freundlicherweise zugestimmt hatte, so überzogen sie über ihrer Bluse und Strickjacke auch wirkte. Das Filmteam baute seine Kameras ab, genau beobachtet von dem schlaksigen jungen Mann ihres Haushalts. Der Stallmeister der Queen stand bereits in der Tür und wartete ungeduldig darauf, Ihre Majestät zu ihrer nächsten Verabredung zu begleiten.
»Ganz herzlichen Dank, Ma’am«, sagte Lavinia.
Die Queen nickte. »Ich freue mich schon auf das Leuchten.« Das kam trocken aus ihr heraus, aber mit einem leichten Zwinkern.
Kapitel 4
Gewohnt organisiert, wie sie war, nutzte Rozie eine abgesagte Besprechung, um, wie von Sir Simon vorgeschlagen, dem Royal Collection Trust einen Besuch abzustatten. Die Sonne schien, und ihr gefiel der Gedanke, sich ein wenig die Beine zu vertreten. Es wäre schön, das Problem mit dem kleinen Bild der Queen von der Liste streichen zu können.
Sie lief schnellen Schritts über den schmutzigen rosa Asphalt vor dem Seitentor bei ihrem Büro und wich einem schwarzen Taxi und ein paar Touristen auf Boris-Bikes aus. Die Luft war warm, der helle Himmel mit weißen Wolken bepinselt. Sie kam am Eck vom Green Park und am großen weißen Clarence House vorbei, in dem Prinz Charles wohnte, wenn er in London war. Dahinter lag ihr Ziel, der St James’s Palace, der eine durchaus andere Erscheinung bot.
Im Tudor-Stil, gedrungen, rote Ziegel, war er weit älter als der Rest. Sir Simon liebte die Historie und genoss es, ihr endlose Anekdoten über den St James’s zu erzählen. Am besten gefiel Rozie die Geschichte von Prinz James, dem jüngeren Sohn von Charles I., der dort von Oliver Cromwell eingesperrt worden war. Entkommen war er schließlich, indem er seine Bewacher zum Versteckspielen überredete. Dabei machte er es ihnen von Mal zu Mal ein wenig schwerer, ihn zu finden, bis er sich eines Tages mit einem gestohlenen Schlüssel durch ein Gartentor schlich und schon halb durch Westminster war, bevor ihnen klar wurde, dass er sich davongemacht hatte. Es gelang ihm, nach Frankreich zu entkommen.
Laut Sir Simon, der ein alter Romantiker war, war Charles I. von hier aufs Schafott nach Whitehall gebracht worden und trug dabei gleich drei Hemden übereinander, damit er nicht zitterte und den Eindruck erweckte, Angst zu haben.
Rozie bog in die Stable Yard Road und zum Bediensteteneingang des St James’s ab und dachte kurz darüber nach, dass alle Botschafter immer noch am »Hof von St James« akkreditiert wurden – warum, hätte sie nicht sagen können. Am Tor stand eine Wache mit scharlachroter Uniformjacke und Bärenfellmütze und reagierte nicht weiter, während sie einem Sicherheitsbeamten ihren Ausweis zeigte. Über endlose Korridore wurde sie zu einem Büro im ersten Stock geführt, wo sie Neil Hudson, der Direktor der königlichen Gemäldesammlung, mit einem verwirrten Lächeln begrüßte.
»Was um alles in der Welt führt Sie zu mir, Captain Oshodi? Sie wissen, dass ich durchaus für Besuche zur Verfügung stehe. Es ist unnötig, mich in meinem Bau aufzuspüren.«
Rozie sah sich um. Für einen »Bau« war das hier nicht schlecht. Durch ein Fensterpaar sah man auf die breite Straße hinaus, die zum Piccadilly führte, und bis zu Fortnum’s und dem Ritz war es kaum ein Steinwurf. Eine holzvertäfelte Wand war vom Boden bis zur Decke mit kleinen, aber unbezahlbaren Kunstwerken bedeckt, die anderen Wände standen voller Bücher. Auf dem Schreibtisch aus Walnussholz, der so groß war, dass man denken konnte, da wären zwei auch so schon abnorm große Schreibtische zu einem zusammengeschoben worden, herrschte ein fürchterliches Durcheinander von Papieren, Paperweights, Bronzestatuetten und Fotos in Silberrahmen. Von einem Computer keine Spur. Rozie nahm an, Neil Hudson versteckte ihn in einer Schublade, wenn er Besucher empfing. Er schrieb doch sicher nicht mehr mit der Feder? Seine gelbe Weste und das kinnlange wellige Haar erweckten den Eindruck eines Mannes, dem es gefallen würde, nähme man das an.
»Ich bin einem Gemälde auf der Spur«, erklärte sie ihm. »Einem privaten von Ihrer Majestät. Wir wissen, wo es sich befindet, aber nicht, wie es dort hingekommen ist. Es ist schon vor einer ganzen Weile verschwunden.«
»Halt!« Hudson hob eine Hand. »Da gleich schon mal halt! Ich kann Ihnen versichern, dass aus der königlichen Sammlung nichts verschwindet.«
»Ich denke schon«, sagte Rozie mit fester Stimme und sah ihn an. »Manchmal.«
»Weniger als manchmal. Kaum jemals. Mir missfällt schon die Annahme, dass es geschehen sein könnte.«
»Nun, das ist sehr gut. Dann werden Sie sicher wissen, was es mit dem Fall auf sich hat.«
Sie erklärte, was sie wusste, und der Direktor nickte unverbindlich.
»In den Neunzigern? Das sollte kein Problem darstellen. Das ist alles gut dokumentiert. Aber falls es, sagen wir … verlegt wurde, viel früher schon, wären wir trotzdem von Fall zu Fall involviert gewesen, besonders, was die privaten Gemälde Ihrer Majestät angeht. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass sie es ausgeliehen hat. Wir verleihen zwar ständig Kunstwerke der Krone, so sie in transportfähigem Zustand sind, aber etwas Kleines, Privates wie das …« Er zog die Nase kraus. »Mal ganz abgesehen davon, wem hätte es auffallen, wer danach fragen sollen? Aber wie auch immer, sehen Sie nach.«
Er rief eine Assistentin, die Rozie einige düstere Korridore hinunterführte, eine halbe Treppe hinauf und weiter, vorbei an einigen gut beleuchteten Werkstätten, durch deren offene Türen sie verschiedene Restauratoren bei der Arbeit sah. Endlich erreichten sie ein stickiges Hinterzimmer, etliche Flügel und Gebäudeteile entfernt. Das Fenster ließ sich nicht öffnen, und das Licht wollte nicht aufhören zu flackern. Schränke mit Glastüren bedeckten drei der Wände, darin Schachteln mit Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1952 zurückreichten. Auf einem Tisch unter dem schmuddeligen Fenster stand ein Computer mit Zugang zu einer Datenbank aller bislang digital registrierten Objekte.
»Ich lasse Sie dann allein«, sagte die Assistentin, nachdem sie ihr erklärt hatte, was wo zu finden war. »Sie brauchen keine Handschuhe oder dergleichen. Mit dem zwanzigsten Jahrhundert sind wir nicht so vorsichtig. Legen Sie nur alles genau dorthin zurück, wo Sie es gefunden haben, und machen Sie hinterher das Licht aus. Viel Glück.«
Rozie dankte ihr, aber das Glück wollte sich nicht so recht einstellen. Nach einer Stunde mühevoller Suche in Schachteln und Ordnern hatte sie gerade mal eine Zeile in einem vergilbten Register gefunden: Ölgemälde: HMY beim 125. Jubiläum der Hobart-Regatta, 1963, vergoldeter Rahmen, 43 x 69, von Vernon Hooker, erhalten 1964. Es gab keine Angabe dazu, ob das Bild je den Palast verlassen hatte, obwohl sie alle verfügbaren Schachteln, Ordner und Register und auch die Datenbank bis zum Jahr 2000 durchsuchte.
Bevor sie ging, nahm sie sich die Schachtel mit der Aufnahmenotiz noch einmal vor und sah ein letztes Mal durch das Register von 1964. Hatte sie etwas übersehen? Sie strich die Seite glatt, um mit ihrem Handy ein Foto zu machen, dabei fiel ihr ein mit Bleistift auf den Rand gekritzeltes Wort auf. Sie hatte es erst der darunter aufgeführten Skulptur zugeordnet, aber vielleicht bezog es sich ja auf das Bild? Etwas stand dort schräg hingeschrieben und war nicht leicht zu entziffern. Sie sah genauer hin.
Hatte da jemand eine Wertung zu dem Bild abgegeben? Schrieben Beamte ihre Meinung zu Anschaffungen in dieser Weise an den Rand? Es war kaum zu erkennen. Hatte es jemand wieder ausradieren wollen?
Rozie hielt die Seite etwas besser ins Licht. Da war eine kleine Lücke zwischen den ersten paar Buchstaben und den letzten beiden. Moment – das waren gar keine Buchstaben, das waren Zahlen. 8 und noch etwas. Konnte es eine »82« sein? Oder »86«? Und im ersten Teil gab es ein »R« und ein »n« – »Ren«-soundso, ja? Aber nein, sie konnte es nicht entziffern.
Sie versicherte sich, dass ihr Foto gut ausgeleuchtet war, damit sie es bei sich im Büro in Ruhe untersuchen konnte.
Beim Mittagessen wurde sie jedoch von etwas anderem abgelenkt.
Rozie hatte sich ihr Tablett in der Mitarbeiterkantine gefüllt. »Kantine«, das war ein typisches Understatement des königlichen Haushalts. Es handelte sich um zwei mit alten Meistern aus der königlichen Sammlung geschmückte, holzvertäfelte Speiseräume, bewacht von einer Statue Burmeses, das eines der Lieblingspferde der Queen gewesen war, ein Geschenk der berittenen königlich-kanadischen Polizei.
Laut Sir Simon waren die Mitarbeiter hier bis vor gar nicht allzu langer Zeit gemäß ihrer Ranghöhe voneinander getrennt worden, mittlerweile saßen jedoch alle zusammen, und so gefiel es Rozie. Man wusste nie, auf wen man traf. Die Atmosphäre war im Allgemeinen entspannt und das Essen so gut, wie man es von einer Küche erwarten konnte, die regelmäßig für Staatsoberhäupter kochte.
Heute war es anders. An den wie immer makellos weiß und mit Silberbesteck gedeckten Tischen im äußeren Raum saßen die Leute zu zweit oder dritt zusammen und unterhielten sich unruhig. Das Essen auf Rozies Tablett hatte wie immer Restaurantqualität und sah äußerst appetitlich aus, aber die Stimmung war angespannt. Lag es am kürzlich abgehaltenen Brexit-Referendum? Sie hatte ältere Hofbeamte darüber spekulieren hören, dass der Ausgang die Gewässer privater Meinungen aufgewühlt und bis dahin unausgesprochene Rivalitäten an die Oberfläche gebracht habe. Warst du Nationalistin oder Europäerin? Warst du für das Commonwealth, für Deutschland oder Frankreich? Rozie dachte, dass man gut für alles sein konnte, und bis noch vor ein paar Monaten schienen es auch alle gewesen zu sein. Jetzt musste man sich für eine Seite entscheiden. Was immer es sein mochte, Rozie hatte das Gefühl, dass sich die Stimmung in den paar Monaten, die sie hier arbeitete, verschoben hatte.
Zwei Frauen in der hinteren Ecke zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich, eine jüngere und eine ältere. Die beiden steckten die Köpfe zusammen. Rozie erkannte die jüngere der beiden, der das flammend rote Haar präraffaelitisch halb über den Rücken hing. Das war Mary van Renen, eine der Assistentinnen von Sir James Ellington. Rozie nickte ihr zu und ging hinüber zu den beiden, um sich zu ihnen zu setzen. Aber als sie sich dem Tisch näherte, sah sie, dass Mary rot geränderte Augen hatte und trübe dreinblickte.
»Oh, entschuldige. Soll ich mich woanders hinsetzen?«, fragte Rozie.
»Nein, komm zu uns.« Mary deutete auf den Platz ihr gegenüber. »Bitte.«
Das Lächeln war wieder da, aber es war wässrig und forciert. Sie hatte ihr Hähnchen kaum angerührt, während ihre etwas steif und streng wirkende Begleitung mit ihrem Essen fast fertig war.
»Sie können mir helfen«, sagte die ältere Frau, als Rozie sich setzte. Marys Kummer schien sie nicht sehr zu berühren. »Ich habe dieser jungen Dame gerade zu erklären versucht, dass sie sich wie ein dummes kleines Mädchen verhält.«
Rozie warf ihrer Freundin einen fragenden Blick zu. »Das ist Cynthia Harris«, sagte Mary tonlos. »Cynthia, das ist Captain Oshodi, die stellvertretende Privatsekretärin der Queen.«
»Einfach nur Rozie«, sagte Rozie und streckte die Hand aus.
»Dachte ich’s mir doch«, sagte Cynthia Harris, ließ ein paar blasse, schiefe Zähne sehen und belud ihre Gabel mit Möhrchen und Kartoffeln. Rozie zog ihre Hand zurück. »Ich habe Sie hier schon gesehen«, fuhr Cynthia fort. »Wie aufregend, Mary, da haben wir eine von den großen Nummern am Tisch sitzen.«
»Keine so große Nummer«, sagte Rozie.
»Oh, doch. Sie gehören zum Privatbüro. Das ist die obere Etage, wir fühlen uns geehrt, oder, Mary?«
Rozie konnte nicht sagen, ob sie es ernst meinte. Mary, die sie einigermaßen gut kannte, da sie immer wieder mit verschiedenen Dingen von Sir James ankam, sah wie ein Häufchen Elend auf ihren Teller. Da erinnerte sich Rozie daran, was Sir Simon über eine der Sekretärinnen gesagt hatte.
»Sag nicht, dass du uns verlässt. Bist du das, die gekündigt hat?«
Mary nickte, ohne den Blick zu heben. Tränen fielen auf ihr unberührtes Kartoffelpüree.
»Sie sagt, dass sie’s tun wird«, sagte Cynthia vom Platz neben ihr. »Gedankenloses Kind. So eine Überreaktion.«
Rozie, die instinktiv alle Leute mochte, solange sie nicht eines Besseren belehrt wurde, sah die ältere Frau forschend an. Cynthia Harris war dürr, hatte glattes, fast weißes, zu einem strengen Bob geschnittenes Haar und Knopfaugen, die Rozie an einen neugierigen Vogel denken ließen. Ihre Uniform war die einer Haushälterin, makellos weiß, darüber trug sie eine dunkelblaue Strickjacke. Sie wirkte fit und drahtig, aber überdurchschnittlich alt für den Job. Sie konnte nicht unter fünfundsechzig sein, dachte Rozie, wobei sie sich fragte, ob das Gesicht sie vielleicht älter machte, als sie tatsächlich war. Die Wangen waren eingefallen. Tiefe Falten zogen sich um die schmalen Lippen und zwischen den Augen her. Auf der Höckernase blühten einige geplatzte Äderchen. Rozie versuchte ihren Ausdruck zu ergründen, während sich die Haushälterin die verbliebenen Möhrchen in den Mund gabelte. War das Ruhe, Genugtuung, Missfallen? Plötzlich richteten sich die Knopfaugen direkt auf sie. Rozie wurde bewusst, dass sie die Frau angestarrt hatte, und so richtete sie den Blick auf Mary.
»Kündigst du wirklich?«, fragte sie.
Die jüngere Frau nickte. »Ich muss. Ich halte das nicht länger aus.«
»Gott, wie theatralisch!«, sagte Cynthia Harris mit einem kleinen Lacher.
»Ich fühle mich nicht mehr sicher.«
»Du solltest dich geschmeichelt fühlen, nichts anderes.«
»Nicht sicher? Warum?«, fragte Rozie.
»Ich bekomme Briefe, Nachrichten von jemandem, dessen Name ich nicht kenne. Er sagt, wir hätten uns über Tinder getroffen, und ich hätte ihn abserviert.«
»Und hast du? Ihn getroffen, meine ich.«
»Ich glaube nicht. Ich bin sie alle immer wieder durchgegangen. Da waren schon ein paar Komische dabei, aber ich glaube nicht, dass einer von ihnen …« Mary brach ab.
Rozie versuchte den Gedanken zu verarbeiten, dass ihre Freundin auf Tinder war. Mary van Renen, schüchtern, methodisch, altmodisch, sie war ihr immer wie eine Frau vorgekommen, die gerne für sich war oder mit einem netten Jungen zusammenlebte, den sie schon seit Jahren kannte. Wenigstens suchte sie nach Liebe. Rozie selbst fand dafür kaum mal Zeit.
»Was schreibt er?«, fragte sie.
»Ist egal«, sagte Mary und wirkte so aufgewühlt, dass Rozie nicht weiter nachfragen wollte.
»Und du weißt nicht mal sicher, ob er das draußen vor deiner Wohnung war, oder?«, sagte die Haushälterin. »Es kann auch jemand gewesen sein, der einfach stehen geblieben ist, um zu telefonieren.«
»Er hatte kein Telefon in der Hand.«
»Heutzutage haben die Leute einen Kopfhörer«, entgegnete Cynthia Harris. »Einen Knopf im Ohr, oder wie immer sie es nennen. Vielleicht hat er auf jemanden gewartet.«
»Er war mindestens dreimal da.« Mary schloss die Augen.
»Sagst du.« Die Haushälterin verdrehte die Augen, sah Rozie an und zuckte mit den Schultern. »Und selbst wenn er es war, die Polizei sagt, das beweist rein gar nichts.«
»Du warst bei der Polizei?«
Mary nickte. »Aber sie meinten, sie brauchen mehr Beweise, bevor sie etwas tun können. Sie schienen zu denken, dass ich es mir nur einbilde. Und dann war da die Sache mit meinem Rad.«
Rozie sah, dass Mary zitterte, während sie die Hände im Schoß rang. Sie war völlig verstört, traumatisiert, und Rozie konnte nicht verstehen, warum Cynthia Harris ihre Gefühle derart abtat, ohne jedes Mitgefühl.
»Was ist mit deinem Fahrrad?«
Mary holte tief Luft, bevor sie Worte herausbrachte. Sie hielt die Augen geschlossen und sprach leise und gehetzt.
»Er hat einen Zettel auf den Sattel geklebt. Da stand, ihm gefiele, dass da meine …«, sie sah aus, als müsste sie würgen, fuhr dann aber fort, »… ich kann das nicht sagen. Dass da ein Teil von mir auf den Sattel drückte. Wo ich saß. Und dass er mich gerne dabei beobachtet.« Sie öffnete die Augen. »Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Ich kann das nicht mehr. Mummy sagt, ich soll nach Hause kommen, und das tue ich, sobald ich kann.«
»Oh, Mary, das tut mir leid. Hast du das mit dem Rad auch der Polizei gesagt?«
Mary schüttelte den Kopf. »Das konnte ich nicht.« Neue Tränen liefen ihr über die Wangen. »Jedes Mal, wenn ich es sage, sehe ich es wieder vor mir. Ich kann das einfach nicht …«
Rozie griff über den Tisch, und Mary überließ ihr zögernd ihre Hand. Rozie drückte sie voller Mitgefühl.
Cynthia Harris schnaufte missfallend. Sie sah Mary entrüstet an.
»Leid wird es dir tun. Wegen einem Zettel auf dem Fahrrad! Nun komm schon! Du läufst nach Hause zu Mummy und lässt Sir James im Stich. Ihr Mädchen seid alle gleich. Eine Verabredung geht daneben, und sieh dich an, ein schniefendes Wrack. Was, glaubst du, hat die Queen alles in ihrem Leben durchmachen müssen? Nennst du das loyal?«
»Ich … Ich kann das einfach nicht mehr … Entschuldigt mich.«
Mary nahm ihre Handtasche, die über der Rücklehne ihres Stuhls hing, stand auf und lief unsicher in Richtung Tür.
»Tja.«
Rozie sah die ältere Frau an, die komisch lächelte und entschuldigend mit den Schultern zuckte. »Wie ich schon sagte, kein Rückgrat. Die sehen gut aus.«
Sie nahm eine Weintraube aus der Schüssel neben ihrem Teller und steckte sie sich in den Mund.
Kapitel 5
Es war Mitte Juli, Hochsommer. Das Parlament stand kurz vor der Sommerpause, und die gewohnten Staatsgeschäfte gingen zurück, was der Queen gelegentlich eine wertvolle freie Stunde bescherte. Nach dem Essen stand die Anprobe für ein paar Abendkleider auf dem Plan, aber bis dahin war noch Zeit. Rennen gab es noch keine. Was also mit der geschenkten Freiheit anfangen?
Im Ostflügel, von dem man auf den Geburtstagskuchen und die Mall hinaussah, hatte es vor Kurzem auf einem der Dachböden einen Wasserschaden gegeben. Ein Wassertank, älter als ein halbes Jahrhundert, war gerissen und hatte ein paar Zimmer im Flur darunter geflutet. Sie hatte sich die Sache am selben Tag noch angesehen: patschnasse Teppiche, triefende Möbel. Der Tank war entfernt worden, um ihn durch etwas Moderneres zu ersetzen. Laut dem Master des Haushalts wurden die Zimmer trockengelegt und neu verputzt und würden anschließend wieder benutzbar sein.
Nun, man vergewisserte sich bisweilen lieber selbst. Die Queen überlegte, ob sie zwei von ihren Hunden mitnehmen sollte, aber die hatten mittags einen langen Spaziergang gemacht und schienen lieber auszuruhen. Sie sagte ihrem Pagen, wohin sie wollte, und machte sich auf den Weg, froh darüber, eine Weile mit ihren Gedanken für sich zu sein.
Sie stellte sich die Highlands vor. Die nächsten zwei Wochen würden vom Umzug nach Balmoral bestimmt sein, wo sie den Rest des Sommers verbringen würden, und im Palast herrschte bereits Aufbruchsstimmung. Philip hasste das Theater und fuhr für ein paar Tage nach Cowes, um die Regatten zu verfolgen. Sie selbst konnte den Umzug nach Norden kaum erwarten. Dort oben gab es gute, saubere schottische Luft zu atmen, man konnte ein wenig mehr »Lilibet« und weniger »Ma’am« sein, und die Urenkel und die Hunde hatten Platz zum Herumtollen, ohne Angst haben zu müssen, etwas zu zerbrechen. Sie freute sich darauf, George herumflitzen zu sehen und Baby Charlotte etwas besser kennenzulernen.
Im zweiten Stock, im Korridor, der zu den beschädigten Räumen führte, spürte sie plötzlich ein Prickeln im Nacken und hätte schwören können, mit einem Mal einen gespenstischen Hauch von Zedernholz zu riechen. Das war äußerst seltsam. Sie hatte mit Nässe gerechnet. Stattdessen wurde sie unversehens achtzig Jahre in der Zeit zurückversetzt. War es der Gedanke an George und Charlotte? Woher kam dieses plötzliche Gefühl, selbst wieder ein kleines Mädchen zu sein, ein wenig unartig, und dass Margaret bei ihr war und sie zu noch größerem Unfug anstachelte? Sie ging weiter, sah in die Zimmer rechts und links und spürte diesem unglaublichen Geruch nach. Schließlich richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf einen großen, halb hinter einer Säule im Korridor versteckten Mahagonischrank. Eine der Türen stand leicht offen, und als sie näher kam, sah sie einen mattgoldenen Bommel am Schlüssel hängen. Oh, ja!
Erinnerungen trieben durch den Nebel der Zeit heran und wurden mit jedem Schritt klarer. Dieser Schrank hatte draußen vor ihrem Kinderzimmer gestanden und war von Mummys oberster Garderobiere als zusätzlicher Stauraum für Kleider benutzt worden. Der Schrank war groß und massiv und hatte mit der Zeit eine prächtige rote Patina angenommen. Sie legte eine Hand auf das Holz und begrüßte ihn wie einen alten Freund.
Durch die halb offene Tür war nur Leere zu sehen, links und rechts mit Leisten, auf denen einmal breite Bretter gelegen haben mussten, für Wäsche, nahm sie an, vor schon längerer Zeit. Mittlerweile war der Schrank jedoch völlig ausgeräumt, bereit, an einen anderen Ort transportiert zu werden, und gerade so erinnerte sie sich wieder an ihn.
Als Onkel David in den letzten Tagen des Jahres 1936 als Edward VIII. abgedankt hatte, wollte die Familie nicht aus ihrem bequemen Heim am Piccadilly in den großen, kalten, schäbigen Palast umziehen, doch da arbeitete Papa jetzt, und Mummy sagte, sie sollten »über dem Laden« wohnen. Im Prinzip war es eine Abfolge endloser Korridore voller hochgewachsener Hausdiener in roten Jacken, und sie hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden und eine richtige Prinzessin sein zu müssen, ohne wirklich zu wissen, wie. Aber es gab auch Entschädigungen. Es war ein wunderbarer Ort zum Versteckenspielen.
Mummys lange Pelze hatten rechts im Schrank gehangen, in Stoffhüllen, ihre Kaschmirtücher lagen sorgfältig aufgerollt in einem Hängegestell auf der linken Seite. In der Mitte waren die Nerzjacken und Opernkleider, und wenn man in den Schrank hineinstieg, verschwand man zwischen ihnen. Sie erinnerte sich, wie Margaret Rose »Lilibet! Schnell!« gezischt hatte, sich hinter die Stoffhüllen schob und sie nicht hatte widerstehen können. Ihre Sandalen waren sauber (sie hatte rasch nachgesehen), und ihre kleinen, schmalen Körper passten beide gut mit hinein in den Schrank, ohne etwas schmutzig oder gar kaputt zu machen. Es war so schön, von Mummys Abendkleidern umhüllt zu sein und ihren Duft einzuatmen, der durch den starken Geruch des Zedernholzes hindurch zu spüren war, das gegen Motten zwischen den Sachen hing.
Sie musste damals etwa elf gewesen sein, Margaret sechs oder sieben. Sie versteckten sich vor Crawfie, ihrer Gouvernante, die nicht wusste, dass sie ein Spiel mit ihr spielten. Es war so gemein, und deshalb schlugen ihre Herzen auch so. Die arme Crawfie. Sie rief und rief, und Margaret bebte vor Lachen.
Sie hatten sich mehrmals im Schrank versteckt, waren aber nur einmal erwischt und bestraft worden. Die Queen konnte sich nicht erinnern, was die Strafe gewesen war – wahrscheinlich gab es nichts Süßes zum Tee –, aber Margaret hatte erklärt, dass es das wert sei, und sie hatte recht. Jetzt, wo der Schrank leer war, passte sie wahrscheinlich auch wieder hinein, selbst in ihrem Alter. Selbst mit ihrem Knie.
Die Queen grinste bei dem Gedanken und trat, zu ihrem eigenen Erstaunen, mit einem Bein hinein, nur einfach so. Mit einer Hand hielt sie sich an der geschlossenen rechten Tür fest, der Schrankboden war höchstens fünfzehn, zwanzig Zentimeter hoch. Ihr rechtes Knie beschwerte sich leicht, aber als sie das linke Bein nachzog, konnte sie Margaret spüren, und auch Mummy, wenn der samtige Duft von L’Heure Bleue auch nicht mehr da war, genauso wenig wie der Zederngeruch. Sie musste ihn sich eingebildet haben.
Es war warm und dunkel im Schrankinneren, ruhig und friedvoll. In den 1950