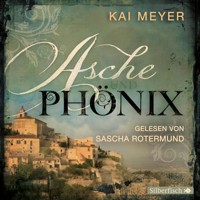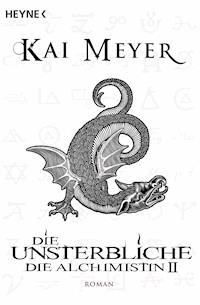
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Alchimistin
- Sprache: Deutsch
Director's Cut - vom Autor vollständig überarbeitete Neuausgabe
Aura Institoris hat das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, aber ihre große Liebe zum Hermaphroditen Gillian ist daran zerbrochen. Ein okkultes Symbol, der blutige Abdruck einer sechsfingrigen Hand, führt sie auf eine gefährliche Odyssee quer durch Europa. Abermals wird Gillian ihre Wege kreuzen, denn ihre Feinde haben einen neuen Verbündeten: Gian, Auras und Gillians Sohn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Erschaffung von Materie aus Energie und von Energie aus Materie ist Alchimie.
Gott ist ein Alchimist.
Walter Lang, Fulcanelli: Master Alchemist
KAPITEL 1
August 1914
Sie erwachte in ihrem Hotelbett und erkannte, was ihr im Leben fehlte. Einen Augenblick lang sah sie es deutlich vor sich, alles, wonach sie jemals gestrebt hatte, jeden Verlust, der sie quälte, ganz greifbar, ganz nah. Die Erkenntnis war so verwirrend wie erdrückend.
Dann aber schlug sie die Augen auf, blinzelte ins Tageslicht, und alles war wieder vergessen, und sie fühlte sich so leer und verfolgt wie am Abend zuvor. An allen Abenden, in all den Jahren.
Aura blickte zum Fenster und sah die Sonne über den Dächern von Paris. Gleißende Helligkeit zerschmolz die Rauchfahnen der Schornsteine zu mageren Fäden. Das Licht brannte in ihren Augen, und sie schloss die Lider, lag ganz ruhig da und versuchte, sich zu erinnern. Sie hatte es fühlen können, in greifbarer Nähe. Sie hätte nur die Hand danach ausstrecken müssen, nach den Antworten auf all ihre Fragen, nach den Gründen ihrer Ruhelosigkeit, nach allem, was sie wieder und wieder von zu Hause forttrieb, in fremde Länder, fremde Städte, von einem Hotel ins andere.
Nun aber war es fort. Die Gewissheit brachte ein ungeheures Gefühl von Verlust mit sich, von Trauer und von Wut. Sie kannte diese Empfindungen, kannte sie von durchwachten Nächten, vom dumpfen an-die-Decke-Starren um drei Uhr nachts, kannte die Hitzewellen, die sie dann überkamen, kannte die Verzweiflung.
Sie lag auf dem Rücken, bedeckt mit einem dünnen Laken. Die Augusthitze machte längst keinen Halt mehr vor den Mauern der Häuser. Die Hotelzimmer, sogar die fensterlosen Flure des Les Trois Grâces verwandelten sich tagsüber in Backöfen. Auch in der Nacht ging die Temperatur kaum zurück.
Die hohen Fenster von Auras Suite – drei Zimmer, von denen sie zwei nicht benutzte – wiesen hinaus auf die Uferstraße und zur Seine, spiegelglatt, nur mit einer Handvoll Boote gesprenkelt. Schwach drang das Brummen vereinzelter Automobile, das Rattern der Droschken, das Klappern von Pferdehufen herauf, zweifach gedämpft von den Doppelfenstern. Aura dachte, dass die stumpfe, unpersönliche Stille von Hotelzimmern etwas an sich hatte, das anderen Geräuschen das Blut aussaugte, sie schal und vage werden ließ; sie legte sich über alle Laute, sperrte die Außenwelt aus und ersetzte sie durch ein Missverständnis, das Architekten Ambiente nennen.
Träge ließ sie ihren Blick über die hellblauen Tapeten und Schmuckbordüren, die Kommoden mit geschwungenen Kanten, die Stühle mit den blassen Bezügen wandern. Seit ihrer Ankunft in Paris vor über zwei Wochen sah sie dasselbe Bild jeden Morgen, jeden Abend. Die Einrichtung, sündhaft teuer wie alles im Trois Grâces, war nicht ihr Geschmack; andererseits hatte sie nie Energie darauf verwandt, einen Geschmack in Sachen Möbel zu entwickeln. Aus demselben Grund bevorzugte sie schwarze Stoffe für all ihre Kleider in den offenen Reisekisten. Schlicht und elegant. Passend zu jeder Gelegenheit.
Außer, zugegeben, im heißesten August seit Jahren, in einer der überfülltesten Städte Europas. Seit einigen Tagen verfluchte sie das Schwarz ihrer Kleider, und brachte doch nicht genug Interesse auf, sich etwas Helleres zu kaufen. Sie hatte so viel anderes zu tun, auch wenn sie an den Abenden kaum zu sagen vermochte, was sie eigentlich den Tag über getan hatte.
Stöbern in staubigen Buchläden und Bibliotheken. Begegnungen mit alten Professoren und verschrobenen Forschern. Endlose Wanderungen durch Museen und Galerien. Und ihre anderen Unternehmungen, nach Einbruch der Dämmerung oder tief in der Nacht: einsteigen durch blinde Fenster und vernagelte Türen, über Kellerstiegen, verborgen unter dem Grün verwilderter Gärten. Streifzüge durch die Flügel verlassener Häuser und Palais, menschenleere Flure, in denen der Hall ihrer Schritte sich vervielfachte und ihr hinaus auf die Straße folgte. Alte Dachböden, deren Dielen sich unter zentnerschweren Kisten bogen. Kellergewölbe, bis zur Decke gefüllt mit verschimmelten Büchern. Vergessene Salons im Nebellicht des Mondes.
Immer auf der Suche.
Aura zog die Hände unter dem Laken hervor und rieb sich mit den Fingerknöcheln die Augen. Das Sonnenlicht erschien ihr jetzt weniger gleißend, die Umrisse des Zimmers gewannen an Schärfe – das Innenleben eines Aquariums, dessen trübes Wasser man durch frisches ersetzt hatte.
Zuletzt richtete sie ihren Blick auf die verspiegelte Decke. Irgendwem musste es frivol erschienen sein, sich im Bett beobachten zu können – Paris, die Stadt der Liebenden –, doch wer immer den Einfall gehabt hatte, hatte nicht an das Erwachen am nächsten Morgen gedacht. Wer will schon als Erstes sich selbst sehen, mit verquollenen Augen und zerzaustem Haar. Als käme man nicht früh genug ins Bad.
Doch es war nicht die Flut ihres pechschwarzen Haars, nicht die Ringe um ihre blassblauen Augen, nicht ihre helle Haut inmitten schillernder Seide, die sie abrupt aus ihren Gedanken riss. Ein Eimer Eiswasser hätte sie nicht gründlicher aufwecken können.
Ein scharlachroter Fleck hob sich wie eine Wunde vom Weiß des Lakens ab.
Aura glitt unter der Decke hervor und sprang aus dem Bett. Entsetzt, fasziniert, neugierig starrte sie auf den dunklen Umriss.
In ihrem Leben hatte sie genug Blut gesehen, um zu erkennen, wann sie welches vor sich hatte. Sie hatte nackt geschlafen, und ein kurzer Blick auf ihre Schenkel bestätigte, dass dies nicht ihr eigenes war.
Es war der Abdruck einer Hand, genau dort, wo ihr Unterleib gelegen hatte.
Eine Hand aus Blut.
Eine Hand mit sechs Fingern.
Eine Kiste voller Bücher. Damit hatte es begonnen.
Damals, vor über einem Jahr, hatte Aura zum ersten Mal vom Verbum Dimissum gehört. Und nun war sie hier, dreizehn Monate später, und sie kannte noch immer nicht mehr als diese beiden Wörter, die selbst nichts anderes als ein Wort bezeichneten.
Verbum Dimissum. Das Verlorene Wort.
Die Bücher, in denen sie darauf gestoßen war, hatten ihrem Vater gehört. Nestor Nepomuk Institoris war seit siebzehn Jahren tot. Die Frachtpapiere der Bücherkiste verrieten, dass sie vor neunzehn Jahren, im Sommer 1895, in Boston aufgegeben worden war, von einem Buchhändler, der seither wie vom Erdboden verschluckt war. Niemand in Boston kannte ihn, die Adresse auf den Frachtpapieren existierte nicht mehr. Das nüchterne Begleitschreiben der Reederei erklärte ihr, die Kiste sei aus Gründen, die sich nicht mehr nachvollziehen ließen, nach Buschir am Persischen Golf fehlgeleitet worden, von dort aus nach Tamatave auf Madagaskar, um schließlich auf Zypern zwischengelagert zu werden. Dort hatte sie siebzehn Jahre in einem Schuppen am Hafen gestanden, begraben unter anderen Fundstücken, um schließlich bei Abrissarbeiten entdeckt und weitergeschickt zu werden, erst zurück nach Boston und von dort aus erneut an die ursprüngliche Empfängeradresse, die man in alten Frachtpapieren im Archiv entdeckt hatte. Man bedaure dieses Versehen außerordentlich, sehe sich jedoch außerstande, eine Entschädigung für eventuelle Verluste anzubieten. Man verbleibe dennoch mit den allerfreundlichsten Grüßen. Hochachtungsvoll.
Als die Diener die Kiste schließlich durch das Portal von Schloss Institoris geschleppt und auf dem Teppich vor dem Kamin abgestellt hatten, war dies der Endpunkt einer Odyssee gewesen, um die manch ein Abenteurer die schlichte Eichenholzkiste beneidet hätte.
Mehrere Monate lang hatte Aura den Inhalt studiert, über einiges die Stirn gerunzelt, anderes bestaunt, das meiste jedoch als belanglos verworfen. Auf einigen der vielen Tausend Seiten, manche noch aus der Frühzeit des Buchdrucks, war sie auf den Begriff des Verbum Dimissum gestoßen. Schließlich hatte er sie so fasziniert, dass sie einige der Bände, die sie ursprünglich beiseitegelegt hatte, abermals hervorgezogen und im einen oder anderen weitere Details entdeckt hatte. Nein, keine Details. Fragen. Denn daraus bestanden all die Erwähnungen, Querverweise und Fußnoten: aus Fragen über Fragen.
Das Verbum. Das erste Wort der Schöpfung.
Im Anfang war das Wort, schrieb der Evangelist Johannes. Und das Wort ward Fleisch.
Und zwischen all den Rätseln, die sich um diese und andere Erwähnungen gruppierten, zwischen all den religiösen Traktaten, den pseudohistorischen Untersuchungen und, ja, den alchimistischen Deutungsversuchen, zwischen all diesen Worthülsen, Ideenspielen und Gedankenklaubereien versteckten sich die zentralen, die wichtigsten Fragen: Wo, wenn es denn je existiert hatte, befand sich das Verbum Dimissum heute? Wo und wann war es verlorengegangen? Und wer hatte es zuletzt gehört, gelesen oder ausgesprochen?
Falls es der Abdruck einer Hand war, und daran hatte sie kaum einen Zweifel, dann musste es die eines Mannes sein. Die Finger waren fast anderthalbmal so lang wie ihre eigenen, und der überzählige war ein zweiter Mittelfinger, exakt so groß wie sein Gegenstück.
Aura zog den Gürtel ihres Morgenmantels fester um ihre Taille, zum zweiten oder dritten Mal.
Jemand war in der Nacht im Zimmer gewesen und hatte sie durch das Laken berührt. Es fiel ihr noch immer schwer, sich das einzugestehen.
Die Tür war verschlossen, die Fenster verriegelt. In einem ersten, eisigen Moment hatte sie die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sich der Eindringling noch immer in der Suite aufhielt. Sie hatte die Räume und das Bad durchsucht, weit gründlicher, als nötig gewesen wäre. Doch da war niemand. Kein Mann. Keine Spuren.
Jemand wollte ihr zeigen, wie nahe er ihr kommen konnte. Er wollte ihr beweisen, wie verletzlich sie war. Wie ungeschützt. Und wie allein. Als hätte es dafür irgendwelcher Zeichen bedurft.
Sie hatte lange nicht mehr an Gillian gedacht – du lügst, du denkst ständig an ihn –, und sie hatte sich vorgemacht, niemand könnte unabhängiger sein als sie selbst. Aber sie war nicht unabhängig. Gewiss, sie besaß mehr Geld, als sie ausgeben konnte, und sie bewegte sich vollkommen frei von Stadt zu Stadt und über alle Grenzen hinweg. Andererseits wusste sie, was um sie herum geschah. Ihr Sohn hasste sie, ihre Schwester beneidete sie, und ihre Mutter – nun, Charlotte hatte in ihren wachen Momenten kaum mehr als Verachtung für ihre älteste Tochter übrig. Die Einzige, die zu Aura hielt, war ihre Nichte Tess, und sie war gerade einmal fünfzehn, ein Jahr jünger als Auras Sohn Gian.
Zehn Jahre waren seit ihrer Rückkehr aus Swanetien vergangen. Zehn Jahre, seit sie und Gillian sich geschworen hatten, für immer zusammenzubleiben.
Und dann, zwei Jahre später, war es aus gewesen.
Das Schlimmste war, dass Aura selbst die Schuld daran trug.
Sie betrachtete erneut den Handabdruck, zum hundertsten Mal innerhalb weniger Minuten. Das Blut war längst getrocknet. Das weiße Leinen hatte es aufgesogen. An den Rändern verschwamm der Umriss zu winzigen Verästelungen, ein haarfeines Netzwerk wie dunkelrote Eiskristalle.
Es hatte keinen Zweck, die Hotelleitung zu informieren. Der Direktor würde darauf bestehen, die Polizei zu rufen, und das war das Letzte, was sie wollte. Nicht in Zeiten wie diesen, die es nötig machten, dass sie unter einem französischen Decknamen reiste, damit niemand ihre wahre Herkunft erkannte.
Sie betastete den Abdruck mit einem Zeigefinger. Das Blut fühlte sich hart und borkig an, wie Baumrinde.
Sie riss sich von dem Anblick los, trat ans Fenster und schaute hinaus auf die Uferstraße. Halb hatte sie erwartet, dass dort unten jemand stehen würde, der sie beobachtete. Doch auf der Straße waren nur ein paar Automobile und Pferdegespanne unterwegs, dazwischen Fußgänger auf dem Weg zur Arbeit.
Rasch trat sie zurück, nahm einen der hässlichen Stühle und verkantete die Lehne unter der Klinke der Zimmertür. Danach fühlte sie sich ein wenig sicherer, auch wenn sie genau wusste, dass sie sich etwas vormachte. Wem es gelungen war, an den Schlüssel zu kommen, der würde auch in der Lage sein, die Tür einzutreten.
Doch sie glaubte nicht, dass er etwas Derartiges tun würde. Seine Gefährlichkeit war subtiler, ein Spiel mit Auras Ängsten, keine Androhung plumper Gewalt. Das würde später kommen. Das Blut war eine erste Warnung. Unmöglich zu sagen, ob es von einem Menschen oder einem Tier stammte; vielleicht war es Hühner- oder Schweineblut. Aber auch dieser Gedanke konnte sie nicht beruhigen.
Sie wünschte sich einen starken Kaffee, irgendetwas, das ihre Sinne schärfte und verhinderte, dass sie sich in tausend Mutmaßungen verzettelte. Etwas, das sie zurück auf den Boden der Tatsachen holte.
Die blutige Hand war eine Tatsache. Der sechste Finger eine andere. Dazu kam die verschlossene Tür. Alles andere blieb Spekulation.
Und nun werd gefälligst damit fertig. Tu etwas.
Traumwandlerisch entschied sie, ein Bad zu nehmen. Sie fühlte sich beschmutzt und ekelte sich vor sich selbst, obwohl sie nur geschlafen hatte. Wie lange war der Fremde im Zimmer gewesen? Hatte er sie nur dort berührt, wo das Blut Spuren hinterlassen hatte? Wie lange hatte er dagestanden und sie im Mondlicht stumm betrachtet?
Zur Sicherheit legte sie ihren kleinen Revolver mit gespanntem Hahn neben die Badewanne. Die Waffe war kaum größer als ihre Handfläche. Aber auch ein Hüne mit sechs Fingern war nicht immun gegen eine Kugel.
Die Versorgung mit heißem Wasser funktionierte im Hotel recht gut, obwohl sie erst am Abend zuvor ein Bad genommen hatte. Sie benutzte keine Öle oder Seifen, entspannte sich und betrachtete ihren nackten Körper durch die spiegelnde Oberfläche. Das Wasser vergrößerte ihren Umriss wie eine Lupe. Selbst nach siebzehn Jahren konnte sie noch immer die beiden Reihen winziger Narben an den Innenseiten ihrer Oberschenkel erkennen, dort, wo sie als Mädchen Ringe durch die Haut gezogen hatte, einen für jeden Monat, den ihr Vater sie in einem Internat in den Schweizer Bergen hatte einsperren wollen. Auf dem Weg dorthin war sie Gillian begegnet.
Es gab Wichtigeres, über das sie hätte nachdenken müssen – wer wusste, dass sie sich in Paris aufhielt, und hatte darüber hinaus einen Grund, sie einzuschüchtern? –, und doch war es immer wieder Gillian, zu dem ihre Gedanken zurückkehrten. Sie hatte ihm die Unsterblichkeit angeboten. Er hatte abgelehnt. Zwei Jahre lang, Tag für Tag. All ihre verzweifelten Argumente, schließlich ihr Flehen – nichts hatte gefruchtet. Er wollte nicht ewig leben, auch nicht aus Liebe zu ihr. Und sie konnte ihn verstehen. Ihr Körper war der einer Vierundzwanzigjährigen und würde es für immer bleiben. In Wahrheit war sie zehn Jahre älter. Noch mit sechzig würde sie aussehen wie eine junge Frau. Auch mit zweihundert. Sie wusste genau, was Gillian gemeint hatte, als er ihr Angebot ausschlug. Die Aussicht auf die Einsamkeit, das Leid, den Schmerz, den Verlust all jener, die sie liebte. Sie und Gillian hätten Seite an Seite leben können, Jahrhundert um Jahrhundert. Aber was hätte die Zeit ihnen angetan? Sie stellte sich diese Frage immer wieder, seit dem Moment, in dem das Gilgameschkraut sie zu einer Unsterblichen gemacht hatte. Sie hatte Liebespaare gesehen, die sich nach wenigen Jahren nichts mehr zu sagen hatten. Wie konnte sie annehmen, dass Gillians Liebe zu ihr eine Ewigkeit dauern würde? Und ihre eigene zu ihm?
Sie war so verflucht jung gewesen. So unerfahren. Sie hatte geglaubt, er würde ihr verzeihen, als sie ihm das Kraut schließlich unter sein Essen mischte. Es zeigte seine Wirkung, als er in ein zweitägiges Koma fiel. Als er wieder erwachte, wusste er sogleich, was sie getan hatte. Am Tag darauf hatte er sie verlassen, hatte Schloss Institoris und der Ostsee den Rücken gekehrt und war nach Süden gegangen. Fort von ihr. Fort auch von Gian, seinem Sohn.
Sie schlug mit der Faust auf die Wasseroberfläche. Eine Fontäne spritzte über den Griff des Revolvers. Eine Waffe, mit der sie um ihr Leben kämpfen würde … die Vorstellung ließ sie schmunzeln. Sie war unsterblich, gewiss, aber alles, wovor das Kraut sie bewahrte, waren das Alter und vielleicht die eine oder andere Krankheit – und nicht einmal dessen konnte sie sicher sein. Lediglich eines wusste sie genau: Wie jeder andere Mensch konnte sie eines gewaltsamen Todes sterben. So wie ihr Vater, der nach sechs Jahrhunderten gestorben war, als jemand seinen Kehlkopf zerquetscht hatte.
Gillian hatte ihn getötet, damals, bevor sie einander begegnet waren.
Immer wieder Gillian.
Sie tauchte unter, bis ihre langen Haare wie Wasserpflanzen auf der Oberfläche trieben, hielt den Atem an, als könnte das drohende Ersticken den Schmerz aus ihrer Seele vertreiben. Trotzdem hatte sie nicht das Bedürfnis, nach Luft zu schnappen, bis sie schließlich auftauchte und abermals zum Beckenrand blickte.
Die Waffe war fort.
Aura sprang auf, Tropfen wirbelten funkelnd in alle Richtungen. Jetzt erst raste ihr Atem, ihr Herzschlag, und ein Wasserschleier verwischte ihre Sicht.
Der Revolver lag auf dem Boden. Die Nässe hatte ihn vom Wannenrand gleiten lassen. Sie konnte von Glück sagen, dass sich kein Schuss gelöst hatte.
Über eine Minute lang stand sie da, reglos und aufrecht, bis zu den Knien im Wasser, nackt und ungeschützt, eine schimmernde Statue im Kristallspiegel an der Marmorwand gegenüber. Sie war niemals schreckhaft gewesen, nicht einmal als Kind. Jetzt aber kam es ihr vor, als füllte ihr pumpendes Herz sie von den Füßen bis zur Stirn aus, pochend, vibrierend, zitternd.
Sie musste raus hier, hinaus an die frische Luft, fort aus diesem Zimmer, das keine Sicherheit mehr bot. Der Eindringling hatte seine Präsenz wie Fußabdrücke auf dem Teppich hinterlassen.
Wenig später trat sie in einem eng geschnürten schwarzen Kleid auf den Hotelflur. Sie war ungeschminkt und trug keinen Schmuck. Ihr Haar war noch immer feucht. Sie hätte lieber eine Hose getragen wie bei ihren nächtlichen Erkundungen, doch das hätte in einem Hotel wie diesem zu viel Aufsehen erregt.
Der Korridor war verlassen. Rechts und links reihten sich Türen wie in einem Gefängnis aneinander. Gaslichter flackerten in engen Abständen an den Wänden. Aus einem Zimmer drang leises Kichern, alt und weiblich. Aura spürte, wie allein das Geräusch ihr Übelkeit bereitete. Dann verstummte es wieder, und durch eine andere Tür glaubte sie Flüstern zu hören. Verstohlenes Wispern.
Er war noch hier. Irgendwo. Sie konnte es spüren.
Nur Einbildung, nichts sonst.
Ein Knirschen am Ende des Flurs ließ sie herumwirbeln. Ein Zimmermädchen schob einen Wagen mit frischer Bettwäsche auf sie zu und beobachtete sie verstohlen. Aura trat einen Schritt zurück, um das Mädchen durchzulassen, dann ging sie in entgegengesetzter Richtung zum Treppenhaus. Kurz bevor sie den Flur verließ, spürte sie Blicke in ihrem Rücken, blieb stehen und schaute über die Schulter zurück. Der Wäschewagen stand verlassen mitten im Gang. Alle Türen waren geschlossen.
Aura eilte die Treppe hinunter. Gedämpfte Schritte auf dickem Teppich. Ganz kurz fragte sie sich, ob das weiße Ding am Boden neben dem Wagen die Haube des Zimmermädchens gewesen war. Es musste sie verloren haben.
Sie war spät dran, es war bereits Mittag. In der Eingangshalle saß eine Gruppe alter Männer und Frauen auf Sesseln am Fenster. Die meisten lasen Zeitung. Ein Mann mit mehr Ringen an den Fingern als Zähnen im Mund grinste sie an und durch sie hindurch. Alle blickten auf, als sie, schwarz wie der Tod, an ihnen vorüberglitt.
Erleichtert atmete sie auf, als sie endlich auf der Straße stand. Die Nähe der alten Menschen verstärkte ihre Übelkeit, eine Nebenwirkung des Gilgameschkrauts.
Sie wechselte die Straßenseite und stützte sich einen Moment mit einer Hand auf die Ufermauer. Schließlich drehte sie sich um und blickte an der Fassade des Les Trois Grâces empor.
Durch ein Fenster ihrer Suite beobachteten sie dunkle Augen in einem weißen Gesicht.
Himmel, ebenso gut mochte es die Suite nebenan sein, vielleicht sogar die übernächste. Vielleicht hatte sie sich in der Etage geirrt. Nur ein Mann, der auf den Fluss blickte und die Boote zählte.
Sie lehnte sich gegen die hüfthohe Mauer, atmete tief durch.
Finger aus Blut. Zwei Mittelfinger wie Fangzähne in einem Raubtierkiefer.
Automobile lärmten vorüber. Ein Kutscher fluchte.
Eine Stimme sprach sie an, ein Mann in schmuddeliger Kleidung. Er trug einen Bauchladen mit Rosen aus schwarzem Glas. Unwirsch winkte sie ihn fort. Er lächelte, nickte ihr zu und ging weiter.
Wind kam auf. Vom anderen Ufer drang Lärm herüber wie ein fernes Rauschen.
Ein Junge mit schmutzigem Gesicht lief auf sie zu. Die weiße Kluft des Zimmermädchens hing über seinem Arm.
Nur Zeitungen. Ein Zeitungsjunge.
»Madame?«, fragte er und streckte grinsend die leere Hand aus.
Als er fortlief, ließ er ihre Münze in seiner Hose verschwinden. Aura betrachtete die Schlagzeile der dünnen Sonderausgabe. Deutschland hatte Russland den Krieg erklärt, vor wenigen Stunden erst. In Frankreich hatte die Mobilmachung begonnen. Nachrichten, die längst keinen mehr überraschten.
Vor ihren Augen schwebte etwas zu Boden, etwas Weißes, aus einem der Hotelfenster. Die Haube des Zimmermädchens. Bevor sie sicher sein konnte, fuhr ein Automobil darüber hinweg. Danach war das Pflaster leer.
Gillian, dachte sie verzweifelt.
Und: Ich will nicht mehr allein sein.
Doch allein wandte sie sich um, und allein lief sie die Straße hinab davon.
KAPITEL 2
Wenn die Wüste sang, tat sie es mit der Stimme des Windes. Tess lauschte dem Lied, und manchmal glaubte sie, Worte zu verstehen. Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, die Mythen der Yeziden, Kurden und Araber; Legenden aus einer Zeit, als die Furcht vor den Dschinnen das Land regierte.
Sie saß im Schneidersitz auf einer Düne, obwohl man sie tausendmal gewarnt hatte, das nicht zu tun: Gib Acht, sonst kriechen Skorpione unter dein Kleid. Tess hatte dies erfreut zum Anlass genommen, die Baumwollkleider, die man ihr bei der Ankunft ausgehändigt hatte, im Schrank zu lassen. Seitdem trug sie Hosen, mochte der Professor auch noch so oft behaupten, damit verärgere sie die einheimischen Arbeiter, die es nicht gewohnt waren, junge Mädchen in Männerkleidung zu sehen.
Von hier aus hatte sie eine gute Aussicht über das gesamte Grabungsgelände. Die gelben Mauerreste, die zwischen tiefen Gräben und Schächten aus dem Wüstensand ragten, wirkten von hier oben wie riesenhafte Buchstaben einer längst vergessenen Schrift. Es fiel schwer, sich vorzustellen, dass sich hier vor ein paar Tausend Jahren eine blühende Metropole erhoben hatte – Uruk, die Hauptstadt des Zweistromlandes. Hier hatte Gilgameschs Thron gestanden, vielleicht im Schatten einer mächtigen Zikkurat oder unter Zwiebeltürmen wie in den Illustrationen der Geschichten um Aladin und Harun-Al-Raschid.
Tess war allein hier heraufgestiegen, weil sie die Ruhe und den Wind mochte, das Säuseln winziger Sandwirbel, die über die Hänge fegten wie die Asche längst vergessener Tänzerinnen. Hier oben fiel es leicht, sich solche Dinge vorzustellen. Verrückte Dinge.
Den Ritter zum Beispiel.
Sie hatte ihn in letzter Zeit oft gesehen, meist aus der Ferne, ein Blitzen am Horizont der persischen Wüste, Sonnenstrahlen die sich auf seinem silbernen Harnisch brachen. Gelegentlich kam er näher. Dann sah sie den Schweif seines schneeweißen Hengstes, sah, wie die Hufe Krater im Sand hinterließen, hörte das Schnauben des Schimmels und das Klirren des Rüstzeugs. Sah das geschlossene Visier unter dem weißen Federbusch.
»Wartest du wieder auf ihn?«
Tess blickte auf. Gian war den Dünenhang heraufgestiegen und stand unvermittelt vor ihr. Sie musste geradewegs durch ihn hindurchgeschaut haben. Kein Wunder, dass er besorgt aussah. Aber Gian war immer besorgt, seit sie den Fehler gemacht hatte, ihm von dem Ritter zu erzählen.
»Nein«, sagte sie wahrheitsgemäß. »Ich wollte nur allein sein.«
»Soll ich wieder gehen?«
»Blödsinn.« Sie deutete auf eine Stelle im Sand, gleich neben sich. »Setz dich.«
Er lächelte. »Und die Skorpione?«
»Haben hoffentlich keinen so exotischen Geschmack, dass sie sich mit zwei Bleichgesichtern wie uns abgeben.«
Schmunzelnd ließ er sich neben ihr nieder. Bleich war eigentlich nur Tess, sie hatte die blasse Haut ihrer Mutter geerbt. Von Sylvette hatte sie auch das weißblonde Haar, das ihr als langer Pferdeschwanz über den Rücken fiel. Zudem entdeckte sie seit ihrer Ankunft in der Wüste fast täglich neue Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken, und Gian hatte zu Anfang keine Gelegenheit ausgelassen, sie damit aufzuziehen. Die meisten glaubten, er wäre ihr Bruder, obgleich er in Wahrheit ihr Cousin war. Aber das hatte nie einen Unterschied gemacht. Er war Auras Sohn, und Aura war so etwas wie ihre zweite Mutter.
»Keine Lust mehr, alte Töpfe zusammenzuleimen?«, erkundigte er sich scheinheilig. Er hatte rabenschwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Sein khakifarbenes Hemd hatte einen Kaffeefleck vom Frühstück, aber mit derlei Dingen nahm man es hier draußen nicht so genau.
Kopfschüttelnd schenkte sie ihm ein Lächeln, auch wenn ihr sein Unterton missfiel. Ein Hauch von Sarkasmus hatte sich in den vergangenen Wochen in vieles eingeschlichen, was er sagte, und das ärgerte sie. Gian und sie hatten niemals ernsthaften Streit gehabt, aber es beschlich sie das Gefühl, dass es bald zum ersten Mal so weit sein könnte.
Professor Goldstein, der Leiter des Camps und ein Bekannter ihrer Tante Aura aus jener Zeit, als sie sich eingehend mit dem Gilgamesch-Epos beschäftigt hatte, hatte Tess zu Arbeiten in den Ruinen einer antiken Töpferwerkstatt eingesetzt. Seine Arbeiter hatten das Areal erst vor ein paar Monaten freigelegt. Tess hatte eine Menge Zeit damit verbracht, die Überreste uralter Gefäße zusammenzufügen, anfangs nur zum Spaß, bis ein Assistent des Professors erkannte, dass sie sich ziemlich geschickt anstellte. Seitdem überließ man ihr auch die Rekonstruktion seltenerer Fundstücke. Nicht schlecht für eine Fünfzehnjährige. Sie spürte, dass Gian neidisch war auf die Verantwortung, die man ihr übertragen hatte. Er war ein Jahr älter und durfte lediglich die Korbjungen bespitzeln, Söhne der Einheimischen, deren Aufgabe es war, den Abraum aus den Gruben in Körben abzutransportieren und nach Fundstücken zu durchsuchen. Manche ließen dabei einzelne Teile unter ihren Gewändern verschwinden, und es oblag Gian, ein wachsames Auge auf sie zu haben – was ihn nicht gerade zu einem Liebling der Beduinenkinder hatte werden lassen. Er erledigte seine unangenehme Aufgabe mit Würde, aber auch voll unterschwelligem Zorn auf den Professor.
Dabei, und das wusste Tess nur zu genau, gab Gian nicht wirklich Goldstein die Schuld an seinem Dilemma. Seit ein paar Wochen erging er sich mehr und mehr in wütenden Tiraden über seine Mutter, die sie beide, wie er meinte, hierher abgeschoben hatte. Und das, wo es zu Hause zum ersten Mal interessant wurde – seine Worte, nicht die von Tess. Im Gegensatz zu ihm schämte sie sich keineswegs, ihre Angst vor dem heraufziehenden Krieg einzugestehen. Ihr war es recht, dass Aura sie mit Goldstein nach Mesopotamien geschickt hatte. Ihr gefielen die Wüste und die Arbeit auf der Ausgrabungsstätte. Nicht einmal die verstohlenen Blicke der arabischen Arbeiter störten sie, die ein so blondes und hellhäutiges Mädchen wie sie noch nie zuvor gesehen hatten.
»Der Ritter wird nicht kommen, weißt du«, sagte Gian, ohne sie anzusehen.
Sie runzelte die Stirn. »Ich hab dir gesagt, dass ich nicht auf ihn warte.«
»Ist das die Wahrheit?«
»Ich hatte bisher keinen Grund, dich anzulügen. Warum sollte ich jetzt damit anfangen?«
»Es ist nicht gerade normal, dass man mitten in der Wüste Ritter in voller Rüstung sieht.«
Sie zog einen Schmollmund, auch wenn sie lieber etwas getan hätte, das sie hätte erwachsener erscheinen lassen. »Ich hätte dir nie von ihm erzählen sollen.«
Er gab keine Antwort, und das beunruhigte sie noch mehr als seine Vorwürfe oder die Tatsache, dass er sie als nicht normal bezeichnet hatte. Das waren sie beide nicht, und Gian wusste es ebenso gut wie sie. Es war nicht normal, wenn man die Fähigkeit besaß, auf die Erinnerungen längst verstorbener Vorfahren zurückzugreifen. Wenn man sich an Dinge erinnern konnte, die andere erlebt hatten, vor Hunderten von Jahren.
»Ich hab nachgedacht«, sagte er.
»So?«
»Über den Ritter.«
»Herrgott, Gian!«
»Nein, im Ernst. Ich meine, du weißt doch, woher er stammen könnte.«
»Aus Nestors Erinnerungen? Oder aus denen von Lysander?«
Er nickte
»Nein«, sagte sie. »Das glaube ich nicht. Ich hab ihn gesehen. Mit meinen Augen. Das war keine Erinnerung, und schon gar keine Einbildung. Außerdem müssen wir beide zusammen sein, damit es funktioniert – anders klappt es nicht.«
Sie spürte, dass ihm etwas unangenehm war. Verheimlichte er ihr etwas? Gian und sie hatten nie Geheimnisse voreinander gehabt. Nur deshalb hatte sie ihm überhaupt von dem Ritter erzählt.
»Wenn nun irgendwas die Erinnerung … hm, ich weiß nicht, wenn etwas sie ausgelöst hätte? Auch ohne mich?«
»Wie meinst du das? Wir haben uns geschworen –«
»Die Vergangenheit ruhen zu lassen. Sicher.« Er sprach leise, fast ein wenig schuldbewusst. Tess konnte sich sein Verhalten nicht erklären. Aber vielleicht deutete sie auch einfach zu viel in seine Worte hinein. Sie selbst hatte sich in letzter Zeit verändert. Das Auftauchen des Ritters hatte sie stärker verunsichert, als sie sich eingestehen mochte.
Gian winkte ab. »War nur so eine Idee.«
Sie war nicht bereit, ihn so einfach davonkommen zu lassen. Sie hasste es, wenn Dinge zwischen ihnen unausgesprochen blieben. Dafür kannten sie einander zu gut. »Wir haben uns geschworen, nicht mehr auf diese Erinnerungen zurückzugreifen. Wir haben es beide geschworen, Gian. Du warst damit einverstanden.« Sie versuchte, ihm in die Augen zu sehen, doch er blickte rasch hinab zu den Ausgrabungen. »Bereust du das jetzt etwa?«
»Nein«, sagte er zögernd. »Nein, nicht wirklich.«
Mit einem Schnauben zog sie sich den Pferdeschwanz über die Schulter vor die Brust. »Ich will solche Erinnerungen nicht, ganz egal, wem sie gehören. Die meisten waren furchtbarer als meine schlimmsten Alpträume.« Sie hatten oft genug mit angesehen, welche Verbrechen ihre Vorfahren Nestor und Lysander während ihres Strebens nach der Unsterblichkeit begangen hatten. Die Männer waren Schüler des Tempelritters Morgantus gewesen, und von ihm hatten sie gelernt, wie man sich dem Tod widersetzte. Alle drei zeugten Mädchen, und sobald diese volljährig waren, zeugten sie mit ihnen weitere Töchter, Generation um Generation, eine endlose Kette von Inzest. Wenn die Frauen selbst wieder Kinder geboren hatten, wurden sie getötet, um aus ihrem Blut das Elixier des Lebens zu gewinnen. So erging es jeder von ihnen, Tochter um Tochter um Tochter.
All die toten Mädchen. So viel Blut.
»Ich hasse diesen Ort«, sagte Gian.
Sie folgte seinem Blick über die Ausgrabungsstätte: Mauerreste wie Zahnstümpfe, dazwischen zahllose Menschen. »Gib nicht Aura die Schuld. Sie hat es nur gut gemeint.«
»Gut gemeint«, wiederholte er verächtlich. »Meine Mutter hat uns hergeschickt, weil sie uns loswerden wollte. Jedenfalls mich.«
»Schwachsinn.«
Sein Kopf ruckte herum, und sie erschrak, als sie den Hass in seinen Augen sah, die dunkle, kalte Wut hinter seinen Pupillen. »Sie hat mich genauso verlassen wie damals mein Vater. Und letztlich war es ihre Schuld, dass er fortgegangen ist. Es gibt keine Entschuldigung für das, was sie getan hat.«
Tess hätte gerne widersprochen, aber das konnte sie nicht. Aura hatte Gillian das Gilgameschkraut verabreicht, hatte ihn gegen seinen Willen zu einem Unsterblichen gemacht. Gillian hatte das nicht gewollt, doch Aura hatte sich selbstsüchtig darüber hinweggesetzt. Aus Liebe, gewiss, und dennoch war es falsch gewesen. Sie alle wussten das.
Tess hatte allerdings die Befürchtung, dass es Gian gar nicht um das ging, was Aura getan hatte. Er sah nur – paradoxerweise in einem ähnlichen Anflug von Egoismus wie dem, den er seiner Mutter zum Vorwurf machte –, dass Gillian die Familie verlassen hatte, als Gian erst acht Jahre alt gewesen war. Und nun hatte Aura auch ihn fortgeschickt, hierher, ans Ende der Welt. Ganz gleich, was Tess sagen mochte, es würde nichts an seinen Gefühlen ändern. Sie hätte den bevorstehenden Krieg erwähnen können, die Gefahr, die ihnen auf Schloss Institoris drohte, aber das alles wäre zwecklos gewesen. Sie brauchte ihn nur anzusehen, um das zu erkennen.
»Irgendwann wirst du ihr verzeihen müssen«, sagte sie.
»Weshalb sollte ich?«
»Weil … weil sie deine Mutter ist.« Gott, sie kam sich so kindisch vor.
Er lachte, aber es klang kühl und machte ihr fast ein wenig Angst. »Meine Mutter …«, flüsterte er, doch falls er noch etwas hatte hinzufügen wollen, so verschluckte er es.
Tess legte einen Arm um seine Schultern und erschrak, als er sich einen Moment lang versteifte, als wäre sie eine Fremde. Dann aber wurde er wieder zu dem alten Gian, dem Jungen, den sie besser kannte als jeden anderen Menschen und den sie liebte wie einen Zwillingsbruder. Er sank ein wenig in sich zusammen und lehnte den Kopf an ihre Schulter.
Tess lauschte dem Wind über den Dünen, horchte auf das Rascheln der Sandwirbel an den Hängen, während ihre Augen den Mustern der Verwerfungen folgten, Antworten darin suchten wie ein Schamane in der Asche eines Feuers.
Ein Blitzen über einem nahen Hügel. Sonnenlicht auf Stahl.
Aber es waren nur ein paar Arbeiter, die mit geschulterten Werkzeugen über die Anhöhe kamen und zu einer der Grabungsstätten hinunterstapften.
»Tess?«
»Hm?«
Er löste seine Wange von ihrer Schulter und sah ihr in die Augen, so blau wie seine eigenen. »Wenn man einen Fehler macht, ganz egal welchen … Glaubst du, man kann ihn wiedergutmachen? Irgendwie?«
Sie erwiderte stumm seinen Blick und wünschte sich mit aller Kraft, sie könnte seine Gedanken lesen. Sie überlegte und fand schließlich eine Antwort, die er vermutlich nicht hören wollte. »Wenn man weiß, dass es ein Fehler ist, und ihn trotzdem begeht … Nein, ich glaube nicht. Nicht jeden.«
Er hielt ihrem Blick ein paar Sekunden länger stand, dann erhob er sich mit einem Ausdruck von Resignation. »Ich geh zurück ins Lager.«
»Gian?«
Er blieb stehen, zögerte aber einen Augenblick, ehe er sich schließlich noch einmal zu ihr umwandte. »Ja?«
»Du erzählst mir noch davon, oder? Was dir so zu schaffen macht?«
Er lächelte traurig. »Ich hab dich lieb, Tess.« Damit drehte er sich um und eilte den Hang hinunter. Seine Schritte lösten weite Sandfelder, die geräuschlos abrutschten, als entfernte sich mit ihm auch die Wüste von ihr.
Tess blinzelte.
Licht auf Stahl, in weiter Ferne. Ganz kurz.
Was geschieht nur mit uns?
Ein Schnauben, vielleicht nur der Wind.
Was geschieht mit mir?
Heute Nacht würde sie wieder schlecht träumen. Wie so oft in letzter Zeit.
Ich will das nicht.
Ich hab dich lieb, Tess.
Ja, ich dich auch.
Abends stand Tess vor dem Spiegel und betrachtete ihr Abbild im trüben Glas. Alles hier war eingestaubt, hauchfein bedeckt mit Wüstensand. Sogar sie selbst, fand sie. Porzellanweiß, sagte sie sich an Tagen, wenn ihre Laune gut genug war, sich selbst zu mögen. Weiß wie der Tod, urteilte sie heute. Gians Haut bräunte in der Sonne schneller als ein Brot im Ofen. Aber sie selbst? So blass wie das zerwühlte Bettzeug unter dem Fenster. Außerdem war sie zu dünn. Mochten andere ihr auch einreden wollen, sie sei schlank und auf feenhafte Weise hübsch, so empfand sie selbst sich nur als mager und knochig. Und was war das für ein Pickel auf ihrer Stirn? Sie drückte so lange daran herum, bis rote Halbmonde auf der Haut erschienen und die Entzündung einrahmten wie Kreise auf einer Zielscheibe. Wunderbar.
Sie schnitt sich selbst eine Grimasse, besah sich noch einmal mürrisch die rote Stelle auf ihrer Stirn, dann kroch sie unter die Decke. Sie wollte nicht an Gian denken. Wollte auch nicht einschlafen, denn sie wusste, dass dann die Träume kämen.
Als sie die Augen dennoch schloss, galoppierte einmal mehr der Ritter durch die Schwärze hinter ihren Lidern.
In der Nacht drang die Kälte der Wüste durch die Ziegelmauern, wehte durch die Ritzen der Fenster und unter den Türen hindurch.
Tess träumte von einem weiten, öden Land, auf dessen Felsen sich mächtige Burgen erhoben. Sie sahen aus, als hätten die Baumeister des Abend- und Morgenlandes gemeinsam Festungen errichtet, in denen sich die Charaktere beider Kulturen vereinten.
Etwas geschah in dieser Einöde, aber als Tess erwachte, konnte sie sich an nichts erinnern. Da waren Menschen in ihrem Traum gewesen. Und ein Ort, der wichtiger war als alle anderen, aus einem Grund, den sie nicht erfassen konnte, und der jetzt, da sie wach war, auch keine Rolle mehr spielte.
Allmählich wichen Verwirrung und Neugier. An ihre Stelle trat etwas anderes. Furcht.
Tess spürte deutlich, dass sie nicht allein im Zimmer war.
»Wer ist da?«
Es war so dunkel, dass sie nur den Umriss des Fensters sehen konnte, sanft erhellt vom Sternenhimmel, der hier draußen so unendlich größer und leuchtender zu sein schien als in ihrer Heimat.
»Wer ist da?« Nochmal dieselbe Frage. Und keine Antwort.
Sie richtete sich auf und hörte ein Rascheln. Jemand entfernte sich von ihr.
Ganz kurz kämpfte sie gegen den Drang an, laut um Hilfe zu schreien. Sie war alt genug, um allein klarzukommen. Wenigstens solange der Eindringling keinen gebogenen Araberdolch zog. So lange er nicht versuchte, ihr Gewalt anzutun.
Vielleicht sollte sie doch schreien.
Nein, du bist kein Kind mehr.
Die Tür wurde geöffnet – von innen! –, dann huschte ein Schemen hinaus und verschwand auf dem Gang. Nur ein wenig größer als sie selbst. Und nicht mit den gleitenden, verstohlenen Bewegungen der Einheimischen.
»Gian?« Sie sprach leise, flüsterte seinen Namen nur. Zu fassungslos, um zornig zu sein. Was suchte er nachts in ihrem Zimmer, neben ihrem Bett?
Sie wollte die Antwort nicht wissen, auch wenn sie offensichtlich war. Sie hatten doch einen Schwur geleistet, alle beide! Er hatte es genauso gewollt wie sie. Keine fremden Erinnerungen mehr.
Vielleicht hatte sie sich getäuscht. Einer der Arbeiter war ins Haus eingebrochen. Wahrscheinlich hatte sie Glück gehabt, dass ihr nichts Schlimmeres zugestoßen war.
Es musste einer der Arbeiter gewesen sein. Nicht Gian. Niemals Gian.
Sie sprang auf, glitt in eine der weiten Männerhosen, die die Frau des Professors für sie gekürzt hatte, stopfte das Hemd, das sie zum Schlafen trug, in den Bund und lief auf nackten Füßen hinaus auf den Gang.
Wer immer in ihrem Zimmer gewesen war, er hatte genug Zeit gehabt, um zu verschwinden. Sie hatte zu lange gezögert. Und insgeheim war sie froh darüber. Es war besser, die Wahrheit nicht zu kennen. Die Bestätigung hätte nur noch mehr geschmerzt.
Trotzdem ging sie weiter den dunklen Gang hinunter, vorbei an der geschlossenen Schlafzimmertür des Professors und seiner Frau, hinaus in den Vorraum, der zugleich als Esszimmer diente. Von dort führten Türen zur Küche, zu zwei kleinen Lagerräumen und zum Zahlzimmer, wo Professor Goldstein ein Mal in der Woche die Arbeiter ausbezahlte; das Zimmer hatte einen Ausgang ins Freie, damit die Männer nicht die Privaträume betreten mussten. Normalerweise war die Verbindungstür zum Vorraum geschlossen. Jetzt aber stand sie offen, und Tess’ Blick fiel auf den Umriss des schweren Stahltresors. Der kühle Luftzug war hier viel stärker als in ihrem Schlafzimmer. Im Näherkommen sah sie, dass auch die Außentür des Zahlzimmers weit geöffnet war.
Vielleicht hätte sie den Professor wecken sollen, spätestens jetzt war der Zeitpunkt dafür gekommen. Es sah aus, als hätte jemand versucht, an das Geld im Tresor heranzukommen. Danach hatte er einen raschen Abstecher in ihr Zimmer gemacht, um einen Blick auf das fremde Mädchen mit dem weißblonden Haar zu werfen.
Obwohl sie die Tatsache, dass ein Fremder in ihr Zimmer eingedrungen war, hätte beunruhigen müssen, verspürte sie nichts als Erleichterung. Sie hatte Gian zu Unrecht verdächtigt. Warum war sie nicht gleich in sein Zimmer gegangen und hatte sich vergewissert, dass er in seinem Bett lag?
Die Kälte drang durch ihr Hemd, aber das bemerkte sie erst, als sich ihr Herzschlag allmählich beruhigte. Sie bekam eine Gänsehaut. Die Schatten hinter dem Tisch, neben dem Tresor und sogar unter der Decke des Raumes waren so schwarz wie der Nachthimmel zwischen den Sternen. Auch der Vorraum hinter ihrem Rücken war erfüllt von einer Dunkelheit, die ihn fremd und unheimlich erscheinen ließ. Dies war nicht mehr der vertraute Raum, in dem sie aßen, Karten spielten oder den Geschichten des Professors lauschten.
Sie schaute zurück zur offenen Außentür und sah dahinter die Dünen im Sternenlicht. Die Sandhänge waren jetzt grau und hätten ebenso gut aus Eis sein können.
Der Riegel war beiseitegeschoben. Jemand hatte die Tür von innen geöffnet.
Die Kälte auf ihrer Haut war jetzt nicht mehr nur eine Folge der Wüstennacht. Tess schlang die Arme um ihren Oberkörper, aber auch davon wurde ihr nicht wärmer. Zögernd durchquerte sie den dunklen Raum und blickte durch die Außentür ins Freie.
Die Fußspuren im Sand führten vom Haus fort, nicht zu ihm hin.
Die einzelnen Abdrücke lagen weit auseinander, so als sei derjenige gerannt, nicht gegangen.
Bitte nicht, dachte Tess. Bitte, bitte nicht.
Sie trat hinaus und schaute sich um. Die Spuren führten zur Ecke des Hauses und verschwanden dahinter.
Du solltest das nicht tun, durchfuhr es sie. Geh wieder ins Bett! Schlaf weiter! Tu einfach so, als wäre nichts gewesen!
Doch natürlich folgte sie den Spuren trotzdem, vorbei an der gelbbraunen Ziegelwand des Hauses, dem einzigen gemauerten Gebäude des Lagers. Rechts von ihr befanden sich eine Reihe von Holzschuppen, dahinter die Zelte der Arbeiter. Sanfter Feuerschein glomm an vereinzelten Stellen, aber sie hörte keine Stimmen. Die Schufterei auf der Grabungsstätte war hart, die wenigsten Männer brachten nachts noch die Kraft auf, mit Freunden am Lagerfeuer zu sitzen.
Die Fußspuren führten nicht zu den Arbeiterzelten, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Dort stand vor einem steilen Dünenhang eine Handvoll weiterer Werkzeugschuppen mit Ersatzgeräten. Nur selten ging jemand dorthin.
Tess folgte den Spuren im Sand und hatte das Gefühl, unsichtbare Hände drückten ihr die Kehle zu. Sie hatte keine Angst vor einer Gefahr. Vielmehr fürchtete sie sich vor dem, was sie finden mochte. Wen sie dort finden mochte.
Sie erreichte den ersten Schuppen, etwa sechzig Meter vom Haus entfernt. Umrundete ihn.
»Hallo?«
Keine Antwort. Nur das Säuseln des Wüstenwindes.
Die Spur tauchte in die Schatten zwischen zwei weiteren Bretterverschlägen. Hinter ihnen wuchs die Düne empor wie der Rücken eines toten Wals, zurückgelassen von einer vergessenen Sintflut. Täuschte sie sich, oder roch es nach Qualm? Aber hier war es überall dunkel, keine Spur von einem Feuer. Vielleicht trug der Wind die Rauchschwaden vom Lager herüber.
Die Tür des Zahlzimmers war von jemandem geöffnet worden, der sich im Haus aufgehalten hatte. Nur der Professor, seine Frau und Gian kamen in Frage.
»Gian?«, rief sie in die Finsternis zwischen den Schuppen.
Er ließ sich Zeit. Tess hatte das dichte Gewebe aus Schatten fast erreicht, ehe sie ihn sah. Er stand da und erwartete sie, ein wenig zögernd und mit Trotz in den Augen, der seine Unsicherheit kaschieren sollte.
»Was soll das?«, fragte sie mit belegter Stimme.
»Was meinst du?«
Zornig machte sie einen weiteren Schritt auf ihn zu, bis nur noch eine Armlänge sie voneinander trennte. Irgendwo in der Ferne schrie eines der Kamele; es klang, als hätte es Schmerzen.
»Du weißt ganz genau, was ich meine!« Was war schlimmer: Sein Vertrauensbruch oder dass er jetzt versuchte, sie für dumm zu verkaufen? »Du warst in meinem Zimmer.«
»So?«
Seine Stimme klang sonderbar. Gedämpft wie ihre eigene, aber mit einem seltsamen Unterton, und diesmal war es kein Sarkasmus. Er klang wie ein Kind, das bei etwas Verbotenem ertappt worden war und nun entsetzliche Angst vor Strafe hatte.
»Wie konntest du nur?« Sie ließ ihm nicht die Chance, ihr auszuweichen. »Das ist schlimmer, als wenn du mein Tagebuch gelesen hättest.« Ihre Blicke nagelten ihn regelrecht an die Wand, und Gnade ihm Gott, wenn er es wagen sollte, irgendetwas abzustreiten. Sie war drauf und dran, sich auf ihn zu stürzen. Das letzte Mal hatten sie sich geschlagen, als sie noch Kinder gewesen waren, acht oder neun Jahre alt.
»Ich …«, begann er, brach aber gleich wieder ab. Erwiderte nur stumm ihren Blick. Er, der Aura sonst wie aus dem Gesicht geschnitten war, besaß plötzlich nur noch wenig Ähnlichkeit mit seiner Mutter. Tess stellte sich vor, dass Aura so ausgesehen haben musste, als Gillian sie damals verlassen hatte. Beschämt, getroffen und insgeheim überzeugt, aus ihrer Sicht das Richtige getan zu haben.
Gian hatte einen ähnlichen Vertrauensbruch begangen. Nicht so weitreichend, nicht von solcher Konsequenz. Aber sie wollte verdammt sein, wenn sie es mit einer Entschuldigung auf sich beruhen ließe.
»Wie oft?«, fragte sie. »Wie oft bist du nachts in mein Zimmer gekommen und hast in Nestors und Lysanders Erinnerungen herumgestöbert? Wir haben uns geschworen, es nicht mehr zu tun, Gian! Ich hab gedacht, ich träume all diese Dinge von Rittern und Burgen und weiß der Teufel was noch! Aber so war es nicht, oder? Es waren Erinnerungen. Du hast sie angezapft, und du hast mich dazu benutzt.«
»Es geht nicht ohne dich. Es funktioniert nur, wenn wir zusammen sind.«
»Du hättest mich fragen können!«
Ganz kurz blitzte Wut in seinen Augen auf. »Der Schwur war deine Idee. Was, glaubst du wohl, hättest du getan, wenn ich dich gefragt hätte? Es wäre genauso gekommen wie jetzt, und zwar bevor wir es auch nur versucht hätten.«
Am liebsten hätte sie ihm eine gescheuert, so hintergangen und ausgenutzt fühlte sie sich. »Und da hast du die Dinge einfach selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Hast Nacht für Nacht im Dunkeln neben meinem Bett gekauert und dich einfach … dich einfach aus meinem Gedächtnis bedient.« Sie schüttelte den Kopf, als sie sich die Szene vorstellte. »Das ist so schäbig, Gian. Das bist doch nicht du, der das getan hat. Und ich hab gedacht, ich kenne dich.«
»Was hab ich denn schon Schlimmes gemacht? Ich hab dich nicht mal angefasst.« Jetzt klang er fast ein wenig verzweifelt, ein Kind, das jeden Moment in Tränen ausbrechen würde. Aber natürlich würde er sich diese Blöße nicht geben, so gut kannte sie ihn.
Aber kannte sie ihn wirklich? Nach allem, was geschehen war, kamen ihr Zweifel daran.
»Ich habe dir von meinen Alpträumen erzählt. Du wusstest, was ich in den letzten Nächten durchgemacht habe. Aber das hat dich nicht gestört, oder?«
Der Qualmgeruch wurde einen Augenblick lang stärker, dann wehte ihn der Wind davon. Wieder blökte ein Kamel im Dunkeln. Ein zweites gesellte sich dazu.
»Es … es hat nichts mit dir zu tun«, sagte Gian. »Die Alpträume – ich hab das nicht gewollt. Trotzdem ging es nicht anders.«
»Aber warum, Gian?«
»Nestors Vergangenheit. Sie steckt irgendwo in uns. Er war ein Alchimist, einer der mächtigsten, die je gelebt haben. Genau wie Lysander. Ihr Wissen ist tief in uns drin. Und das alles könnte uns gehören, Tess. Begreifst du das nicht?«
»Und dann? Was hätten wir davon?« Sie erkannte, worum es ihm ging, noch bevor er es aussprechen konnte. Sie nutzte sein Schweigen, um rasch fortzufahren: »Es ist wegen Aura, stimmt’s? Sie hat sich mehr als fünfzehn Jahre mit der Alchimie beschäftigt. Und du hast gedacht, du könntest ihr überlegen sein, indem du Nestors und Lysanders Erinnerungen anzapfst. Es ging dir nur darum, sie zu übertrumpfen!«
Gian sah sie eine Weile lang an, fast ein wenig verwundert. Dann nickte er. Aber etwas in seiner Mimik sagte ihr, dass dies noch nicht die ganze Wahrheit war, auch wenn er wollte, dass sie das glaubte.
»Ja«, sagte er, und selbst seine Beschämung erschien ihr mit einem Mal gespielt, nicht echt. Nur ein Vorwand, damit sie nicht weiterfragte und ihn endlich in Ruhe ließ. »Meine Mutter hat meinen Vater verraten, und sie hat mich verraten. Ihn hat sie vergrault, und bei mir versucht sie jetzt dasselbe. Sie will doch nur, dass ich sie hasse! Damit ich so bald wie möglich von selbst aus ihrem Leben verschwinde und sie es wieder für sich allein hat. Für sich und ihre verdammte Alchimie!«
»So ist es nicht. Das weißt du genau. Und du hasst sie nicht. Vielleicht denkst du das im Moment, vielleicht denkt sogar sie selbst es. Aber du hasst sie nicht, glaub mir.«
»Du redest wie ein Prediger.«
Tess trat vor und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige. Die Kamele brüllten noch lauter. Irgendwo schlug ein Hund an und ließ sich nicht mehr beruhigen.
Er starrte sie stumm an. Seine Wange war rot, wo ihre Finger sie getroffen hatten. Aber er rührte sich nicht.
Ich verliere ihn, dachte Tess mit plötzlicher Gewissheit. Ich verliere ihn, wie Aura ihn verloren hat.
Sie sahen einander an, und plötzlich waren sie Erwachsene im schwersten Moment ihres Lebens. Eine Entscheidung musste getroffen werden, aber Tess wagte nicht, sie in Worte zu fassen, nicht einmal in Gedanken.
»Du hättest das nicht tun dürfen«, flüsterte sie. »Du hast alles kaputtgemacht.«
»Mehr als du denkst.« Aber er sagte es so leise, dass sie nicht sicher war, ob sie ihn richtig verstanden hatte.
Tränen stiegen ihr in die Augen, und nun war sie es, die sich abwenden musste, damit er es nicht sah.
Als sie sich wieder umdrehte, war er fort.
So schnell, so leise.
Seine Spuren wiesen nicht zurück zum Haus, wie sie im ersten Moment vermutet hatte. Sie verloren sich im Schatten zwischen den Schuppen, führten die Düne empor. Dahinter, jenseits des Kamms, war nichts als Wüste. Tausend Kilometer und mehr.
»Gian!« Sie lief los, folgte ihm den Hang hinauf, trat Sandschollen los, sank bei jedem Schritt bis zu den Knöcheln ein.
»Gian, verdammt noch mal!«
Er benahm sich wie ein bockiger kleiner Junge. Lief einfach davon, als könnte er dadurch irgendetwas ungeschehen machen. Idiotisch.
Sie war bald außer Atem und sog scharf die Luft durch Mund und Nase ein. Wieder bemerkte sie den Geruch nach Rauch und Feuer, doch sie achtete nicht darauf. Sie musste Gian zur Vernunft bringen. Sie hatte nicht vor, jede Nacht ihre Zimmertür zu verriegeln, nur auf die Gefahr hin, dass er wieder einmal Lust auf die Vergangenheit verspürte, Lust darauf, seiner Mutter eins auszuwischen. Er musste seinen Fehler einsehen, und sie würde dafür sorgen. Hier und jetzt, heute Nacht, und wenn es sein musste, auch dort draußen in der Wüste. Erst dann konnte alles zwischen ihnen wieder so werden, wie es gewesen war.
Du machst dir etwas vor. Du hast ihn doch gesehen, hast ihn gehört. Er wusste genau, was er getan hat. Dass er dich verletzt hat. Dass er dein Vertrauen missbraucht hat.
Du weißt es, und du willst es nicht wahrhaben!
Sie erreichte den Dünenkamm und blieb stehen, atemlos, eine Hand in die Seite gepresst.
Sie konnte ihn jetzt wieder sehen, unten im nächsten Dünental, keine hundert Meter entfernt. Und nicht nur ihn.
Da waren andere. Mehrere Umrisse, die sich schwarz vom hellen Sand abhoben.
Sie hatten ein Fahrzeug dabei, ein Automobil mit breiten Reifen. Im Lager gab es eines, das ganz ähnlich aussah. Der Professor fluchte oft, dass es zu nichts zu gebrauchen sei, da sich die Räder immerzu im Sand festfraßen. Dies hier schien ein besseres Modell zu sein. Tess konnte Reifenspuren im Sand erkennen, zwei Schattenschlangen, die sich über die Ebene und um die nächste Düne wanden.
Eine der Silhouetten hatte Gian am Oberarm gepackt und redete auf ihn ein. Gian versuchte, sich loszureißen, doch der Mann hielt ihn fest.
Tess unterdrückte den Drang, seinen Namen zu rufen, und ließ sich flach in den Sand fallen. Sie wusste nicht, ob eine der Gestalten dort unten sie bemerkt hatte. Wusste nur, dass sie Gian helfen musste. Am besten, sie lief zurück zum Lager.
Schüsse peitschten. Hinter ihr. Und mit ihnen trieb der Wind beißenden Brandgeruch heran.
Sie blickte über ihre Schulter, aber sie lag zu flach am Boden, um etwas sehen zu können. Hin- und hergerissen zwischen ihrer panischen Sorge um Gian und ihrer Verwirrung über den Lärm zögerte sie für ein, zwei Atemzüge. Dann rollte sie sich herum und kroch ein paar Meter zurück, wo sie sich langsam auf die Knie erhob.
Aus den Fenstern des Ziegelhauses schlugen Flammen. Zahllose Zelte brannten lichterloh. Überall liefen aufgescheuchte Arbeiter umher, die meisten nur notdürftig bekleidet, einige nackt. Zwischen ihnen sah Tess dunkle Gestalten, ähnlich jenen beim Fahrzeug. Schwarze, eng anliegende Kleidung. Schwarze Masken, die nur ihre Augen frei ließen. Feuerschein spiegelte sich auf Säbeln und Messern.
Professor Goldstein stand im Schlafanzug vor dem brennenden Haus und feuerte mit einem Jagdgewehr auf die Angreifer. Doch für jeden, der fiel, lösten sich zwei weitere aus der Nacht und näherten sich ihm mit flinken Bewegungen.
Tess’ Herz schlug zu schnell, sie spürte es flattern wie einen gefangenen Vogel.
Jetzt sah sie auch die Frau des Professors. Frau Goldstein, die sonst immer die Dame herauskehrte und niemals die Kontrolle verlor, irrte wie blind umher und näherte sich den Schuppen am Fuß der Düne. Ihr Haar war auf einer Seite versengt, eine schwarze Stoppelwüste, die bis in ihren Nacken reichte. Aus einem ihrer Augen lief Blut. In ihrem weißen Nachthemd war es nur eine Frage der Zeit, ehe einer der Maskierten sie entdeckte.
Tess rannte den Hang hinunter. Sie konnte weder Gian noch dem Professor helfen. Aber Frau Goldstein war weit genug vom Zentrum der Kämpfe entfernt, um rechtzeitig ein Versteck zu finden. In einem ziellosen Taumel näherte sich die Frau den Verschlägen. Niemand war hinter ihr.
Tess erreichte den unteren Teil der Düne, und jetzt schob sich das finstere Massiv der Schuppen zwischen sie und die Frau. Für einen Moment verlor Tess sie aus den Augen, aber das ließ sie nur noch schneller laufen. Allein ihr Instinkt steuerte sie und sagte ihr, dass sie gebraucht wurde, jenseits der Hütten, wo die Brände den Himmel golden färbten wie ein nächtlicher Sonnenaufgang.
Als sie um den letzten Schuppen bog, erfasste sie das ganze Ausmaß der Katastrophe. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass einer der Angreifer einen Stab aufrichtete und etwas daran emporzog. Im ersten Moment glaubte sie, es wäre ein zappelnder Mensch; dann erkannte sie die Flagge. Die Farben des Britischen Empire.
Engländer, die in schwarzen Masken ein deutsches Archäologencamp niederbrannten? Wohl eher ein Täuschungsmanöver für jene, die die Leichen finden würden.
Stocksteif blieb sie stehen. Ihr war, als wären ihre Beine bis zu den Knien im Sand eingesunken.
Nur ein kleines Stück von ihr entfernt lag die Frau des Professors am Boden, streckte verzweifelt eine Hand nach ihr aus und starrte sie durch einen Blutschleier an. Ihre Finger zuckten, der Arm sank herab. Ihr Röcheln war sogar durch das Prasseln und die Geräusche des Massakers zu hören. Dann brach es ab. Verschwommen wie in einem Traum wurde Tess bewusst, dass auch die Schüsse des Professors längst verstummt waren.
Im Rücken der Frau klaffte eine Wunde. Eine der schwarzen Gestalten stand breitbeinig über ihr und wischte seinen Säbel an ihrem Nachthemd sauber.
Er blickte auf und sah Tess.
Die Trägheit in ihren Beinen löste sich schlagartig. Mit einem zornigen Aufschrei wirbelte sie herum und lief zurück zwischen die Schuppen.
Erst als die Schatten um sie herum zu Körpern gerannen, zu Armen, Beinen und Augen, kam ihr die Erkenntnis, dass es vorbei war.
Hinter ihr wehte die Flagge in der Nacht.
Vor ihr blitzte Stahl.
Ein Hieb traf sie ins Kreuz und schleuderte sie flach in den Sand.
KAPITEL 3
Im Nachhinein fiel es Aura schwer, sich an den Rest des Tages zu erinnern. Irgendwann war sie ins Hotel zurückgekehrt, mit Fingern, die nach Buchbinderleim rochen, Augen, vor denen gotische Lettern tanzten, und Schultern, die von der gebeugten Haltung in den Lesesälen schmerzten. Sie hatte die Räume der Suite durchsucht und sich drei Mal vergewissert, dass die Tür von innen verschlossen war; zuletzt hatte sie eine Kommode davorgeschoben. Auch die Fenster waren geschlossen. Ein Eindringling hätte an der glatten Fassade heraufklettern müssen, um sie überhaupt zu erreichen.
Auras Bett war frisch bezogen, das beschmutzte Laken fort. Sie fragte sich, was das Zimmermädchen gedacht haben mochte, als es den blutigen Handabdruck entdeckt hatte. Vermutlich konnte sie froh sein, dass sie bei ihrer Rückkehr nicht der Hoteldirektor erwartet hatte. Auf ein Wort, Mademoiselle.
In der Nacht war sie mehrfach wach geworden, als die Nationalisten am anderen Seineufer vorübermarschierten, Schüsse in die Luft gefeuert wurden und patriotische Gesänge über das Wasser hallten. Dazwischen aber war ihr Schlaf traumlos und tief gewesen.
Dennoch hatte sie sich beim Aufwachen wie gerädert gefühlt. Erst als sie sah, dass ihre Decke unbefleckt war und es keine Anzeichen eines weiteren Einbruchs gab, hatte sich ihre Verspannung allmählich gelöst. Ihr war noch immer schwindelig, doch nach einem Frühstück aus fettigen Croissants gab sich auch das.
Dann aber, draußen auf der Straße, zwischen Menschen mit Transparenten, den engagierten Rednern auf der Ufermauer und den krakeelenden Zeitungsverkäufern holte sie das Gefühl wieder ein, aus der Menge heraus beobachtet zu werden.
War da jemand, der ihr folgte? Ein Mann blickte über den Rand seiner Zeitung zu ihr herüber. Kinder zeigten im Vorbeilaufen auf sie, nein, auf einen streunenden Hund, der an einer Hauswand ein Nickerchen machte. Eine Frau rief etwas, das ihr gelten mochte, vielleicht aber auch einer anderen, die jetzt aufblickte und der Ruferin zuwinkte.
Verrückt.
Sie wurde ganz allmählich verrückt.
Es hatte nicht mit der blutigen Hand begonnen. Nicht einmal mit ihrer Ankunft in Paris. Auch wenn es, und daran gab es keinen Zweifel, hier schlimmer geworden war.
Im Schloss hatte sie sich in den letzten Wochen immer öfter mit Sylvette gestritten. Bis dahin hatte Aura geglaubt, ihre Schwester spiele gerne die Rolle der Dame des Hauses. Sie führte die Dienerschaft mit einer Zielstrebigkeit, die Aura fehlte. Sylvette war perfekt darin, Aufgaben zu delegieren, mit der Köchin die Speisepläne für Wochen im Voraus zu erstellen, die Dienstmädchen aus dem Dorf bei Laune zu halten und die hochnäsigen Diener, die meist aus Berlin ins Schloss kamen, in die Schranken zu weisen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sylvette war – trotz allem, was sie als Kind und junge Frau durchgemacht hatte – eine echte Dame geworden, feinfühlig im Umgang mit den Angestellten, zupackend, wenn sie in der Küche gebraucht wurde.
Nie wäre Aura auf den Gedanken gekommen, dass ihre Halbschwester tief im Herzen todunglücklich war. Und, mehr noch, dass sie selbst, Aura, die Ursache dieses Unglücks war.
Im Grunde lief es auf eines hinaus: Neid. Sylvette beneidete Aura um die Freiheiten, die sie sich nahm, während die Verantwortung für das Schloss auf den Schultern ihrer jüngeren Schwester lastete. Und sie beneidete sie um ihre Reisen quer durch Europa, auch wenn Sylvette nie großes Interesse an anderen Ländern gezeigt hatte. Sie beneidete sie um das Wissen, das sie sich in siebzehn Jahren im Laboratorium und der Bibliothek ihres Vaters angeeignet hatte; nicht so sehr um ihre Kenntnisse alchimistischer Zusammenhänge – nichts hätte Sylvette ferner liegen können –, sondern um ihre Allgemeinbildung, ihr Schulwissen, ihr Gefühl für andere Sprachen. Mehrfach hatte Aura ihre Schwester mit Büchern in der Bibliothek ertappt, mit Lexika und Nachschlagewerken über Natur, Kultur und Geschichte, mit Sprachlehrbüchern, Dramen und Poesie. Doch das änderte nichts daran, dass Sylvette sich Aura unterlegen fühlte, mochte sich auch noch so oft zeigen, dass sie diejenige war, die den Misslichkeiten des Alltags gewachsen war, während Aura sich lieber im Dachgarten verschanzte und die wundersame Pflanzenwelt studierte, die ihr Vater in dem riesigen Gewächshaus kultiviert hatte.
Sie hatten über all das miteinander geredet. Meist aber endeten solche Gespräche damit, dass sich Sylvette trotzig auf den Standpunkt stellte, Aura sei ihr intellektuell überlegen. Es sei unmöglich, mit ihr über diese Dinge zu sprechen, behauptete sie. Aura könnte sie nicht verstehen, und, sei doch ehrlich, eigentlich hätte sie es auch niemals ernsthaft versucht.
Nur um eines beneidete Sylvette Aura nicht im Geringsten: Sie hatte, ebenso wie Gillian, die Unsterblichkeit abgelehnt, als Aura sie ihr anbot. Danach hatte sie nie wieder ein Wort darüber verloren. Aura kannte die Wahrheit: Sylvette hatte als Kind erlebt, was eine jahrhundertelange Existenz aus anderen gemacht hatte, aus ihrem Vater Lysander und dessen Meister Morgantus.
Aura fragte sich, ob Sylvette trotz ihrer Minderwertigkeitskomplexe nicht doch die Klügere von ihnen beiden war. Immerhin hatte sie die Tücken des Lebens durchschaut, während ihre ältere Schwester von einem Fiasko ins nächste schlitterte.
Aura hatte Fehler gemacht, viele Fehler. Nachdem Gillian sie verlassen hatte, hatte sie geglaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Nun aber hatte sie auch noch ihren Sohn verloren. Ihr Leben, ganz egal, wie lange es währen mochte, zerrann ihr unter den Händen. Die Ewigkeit war nicht mehr allein Verheißung, sondern auch Drohung.
Blindlings stürzte sie sich auf ihre Studien, auf die ziellose Suche nach Dingen, die sie nicht wirklich verstand. Was war das Verbum Dimissum, dessentwegen sie nach Paris gekommen war? Ein Wort, mit dem die Schöpfung der Welt begonnen hatte. Doch falls sie es jemals fand – aufgeschrieben, ausgesprochen, ganz egal –, was würde sie damit tun? Sie wusste es nicht und hatte sich auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Es war die Suche, die sie antrieb, und es spielte nicht wirklich eine Rolle, um was es dabei vordergründig ging. So lange es nur die Leere in ihrem Inneren füllte und verhinderte, dass sie allzu oft über sich selbst und ihr Versagen nachdachte.
Verrückt.
Zumindest auf dem besten Weg dorthin.
Und alle starrten sie an.
Sie nahm eine Droschke und ließ sich zu Philippes Palais fahren.
Das Anwesen gehörte Auras Familie, eine von unzähligen Immobilien, auf denen der Reichtum der Institoris’ gründete. Es blieb abzuwarten, wie viel nach einem Krieg davon noch übrig sein würde. Philippe Monteillet hatte das Haus vor vielen Jahren gemietet, als die Makler noch Auras Vater Rechenschaft schuldeten. Sie selbst hatte sich nach Nestors Tod lange Zeit nicht um die Besitztümer der Familie gekümmert, bis besorgte Briefe von Notaren und Justitiaren aus ganz Europa ihr schließlich die Notwendigkeit ihres Einschreitens vor Augen führten. So hatte sie den Erhalt des Vermögens als eine weitere Aufgabe akzeptiert, um sich von ihren trüben Gedanken abzulenken.