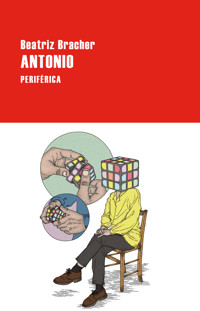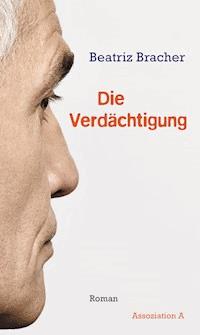
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Assoziation A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Beatriz Bracher verarbeitet in dem Roman »Die Verdächtigung« das gesellschaftliche Trauma der brasilianischen Militärdiktatur von 1964 bis 1985, das sie anhand eines Einzelschicksals darstellt. Durch eine Sprache von seismografischer Genauigkeit gelingt es ihr auf exemplarische Weise, die persönlichen Tragödien und inneren Konflikte der Menschen unter der Militärdiktatur nachempfindbar zu machen. Ihr Roman ist zugleich eine über den zeitgenössischen Kontext hinausweisende Auseinandersetzung mit der Frage von Schuld, Verantwortung und der Bosheit falscher Verdächtigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beatriz Bracher
Die Verdächtigung
Beatriz Bracher wurde 1961 in São Paulo geboren. Sie studierte Literaturwissenschaften und war Mitbegründerin der Zeitschrift 34 Letras, später des Verlags Editora 34, in dem sie acht Jahre als Lektorin tätig war, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Beatriz Bracher gilt als eine der herausragenden Stimmen der brasilianischen Gegenwartsliteratur. 2008 erhielt sie für ihren Roman Antonio (2007, dt. Übersetzung 2013, Assoziation A) den Prêmio Jabuti, den wichtigsten Literaturpreis Brasiliens.
Beatriz Bracher ist auch eine erfolgreiche Drehbuchautorin. Für Meu Amor erhielt sie beim Filmfestival in Rio de Janeiro 2009 den Preis für das beste Drehbuch.
Die Verdächtigung ist ihr zweiter auf Deutsch erschienener Roman.
Beatriz Bracher
DieVerdächtigung
Aus dem brasilianischen Portugiesischvon Maria Hummitzsch
Titel der Originalausgabe:
Não falei (Editora 34, 2004)
Obra publicada com o apoio do Ministério da
Cultura do Brasil/Fundação Biblioteca Nacional
Die Übersetzung aus dem Portugiesischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
Die Arbeit der Übersetzerin wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© Beatriz Bracher 2004 by arrangement with Literarische Agentur Mertin Inh.
Nicole Witt, Frankfurt am Main, Germany and Agência Riff, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
© der deutschsprachigen Ausgabe Berlin, Hamburg, 2015:
Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin
www.assoziation-a.de
[email protected], [email protected]
Titelgestaltung: Herbert Woyke/Konturwerk
Gestaltung Innenteil: Andreas Homann
Foto, Buchcover: Peter Augustin/gettyimages
ISBN (Print) 978-3-86241-438-3
ISBN (EPUB) 978-3-86241-607-3
Für Roberto Perosa
Wäre ein Gedanke ohne Worte und Bilder denkbar, vollkommen losgelöst von Zeit und Raum, aber durch mich entstanden, eine Offenbarung dessen, was sich zwar in mir und vor mir versteckt, aber da ist; könnte dieser Gedanke ohne Hinweis auf seine Herkunft vor den Augen aller hervortreten, also eben nicht durch das, was an Kraft von mir ausgeht – Stimmlage, Rhythmus und Sprechpausen, Blick –, und könnte man ihn in den Köpfen aller anderen aufblitzen lassen, oder sogar als eine Sache, also mehr als nur einen reinen Gedanken, so würde ich gern eine Geschichte erzählen.
Es ereignet sich jeden Tag. Es braucht einen Ort mit vielen unbekannten Menschen, weil an ihm etwas entsteht. Auf diese Weise machen wir Bekannte aus ihnen – indem wir ihnen Geschichten andichten, um uns die Zeit in der Schlange auf der Bank zu vertreiben, auf der Rückbank im Bus und am Tresen in der Bäckerei.
Was machen Sie beruflich?, fragte ich. Bin pensioniert, antwortete er. Vor dreiundzwanzig Jahren, am Tisch im Café einer Pension, fand ich die Antwort unpassend. Seine Ehefrau, die ganz in Weiß gekleidet wie eine Krankenschwester aussah, was durch das körperliche Gebrechen ihres Mannes noch bekräftigt wurde, arbeitete bei der Marine. Ich war damals Schuldirektor. Das waren Berufe, aus denen heraus man etwas entwickeln konnte, mitsamt den Falten im Gesicht, der Farbe der Haut, der Kleidung, die wir trugen, der Art, wie wir Butter aufs Brot schmierten. Aber pensioniert doch nicht. Ein pensionierter Arzt, ein pensionierter Müllmann, ein pensionierter Präsident, eine pensionierte Kosmetikerin, aber nicht einfach nur pensioniert. Aber heute, ja, da kann ich sehen, pensioniert war schon treffend
Hören Sie zu. Ich wurde gefoltert; sie sagen, ich hätte einen Genossen denunziert, der kurz darauf durch Kugeln der Militärs gestorben ist. Ich habe ihn nicht denunziert; ich bin in dem Raum, in dem ich ihn angeblich denunziert habe, fast gestorben. Sie haben gesagt, ich hätte alles gesagt; und Armando ist gestorben. Zwei Tage nach seinem Tod wurde ich freigelassen und durfte weiter als Schuldirektor arbeiten.
Eliana war in Paris, unsere kleine Tochter Lígia bei meiner Mutter, hier in diesem Haus, das heute leer ist und damals voll war. Unmittelbar nach meiner Verhaftung organisierten sie Elianas Ausreise nach Paris. Für mich wurde keine Ausreise organisiert, nirgendwohin. Eliana starb. Mein Vater war pensioniert und krank, meine Schwester Jussara, eigentlich noch ein halbes Kind, machte ihren Schulabschluss, schaffte es irgendwie, einen Platz in einem kostenlosen Vorbereitungskurs für die Uni-Aufnahmeprüfung zu ergattern, und büffelte den ganzen Tag. Auf José konnte die Familie nie wirklich zählen. Eliana ist in Paris gestorben, dort liegt sie begraben. Gleich nach meiner Freilassung habe ich mit ihr telefoniert. Hier war Sommer und sie zitterte vor Kälte, klagte viel über die Kälte, wollte unsere kleine Tochter sehen, ihren Bruder beerdigen, sich um ihre Mutter kümmern, ihre Stimme zitterte am öffentlichen Telefon, das sie kostenlos nutzen konnte, das aber eine schlechte Verbindung hatte. Ich stellte mir die blau angelaufenen Lippen vor und die viel zu dünne Kleidung. Es war unmöglich für sie, zurückzukehren, und mir war klar, dass sie das nicht ertragen würde, die Kälte hat ihr immer mehr zugesetzt als mir, aber zum damaligen Zeitpunkt konnte sie nicht zurückkehren, und etwas anderes blieb ihr nicht.
Armando, mein Freund, war ihr einziger Bruder gewesen. Luiza sagt, Eliana sei an einer Lungenentzündung gestorben, hätte nicht gewusst, dass ich gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Ich misstraue Luiza. Wie kann jemand denn in Paris an einer Lungenentzündung sterben? Aber sie hat doch nichts mehr gegessen. Ja, aber hat es denn keine Freunde gegeben, die ihr mit Essen und Kleidung hätten aushelfen können? Ich tobte. Luiza riet mir zu revolutionärer Standhaftigkeit, sie zögerte, und ihre metallische Stimme war auf einmal geladen wie die schrecklichen Elektroschocks der Militärs, was noch schlimmer war, und mein rechtes Ohr wurde vollends taub. Du bleibst einer von uns, trotz Armando, nicht alle halten stand, selbst von den Stärksten; keine Angst, Eliana hat es nicht gewusst, als sie gestorben ist. Dona Esther ist durch den Tod ihrer Kinder verrückt geworden, wollte bei ihrer Enkelin bleiben. Verrückt bin ich nicht geworden, aber ich konnte Lígia nicht berühren. Ihr Baby-Gebrabbel war mir unerträglich.
Francisco Augusto, der gerade seinen Universitätsabschluss gemacht hatte, rückte die Knochen meiner Finger wieder zurecht und stellte sie mit einer Schiene ruhig, die ich eine Woche später wieder herunterriss, stellte auf dem rechten Ohr völlige Taubheit fest und empfahl mir wegen der zwei fehlenden Zähne einen befreundeten Zahnarzt, den ich nicht aufsuchte. Die nächtliche Unruhe und die Unfähigkeit, länger als fünfzehn Minuten am Stück zu schlafen, ließ ich unerwähnt. Albträume haben wir alle, und ich durfte nicht verrückt werden.
Dona Esther nahm sich das Leben, stattete uns vorher aber noch einen letzten Besuch ab, umarmte ihre Enkelin Lígia, flüsterte ihr ein Abschiedsmantra in das kleine Ohr und sah mich enttäuscht an: Armando hat dir vertraut, mehr noch sogar als mir.
Am Cafétisch dieser Pension im Inland erzählte uns die junge Frau von der Marine, sie und ihr Mann seien ganz frisch verheiratet. Seit Elianas Tod waren zehn Jahre vergangen, und ich sagte, ich bin Schuldirektor, und der Ehemann sagte, ich bin pensioniert. Und mittlerweile bin ich selbst pensioniert. Ich hätte auch Biologe sagen können, oder Linguist, oder Pädagoge. Die Zähne in meinem Mund waren wieder vollzählig, und zusammen mit Lígia und ihrer Freundin Francisca machte ich Urlaub in den geschichtsträchtigen Städten von Minas Gerais.
Als ob nur manche Städte geschichtsträchtig wären. In der gegenwärtigen Geschichte São Paulos nimmt die Gewalt so viel Raum ein, dass sie Vergangenheit und Zukunft verdrängt. Da wir nicht zur Seite schauen können, nicht nach vorn und nicht nach hinten, schauen wir auf unsere Füße. Als Lígia zehn Jahre alt war, bestand für São Paulo noch die Chance auf Geschichte. Wir gingen ins Kloster des Heiligen Benedikt, ins Patío do Colégio, den Ausgangspunkt der Stadtentwicklung, ins Museum von Iparanga und auf den Friedhof »Cemitério da Consolação«, aber vor allem konnte Lígia allein zum Bäcker gehen und Brot kaufen. Sie kannte Dona Maria vom Marktstand, Seu Ademar, den Schuhmacher, und spielte mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Ich bin zum Opfer einer städtischen Idylle geworden, und das gefällt mir nicht. Zunehmend glaube ich, dass so etwas möglich ist; auch wenn ich es nicht wahrhaben will und mich mit Lígia deswegen streite. Mit dem Umzug nach São Carlos lasse ich meine Arbeit nicht auslaufen, wie sie behauptet, sondern setze sie fort. An der Universität dort werde ich mich Lucilias Projekt widmen, einer Untersuchung der Schwierigkeiten beim Erlernen von Sprache. Lígia ist der Meinung, ich hätte dem Ruf des Ministeriums für Kultur und Bildung folgen oder zumindest weiterhin in leitender Funktion die Lehrerumschulungen betreuen und den Anfragen nach Vorlesungen und Seminaren nachkommen sollen. Wie gern hätte ich, dass sie mit mir käme. Die dortige Universität hat einen sehr guten Ruf, ihr Ehemann hätte sicher kein Problem, eine Stelle zu bekommen, und meine Enkelin Marta könnte ganz allein Brot für uns kaufen. Jetzt noch nicht, sie ist erst drei, aber ich würde sie mitnehmen, sie würde die Bäckerei kennenlernen, die Nachbarn, würde lernen, auf die Farbe des Himmels zu achten, auf die Winde, die den Regen bringen. Nein, mit Romantik hat das nichts zu tun, da bin ich mir nach den vielen Selbstgesprächen hier in diesem leeren Haus sicher.
Das Haus wurde schließlich verkauft. Für die Übergabe habe ich ein paar Monate Zeit. Einmal mehr sehe ich mir die wenigen Möbel an, die mich begleiten sollen. Nach dem Tod unserer Mutter hatten José, Jussara und Lígia alles mitgenommen, was sie haben wollten. Jussara hatte sich eigentlich nur Kleinigkeiten ausgesucht, das reproduzierte Ölgemälde von dem kleinen malenden Jungen und den Spiegelaufsatz der Kommode, wie so viele aus der Stadt Teodoro Sampaio mit einem hässlichen Mahagoniholzrahmen versehen, der früher mal Vóana gehört und an dem meine Mutter deshalb sehr gehangen und unter den sie immer Zettel mit Erinnerungsnotizen für den kommenden Tag geklemmt hatte. Jussara ist zu einer großen und schönen jungen Frau herangewachsen, viel zu dünn allerdings, kommt mehr nach unserem Vater, und hat trotzdem ein paar Blusen unserer gedrungenen und fülligen Mutter mitgenommen, die sie anziehen will, wenn sie allein zu Hause ist. Ich habe sie nie besucht, sie hat in London eine Familie gegründet, ist eine anerkannte Psychologin, ihre Kinder sprechen Portugiesisch mit britischem Akzent. Aber sie sagt, wenn sie allein zu Hause ist, zieht sie Dona Joanas Blusen an, vor allem aber trägt sie den hellblauen Morgenmantel aus feiner Wolle. Immer wenn ich an Jussara denke, sehe ich sie in diesem Morgenmantel vor mir, den unsere Mutter so oft getragen hat. In meiner Vorstellung muss ich Jussara etwas schrumpfen, ja, kleiner erscheinen lassen, weil der Morgenmantel sonst zu kurz für sie wäre und unschicklich für ein Kleidungsstück von Dona Joana.
Meine Mutter war eine hervorragende Schneiderin. Mit der Zeit hatte sie einen Stamm wichtiger Kunden, Leute, die nicht aus der Nachbarschaft kamen. Wichtig, so nannte sie sie. Und wir verstanden, wen sie damit meinte, was es heutzutage so nicht mehr geben würde. Spräche heute jemand von wichtiger Kundschaft, könnte ich keine Gesichter oder Namen oder Berufe mehr zuordnen. Es waren ganz sicher keine Leute aus unserem Stadtteil. Als ich aufs Gymnasium wechselte, musste ich fortan zwei Busse nehmen und im Zentrum aussteigen, ich verstand, dass es, um wichtig zu sein, nicht ausreichte, aus einem anderen Stadtteil zu kommen. Meine Mutter behandelte alle Kunden gleich, fertigte alle Sachen mit der gleichen Sorgfalt an und hatte feste Preise. Handelte es sich um einen wichtigen Kunden, wirkte sich das einzig auf die Qualität der Stoffe aus, und auf die Geduld, die meine Mutter aufbrachte. Die wichtigen Leute, sagte meine Mutter, wenn sie am Herd das Essen zubereitete, während José und ich am Küchentisch unsere Hausaufgaben machten und Jussara, unser Nesthäkchen, zehn Jahre jünger als José, in der Wiege schlief, sind misstrauischer, erklären jedes noch so kleine Detail, aus Angst, ich könnte die Namen der Modellausführungen nicht kennen. Mutter hatte Verständnis für das Misstrauen, Pfusch sei schließlich überall auf der Welt zu finden und könne an jeder Ecke lauern, Ignoranz habe keine feste Anschrift und auch keinen Zettel an der Stirn, darum hörte sie aufmerksam zu und setzte jeden Wunsch demütig um. Immer wieder kam es vor, sagte sie, dass wichtige Kunden die falschen Begriffe benutzten, einen Plisseerock wollten, aber von einem Faltenrock sprachen, eine Dreiviertel-Länge für die Ärmel wollten, aber von einer halben Länge sprachen. Man darf sie nicht korrigieren, das hat überhaupt keinen Sinn, die Armen, sie sind sich sicher in ihren Fehlern, also muss ich am Stoff zeigen, wie es aussehen würde, das Foto von einem ähnlichen Modell heranziehen, nur so kann ich mit Sicherheit herausfinden, was sie wollen. Aber man muss auch sehen, dass diese Leute keine Möglichkeit hatten, es zu lernen.
Die verstorbene Dona Joana war ein sehr kluger, aber kein sehr ambitionierter Mensch. Dummheit und Ehrgeiz betrachtete sie als angeborenes Fehlverhalten, oder als Eigenschaften, die durch unglückliche Lebensumstände erworben wurden und denen wir mit derselben Geduld und demselben Mitgefühl zu begegnen hatten wie Blindheit und Taubheit.
Armando hat Dona Joana sehr gemocht. Wir sind auf dieselbe Schule und dasselbe Gymnasium gegangen. Zum Mittagessen kam er immer mit zu mir, auch am Abend vor Klassenarbeiten, und an den Nachmittagen hockten wir zusammen und büffelten. Francisco Augusto wurde Armandos Kommilitone an der medizinischen Fakultät. Er ist ein guter Arzt, ob genauso gut, wie Armando einer geworden wäre, bezweifle ich. Mich hat es zur Biologie gezogen, dann zur Pädagogik, dann zur Linguistik und jetzt zieht es mich nach São Carlos. Armando hat sich oft mit meiner Mutter unterhalten. Über Gewürze, Rezepte, kleine Geschichten aus dem Leben der Stadt und ihrer Menschen. Manche Gerichte meiner Mutter bekamen den Beinamen »à la Armando«. Gegeben hatte es sie schon vorher, die Pasta mit Hackfleischbällchen, Sofrito mit Zucchini, Reis aus dem Backofen, ohne Oliven, aber mit echtem Mais, und die Toastschnittchen mit Spinatpaste und klein geschnittenem gekochten Ei, aber jetzt wurden daraus Hackfleischbällchen à la Armando, Reis à la Armando, dieselben Köstlichkeiten wie immer, aber mit einem richtigen Namensgeber. José, Vater, Jussara und ich hatten keine eigenen Gerichte, auch wenn wir sie genüsslich aßen, aber ich glaube, Lob gehörte nicht zu unserem Sprachgebrauch, vielleicht lag es daran. Manchmal wurde ich wegen irgendetwas im Zentrum aufgehalten, was Armando gar nicht recht war; er wollte das Essen von Dona Joana nicht verpassen. Später kannte er den Weg und ging einfach ohne mich. Er sagte, er könne nur mit dem Teck-Tack der Nähmaschine im Ohr richtig gut lernen.
Gesundheitlich geht es mir gut; die Krankheiten, die kommen, verschwinden auch wieder, ganz ohne ständige Medikamente, die Kosten sind niedrig. Unsere Eltern sind verstorben, Jussara steht schon lange auf eigenen Beinen, Lígia und ihr Mann kommen zurecht, Renato gibt es nicht mehr, und damit ist meine Rente mehr als ausreichend. Ich habe kein Auto, für das ich Steuern oder Reparaturen zahlen müsste, auch keine Mikrowelle oder andere unnütze Geräte, nur den Computer, der manchmal muckt, weshalb ich dann den immer verschrobener werdenden Alexandre, Enkel der früheren Nachbarin Dona Eulália, kommen lassen muss, der fast immer vergisst, etwas für seine Dienste zu nehmen. Am Haus gibt es immer irgendwas zu tun, mal ist es ein geplatztes Rohr, mal eine kaputte elektrische Leitung, mal die Tür, die knarrt und nicht mehr richtig schließt. Aber das geht schon, ich habe eine Absprache mit Tobias, der alles repariert und nicht sehr teuer ist. Er liegt mir ständig in den Ohren, das Haus brauche eine Generalüberholung, neue Rohre, neue Elektrik und tausend Dinge mehr. Ich habe mich in diesen dreißig Jahren, seit ich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis und nach Elianas Tod wieder hier eingezogen bin, immer tapfer dagegen gewehrt. Anfangs hat mein Vater mich noch kräftig unterstützt, aber nach seinem Tod musste ich dann allein weiterkämpfen. Lígia, Jussara und Mutter haben sich auf Tobias’ Seite gestellt und wollten immer alles auswechseln, umbauen, neu gestalten, aber mein Team hat gewonnen, und das Haus darf in Würde alt werden. Jetzt fällt alles in die Hände einer Baufirma, wie auch schon die Nachbarhäuser, und demnächst werden hier viele Familien leben, einschließlich Lígia und ihrer Familie. Meinen Anteil vom Verkaufserlös habe ich in eine Wohnung für sie gesteckt, und der Rest hat für ein kleines Haus mit Garten in São Carlos gereicht.
Vor ein paar Tagen war José hier; er hat drei Nächte lang in unserem früheren Zimmer geschlafen. Und ich in dem Zimmer, das unseren Eltern gehörte. Er war hier, um mit seinem Verleger und den Leuten von der Zeitung und der Fachzeitschrift zu sprechen, für die er schreibt. Den letzten Abend hat er sich für ein gemeinsames Essen mit mir freigehalten. So hat er es angekündigt, den Freitag halte ich mir frei, damit wir zusammen essen können, hast du da schon was vor? Ich habe nur vor zu schlafen, sonst nichts, der Herr, antwortete ich wie ein einfacher Geschäftsmann aus dem Viertel auf seine Anfrage, die wie die eines wichtigen Geschäftsmanns klang. Das fand er lustig, er weiß, dass ich zu faul bin, abends noch auszugehen, und er weiß um meine unchristlichen Aufstehzeiten. Am Mittwoch und am Donnerstag haben wir uns so gut wie gar nicht gesehen. Er hat immer noch den Schlüssel zum Haus, weiß, wo er Bettzeug und Handtücher findet, und auch wenn er sich darüber mokiert, kommt er doch sehr gut mit den umfunktionierten Marmeladengläsern zurecht, dem zusammengewürfelten Geschirr und dem verbogenen Besteck. Obwohl es der letzte Monat war, den ich Umschulungskurse für Lehrer gab, musste ich noch immer zu den Besprechungen für die Vorbereitung des kommenden Semesters im Ministerium erscheinen und an den akademischen Feierlichkeiten teilnehmen. Es waren Tage des Abschieds und der Abschiedsveranstaltungen, als läge São Carlos auf einem anderen Planeten, einem Planeten, dessen runzlige Einwohner, die sich dorthin zurückgezogen hatten und der Hektik São Paulos entflohen waren, in den Reden zu ihren Ehren nicht länger das Tempus Präsens verdienten. In den Huldigungsworten triumphierte das Präteritum, und jedes Mal ging ich zorniger davon, als ich gekommen war. Diese Beerdigung zu Lebzeiten behagt mir ganz und gar nicht. Es ist eine elegante und effiziente Art zu überhören, was ich sage, und mit verzerrtem Blick zu lesen, was ich geschrieben habe. Wie sollte ich mit den Umschulungskursen für Lehrer weitermachen, wenn doch wir es sind, die Umschulung und Umdenken nötig hätten? Ich glaube nicht länger an das alles, nicht mehr. Aber lieber Herr Professor, mit diesem Stimmchen grausigen Respekts, das ich unerträglich finde, aber lieber Herr Professor, das ist das, was möglich ist. Ich glaube, ich bin des Möglichen überdrüssig, es interessiert mich nicht mehr. Aber wie dem auch sei, mit meinem Umzug schließe ich etwas ab, das ist definitiv ein Ende. Irgendetwas töte ich auf jeden Fall, was auch immer es sein mag, vielleicht den Ehrgeiz, der mir trotz Dona Joanas gegenteiligen Bemühungen durch unglückliche Lebensumstände eingeimpft worden ist.
Am Freitag bin ich sehr früh zur Universität gefahren, um meine Sachen aus dem Seminarraum abzuholen, die benoteten Arbeiten der ewigen Nachzügler abzugeben, die notwendigen bürokratischen Unterschriften für die endgültige Abwicklung zu leisten und mit Teresa zu Mittag zu essen. Als ich ganz früh am Morgen das Brot und die Zeitung auf den Küchentisch legen wollte, eine schon völlig automatisierte Handbewegung, auf die immer folgt, dass ich mich zum Herd drehe, einen Topf nehme, ihn mit Wasser fülle, auf die Herdplatte stelle etc., bin ich gegen den Tisch geknallt, Brot und Zeitung sind auf den Tisch geknallt, und zwei Tassen wären fast zu Bruch gegangen, zwei Untertassen und zwei kleine Teller von dem alten Geschirr, das wir früher zu Hause benutzt haben und das José mitgenommen hat, als es nach Mutters Tod aufgebaut auf weißen Tischtüchern stand. Auf dem Küchentisch war noch etwas, eine Vase mit Blumen aus dem Garten und ein Päckchen in goldenem Einpackpapier mit einem kurzen Brief von meinem Bruder. Ich sah mich instinktiv um, ob das hier auch das richtige Haus war. Dann ärgerte ich mich über dieses Eindringen in meine morgendliche Kaffeestunde, Kaffee aus dem Glas, im Topf gesüßt, dazu ausgehöhlte Baguetteschiffchen mit Butter und lauter Krümel auf dem alten Küchentisch. Im kriegsähnlichen und verwirrten Zustand dieser letzten Tage, wie so viele um mich herum sie nannten, habe ich den ganzen Kram in eine Ecke geschoben, mein Glas genommen, mein Brot zerkrümelt und meine Zeitung gelesen. Naheliegenderweise die Sportseiten, eine von Armandos Angewohnheiten, die ich erst in den letzten Jahren übernommen habe, als wäre es schon immer meine gewesen. Das Päckchen meines Bruders José warf ich aufs Bett und den Brief nahm ich mit, um ihn auf dem Weg zur Universität im Bus zu lesen.
Meine, mein, meine, wie ein kleines Kind, das die Sprache des Stammes lernt, befinde ich mich in der Phase des Spracherwerbs, wo in der alten, die ich kann und verwendet habe, die Wörter unfruchtbar geworden sind, wie mir scheint, als hätte man sie zur Diskussion gestellt, dann angenommen und in etwas umgewandelt, das ich nicht länger wiedererkenne. Darum mein Glas, mein Brot, meine Wut, meine vierundsechzig Jahre. Als müsste ich alles, was ich mitnehme, erneut benennen und in Besitz nehmen. Als müsste ich zur ersten Person zurückkehren und zum Possessivum, den zwei Plagen der Jugendzeit, unseren Vermächtnissen der Moderne, gegen die ich mich ernsthaft wehrte. Auch in Josés Brief ist von dieser Notwendigkeit die Rede, aber was er damit verbindet, ist das völlige Gegenteil dessen, was ich empfinde. Er spricht vom Gedenken, ich vom Erschaffen; er denkt ans Entdecken, ich brauche das Vertiefende. Der Brief hat mir Ruhe geschenkt und mich von dieser kindischen Entrüstung der letzten Tage befreit, die mich bedenkenlos mitgerissen, jedes Reflexionsvermögen ausgeschaltet und mich als Waise in den Händen reinen Reagieren-Könnens zurückgelassen hatte. Der an Machado erinnernde Ton des Briefs, den José auf eine paradox persönliche Weise derart kultiviert, dass es an Plagiat grenzt, ließ meine Freude wieder aufleben, eine Freude, wie man sie empfindet, denkt man gerade angestrengt über das Besondere einer Komposition nach und wird plötzlich vom Gesang eines Vögelchens überrascht. Vielleicht hat der kleine Vogel schon lange gesungen; vielleicht hat sein Gesang unbemerkt einen Umschwung unserer Gedanken bewirkt, nur dass wir ihn erst jetzt wahrnehmen, er sich uns im selben Moment offenbart wie die unerwartete Freude, ihn zu hören. Das Vögelchen reißt uns aus unseren Gedanken, zerstört spurlos den mühsam von uns gesponnenen Faden und überlässt uns einzig der Freude, ein Vögelchen zu hören. Wenn unsere Freude und der verlorene Faden uns dann bewusst werden, wir weiterarbeiten und resigniert seufzen, präsentiert sich uns nicht selten die Lösung, deutlich und unverhofft wie der Gesang. Bei José heißt es: »Das tue ich, indem ich die Erinnerungen und eine Konstruktion oder Dekonstruktion meiner selbst zulasse« (Machado frei nach José).
Erinnerungen zulasse, wie schön formuliert. Ich muss endlich wieder Machado lesen und mir das Überraschende, das mir selbst nicht mehr widerfährt, erneut zu eigen machen. Anders als José, der genau wie Dom Casmurro versucht, sich eine Vergangenheit zu konstruieren, die sich ihm in der Gegenwart gefügig macht, suche ich nach meinen Fehlern, räume weg, was im Weg ist, zertrample Schaben, habe Spinnweben im Gesicht, und bei jedem erhaben herumstehenden Erinnerungsstück frage ich mich, nützt du mir noch?, hast du dich gut gehalten, strahlst du Licht aus, machst du Geräusche, nützt du zumindest noch als Pfeiler, um den zu stützen, der dich gemacht hat, oder wurdest du schon von meiner Zustimmung zerfressen und jede kleinste Bewegung stürzt dich hinab in den schlammigen und sanft dahintreibenden Fluss der Zufriedenen?
Das goldglänzende Päckchen auf meinem Bett enthielt die ersten Kapitel von Josés neuem Buch, laut seinem Brief der erste Band eines autobiographischen Zyklus, der erste Band, den ich bekam, bevor er überhaupt fertig war, und zu dem er mich um meine Meinung bat. Seine Bitte war nicht nur schön formuliert, sondern auch ehrlich, was mich berührte, aber ich musste doch schmunzeln. José hatte sich und unsere Familie von Anfang an exponiert, gleich mit dem ersten Buch, dem experimentelleren, das mir am besten gefiel. Keines der anderen ist wirklich schlecht, jedes hat seinen Charme und seine Tiefe, aber die verschiedenen politischen und historischen Stile, mit denen er experimentiert hatte, ja selbst seine kritischen Essays hatten immer etwas Vorhersehbares, an dem ich mich störte. Ich weiß, worauf er abzielt, denn im Grunde sind es lange Erklärungen, in denen seine Sexualität eine jedes Mal größere Rolle spielt. Aber der Brief hat mich berührt. Ich glaube, es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass mein Bruder mich direkt um etwas bittet. Auch in seinen schwersten Stunden hat er uns nie um etwas gebeten und uns nie die Möglichkeit gegeben, ihm zu helfen. Er hat schon sehr früh im Ausland gelebt, ist oben in Bahia einer der Hippies von Arembepe gewesen, hat im zentralen Hochland ein UFO gesehen, war Rucksackreisender im peruanischen Machu Picchu und Drogensüchtiger in Kalifornien, und wie mancher, der spät noch zum Glauben findet und konvertiert, ist er erst spät Akademiker geworden, ein Meister schöngeistiger Literatur, hat ein Stipendium für Deutschland bekommen, dann eins für Spanien und sich schließlich in Curitiba niedergelassen. Nach Vaters Tod hat er uns häufiger besucht, und als unsere Mutter vor fünf Jahren krank wurde, ist er bei uns eingezogen und hat sie die letzten zwei Monate vor ihrem Tod gepflegt. Man kann schlecht von einer Aussöhnung sprechen, da es eigentlich nie einen Streit gegeben hatte, Wiederbegegnung ist wohl eher das richtige Wort, wenn man auch Josés Sicht berücksichtigt.
Ich, der ich praktisch mein ganzes Leben mit Dona Joana unter einem Dach gelebt habe, hätte ihr gar nicht wiederbegegnen können. Genau genommen hätte auch unsere Mutter José nicht wiederbegegnen können, denn der Sohn, der mit siebzehn Jahren das Haus verlassen hatte, war fern ihren Blicken durch so viele Transformationen gegangen, dass die Zuneigung meiner Mutter für diesen herangereiften Mann viel eher von der Art war, wie man sie dem Freund des eigenen verstorbenen Kindes entgegenbringt, der uns durch seine Gegenwart, sein Alter und seine Geschichten an das geliebte Kind erinnert, das nicht mehr da ist. »Die Tassen«, heißt es im Brief weiter, »gehören zu dem Spiel, das wir als Kinder gespielt haben, und zu dem, was mir bei der Aufteilung des Erbes zugefallen ist. Ich musste an all das denken, was diese Gegenstände für mich besonders wertvoll gemacht hat, und an meinen Wunsch, mit dir, meinem älteren Bruder, zu teilen, was die Zeit auf uns verteilt hat, aber all das wird dich zutiefst verärgern, auch wenn es ehrlich ist. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, was du über Gegenstände als Erinnerungsträger denkst, ich kenne deine Abneigung gegenüber Plunder aller Art und deine Vorliebe für Kaffee aus Marmeladengläsern. Ich bitte dich nur, die Tassen anzunehmen, denn dieses Geschenk ist verbunden mit meiner aufrichtigen Zuneigung.«
Ich habe Teresa fürs Mittagessen zugesagt, weil ich sie in vielerlei Hinsicht mag, was meiner Meinung nach auf Gegenseitigkeit beruht und dazu führt, dass wir selbst in akademischen Belangen angeregt zu einem Einvernehmen finden. Diesmal wollten wir am Jahresende noch einmal nett zusammensitzen, ganz ohne etwas besprechen zu müssen. Wir hatten verabredet, uns im Café der Fakultät zu treffen und dann irgendwo in der Nähe gut und lauschig essen zu gehen. Teresa brachte eine junge Frau mit, anscheinend eine ehemalige Studentin von mir. Ich kann mich nicht an sie erinnern, nur daran, dass sie reizend war, aber das waren so viele. Also, ich meine, es waren so viele Studenten in all diesen Jahren. Ihr Name ist mir schon wieder entfallen, etwas wie Ercília oder Marília. Sie schreibt an einem Roman, der in den Sechzigern und Siebzigern spielt, Jahren, in denen sie noch ein Kind war, und sie will mich zu dieser Zeit befragen. Sie hat schon andere interviewt, Teresa hat mich vorgeschlagen. In der momentanen Fassung habe ihre Hauptfigur ungefähr mein Alter, sei verhaftet worden und arbeite als Lehrer. Was ihr fehle, seien Informationen über diese Zeit, über das Schulsystem, den Alltag an staatlichen Schulen, das Gefängnis. Meine Bücher habe sie gelesen, sagte sie, ich glaube, sie ist Pädagogin oder Anthropologin, so genau habe ich das nicht verstanden. Sie habe nicht gewusst, dass ich verhaftet worden und in den politischen Bewegungen aktiv gewesen sei. War ich auch nicht, sagte ich. Aber Teresa verzog das Gesicht, als hätte ich mich soeben bescheuert verhalten oder täte übertrieben bescheiden. Ich wollte Teresa nicht verstimmen, war aber verärgert. Das merkte die junge Frau, und es erschreckte sie; sie ist interessant. Damit meine ich – gar nichts meine ich damit, sie ist genau das, hübsch, ernst und ihre Neugierde ist überhaupt nicht naiv. Teresa ermunterte sie schließlich, doch etwas mehr von ihrem Buch zu verraten. Die junge Frau hat vor kurzem an einer staatlichen Schule angefangen und ist erschüttert von der »aggressiven Leere«, die sie unter den Lehrern spürt. In ihrem Roman möchte sie über eine Zeit sprechen, in der Bildung die Bedeutung einer Sprengkapsel, einer Explosion gehabt zu haben scheint, eine Zeit, die mit ihrem Ende auch all das mitgerissen hat. Sie hat schon eine Menge Bücher gelesen, über die Geschichte des Bildungswesens, die staatliche Repression und die Widerstandsbewegungen, hat Filme gesehen, Musik gehört, sagt aber, sie bräuchte diese Interviews mit realen Personen, da es in ihrem Buch nicht um Politik gehe, nicht um Bildung, sondern um etwas, das noch nicht einmal sie selbst ganz verstanden habe. Irgendwie missbraucht sie mich, diese junge Frau. Ich weiß ganz genau, wovon sie spricht, denn ich habe das schon oft gemacht, und es gefällt mir überhaupt nicht, als Rohstoff herhalten zu müssen.
Aber in dem Moment konnte ich dem Ganzen etwas abgewinnen; dieser Schamlosigkeit, von meinem Leben wissen zu wollen, etwas so Transparentes und Utilitäres. Sie sagte, sie bräuchte Vokabular aus dieser Zeit, Details und Feinheiten, die sie in Büchern nicht gefunden hätte. Soweit ich verstanden habe, bewundert sie meine Anschauungen, aber um diese geht es ihr nicht, fast so, als wäre dieser Teil gar nicht wichtig. Sie will mein Alter. Sie schnüffelt nach Überbleibseln dieser Jahre in der heutigen Sprache alter Männer. Sie war ein trojanisches Pferd, dieses Geschenk von Teresa. Und sie gingen mir nicht aus dem Kopf, die junge Frau und ihr Interview. Sie hat meine Telefonnummer, hat aber noch nicht angerufen. Ich hoffe, sie ruft nicht an, es ist ein schlechter Zeitpunkt, dieser jetzt. Ich hatte zu ihr gesagt, ich könne mich an fast nichts erinnern, und sie hatte gesagt, sie wolle auch das, diese Erinnerungsscherben, das Gewirr dessen, was mit Abstand betrachtet übrig geblieben ist und inmitten der angesprochenen aggressiven Leere verschwindet.
Vor dem Interview würde sie gern etwas Aktuelles von mir lesen, sagte sie, und Teresa sprach von den Berichten und Briefen, die ich kurz zuvor an das Ministerium für Kunst und Bildung geschickt und in denen ich mich auf unverschämte Weise zu den aktuellen Entwicklungen im Bildungssystem geäußert hatte. Letztlich versprach ich, sie der jungen Frau zu schicken, auch wenn es sich dabei nicht um öffentliche Dokumente handelte. Wie hieß sie nur? Josefina, Maria? Auf keinen Fall rufe ich Teresa an und frage nach. Wenn die junge Frau anruft, wird sie ihren Namen schon sagen. Das ist wirklich unangenehm, wenn man anfängt, unmittelbar Vergangenes zu vergessen. Irgendwo habe ich mir ihre E-Mail-Adresse aufgeschrieben, aber sie enthält nur die Initialen. Die habe ich mir aufgeschrieben, um ihr diese Brief-Berichte zukommen zu lassen, aber bislang hatte ich keine Zeit dafür.
Ich bin unorganisiert und vergesslich, weshalb ich eine recht zielstrebige Arbeitsweise entwickelt und mir auferlegt habe, der ich nicht entfliehen kann, wodurch ich zu einer scheinbar pünktlichen Person geworden bin, ordentlich und verantwortungsbewusst. »Scheinbar« ist das richtige Wort, allerdings ohne die Konnotation der Falschheit, die mit oberflächlichem oder unvollständigem Wissen verbunden ist und aus ihr resultiert. Dieses Wissen ist scheinbar nobel, aber wenn wir es ganz genau durchschauen, sieht es anders aus. Was ich eben gemacht habe, das wäre eine gute Art, Portugiesisch zu unterrichten. Zufällig ein Wort herauszugreifen, eins, das in einem trivialen Gespräch im Unterricht auftaucht, wenn gerade, ja, wenn scheinbar nicht unterrichtet wird. In einem dieser unzähligen Augenblicke, da die Lehrerin etwas über ihren Mann sagt, oder gegen die Regierung, oder wenn ein Schüler etwas – aber nein, ein triviales Gespräch, das vom Schüler ausgeht, wird ja doch eher selten gestattet. In solchen Augenblicken können wir das Gespräch unterbrechen und die Aufmerksamkeit auf das verwendete Wort lenken. Auf jenen Gesang des Vögelchens. Oder auf das Erscheinen des Pfarrers in der Kirche, die wir nur betreten haben, um uns die Buntglasfenster anzusehen. Jener Augenblick, da sich uns in dem, was wir tun, in dem Objekt, das wir betrachten, den Gegenständen, die wir benutzen, eine andere Dimension zeigt. Der Wert des Fehlers, genau darin liegt der Wert des Fehlers. Ja, denn der Vogelgesang, der die Kant-Lektüre stört, ist sehr wohl ein Fehler, genauso wie ein Pfarrer aus Fleisch und Blut, der plötzlich neben einem steht, wenn man sich gerade über das Barocke der Kirche auslässt, ein Fehler ist. Er reißt uns aus unseren Gedanken, lenkt uns ab. Aber auf eine gewisse Weise gibt uns die Magie des Fehlers etwas zurück. Als hätte man sich verlaufen, als sei man plötzlich in der falschen Straße gelandet. Erst dann halten wir an, um unseren Blick zu weiten, uns den Verlauf der Straßen und ihre Lage zueinander vor Augen zu führen, und entdecken den interessantesten Weg, der vielleicht der kürzeste ist, oder auch nicht. Die Lehrerin verwendet also das Wort »scheinbar« auf eine ungewöhnliche Weise, hält inne und sagt, wie merkwürdig, normalerweise verwenden wir scheinbar, um etwas zu beschreiben, das nicht stimmt und dem äußeren Eindruck nach etwas zu sein scheint, das es eigentlich nicht ist; genau genommen können wir es auch verwenden, wenn uns eine bestimmte Sache so zu sein scheint, auf eine ganz bestimmte Weise, und eben das die einzige ist, die wir kennen, die Art und Weise, wie uns die Dinge zu sein scheinen. Da wir uns nicht sicher sind, ob die Weise, die Sache zu sehen, weiter so bleiben wird, wie wir sie jetzt sehen, und andererseits vielleicht mutmaßen, sie könne sich ändern, sagen wir also scheinbar