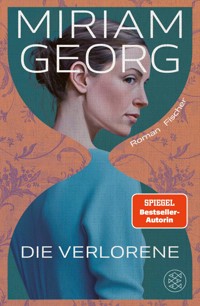
12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vergessener Gutshof, eine verhängnisvolle Liebe, eine junge Frau auf der Suche nach ihren Wurzeln: Der neue Roman von Bestsellerautorin Miriam Georg (»Elbleuchten«) Laura ist schwanger. Ein Wunschkind. Warum kann sie sich nicht freuen? Als ihre geliebte Großmutter Änne schwer erkrankt, merkt Laura, wie wenig sie über ihre eigene Familiengeschichte weiß. Auf der Suche nach Antworten fährt sie zum ehemaligen Gutshof ihrer Familie und taucht immer tiefer ein in die Vergangenheit. Und plötzlich geht es nicht mehr nur um Fragen nach dem Früher, sondern auch um Lauras eigenes Glück. Über sieben Jahrzehnte zuvor: Die Dachkammer des Gutshofs ist Ännes ganze Welt. Frei bewegen kann sie sich nur nachts. Bis die Begegnung mit Karl ihr Leben und das ihrer Lieben ins Wanken bringt ... »Eine berührende Familiengeschichte über mehrere Generationen, die von Frankfurt nach Schlesien führt und immer wieder die Frage aufwirft: Wie viel wissen wir eigentlich wirklich über unsere eigene Familie?« Katharina Mahrenholtz Lesegenuss pur in einem Einzelband
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Miriam Georg
Die Verlorene
Über dieses Buch
Sie hatte von den Sommern erzählt, von den Pferden am Fluss, vom Rauschen der Pappeln. Aber mehr von ihrer schlesischen Vergangenheit wollte Änne ihrer Tochter Ellen und ihrer Enkelin Laura nie verraten. Als Änne ins Koma fällt, reißt das ein Loch in Ellens und Lauras Leben. Auf einmal scheint es zu spät für all die Fragen, die jahrzehntelang unausgesprochen geblieben sind. Dann macht Laura eine Entdeckung, die ein ganz neues Licht auf das Leben der Frau wirft, die sie so gut zu kennen glaubt. Sie begibt sich auf die Suche nach dem ehemaligen Gutshof ihrer Familie - und stößt nicht nur auf Wahrheiten, die ihr Bild von Änne erschüttern, sondern auch auf neue Fragen, die noch tiefer in die Vergangenheit ihrer Familie führen. Fragen, deren Antworten alles verändern könnten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Miriam Georg, geboren 1987, schrieb sich mit den Hamburg-Dilogien »Elbleuchten«, »Das Tor zur Welt« und »Im Nordwind« an die Spitze der Bestsellerlisten. Für ihren neuen Roman hat sie sich von ihrer eigenen Familiengeschichte und ihrer Ausbildung zur Systemischen Therapeutin inspirieren lassen. Sie hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur und lebt mit ihrer gehörlosen Hündin Rosali in Berlin-Neukölln. Auf Instagram ist sie unter @miriam_georg zu finden.
Impressum
Hinweis:
Dieser Roman thematisiert Traumata im Kontext der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs, unter anderem in Schlesien und auf der Krim. Und was ihre Aufarbeitung noch Generationen später bewirken kann.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 Miriam Georg
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Hanne Reinhardt
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Schmidt.
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
ISBN 978-3-10-491971-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Teil 1
Frankfurt 2019
Die Krim 1941
Frankfurt 2019
Schlesien 1943
Frankfurt 2019
Frankfurt 2019
Die Krim 1941
Frankfurt 2019
Die Krim 1941
Frankfurt 2019
Schlesien 1943
Frankfurt 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1943
Schlesien 1943
Teil 2
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1944
Schlesien 1944
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1945
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien 1945
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien | Śląsk 1946
Schlesien | Śląsk 1946
Schlesien | Śląsk 1946
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien | Śląsk 1946
Schlesien | Śląsk 2019
Schlesien | Śląsk 1947
Schlesien | Śląsk 2019
Epilog
Nachwort
Danksagung
Für Karl Alexander Georg, meinen Großvater
Vielleicht ist es so, dass die Träume in den Saum hinter den Dingen wandern und von dort unerkannt wiederkommen und dann Namen erhalten und Leben heißen.
Karl Georg
Prolog
Das Atelier roch nach Holz. Draußen schien eine goldene Maisonne auf den Hof, drinnen ließ sie Schatten über die Dielen tanzen. Er kam nicht mehr oft hier hinein, zu viele Erinnerungen an ihr altes Leben hingen zwischen den Wänden. Die staubigen Pinsel warteten in ihren Gläsern, auch den Farben und Leinwänden sah man an, dass sie nicht mehr benutzt wurden. Auf der Leiter, die zu dem Alkoven hinaufführte, in dem einst die Knechtkammern untergebracht waren, stand ein vergessenes Rotweinglas. Früher hatten sie dort oben manchmal zusammen gelegen, durch das Fenster in den Himmel geschaut, geredet, die Zeit verstreichen lassen. In diesen Momenten hatte es nur sie beide gegeben und dieses Gefühl von Zukunft, das alles durchströmte.
Wenn er daran dachte, wie jung sie einmal gewesen waren, schien es ihm beinahe absurd. Das Alter nahm einem so vieles. Vor allem nahm es einem die Zeit. Er fühlte sich ständig gehetzt, seit Jahren. Wie sagte seine Frau doch immer? Einmal noch. Einmal noch in den Urlaub, einmal noch Schweden sehen, einmal noch …, bevor es zu spät war. Aber sie waren alt, für vieles war es bereits zu spät. Der letzte Urlaub war gekommen und gegangen, ohne dass sie ihn als den letzten benannt hatten. Und doch hatten sie es beide gewusst.
Langsam drehte er sich um sich selbst, die Daumen in die Hosenträger verschränkt. Irgendwo klapperte Geschirr, es roch nach Petersilie und Kartoffeln, sicher hatte Annette schon mit dem Abendessen begonnen. Die Fenster, vor denen er stand, waren hoch und geschwungen. Ursprünglich hatte es hier nur kleine, glaslose Vierecke in den Wänden gegeben. Sie hatten die Decke des Stalls durchbrochen, die alten Knechtkammern auf dem Heuboden entfernt, Licht hereinfluten lassen. Er liebte diesen Raum. Diese Stille. Die Inspiration, die man in der Luft fühlen konnte. Und natürlich hatte man hier den besten Blick auf das Haus.
Das Haus. Nicht nur durch die Fenster war es zu sehen, auch auf vielen der Leinwände, die sich an den Wänden stapelten. Im Winter von Schnee bedeckt, im Sommer hinter Efeu verborgen, der Backstein rot glühend in der Abendsonne, die gelben Pirole helle Farbtupfer in den Pappeln. Auf jedem Bild waren die Fenster erleuchtet, aber nie sah man Menschen. Was man hingegen deutlich sehen konnte, war der Verfall. Mehr als alles andere dokumentierten die Bilder Vergänglichkeit. All die verflossenen Jahre.
Eine seltsame Rührung überkam ihn. Nun war es endgültig vorbei mit dem Malen. Und wenn die neuen Pächter nicht ein Wunder vollbrachten, irgendwann auch mit dem Haus. Ein Blick aus dem Fenster machte es deutlich; der Hof stand kurz davor, eine Ruine zu werden. Genau wie er selbst.
Auf der anderen Hälfte der Bilder war eine Frau zu sehen. Im Gegensatz zum Haus war sie jung geblieben. Eines der Gemälde hatte er immer besonders gemocht. Acryl auf Leinwand, Farben wie ein Gewitter. Er hatte einmal vorgeschlagen, es aufzuhängen, aber natürlich hatte er, bereits während er die Worte aussprach, gewusst, wie falsch sie waren. Das Bild stand auf einer Staffelei, seit Jahren, schon immer, wie es schien. Langsam ging er näher heran, betrachtete ihr Gesicht. Dieses Gesicht, das ihm so vertraut war. Das er so liebte.
Die Frau auf dem Bild saß vor einem Spiegel. Aber während sie ruhig, beinahe abwesend lächelte, war ihr Ebenbild verzerrt vor Trauer. Es streckte ihr die Hände entgegen, als wolle es durch das Glas nach ihr greifen.
Der Anblick des Gemäldes tat weh. Dass man einem Menschen alles geben konnte und trotzdem nicht genug war …
Sie würden die meisten der Bilder spenden. Es war besser, das nicht mehr weiter aufzuschieben, Abschied war immer schwer, man durfte das nicht anderen Menschen überlassen, er musste es jetzt regeln, da er es noch selbst konnte.
Annette hatte die gefalteten Umzugskartons gegen die Tür gelehnt. Natürlich hatte sie angeboten zu helfen, aber er wollte das alleine schaffen. Einen Karton nach dem anderen setzte er ordentlich zusammen, reihte sie auf dem Boden auf. Methodisch und langsam, wie er alles tat, begann er, die Sachen hineinzuordnen, die Dosen, die Farben, die Mischflaschen. Er nahm die Pinsel aus den Gläsern, fühlte kurz über ihre weichen kleinen Enden, verabschiedete sich Stück für Stück von einem Leben, das bald zu Ende sein würde. Es auf gewisse Weise bereits war. Tatsächlich genoss er es, hier zu sein, auch wenn es keine schöne Aufgabe war. Die Ruhe, die Sonne im Nacken. Wer wusste schon, ob es ihr letzter Sommer sein würde. Einmal noch …
Als er alle Farben und Pinsel eingeräumt hatte, machte er sich an die Schubladen des Regals. Hier war seit Jahrzehnten alles nur hineingestopft worden, Dokumente, Briefe und Büromaterial, alles stapelte sich wild übereinander. Besser direkt kurzen Prozess machen. Nichts hier drin war von Wert.
Einem Impuls folgend, zog er die erste Lade ganz heraus und stellte sie auf den Tisch. Ein Blatt Papier segelte durch die Luft. Es musste hinter dem Schubfach verkeilt gewesen sein. Lautlos fiel es zu Boden und glitt unter das Regal.
Er zögerte. Mit seinen Knien war jedes Bücken eine Qual. Aber er konnte schlecht nach Annette rufen, damit sie ihm etwas aufhob, das direkt vor seinen Füßen lag. »Gut, dann also los!« Er wappnete sich, ging in die Knie und angelte nach dem Papier. Seine Gelenke knackten alarmierend. Beinahe hätte er den Zettel einfach achtlos zu den anderen Sachen in den Karton gelegt. Beinahe wäre es ihm entgangen.
Doch sein Blick blieb an etwas hängen. Etwas, das trotz der Sonne in seinem Nacken Kälte durch ihn hindurchjagte.
Ein Name.
Eine Weile starrte er auf die Buchstaben, bis ihm wirklich, in aller Konsequenz, bewusst wurde, was er da vor sich hatte. Dann fuhr er herum. Er stolperte durch die Diele in die Küche.
Annette schüttete gerade die Kartoffeln ab. Als er hereinkam, den Zettel in der Faust erhoben wie eine Anklage, drehte seine Frau überrascht den Kopf.
»Du hast es all die Jahre gewusst.« Seine Stimme bebte vor Zorn. Vor Fassungslosigkeit. »Du hast all die Jahre gewusst, wo sie ist.«
Teil 1
Frankfurt 2019
Als Änne fiel, wusste sie, dass sie sterben würde. Der Hocker wackelte erst bedrohlich, dann kippte er, ihre Füße verloren den Halt, die Arme ruderten in der Luft. Noch bevor der erstaunte Schrei aus ihrer Kehle dringen konnte, nahm ihr der Aufprall den Atem. Sie war zu alt, um sich abzurollen, knallte wie ein Stein auf den Boden, erst der Körper, dann, mit einem dumpfen Laut, der Kopf.
Sie starb nicht. Nicht sofort. Sie lag auf dem Teppich des Hauses, in dem sie die letzten sechzig Jahre gelebt hatte, und wusste weder, wer sie war, noch, wie sie hieß. Gesichter huschten vorbei, Gelächter, Stimmen. Sie nahm es wahr, aber sie fühlte keinen Schmerz, keine Angst, es war, als würde in ihrem Kopf Schnee fallen. Das Leben sickerte aus ihr heraus, und eine kühle Decke aus Nichts legte sich über sie, schluckte ihre Gedanken. Dann waren da plötzlich Bilder. Eine Mühle im Wald. Pappeln im Wind. Pferde, die im Fluss badeten. Ein junger Mann. Und ein Mädchen.
Eine Welle aus roher Sehnsucht schwappte über sie. Nur einmal noch, dachte sie, als die Bilder verschwanden und die Dunkelheit kam. Dann waren auch die Wörter weg. Und mit ihnen die Sehnsucht.
Laura stand vor der Apotheke, als ihr Handy klingelte. Die Plastiktüte mit ihren Einkäufen in der einen Hand, den tropfenden Regenschirm in der anderen, wühlte sie in ihrem Rucksack, in Gedanken bei dem, was zu Hause auf sie wartete. Als sie das Handy endlich in einer Seitentasche fand, hüpfte der Name ihrer Mutter auf dem Display auf und ab. Sie überlegte kurz, ob sie einfach später zurückrufen sollte. Aber wenn man Ellen ignorierte, wurde sie nur immer beharrlicher.
Es dauerte einen Moment, bis die Bedeutung der Worte zu ihr durchdrang. »Laura, hast du gehört?«, rief ihre Mutter, als sie nicht antwortete.
Die Tüte rutschte ihr aus der Hand, fiel auf das nasse Kopfsteinpflaster. »Natürlich«, erwiderte sie, während sie sich bückte und hastig die kleine Pappschachtel aufhob. »Oh Gott, natürlich, ich komme.«
Das Handy am Ohr drehte Laura sich um, blickte über die nasse Fußgängerzone, wie leergefegt an diesem grauen Vormittag, bis auf einige wenige Kaufwütige, die sich vom schlechten Wetter nicht vertreiben ließen. »Welches Krankenhaus?« Sie hatte keine beruhigenden Worte. Sie war nicht gut im Beruhigen, und sie wusste ja auch nicht, was eigentlich geschehen war. »Gefallen«, hatte ihre Mutter ins Telefon gerufen. »Vielleicht die Epilepsie … Gefunden von der Nachbarin … Notarzt. Bewusstlos.«
Lauras Hals fühlte sich an wie zugezogen. »Ich fahre sofort los«, versicherte sie noch einmal.
»Beeil dich!« Ihre Mutter legte auf, ohne sich zu verabschieden.
Der Taxifahrer lächelte sie im Rückspiegel an. »Anschnallen, bitte!« Sein Blick glitt zu der Apothekentüte in ihren Händen, und mit einem seltsamen Gefühl der Scham, über das sie sich ärgerte, stopfte sie die Tüte in ihren Rucksack und zog den Gurt aus der Halterung.
Frankfurt war wie immer viel zu voll, sie brauchten fast eine halbe Stunde für den Weg. In der Schlange an der Rezeption verfolgte Laura mit einem brennenden Gefühl im Magen den Zeiger der Uhr, der von 11.32 Uhr auf 11.54 Uhr wanderte, bis man ihr sagte, wo sie hinmusste.
»Endlich!« Die Stimme ihrer Mutter empfing sie, als sie im zweiten Stock aus dem Aufzug stolperte. Laura hatte den Blick an die Decke gerichtet, auf der Suche nach Schildern, die ihr den Weg weisen würden, und zuckte zusammen, als Ellen unvermittelt vor ihr stand.
»Es tut mir leid. Der Verkehr war schrecklich, und dann musste ich unten …«
Ihre Mutter ließ sie nicht ausreden. »Egal, jetzt bist du ja da.«
»Wie geht es ihr?« Laura versuchte, mit Ellen Schritt zu halten, die sie den Flur hinunterzog, und gleichzeitig ihren Schal in den Rucksack zu stopfen. Sie hatte Angst vor der Antwort.
»Mama ist noch nicht aufgewacht.«
Und warum hetzt du mich dann so, dachte sie ärgerlich, fühlte im selben Moment eine Explosion von Schuld und Erleichterung darüber, dass ihre Großmutter noch lebte. »Was heißt das?«
»Na, das heißt es eben. Wirklich, Laura.« Ihre Mutter war in Krisensituationen genauso wenig zu gebrauchen wie sie selbst.
»Was haben sie denn gesagt? Irgendwas werden sie doch gesagt haben!«, erwiderte Laura im gleichen ungeduldigen Ton, bevor sie sich innerlich befahl, tief durchzuatmen.
»Nichts, du weißt doch, wie es ist, sie sagen nichts, bis sie Genaues wissen.« Ihre Mutter führte sie in ein Wartezimmer, bedeutete ihr, sich zu setzen, und ging sofort zur Kaffeemaschine. Als sie zurückkam, zwei dampfende Plastikbecher in der Hand, blieb sie vor Lauras Stuhl stehen und musterte sie. »Was ist denn mit dir?«
»Was meinst du?«
»Du siehst nicht gut aus. Bist du krank? Geht es dir nicht gut?«
»Es ist alles in Ordnung. Ich mache mir nur Sorgen«, erwiderte sie mit einer Geste, die das Krankenhaus und die Situation umfassen sollte. Wie zum Teufel wusste ihre Mutter immer genau, wenn etwas nicht stimmte?
Ellen fixierte sie noch einen Moment misstrauisch mit ihrem Lehrerinnenblick, dem nichts entging. Unter ihren Augen war der Lidstrich verschmiert, das Deckenlicht reflektierte in ihren Brillengläsern. Laura dachte, dass auch sie nicht gut aussah, sie war bleich, man merkte ihr den Schock an. Wortlos setzte ihre Mutter sich neben sie auf einen der harten Stühle und reichte ihr den Kaffee. Laura konnte riechen, dass er nicht schmecken würde.
Draußen hing noch immer die graue Regenwolke über Frankfurt. Ein paar Minuten umklammerten sie beide schweigend ihre Plastikbecher und beobachteten das Gewusel der Menschen um sich her, sahen jedes Mal hoffnungsvoll auf, wenn jemand um die Ecke bog. »Das wird dauern!« Mit einem ergebenen Seufzer schälte Ellen sich aus ihrer Softshell-Jacke.
Laura hatte gerade genau das Gleiche gedacht. Sie selbst behielt ihre Jacke an, wickelte sie sogar noch ein wenig fester um sich. Es war Mai, aber das Nieselwetter hielt schon fast eine Woche an, und es schien von Minute zu Minute kälter zu werden. Bereits im Taxi hatte sie Jonathan eine Nachricht geschrieben, nun kramte sie ihr Handy hervor, um ihm ein Update zu schicken. Es gibt nichts Neues, sie ist noch nicht wach.
Er schien auf ihre Nachricht gewartet zu haben, antwortete sofort, wusste natürlich genau, was sie nicht geschrieben, aber dennoch gesagt hatte. Änne ist jetzt wichtiger. Wir haben Zeit. Kann ich etwas tun? Soll ich zu euch kommen?
Laura schickte ihm ein Herz. Nicht nötig, Mama ist ja hier, wir können sowieso nichts machen! Sie verschwieg, was beide wussten: Ihre Mutter würde nicht wollen, dass er kam.
Laura steckte das Handy wieder weg. Jonathan hatte recht, sie hatten Zeit. Und trotzdem spürte sie das Gewicht des Schwangerschaftstests in ihrer Tasche, als wöge er hundert Kilo.
Ausgerechnet heute, dachte sie. Ausgerechnet jetzt.
Laura sah anders aus. Es war ihr sofort aufgefallen. Verstohlen musterte Ellen ihre Tochter über die zwei Jahre alte Zeitschrift hinweg, die sie sich vors Gesicht hielt und in der sie noch kein einziges Wort gelesen hatte. Die schlanke Gestalt hatte sich nicht verändert, die braunen, schulterlangen Locken fielen wie immer um Lauras Gesicht. Aber etwas war nicht wie sonst, es gelang ihr bloß nicht, den Finger drauf zu legen. Seit ihre Tochter vor fünf Minuten aus dem Aufzug gestolpert war, konnte Ellen wieder etwas leichter atmen. Sie hasste Krankenhäuser. Sicherlich ging das jedem so, was gab es schließlich zu mögen, aber sie reagierte geradezu allergisch auf die Energie, die hier herrschte. Und dieser Geruch … Einem Impuls folgend, stand Ellen auf, entschuldigte sich und ging zur Toilette. Dort drehte sie das Wasser an, hielt einen Moment die Handgelenke unter den kalten Strahl. Wie immer erschrak sie über ihr Spiegelbild. Sie war fünfundsiebzig. Eine alte Frau. Vor kurzem hatte sie gelesen, dass beim Tod der eigenen Eltern neben der Trauer das Schlimmste dieses Gefühl war, als Nächstes dran zu sein. Dass man auf der Leiter des Lebens plötzlich eine riesige Stufe übersprungen hatte und nun nichts Nennenswertes mehr stand zwischen dem Jetzt und dem Tod. Kein Ereignis mehr, das auf jeden Fall noch vorher kommen würde. Als sie sich dabei ertappte, wie sie über sich selbst nachdachte anstatt über ihre kranke Mutter, bekam sie sofort ein schlechtes Gewissen.
Ihr Eyeliner war verschmiert, sie sah unmöglich aus. Missbilligend wischte Ellen an ihren Augen herum, richtete sich die Haare, nahm die rote Brille ab und rieb sie an ihrem Pulloverärmel sauber. Als sie sie wieder aufsetzte, kamen ihr unvermittelt die Tränen. »Hör auf zu heulen! Das hilft niemandem«, murmelte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Tränen griffen ihr Nervenkostüm an, sie mussten weg, und zwar sofort, bei sich selbst wie bei anderen. Ellen umklammerte den Rand des Waschbeckens, sah dabei zu, wie ihr Gesicht verkrampfte bei dem Versuch, die Trauer zurückzudrängen. Es gelang ihr nicht. Da war dieses ohnmächtige Gefühl, das ihr auf der Brust saß. Ihre Mutter war schwierig, und ihr Verhältnis war schwierig. Aber dass Änne sterben könnte, war undenkbar. Dabei wusste sie ja, dass es passieren würde. Passieren musste. Wenn nicht heute, dann bald. Änne war dreiundneunzig Jahre alt. Dass sie überhaupt noch lebte, war ein Wunder, und dann auch noch so selbständig und klar im Kopf, wie sie es bis heute gewesen war.
Die Tür ging auf, und eine Frau kam herein. Ellen drehte sich rasch zum Föhn an der Wand. Als sie aufsah, traf sie im Spiegel auf ein mitfühlendes Lächeln, das sie nicht erwidern konnte, weil sie sofort wieder anfing zu weinen.
Sie hatte sich hingesetzt und gerade den Mund geöffnet, um Laura zu sagen, dass sie sie doch bitte darauf hinweisen sollte, wenn ihr Eyeliner verschmiert war, da knallten Schritte über den Flur. Eine Ärztin trat ins Wartezimmer. Viele hoffnungsvolle Gesichter wandten sich ihr zu, aber dieses Mal waren tatsächlich sie gemeint. »Elena Weiler?«
»Hier!« Ellens Hand schoss nach oben, als wäre sie in der Schule aufgerufen worden.
Die Ärztin lächelte nachsichtig. »Ich hätte gar nicht fragen müssen. Sie sehen aus wie Ihre Mutter.«
Im Alter schien die Ähnlichkeit stärker zu werden, sie wurde in letzter Zeit ständig darauf angesprochen. Es war nicht unbedingt schmeichelhaft, mit einer Dreiundneunzigjährigen verglichen zu werden. Ellen wollte nicht aussehen wie ihre Mutter. Sie wollte aussehen wie sie selbst. Und Änne schien es ebenso zu gehen, sie machte bei solchen Bemerkungen stets ein Gesicht, als hätte sie in etwas Faules gebissen.
»Maibach!«, stellte die Ärztin sich vor, winkte sie und Laura auf den Flur hinaus, wo sie vor den neugierigen Augen und Ohren der anderen Wartenden geschützt waren.
»Wie geht es ihr?« Ellen drehte die Zeitschrift, die sie versehentlich mitgenommen hatte, in ihren Händen zu einer schmalen Röhre. Ein einziger Blick in das Gesicht der Ärztin reichte, damit sich ihr Magen noch weiter zusammenzog.
»Ihre Mutter ist für den Moment stabil, aber wir wissen noch nicht, was ihren Zustand ausgelöst hat.« Man hörte Dr. Maibachs Stimme das Mitgefühl an, trotzdem klang sie schrecklich routiniert. »Wir müssen warten, bis sie aufwacht, um eine Gehirnblutung auszuschließen. Sie hat sich den Kopf aufgeschlagen, das ist immer gefährlich.« Die Ärztin warf einen Blick in die Akte in ihrer Hand. »Sie sind die Vorsorgebevollmächtigte?« Die blauen Augen hefteten sich auf Ellen.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Meine Mutter war bis heute sehr fit. Sie wollte so etwas nie«, fügte sie hinzu.
Die Stirn der Ärztin zog sich kaum merklich zusammen, sie blätterte in den Unterlagen. »Ah, stimmt, entschuldigen Sie. Hier steht Laura Weiler?«
Ungläubig starrte Ellen auf die Handschrift ihrer Mutter.
Laura räusperte sich. »Ich bin Laura Weiler.«
»Ah, das erklärt es.« Frau Maibach nickte zerstreut. »Sie sind die Enkelin? Ihre Großmutter hat Ihnen die Vorsorgevollmacht übertragen.«
»Aber …« Verblüfft sah Laura Ellen an. »Das kann nicht sein. Ich habe nie etwas unterschrieben.«
»Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Dinge zu regeln. Wenn das Ganze ohne Notar abläuft, ist eine Unterschrift nicht zwingend notwendig.« Die Ärztin drehte nun das Klemmbrett so, dass auch ihre Tochter lesen konnte, was Ellen schon gesehen hatte. Diese Ungeheuerlichkeit, die dort stand, schwarz auf weiß. Es war wie eine Ohrfeige aus dem Nichts. Es nahm Ellen den Atem. Für einen Moment nahm es ihr sogar die Sorge. Plötzlich war da nur noch brennende Enttäuschung.
Ellen hatte gedrängt und gedrängt. In Ännes Alter konnte jederzeit etwas passieren. Genau genommen war es ein Wunder, dass ihre Mutter bisher ohne größere Katastrophen durchs Leben gegangen war – sah man von dem Sturz im letzten Sommer ab, der Gott sei Dank glimpflich verlaufen war. Änne war über eine Falte im Teppich gestolpert, hatte sich das Handgelenk verstaucht und beide Knie aufgeschürft. Seitdem war sie unsicherer auf den Beinen, auch wenn sie es natürlich nicht zugab. Man sah es an der Art, wie sie sich bewegte, wie ihre Schritte kleiner und trippelnder wurden. Ellen hatte die Teppiche im Haus mit Klebeband aus dem Baumarkt gesichert, damit sich keine Stolperfallen mehr bilden konnten. Außerdem hatte sie im Sanitätshaus einen schnittigen kleinen Rollator geholt, mit einem Tablett vorne drauf, um Teller und Tassen zu transportieren. Änne hatte er überhaupt nicht gefallen. Aber sie hatte nichts gesagt, bloß abwertend geschnaubt, als sei das alles mal wieder vollkommen übertrieben. Benutzt hatte sie den Rollator trotzdem.
Ihre Mutter war gesund wie ein Pferd, das musste Ellen zugeben. Aber sogar bei jemand so Unverwüstlichem wie Änne kam irgendwann der Moment, in dem es alleine nicht mehr ging. Man konnte das Alter nicht für immer ignorieren. Schließlich hatte Ellen sich beraten lassen, ein Schreiben aufgesetzt und es ihrer Mutter auf die grün-blau karierte Tischdecke geknallt, die seit sechzig Jahre in der Küche in Eschersheim aufgelegt wurde, sobald der letzte Teller abgetragen war, zum Essen jedoch immer abgenommen werden musste. »Mama, du brauchst eine Verfügung. Wir regeln das jetzt!«
Änne hatte sich glatt geweigert. »Ich brauch so was nicht.« Ihr Augen waren hart und starr geworden wie kleine Murmeln, und sie hatte die Arme auf eine Art vor der Brust verschränkt, die klarmachte, dass es hier kein Weiterkommen gab. Im Alter war es schlimmer geworden, dieses Misstrauen gegen die Welt, das sogar vor der eigenen Tochter nicht haltmachte. Was dachte sie denn, was Ellen tun würde mit der Vollmacht? Die erste Gelegenheit ergreifen, um die Schläuche durchzuschneiden?
»Dann regele deinen Scheiß eben alleine«, hatte sie schreien wollen. »Dann entscheidet im Ernstfall eben niemand, ob du künstlich am Leben gehalten wirst oder nicht.«
Aber natürlich hatte sie das nicht gesagt.
Danach hatte sie eine ganze Woche lang mit dem Drang gekämpft, ihre Mutter mit ihrem Aquarium und dem viel zu großen Haus einfach sitzenzulassen. Sollte Änne doch mal sehen, wie es war, wenn Ellen nicht mehr kam und die vielen kleinen Dinge machte, die niemandem auffielen, die aber durchaus Arbeit bedeuteten und ohne die es schon lange nicht mehr ging. »Du nimmst das viel zu persönlich.« Laura hatte wie immer beschwichtigt, als sie sich bei ihr beschwerte. »Es hat nichts mit dir zu tun. Sie will einfach ihre Autonomie nicht verlieren.«
»Das verstehe ich vollkommen, aber darum geht es doch nicht.« Auf eine Weise verstand sie tatsächlich sehr gut. Und sie war nicht einmal sicher, ob sie selbst an Ännes Stelle nicht genauso allergisch auf eine Verfügung reagiert hätte. Aber das machte es nicht einfacher.
»Sie haben am Empfang angegeben, dass Ihre Mutter an Epilepsie leidet?« Die Stimme von Dr. Maibach riss Ellen aus ihrem Gedankenstrudel.
»Wie bitte? Ja genau, das stimmt.«
Die Lippen der Ärztin bewegten sich, als sie die Akte las. Mit dem Zeigefinger schob sie ihre Brille nach oben.
»Ich habe hier die Unterlagen der Hausärztin. Laut diesen Informationen nimmt Ihre Mutter keine Medikamente gegen Epilepsie.«
Laura und sie tauschten einen Blick. Aber dieses Mal war Ellen ganz sicher, dass es sich um einen Fehler handelte. »Doch, doch, schon immer«, versicherte sie, gleichzeitig nickend und kopfschüttelnd. »Frau Dr. Kopp muss vergessen haben, es aufzuschreiben.«
»Wenn Ihre Mutter regelmäßig Medikamente nehmen würde, stünde es in der Akte. Sehen Sie, hier ist alles aufgelistet: Blutverdünner, etwas für den Magen, Mirtazapin …«
»Mirtaza-was?«
»Ein Stimmungsaufheller. Antidepressivum«, fügte die Ärztin hinzu, ohne von der Akte aufzusehen.
Es dauerte einen Moment, bis Ellen die Worte verstand. »Aber meine Mutter hat nicht … Ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen …« Sie merkte, dass sie sich an die Zeitschrift klammerte wie an einen Rettungsanker.
Offensichtlich sah man ihr den Schock an, denn Dr. Maibach lächelte beruhigend. »Es soll auch Appetit und Schlaf fördern. Das muss nichts heißen, Frau Weiler, vielleicht hatte Ihre Mutter einfach eine schlechte Phase, und die Hausärztin wollte ihr einen kleinen Schubs geben. Im Alter verschreibt man diese Dinge schneller als bei jungen Menschen. Und im Alter hat man eben auch mehr Gründe für schlechte Stimmung.«
»Sie sagen mir also, dass meine Mutter keine Medikamente mehr gegen ihre Epilepsie nimmt. Aber stattdessen ein Antidepressivum?« Sie hörte selbst, dass ihre Stimme schrill und höhnisch klang, aber das Ganze war absurd.
Die Ärztin nickte. »So steht es hier.«
»Dann muss das ein Fehler sein. Oder vielleicht hat die Hausärztin die Medikamente abgesetzt und es mir nicht gesagt. Meine Mutter ist schon ewig symptomfrei, ich kann mich gar nicht erinnern, wann …«
»Antiepileptika nimmt man sein Leben lang. Es gibt keine Heilung, nur Unterdrückung der Symptome.«
»Meine Großmutter hat Epilepsie«, beharrte nun auch Laura mit ruhiger Stimme. »Sie hat ihr ganzes Leben lang die Pillen geschluckt. Es muss ein Fehler in der Akte sein.«
»Richtig. Das ist lächerlich. Wir haben es schließlich selbst oft miterlebt, die Anfälle …« Ihre Stimme war lauter geworden, und die Ärztin griff beruhigend nach ihrem Arm. »Frau Weiler, wir kriegen schon raus, was das zu bedeuten hat. Ich versuche am besten gleich einmal, in der Praxis der Hausärztin anzurufen und das zu klären.« Dr. Maibach sah auf ihre Armbanduhr. »Ich hoffe, ich erwische da noch jemanden. Sobald ich Näheres weiß, sage ich Bescheid.« Sie ging über den Gang davon, das Handy mit der Schulter ans Ohr gepresst.
»Seltsam.« Laura blickte ihr nach. »Aber das klärt sich bestimmt.«
»Es kann ja nur ein Irrtum sein.« Ellen fühlte, wie eine bleierne Müdigkeit sie zu überspülen drohte. »Diese Frau und ihre verdammte Sturheit. Habe ich es nicht immer gesagt, dass man eine Verfügung braucht?«
»Sie hat eine, Mama!«, erinnerte Laura. Natürlich verstand ihre Tochter ganz genau, was in ihr vorging. »Änne hat es nicht böse gemeint. Du kennst sie doch. Wahrscheinlich dachte sie, du tust schon genug für sie, und …«
»Unsinn!« Ellen hatte schärfer geklungen als beabsichtigt. »Sie will sich einfach nichts vorschreiben lassen.«
»Ach komm schon.«
»Du hast nichts davon gewusst?«
»Ich hätte es dir erzählt, das weißt du!«
Sie war kurz davor, wieder in Tränen auszubrechen. Das Gefühl, von ihrer Mutter auf eine Art behandelt zu werden, die sie nicht verdiente, ohne ersichtlichen Grund und auf eine Weise, die sie kleinlich erscheinen ließ, wenn sie es ansprach, war nichts Neues. Normalerweise konnte sie damit umgehen. Heute war es zu viel.
»Mama, jetzt sei doch nicht gleich wieder so empfind –«
»Kannst du ihre Sachen holen?«
Laura versuchte immer zu beschwichtigen, wenn es um Änne ging. Sie hatte noch nicht verstanden, dass es einen himmelschreienden Unterschied machte, ob man eine exzentrische, sture Großmutter hatte oder eine exzentrische, sture Mutter.
»Natürlich! Was genau?«
»Ein paar Nachthemden, die Strickjacke, die Fernsehzeitung, ihre Hausschuhe, den Kulturbeutel …« Ellen riss sich zusammen, zählte an den Fingern auf, was ihre Mutter alles brauchen würde, wenn sie aufwachte. »Vielleicht sollte ich doch lieber selber fahren, du weißt ja nicht, wo alles ist, du kannst ja …«
»Natürlich weiß ich das.« Es war offensichtlich, dass Laura sich bemühte, besonders ruhig zu bleiben, um Ellens Überreaktion auszugleichen. »Und wenn ich was nicht finde, rufe ich dich an.«
Ellen hatte nie verstanden, warum für ihre Tochter immer alles so einfach schien. Laura meisterte das Leben mit einem unbekümmerten Schulterzucken. Ellen selbst fand nichts einfach. Sie nahm alles ernst und alles schwer. Das hatte zumindest Lauras Vater immer gesagt, bevor sie sich trennten. Er hatte auch noch einige andere Dinge gesagt, an die Ellen nicht denken konnte, ohne dass sich ihr Magen zusammenzog.
»Gut.« Sie biss sich auf die Lippen, um die Tränen zurückzuhalten, kramte in ihrer Tasche nach dem Autoschlüssel. »Bring auch Mamas Lakritztee mit. Und die Heizdecke. Auf dem Sofa. Ach, und die Lesebrille natürlich. Sie hat ja Hunderte, nimm einfach irgendeine.«
Laura nickte, sie umarmten sich kurz, Ellen wehte ein vertrauter Hauch von Parfum und Duschgel um die Nase, dann winkte ihre Tochter mit dem Autoschlüssel und war verschwunden. Sie musste dem Drang widerstehen, ihr hinterherzulaufen.
Ellen sackte auf dem Flur in einen Stuhl und legte die Hände vors Gesicht. Seltsamerweise kamen die Tränen nicht, von denen sie eben noch gedacht hatte, sie würden erneut aus ihr herausplatzen, sobald sie alleine war. Was kam, war Erschöpfung.
Erschöpfung und Wut.
Ännes Haus lag in einer ruhigen Gegend von Eschersheim. Über den Apfelbäumen im Garten ragte in der Ferne der Fernsehturm auf. Es roch nach Regen, von den Büschen tropfte es, und zwischen den Häusern konnte man Nebel über dem Taunus sehen. Inzwischen dämmerte es.
Laura manövrierte den grünen Peugeot ihrer Mutter in die Einfahrt und stieg aus. Den unebenen Kachelweg zum Haus war sie schon ihr ganzes Leben gegangen, er führte um die Ecke zum Schuppen weiter, in dem Änne früher Hühner gehalten hatte. Ein Blauregen rankte sich am verblassten Gelb der Fassade empor. Der Garten, in dem es in jedem Sommer in Hülle und Fülle geblüht hatte, war erschreckend kahl. Änne schaffte es nicht mehr, sich zu kümmern, die Staudenbeete wucherten noch, aber alles andere lag brach. Laura wusste, dass sie sich in vielleicht naher Zukunft von diesem Ort verabschieden musste, aber vorstellen konnte sie es sich nicht. Der Gedanke verursachte ein Ziehen in ihrer Brust.
Sie angelte den Schlüssel aus dem rostigen Schirmständer. Als sie aufschloss, schabte die Tür über den Teppich. Der vertraute Geruch strömte ihr entgegen, eine Mischung aus altem Haus, Essen und dem Aquarium im Wohnzimmer. In den letzten Jahren hatte es ihre Mutter übernommen, sich um die Fische zu kümmern. Ellen hatte endlose Stunden im Baumarkt verbracht und die Anrichte im Wohnzimmer mit Dingen wie Algenreiniger und Absaugeschläuchen gefüllt. Nun kam sie mehrmals in der Woche vorbei, meist unter dem Vorwand, nach den Guppys sehen zu wollen. Aber natürlich wussten sie alle, dass Ellen eigentlich nach Änne sah. Laura war nur allzu bewusst, dass ihre Mutter diese Besuche genauso sehr brauchte wie ihre Großmutter, wenn auch auf eine andere Art. Ellen war im Volleyballverein und im Chor, sie half in der Bibliothek, sie ging gerne wandern, hatte viele Bekannte. Aber enge Freundinnen hatte sie nicht. Und seit ihrer Pensionierung war es ihre Hauptbeschäftigung geworden, um Änne herumzukreisen.
Was macht Mama nur, wenn das alles plötzlich wegfällt, schoss es Laura durch den Kopf. Und der Gedanke erschreckte sie.
Änne hingegen konnte nur schwer ertragen, dass sie Hilfe brauchte. Es nahm ihr ihre Leichtigkeit. Sie konnte auch nicht danach fragen. Mit verkniffenem Mund sagte sie in bedauerndem Tonfall Sätze wie: »Den Rasen müsste mal jemand machen …«, oder: »Wenn ich noch könnt wie früher, würde ich heut die Äpfel auflesen.« Dinge, die in den Keller mussten, stapelte sie im Flur, Ellen oder Laura trugen sie hinunter, wenn sie im Haus waren, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Und natürlich hatten sie den Rasen gemacht. Und sie hatten auch die Äpfel aufgelesen. Bis es irgendwann zu viel geworden war und Ellen eine Nachbarin engagierte, um Änne unter die Arme zu greifen.
Laura war noch nie alleine hier gewesen. Änne war immer da, irgendwo im Haus. Und irgendwo lief immer eine Kaffeemaschine oder ein Bügeleisen, ein Radio, eine Sendung im Fernsehen. Jetzt tickten die vielen Uhren in der Stube so laut, dass Laura dem Drang widerstehen musste, die Zeiger anzuhalten. Änne hatte ihr ganzes Leben lang Uhren gesammelt, von jeder Reise und aus jedem Urlaub eine mitgebracht, sie zu Weihnachten und zu Geburtstagen geschenkt bekommen. Wenn man mit ihr zusammen auf dem Sofa saß und Zeitung las oder Kaffee trank, hatte das Ticken etwas Gemütliches. Wenn man allein hier war und die Uhren nur für einen selbst tickten, machte es unruhig.
Langsam ging Laura durch die Diele, knipste die Lichter an, hängte ihre Jacke auf. Im Wohnzimmer war alles wie immer, das Aquarium blubberte vor sich hin, die Spiegelvitrine mit den vielen Gläsern und der kleinen Pferde-Porzellanfigur in der Mitte schimmerte im Licht der Deckenlampe. In der Tür zur Küche blieb sie stehen.
Auf dem Tisch lag ein aufgerissenes Paket. Als Laura näher trat, sah sie, dass darin eine bemalte Leinwand eingepackt gewesen war, in Luftpolsterfolie eingeschlagen und in Packpapier gewickelt. Änne hatte das Papier anscheinend grob mit der Schere auseinandergeschnitten und das Bild herausgeholt. Verwundert hielt Laura die Leinwand hoch, um sie im Licht der Küchenlampe anschauen zu können. Soweit sie es beurteilen konnte, war das Acryl, die düsteren Farben erinnerten an ein Gewitter.
Die Frau auf dem Bild saß vor einem Spiegel. Aber während sie ruhig, beinahe abwesend lächelte, schien ihr Ebenbild verzerrt vor Trauer. Es sah aus, als wolle es durch das Glas nach ihr greifen.
Etwas am Anblick der Spiegelfrau kam Laura bekannt vor.
Einer Eingebung folgend, ging sie ins Wohnzimmer zurück, hielt das Gemälde neben das Foto auf der Kommode – das einzige existierende Bild der jungen Änne, und auch das einzige, das ihre Flucht aus Schlesien nach dem Krieg überlebt hatte. Seit Laura denken konnte, stand es neben dem Fernseher. Zweifelnd betrachtete sie die beiden Frauen, eine sehr jung, fast noch ein Mädchen, in Sepia gegossen, die andere durch die Acrylfarben leicht ins Abstrakte gerückt. Die Ähnlichkeit war stark, aber sie konnte durchaus Zufall sein. In der unteren rechten Ecke des Gemäldes prangte ein schräger Schriftzug. Als Laura das Bild schief hielt und genauer hinsah, erkannte sie ein L, dann ein u. »Luise«, murmelte sie, war sich aber nicht sicher, ob es stimmte. Wahrscheinlich die Künstlerin. Sie kannte niemanden mit diesem Namen.
In der Küche untersuchte Laura das Paket. Es stand kein Absender darauf, nur Ännes Adresse in großer, verschlungener Kuli-Schrift, daneben klebten bunte Briefmarken. Auf allen stand das Wort Polska in fetten Buchstaben.
Was in aller Welt hatte Änne da wieder bestellt? Laura legte das Bild zurück auf den Tisch. Ihre Großmutter neigte zum Teleshopping, auch wenn das Gemälde nicht wie eines der Produkte wirkte, die dort typischerweise angepriesen wurden. Sie nahm ein Glas aus dem Schrank und füllte es mit dem Multivitaminsaft, den Änne immer im Kühlschrank hatte. Als sie das leere Glas in die Spüle stellte, hörte sie ein Geräusch. Ein leises Klingeln aus dem Flur. Dann ein Schaben.
Jemand war im Haus.
Laura erstarrte. Doch bevor die Panik sie überkam, erklang eine Stimme. »Ellen? Nicht erschrecken! Ich hab das Auto gesehen.«
Langsam atmete sie aus. Frau Wehrhahn kam immer durch den Keller nach oben. Dort unten bewahrte die Nachbarin die Putzmittel und ihre Wechselkleidung auf. »In der Küche!«, rief sie und spürte ihren Puls wummern.
Als die Nachbarin hereinkam, einen Eimer in der einen und ihre Tasche in der anderen Hand, stieß sie einen bekümmerten Laut aus. Sie ließ beides fallen, trat auf Laura zu und umarmte sie lang und fest. »So ein Schreck, Kind. So ein Schreck! Wisst ihr was Neues?«
Bei jedem anderen hätte es Laura gestört, mit siebenunddreißig noch Kind genannt zu werden. Bei Frau Wehrhahn mochte sie es seltsamerweise. »Nichts«, erwiderte sie, während die Nachbarin sie weiter an sich drückte. »Sie ist noch nicht wach. Ich hole ihr nur ein paar Sachen.«
Frau Wehrhahn nickte mitfühlend. »Ich wollte bloß eben schnell den Kühlschrank ausräumen und schauen, dass die Fenster zu sind. Deine Mutter hat angerufen und gesagt, dass Änne auf Intensiv ist und wohl eine Weile bleiben wird? Soll ich dir Wäsche für sie raussuchen?«
»Gerne.« Laura nickte dankbar. »Haben Sie das Paket gesehen?« Sie zeigte auf das Bild. »Hat sie etwas darüber gesagt?«
»Es kam heute Morgen mit der Post.« Frau Wehrhahn setzte die Brille auf, die ihr an einer Kette um den Hals hing. »Es war ganz seltsam, Laura. Änne wollte das Paket erst gar nicht annehmen. Und dann wollte sie es nicht auspacken. Es ist ja kein Absender drauf. Aber sie meinte, sie sieht an den Briefmarken, woher es kommt.«
Erstaunt betrachtete Laura die bunten polnischen Marken.
»Heute war sie sehr merkwürdig, Laura. Ganz anders als sonst. Es hat sie furchtbar durcheinandergebracht, das Paket. Ist aber auch ein seltsames Bild, findest du nicht? Sie hat es ausgepackt, ist nach oben, um etwas zu suchen, dann habe ich es rumpeln hören und …«
»Ach, ich dachte, sie wäre hier gestürzt«, unterbrach Laura den Bericht.
Frau Wehrhahn schüttelte den Kopf. »Nein, oben. Im Schlafzimmer.« Bekümmert deutete sie auf den Eimer. »Ich wollte eben das Blut aufwischen. Vielleicht kann man den Teppich noch retten.«
Während Frau Wehrhahn ihren Kittel aus dem Keller holte, stieg Laura in den oberen Stock hinauf. Wie schon Hunderte Male zuvor fuhr ihre Hand über das abgenutzte Holz des Treppengeländers. Dieses Haus gehörte zu ihnen, zu Änne. Es roch wie sie, es fühlte sich an wie sie. Laura konnte sich nicht vorstellen, dass bald jemand Fremdes seine Hand über das Holz gleiten lassen würde. Änne besaß lebenslanges Wohnrecht, doch das Haus gehörte den Söhnen ihres Mannes aus dessen erster Ehe. Einen Moment stellte Laura sich vor, was sie wohl mit Ännes Möbeln machen würden, dem großen alten Bett, der knarzenden Küchenbank. Aber es war zu schmerzhaft. Hoffentlich kommt sie noch einmal zurück, dachte sie. Sie konnte sich ja gar nicht verabschieden.
Als Laura die Tür zum Schlafzimmer aufstieß, entfuhr ihr ein heiserer Laut. Eine Blutlache hatte den Teppich getränkt. Sie war wesentlich größer, als sie erwartet hatte, und sehr rot. Vor dem Spiegelschrank lag ein umgekippter Hocker. Ihre Großmutter musste darauf gestiegen sein, um Sachen aus dem oberen Fach zu holen. »Oh, Änne …«, murmelte Laura. »In deinem Alter!«
Ein Stapel Pullover lag auf dem Boden, daneben eine Kiste. Ihr Inhalt hatte sich auf den Teppich ergossen. Es war so ungewohnt, dieses Zimmer in nicht perfektem Zustand zu sehen, dass das Chaos Laura fast mehr verstörte als das Blut. Das Schlafzimmer wurde morgens von Änne gelüftet, tadellos hergerichtet und dann den ganzen Tag nicht mehr betreten.
Laura kniete sich hin und betrachtete die Sachen, die aus der Kiste gefallen waren. Ein kleines weißes Kleid, eine ebenso kleine gestrickte Hose, ein Mützchen mit Blumen darauf. Es musste sich um eine Erinnerungskiste handeln. Sicher hatte das weiße Kleidchen einmal Ellen gehört. Laura hob es ins Licht. Es war schwer, sich ihre Mutter als Kind vorzustellen. Sie drehte die Kiste um. Ein vergilbtes Dokument fiel ihr entgegen. Nicht viel mehr als ein Fetzen, an den Rändern angesengt, verschmiert und zerknittert. Als Laura es auseinanderfaltete, waren die Buchstaben kaum noch zu erkennen. Erstaunt stellte sie fest, dass es sich um Ellens Geburtsurkunde handelte. Man konnte gerade noch das Standesamt, die Überschrift und ihren Namen lesen: Elena Thomke, vier Zeilen darunter neben dem Wort Mutter Änne Thomke. Alles andere war so gut wie unleserlich. Die untere linke Hälfte des Papiers fehlte ganz. Erschüttert blickte Laura auf das zerfetzte Dokument. Es konnte nicht mehr gültig sein. Sicher hatte Änne eine neue Urkunde beantragt und diese aus sentimentalen Gründen behalten. Laura hatte gewusst, dass ihre Großmutter nach dem Krieg aus Schlesien geflohen war, aber über die Details der Flucht hatte Änne immer geschwiegen. Was musste damals passiert sein, dass dieses Papier so aussah?
Sie machte ein Foto, um es später ihrer Mutter zu zeigen, und legte das Dokument behutsam beiseite. In einer Ecke der Kiste klemmte ein goldener Schlüssel. Er wirkte nicht unbedingt alt, war zu klein für eine Tür und zu groß für ein Poesiealbum. Daneben lag ein weiteres vergilbtes Blatt Papier. Laura hatte Sorge, dass es ihr in der Hand zu Staub zerfallen würde, so alt schien es.
Es standen nur zwei Worte darauf. Sie waren handgeschrieben. Und sie ergaben keinen Sinn. Einen Moment starrte Laura auf die Buchstaben, dann wurde ihr klar, dass es sich um Kyrillisch handeln musste. Sie nahm ihr Handy aus der Jeanstasche, machte ein Foto von dem Zettel und schickte es an Jonathan. Könntest du Leo fragen, was das heißt? Der Kollege, mit dem er das Büro an der Uni teilte, kam aus Lettland.
Jonathan hatte die Nachricht wieder sofort gelesen, antwortete aber nicht. Wahrscheinlich wunderte er sich, warum sie ihm so etwas schickte statt ein Update von Änne. Ich erklär’s später!, fügte sie hinzu und wünschte, sie hätte ihn doch gebeten, herzukommen. Ännes Blut auf dem Teppich verstörte sie mehr, als sie zugeben wollte.
Das Letzte, was Laura aus der Kiste zog, war ein Bündel Briefe, zusammengehalten mit einer einfachen Kordel. Erstaunt begutachtete sie die Umschläge. Auf keinem davon stand eine Adresse oder ein Absender, aber sie waren fest verschlossen.
Wer schrieb Briefe, um sie dann nicht abzuschicken?
»Kann ich dir helfen?« Frau Wehrhahn kam die Treppe herauf.
Schnell ging Laura zu ihr in den Flur und zog die Tür hinter sich zu. »Danke, ich räume nur schnell auf, damit wir putzen können.«
»Dann lasse ich schon mal Wasser einlaufen.«
Mit Eimer und Mob bewaffnet, ging die Nachbarin ins Bad nebenan, und Laura schlüpfte zurück ins Schlafzimmer. Sie zögerte nur eine Sekunde. Dann griff sie das Bündel Briefe, lief die Treppe hinunter und steckte es in ihren Rucksack. Zehn Sekunden später war sie wieder oben, ordnete die anderen Sachen in die Kiste zurück, stieg auf den Hocker und schob sie in das Schrankfach, faltete Ännes heruntergefallene Pullover auf einen Stapel und legte ihn davor.
Dann half sie Frau Wehrhahn bei dem vergeblichen Versuch, mit Zitronensaft und Natron das Blut ihrer Großmutter aus dem Teppich zu schrubben.
Eine halbe Stunde später zog sie die Haustür hinter sich ins Schloss und ließ den Schlüssel wieder in den alten Schirmständer neben der Fußmatte gleiten, in dem er immer lag. Sie stellte die Reisetasche mit Ännes Sachen auf den Rücksitz des Peugeots und warf die Tür zu. Im gleichen Moment meldete sich ihr Handy. Jonathan hatte geantwortet.
Es ist Russisch. Leo sagt, es bedeutet: Komm heim!
Die Krim 1941
Ihn umgab der Ruf, dass er Glück hatte. Dass man gut daran tat, sich in seiner Nähe zu halten.
Und es stimmte. Er hatte Glück. Aber er glaubte nicht, dass es gut war, sich in seiner Nähe zu halten. Es gab den Zufall, es gab das Glück, und es gab Geschossbahnen, Streuung und Splitterwirkung. In seiner Nähe blieb für andere kein Glück mehr übrig. Was für ein Glück war das schon, das links und rechts neben ihm aufhörte.
Mitten in der Nacht war Karl aufgewacht. Schlotternd vor Kälte starrte er in die Dunkelheit, überrascht, dass er überhaupt geschlafen hatte. Schlaf war etwas, das einem alten Leben angehörte. Sich einfach abends ins Bett legen und wegdämmern, eingehüllt in warme, vertraute Decken, ohne Gedanken, die einen zermarterten. Das gab es nicht mehr. Er hielt sich jede Nacht wach, so lange er konnte. Wenn er schlief, dann nur, weil ihn die Erschöpfung überkam, ihn für ein paar kurze, unruhige Augenblicke mitnahm in ein schwarzes Meer. So hatte er sich immer den Tod vorgestellt: ein sanftes Nichts, in dem alles durcheinanderwogte und in dem man langsam versank, bis einen die Dunkelheit einhüllte.
Natürlich wusste er es inzwischen besser.
Nachdem der Landweg aus der Krim heraus abgeschnitten war, knapp oberhalb von Kertsch, hatten sie sich hier in die Erde gewühlt. Und nun saßen sie bei Bulganak fest, in einer kleinen Ansammlung von Schutt irgendwo nördlich der Stadt. Es hätte auch mitten auf dem Mond sein können. Oder mitten in der Hölle.
Karl richtete sich auf und griff nach seinen Zigaretten. Kaum wach, konnte er den Bunker nicht mehr ertragen, die trüben Lichter, den Geruch. Also stand er auf und ging hinaus in den Graben. Er redete ein paar Worte mit den Männern aus der schweren Kompanie, die auf einen möglichen Einsatz warteten, gähnte hin und wieder verstohlen, wollte um jeden Preis wach bleiben. Bei einem Artilleriebeobachter, den er aus der Ausbildung in Frankfurt kannte, blieb er eine Weile sitzen. Sie teilten sich ein seltsames Gebräu, das der Mann in den vielen Stunden der Langeweile und des Wartens erfunden hatte und das Karl beinahe die Stiefel auszog. Sie redeten, lachten sogar, auch wenn es sich seltsam anfühlte, wie etwas, das er einmal gekonnt und dann verlernt hatte. Trotzdem half es nichts. Gott, er war müde. So müde. Der Schlaf lauerte hinter seinen Lidern, in seinen Gelenken, sogar in seinen Gedanken. Alles war anstrengend, beim Atmen spürte er, wie sich das Uniformtuch über der Brust und am Hals hob und senkte. Aber er wollte nicht schlafen. Er wollte nicht träumen.
Er rauchte eine Zigarette, dann noch eine. Dachte über eine dritte nach. Fragte sich, ob das jetzt immer so bleiben würde. Diese Unruhe in ihm.
Es hatte geregnet. Nun war die Erde feucht, und an den Grabenwänden machte man sich die Ärmel schmutzig. In einem Sarg würde es genauso riechen wie hier, schoss es ihm durch den Kopf, und zu seiner Überraschung ließ der Gedanke seinen Hals trocken werden. Trotzdem lauschte er mit seltsamer Gelassenheit auf die Einschläge. Es waren nicht mehr viele, kein einziger vor ihm, ein paar hinter ihm. Als unten vor der Stadt eine Leuchtkugel hochzitterte, sah er in ihrem Schein Stiefelabdrücke auf der Erdbank vor sich. Es war verboten, zum Essenholen den Graben zu verlassen. Die Männer taten es natürlich dennoch, sie waren zu jung, um die Gefahr richtig zu würdigen. Man konnte nicht immer Angst haben.
Einer Laune folgend, stieg er selbst hinaus, fühlte die Weite, das freie Feld. Er fragte sich, wann er jemals wieder aufrecht gehen würde, ohne einen schützenden Graben um sich zu haben. Einfach über eine Wiese laufen, ohne den Kopf einzuziehen, ohne sich umzusehen, auf den nächsten Einschlag zu lauschen. Als hätte sie seinen Gedanken zugehört, zischte in seinem Abschnitt eine Leuchtkugel hoch. Noch bevor sie zu sprühen begann, sah er ein paar aufwärtsfegende Funken und hockte sich rasch hinter den nächsten Erdaufwurf. Es war neblig, die Sicht nicht gut. In den Hügeln hinter den russischen Linien hing ein Dunstschleier. Das Gras glitzerte feucht. Der grüne Schein der Leuchtkugel sank in sich zusammen, doch Karl blieb hocken, wartete. Man konnte nicht vorsichtig genug sein. Er hätte den Graben nicht verlassen sollen. Aber das hatte er vorher gewusst.
Er legte die Hände über die Knie und ließ seine Stirn darauf sinken. Es war ruhiger als sonst. Sicher war daran der Regen schuld. Regen war auf eine Art schlimmer als Schnee, er untergrub die Moral auf seine ganz eigene, nasse, tropfende Weise. Trotzdem hatte Karl wahnsinnige Angst vor dem Winter. Es wurde Tag für Tag kälter.
Wieder ein Schuss. Er sah auf, aber die Leuchtspuren und die Schüsse sollten nur zeigen, dass die Posten wach waren, hier wie drüben. Dass sie wach waren und an den Feind dachten. Dass sie warteten, immerzu warteten. Er hätte nie gedacht, dass Krieg aus so viel Warten bestand.
Wie immer, wenn er Zeit hatte nachzudenken, fühlte er den Drang, nach Hause zu schreiben. Den anderen war das oft lästig, sie schickten stets die gleichen Phrasen – alles in Ordnung, keine Läuse, in alter Frische, Essen passabel. Er wollte nichts mehr, als Zeilen wie diese auf den Weg zu schicken und zu wissen, dass sie irgendwo ankamen. Dass es jemanden interessierte, ob das Essen passabel war und sein Kopf läusefrei.
Er hatte kein Zuhause mehr. Immer wieder vergaß er das zwischendurch, vergaß für kurze Zeit, warum da diese Schwere in ihm war, dieser Druck auf der Brust. Und dann fiel es ihm wieder ein, und es war jedes Mal wie ein Knall, ein Schlag, eine Erschütterung der Welt. Er hatte jedes Mal aufs Neue das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Aber natürlich musste man sich zusammenreißen. Es gab viele hier, die mehr verloren hatten. Oder besser, es gab sie nicht mehr. Nur noch ihre Schatten in den Gräben. Manchmal ihre Helme, manchmal ihre Namen, die versehentlich vorgelesen wurden und sie alle zusammenzucken ließen.
Ein einzelnes Maschinengewehr warf eine Leuchtspur in die Nacht, dann schien es ruhig, aber in die Stille hinein sprühten sofort die Schüsse der russischen Posten. Man durfte nicht vergessen, wo man war. Und in letzter Zeit vergaß er es oft, wanderte mit den Gedanken, wachte auf und glaubte einen wunderbaren Moment lang, seine Mutter in der Nähe zu wissen. Er war einundzwanzig Jahre alt. Und er fühlte sich wie ein kleiner Junge mit Heimweh.
Am Tag zuvor hatten sie einen Brief gefunden, in einer Munitionsnische, in den zurückeroberten Gräben. Dass Briefe gefunden wurden, wenn die Russen in den Gräben gewesen waren, war in ihrem Frontabschnitt nichts Neues, das kam alle zwei Wochen vor. Manchmal waren es Aufrufe zum Überlaufen, manchmal vergessene Feldpost. Meistens wusste man nicht, woher sie stammten, wer sie geschrieben hatte. Man war hier vorsichtig mit Namen und Adressen, machte sie unleserlich. Nur für den Fall. Obwohl nicht einmal er so genau wusste, wie dieser Fall aussehen sollte. Aber anscheinend hielten die Russen es ebenso. »Komm heim«, hatte in dem Brief gestanden. Sonst nichts. Nur zwei Ausrufezeichen. Anders als die meisten hier brauchte er niemanden zum Übersetzen. Er hatte die Worte vorgelesen, sie hatten die Männer gerührt und gleichzeitig unruhig gemacht, er sah es in ihren Gesichtern. Der Feind war eben doch auch ein Mensch. Es war für sie alle besser, wenn sie das vergessen konnten.
Karl hatte den Brief eingesteckt. Er wusste nicht genau warum, aber er lag seitdem zusammengefaltet in seiner Brusttasche. Komm heim, dachte er, und sein Hals zog sich zusammen. Nie wieder würde das jemand zu ihm sagen.
Nie wieder würde er heimkommen können.
Aus den Hügeln drang das Grollen eines Flugzeugmotors. Es musste einer jener schnellen russischen Nachtbomber sein, die weit ins Hinterland flogen. Der Lärm war wie eine Wand, die auf ihn zuraste, er überschwemmte alles, seinen Körper, seine Gedanken, die Welt. Karl löste sich auf, war nur noch Gefühl. Beinahe genoss er es. Doch als das Grollen leiser wurde und er schon aufatmete, kam etwas anderes; ein Geräusch wie von herabfliegenden Tauben. Und er wusste, dass er jetzt Glück brauchte.
Viel Glück.
Er warf sich herum, seine Stiefel rutschten auf dem Boden, die Arme ruderten in der Luft. Aus dem Flattern der Tauben war das heiße Fauchen der Wurfgranaten geworden. Er rannte um sein Leben. Wieder einmal. Die erste Granate detonierte, als er in den Graben sprang, im selben Moment, in dem sich seine Füße vom Boden lösten. Ihr gelber Blitz griff nach ihm. Doch dann war er unter der Erde, prallte auf den nassen, dunklen Boden.
Er lag unten auf der Grabensohle und blickte hinauf ins Nichts. Alles an ihm war mit Erde bedeckt. Seine Hände waren so schmutzig, dass er sich nicht ins Gesicht fassen konnte, aber er spürte ein warmes Sickern an den Schläfen. Vorsichtig probierte er seine Muskeln, dehnte den Nacken, die Beine. Alles war noch da, funktionierte noch.
Er wusste nicht, wie er das fand.
Draußen trafen zu beiden Seiten Faustschläge den Rasen. Die Russen hatten den Lärm des Fliegers ausgenutzt und ihre Abschüsse darunter verborgen. Richtig so, dachte er grimmig, während er nun doch die Schramme an seiner Schläfe betastete. Eine gute Taktik. Er hätte es genauso gemacht.
Als es wieder still war, stand er auf. Die anderen sagten kein Wort, als sie sein Gesicht sahen, schauten nur erschrocken. Sein Fuß pochte. Er humpelte an ihnen vorbei, signalisierte mit zwei Fingern, dass alles in Ordnung war. Er war allein gewesen und hatte dem Zufall keine Wahl gelassen. So war es eben passiert. Und sie nickten, drehten sich wieder zu ihren Posten.
Sie wussten, dass er trotzdem mal wieder Glück gehabt hatte.
Frankfurt 2019
»Frau Weiler?«
Ellen fuhr in die Höhe. Das Lächeln von Dr. Maibach war ebenso routiniert wie ihre Stimme.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie geweckt habe.«
Sie war im Stuhl neben dem Krankenhausbett eingeschlafen. Sofort zuckten Ellens Augen hoffnungsvoll zu ihrer Mutter. Aber Änne hatte sich seit dem Vortag nicht bewegt. Wie eine Wachspuppe lag sie da, das Gesicht zugleich bleich und zart, uralt und auf eine Weise fast ein wenig kindlich.
»Vielleicht holen Sie sich erst mal einen Kaffee? Er ist nicht so schlimm, wie er aussieht.« Frau Maibach musterte sie.
Ellen nickte. Seit sie hier war, hatte sie sicher zehn Kaffee aus dem Stationsautomaten getrunken. Sie waren so schlimm, wie sie aussahen. »Gibt es Neuigkeiten? Kann ich Ihnen etwas anbieten?« Laura hatte am Abend zuvor nicht nur Ännes Sachen gebracht, sondern auch noch den halben Supermarkt leergekauft, auf dem Tisch am Fenster stapelten sich Süßigkeiten, Obst und Zeitschriften. »Mama kann doch gar nichts essen«, hatte Ellen protestiert, als ihre Tochter mit den Tüten angekommen war. »Dann essen wir es eben.« Laura hatte schuldbewusst gelächelt, dann Salat aus der Frischetheke ausgepackt, belegte Brötchen und zwei Flaschen Multivitaminsaft.
Ellen schüttete etwas Saft in einen Pappbecher und, dem aufmunternden Nicken der Ärztin folgend, auch noch in einen zweiten.
Frau Maibach setzte sich ihr gegenüber und trank einen Schluck. »Ich habe tatsächlich etwas herausgefunden. Tut mir leid, dass es gedauert hat, aber die Sache hat sich nun aufgeklärt.« Sie blickte in die Akte, die sie mitgebracht hatte, dann sah sie Ellen an. »Frau Weiler, was ich Ihnen jetzt sage, wird Sie überraschen.« Die Ärztin hielt inne, schien zu überlegen, wie sie formulieren sollte, was sie ihr beibringen wollte. »Ihre Mutter hat keine Epilepsie.«
Man musste ihr die Verwirrung ansehen. »Ich weiß, was Sie jetzt denken.« Beschwichtigend hob die Ärztin die Hand. »Aber es gibt eine Erklärung. Ich habe heute Morgen lange mit der Hausärztin telefoniert. Ihre Mutter leidet höchstwahrscheinlich unter sogenannten dissoziativen Krampfanfällen.«
»Bitte was?« Überrumpelt lehnte Ellen sich zurück. Sie hatte diesen Begriff noch nie gehört.
Dr. Maibach nickte, nahm einen Schluck Saft. »Ein interessantes Phänomen, wenn ich das so sagen darf. Die Anfälle ähneln denen der Epilepsie, deswegen werden sie manchmal verwechselt, auch von Fachleuten. Eigentlich verlieren Menschen bei dissoziativen Krampfanfällen nicht das Bewusstsein, wir führen daher den momentanen Zustand Ihrer Mutter auf den Sturz zurück. Sie hat sich den Kopf angeschlagen, wie Sie wissen, und viel Blut verloren. Da die Antiepileptika offensichtlich keine Wirkung zeigten, hat die Hausärztin schon vor vielen Jahren ein EEG bei Ihrer Mutter durchführen lassen. Es gab keine Auffälligkeiten, somit konnte sie die Epilepsie ausschließen und hat die Medikamente abgesetzt.« Frau Maibach zögerte. »Frau Weiler. Das ist bereits über zehn Jahre her.«
Ellen spürte, wie heiße Wellen durch ihren Körper jagten. Unwillkürlich presste sie die Handflächen gegeneinander. Sie hatte den starken Impuls zu protestieren, der Ärztin zu sagen, dass sie Ännes Anfälle schon oft miterlebt hatte, es sich mithin um einen Irrtum handeln musste. Aber das bedeutete ja nicht, dass nicht ein anderes Krankheitsbild dahinterstecken konnte. Und genau genommen hatte sie es auch nur ein paar wenige Male miterlebt. Und diese paar Male waren lange her.
Bei Ännes erstem Anfall, den sie erinnerte, war sie selbst noch ein Kind gewesen. Ihre Mutter hatte abends beim Fernsehen plötzlich nicht mehr reagiert, als Ellen sie ansprach. Vollkommen unvermittelt hatte Änne zu zucken begonnen, die Augen weit aufgerissen. Als wäre es gestern gewesen, erinnerte Ellen sich an die Panik, die sie übermannt hatte. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was sie tun sollte, hatte ihrer Mutter auf die Wangen geschlagen, sie geschüttelt, ihr irgendwann sogar Wasser ins Gesicht gespritzt. Änne hatte nicht reagiert. Die Zeit, in der sie auf den Notarzt warteten, war Ellen vorgekommen wie Jahre. Irgendwann hatte ihre Mutter aufgehört zu zucken, sie aber immer noch nicht wahrgenommen, nur weiter benommen vor sich hin gestarrt. Schließlich war sie zu sich gekommen. »Du bist hier?«, hatte sie gefragt, Ellen blinzelnd und misstrauisch angesehen, offensichtlich vollkommen verdutzt über ihre Anwesenheit. Und Ellen hatte gleichzeitig panisch gelacht und geschluchzt: »Natürlich. Ich war doch die ganze Zeit hier.«
Ihre Mutter schien ihr nicht zu glauben, hatte sogar die Hand gehoben und vorsichtig ihr Gesicht befühlt. Dann hatte der Notarzt geklingelt.
»Zehn Jahre …«, murmelte Ellen, vollkommen schockiert. »Und sie hat mir nie etwas gesagt?«
Die Ärztin nickte zögerlich. »Ihre Mutter hat sich damals einer Psychotherapie unterzogen und …«
»Entschuldigung. Was?« Ellen fuhr im Stuhl herum, lachte auf, aber es kam bloß ein hysterisches Quietschen aus ihr heraus. »Meine Mutter? Eine Therapie?« Änne stammte aus einer Generation, die nicht an die Psyche glaubte.
Frau Maibach ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Ich bin keine Neurologin und auch keine Psychotherapeutin, aber dissoziative Störungen sind unterbewusste Reaktionen auf überfordernde emotionale Belastungen. Sie sind selten, Frau Dr. Kopp sagte mir, etwa 2–3 von 10000 PatientInnen leiden unter dieser Art von Anfällen. Überwiegend Frauen. Sie werden meist durch ein Trauma ausgelöst.«
»Aber meine Mutter hat doch kein …« Ellen hielt inne. »Meinen Sie etwa, ihr ist etwas passiert, wovon sie uns nichts erzählt hat?« Ihr wurde kalt. Plötzlich hatte sie grauenvolle Bilder im Kopf.
Frau Maibach schüttelte den Kopf. »Die Traumata können sehr lange zurückliegen. Und die Person muss sich auch nicht unbedingt daran erinnern.«
»Oh«, langsam stieß Ellen die Luft aus, die sie unwillkürlich angehalten hatte. »Der Krieg?«
»Es wäre möglich. Wissen Sie viel darüber, was Ihre Mutter damals erlebt hat?«
Ellen blickte zu Änne, die so verloren aussah zwischen den weißen Laken. »Eigentlich nicht.« Sie stockte. »Wir sind aus Schlesien rübergekommen. Nach dem Krieg. Ich war noch ganz klein damals. Sie war ganz alleine. Nur mit mir.«
Die Augen der Ärztin weiteten sich mitfühlend. »Das könnte eine Spur sein. Wer weiß, was Ihre Mutter während der Flucht erlebt hat. Viele Menschen haben ja nie gelernt, darüber zu sprechen. Oder sie wurden nicht gefragt. Man hört das doch so oft.« Sie hob die Schultern. »Als er endlich vorbei war, wollte ja erst mal niemand mehr was vom Krieg wissen. Aber nur, weil alle gelitten haben, macht es das individuelle Erleben nicht unbedingt einfacher.«
Die Ärztin blickte nun ebenfalls zum Bett, ihre Augen verweilten einen Moment auf Ännes Gesicht, dann sah sie wieder auf ihre Armbanduhr. »Ich muss leider weiter. Wir rufen Sie an, wenn Ihre Mutter aufwacht, Frau Weiler. Gehen Sie nach Hause und erholen Sie sich ein wenig. Jetzt können wir ohnehin nichts tun.«
Ellen sah ihr nach, wie sie mit ruhigen und doch schnellen Schritten zur Tür ging, in Gedanken sicher schon beim nächsten Fall. Die Worte der Ärztin hallten in ihrem Kopf nach wie ein vorwurfsvolles Echo.
Oder sie wurden nicht gefragt.
Sofort hatte sich etwas in ihr schuldbewusst verkrampft. Dabei stimmte es nicht einmal. Sie hatte gefragt.
Aber sie hatte nie eine Antwort bekommen.
»Du siehst müde aus.«




























