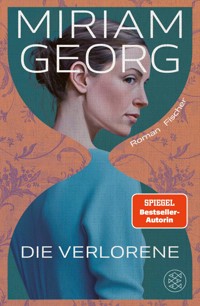9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine hanseatische Familiensaga
- Sprache: Deutsch
Das Leuchten einer neuen Welt Lily Karsten ist Tochter einer der erfolgreichsten Reederfamilien Hamburgs. Sie lebt in einer Villa an der Bellevue und träumt von der Schriftstellerei. Und sie glaubt, dass sie ihren Verlobten Henry liebt. An einem heißen Sommertag 1886 hält sie bei einer Schiffstaufe die Rede, als plötzlich eine Windbö ihren Hut in die Elbe weht. Ein Arbeiter soll ihn zurückholen – und gerät in einen grauenhaften Unfall. Jo Bolten lebte als Kind im Elend des Altstädter Gängeviertels, jetzt arbeitet er im Hafen für Ludwig Oolkert, den mächtigsten Kaufmann der Stadt. Jo will bei den Karstens für seinen verletzten Freund um Hilfe bitten, aber er wird kaltherzig abgewiesen. Lily will unbedingt helfen! Also nimmt Jo sie mit in seine Welt, in der der tägliche Kampf ums Überleben alles bestimmt. Mit eigenen Augen sieht Lily das Elend der Menschen und erkennt die Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen. Bald kommen Lily und Jo sich näher. Doch eine Verbindung zwischen ihnen ist undenkbar. Und Jo hat ein Geheimnis, von dem Lily niemals erfahren darf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 831
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Miriam Georg
Elbleuchten
Eine hanseatische Familiensaga
Über dieses Buch
Das Leuchten einer neuen Welt
Lily Karsten ist Tochter einer der erfolgreichsten Reederfamilien Hamburgs. Sie lebt in einer Villa an der Bellevue und träumt von der Schriftstellerei. Sie glaubt, dass sie ihren Verlobten Henry liebt.
An einem heißen Sommertag 1886 hält sie bei einer Schiffstaufe die Rede, als plötzlich eine Windbö ihren Hut in die Elbe weht. Ein Arbeiter soll ihn zurückholen – und gerät in einen grauenhaften Unfall.
Jo Bolten lebte als Kind im Elend des Altstädter Gängeviertels, jetzt arbeitet er im Hafen für Ludwig Oolkert, den mächtigsten Kaufmann der Stadt. Jo will bei den Karstens für seinen verletzten Freund um Hilfe bitten, aber er wird kaltherzig abgewiesen.
Lily will unbedingt helfen! Also nimmt Jo sie mit in seine Welt, in der der tägliche Kampf ums Überleben alles bestimmt. Mit eigenen Augen sieht Lily das Elend der Menschen und erkennt die Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen. Bald kommen Lily und Jo sich näher. Doch eine Verbindung zwischen ihnen ist undenkbar. Und Jo hat ein Geheimnis, von dem Lily niemals erfahren darf …
Vita
Miriam Georg, geboren 1987, ist freiberufliche Korrektorin und Lektorin. Sie hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur sowie einen Master mit dem Schwerpunkt Amerikanisch-Indianische Literatur. Aus Liebe zu schönen Dingen betreibt sie außerdem ein Schmucklabel unter dem Namen Mina Gold. Wenn sie sich nicht auf einer ihrer Reisen befindet, lebt die Autorin mit ihrer gehörlosen kleinen Hündin Rosali und ihrer Büchersammlung in Berlin-Neukölln.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shutterstock, Magdalena Zyzniewska/Trevillion Images, Richard Jenkins
Karte Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-00693-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Mutter
Stets gibt es ein Begehren, das mitreißt,
ein Gebot der Schicklichkeit, das zurückhält
Gustave Flaubert
Teil 1
Prolog
Die Augen der Frau glänzten wie im Fieberwahn. Mit den Ellbogen bahnte sie sich einen Weg durch die Menschenmenge. Schweiß strömte ihr über das Gesicht, ihr Kleid war zerrissen und voller Rußflecken. Mit der einen Hand zerrte sie ein rotnasiges Mädchen hinter sich her, mit der anderen presste sie einen Säugling an ihre Hüfte.
Alfred Karsten sah sie als Erster. Auf der Suche nach seiner Tochter ließ er den Blick über die Köpfe schweifen und versuchte, zwischen den wippenden Hüten der Damen und den Zylindern der Herren Lilys rote Haare auszumachen. Er zuckte zusammen, als er dem Blick der Frau begegnete. An der Art, wie sich die brennenden Augen an ihn hefteten, erkannte er sofort, dass ihre Wut ihm galt. Einen Moment hielt er inne, überlegte mit gerunzelter Stirn, was sie wollen konnte. Es war offensichtlich, dass sie nicht zu den Gästen gehörte. Sie war direkt aus dem Schlamm der Gängeviertel gekrochen, beinahe konnte er das Elend an ihr riechen. Durch die entsetzten Blicke, die ihr folgten, und den Abstand, den die Menschen, die sie rechtzeitig bemerkten, zu ihr hielten, fand er diese Vermutung bestätigt. Er wollte sich schon wieder abwenden und eine Anweisung geben, die Frau diskret zu entfernen, der festen Überzeugung, dass sie doch nur zufällig hier inmitten der feinen Gesellschaft gelandet war. Aber als die Frau plötzlich einer Dame im violetten Tournürenkleid einen Stoß in den Rücken gab, weil sie ihr den Weg versperrte, die Dame nach Luft schnappte und beinahe ihren Sonnenknicker fallen ließ, löste er sich abrupt aus seiner Starre. Diese Fremde hatte soeben eine der bekanntesten Kommerzienrätinnen Hamburgs öffentlich angegriffen. Eine Anzeige würde sie ohne Prozess ins Zuchthaus bringen. Dass sie das riskierte, ja nicht einmal zu merken schien, was sie getan hatte, zeigte ihm, dass etwas mit der Frau ganz und gar nicht stimmte. Sie sah krank aus, manisch.
Noch immer hatte sie ihren Blick keine Sekunde lang von ihm genommen.
Ihm schoss ein leiser Schauer durch den Körper, der die Haare an seinen Armen wie elektrisiert aufstehen ließ. Einem Instinkt folgend, schob er seine Frau Sylta ein Stück hinter sich, die verwirrt zu ihm aufsah, und nickte dann Franz zu. Sein Sohn brauchte nur wenige Sekunden, um die Situation zu erfassen. Ohne seinen gelassenen Gesichtsausdruck zu verändern, bellte er einen knappen Befehl in Richtung der Hafenarbeiter, die sie für den heutigen Tag als Sicherheitsmänner angeheuert hatten. Die Männer standen mit auf dem Rücken gefalteten Händen in einer Reihe hinter der Bühne und blickten starr geradeaus. Sofort lösten sich drei von ihnen aus der Formation und traten der Frau entgegen. Doch bevor sie sie zu fassen kriegten, begann sie zu schreien. «Karsten! Mein Mann ist als Krüppel von deinem Schiff runtergekommen. Sieben Kinder und kein Vater. Wir werden alle im Elend verrecken. Zehn Jahre hat er für die Reederei gearbeitet, und dann wird er davongejagt wie ein räudiger Hund!»
Einer der Männer packte die kreischende Frau um die Taille und versuchte, sie fortzuziehen, während die anderen sie von der Menge abschirmten. Sie ließ das Mädchen los, kratzte und schrie, versuchte, ihn zu beißen. Fast wäre ihr dabei der Säugling aus den Armen gefallen. Der Mann fasste sie grob an den Haaren und drehte ihr die freie Hand auf den Rücken. Als sie merkte, dass sie keine Chance hatte, veränderte sich plötzlich ihr Tonfall, das Kreischen wurde zu einem verzweifelten Flehen. «Bitte! Wie sollen wir überleben?», rief sie. «Mein Mann braucht Arbeit! Meine Kinder werden sterben.» Wie um ihre Worte zu bestätigen, begannen beide Kleinen, laut zu weinen.
«Schafft sie fort!», knurrte Franz, der gleichzeitig beruhigend in die Menge lächelte und einem weiteren Arbeiter zunickte, der sofort herbeieilte, um die anderen zu unterstützen. Kurzentschlossen packte der Mann das Mädchen, warf es sich über die Schulter und trug es davon. Die anderen fassten die Frau an den Armen und zerrten sie hinter ihm her. Bald waren ihre verzweifelten Rufe und das Weinen der Kinder unter dem aufgeregten Gemurmel der Menge nicht mehr zu hören.
Alfred wischte sich verstohlen mit seinem Einstecktuch über die Stirn. Das hätte auch anders ausgehen können. In Situationen wie diesen war es gut, Franz an seiner Seite zu haben, der nie Skrupel zeigte, wenn es darum ging, mit harter Hand durchzugreifen. Er lächelte den Umstehenden beschwichtigend zu, die zwar ein wenig aufgewühlt schienen, aber nicht wirklich beeindruckt. Jeder hier war in einer ähnlichen Situation und wusste, dass ihn keine Schuld an dem Zwischenfall traf. Einen Moment durchzuckte ihn der Gedanke, dass die Frau recht hatte. Sie würde vermutlich verhungern. Genau wie ihre Kinder. Der Säugling hatte bereits mehr tot als lebendig ausgesehen. Wenn der Vater als Brotverdiener wegfiel, blieb ihr nichts anderes übrig, als die größeren Kinder zum Betteln zu schicken, was wohl kaum eine neunköpfige Familie ernähren würde. Es war eine grausame Welt, ein grausames System, in dem sie lebten, aber er hatte es nicht erfunden. Sollte er vielleicht jedem seiner Arbeiter Krankengeld zahlen? Er schnaubte bei dem lächerlichen Gedanken leise auf. Es wäre sein Ruin! Es gab nun mal keine Lösung für solch ungerechte Situationen, die Frau würde sich, wie so viele ihresgleichen, in ihr Schicksal fügen müssen. Und dennoch … Etwas an dem kleinen Mädchen, das an ihrem Rockzipfel gehangen hatte, ließ ihn nicht los. Es erinnerte ihn auf seltsame Weise an Lily, der schüchterne, aber neugierige Blick, die feinen Sommersprossen auf der Nase. Er schüttelte den Kopf, wie um sich zur Ordnung zur rufen, und war über sich selbst überrascht, als er sich plötzlich seinem Sohn zuwandte und ihm ins Ohr flüsterte. «Lass anweisen, dass ich der Frau fünfzig Mark als Entschädigung zukommen lasse!»
Franz verzog keine Miene, aber der Blick, mit dem er auf seine Worte regierte, war voll ungläubigem Staunen. «Bist du von Sinnen?», zischte er.
«Tu es einfach!» Alfred hatte keine Lust auf eine Diskussion. Er drehte sich um, aber Franz fasste ihn grob am Ärmel. «Wenn wir ihr etwas geben, kommen sie bald alle angekrochen!»
Er zögerte einen Moment. Es war ein berechtigter Einwand. «Schön. Sie kriegt das Geld nur, wenn sie niemandem erzählt, woher es kommt. Sollte jemand bei uns erscheinen und sich auf sie berufen, werde ich eine sofortige Rückzahlung verlangen. Das sollte sie zum Schweigen bringen!»
Franz war nicht besänftigt. «Vater, das ist eine vollkommen schwachsinn…»
«Mach bitte, was ich sage!» Alfreds schneidende Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Sein Sohn würde in absehbarer Zukunft die Geschäfte und damit sein gesamtes Lebenswerk übernehmen. Aber noch traf er die Entscheidungen.
Franz wandte sich nach einem letzten ungläubigen Blick zähneknirschend ab, um die Anordnung weiterzugeben.
Alfred seufzte leise und ließ den Blick über die Titania schweifen. Das Schiff war eine Augenweide, er hätte nicht stolzer sein können. Traditionell gefertigt und doch mit der modernsten deutschen Technik ausgestattet. Den Stapellauf hatte sie schon in Liverpool hinter sich gebracht, wo sie gebaut worden war, aber die Taufe musste hier stattfinden, auf Hamburger Wasser, mit Hamburger Traditionen.
Die Segel waren über die Toppen geflaggt, die blau-weiß gestreifte Karsten-Flagge war gehisst, und am Bug hing ein großer Kranz aus Blumen. Alles war bereit. Nun gab es nur noch ein Problem: Die Taufpatin fehlte. Ohne sie konnte die Zeremonie nicht losgehen. Er zog seine Taschenuhr hervor und warf einen nervösen Blick darauf. Sie hätte längst hier sein müssen.
Wo blieb Lily?
1
Lilys Hand ruhte bewegungslos auf dem Papier. Ein kleiner Klecks Tinte war von der Feder auf das Blatt gefallen und hatte dort eine blaue Träne gebildet. Sie lief an den Rändern leicht auseinander, wo die Fasern des Papiers die Oberfläche des Tropfens aufbrachen. Aber Lily bemerkte es nicht. Sie starrte vor sich hin, die Stirn nachdenklich gekräuselt, sodass über ihrer Nase jener kleine Kreis entstand, den ihre Mutter immer liebevoll ihre Denkerfalte nannte.
Über Hamburg flimmerte die Luft, der Himmel war ein endloser blauer Ozean. Eine Glocke aus Hitze schien sich über die Stadt gelegt zu haben und jede Bewegung in ihrem Inneren zu ersticken. Nicht einmal das Wasser der Alster, die Lily von ihrem Schreibtisch aus sehen konnte, schillerte wie sonst in kleinen, wirbelnden Mustern. Der Fluss glitt träge dahin wie ein grünblauer Spiegel.
Die Farben des Wassers, der schwere Duft der Kletterrosen vor ihrem Fenster und die seltsame Stille, die über der Stadt lag, lösten ein Gefühl in Lily aus. Ein beinahe schmerzhaftes Gefühl, das ein Ziehen in ihrer Brust verursachte. Sie kannte dieses Gefühl. Es überkam sie oft an heißen Tagen, wenn der süße Hauch des Sommers allgegenwärtig war. Besonders stark wurde es an den Abenden, an denen sie mit ihrer Mutter und Michel auf der Terrasse saß und sie sich vorlasen. Schon seit ein paar Minuten suchte sie nach einem Wort, um das Gefühl zu beschreiben. Sehnsucht hatte sie bereits durchgestrichen. Das traf es nicht. Auch Melancholie war nicht das, was sie suchte. Es war etwas Ähnliches, aber sie wollte das perfekte Wort finden, das Wort, das ihr Gefühl so präzise wie möglich spiegelte. «Wenn ihr mit wenigen Sätzen genau das ausdrücken könnt, was ihr fühlt, dann könnt ihr schreiben!», hatte Frau Finke, ihre alte Lehrerin, immer gesagt. Und Lily hatte sich das zu Herzen genommen.
Nur gelang es ihr einfach nicht.
Sie schrieb Vorahnung auf und blickte mit gerunzelter Stirn auf die leicht nach rechts geneigten Buchstaben Auch das traf es nicht genau, aber ein wenig Wahrheit steckte doch darin. Sie fühlte sich, als würde sie auf etwas warten, als trage die Luft ein Versprechen auf die Zukunft in sich. Trotzdem zog sie energisch einen Strich durch das Wort. Eine halbe Wahrheit konnte sie nicht gebrauchen, sie wollte Genauigkeit.
Ein paar Wochen später würde sie beim Durchblättern der Seiten ein Schauer durchrieseln. Im Schatten der Ereignisse hatte das Wort eine vollkommen neue Bedeutung bekommen.
Aber in diesem Moment umschrieb es nicht mehr als die Vorfreude auf einen langen, heißen Sommer, in dem sie vor allem schreiben wollte. Schreiben und lesen. Und tanzen. Und küssen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Aber die bestimmte Henry. Er war immer so korrekt, so streng auf die Einhaltung von Regeln bedacht, als hinge sein Leben davon ab. Sie durften sich offiziell nur in Begleitung sehen, und anstatt dieses Gebot zu umgehen und ihr heimlich Avancen zu machen, wie man es erwartete, bestand er strikt auf dessen Einhaltung. Manchmal war sie fast ein wenig wütend darüber, wie wenig Mühe er sich gab, sie zu umwerben. Ja, sie waren einander bereits versprochen, sogar offiziell verlobt. Aber das hieß doch nicht, dass er jetzt aufhören konnte, ihr Briefe zu schreiben und ihr das Gefühl zu geben, schön und begehrenswert zu sein. «Du nimmst mich bereits für selbstverständlich!», hatte sie ihm einmal vorgeworfen, und er hatte sie entsetzt angeblickt und Besserung gelobt. Die sie dann auch bekam – in Form von Schokolade und einem Gedicht.
Schokolade und Gedichte waren ja nicht schlecht, man konnte auf jeden Fall am Seminar damit angeben, auch wenn Henry das Gedicht nicht selbst, sondern von Brentano abgeschrieben hatte. Brentanos Gedichte waren ihr zu lieblich. Sie wollte aufregende Küsse in der Halle und romantische, nächtliche Treffen, für die sie sich aus dem Haus schleichen musste, wie in den Büchern, die Berta ihr heimlich auslieh und die sie im Regal hinter Goethe versteckte. Doch für so was war Henry einfach nicht zu haben. Als sie daran dachte, dass sie ihn heute bei der Schiffstaufe sehen würde, lächelte sie. Verliebt war sie, da gab es keinen Zweifel. Er hatte sie abholen wollen, aber er war so beschäftigt mit seinem Medizinstudium, stand kurz vor seinem Abschluss. Sie konnte genauso gut mit Franz fahren. Ihre Eltern waren bereits vor über zwei Stunden aufgebrochen, es gab vor den Feierlichkeiten noch einen Empfang in den Alsterarkaden, und Lily hatte sich gesträubt mitzukommen. Sie fand Empfänge entsetzlich langweilig. Als sie jetzt über die Taufe nachdachte, wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie schon viel zu lange hier saß. Sie musste sich fertig machen!
Die stehende Luft im Raum ließ einen starken Geruch nach Teppich und altem Holz aus den Zimmerritzen hervorkriechen und gab einen Vorgeschmack darauf, wie heiß es bei der Taufe werden würde, die im Freien und – soweit sie wusste – ohne Schatten stattfand. Puder sollte sie also lieber nicht auflegen, der würde ihr nur über die Wangen hinablaufen. Dafür hatte sie auch gar keine Zeit mehr. Nach einem erschrockenen Blick auf die Standuhr im Flur hastete sie zu ihrer Kommode. Gut, dass Seda ihr heute Morgen bereits die Haare aufgesteckt hatte. Nur ein paar rote Locken waren der kunstvollen Frisur entwischt und mussten zurück an ihren Platz geschoben werden. Eine müßige Arbeit, da sie sowieso wieder hervorspringen würden, sobald Lily sich bewegte. Ihr neues Kleid hing gestärkt und duftend am Schrank. Sie warf einen missmutigen Blick darauf. In Weiß sah sie blass und gespenstisch aus. Sie fühlte sich dann immer, als würde sie in dem Stoff verschwinden. Aber ihr Vater hatte darauf bestanden. «Eine Taufpatin muss so jung und unschuldig wie möglich aussehen, was kann das besser unterstreichen als ein weißes Spitzenkleid?»
Eine Haarklammer zwischen den Lippen, sprang sie hastig aus ihrem Hausmantel und klingelte an der kleinen Glocke neben ihrem Bett. «Seda, ich bin zu spät!», rief sie in den Flur, in der Hoffnung, dass Seda vielleicht schon in der Nähe war. Sie klingelte schnell noch einmal. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie spät sie tatsächlich dran war. Franz würde jeden Moment hereinkommen, und sie war noch nicht zur Hälfte fertig.
In ihrer Chemise setzte sie sich vor den Spiegel, griff nach dem Rouge und malte hastig ein wenig Rot auf ihre Wangen. «Oh verflixt, das war zu viel!» Nun sah sie aus, als hätte sie Fieber. Sie tauchte ein Tuch in die Schale mit Wasser und rubbelte sich über das Gesicht. Das machte es nicht besser, nun klebte ihr das Rot in nassen Schlieren an den Wangen. Schnell drehte sie das Tuch um und rieb mit dem trockenen Ende, so fest sie konnte, über die Farbe. Als sie fertig war, standen die kleinen Locken am Rande ihres Gesichts wie elektrisiert in die Höhe, ihre Wangen glühten. «Gut, dass ich heute nicht vor fast hundert Leuten eine Rede halten muss», sagte sie zu ihrem Spiegelbild und zog eine Grimasse. «Oh, warte. Doch, das war heute!» Sie seufzte und warf das Tuch in die Ecke. Wie war das nun wieder passiert, sie hatte doch so viel Zeit gehabt. Den ganzen Vormittag! Wie immer, wenn sie an ihrem Schreibtisch saß, die Gedanken zu Worten wurden, die Worte zu Sätzen, die Sätze zu Figuren und Geschichten, machte die Zeit einfach, was sie wollte. Sie verflüssigte sich, verschwamm, und wenn Lily aufsah und meinte, es sei doch nur ein Moment vergangen, war sie einfach nicht mehr da.
Ihr Blick fiel auf ihren neuen Hut. Sie biss sich auf die Lippen. «Auf keinen Fall!», hatte ihr Vater gesagt. «An jedem anderen Tag, aber nicht zur Taufe!» Lily wusste, dass er es ernst gemeint hatte. Ein wenig gewagt war der Hut, das stimmte schon. Groß und dunkelgrün, mit einer enormen wippenden Feder und einem breiten Band mit kleinen Punkten. Extravagant und auf jeden Fall auffallend, nach der neuesten Mode, die ihrem konservativen Vater prinzipiell nicht gefiel, egal, wie sie aussah. Aber Lily liebte diesen Hut. Und er würde ihrem Gesicht etwas Schatten spenden. Während sie noch überlegte, ob sie es wagen konnte, die Anweisung ihres Vaters zu missachten, kam Seda herein. «Wir sind spät dran, oder?», fragte sie und griff nach dem Korsett, das auf dem Bett bereitlag.
«Sehr spät!» Lily ließ die Unterwäsche fallen, hob die Arme und stellte sich vor Seda, sodass diese es ihr überstreifen konnte. Nicht nur das Kleid, auch das Korsett war nach der neuesten Mode gefertigt. Es war lang, presste den Bauch weg und formte Hüfte, Brust und Gesäß nach außen. Schon wie Seda es da in den Händen hielt, sah es furchtbar schmal und unbequem aus. Lily hatte es erst einmal kurz anprobiert und Seda nach wenigen Minuten gebeten, es wieder aufzuschnüren, weil sie sich gefühlt hatte wie in einem Käfig. Wie sie einen so drückend heißen Tag darin überstehen sollte, war ihr schleierhaft. Sie musste unbedingt an ihr Riechfläschchen denken, damit sie nicht von der Bühne in die Menge kippte.
«Für Schönheit muss man eben leiden!», bemerkte Seda, als sie Lilys gequälten Gesichtsausdruck im Spiegel sah, und lächelte ihr aufmunternd zu.
Lily nickte mit aufeinandergepressten Lippen und hielt sich am Bettpfosten fest. Das Kammermädchen zog, so fest es ging, an den Schnüren, die die Federstahlbänder gegen ihren Körper pressten und ihren Bauch in die moderne Kürasstaille formten. Lily zuckte bei jedem Zug zusammen und spürte, wie ihre Gedärme immer enger zusammengedrückt wurden. Es fühlte sich an, als hätte sie einen dicken Stein im Magen.
Seda holte das Maßband hervor und schlang es mit konzentrierter Miene um Lilys Taille. «Dreiundfünfzig Zentimeter.» Sie nickte zufrieden.
«So könntest du an den Straßenecken gutes Geld verdienen!», sagte eine Stimme hinter ihr.
Lily fuhr herum. Franz stand im Türrahmen. Er blickte sie mit leicht verächtlichem Ausdruck im Gesicht an. Sofort überzog eine hektische Röte Sedas Wangen, schüchtern sah sie zu Boden. Lily wusste, dass das Hausmädchen ihren großen Bruder attraktiv fand, sogar ein wenig in ihn verliebt war. Franz tat jedoch wie immer so, als befände sie sich gar nicht im Raum.
«Charmant wie stets!», zischte Lily ihm als Antwort zu, und er verzog spöttisch einen Mundwinkel.
«Die Pferde sind eingespannt. Wir müssen los.»
«Du siehst doch, dass ich noch nicht fertig bin!»
«Du hattest den ganzen Tag Zeit.»
«Ja, aber es dauert nun mal noch. Sie werden schon nicht ohne mich anfangen.» Wie immer, wenn sie mit Franz sprach, stahl sich eine schnippische Gereiztheit in ihren Ton.
Ihr Bruder lehnte sich im Türrahmen nach hinten und warf einen Blick auf die Uhr in der Halle. «Du willst also eine ganze Festgesellschaft auf dich warten lassen? Typisch. Die Erde dreht sich ja auch um Lily Karsten.» Er zog die Augenbrauen hoch. «Ich gebe dir noch fünf Minuten. Die Pferde stehen in der Sonne», sagte er ungerührt, und mit einem weiteren abschätzigen Blick auf ihre aus dem Korsett quellenden Brüste war er verschwunden.
Lily zischte eine derbe Verwünschung hinter ihm her, die Seda schockiert zusammenzucken ließ. «Als würden ihn die Pferde kümmern! Er will mich einfach nur bloßstellen.» Fünf Minuten konnte sie niemals schaffen. Sie musste noch ins Kleid, und ihre Haare waren auch noch nicht fertig. «Er wird es nicht wagen …», murmelte sie und wusste doch zugleich, dass er es sehr wohl wagen, ja sogar genießen würde, ohne sie loszufahren und sie vor aller Welt zu blamieren. Einen Moment überlegte sie fieberhaft. «Seda, lauf rasch nach unten und sag Agnes, dass Toni die Droschke für mich anspannen soll. Franz wird ohne mich fahren, ich weiß es genau!»
Seda ließ sofort das Maßband fallen und eilte zur Tür hinaus. Einen Moment stand Lily ratlos da, überlegte, welche Aufgabe sie ohne Hilfe bewältigen konnte und lief schließlich zum Spiegel, um ihre Haare zu ordnen. Doch schon nach wenigen Sekunden wurde ihr klar, dass es aussichtslos war. Die Luftfeuchtigkeit war zu hoch, die Locken kringelten sich in alle Richtungen. Frustriert warf sie die Haarnadeln wieder in die Schale. In dem Moment hörte sie durch das offene Fenster die Hufe der Pferde auf dem Kies. «Was? Die fünf Minuten sind doch noch nicht einmal um!», rief sie und hastete auf den Balkon. Sie sah gerade noch Franz’ Zylinder und sein hämisches Grinsen, als er ihr kurz durch das Fenster der Kutsche zuwinkte, die aus dem Tor hinaus die Bellevue hinabfuhr. Lily trat wütend mit dem Fuß gegen das Geländer und zuckte zurück, als ein stechender Schmerz ihr Bein hinauffuhr. «Du Mistkerl!», brüllte sie ihm hinterher, aber die Kutsche war schon hinter den Bäumen der Allee verschwunden.
Sie hüpfte auf einem Bein ins Zimmer zurück. «Seda! Wo bleibst du?», rief sie verzweifelt. Jetzt musste sie sich wirklich, wirklich beeilen.
Fünfzehn Minuten später eilte Lily Karsten die große Treppe in der Halle hinunter. Ihre Wangen waren noch immer einen Hauch zu rot, aber sie war tadellos geschnürt und zurechtgemacht. Die Taille in dem weißen Kleid sah aus, als würde sie bei der ersten unbedachten Bewegung zerbrechen. Als sie einen letzten Blick in den Spiegel über dem Kamin warf, kam ihr Agnes, ihre Haushälterin, mit sorgenvoller Miene entgegen.
«Oh, Lily. Wir haben ein Problem!», rief sie. Dann stockte sie, und ihr Blick glitt nach oben. «Aber ich dachte … Dein Vater hatte doch verboten … der grüne Hut …» Wie immer, wenn niemand anderes in der Nähe war, duzte sie Lily.
«Jaja, ich weiß, es ging nicht anders! Ich muss meine Haare verdecken.» Lily, die sich in letzter Sekunde doch für die Rebellion entschieden hatte und es bereits bereute, winkte rasch ab, damit Agnes sie nicht noch mehr verunsicherte. «Was gibt es für ein Problem?»
«Das Pferd lahmt», verkündete die Haushälterin mit Grabesmiene. «Toni hat es eben erst bemerkt. Die Droschke kann nicht fahren!»
«Was?» Lily starrte sie entsetzt an. Kleine Punkte tanzten vor ihren Augen, und sie musste sich kurz am Geländer festhalten. Es liegt am Korsett, dachte sie, und atmete so tief ein und aus, wie es ihr möglich war. Oder an dem Gedanken an eine ungeduldige Festgesellschaft der Hamburger Oberschicht, die in der stechenden Hitze auf sie wartete. «Das darf nicht wahr sein!», keuchte sie.
«Was machen wir nun?» Agnes schlug bekümmert die Hände zusammen. Wie immer, wenn sie sich aufregte, sah sie aus wie ein aufgeplustertes Huhn. Lily fing sich, holte tief Luft und eilte an ihr vorbei aus dem Haus.
Draußen in der kreisrunden Einfahrt stand die kleine Droschke, die ihr Vater benutzte, wenn er alleine ausfuhr. Silber, der schwarze Hengst, den sie letzten Herbst gekauft hatten, stand schnaubend davor. Toni bückte sich gerade und begutachtete seinen Vorderhuf. «Was hat er?», fragte Lily, die schon von den wenigen Stufen atemlos keuchte.
«Tag, Fräulein Lily!» Toni lüpfte seine Mütze, ohne dabei den Huf loszulassen. «Ich weiß es nicht, der Knöchel ist geschwollen. Der kann so auf keinen Fall laufen.»
«Dann hol schnell ein anderes Pferd!» Lily wischte sich über die Stirn. Schon jetzt begann sie zu schwitzen. «Ich bin schon viel zu spät», rief sie verzweifelt.
Toni nickte mit zusammengezogenen Augenbrauen. «Ich habe schon Bescheid gegeben, aber es wird ’nen Moment dauern.»
Lily wusste, dass er recht hatte. Er musste Silber abspannen, das neue Pferd, das noch nicht mal in Sichtweite war, einspannen, vielleicht sogar noch striegeln oder die Hufe auskratzen. «Dafür ist keine Zeit!»
Der Stallaufseher fuhr sich ratlos mit der Hand über den Kopf. Agnes, die hinter Lily hergeeilt war, knetete ihre Schürze. «Was sollen wir nur tun?», rief sie. Ihre Wangen hatten unter der Haube stechende rote Flecken bekommen. «Wenn du nicht rechtzeitig kommst, wird es eine Katastrophe!»
«Ich weiß!» Lily stöhnte und sah sich hilfesuchend um, als erwartete sie, wie von Zauberhand eine Droschke die Einfahrt hinauffahren zu sehen. «Verflixter Franz, der mich einfach stehenlässt!» Sie stampfte mit dem Fuß auf wie ein kleines Kind und hätte sich am liebsten die Haare gerauft. Plötzlich fiel ihr Blick auf etwas Glänzendes, das neben dem Pfeiler der Eingangstür an der Wand lehnte.
Franz’ neues Fahrrad.
Lily runzelte die Stirn. Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Ein vollkommen abwegiger, verrückter Gedanke. Sie biss sich auf die Lippen. Könnte sie es wagen? Nein, es war ganz und gar unschicklich. Oder? Sie hatte Bilder von Frauen auf Fahrrädern gesehen. Allerdings waren das Radrennen gewesen, Sportwettkämpfe, und sie hatten in Belgien und Frankreich stattgefunden. Nicht in Hamburg. Und mit einem Kleid wie dem ihren? Nein, es war zu verrückt. Sie wusste, wie man fuhr, hatte Franz so lange angebettelt, bis er grummelnd im Hof mit ihr übte. Mit seinem alten Hochrad hatte sie nicht umgehen können, aber dies hier war ein modernes Niederrad, ganz neu auf den Markt gekommen und somit auch für sie leicht zu handhaben. Es war ein herrliches Gefühl gewesen, der Wind im Haar, das Rattern der Räder auf dem Kies. Michel war lachend um sie herumgesprungen und hatte versucht, sie einzufangen. Sie hatte sich frei gefühlt. Als könnte sie einfach die Einfahrt hinunter auf die Bellevue sausen und verschwinden. Wo auch immer sie hinwollte, ihre Beine würden sie in Windeseile an ihr Ziel bringen. Sie beneidete ihren großen Bruder glühend darum, dass er in der Stadt damit fahren konnte. Extra aus England hatte er das Fahrrad kommen lassen und stolze dreihundert Mark dafür gezahlt. «Wenn du es zerkratzt und ich es bemerke, bist du besser nicht in der Nähe!», hatte Franz gedroht, und sie wusste, dass er es ernst meinte.
Aber sie hatte ja auch nicht vor, es zu zerkratzen. Fahrrad fahren war kinderleicht, wenn man erst mal den Dreh raushatte. Zwar würde es schwierig werden, nicht mit dem Rock hängen zu bleiben. Aber wenn sie mit einer Hand ihr Kleid hielt und mit der anderen lenkte … Sie warf einen Blick in Agnes’ und Tonis ratlose Gesichter. «Ich werde einen Jungen zum Marktplatz schicken, damit er eine Mietdroschke anhält!», schlug Agnes jetzt vor, aber Lily winkte ab.
«Bis er wieder da ist, ist die Taufe vorbei!» Sie zögerte noch eine Sekunde, dann marschierte sie entschlossen los. Mit den Pferden war sie auch nicht viel schneller als mit dem Rad, und so konnte sie wenigstens sofort losfahren. Sie musste nur sichergehen, dass die Festgesellschaft sie nicht sah.
Sonst würde sie einen Skandal auslösen.
Zuversichtlich lächelte Alfred Karsten in die erwartungsvollen Gesichter. Alle waren gekommen, Hamburgs Erster und Zweiter Bürgermeister Petersen und Kirchenpauer, der Stadtrat, Gerhard Weber und Jens Borger, seine wichtigsten Investoren. Er sah Ludwig Oolkerts gelbes Haar in der Sonne aufblitzen. Dass der wirklich aufgetaucht war, wunderte ihn etwas. Oolkert gehörte der Rosenhof, das erste und bisher einzige Kontorhaus Hamburgs und – wenn man ihm glaubte – das modernste der Welt. Seit Anfang des Jahres hatte auch die Reederei Karsten ihren Sitz dorthin verlegt. Trotzdem war das Verhältnis zwischen ihm und Oolkert gelinde ausgedrückt unterkühlt. Er wurde einfach nicht warm mit diesem Mann. Doch er rechnete es ihm hoch an, dass er heute die Geschäfte ruhenließ, um die Karstens zu unterstützen. Natürlich geschah dies nicht ohne Hintergedanken, das war ihm durchaus bewusst. Dennoch war es eine noble Geste.
Er sah sich um. Die halbe Bellevue und große Teile der Elbchaussee waren versammelt – und alle schwitzen sie grandios in ihren feinen Kleidern und Anzügen. Hamburg schien zu kochen. Die Damen wedelten sich mit Federn und Fächern Luft zu, und die Herren tupften sich verstohlen kleine Schweißrinnsale von den Schläfen. Langsam wurde Alfred Karsten unruhig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine der Frauen die Enge ihres Korsetts und die Hitze nicht mehr aushielt. Die Gattin von Gerhard Weber wirkte bereits etwas grün um die Nase. Im Hafen roch es nie besonders gut, aber heute schien die Luft alle Ausdünstungen der Stadt zu einem einzigen schrecklichen Gestank zu verkochen, der wie ein trüber Schleier in der Luft lag und sogar ihm ein Druckgefühl im Magen bescherte. Er durfte die Leute nicht länger warten lassen. Wenn Lily nicht sofort kam, musste er jemand anderes finden. Sylta konnte nicht einspringen, der Tradition nach musste die Taufpatin eine Jungfrau sein. Unauffällig sah er sich um und merkte, wie er immer ärgerlicher wurde. Man konnte sich einfach nicht auf Lily verlassen, es war immer wieder dasselbe. Sie schwebte mit dem Kopf in den Wolken – oder, besser, in Büchern. Prinzipiell hieß er das gut, aber es ließ sie zu verträumt werden. Es war eine Ehre, als Taufpatin für ein so bedeutendes Schiff wie die Titania ausgewählt zu werden. Eine große Ehre. Nicht nur schien sie dies nicht zu würdigen, sie schien es gar nicht zu verstehen. Er wusste ja, dass die Reederei für sie nicht die gleiche Bedeutung hatte wie für den Rest der Familie, dass sie Schiffe langweilig fand und nicht verstand, was ihn daran so faszinierte. Aber trotzdem. Ein Mindestmaß an Anstand konnte er doch immerhin noch erwarten. Die Diskussion, die er hatte aushalten müssen über ihren scheußlichen neuen Hut! Allein der Gedanke ließ ihn mit den Zähnen knirschen. Dass sie tatsächlich bei einer Schiffstaufe Grün tragen wollte! Zum Glück hatte Franz sie schnell zum Schweigen gebracht. Er war oft zu harsch mit seinen Geschwistern, aber mit ihm diskutierte Lily wenigstens nicht so lange. Alfred seufzte und sah sich um. Manchmal dachte er, dass er und Sylta in ihrer Erziehung zu liberal gewesen waren. Lily hatte ihren eigenen Kopf. Prinzipiell gefiel ihm das, Sylta war genauso, jedoch auf eine ruhigere, weniger aufsässige Weise. Er war absolut dafür, dass Frauen für sich selbst dachten.
Doch manchmal vergaß Lily ihren Platz.
In diesem Moment ging ein Raunen durch die Menge, Köpfe drehten sich, Hälse wurden gereckt, die Menschen flüsterten hinter vorgehaltenen Händen. Am Blick seiner Frau sah er, dass etwas nicht stimmte. Alle Farbe wich ihr aus dem Gesicht.
«Um Himmels willen», zischte sie. «Was hat sie sich nur dabei gedacht?» Sylta krallte sich in seinen Arm und deutete entsetzt in Richtung Werft. Nun sah auch er, was die Menschen und seine Frau so aus der Fassung brachte.
Lily war angekommen. Auf dem Kopf trug sie den grünen Hut mit der riesigen Feder. Und – ihm stockte der Atem – war sie denn von allen guten Geistern verlassen? Einen Moment dachte er, er sähe nicht richtig.
Seine Tochter saß auf einem Fahrrad!
Lily musste all ihre Kraft zusammennehmen, um nicht sofort wieder umzukehren. Ihre Knie zitterten. Sie versuchte, gewinnend in die Menge zu lächeln, die ihr entgegenstarrte, aber ihre Gesichtsmuskeln wollten ihr nicht gehorchen. Der Plan war voll und ganz missglückt. Sie hatte sich ein paarmal verfahren, war einmal sogar gestürzt, als sich ihr Kleid in der Kette verfangen hatte. Nun waren ihre Handschuhe schmutzig, und ihr Kleid hatte einen Riss. Zu allem Überfluss hatte sie auch noch vergessen, wo genau die Titania vor Anker lag. Noch nie war sie alleine hier unterwegs gewesen. Eilig war sie um eine Ecke geschossen, und plötzlich hatten sich Dutzende Köpfe zu ihr umgedreht und entsetzte Blicke auf sie geheftet. Nun war es zu spät, um das Rad heimlich abzustellen.
Am liebsten wäre sie an Ort und Stelle im Boden versunken. Doch sie rollte langsam näher und stieg schließlich mit hocherhobenem Kopf vor aller Augen ab, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Das Tuscheln der Menge ließ ihren Nacken prickeln. Schweiß rann ihr über den Körper. Das Korsett erlaubte es ihren Lungen nicht, sich richtig mit Luft zu füllen. Sie konnte ihren Atem in dem engen Kleid kaum noch kontrollieren. Ängstlich warf sie einen Blick auf die kleine Tribüne, wo ihre Familie stand. Sogar aus dieser Entfernung sah sie, dass ihre Mutter nur mit Mühe die Fassung bewahrte. Franz wirkte wie versteinert, Henry war alle Farbe aus dem Gesicht gewichen, und ihr Vater kochte vor unterdrückter Wut.
Lilys Gedanken rasten. Jetzt konnte sie nur eines tun: ruhig bleiben und lächeln.
Auf der Suche nach einem Platz, an dem sie das Rad abstellen konnte, sah sie sich um. An einer Laterne neben ihr lehnte ein Mann, offensichtlich ein Hafenarbeiter, der sie mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht musterte. Eine Mischung aus Neugierde, Erstaunen … und Belustigung. Lily merkte, wie sie unter seinem Blick noch mehr errötete. Er lacht mich aus, dachte sie wütend. Aber dann gab sie sich einen Ruck. «Würden Sie?», fragte sie zuckersüß, schob das Rad zu ihm und hielt ihm den Lenker hin.
Erstaunen flackerte in seinen Augen auf. Einen ewigen Augenblick lang reagierte er nicht. Sein durchdringender Blick jagte ein Prickeln durch ihren Körper. Dann zog er eine Augenbraue hoch und nahm wortlos das Rad entgegen. Sie registrierte, dass er auf eine rohe Art sehr attraktiv war. Lily dankte ihm mit einem Lächeln, das er nicht erwiderte. Als sie an ihm vorbeiging, spürte sie seinen Blick im Nacken.
Die Menge hatte inzwischen einen Gang frei gemacht, durch den sie nun hindurchschritt wie eine Braut zum Altar. Oder wie Anne Boleyn zum Schafott, dachte sie und schluckte. Sie fühlte sich, als würde sie durch ein Rudel Wölfe laufen. Das künstliche Lächeln auf dem Gesicht eingefroren, ging sie langsam mit hocherhobenem Kopf auf ihre Familie zu. Dabei bemühte sie sich, das Kleid so zu raffen, dass ihre Hand den Riss überdeckte. Beinahe genauso stark bemühte sie sich, die teils leise, teils unüberhörbar laut gemurmelten Kommentare über ihren Auftritt zu ignorieren, die an ihre Ohren drangen.
«Hast du es gesehen, Millie? Mit beiden Beinen über der Stange!» «Ist das überhaupt erlaubt?» «Ich bin schockiert!» «Wie kann Karsten das billigen?»
Mit schmerzendem Magen dachte Lily, dass ihre Eltern sie nach diesem Tag bestimmt in ein Kloster ans Ende der Welt stecken und nie wieder nach Hause lassen würden. Doch als sie einen kurzen Blick in die Gesichter der Gäste wagte, bemerkte sie zu ihrem Erstaunen, dass nicht alle entsetzt schienen. Ein paar der Herren lächelten ihr tatsächlich amüsiert, ja beinahe beeindruckt zu, und die alte Gerda Lindmann, die beste Freundin ihrer Großmutter, lachte begeistert und winkte ihr mit ihrem Spitzentuch.
Sie hob schüchtern die Hand und winkte zurück.
Lilys Weg zur Tribüne hatte der Familie Zeit gegeben, sich zu fangen. Sylta reagierte am schnellsten. «Unsere Überraschung ist gelungen!», rief sie mit einem strahlenden Lächeln in die Menge. «Das Warten hat sich gelohnt, meine Damen und Herren. Die Taufpatin ist angekommen. Wir waren der Ansicht, ein besonderer Anlass verdient einen besonderen Auftritt! Ich hoffe, wir konnten Sie damit beeindrucken.»
Gerda Lindmann war die Erste, die in die Stille hinein zu klatschen begann. Sie stupste die Dame neben sich an, die nach einer Sekunde des Zögerns ebenfalls applaudierte. Schnell folgten erst vereinzelt, dann zunehmend die anderen Gäste. Zwar blickten besonders die älteren Damen immer noch konsterniert finster, aber die allgemeine Stimmung stieg.
Lily wagte einen Seitenblick zu ihrem Vater. Auch er klatschte, aber sie sah, wie es hinter der Fassade in ihm brodelte. Franz musterte sie mit einem beinahe hasserfüllten Ausdruck in den Augen. Er klatschte nicht, setzte aber nach einem mahnenden Blick von Sylta ein dünnes Lächeln auf.
«Nun, dann können wir ja beginnen!» Ihr Vater hatte das Wort ergriffen. «Man muss über seine Zeit hinausdenken. Dieses Motto begleitet unsere heutige Taufe und hat uns zu dem ungewöhnlichen Auftritt meiner Tochter inspiriert, den Sie uns hoffentlich in seiner Waghalsigkeit verzeihen», verkündete er und erntete von einigen Seiten beifälliges Nicken und vereinzelte Lacher.
Lily verstand, wie klug er vorging, und warf ihm einen bewundernden Blick zu. Ihre Eltern waren Meister darin, Unzulänglichkeiten der Familie vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Durch Michel hatten sie darin viel Übung. Aber das hier war sogar für ihren Vater eine Meisterleistung. Lily sah, wie er die Menschen durch seine Worte und seine herzliche Art immer mehr auf seine Seite zog, bis auch der letzte grimmig verzogene Mundwinkel sich lockerte. Niemand konnte Alfred Karsten widerstehen, wenn er seinen ganzen weltmännischen Charme ausspielte. Die geniale Idee ihrer Mutter, es aussehen zu lassen, als habe die Familie diesen gewagten Auftritt als Unterhaltung für die Gäste geplant, war ihre Rettung.
«Unsere Schiffe sind traditionell nach bester Handwerkskunst gefertigt, aber von modernster Technik, die sie sicher über die Weltmeere befördert. Wir denken einen Schritt voraus, wagen etwas, wo andere zurückbleiben», fuhr ihr Vater fort, und sie merkte, wie er mit jedem Wort zuversichtlicher wurde. Auch Franz nickte nun zufrieden. Natürlich würden die Menschen sich trotzdem die Mäuler über sie zerreißen, Lily machte sich keine Illusionen darüber. Aber wenigstens wurde sie nicht öffentlich an den Pranger gestellt und konnte ihr Gesicht wahren.
Als ihr Vater schließlich das Wort an sie übergab, zitterten Lilys Hände immer noch leicht. Sie holte ihr kleines Notizbuch aus der Perlenhandtasche und schlug es auf. Obwohl sie so nervös war, dass ihr Magen flatterte, schaffte sie es, ruhig zu atmen. Der Puls pochte ihr in den Wangen. «Wie Titania, die Elfenkönigin, nach der dieses großartige Schiff benannt wird, in Shakespeares Sommernachtstraum so schön sagt», setzte sie laut zu sprechen an und hörte Franz neben sich leise aufstöhnen.
Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Franz fand es lächerlich, dass ihr Vater alle seine Schiffe nach Heldinnen aus Shakespeare-Stücken taufen ließ. «Gib ihnen doch einen schönen deutschen Namen!», brummte er oft, wenn es um die Taufen ging.
«Die Schiffe sind in England gemacht, genau wie die meiste gute Literatur, warum sollten sie also nicht einen englischen Namen tragen?», erwiderte ihr Vater meist in diesen Situationen.
«Goethe hat auch gut geschrieben!», murmelte Franz dann, und ihr Vater beendete den Disput, indem er seinen Sohn damit aufzog, dass er keine Ahnung habe, was Goethe eigentlich geschrieben hatte, und ihn fragte, ob er ihm nicht mal etwas zitieren wolle, wenn er von dessen Genie so überzeugt war.
Lily stieß ihrem großen Bruder leicht den Ellbogen in die Rippen, sah auf ihre Notizen und ließ dann den Blick auf der Menge ruhen, als sie leicht zitternd, aber auswendig und mit lauter Stimme Titania zitierte:
Wir saßen auf Neptunus’ gelbem Sand,
Sahn nach den Handelsschiffen auf der Flut
Und lachten, wenn vom üpp’gen Spiel des Windes
Der Segel schwangrer Leib zu schwellen schien.
Ihre Mutter schnappte neben ihr erschrocken nach Luft. Die Analogie war doch ein wenig gewagt. Auch durch die Menge ging ein kurzes, erstauntes Raunen. Aber es war Shakespeare. Er war immer etwas skandalös, jedoch auf eine salonfähige Art. Gegen ihn konnte man schlecht etwas sagen. Lily lächelte, weil sie das genau wusste, und fuhr in ihrer Rede fort. Als sie fertig war, rief sie: «Was bleibt noch hinzuzufügen außer: Ich taufe dich auf den Namen Titania, wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und ich taufe dich mit einem dreifachen Hipphipphurra!» Sie nahm die Flasche Champagner, die in ein feines Netz gespannt an einem langen Seil hing, und ließ sie mit aller Kraft gegen den Bug des Schiffes donnern. Die Flasche zerbarst, die Tropfen des Champagners spritzten in die Luft und glitzerten für eine Sekunde im Sonnenlicht, bevor sie sich im Matsch des Hafenbodens auflösten.
Die Menge johlte und klatschte. Ihr Vater umarmte erst Lily, wobei er gleichzeitig lächelte und ihr mit einer hochgezogenen Augenbraue deutlich machte, dass es später noch ein ernstes Gespräch geben würde, und dann ihre Mutter. Henry gab Lily leicht verwirrt einen Kuss auf die Wange. Franz jubelte ausgelassen in die Menge und ignorierte seine Familie.
«Das war eine sehr gelungene Rede, mein Liebling. Wenn das Zitat auch besser hätte gewählt sein können.» Sylta küsste ihre Tochter auf die Stirn. «Ich bin stolz auf dich. Über das Fahrrad reden wir noch!»
Als sie von der Bühne stiegen und allseitige Gratulationen entgegennahmen, passierte es. Eine plötzliche Windböe wirbelte die staubtrockene Luft des Hafens auf. Erschrockene Uh- und Ah-Rufe wurden laut, ein, zwei Zylinder gerieten ins Wackeln, und die Damen hielten ihre Kleider fest.
«Ein Gewitter wäre ein Segen!» Mit einem Stirnrunzeln blickte Sylta in den Himmel und wandte sich dann blinzelnd ab, weil sie Sand in die Augen bekommen hatte.
«Aber erst, wenn wir daheim sind!», brummelte Franz.
Lily, die sich bei Henry eingehakt hatte, beobachtete ebenfalls die dunklen Wolken, die sich am Horizont über der Kirchturmspitze des Hamburger Michels bedrohlich zusammenballten.
«Sieh zu, dass du auf dem Nachhauseweg nicht nass wirst, Schwesterchen!»
Erschrocken blickte Lily in das hämisch verzogene Gesicht ihres großen Bruders. «Was meinst du?»
«Na, du glaubst doch wohl nicht, dass ich dir das Rad heimfahre? Noch dazu in dieser Hitze.»
«Aber …» Lilly starrte ihn an. Daran hatte sie nicht gedacht.
Franz verzog keine Miene. «Auf der Kutsche ist jedenfalls kein Platz. Es ist mir egal, wie du es anstellst, aber das Rad ist heute Abend wieder in der Villa, oder du schuldest mir dreihundert Mark.»
«Das ist nicht fair! Du hast mich einfach stehengelassen. Ich musste doch …» Lily wollte aufbrausen, aber Henry schaltete sich dazwischen. «Liebes, es wird doch sicher eine Möglichkeit geben. Eine Mietdroschke ist hier im Hafen schwer aufzutreiben, aber wir finden schon jemanden, der es für eine kleine Bezahlung nach Hause fährt.»
Franz lachte verächtlich. «Willst du es vielleicht einem der Hafenarbeiter geben? Das Rad ist mehr wert, als sie in einem Jahr verdienen. Nein, Lily soll sich mal schön selbst darum kümmern, dass …» In diesem Moment fuhr erneut ein Windstoß durch die Menge. Er klatschte Franz die Krawatte ins Gesicht, sodass er grob unterbrochen wurde.
Lily fühlte ein Zerren an den Haaren und plötzlich ein seltsames Gefühl am Kopf. Verwundert fasste sie sich in die Locken. «Oh, was …?» Sie sah sich um. Der Hut war ihr heruntergerissen worden. Henry bückte sich bereits danach, da ließ ihn ein erneuter Windstoß davontanzen, auf das Wasser zu.
«Mein Hut!», rief Lily. Dann lachte sie. «Henry, lauf schnell!»
Hinterher dachte sie darüber nach, wie harmlos, ja lustig ihr die Situation in diesem Moment erschienen war. Henry stolperte hinter dem grünen Stoffbündel her, und sie feuerte ihn an und beobachtete amüsiert die feinen Damen, die wie aufgescheuchte Hühner durcheinanderliefen. Sie konnte ja nicht wissen, dass an diesem Tag, mit diesem einen unbedeutenden Ereignis, alles beginnen würde.
Gerade als Henry erneut nach dem Hut fasste, wurde dieser wie von unsichtbarer Hand gepackt und verschwand zwischen Schiff und Hafenmauer.
«Oh nein!» Lily stöhnte auf.
Henry stand etwas ratlos da und sah ins Wasser. Eilig lief sie zu ihm. «Was machen wir jetzt? Er war schrecklich teuer! Wenn ich ihn verliere, zu all dem, was heute ohnehin schon passiert ist, kriege ich drei Wochen Stubenarrest.»
«Keine Sorge, ich regele das!» Henry winkte einen der Sicherheitsmänner herbei. «He! Klettere da runter und hol der Dame ihren Hut herauf!», sagte er, nicht unfreundlich, aber es war auch keine Frage, sondern ein Befehl.
«Henry, das können wir doch nicht verlangen!», rief Lily.
«Warum nicht?» Er sah sie erstaunt an. Dann seufzte er. Stirnrunzelnd holte er seine Brieftasche hervor, kramte darin herum und hielt dem Mann eine Münze hin. «Für deine Mühen.»
Der Mann zögerte kurz, dann nahm er die Münze. Lily registrierte mit Schaudern seine zerfurchten, aufgerissenen Hände. Der Mann streifte die Schuhe ab, packte eines der Taue, die über die Kante ins Wasser hingen, und kletterte wie ein Affe daran hinab.
«Ist das nicht gefährlich?» Lily fasste Henrys Arm. Das riesige Schiff war nur etwa einen Meter von der Hafenmauer entfernt.
«Was sollte daran gefährlich sein, er wird vielleicht ein bisschen nass!», sagte Henry und lachte.
Lily spürte Ärger in sich aufsteigen. Warum holst du ihn dann nicht raus, wenn es so einfach ist?, dachte sie und warf ihm einen Seitenblick zu. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass einer ihrer Romanhelden in dieser Situation einfach nur danebenstehen würde. Sie verglich Henry oft mit den Männern aus ihren Büchern. Meistens schnitt er dabei gut ab, er war groß, stattlich mit seinen blonden Locken, seine Familie war adelig und sein Benehmen stets tadellos. Und natürlich waren Romane nicht die Wirklichkeit. Wenn man erwartete, dass normale Männer sich plötzlich wie Helden aufführten, konnte man wahrscheinlich nur enttäuscht werden. Aber trotzdem, dachte sie. Sehr galant war es nicht.
Dann beobachtete sie besorgt, wie der Mann sich mit einer Hand am Tau festhielt und versuchte, mit der anderen den Hut zu erreichen, der jedoch viel zu weit entfernt war. Da es ihm nicht gelang, ließ er sich kurzerhand ins Wasser gleiten.
In diesem Moment erklang ein Rascheln um sie her. Erst leise, dann immer stärker. Lily hob erstaunt den Kopf. Die dunkle Wolke, die eben noch in der Ferne über dem Michel gehangen hatte, schob sich über den Hafen. Innerhalb weniger Sekunden wurden die Böen so stark, dass sie ihr Kleid festhalten musste, damit es ihr nicht über den Kopf geweht wurde. Der Wind heulte plötzlich wie ein wütendes Tier.
«Wir suchen besser einen Unterstand!» Henry wollte sie mit sich ziehen, aber Lily stemmte sich ihm entgegen.
«Warte doch!», rief sie. Der Mann im Wasser kämpfte mit den aufkommenden Wellen, die den Hut weiter von ihm wegtrieben. Lily sah besorgt zu. Eben war da doch noch viel mehr Wasser, dachte sie, bevor ihr entsetzt klarwurde, dass die Titania sich bewegte. «Passen Sie auf!», rief sie. «Das Schiff!» Der Mann blickte zu ihr hoch, schien sie aber nicht zu hören, denn er paddelte weiter und trieb durch seine Bewegungen den Hut immer mehr von sich weg. Panisch sah Lily sich nach Hilfe um. Aber es war kaum mehr jemand in der Nähe, die Menschen eilten zu ihren Kutschen und Droschken, sie sah in einiger Entfernung ihre Familie, die hastig ihre Sachen zusammensuchte und die Herrschaften verabschiedete. «Henry, was, wenn das Schiff ihn zerquetscht?» Lily zog ihn zurück zur Wasserkante. Aufgeregt deutete sie auf den Bauch der Titania, der jetzt noch wesentlich näher an der Mauer war als noch vor ein paar Sekunden. «Der Wind treibt das Schiff gegen die Steine.»
Henry hielt seinen Zylinder fest und folgte mit den Augen ihrem ausgestreckten Zeigefinger. «Ach, Lily, dafür hängen doch die ganzen dicken Taue über der Mauer. Sie bremsen das Schiff aus. Sonst würde es doch ständig gegen den Rand schlagen und sich selbst zerstören!», rief er gegen den Wind. «Nun beeil dich doch, die Dame wartet!», brüllte er dann zu dem Mann hinunter, der den Hut inzwischen ergriffen hatte.
Erleichtert beobachtete Lily, wie er zurückschwamm und versuchte, sich an einem der Taue hochzuziehen. Aber das Seil war zu dick und mit glitschigen Algen überwuchert. Seine Hände rutschten immer wieder ab. Lily sah Angst in seinem Blick aufflackern. Er muss zurück zu dem dünneren Seil, dachte sie. «Kommen Sie hierher, hier ist es leichter», rief sie aufgeregt und ließ sich auf die Knie nieder.
«Lily! Dein Kleid!» Wie aus dem Nichts war ihre Mutter neben ihr erschienen, packte sie hart am Ellbogen und zog sie hoch. «Bist du denn heute völlig von Sinnen?»
«Es ist sowieso zerrissen. Mama, schau doch nur!» Angstvoll deutete sie auf den Mann, der sich nun den Hut auf den Kopf gesetzt hatte, um besser schwimmen zu können. Er versuchte, zu der Stelle zurückzukommen, an der er sich ins Wasser gelassen hatte.
«Ach du meine Güte.» Irritiert blickte Sylta zu ihm hinab. «Was soll denn das?»
«Der Wind hat meinen Hut über die Kante geweht. Ich mache mir Sorgen, dass das Schiff …»
In diesem Moment gab die Titania ein lautes, beinahe menschliches Stöhnen von sich, und die Lücke zwischen Rumpf und Kante verschwand. Plötzlich war der Mann nicht mehr zu sehen.
«Oh Gott!» Lily schrie auf. Sylta wurde blass, beide Frauen ließen sich gleichzeitig auf die Knie fallen und blickten über den Rand. «Siehst du ihn? Wo ist er?»
«Ich bin hier!» Eine dumpfe Stimme erscholl von unten aus dem Wasser.
«Oh, Gott sei Dank! Von hier oben sieht es aus, als seien Sie verschwunden!», rief Lily. Als sie sich noch ein Stück vorbeugte, sah sie den Kopf des Mannes, der sich an die Wand klammerte. «Schaffen Sie es zu dem ersten Seil zurück?»
«Ich versuche es. Ich steck zwischen zwei Tauen. Aber wenn ich mich hier wegbewege und das Schiff wieder gegen die Wand gedrückt wird …»
Entsetzt sah Lily ihre Mutter an. Sylta hatte die Hand über den Mund geschlagen. Sie kniete immer noch neben Lily. «Henry, tu doch etwas!», rief sie nun.
Henry war von der Situation offensichtlich überfordert. Er beugte sich ebenfalls über die Kante und schien fieberhaft nachzudenken, aber zu keinem Ergebnis zu kommen. Lily verlor beinahe den Halt, so weit lehnte sie sich über das Wasser. Sie sah, wie der Mann sich nun langsam am Schiffsbauch entlangtastete. Die Lücke war so schmal, dass er immer, wenn er an einem der dicken Taue vorbeikam, nur mit Mühe hindurchschlüpfen konnte.
Mit einem Mal überzog eine Gänsehaut Lilys Körper.
Das Rascheln war wieder da.
Entsetzt blickte sie auf. Trockenes Laub, ausgedörrt von wochenlanger Sommerhitze, fegte über den Platz, und Staubkörner knirschten in ihrem Mund. Plötzlich erklang unter ihr ein markerschütternder Schrei.
«Um Gottes willen, er ist eingequetscht!» Sylta beugte sich mit bleichem Gesicht nach vorne.
Im nächsten Moment wurde Lily grob beiseitegestoßen. Sie fiel mit dem Gesicht voran in den Staub, ihr Kinn kratzte über den harten Boden. Verwundert setzte sie sich auf. Ein Mann in Arbeiterkleidung und mit Mütze auf dem Kopf hatte sich vor ihr auf den Boden geworfen, um über die Kante zu sehen. Innerhalb von Sekunden schien er die Situation zu erfassen. Er sprang auf und brüllte etwas. Dann rannte er zu einem Stapel mit Eisenstangen, hob eine hoch und stemmte sie mit aller Kraft gegen das Schiff. Erstaunt sah Lily, wie die anderen Sicherheitsmänner und einige Hafenarbeiter herbeieilten, sich am Schiff entlang verteilten und es ihm gleichtaten. Sie bellten sich mit grimmigen Mienen gegenseitig Worte zu.
Erst wirkte es, als würde die Titania sie gar nicht bemerken. Das Schiff ist so riesig, wie sollen sie da mit diesen kleinen Stangen etwas anfangen, dachte Lily erschrocken. Noch immer saß sie mit ihrem weißen Kleid zwischen den Männern im Staub. Aber nach ein paar Sekunden, in denen die Arbeiter sich mit aller Kraft und hochroten Gesichtern gegen das Schiff stemmten, gab die Titania nach und bewegte sich. Erst so langsam, dass Lily es gar nicht wahrnahm, dann plötzlich schneller, und schließlich stießen die Stangen der Männer ins Leere, und die Taue, an denen das Schiff befestigt war, spannten sich.
«Jetzt! Holt ihn raus!» Der Mann, der sie geschubst hatte, zögerte keine Sekunde. Als die Lücke breit genug war, packte er eines der Taue und schwang sich über die Mauer. Bevor sein Gesicht verschwand, bohrte sich sein wütender Blick eine Sekunde lang in ihren, und Lily erkannte erschrocken, dass es der Mann war, dem sie vorhin so frech das Fahrrad in die Hand gedrückt hatte. Sie rappelte sich auf. Henry, der das ganze Geschehen wie in Schockstarre beobachtet hatte, half ihr hoch.
Der Mann hatte jetzt den verletzten Arbeiter gepackt und wickelte sich mit ihm zusammen in ein Seil. Auf seinen Befehl hin zogen die Männer an, und wenig später lagen beide keuchend auf dem Boden des Anlegers.
Lily wollte zu dem Verletzten eilen, aber plötzlich blieb sie stehen und schlug entsetzt die Hand über den Mund. Das Bein des Mannes, der ihren Hut hatte retten sollen, war seltsam verdreht. Er lag mit dem Gesicht auf dem Boden, grub die Hände in den Staub und stöhnte gequält. Dort, wo sein linker Fuß sein sollte, waren nur noch blutige Fetzen und Knochensplitter zu sehen. Sie musste sich abwenden, weil eine plötzliche Welle der Übelkeit sie überrollte. «Schnell, Henry!», keuchte sie, aber Henry kniete bereits neben dem Mann.
Er hob das Hosenbein und betrachtete den Fuß, dann fühlte er den Puls. «Er muss sofort ins Krankenhaus zu einem Chirurgen», verkündete er mit ernster Miene.
«Was ist hier los?» Alfred und Franz traten zu ihnen. Sylta erklärte in kurzen Worten, was geschehen war.
«Dieser Tag ist verflucht», murmelte Alfred leise und warf einen raschen Blick auf den zerschredderten Fuß des Mannes. Er wurde blass, wandte sich ab und fuhr sich kurz mit der Hand über die Schläfe. «Schafft ihn ins St. Georg. Ich bezahle die Behandlung», befahl er den umstehenden Männern. Zwei nahmen den halb ohnmächtigen Mann in die Mitte, die anderen liefen los, um eine Karre zu holen.
Der Verletzte schrie, als er so plötzlich bewegt wurde, und Lily presste die Hände über die Ohren. Noch nie hatte sie jemanden so schreien hören. Als sie ihn davontrugen, zog er eine Blutspur hinter sich her. Leuchtend rot grub sie sich in den Staub des Hafens.
«Nun, das wäre geklärt.» Ihr Vater bückte sich und hob den Hut auf, der nass und schmutzig auf dem Boden lag. Mit einem Ausdruck von kalter Wut in den Augen drückte er ihn Lily in die Hände. «Ich hoffe, es hat sich gelohnt!» Dann nahm er Sylta am Arm und zog sie mit sich in Richtung Kutsche. Ihre Mutter warf Lily einen besorgten Blick zu, ließ sich aber fortführen. Franz folgte ihnen wortlos.
Henry legte ihr einen Arm um die Schulter. Benommen blickte Lily auf den Hut in ihren Händen. Die prächtige grüne Feder war geknickt und ausgefranst. Aber sie wusste, dass sie ihn ohnehin nie wieder aufsetzen würde. Sie fühlte sich schrecklich. Das Ganze war allein ihre Schuld. Wenn sie an die gequälten Schreie des Verletzten dachte, war sie kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Als sie sich umdrehte, fing sie erneut den Blick des Mannes auf, der den Arbeiter gerettet hatte. Er sammelte gerade die zerstreuten Eisenstangen ein und warf sie zurück auf den Haufen. Kalt, beinahe verächtlich sah er sie an. Sie schluckte, dann sammelte sie ihren Mut und trat auf ihn zu. «Vielen Dank, dass Sie …», begann sie stotternd, aber sie wurde sofort von Henry unterbrochen.
«He, du da! Du hast meine Verlobte auf den Boden geschubst! Sie ist hingefallen! Schau nur, wie sie aussieht.»
Lily blickte an sich hinunter. Das weiße Kleid war von oben bis unten eingestaubt, ihre perlfarbenen Handschuhe waren nun endgültig zerrissen, ihre Handflächen aufgeschürft und blutig. Sie hatte es nicht einmal bemerkt.
Der Mann schien nicht ganz entschieden, ob er Henrys Aufregung amüsant oder irritierend fand. Einen Moment lang musterte er ihn wortlos, eine Hand in die Hüfte gestemmt. «Sie war im Weg!», sagte er schließlich schulterzuckend und warf die letzte Stange auf den Haufen. Als Henry aufbrausen wollte, wandte der Mann sich einfach ab und ließ ihn stehen. Doch dann hielt er inne, drehte sich um und sah Lily an. «Es tut mir leid, wenn ich Ihnen weh getan habe. Ich musste schnell handeln», sagte er nach kurzem Zögern.
Lily nickte erschrocken. «Es war alles meine Schuld. Ich danke Ihnen sehr!»
Er schien erstaunt über ihre Reaktion, erwiderte aber nichts.
Plötzlich fiel ihr ein, dass sie ja noch irgendwie nach Hause kommen musste. «Sie haben noch mein Fahrrad!»
«Ich habe es dort vorne an eine Laterne gebunden.»
«Na, das ist doch wunderbar. Wir brauchen ohnehin jemanden, der es uns zurückfährt», mischte Henry sich ein. «Wie heißt du?»
«Jo Bolten», erwiderte der Mann kurz angebunden.
«Bolten, was sagst du, willst du dein Heldentum noch ein wenig verstärken und dir etwas dazuverdienen? Die Dame sucht jemanden, der ihr das Rad in die Bellevue zurückfährt!»
«Sie hat es doch auch hergeschafft, was hindert sie daran, es zurückzufahren?», fragte der Mann.
«Der Regen natürlich.» Henry hielt ihm eine Münze hin. «Es wird gleich richtig losgehen. Willst du vielleicht, dass sie eine Lungenentzündung bekommt?»
Der Mann blickte auf die Münze in Henrys Hand, dann sah er Lily an. Er rührte sich nicht.
Lily spürte, wie sie unter seinem Blick feuerrot wurde. «Sie müssen das nicht machen …», stotterte sie. «Henry, wir finden schon jemanden, der …»
«Warum fahren Sie es nicht zurück?», sagte der Mann zu Henry, ohne Lilys Blick loszulassen. Seine Stimme war weder unfreundlich noch herausfordernd. Doch Henry brauste auf, als hätte er ihn angegriffen.
«Soll ich mir vielleicht meinen Anzug ruinieren? Was denkst du dir denn? Es wird gleich schütten wie aus Eimern, die Stadt wird eine Schlammwüste sein.»
Genau in diesem Moment begann es zu regnen. Schwere, kalte Tropfen klatschten um sie herum auf den Boden und brannten Lily auf den Wangen und im Nacken. «Also, was ist?», rief Henry und drückte Lily beschützend an sich. «Das Rad muss zur Karsten-Villa. Die kennst du sicher.»
Der Mann schien den Regen gar nicht zu bemerken. Er tropfte von seinem dunklen Haar in sein Gesicht. «Die Karsten-Villa?» Er schien kurz nachzudenken. «Ich hab noch einen Auftrag. Ich bringe es heute Abend vorbei», sagte er.
«Es ist besser in tadellosem Zustand!»
«Henry!» Lily schämte sich entsetzlich. «Er tut uns doch einen Gefallen!»
Der Mann zuckte nicht mit der Wimper, er würdigte Henry weder einer Antwort noch eines Blickes, sondern drehte sich einfach um und ging davon. Henry stand immer noch mit ausgestreckter Hand da. Erst jetzt bemerkte Lily, dass der Mann die Münze nicht genommen hatte.
2
Die Ratte war krank, daran gab es keinen Zweifel. Jo beobachtete sie schon eine ganze Weile. An die Wand des Hinterhofs gelehnt, sah er zu, wie das Tier vor sich hin taumelte und sich immer wieder wie im Fieberwahn schüttelte. Die schwarzen Augen waren von einem Schleier überzogen, an der Schnauze klebte Blut.
Jo hasste Ratten, sie erinnerten ihn an die Zeit im Gefängnis, als sie im Dunkeln angefangen hatten, an seinen Zehen zu nagen. Als er klein war, hatte sich einmal eine Ratte mit ins Bett geschlichen und das Ohr seines Bruders angefressen. Noch heute konnte man den Riss sehen, wo sie ein Stück aus ihm herausgebissen hatte. Wilhelm hatte eine schreckliche Entzündung bekommen. Ihr Vater hatte einen guten Teil seines Jahresgehaltes für seine Behandlung ausgeben müssen.
Das Tier zu seinen Füßen hatte sich offenbar an den fauligen Abfällen des Viertels mehr als gütlich getan. Es war so fett, dass sein Bauch im Dreck schleifte. Die Ratten sind hier nun mal die Einzigen, die sich satt fressen können, dachte Jo verbittert und spuckte einen Krümel Tabak auf den Boden. Aber das, was er erledigen musste, gab es eben nicht in der Bellevue.
Das gab es nur hier. Im schwarzen Herzen Hamburgs.
Auf seinem Weg zu dem Haus, dessen Adresse auf einem Zettel in seiner Westentasche stand, war er an mehr Prostituierten und Bettlern vorbeigekommen, als er zählen konnte. Der Verwesungsgestank aus den Fleeten mischte sich mit dem Qualm der unzähligen Schornsteine. Verwahrloste Kinder, die auf ihren durch Rachitis krumm gewordenen Beinen kaum richtig laufen konnten, rangelten um Stöcke und leere Konservendosen. Jo wusste, wie es war, hier aufzuwachsen. Die stinkenden Gassen des Altstädter Gängeviertels zwischen Stein-, Spitaler- und Niedernstraße waren auch sein Zuhause. Allerdings gab es einen Unterschied zwischen ihm und den Kindern. Er hatte Arbeit, verdiente Geld, konnte seine Familie zumindest so weit über Wasser halten, dass seine Geschwister nicht mehr nachts vor Hunger wachlagen.