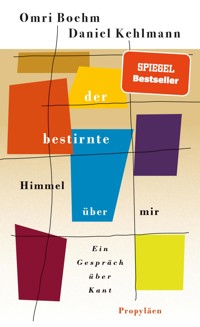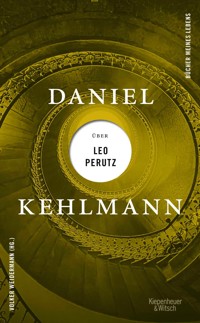9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Eine literarische Sensation.» (Guardian) Mit hintergründigem Humor schildert Daniel Kehlmann das Leben zweier Genies: Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Er beschreibt ihre Sehnsüchte und Schwächen, ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und Erfolg. Ein philosophischer Abenteuerroman von seltener Phantasie, Kraft und Brillanz. «Ein großes Buch, ein genialer Streich.» (Frankfurter Rundschau) «Urkomisch und herzzerreißend.» (Time Magazine) «Ein wahrhaft reicher und bahnbrechender Roman.» (Nouvel Observateur) «Daniel Kehlmanns Roman über Gauß und den Naturforscher Alexander von Humboldt ist die leichthändig ineinander verwobene Doppelbiographie zweier großer Gelehrter, so unterhaltsam und humorvoll und auf schwerelose Weise tiefgründig und intelligent, wie man es hierzulande kaum für möglich hält.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Die Vermessung der Welt
Roman
Über dieses Buch
«Eine literarische Sensation.» (Guardian)
Mit hintergründigem Humor schildert Daniel Kehlmann das Leben zweier Genies: Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Er beschreibt ihre Sehnsüchte und Schwächen, ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und Erfolg. Ein philosophischer Abenteuerroman von seltener Phantasie, Kraft und Brillanz.
«Ein großes Buch, ein genialer Streich.» (Frankfurter Rundschau)
«Urkomisch und herzzerreißend.» (Time Magazine)
«Ein wahrhaft reicher und bahnbrechender Roman.» (Nouvel Observateur)
«Daniel Kehlmanns Roman über Gauß und den Naturforscher Alexander von Humboldt ist die leichthändig ineinander verwobene Doppelbiographie zweier großer Gelehrter, so unterhaltsam und humorvoll und auf schwerelose Weise tiefgründig und intelligent, wie man es hierzulande kaum für möglich hält.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Vita
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Welt war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit, und auch sein Roman Tyll stand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Daniel Kehlmann lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2005 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther/ Walter Hellmann
Coverabbildung ‹Alexander Humboldt - Plantes Equinoxiales› akg-images
ISBN 978-3-644-00011-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Reise
Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum erstenmal seit Jahren seine Heimatstadt, um am Deutschen Naturforscherkongreß in Berlin teilzunehmen. Selbstverständlich wollte er nicht dorthin. Monatelang hatte er sich geweigert, aber Alexander von Humboldt war hartnäckig geblieben, bis er in einem schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme nie, zugesagt hatte.
Nun also versteckte sich Professor Gauß im Bett. Als Minna ihn aufforderte aufzustehen, die Kutsche warte und der Weg sei weit, klammerte er sich ans Kissen und versuchte seine Frau zum Verschwinden zu bringen, indem er die Augen schloß. Als er sie wieder öffnete und Minna noch immer da war, nannte er sie lästig, beschränkt und das Unglück seiner späten Jahre. Da auch das nicht half, streifte er die Decke ab und setzte die Füße auf den Boden.
Grimmig und notdürftig gewaschen ging er die Treppe hinunter. Im Wohnzimmer wartete sein Sohn Eugen mit gepackter Reisetasche. Als Gauß ihn sah, bekam er einen Wutanfall: Er zerbrach einen auf dem Fensterbrett stehenden Krug, stampfte mit dem Fuß und schlug um sich. Er beruhigte sich nicht einmal, als Eugen von der einen und Minna von der anderen Seite ihre Hände auf seine Schultern legten und beteuerten, man werde gut für ihn sorgen, er werde bald wieder daheim sein, es werde so schnell vorbeigehen wie ein böser Traum. Erst als seine uralte Mutter, aufgestört vom Lärm, aus ihrem Zimmer kam, ihn in die Wange kniff und fragte, wo denn ihr tapferer Junge sei, faßte er sich. Ohne Herzlichkeit verabschiedete er sich von Minna; seiner Tochter und dem jüngsten Sohn strich er geistesabwesend über den Kopf. Dann ließ er sich in die Kutsche helfen.
Die Fahrt war qualvoll. Er nannte Eugen einen Versager, nahm ihm den Knotenstock ab und stieß mit aller Kraft nach seinem Fuß. Eine Weile sah er mit gerunzelten Brauen aus dem Fenster, dann fragte er, wann seine Tochter endlich heiraten werde. Warum wolle die denn keiner, wo sei das Problem?
Eugen strich sich die langen Haare zurück, knetete mit beiden Händen seine rote Mütze und wollte nicht antworten.
Raus mit der Sprache, sagte Gauß.
Um ehrlich zu sein, sagte Eugen, die Schwester sei nicht eben hübsch.
Gauß nickte, die Antwort kam ihm plausibel vor. Er verlangte ein Buch.
Eugen gab ihm das, welches er gerade aufgeschlagen hatte: Friedrich Jahns Deutsche Turnkunst. Es war eines seiner Lieblingsbücher.
Gauß versuchte zu lesen, sah jedoch schon Sekunden später auf und beklagte sich über die neumodische Lederfederung der Kutsche; da werde einem ja noch übler, als man es gewohnt sei. Bald, erklärte er, würden Maschinen die Menschen mit der Geschwindigkeit eines abgeschossenen Projektils von Stadt zu Stadt tragen. Dann komme man von Göttingen in einer halben Stunde nach Berlin.
Eugen wiegte zweifelnd den Kopf.
Seltsam sei es und ungerecht, sagte Gauß, so recht ein Beispiel für die erbärmliche Zufälligkeit der Existenz, daß man in einer bestimmten Zeit geboren und ihr verhaftet sei, ob man wolle oder nicht. Es verschaffe einem einen unziemlichen Vorteil vor der Vergangenheit und mache einen zum Clown der Zukunft.
Eugen nickte schläfrig.
Sogar ein Verstand wie der seine, sagte Gauß, hätte in frühen Menschheitsaltern oder an den Ufern des Orinoko nichts zu leisten vermocht, wohingegen jeder Dummkopf in zweihundert Jahren sich über ihn lustig machen und absurden Unsinn über seine Person erfinden könne. Er überlegte, nannte Eugen noch einmal einen Versager und widmete sich dem Buch. Während er las, starrte Eugen angestrengt aus dem Kutschenfenster, um sein vor Kränkung und Wut verzerrtes Gesicht zu verbergen.
In der Deutschen Turnkunst ging es um Gymnastikgeräte. Ausführlich beschrieb der Autor Vorrichtungen, die er sich ausgedacht hatte, damit man auf ihnen herumklimmen könne. Eine nannte er Pferd, eine andere den Balken, wieder eine andere den Bock.
Der Kerl sei von Sinnen, sagte Gauß, öffnete das Fenster und warf das Buch hinaus.
Das sei seines gewesen, rief Eugen.
Genau so sei es ihm vorgekommen, sagte Gauß, schlief ein und wachte bis zum abendlichen Pferdewechsel an der Grenzstation nicht mehr auf.
Während die alten Pferde ab- und neue angeschirrt wurden, aßen sie Kartoffelsuppe in einer Gastwirtschaft. Ein dünner Mann mit langem Bart und hohlen Wangen, der einzige Gast außer ihnen, musterte sie verstohlen vom Nebentisch aus. Das Körperliche, sagte Gauß, der zu seinem Ärger von Turngeräten geträumt hatte, sei wahrhaftig die Quelle aller Erniedrigung. Er habe es immer bezeichnend für Gottes bösen Humor gefunden, daß ein Geist wie seiner in einen kränklichen Körper eingesperrt sei, während ein Durchschnittskopf wie Eugen praktisch nie krank werde.
Als Kind habe er schwere Pocken gehabt, sagte Eugen. Er habe es fast nicht überlebt. Hier sehe man noch die Narben!
Ja richtig, sagte Gauß, das habe er vergessen. Er wies auf die Postpferde vor dem Fenster. Eigentlich sei es nicht ohne Witz, daß reiche Leute für eine Reise doppelt so lange bräuchten wie arme. Wer Tiere der Post verwende, könne sie nach jeder Etappe austauschen. Wer seine eigenen habe, müsse warten, bis sie sich erholt hätten.
Na und, fragte Eugen.
Natürlich, sagte Gauß, komme das einem, der nicht ans Denken gewohnt sei, selbstverständlich vor. Ebenso wie der Umstand, daß man als junger Mann einen Stock trage und als alter keinen.
Ein Student führe einen Knotenstock mit, sagte Eugen. Das sei immer so gewesen, und das werde so bleiben.
Vermutlich, sagte Gauß und lächelte.
Sie löffelten schweigend, bis der Gendarm von der Grenzstation hereinkam und ihre Pässe verlangte. Eugen gab ihm seinen Passierschein: ein Zertifikat des Hofes, in dem stand, daß er, wiewohl Student, unbedenklich sei und in Begleitung des Vaters preußischen Boden betreten dürfe. Der Gendarm betrachtete ihn mißtrauisch, prüfte den Paß, nickte und wandte sich Gauß zu. Der hatte nichts.
Gar keinen Paß, fragte der Gendarm überrascht, keinen Zettel, keinen Stempel, nichts?
Er habe so etwas noch nie gebraucht, sagte Gauß. Zum letztenmal habe er Hannovers Grenzen vor zwanzig Jahren überschritten. Damals habe er keine Probleme gehabt.
Eugen versuchte zu erklären, wer sie seien, wohin sie führen und auf wessen Wunsch. Die Naturforscherversammlung finde unter Schirmherrschaft der Krone statt. Als ihr Ehrengast sei sein Vater gewissermaßen vom König eingeladen.
Der Gendarm wollte einen Paß.
Er könne das ja nicht wissen, sagte Eugen, aber sein Vater werde verehrt in entferntesten Ländern, sei Mitglied aller Akademien, werde seit früher Jugend Fürst der Mathematiker genannt.
Gauß nickte. Man sage, Napoleon habe seinetwegen auf den Beschuß Göttingens verzichtet.
Eugen wurde blaß.
Napoleon, wiederholte der Gendarm.
Allerdings, sagte Gauß.
Der Gendarm verlangte, etwas lauter als zuvor, einen Paß.
Gauß legte den Kopf auf seine Arme und rührte sich nicht. Eugen stieß ihn an, doch ohne Erfolg. Ihm sei es egal, murmelte Gauß, er wolle nach Hause, ihm sei es ganz egal.
Der Gendarm rückte verlegen an seiner Mütze.
Da mischte sich der Mann am Nebentisch ein. Das alles werde enden! Deutschland werde frei sein, und gute Bürger würden unbehelligt leben und reisen, gesund an Körper und Geist, und kein Papierzeug mehr brauchen.
Ungläubig verlangte der Gendarm seinen Ausweis.
Das eben meine er, rief der Mann und kramte in seinen Taschen. Plötzlich sprang er auf, stieß seinen Stuhl um und stürzte hinaus. Der Gendarm starrte ein paar Sekunden auf die offene Tür, bevor er sich faßte und ihm nachlief.
Gauß hob langsam den Kopf. Eugen schlug vor, sofort weiterzufahren. Gauß nickte und aß schweigend den Rest der Suppe. Das Gendarmenhäuschen stand leer, beide Polizisten hatten sich an die Verfolgung des Bärtigen gemacht. Eugen und der Kutscher wuchteten gemeinsam den Schlagbaum in die Höhe. Dann fuhren sie auf preußischen Boden.
Gauß war nun aufgeräumt, fast heiter. Er sprach über Differentialgeometrie. Man könne kaum ahnen, wohin der Weg in die gekrümmten Räume noch führen werde. Er selbst begreife erst in groben Zügen, Eugen solle froh sein über seine Mittelmäßigkeit, manchmal werde einem angst und bange. Dann erzählte er von der Bitternis seiner Jugend. Er habe einen harten, abweisenden Vater gehabt, Eugen könne sich glücklich schätzen. Gerechnet habe er noch vor seinem ersten Wort. Einmal habe der Vater beim Abzählen des Monatslohns einen Fehler gemacht, darauf habe er zu weinen begonnen. Als der Vater den Fehler korrigiert habe, sei er sofort verstummt.
Eugen tat beeindruckt, obgleich er wußte, daß die Geschichte nicht stimmte. Sein Bruder Joseph hatte sie erfunden und verbreitet. Inzwischen mußte sie dem Vater so oft zu Ohren gekommen sein, daß er angefangen hatte, sie zu glauben.
Gauß kam auf den Zufall zu sprechen, den Feind allen Wissens, den er immer habe besiegen wollen. Aus der Nähe betrachtet, sehe man hinter jedem Ereignis die unendliche Feinheit des Kausalgewebes. Trete man weit genug zurück, offenbarten sich die großen Muster. Freiheit und Zufall seien eine Frage der mittleren Entfernung, eine Sache des Abstands. Ob er verstehe?
So ungefähr, sagte Eugen müde und sah auf seine Taschenuhr. Sie ging nicht sehr genau, aber es mußte zwischen halb vier und fünf Uhr morgens sein.
Doch die Regeln der Wahrscheinlichkeit, fuhr Gauß fort, während er die Hände auf seinen schmerzenden Rücken preßte, gälten nicht zwingend. Sie seien keine Naturgesetze, Ausnahmen seien möglich. Zum Beispiel ein Intellekt wie seiner oder jene Gewinne beim Glücksspiel, die doch unleugbar ständig irgendein Strohkopf mache. Manchmal vermute er sogar, daß auch die Gesetze der Physik bloß statistisch wirkten, mithin Ausnahmen erlaubten: Gespenster oder die Übertragung der Gedanken.
Eugen fragte, ob das ein Scherz sei.
Das wisse er selbst nicht, sagte Gauß, schloß die Augen und fiel in tiefen Schlaf.
Sie erreichten Berlin am Spätnachmittag des nächsten Tages. Tausende kleine Häuser ohne Mittelpunkt und Anordnung, eine ausufernde Siedlung an Europas sumpfigster Stelle. Eben erst hatte man angefangen, prunkvolle Gebäude zu errichten: einen Dom, einige Paläste, ein Museum für die Funde von Humboldts großer Expedition.
In ein paar Jahren, sagte Eugen, werde das hier eine Metropole sein wie Rom, Paris oder Sankt Petersburg.
Niemals, sagte Gauß. Widerliche Stadt!
Die Kutsche rumpelte über schlechtes Pflaster. Zweimal scheuten die Pferde vor knurrenden Hunden, in den Nebenstraßen blieben die Räder fast im nassen Sand stecken. Ihr Gastgeber wohnte im Packhof Nummer vier, in der Stadtmitte, gleich hinter der Baustelle des neuen Museums. Damit sie es nicht verfehlten, hatte er mit dünner Feder einen sehr genauen Lageplan gezeichnet. Jemand mußte sie von weitem gesehen und angekündigt haben, denn wenige Sekunden nachdem sie in den Hof eingefahren waren, flog die Haustür auf, und vier Männer liefen ihnen entgegen.
Alexander von Humboldt war ein kleiner alter Herr mit schlohweißen Haaren. Hinter ihm kamen ein Sekretär mit aufgeschlagenem Schreibblock, ein Bote in Livree und ein backenbärtiger junger Mann, der ein Gestell mit einem Holzkasten trug. Als hätten sie es geprobt, stellten sie sich in Positur. Humboldt streckte die Arme nach der Kutschentür aus.
Nichts geschah.
Aus dem Inneren des Fahrzeugs hörte man hektisches Reden. Nein, rief jemand, nein! Ein dumpfer Schlag ertönte, dann zum dritten Mal: Nein! Und eine Weile nichts.
Endlich klappte die Tür auf, und Gauß stieg vorsichtig auf die Straße hinab. Er zuckte zurück, als Humboldt ihn an den Schultern faßte und rief, welche Ehre es sei, was für ein großer Moment für Deutschland, die Wissenschaft, ihn selbst.
Der Sekretär notierte, der Mann hinter dem Holzkasten zischte: Jetzt!
Humboldt erstarrte. Das sei Herr Daguerre, flüsterte er, ohne die Lippen zu bewegen. Ein Schützling von ihm, der an einem Gerät arbeite, welches den Augenblick auf eine lichtempfindliche Silberjodidschicht bannen und der fliehenden Zeit entreißen werde. Bitte auf keinen Fall bewegen!
Gauß sagte, er wolle nach Hause.
Nur einen Augenblick, flüsterte Humboldt, fünfzehn Minuten etwa, man sei schon recht weit fortgeschritten. Vor kurzem habe es noch viel länger gedauert, bei den ersten Versuchen habe er gemeint, sein Rücken halte es nicht aus. Gauß wollte sich loswinden, aber der kleine Alte hielt ihn mit überraschender Kraft fest und murmelte: Dem König Bescheid geben! Schon war der Bote fortgerannt. Dann, offenbar weil es ihm gerade durch den Kopf ging: Notiz, Möglichkeit einer Robbenzucht in Warnemünde prüfen, Bedingungen scheinen günstig, mir morgen vorlegen! Der Sekretär notierte.
Eugen, der erst jetzt leicht hinkend aus der Kutsche stieg, entschuldigte sich für die späte Stunde ihrer Ankunft.
Hier gebe es keine frühe oder späte Stunde, murmelte Humboldt. Hier gebe es nur Arbeit, und die werde getan. Zum Glück habe man noch Licht. Nicht bewegen!
Ein Polizist betrat den Hof und fragte, was hier los sei.
Später, zischte Humboldt mit zusammengepreßten Lippen.
Dies sei eine Zusammenrottung, sagte der Polizist. Entweder man gehe sofort auseinander, oder er werde amtshandeln.
Er sei Kammerherr, zischte Humboldt.
Was bitte? Der Polizist beugte sich vor.
Kammerherr, wiederholte Humboldts Sekretär. Angehöriger des Hofes.
Daguerre forderte den Polizisten auf, aus dem Bild zu gehen.
Mit gerunzelter Stirn trat der Polizist zurück. Erstens könne das nun aber jeder sagen, zweitens gelte das Versammlungsverbot für alle. Und der da, er zeigte auf Eugen, sei offensichtlich Student. Da werde es besonders heikel.
Wenn er sich nicht gleich davonmache, sagte der Sekretär, werde er Schwierigkeiten bekommen, die er sich noch gar nicht vorstellen könne.
So spreche man nicht mit einem Beamten, sagte der Polizist zögernd. Er gebe ihnen fünf Minuten.
Gauß stöhnte und riß sich los.
Ach nein, rief Humboldt.
Daguerre stampfte mit dem Fuß auf. Jetzt sei der Moment für immer verloren!
Wie alle anderen, sagte Gauß ruhig. Wie alle anderen.
Und wirklich: Als Humboldt noch in derselben Nacht, während Gauß im Nebenzimmer so laut schnarchte, daß man es in der ganzen Wohnung hörte, die belichtete Kupferplatte mit einer Lupe untersuchte, erkannte er darauf gar nichts. Und erst nach einer Weile schien ihm ein Gewirr gespenstischer Umrisse darin aufzutauchen, die verschwommene Zeichnung von etwas, das aussah wie eine Landschaft unter Wasser. Mitten darin eine Hand, drei Schuhe, eine Schulter, der Ärmelaufschlag einer Uniform und der untere Teil eines Ohres. Oder doch nicht? Seufzend warf er die Platte aus dem Fenster und hörte sie dumpf auf den Boden des Hofes schlagen. Sekunden später hatte er sie, wie alles, was ihm je mißlungen war, vergessen.
Das Meer
Alexander von Humboldt war in ganz Europa berühmt wegen einer Expedition in die Tropen, die er fünfundzwanzig Jahre zuvor unternommen hatte. Er war in Neuspanien, Neugranada, Neubarcelona, Neuandalusien und den Vereinigten Staaten gewesen, hatte den natürlichen Kanal zwischen Orinoko und Amazonas entdeckt, den höchsten Berg der bekannten Welt bestiegen, Tausende Pflanzen und Hunderte Tiere, manche lebend, die meisten tot, gesammelt, hatte mit Papageien gesprochen, Leichen ausgegraben, jeden Fluß, Berg und See auf seinem Weg vermessen, war in jedes Erdloch gekrochen und hatte mehr Beeren gekostet und Bäume erklettert, als sich irgend jemand vorstellen mochte.
Er war der jüngere von zwei Brüdern. Ihr Vater, ein wohlhabender Mann von niederem Adel, war früh gestorben. Seine Mutter hatte sich bei niemand anderem als Goethe erkundigt, wie sie ihre Söhne ausbilden solle.
Ein Brüderpaar, antwortete dieser, in welchem sich so recht die Vielfalt menschlicher Bestrebungen ausdrücke, wo also die reichen Möglichkeiten zu Tat und Genuß auf das vorbildlichste Wirklichkeit geworden, das sei in der Tat ein Schauspiel, angetan, den Sinn mit Hoffnung und den Geist mit mancherlei Überlegung zu erfüllen.
Diesen Satz verstand keiner. Nicht die Mutter, nicht ihr Majordomus Kunth, ein magerer Herr mit großen Ohren. Er meine zu begreifen, sagte Kunth schließlich, es handle sich um ein Experiment. Der eine solle zum Mann der Kultur ausgebildet werden, der andere zum Mann der Wissenschaft.
Und welcher wozu?
Kunth überlegte. Dann zuckte er die Schultern und schlug vor, eine Münze zu werfen.
Fünfzehn hochbezahlte Experten hielten ihnen Vorlesungen auf Universitätsniveau. Für den jüngeren Bruder Chemie, Physik, Mathematik, für den älteren Sprachen und Literatur, für beide Griechisch, Latein und Philosophie. Zwölf Stunden am Tag, jeden Tag der Woche, ohne Pause oder Ferien.
Der jüngere Bruder, Alexander, war wortkarg und schwächlich, man mußte ihn zu allem ermutigen, seine Noten waren mittelmäßig. Wenn man ihn sich selbst überließ, strich er durch die Wälder, sammelte Käfer und ordnete sie nach selbsterdachten Systemen. Mit neun Jahren baute er den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter nach und befestigte ihn auf dem Dach des Schlosses, das sie nahe der Hauptstadt bewohnten. Es war der zweite in Deutschland überhaupt; der andere stand in Göttingen auf dem Dach des Physikprofessors Lichtenberg. Nur an diesen zwei Orten war man vor dem Himmel sicher.
Der ältere Bruder sah aus wie ein Engel. Er konnte reden wie ein Dichter und schrieb früh altkluge Briefe an die berühmtesten Männer des Landes. Wer immer ihn traf, wußte sich vor Begeisterung kaum zu fassen. Mit dreizehn beherrschte er zwei Sprachen, mit vierzehn vier, mit fünfzehn sieben. Er war noch nie bestraft worden, keiner konnte sich erinnern, daß er je etwas falsch gemacht hätte. Mit dem englischen Gesandten sprach er über Handelspolitik, mit dem französischen über die Gefahr des Aufruhrs. Einmal sperrte er den jüngeren Bruder in einen Schrank in einem entlegenen Zimmer. Als ein Diener den Kleinen dort am nächsten Tag halb ohnmächtig fand, behauptete der, sich selbst eingeschlossen zu haben; er wußte, die Wahrheit hätte keiner geglaubt. Ein anderes Mal entdeckte er weißes Pulver in seinem Essen. Er verstand genug von Chemie, um zu erkennen, daß es Rattengift war. Mit zitternden Händen schob er den Teller weg. Von der anderen Seite des Tisches sah ihn der ältere anerkennend mit unergründlich hellen Augen an.
Niemand konnte leugnen, daß es im Schloß spukte. Nichts Spektakuläres, bloß Schritte in leeren Gängen, Kinderweinen ohne Ursprung und manchmal ein schemenhafter Herr, der mit schnarrender Stimme darum bat, ihm Schuhbänder, kleine Spielzeugmagneten oder ein Glas Limonade abzukaufen. Unheimlicher als die Geister aber waren die Geschichten über sie: Kunth gab den beiden Jungen Bücher zu lesen, in denen es um Mönche ging, um offene Gräber, Hände, die aus der Tiefe ragten, in der Unterwelt gebraute Elixiere und Séancen, bei denen Tote zu schreckensstarren Zuhörern sprachen. Solches kam gerade in Mode und war noch so neu, daß keine Gewohnheit gegen das Grauen half. Das sei nötig, erklärte Kunth, die Begegnung mit dem Dunkel sei Teil des Heranwachsens, wer metaphysische Angst nicht kenne, werde nie ein deutscher Mann. Einmal stießen sie auf eine Geschichte über Aguirre den Wahnsinnigen, der seinem König abgeschworen und sich selbst zum Kaiser ernannt hatte. In einer Alptraumfahrt ohnegleichen waren er und seine Männer den Orinoko entlanggefahren, an dessen Ufern das Unterholz so dicht war, daß man nicht an Land gehen konnte. Vögel schrien in den Sprachen ausgestorbener Völker, und wenn man aufblickte, spiegelte der Himmel Städte, deren Architektur offenbarte, daß ihre Erbauer keine Menschen waren. Noch immer waren kaum Forscher in diese Gegend vorgedrungen, und eine verläßliche Karte gab es nicht.
Aber er werde es tun, sagte der jüngere Bruder. Er werde dorthin reisen.
Sicherlich, antwortete der Ältere.
Er meine es ernst!
Das sei ihm klar, sagte der Ältere und rief einen Diener, um Tag und Stunde zu bezeugen. Einmal werde man froh sein, diesen Augenblick fixiert zu haben.
In Physik und Philosophie unterrichtete sie Marcus Herz, Lieblingsschüler von Immanuel Kant und Ehemann der für ihre Schönheit berühmten Henriette. Er goß zwei Substanzen in einen Glaskrug: Die Flüssigkeit zögerte einen Moment, bevor sie mit einem Schlag die Farbe wechselte. Er ließ Wasserstoff aus einem Röhrchen strömen, hielt eine Flamme an die Mündung, und mit einem Jauchzen schoß das Feuer auf. Ein halbes Gramm, sagte er, zwölf Zentimeter hoch die Flamme. Wann immer einen die Dinge erschreckten, sei es eine gute Idee, sie zu messen.
In Henriettes Salon trafen sich einmal in der Woche gebildete Leute, sprachen über Gott und ihre Gefühle, weinten ein wenig, schrieben einander Briefe und nannten sich selbst die Tugendbündler. Niemand wußte mehr, wer auf diesen Namen gekommen war. Ihre Gespräche mußten nach außen hin geheimgehalten werden; aber anderen Tugendbündlern hatte man über alles, was einem in der Seele vorging, offen und mit Ausführlichkeit Auskunft zu geben. Ging einem nichts in der Seele vor, mußte man etwas erfinden. Die zwei Brüder waren die jüngsten. Auch dies sei nötig, sagte Kunth, und sie dürften keinesfalls ein Treffen versäumen. Es diene der Herzensbildung. Ausdrücklich ermutigte er sie, an Henriette zu schreiben. Eine Vernachlässigung sentimentalischer Kultur in frühen Lebensphasen könne später unerfreuliche Folgen zeitigen. Es verstand sich von selbst, daß ihm jedes Schreiben vorgelegt werden mußte. Wie erwartet, waren die Briefe des älteren Bruders die besseren.
Henriette antwortete ihnen höflich, in einer unsicheren Kinderschrift. Sie war selbst erst neunzehn. Ein Buch, das ihr der jüngere geschenkt hatte, kam ungelesen zurück: L’homme machine von La Mettrie. Dieses Werk sei verboten, ein verabscheuungswürdiges Pamphlet. Sie bringe es nicht über sich, es auch nur aufzuschlagen.
Das bedauere er, sagte der jüngere Bruder zum älteren. Es sei ein bemerkenswertes Buch. Der Autor behaupte ernstlich, der Mensch sei eine Maschine, ein automatisch agierendes Gestell von höchster Kunstfertigkeit.
Und ohne Seele, antwortete der Ältere. Sie gingen durch den Schloßpark; der Schnee lag dünn auf kahlen Bäumen.
Nein, widersprach der Jüngere. Mit Seele. Mit Ahnungen und poetischem Gespür für Weite und Schönheit. Doch sei diese Seele selbst nur ein Teil, wenn auch der komplizierteste, der Maschinerie. Und er frage sich, ob das nicht der Wahrheit entspreche.
Alle Menschen Maschinen?
Vielleicht nicht alle, sagte der Jüngere nachdenklich. Aber wir.
Der Teich war zugefroren, die Dämmerung des Spätnachmittags färbte Schnee und Eiszapfen blau. Er habe ihm etwas mitzuteilen, sagte der Ältere. Man mache sich Sorgen um ihn. Seine schweigsame Art, seine Verschlossenheit. Die schleppenden Erfolge im Unterricht. Mit ihnen beiden stehe und falle ein großer Versuch. Keiner von ihnen habe das Recht, sich gehenzulassen. Er zögerte einen Moment. Das Eis sei übrigens ganz fest.
Tatsächlich?
Aber ja.
Der Jüngere nickte, holte Luft und trat auf den See. Er überlegte, ob er Klopstocks Eislaufode rezitieren sollte. Mit den Armen weit ausschwingend, glitt er zur Mitte. Er drehte sich um sich selbst. Sein Bruder stand leicht zurückgebeugt am Ufer und schaute ihm zu.
Auf einmal war es still. Er sah nichts mehr, und die Kälte nahm ihm fast die Sinne. Erst da begriff er, daß er unter Wasser war. Er strampelte. Sein Kopf prallte gegen etwas Hartes, das Eis. Seine Fellmütze löste sich und schwebte davon, seine Haare richteten sich auf, seine Füße schlugen auf den Boden. Jetzt hatten sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Einen Moment lang sah er eine erstarrte Landschaft: zitternde Halme, darüber Gewächse, durchsichtig wie Schleier, einen einzelnen Fisch, eben noch da, jetzt schon weg, wie eine Täuschung. Er machte Schwimmbewegungen, stieg auf, prallte wieder gegen das Eis. Ihm wurde klar, daß er nur noch Sekunden zu leben hatte. Er tastete, und gerade als er keine Luft mehr hatte, sah er einen dunklen Fleck über sich, die Öffnung; er riß sich nach oben, atmete ein und aus und spuckte, das scharfkantige Eis zerschnitt ihm die Hände, er hievte sich empor, rollte sich ab, zog die Beine nach und lag keuchend, schluchzend da. Er drehte sich auf den Bauch und robbte auf das Ufer zu. Sein Bruder stand noch wie zuvor, zurückgebeugt, die Hände in den Taschen, die Mütze ins Gesicht gezogen. Er streckte die Hand aus und half ihm auf die Füße.
In der Nacht kam das Fieber. Er vernahm Stimmen und wußte nicht, ob sie Gestalten seiner Träume oder den Menschen gehörten, die sein Bett umringten, und immer noch spürte er die Eiseskälte. Ein Mann ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, wahrscheinlich der Arzt, und sagte, entscheide dich, gelingen oder nicht, das ist ein Entschluß, man muß dann nur durchhalten, oder? Aber als er darauf antworten wollte, erinnerte er sich nicht mehr, was gesagt worden war, statt dessen sah er ein weit ausgespanntes Meer unter einem elektrisch flackernden Himmel, und als er wieder die Augen öffnete, war es Mittag am übernächsten Tag, die Wintersonne hing bleich im Fenster, und sein Fieber hatte nachgelassen.
Von nun an wurden seine Noten besser. Er arbeitete konzentriert und nahm die Gewohnheit an, beim Nachdenken die Fäuste zu ballen, als müsse er einen Feind besiegen. Er habe sich verändert, schrieb ihm Henriette, ein wenig mache er ihr jetzt angst. Er bat darum, eine Nacht in dem leeren Zimmer verbringen zu dürfen, aus dem man am häufigsten nächtliche Laute hörte. Am Morgen darauf war er blaß und still, und senkrecht über seine Stirn zog sich die erste Falte.
Kunth entschied, daß der ältere Bruder die Rechte und der jüngere Kameralistik studieren solle. Natürlich reiste er mit ihnen zur Universität nach Frankfurt an der Oder, begleitete sie in die Vorlesungen und überwachte ihre Fortschritte. Es war keine gute Hochschule. Wenn einer nichts könne und Doktor werden wolle, schrieb der Ältere an Henriette, solle er getrost kommen. Auch sei aus Gründen, die keiner kenne, meist ein großer Hund im Kollegium, kratze sich viel und mache Geräusche.
Beim Botaniker Wildenow sah der Jüngere zum erstenmal getrocknete Tropenpflanzen. Sie hatten fühlerartige Auswüchse, Knospen wie Augen und Blätter, deren Oberfläche sich anfühlte wie menschliche Haut. Aus Träumen kamen sie ihm vertraut vor. Er zerschnitt sie, machte sorgfältige Skizzen, prüfte ihre Reaktion auf Säuren und Basen und verarbeitete sie säuberlich zu Präparaten.
Er wisse nun, sagte er zu Kunth, womit er sich befassen wolle. Mit dem Leben.
Das könne er nicht billigen, sagte Kunth. Man habe auf der Welt andere Aufgaben, als einfach nur dazusein. Leben allein, das sei kein Inhalt einer Existenz.
So meine er es nicht, antwortete er. Er wolle das Leben erforschen, die seltsame Hartnäckigkeit verstehen, mit der es den Globus umspanne. Er wolle ihm auf die Schliche kommen!
Also durfte er bleiben und bei Wildenow studieren.
Im nächsten Semester wechselte der ältere Bruder an die Universität Göttingen. Während er dort seine ersten Freunde fand, zum erstenmal Alkohol trank und eine Frau berührte, schrieb der Jüngere seine erste wissenschaftliche Arbeit.
Gut, sagte Kunth, aber noch nicht gut genug, um unter dem Namen Humboldt gedruckt zu werden. Mit dem Veröffentlichen müsse man noch warten.
In den Ferien besuchte er den älteren Bruder. Auf einem Empfang des französischen Konsuls lernte er den Mathematiker Kästner kennen, dessen Freund Hofrat Zimmermann und den wichtigsten Experimentalphysiker Deutschlands, Professor Georg Christoph Lichtenberg. Dieser drückte ihm weich die Hand und starrte, bucklig, doch mit makellos schönem Gesicht, ein Klumpen aus Fleisch und Intelligenz, belustigt an ihm empor. Humboldt fragte ihn, ob es stimme, daß er an einem Roman arbeite.
Ja und nein, antwortete Lichtenberg mit einem Blick, als sehe er etwas, von dem Humboldt selbst nichts ahne. Das Werk heiße Über Gunkel, handle von nichts und komme überhaupt nicht voran.
Das Romanschreiben, sagte Humboldt, erscheine ihm als Königsweg, um das Flüchtigste der Gegenwart für die Zukunft festzuhalten.
Aha, sagte Lichtenberg.
Humboldt errötete. Somit sei es ein albernes Unterfangen, wenn ein Autor, wie es jetzt Mode werde, eine schon entrückte Vergangenheit zum Schauplatz wähle.
Lichtenberg betrachtete ihn mit schmalen Augen. Nein, sagte er dann. Und ja.
Auf dem Heimweg sahen die Brüder eine zweite, nur wenig größere Silberscheibe neben dem gerade aufgegangenen Mond. Ein Heißluftballon, erklärte der ältere. Pilâtre de Rozier, der Mitarbeiter der Montgolfiers, weile zur Zeit im nahen Braunschweig. Die ganze Stadt rede davon. Bald würden alle Menschen in die Luft steigen.
Aber sie würden es nicht wollen, sagte der Jüngere. Sie hätten zuviel Angst.
Kurz vor seiner Abreise lernte er den berühmten Georg Forster kennen, einen dünnen, hustenden Mann mit ungesunder Gesichtsfarbe. Er hatte mit Cook die Welt umrundet und mehr gesehen als irgendein anderer Mensch aus Deutschland; jetzt war er eine Legende, sein Buch war weltbekannt, und er arbeitete als Bibliothekar in Mainz. Er erzählte von Drachen und lebenden Toten, von überaus höflichen Kannibalen, von Tagen, an denen das Meer so klar war, daß man meinte, über einem Abgrund zu schweben, von Stürmen, so heftig, daß man nicht zu beten wagte. Melancholie umgab ihn wie ein feiner Nebel. Er habe zuviel gesehen, sagte er. Eben davon handle das Gleichnis von Odysseus und den Sirenen. Es helfe nichts, sich an den Mast zu binden, auch als Davongekommener erhole man sich nicht von der Nähe des Fremden. Er finde kaum Schlaf mehr, die Erinnerungen seien zu stark. Vor kurzem habe er Nachricht bekommen, daß sein Kapitän, der große und dunkle Cook, auf Hawaii gekocht und gegessen worden sei. Er rieb sich die Stirn und betrachtete die Schnallen seiner Schuhe. Gekocht und gegessen, wiederholte er.
Er selbst wolle auch reisen, sagte Humboldt.
Forster nickte. Mancher wolle das. Und jeder bereue es später.
Warum?
Weil man nie zurückkommen könne.
Forster empfahl ihn an die Bergbauakademie in Freiberg. Dort lehrte Abraham Werner: Das Erdinnere sei kalt und fest. Gebirge entstünden durch chemische Ausfällungen aus dem schrumpfenden Ozean der Urzeit. Das Feuer der Vulkane komme keineswegs von tief innen, es werde genährt von brennenden Kohlelagern, der Erdkern sei aus hartem Stein. Diese Lehre nannte sich Neptunismus und wurde von beiden Kirchen und Johann Wolfgang Goethe verfochten. In der Freiberger Kapelle ließ Werner Seelenmessen für seine die Wahrheit noch leugnenden Gegner lesen. Einmal hatte er einem zweifelnden Studenten die Nase gebrochen, angeblich einem anderen vor vielen Jahren ein Ohr abgebissen. Er war einer der letzten Alchimisten: Mitglied geheimer Logen, Kenner der Zeichen, denen die Dämonen gehorchten. Er vermochte Zerstörtes wieder zusammenzufügen, aus dem Rauch das zuvor Verbrannte und aus dem Zerstoßenen wieder Festes zu formen, auch hatte er mit dem Teufel gesprochen und Gold gemacht. Intelligent wirkte er dennoch nicht. Er lehnte sich zurück, kniff die Augen zusammen und fragte Humboldt, ob er Neptunist sei und ans kalte Erdinnere glaube.
Humboldt versicherte es.
Dann müsse er aber auch heiraten.
Humboldt wurde rot.
Werner blies die Backen auf, machte eine Verschwörermiene und fragte, ob er einen Schatz habe.
Das behindere nur, sagte Humboldt. Man heirate, wenn man nichts Wesentliches im Leben vorhabe.
Werner starrte ihn an.
So werde behauptet, sagte Humboldt schnell. Natürlich zu Unrecht!
Ein unverheirateter Mann, sagte Werner, sei noch nie ein guter Neptunist gewesen.
Humboldt durchlief das Kurrikulum der Akademie in einem Vierteljahr. Morgens war er sechs Stunden unter der Erde, nachmittags hörte er Vorlesungen, am Abend und die Hälfte der Nacht lernte er für den nächsten Tag. Freunde hatte er keine, und als sein Bruder ihn zu seiner Hochzeit einlud – er habe eine Frau gefunden, wie sie ihm gezieme, eine, die nicht ihresgleichen habe auf der Welt –, antwortete er höflich, daß er nicht kommen könne, ihm fehle Zeit. Er kroch durch die niedrigsten Schächte, bis er sich an seine Platzangst gewöhnt hatte wie an einen nicht nachlassenden, allmählich jedoch erträglichen Schmerz. Er stellte Temperaturmessungen an: Je tiefer man hinabstieg, desto wärmer wurde es, und das widersprach allen Lehren Abraham Werners. Ihm fiel auf, daß es noch in der tiefsten Höhlendunkelheit Vegetation gab. Das Leben schien nirgendwo aufzuhören, überall fand sich noch eine Form von Moos und Wucherung, irgendeine Art verkümmerter Gewächse. Sie waren ihm unheimlich, und darum zerlegte und untersuchte er sie, ordnete sie nach Klassen und schrieb eine Abhandlung darüber. Jahre später, als er ähnliche Pflanzen in der Höhle der Toten sah, war er vorbereitet.
Er machte den Abschluß und bekam eine Uniform. Wo immer er auch hinkam, sollte er sie tragen. Sein Amtstitel war der eines Assessors beim Berg- und Hüttendepartement. Er schäme sich selbst, schrieb er seinem Bruder, daß er sich so darüber freue.
Wenige Monate später war er schon Preußens zuverlässigster Bergwerksinspektor. Er ließ sich durch Hütten, Torfstechereien und zu den Brennöfen der Königlichen Porzellanmanufaktur führen; überall erschreckte er die Arbeiter durch die Geschwindigkeit, mit der er sich Notizen machte. Er war ständig unterwegs, schlief und aß kaum und wußte selbst nicht, was all das sollte. Etwas sei an ihm, schrieb er seinem Bruder, das ihn befürchten lasse, er verliere den Verstand.
Zufällig stieß er auf Galvanis Buch über den Strom und die Frösche. Galvani hatte abgetrennte Froschschenkel mit zwei unterschiedlichen Metallen verbunden, und sie hatten gezuckt wie lebendig. Lag das nun an den Schenkeln, in denen noch Lebenskraft war, oder war die Bewegung von außen gekommen, aus dem Unterschied der Metalle, und von den Froschteilen bloß sichtbar gemacht? Humboldt beschloß, es herauszufinden.
Er zog sein Hemd aus, legte sich aufs Bett und wies einen Diener an, zwei Aderlaßpflaster auf seinen Rücken zu kleben. Der Diener gehorchte, Humboldts Haut warf zwei große Blasen. Und jetzt solle er die Blasen aufschneiden! Der Diener zögerte, Humboldt mußte laut werden, der Diener nahm das Skalpell. Es war so scharf, daß der Schnitt kaum schmerzte. Blut tropfte auf den Boden. Humboldt befahl, ein Stück Zink auf eine der Wunden zu legen.
Der Diener fragte, ob er eine Pause machen dürfe, ihm sei nicht wohl.
Humboldt bat ihn, sich nicht dumm anzustellen. Als ein Silberstück die zweite Wunde berührte, ging ein schmerzhaftes Pochen durch seine Rückenmuskeln, bis hinauf in den Kopf. Mit zitternder Hand notierte er: Musculus cucularis, Hinterhauptbein, Stachelfortsätze des Rückenwirbelbeins. Kein Zweifel, hier wirkte Elektrizität. Noch einmal das Silber! Er zählte vier Schläge, in regelmäßigem Abstand, dann wichen die Farben aus den Gegenständen.
Als er wieder zu sich kam, saß der Diener auf dem Boden, das Gesicht bleich, die Hände blutig.
Weiter, sagte Humboldt, und mit seltsamem Schrecken wurde ihm klar, daß etwas in ihm Lust empfand. Jetzt die Frösche!
Das nicht, sagte der Diener.
Humboldt fragte, ob er sich eine neue Anstellung suchen wolle.
Der Diener legte vier tote, sorgsam gereinigte Frösche auf Humboldts blutigen Rücken. Aber jetzt reiche es, sagte er, sie seien doch Christenmenschen.
Humboldt ignorierte ihn und befahl: Wieder das Silber! Schon kamen die Schläge. Bei jedem davon, er sah es im Spiegel, sprangen die Froschleiber wie lebendig. Er biß in das Kissen, der Stoff war naß von seinen Tränen. Der Diener kicherte hysterisch, Humboldt wollte Notizen machen, aber seine Hände waren zu schwach. Mühsam stand er auf. Aus den zwei Wunden lief Flüssigkeit, so ätzend, daß sie seine Haut entzündete. Humboldt versuchte etwas davon in einem Glasröhrchen aufzufangen, aber seine Schulter war geschwollen, und er konnte sich nicht drehen. Er sah den Diener an.
Der schüttelte den Kopf.
Na gut, sagte Humboldt, dann solle er jetzt in Gottes Namen den Arzt holen! Er wischte sich das Gesicht ab und wartete, bis er wieder fähig war, die Hände zu gebrauchen und das Nötigste aufzuschreiben. Strom war geflossen, das hatte er gespürt, und entsprungen war er nicht seinem Körper und nicht den Fröschen, sondern der chemischen Feindschaft der Metalle.
Es war nicht leicht, dem Arzt zu erklären, was hier geschehen war. Der Diener kündigte in der Woche darauf, zwei Narben blieben, und die Abhandlung über die lebendige Muskelfaser als leitende Substanz begründete Humboldts wissenschaftlichen Ruf.
Er scheine verwirrt zu sein, schrieb sein Bruder aus Jena. Doch möge er bedenken, daß man moralische Verpflichtungen auch dem eigenen Körper gegenüber habe, der doch kein Ding unter Dingen sei; ich bitte Dich, komm! Schiller möchte Dich kennenlernen.
Du verkennst mich, antwortete Humboldt. Ich habe herausgefunden, daß der Mensch bereit ist, Unbill zu erfahren, aber viel Erkenntnis entgeht ihm, weil er den Schmerz fürchtet. Wer sich jedoch zum Schmerz entschließt, begreift Dinge, die er nicht … Er legte die Feder weg, rieb sich die Schulter und zerknüllte das Blatt. Unsere Brüderlichkeit, begann er von neuem, wieso erscheint sie mir als das eigentliche Rätsel? Daß wir allein sind und verdoppelt, daß Du bist, was ich nicht werden soll, und ich bin, was Du nicht sein kannst, daß wir zu zweit durchs Dasein müssen, einander, ob wir wollen oder nicht, für immer näher als jedem anderen. Und wieso vermute ich, daß unsere Größe folgenlos bleiben und, was wir auch vollbringen, dahinschwinden wird, als wäre es nichts, bis unsere gegeneinander gewachsenen Namen, wieder zu einem verschmolzen, verblassen werden? Er stockte, dann zerriß er das Blatt in winzige Fetzen.
Um die Pflanzen in der Freiberger Mine zu untersuchen, entwickelte er die Grubenlampe: eine Flamme, genährt von einem Behälter Gas, die auch an Orten ohne Luft noch Licht gab. Fast hätte es ihn umgebracht. Er stieg in eine noch nie erforschte Kammer ab, stellte die Lampe hin und wurde nach wenigen Minuten ohnmächtig. Sterbend sah er tropische Schlingpflanzen, welche unter seinem Blick zu Frauenkörpern wurden, aufschreiend kam er zu sich. Ein Spanier namens Andres del Rio, ein ehemaliger Mitschüler an der Freiberger Akademie, hatte ihn gefunden und hinaufgeschafft. Vor Scham brachte Humboldt es kaum fertig, sich zu bedanken.
In einem Monat harter Arbeit entwickelte er eine Respirationsmaschine: Von einem Luftsack führten zwei Schläuche zu einer Atemmaske. Er schnallte das Gerät um und stieg hinab. Mit steinernem Gesicht ertrug er die beginnenden Halluzinationen. Dann erst, seine Knie wurden bereits weich und das Schwindelgefühl vervielfachte die Kerzenflamme zu einer Feuersbrunst, öffnete er das Ventil und sah grimmig zu, wie die Frauen wieder zu Pflanzen und die Pflanzen zu nichts wurden. Er blieb noch Stunden in der kühlen Dunkelheit. Als er ans Tageslicht kam, erwartete ihn Kunths Schreiben, das ihn ans Sterbebett seiner Mutter rief.
Wie es sich gehörte, ritt er auf dem schnellsten Pferd, das zu bekommen war. Regen schlug ihm ins Gesicht, sein Mantel flatterte, zweimal rutschte er vom Sattel und