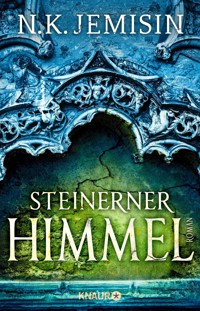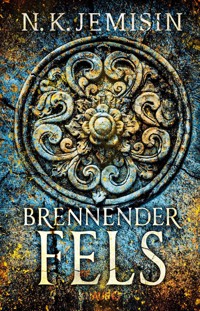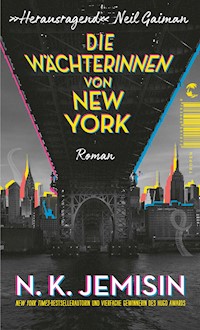
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine großartige Geschichte, angesiedelt in der fantastischsten aller Städte: New York. Sie ist auf die beste Art inklusiv und beinhaltet Elemente von Borges und Lovecraft, doch die einzigartige Stimme ist allein Jemisin.« Neil Gaiman Jede Stadt hat eine Seele. Manche so alt wie die Mythen. Andere so jung und ungestüm wie Kinder. Und New York City? Hat gleich mehr als eine. Gerade erst erwacht und so unterschiedlich, wie das Leben in New York, müssen sich die Wächter der Stadt zusammenschließen, um sie vor dem Grauen zu schützen, das unter ihr lauert. Städte sind lebendig. Sagt man. Doch das ist mehr als nur ein Sprichwort. Wenn eine Stadt erwacht, bestimmt sie jemanden, der sie verkörpert. Aber um New York steht es schlecht. Die Lebendigkeit der Stadt steht auf dem Spiel. Ihr Schicksal liegt in den Händen der Stadtteile und ihrer fünf Wächterinnen. Sie alle sind so unterschiedlich wie nur New York sein kann. Manny löst Probleme Manhattan-Style: mit Geld. In Brooklyn hört eine ehemalige Rapperin den Beat der Stadt. Und die Kuratorin einer Gemeindegalerie beweist, dass sich die Bronx nichts gefallen lässt. Aber was ist mit Queens und Staten Island? Die Lage ist kritisch und die Zeit drängt, denn zerstörerische Kräfte haben damit begonnen, die Stadt zu vergiften. Wenn die Wächterinnen keinen Weg finden, zusammenzuarbeiten, droht nicht nur New York das Schlimmste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
N. K. Jemisin
Aus dem amerikanischen Englisch von Benjamin Mildner
Tropen
Impressum
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Unterstützung seiner Arbeit.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The City We Became« im Verlag Orbit, New York.
© 2020 by N. K. Jemisin
Published by Arrangement with N. K. Jemisin
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutsche Ausgabe
© 2022, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München unter Verwendung der Daten des Originalverlags; Foto: © David Paire/Arcangel, Design: © Lauren Panepinto, Hachette Book Group Inc.
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Grafik Tentakel: © VectorStock
Karte: © Lauren Panepinto
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50187-2
E-Book ISBN 978-3-608-11860-5
»Zu New York gehört man augenblicklich, man gehört nach fünf Minuten so sehr hierher wie nach fünf Jahren.« TOM WOLFE
Prolog
Also, das war so
Ich besinge die Stadt.
Diese scheiß Stadt. Ich stehe auf dem Dach eines Gebäudes, in dem ich nicht wohne, und breite meine Arme aus und spanne meinen Bauch an und schreie sinnloses Geheul rüber zu der Baustelle, die mir die Sicht versperrt. Eigentlich besinge ich die Stadt, die dahinter liegt. Die wird das schon verstehen.
Sonnenaufgang. Die feuchte Luft macht, dass sich meine Jeans schmierig anfühlt, oder vielleicht liegt das auch daran, dass sie schon seit Wochen nicht gewaschen worden ist. Ich hätte genug Kleingeld, um sie waschen und trocknen zu lassen, nur leider keine zweite Hose, die ich in der Zwischenzeit anziehen könnte. Vielleicht kauf ich mir von dem Geld lieber eine Hose beim Goodwill die Straße runter … aber jetzt noch nicht. Jetzt muss ich erst noch AAAaaaAAAaaa (Luft holen) aaaAAAaaaaaa machen und zuhören, wie diese eine Silbe von jeder Fassade in der Umgebung zurückhallt. In meinem Kopf läuft die »Ode an die Freude« über einen Beat von Busta Rhymes. Meine Stimme bringt das Ganze nur zusammen.
Halt deine verdammte Fresse!, schreit irgendjemand, also verbeuge ich mich und gehe von der Bühne.
Doch mit der Hand an der Tür zum Treppenhaus bleibe ich stehen und drehe mich noch einmal um und lausche stirnrunzelnd, denn für einen Moment habe ich etwas gehört, das gleichzeitig weit entfernt und sehr vertraut meinen Gesang beantwortet hat, tief wie eine Bassstimme. Irgendwie neckisch.
Und von noch weiter weg höre ich etwas anderes: ein dissonantes, lauter werdendes Grummeln. Oder vielleicht ist das nur das leise Knurren, mit dem sich Polizeisirenen ankündigen? Jedenfalls nichts, was mir gefällt. Ich hau ab.
»Das muss immer auf eine ganz bestimmte Weise ablaufen«, sagt Paulo. Er raucht schon wieder, die Sau. Ich hab ihn noch nie essen gesehen. Er benutzt seinen Mund nur zum Rauchen, Kaffeetrinken und Reden. Irgendwie schade; ist eigentlich ein hübscher Mund.
Wir sitzen in einem Café. Ich sitze hier mit ihm, weil er mich zum Frühstück eingeladen hat. Die Leute im Café schauen ihn aus dem Augenwinkel an, weil er für sie nicht richtig weiß ist, aber sie wissen auch nicht, was er stattdessen ist. Mich schauen sie aus dem Augenwinkel an, weil ich definitiv Schwarz bin und weil die Löcher in meinen Klamotten nichts mit Mode zu tun haben. Ich stinke nicht, aber diese Leute hier können jeden, der kein Aktiendepot hat, auf einen Kilometer Entfernung riechen.
»Aha«, sage ich, während ich in ein Eiersandwich beiße und mir fast in die Hose mache vor Freude. Echtes Ei! Emmentaler! Das ist so viel besser als dieser McDonald’s-Scheiß.
Der Typ hört sich gerne reden. Ich mag seinen Akzent; hat was Nasales, Zischendes, ganz anders als bei Spanischsprechern. Seine Augen sind riesig, und ich denke mir, Wenn ich solche Kulleraugen hätte, würde man mir so viel mehr durchgehen lassen. Aber er wirkt älter, als er aussieht – sehr viel älter. Er hat nur ein paar feine, ehrwürdige graue Strähnen an den Schläfen, aber ich hab das Gefühl, er ist, keine Ahnung, hundert.
Er schaut mich auch aus dem Augenwinkel an, aber anders, als ich es sonst kenne. »Hörst du mir überhaupt zu?«, fragt er. »Das ist wichtig.«
»Jo«, sage ich und beiß noch mal von meinem Sandwich ab.
Er lehnt sich vor. »Ich hab’s zuerst auch nicht geglaubt. Hong musste mich in die Kanalisation zerren, runter in die stinkende Dunkelheit, und mir die wachsenden Wurzeln zeigen, die knospenden Zähne. Ich hatte es schon mein ganzes Leben lang atmen gehört. Ich dachte, jeder hätte das.« Er hält inne. »Hast du es schon gehört?«
»Was gehört?«, frage ich. Falsche Antwort. Es ist ja nicht so, als würde ich nicht zuhören. Es interessiert mich nur einen Scheiß.
Er seufzt. »Du musst zuhören.«
»Ich hör doch zu!«
»Nein. Ich meine, hör zu, aber nicht mir.« Er steht auf, wirft einen Zwanziger auf den Tisch – was nicht nötig wäre, weil er das Sandwich und den Kaffee schon am Tresen bezahlt hat und weil es in diesem Café sowieso keine Bedienung gibt. »Komm am Donnerstag wieder hierher.«
Ich nehme den Zwanziger, befühle ihn, stecke ihn in die Tasche. Ich hätt’s ihm auch nur für das Sandwich besorgt, oder weil mir seine Augen gefallen, aber was soll’s. »Hast du ’ne Wohnung?«
Er blinzelt, und schaut dann sehr genervt. »Hör zu«, befiehlt er mir noch mal, und geht.
Ich sitze noch so lange da, wie ich kann, esse mein Sandwich so langsam wie möglich, trinke in kleinen Schlückchen den Rest seines Kaffees, genieße die Vorstellung, ich wäre normal. Ich beobachte die Menschen, beurteile das Aussehen anderer Stammgäste; aus dem Stand improvisiere ich ein Gedicht aus der Perspektive eines reichen weißen Mädchens, das einen armen Schwarzen Jungen in ihrem Coffeeshop sieht und eine Existenzkrise hat. Ich stelle mir vor, wie Paulo von meiner Kultiviertheit beeindruckt ist und mich bewundert, anstatt mich nur für irgendeinen dummen Straßenjungen zu halten, der nicht zuhört. Ich male mir aus, wie ich nach Hause in eine hübsche Wohnung gehe, mit einem weichen Bett und einem Kühlschrank bis oben hin voll mit Essen.
Auf einmal kommt ein Bulle rein, ein fetter, rosiger Typ, der Kaffee für sich und seinen Partner im Streifenwagen holt, und mit leerem Blick schaut er sich im Laden um. Ich stelle mir Spiegel um meinen Kopf herum vor, einen rotierenden Zylinder aus Spiegeln, der seinen Blick einfach abprallen lässt. Das bewirkt eigentlich nichts – es ist nur etwas, das ich mache, um meine Angst in den Griff zu kriegen, wenn die Monster in der Nähe sind. Zum ersten Mal funktioniert es aber irgendwie: Der Bulle schaut sich um, bleibt aber nicht an dem einzigen Schwarzen Gesicht im Café hängen. Glück gehabt. Ich haue ab.
Ich bemale die Stadt. Als ich noch zur Schule ging, gab es einen Künstler, der immer freitags in die Schule kam und uns kostenlos Dinge beibrachte wie Perspektive und Licht und anderen Scheiß, für den weiße Leute auf die Kunsthochschule gehen. Dieser Typ hatte das auch gemacht, allerdings war er Schwarz. Ich hatte noch nie einen Schwarzen Künstler gesehen. Für eine kurze Zeit glaubte ich, ich könnte auch einer sein.
Und manchmal kann ich das auch. In der tiefen Nacht, auf einem Dach in Chinatown, mit einer Sprühdose in jeder Hand und einem Eimer Wandfarbe, den jemand rausgestellt hat, nachdem er sein Wohnzimmer fliederfarben gestrichen hat, wirbele ich in trippelnden, krebsartigen Bewegungen umher. Von der Wandfarbe kann ich nicht allzu viel benutzen; die blättert nach ein paar Regenschauern wieder ab. Spraydosen sind immer besser, aber ich mag den Kontrast zwischen den beiden Texturen – flüssiges Schwarz auf rauem Flieder, roter Rand um schwarze Flächen. Ich male ein Loch. Es ist wie eine Kehle, die nicht als Mund beginnt und in Lungenflügeln endet; ein Ding, das unaufhörlich atmet und schluckt und nie voll ist. Niemand wird es sehen, außer den Passagieren, die den LaGuardia-Flughafen von Südwesten anfliegen, ein paar Touristen auf Helikopter-Rundflügen und den Leuten von der Luftüberwachung der NYPD. Mir ist egal, was sie darin sehen. Ich male es nicht für sie.
Es ist echt spät. Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll, also mache ich das hier, um wach zu bleiben. Wenn nicht Monatsende wäre, würde ich in die U-Bahn gehen, aber die Bullen, die ihre Quote noch nicht erfüllt haben, würden Stress machen. Man muss hier aufpassen; westlich von der Chrystie Street hängen einige von diese scheiß chinesischen Kids rum, die so tun, als wären sie eine Gang, und ihr Revier verteidigen, also halte ich mich bedeckt. Ich bin dünn und dunkel; das ist praktisch. Ich will doch nur malen, Mann, es ist einfach in mir drin und muss raus. Ich muss diese Kehle aufmachen. Ich muss, ich muss … ja. Ja.
Ein leises, seltsames Geräusch ist zu hören, als ich den letzten schwarzen Pinselstrich auftrage. Ich halte inne und schaue mich um, kurzzeitig verwirrt – und auf einmal seufzt die Kehle hinter mir. Ein großer, schwerer Schwall feuchter Luft kitzelt die Haare in meinem Nacken. Ich habe keine Angst. Dafür habe ich das gemacht, auch wenn ich das am Anfang noch nicht verstanden habe. Keine Ahnung, warum ich es jetzt weiß. Doch als ich mich umdrehe, ist es wieder nur Farbe auf einem Dach.
Paulo hat keinen Blödsinn erzählt. Hm. Oder vielleicht hat Mama recht gehabt, und ich bin noch nie ganz richtig im Kopf gewesen.
Ich springe in die Luft und brülle vor Freude, und ich weiß nicht mal, warum.
Die nächsten zwei Tage mache ich nichts anderes, als durch die ganze Stadt zu gehen und überall Atemlöcher zu malen, bis ich keine Farbe mehr habe.
An dem Tag, als ich Paulo wiedertreffe, bin ich so müde, dass ich stolpere und fast durch das große Schaufenster des Cafés falle. Er hält mich am Ellbogen fest und zieht mich hinüber zu einer Bank, die zum Café gehört. »Du hörst es jetzt«, sagt er. Er klingt erfreut.
»Ich höre Kaffee«, rege ich an und verkneife mir das Gähnen nicht. Ein Bullenwagen fährt vorbei. Ich bin nicht zu müde, um mir vorzustellen, ich sei Nichts, unterm Radar, jemand, der es nicht mal wert ist, ihn zum Spaß zu verprügeln. Es funktioniert wieder; sie fahren weiter.
Paulo ignoriert meinen Vorschlag. Er setzt sich neben mich und sein Blick wird für einen Augenblick seltsam und abwesend. »Ja. Die Stadt kann jetzt besser atmen«, sagt er. »Du machst gute Arbeit, sogar ohne Übung.«
»Ich geb mir Mühe.«
Er schaut amüsiert. »Ich bin mir nicht sicher, ob du mir nicht glaubst, oder ob’s dir einfach egal ist.«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich glaube dir.« Es ist mir auch egal, zumindest ein bisschen, weil ich Hunger hab. Mein Magen knurrt. Ich hab immer noch den Zwanziger, den er mir gegeben hat, aber ich will damit zu der Kirchenspeisung im Prospect Park, von der ich gehört hab. Da kriege ich Hühnchen und Reis und Gemüse und Maisbrot und bezahle dafür weniger, als hier für einen handgerösteten Fairtrade-Latte.
Sein Blick streift meinen Bauch, wenn er knurrt. Hm. Ich tue so, als würde ich mich strecken, kratze mich über meinen Bauchmuskeln und sorge dafür, dass mein T-Shirt dabei ein bisschen hochrutscht. Der Künstlertyp hat damals mal ein Modell mitgebracht, das wir zeichnen sollten, und er zeigte uns die kleine Muskelerhöhung über der Hüfte, der sogenannte Apollo-Gürtel. Paulos Blick geht genau dorthin. Na komm, komm, komm, Hündchen. Ich brauch einen Ort zum Schlafen.
Dann verengen sich seine Augen und schauen mir wieder ins Gesicht. »Ich hatte vergessen«, sagt er mit dünner, fragender Stimme. »Ich hab fast … Es ist so lange her. Damals war ich ein kleiner Junge in den Favelas.«
»Gibt leider nicht viel mexikanisches Essen in New York«, antworte ich.
Er blinzelt, und schaut wieder amüsiert. Dann wird er ernst. »Diese Stadt wird sterben«, sagt er. Er erhebt nicht die Stimme, aber das muss er auch nicht. Ich höre ihm jetzt zu. Essen, Leben: Diese Dinge bedeuten mir etwas. »Wenn du diese Sachen nicht lernst, muss ich sie dir beibringen. Wenn du nicht hilfst. Es wird die Zeit kommen, und du wirst versagen, und diese Stadt wird das gleiche Schicksal ereilen wie Pompeji und Atlantis und noch ein Dutzend anderer, an deren Namen sich niemand erinnert, obwohl Hunderttausende von Menschen mit ihnen gestorben sind. Oder vielleicht wird es eine Fehlgeburt – die Hülle der Stadt überlebt und wächst möglicherweise sogar noch, aber ihr lebenserhaltender Funke wird fürs Erste verlöschen, so wie in New Orleans – nur wirst du trotzdem in jedem Fall getötet. Du bist der Faktor, von dem alles abhängt, du entscheidest über Stärke oder Zerstörung.«
So redet er schon, seit er aufgetaucht ist – Orte, die nie waren, Dinge, die nicht sein können, Omen und Vorzeichen. Ich schätze, das ist alles Bullshit, denn er erzählt das alles mir, einem Jungen, den seine eigene Mama rausgeschmissen hat und für dessen Tod sie jeden Tag betet und den sie wahrscheinlich hasst. Gott hasst mich. Und ich hasse diesen scheiß Gott auch, warum sollte er also mich für irgendetwas erwählen? Aber in Wirklichkeit ist er der Grund, warum ich jetzt anfange zuzuhören: Gott. Ich muss nicht an etwas glauben, damit es mein Leben in die Scheiße reiten kann.
»Sag mir, was ich tun soll«, sage ich.
Paulo nickt und schaut dabei selbstzufrieden. Er glaubt, er hat mich jetzt. »Aha. Du willst nicht sterben.«
Ich stehe auf, strecke mich, fühle, wie die Straßen um mich herum in der zunehmenden Hitze der Sonne länger und biegsamer werden. (Geschieht das wirklich oder stelle ich es mir nur vor, oder geschieht es und ich stelle mir vor, dass es irgendwas mit mir zu tun hat?) »Fick dich. Darum geht’s nicht.«
»Dann ist dir sogar das egal.« Mit dem Tonfall seiner Stimme macht er eine Frage daraus.
»Es geht nicht darum, am Leben zu sein.« Ich werde eines Tages verhungern, oder in einer Winternacht erfrieren, oder mir irgendwas einfangen, das mich von innen zerfrisst, bis mich die Krankenhäuser aufnehmen müssen, sogar ohne Geld oder eine Adresse. Doch bis dahin werde ich die Stadt besingen und bemalen und antanzen und ficken und beweinen, weil sie nämlich mir gehört. Sie gehört verdammt noch mal mir. Deshalb.
»Es geht darum, zu leben«, schließe ich. Und dann drehe ich mich um und schaue ihn finster an. Wenn er das nicht versteht, kann er mich am Arsch lecken. »Sag mir, was ich tun soll.«
Etwas verändert sich in Paulos Gesicht. Jetzt hört er zu. Mir. Also steht er auf und führt mich fort von hier für meine erste Unterrichtseinheit.
Die Lektion ist folgende: Große Städte sind wie alle anderen lebenden Dinge, sie werden geboren und werden älter und sie ermüden und sterben, wenn die Zeit gekommen ist.
Pff, ach was! Jeder, der schon mal eine echte Stadt gesehen hat, fühlt das, so oder so. All diese Leute vom Land, die die Stadt hassen, haben Angst vor etwas, das wirklich da ist; Städte sind einfach wirklich anders. Sie drücken mit ihrem Gewicht auf die Welt, sie reißen das Gewebe der Realität ein, wie … wie Schwarze Löcher vielleicht. Ja. (Ich gehe manchmal in Museen. Da drin ist es kühl, und Neil deGrasse Tyson ist geil.) Wenn immer mehr Menschen in die Stadt kommen und ihre Merkwürdigkeit abladen und wieder gehen und ersetzt werden durch andere, dann reißt das Gewebe immer weiter ein. Irgendwann wird der Riss so groß, dass er zu einer Tasche wird, und nur noch ein winzig dünner Faden verbindet … irgendwas mit … irgendwas. Woraus Städte auch immer gemacht sind.
Doch die Teilung setzt einen Prozess in Gang, und in dieser Tasche beginnen sich die vielen Teile der Stadt zu multiplizieren und zu differenzieren. Die Kanalisation erstreckt sich bis in Gegenden, wo kein Wasser gebraucht wird. Den Slums wachsen Zähne und den Künstlervierteln Krallen. Die gewöhnlichen Dinge darin, wie der Verkehr und Baustellen und der ganze Kram, entwickeln einen Rhythmus wie ein Herzschlag, wenn man ihre Geräusche aufnimmt und schnell rückwärts abspielt. Die Stadt … beschleunigt.
Nicht alle Städte erreichen diesen Zustand. Früher gab es mal einige große Städte auf diesem Kontinent, aber das war, bevor Kolumbus die ganze Scheiße mit den Indianern gemacht hat, also mussten wir neu anfangen. New Orleans hat’s nicht geschafft, wie Paulo gesagt hat, aber es hat überlebt, das ist immerhin etwas. Es hat noch einen Versuch. Mexiko City ist auf einem guten Weg. Aber New York ist die erste Stadt in Amerika, die diesen Punkt erreicht hat.
Die Reifung kann zwanzig Jahre dauern oder zweihundert oder zweitausend, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Die Nabelschnur wird durchtrennt und die Stadt wird selbstständig, kann auf eigenen, klapprigen Beinen stehen und Sachen machen wie … na ja, was so ein lebendes, denkendes Ding in Form einer scheißriesigen Stadt eben so tun will.
Und wie überall in der Natur gibt es Dinge, die auf diesen Moment lauern, die hoffen, das süße frische Leben jagen und reißen zu können und seine Eingeweide herunterzuschlingen, während es noch schreit.
Deshalb ist Paulo hier, um mir etwas beizubringen. Deshalb kann ich die Atmung der Stadt befreien und ihre Asphalt-Gliedmaßen strecken und massieren. Ich bin nämlich die Hebamme.
Ich halte die Stadt am Laufen. Jeden beschissenen Tag.
Paulo nimmt mich mit zu sich. Es ist nur eine Wohnung zur Untermiete für den Sommer in der Lower East Side, aber es fühlt sich an wie ein Zuhause. Ich dusche bei ihm und esse etwas von den Sachen, die im Kühlschrank sind, ohne ihn zu fragen, nur um zu sehen, was er dann macht. Er macht überhaupt nichts, er raucht nur eine Zigarette, wahrscheinlich um mir damit auf den Sack zu gehen. Ich höre Sirenen auf den Straßen im Viertel – oft, und nah. Ich frage mich aus irgendeinem Grund, ob sie nach mir suchen. Ich spreche es nicht aus, aber Paulo sieht, wie ich zusammenzucke. Er sagt, »Die Vorboten des Feindes werden sich zwischen den Parasiten der Stadt verstecken. Nimm dich vor ihnen in Acht.«
Er sagt immer solchen kryptischen Scheiß. Manches davon ergibt Sinn, wie wenn er überlegt, dass das alles vielleicht ein Ziel hat, dass es einen Grund für die Städte gibt und für den Prozess, der sie erschafft. Was der Feind bisher gemacht hat – im Moment der Verwundbarkeit anzugreifen, quasi Gelegenheitsverbrechen –, ist vielleicht nur eine Aufwärmübung für etwas Größeres. Aber Paulo erzählt auch viel Müll, wie wenn er sagt, ich sollte mal Meditation ausprobieren, um mich besser mit den Bedürfnissen der Stadt in Einklang zu bringen. Als würde ich das Ganze hier mit Weiße-Mädchen-Yoga überstehen.
»Weiße-Mädchen-Yoga«, sagt Paulo nickend. »Indische-Männer-Yoga. Aktienbroker-Squash und Schüler-Handball, Ballett und Merengue, Gewerkschaftshäuser und Galerien in SoHo. Du wirst eine Millionenstadt verkörpern. Du musst diese Menschen nicht sein, aber sei dir bewusst, dass sie ein Teil von dir sind.«
Ich lache. »Squash? Das ist kein scheiß Teil von mir, Alter.«
»Die Stadt hat unter allen Menschen dich auserwählt«, sagt Paulo. »Ihre Leben hängen von dir ab.«
Vielleicht. Aber ich bin trotzdem noch ständig müde und hungrig, hab ständig Angst, bin nie sicher. Was hab ich davon, wertvoll zu sein, wenn niemand mich wertschätzt?
Er bemerkt, dass ich keine Lust mehr auf Reden habe, also steht er auf und geht ins Bett. Ich werfe mich aufs Sofa und bin sofort weg. Wie tot.
Ich träume, ein Traum im Tod, von einem dunklen Ort unter schweren, kalten Wellen, wo etwas lauert und sich mit einem glitschigen Geräusch bewegt und sich ausbreitet und auf die Mündung des Hudson zubewegt. Hin zu mir. Und ich bin zu schwach, zu hilflos, zu angstgelähmt, um irgendetwas zu tun, außer zusammenzuzucken unter seinem raubtierhaften Blick.
Etwas kommt von weit aus dem Süden, irgendwie. (Nichts davon ist wirklich echt. All das hangelt sich an der dünnen Leine entlang, die die Realität der Stadt mit der der restlichen Welt verbindet. Der Effekt findet in der Welt statt, hat Paulo gesagt. Die Ursache dreht sich um mich.) Es bewegt sich zwischen mir, wo immer ich bin, und dem sich ausbreitenden Ding, wo immer das ist. Etwas unermesslich Großes beschützt mich, nur dieses eine Mal, nur an diesem Ort – aber ich spüre, dass in weiter Ferne andere warten und knurren und aufstehen und sich bereit machen. Den Feind warnen, dass er sich an die Regeln halten muss, die diesen uralten Kampf schon immer bestimmt haben. Es ist nicht gestattet, mich zu früh anzugreifen.
Mein Beschützer in diesem surrealen Traumland ist ein Juwel, wuchernd und mit schmutzverkrusteten, geschliffenen Flächen, ein Ungetüm, das nach dunklem Kaffee stinkt und dem zerschrammten Rasen eines Futebol-Platzes und Verkehrslärm und dem vertrauten Zigarettenrauch. Es lässt seine säbelförmigen Stahlträger nur für einen Augenblick aufblitzen, doch das genügt. Das sich ausbreitende Ding schreckt zusammen und zieht sich verbittert zurück in seine kalte Höhle. Doch es wird wiederkommen. Auch das ist immer so gewesen.
Ich wache auf von dem Sonnenlicht, das mir das halbe Gesicht wärmt. War das ein Traum? Ich stolpere in das Zimmer, wo Paulo schläft. »São Paulo«, flüstere ich, aber er wacht nicht auf. Ich schlängele mich unter die Bettdecke. Als er aufwacht, greift er nicht nach mir, drückt mich aber auch nicht weg. Ich lasse ihn meine Dankbarkeit spüren und gebe ihm einen Grund, mich später wieder reinzulassen. Mit dem Rest muss ich warten, bis ich Kondome gekauft habe und er seine Raucherzähne geputzt hat. Danach dusche ich noch mal, ziehe meine Klamotten an, die ich in seiner Spüle gewaschen hab, und gehe raus, während er noch schnarcht.
Bibliotheken sind sichere Orte. Im Winter ist es dort warm. Niemanden schert es, wenn du den ganzen Tag dort herumhängst, solange du nicht dauernd in die Kinderecke starrst oder versuchst, mit den Computern auf Pornoseiten zu gehen. Die an der 42sten – die mit den Löwen – ist keine solche Bücherei. Man kann dort keine Bücher ausleihen. Aber sie bietet doch die gleiche Sicherheit wie jede andere Bücherei, also setze ich mich in eine Ecke und lese alles, was in meiner Reichweite steht: das städtische Steuerrecht, Die Vögel des Hudson Valley, Wir bekommen ein Stadt-Baby: New-York-Edition. Siehst du, Paulo? Ich hab doch gesagt, ich hör zu.
Es wird später Nachmittag und ich gehe wieder raus. Die Stufen sind übersät von Menschen, die lachen, quatschen, Selfie-Sticks haltend Grimassen schneiden. Drüben beim U-Bahn-Eingang stehen Bullen in schusssicheren Westen und stellen ihre Knarren zur Schau, damit sich die Touristen vor New York beschützt fühlen. Ich kaufe mir eine polnische Kielbasa-Wurst und esse sie zu Füßen eines der Löwen. »Fortitude«, nicht »Patience«. Ich kenne meine Stärken.
Mein Bauch ist voller Fleisch und ich bin entspannt und denke über Sachen nach, die nicht wirklich wichtig sind – wie lange Paulo mich wohl bei sich wohnen lässt und ob ich seine Adresse benutzen kann, um mich für irgendwas zu bewerben –, deshalb achte ich nicht auf die Straße. Bis ein kaltes Kribbeln über meine eine Seite huscht. Ich verstehe, was es ist, noch bevor ich reagiere, aber ich passe wieder nicht richtig auf, denn ich drehe mich um und schaue … Dumm, so dumm, ich sollte das besser wissen; unten in Baltimore haben die Bullen mal einem Typen die Wirbelsäule gebrochen, weil er sie angeguckt hat. Doch als ich diese beiden an der Ecke gegenüber der Bibliothekstreppe sehe – kleiner, blasser Mann und hochgewachsene dunkle Frau, beide in Dunkelblau, fast schwarz –, bemerke ich etwas, das so seltsam ist, dass ich meine Angst vergesse.
Es ist ein heller, klarer Tag, keine Wolke am Himmel. Die Menschen, die an den beiden Cops vorbeilaufen, hinterlassen kurze, blasse Nachmittagsschatten, fast nicht zu erkennen. Doch um diese beiden herum sammeln sich die Schatten und kräuseln sich, als würden sie unter ihrer eigenen, privaten grollenden Donnerwolke stehen. Und während ich zuschaue, beginnt der kleine Polizist … sich zu strecken, irgendwie, und seine Gestalt verzerrt sich ganz leicht, bis das eine Auge doppelt so groß ist wie das andere. Seine rechte Schulter bildet nach und nach eine Beule aus, die aussieht, als wäre sie ausgekugelt. Seine Kollegin scheint das alles nicht zu bemerken.
Okaaayyy, nein. Ich stehe auf und bahne mir meinen Weg durch die Menschenmengen auf der Treppe. Ich mache diese eine Sache, wo ich versuche, ihren Blick an mir abprallen zu lassen – aber diesmal fühlt es sich anders an. Klebrig irgendwie, als würden Fäden von billigem Scheißkaugummi mir die Spiegel zukleistern. Ich fühle, wie sie die Verfolgung aufnehmen, etwas Riesiges und Falsches schiebt sich in meine Richtung.
Selbst da bin ich noch nicht sicher – viele Bullen versprühen und atmen Sadismus auf dieselbe Weise –, aber ich will kein Risiko eingehen. Meine Stadt ist hilflos, noch ungeboren, und Paulo ist nicht hier, um mich zu beschützen. Ich muss mir selbst helfen, so wie immer.
Ich tue ganz unbeteiligt, bis ich die Ecke erreiche und losrenne. Oder es zumindest versuche. Diese beschissenen Touristen! Schlendern auf der falschen Straßenseite rum, halten an, um auf Stadtpläne zu schauen und Fotos von Zeug zu machen, für den sich sonst keine Sau interessiert. Ich bin so damit beschäftigt, sie in meinen Gedanken zu beschimpfen, dass ich vergesse, wie gefährlich sie auch sein können: Irgendjemand schreit rum und greift nach meinem Arm, während ich mich wie ein Footballspieler durch die Menge schiebe, und ich höre jemanden rufen, »Der hat versucht, ihre Handtasche zu klauen!«, während ich mich losreiße. Nix hab ich geklaut, du Vogel, denke ich, aber es ist zu spät. Ich sehe eine andere Touristin, die ihr Handy rausholt, um die Polizei zu rufen. Jeder Bulle in der Gegend wird es jetzt auf jeden Schwarzen Mann jedweden Alters abgesehen haben.
Ich muss hier weg.
Die Grand-Central-Station ist nicht mehr weit, süße Untergrund-Verlockung, doch ich sehe drei Bullen am Eingang rumstehen, also biege ich nach rechts auf die 41ste ab. Hinter der Lexington dünnen die Massen langsam aus, aber wo kann ich hin? Ich sprinte, trotz des Verkehrs, über die Third Avenue, ich schlängele mich durch die Lücken. Aber ich kann langsam nicht mehr, ich bin ein dürrer Typ, der nicht genug zu essen bekommt, kein Leichtathletik-Star.
Aber ich laufe weiter, trotz der brutalen Seitenstiche. Ich kann diese Bullen fühlen, die Vorboten des Feindes, nicht weit hinter mir. Der Boden erzittert unter ihren klobigen Schritten.
Ich höre eine Sirene, etwa eine Straße entfernt, sie kommt näher. Scheiße, da vorne kommt bald das UN-Gebäude; den Secret Service kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Ich schere nach links aus, durch eine Gasse, und stolpere über eine Holzpalette. Wieder Glück gehabt – ein Polizeiauto fährt langsam an der Gasse vorbei, während ich gerade hinfalle, und sie sehen mich nicht. Ich bleibe liegen und versuche, zu Atem zu kommen, bis das Motorengeräusch in der Ferne verschwindet. Dann, als die Luft rein zu sein scheint, drücke ich mich hoch. Ich schaue mich um, denn die Stadt krümmt sich um mich herum, der Beton zittert und hebt und senkt sich, alles von den Fundamenten bis zu den Dachcafés will mir mit aller Kraft sagen, dass ich abhauen soll. Los. Los.
Hinter mir ist die Gasse versperrt von … von … was zur Hölle? Ich kann nicht sagen, was das ist. Zu viele Arme, zu viele Beine, zu viele Augen, und alle auf mich gerichtet. Irgendwo in der Masse erblicke ich dunkle Locken und ein paar hellblonde Haare, und plötzlich wird mir klar: Das hier sind – das ist – meine zwei Bullen. Ein absolutes Monstrum. Die Mauern der Gasse krachen, während es versucht, sich in die schmale Lücke zu schleimen.
»Oh. Fuck. Nein«, keuche ich.
Ungeschickt richte ich mich auf und mache mich aus dem Staub. Ein Streifenwagen kommt aus der Second Avenue um die Ecke und ich sehe ihn nicht rechtzeitig, um mich zu ducken. Der Lautsprecher des Autos quäkt irgendwas Unverständliches, wahrscheinlich Ich bring dich um, und ich bin wirklich erstaunt. Sehen die nicht das Ding hinter mir? Oder scheißen sie einfach drauf, weil sie es nicht einbuchten und dabei irgendein Bußgeld für die Stadt rausholen können? Sollen sich mich doch erschießen, verdammt. Immer noch besser, als was immer dieses Ding mit mir vorhat.
Haken nach links in die Second Avenue. Das Bullenauto kann nicht hinter mir her, gegen den Verkehr, aber dieses komische Zwei-Cop-Monster lässt sich davon natürlich nicht abhalten. 45ste. 47ste und meine Beine sind wie geschmolzener Granit. 50ste und ich glaube, ich sterbe. So jung und schon ein Herzkasper; armer Junge, hätte mehr Biolebensmittel essen sollen; hätte es entspannt angehen und nicht so wütend sein sollen; die Welt kann dir nichts antun, wenn du einfach ignorierst, was alles Scheiße daran ist; na ja, bis sie dich halt umbringt.
Ich wechsele die Straßenseite und riskiere einen Blick zurück und sehe ein Etwas auf mindestens acht Beinen auf den Gehweg rollen, das sich mit drei oder vier Armen an der Mauer abstützt, als es ein bisschen ins Wanken gerät … bevor es dann wieder direkt auf mich zuhält. Es ist der Mega Cop, und er wird größer. Scheiße Scheiße Scheiße bitte nein.
Mir bleibt nur eine Möglichkeit.
Nach rechts abbiegen. 53ste, gegen den Verkehr. Ein Altenheim, ein Park, eine Promenade … scheiß auf die. Fußgängerbrücke? Nein, Mann. Ich halte genau auf die sechsspurige Mixtur aus Beklopptheit und Schlaglöchern namens FDR Drive zu, gehe nicht über Los, überquere die Straße nicht zu Fuß, wenn du nicht zermatscht und über eine Strecke von hier bis Brooklyn verteilt werden willst. Dahinter? Der East River, wenn ich überlebe. Ich bin so hinüber, dass ich in dieser scheiß Kloake sogar versuchen würde zu schwimmen. Aber wahrscheinlich werde ich schon auf der dritten Spur zusammenbrechen und fünfzigmal überfahren, bevor irgendjemand auch nur ans Bremsen denkt.
Hinter mir stößt der Mega Cop ein feuchtes, geblähtes Houh aus, als würde er sich räuspern, um sich zum Schlucken fertig zu machen. Ich springe über die Absperrung und laufe durch das Gras bis in die verdammte Hölle ich renne auf die erste Spur silbernes Auto zweite Spur Hupen Hupen Hupen dritte Spur LASTER WAS ZUM FICK MACHT EIN LASTER AUF DEM FDR DER IST ZU HOCH DU VERDAMMTES LANDEI ich schreie vierte Spur GRÜNES TAXI ich schreie ein Smart Hahaha süß fünfte Spur SUV sechste Spur und der blaue Lexus streift tatsächlich meine Klamotten während er an mir vorbeirauscht ich schreie schreie schreie
schreie
Schreie von Metall und Reifen, während sich die Realität dehnt, und kein Auto hält an für den Mega Cop; er gehört nicht hierher und der FDR ist eine Arterie, die pulsiert von der Bewegung von Nährstoffen und Stärke und Attitüde und Adrenalin, die Autos sind weiße Blutkörperchen und dieses Ding ist ein Erreger, eine Infektion, ein Eindringling, dem die Stadt weder Aufmerksamkeit noch Gnade schenkt.
Schreie, während der Mega Cop in Stücke zerfetzt wird von dem Laster und dem Taxi und dem Lexus und sogar von dem putzigen Smart, der extra etwas ausschert, um ein zappelndes Stück davon zu überfahren. Ich breche auf einem kleinen Rasenstück zusammen, außer Atem, zitternd, keuchend, und kann nur zuschauen, wie ein Dutzend Gliedmaßen zermalmt werden, zwei Dutzend Augen platt gedrückt werden und ein Maul, das fast nur aus Zahnfleisch besteht, vom Kiefer bis zum Gaumen gespalten wird. Wie bei einem Monitor, an dem das Kabel nicht richtig steckt, flimmern die Stücke, durchsichtig, dann undurchsichtig, dann wieder zurück – doch auf dem FDR hält niemand für niemanden an, außer vielleicht für die Autokolonne vom Präsidenten, oder für ein Spiel der Knicks, aber dieses Ding ist mit Sicherheit nicht Carmelo Anthony. Schon bald ist nichts mehr davon übrig außer halb-wirkliche Schmierspuren auf dem Asphalt.
Ich lebe. Oh Gott.
Ich weine ein bisschen. Mamas neuer Freund ist nicht da, um mir dafür eine runterzuhauen und mir zu sagen, dass ich kein echter Mann bin. Papa hätte gesagt, dass es okay ist – Tränen bedeuten, dass man am Leben ist –, aber Papa ist tot. Und ich lebe.
Mit schwachen und vor Schmerzen brennenden Gliedern raffe ich mich auf, und falle wieder hin. Alles tut weh. Ist das so ein Herzinfarkt? Mir ist schlecht. Alles zittert, verschwimmt. Vielleicht ein Schlaganfall. Dafür muss man doch nicht alt sein, oder? Ich stolpere zu einer Mülltonne und spiele mit dem Gedanken, hinein zu kotzen. Auf einer Bank liegt ein alter Typ – ich in zwanzig Jahren, wenn ich es überhaupt so lange mache. Während ich dastehe und würge, öffnet er ein Auge, presst die Lippen abschätzig zusammen, als würde er selbst im Schlaf bessere Würgeanfälle hinbekommen.
Er sagt, »Es ist Zeit«, und dreht mir den Rücken zu.
Zeit. Auf einmal muss ich mich bewegen. Krank oder nicht, erschöpft oder nicht, etwas … zieht mich. Nach Westen, in Richtung Stadtmitte. Ich stütze mich von der Mülltonne ab und schlinge meine Arme um meinen Körper, während ich zitternd auf die Fußgängerbrücke zuwanke. Ich gehe über die Fahrbahnen, über die ich gerade noch gerannt bin, und schaue hinunter auf die flackernden Überreste des toten Mega Cops, die mittlerweile von Hunderten Autoreifen in den Asphalt gepresst worden sind. Einige Krümelchen von ihm zucken noch, und das gefällt mir nicht. Infektion, Eingriff. Ich will das hier nicht.
Wir wollen das hier nicht. Ja. Es ist Zeit.
Ich blinzele und auf einmal bin ich im Central Park. Wie zur Hölle bin ich hierhergekommen? Orientierungslos begreife ich erst, dass ich an zwei anderen Bullen vorbeigehe, als ich ihre schwarzen Schuhe sehe, aber diese zwei lassen mich in Ruhe. Das sollten sie nicht – ein dürrer Junge, der an einem Junitag zittert, als würde er frieren; selbst, wenn sie mich nur irgendwohin zerren, um mir einen Gummipümpel in den Arsch zu schieben, sie sollten auf mich reagieren. Stattdessen tun sie so, als wäre ich gar nicht da. Wunder gibt es immer wieder, Ralph Ellison hatte recht, für jeden New Yorker Bullen, an dem du vorbeilaufen kannst, ein Halleluja.
Der Lake. Die Bow Bridge: ein Ort des Übergangs. Ich halte an, und stehe hier, und verstehe … alles.
Alles, was Paulo mir erzählt hat: Es stimmt. Irgendwo fernab der Stadt wacht der Feind gerade auf. Er hat seine Vorboten geschickt und sie haben versagt, doch sie haben seine Spur in der Stadt hinterlassen, und sie breitet sich mit jedem Auto aus, das über jedes noch so mikroskopische Körnchen der Substanz des Mega Cops hinwegfährt, und damit bekommt der Feind einen Fuß in die Tür. Der Feind hievt sich mithilfe dieses Ankers aus der Dunkelheit heraus in unsere Welt, hin zur Wärme und zum Licht, zu der Herausforderung, die Ich bin, zur sprießenden Gänze meiner Stadt. Dieser Angriff ist natürlich nicht alles. Was auf uns zukommt, ist nur der winzigste Bruchteil der alten, alten Boshaftigkeit des Feindes – aber dieser Bruchteil sollte mehr als genügen, um ein verlorenes, ausgemergeltes Bürschchen zu zerfleischen, das zu seinem Schutz nicht mal eine wirkliche Stadt hat.
Noch nicht. Es ist Zeit. Aber rechtzeitig? Wir werden sehen.
Auf der Second, Sixth und Eighth Avenue läuft mein Wasser aus. Also, aus den Leitungen. Aus den Hauptwasserleitungen. Große Sauerei, wird den Feierabendverkehr komplett zerficken. Ich schließe meine Augen und sehe, was außer mir niemand sieht. Ich fühle die Biegungen und den Rhythmus der Wirklichkeit, die Anspannungen der Möglichkeiten. Ich strecke meine Hand aus und greife nach dem Geländer der Brücke vor mir und fühle den gleichmäßigen, kräftigen Puls, der hindurchfließt. Du machst das großartig, Baby. Wirklich großartig.
Etwas fängt an, sich zu regen. Ich wachse, ich werde immer größer, allumfassend. Ich fühle mich hoch am Himmelszelt, so schwer wie die Fundamente einer Stadt. Mit mir sind noch andere hier, drohend, lauernd – die Knochen meiner Vorfahren unter der Wall Street, das Blut meiner Vorfahren, eingerieben in die Bänke im Christopher Park. Nein, neue andere, von meinem neuen Volk, tiefe Abdrücke in dem Gewebe aus Zeit und Raum. São Paulo kauert mir am nächsten, seine Wurzeln erstrecken sich den ganzen Weg bis zu den Knochen des toten Machu Picchu, und er schaut aus klugen Augen und zittert etwas bei der Erinnerung an seine eigene, relativ kurz zurückliegende Geburt. Paris beobachtet das Ganze mit distanziertem Desinteresse, leicht indigniert, dass eine Stadt aus unserem geschmacklosen Emporkömmlingsland den Übergang geschafft hat; Lagos jubelt vor Freude darüber, einen neuen Gefährten zu haben, der die Mühen kennengelernt hat, den Wirbel, den Kampf. Und noch mehr, viele mehr vor ihnen, alle beobachten, warten und schauen zu, ob sie jetzt wieder einer mehr werden. Oder nicht. Wenigstens werden sie Zeuge sein, dass ich – dass wir für einen kurzen, glanzvollen Moment wahre Größe erreicht haben.
»Wir werden’s schaffen«, sage ich, drücke das Geländer und fühle, wie sich die Stadt zusammenzieht. In der gesamten Stadt knackt es in den Ohren der Menschen, und sie schauen sich verwirrt um. »Nur noch ein bisschen. Komm schon.« Ich habe Angst, aber keine Eile. Lo que pasa, pasa – Scheiße, jetzt hab ich diese Melodie im Kopf, in mir, wie auch im Rest von New York. Es ist alles hier, wie Paulo gesagt hat. Zwischen mir und der Stadt steht nichts mehr.
Und das Firmament kräuselt sich, rutscht, reißt auf, und der Feind räkelt sich aus den Tiefen empor mit einem Realität gewordenen Brüllen …
Aber es ist zu spät. Die Verbindung ist zerschnitten und wir sind da. Wir beginnen! Wir stehen, ganz und gar und unabhängig, und unsere Beine schwanken noch nicht einmal. Wir kriegen das hin. Wir sind die Stadt, die niemals schläft, Kleiner, also halt deinen schuppigen, gruseligen Scheiß verdammt noch mal fern von hier.
Ich hebe meine Arme und die Straßen springen hoch. (Es ist real, aber nicht wirklich. Die Erde wackelt und die Leute denken, Oh, in der U-Bahn rappelt’s aber heute ordentlich.) Ich spanne meine Füße an und sie sind Stahlträger, Anker, Erdreich. Das Biest aus der Tiefe kreischt auf und ich lache, ganz schwindelig von den postpartalen Endorphinen. Na los. Und als es mich angreift, verpasse ich ihm mit dem Brooklyn-Queens-Expressway einen Bodycheck, gebe ihm eine Schelle mit dem Inwood Hill Park und ramme ihm die South Bronx wie einen Ellbogen rein. (In den Abendnachrichten später werden zehn Baustellen von herabfallenden Abrissbirnen berichten. Die städtischen Sicherheitsauflagen sind so lasch; schrecklich, ganz schrecklich.) Der Feind probiert irgendeinen abgefuckten Wackel-Scheiß – mit diesen ganzen Tentakeln – und ich knurre ihn an und beiße ihn, denn New Yorker essen verdammt noch mal fast so viel Sushi wie ganz Tokyo, mit Quecksilber und allem Drum und Dran.
Ach, jetzt weinst du! Du willst wegrennen? Nein, Großer. Da hast du dich in der Postleitzahl geirrt. Ich lasse das Biest Bordstein fressen und trete mit der ganzen Macht von Queens auf seinen Hinterkopf … etwas in ihm zerbricht und schillerndes Blut spritzt in alle Richtungen. Es ist schockiert, denn es ist schon seit Jahrhunderten nicht mehr wirklich verletzt worden. Wütend schlägt es zurück, schneller, als ich schauen kann, und von einem Ort aus, den der Großteil der Stadt nicht sehen kann, entrollt sich ein hochhauslanger Tentakel aus dem Nichts und schmettert in den New Yorker Hafen. Ich schreie und falle, ich kann hören, wie meine Rippen brechen, und – nein! – ein schweres Erdbeben erschüttert Brooklyn zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Williamsburg Bridge verbiegt sich und zerknackt wie ein trockener Zweig; Manhattan stöhnt und splittert, aber Gott sei Dank gibt es nicht nach. Ich fühle jeden Tod, als wäre es mein eigener.
Dafür bring ich dich verfickt noch mal um, du Wichser, nicht-denke ich. Der Zorn und die Trauer treiben mich in die Rachsucht. Der Schmerz ist nicht der Rede wert; ich hab schon Schlimmeres erlebt. Meine Rippen ächzen, als ich mich hochwuchte und angespannt meine Beine durchdrücke, als würde ich von einem Bahnsteig pissen. Dann lasse ich auf den Feind einen Doppelschlag aus Long-Island-mäßiger Strahlung und Gowanuskanal-Giftmüll niederregnen, die ihn verbrennen wie Säure. Er schreit vor Schmerzen und Ekel, aber Fick dich, du hast hier nix zu suchen, die Stadt gehört mir, hau ab! Um meine Aussage zu unterstreichen, zerschneide ich ihn mit der Long-Island-Eisenbahn aus langen, grausamen lauten Bahnlinien; und um den Schmerz noch zu verlängern, salze ich diese Wunden mit der Erinnerung an eine Busfahrt zum LaGuardia-Flughafen und zurück.
Dann setze ich dem ganzen noch die Krone auf, indem ich ihm mit Hoboken den Hintern versohle und lasse die besoffene Wut von zehntausend jungen Dudebros auf ihn herniederprasseln wie den Hammer Gottes. Durch die Hafenbehörde wird es ehrenhalber zu New York, du Arschloch; das war deine Portion New Jersey.
Der Feind ist ebenso unerlässlich für die Natur wie jede Stadt. Man kann weder unseren Werdungsprozess aufhalten noch den Feind zum Aufhören bringen. Ich verletze nur einen kleinen Teil von ihm – aber ich weiß verdammt genau, dass dieser kleine Teil reparaturbedürftig zurückgeht. Gut. Wenn irgendwann die Zeit für den finalen Kampf gekommen ist, wird er es sich zweimal überlegen, sich noch mal mit mir anzulegen.
Mir. Uns. Ja.
Als ich meine Hand entspanne, meine Augen öffne und Paulo erblicke, wie er über die Brücke auf mich zuschlendert, wieder mit einer gottverdammten Kippe im Mund, sehe ich ihn für einen Moment wieder als das, was er ist: das wuchernde Ding aus meinem Traum, voll von funkelnden Spitzen und stinkenden Slums und geklauten, mit gezierter Brutalität überarbeiteten Rhythmen. Ich weiß, dass er auch erkennt, was ich bin, all das helle Licht und das Getöse in mir. Vielleicht hat er das schon immer gesehen, aber jetzt liegt Bewunderung in seinem Blick, und das gefällt mir. Er kommt zu mir, damit ich mich auf seine Schulter stützen kann, und er sagt »Glückwunsch«, und ich lächele.
Ich lebe die Stadt. Sie gedeiht und sie ist mein. Ich bin ihr Wächter, ihr würdiger Avatar, und zusammen werden wir
niemals
Angst ha…
oh Scheiße
irgendwas ist nicht in Ordnung.
Unterbrechung
Der Avatar bricht zusammen, fällt schlaff hinab auf die dicken alten Holzbohlen der Brücke, trotz São Paulos Bemühungen, ihn aufzufangen. Und mitten in ihrem Triumph erzittert die neugeborene Stadt New York.
Paulo – neben dem bewusstlosen Jungen kauernd, der New York verkörpert, der für New York spricht und kämpft – schaut besorgt hinauf zum flackernden Himmel. Zuerst ist er noch von einem diesigen Mittagsblau, wie ein nordöstlicher Junihimmel, dann wird er dunkler, röter, und deutet den Sonnenuntergang an. Während er zuschaut, mit zusammengekniffenen Augen, flackern auch die Bäume im Central Park – ebenso wie das Wasser, und sogar die Luft. Hell, dann schattig, dann wieder hell; kräuselnd, dann fast still, dann auf einmal wieder kräuselnd; schwül, mit leichter Brise, dann windstill und mit dem leichten Geruch von ätzendem Rauch, dann wieder schwül. Einen Augenblick später löst sich der Avatar unter Paulos Händen in Luft auf. Das ist eine Version von etwas, das er schon einmal gesehen hat, und für einen Moment erstarrt er vor Angst – doch nein, die Stadt ist nicht gestorben, Gott sei Dank. Paulo kann die Präsenz und die Lebendigkeit des ihn umgebenden Wesens spüren … doch diese Präsenz ist viel, viel schwächer, als sie sein sollte. Keine Totgeburt, das nicht, aber auch kein Zeichen von Gesundheit und Ruhe. Es hat postpartale Komplikationen gegeben.
Paulo holt sein Handy raus und macht einen Auslandsanruf. Nach einem Klingeln nimmt die angerufene Person ab und seufzt ins Telefon. »Genau das, wovor ich Angst hatte.«
»Wie bei London also«, sagt Paulo.
»Schwer zu sagen. Aber ja, bis jetzt wie bei London.«
»Wie viele, glaubst du? Die Metropolregion erstreckt sich über drei Bundesstaaten …«
»Das bedeutet gar nichts. Für dich sind es einfach nur ›mehr‹. Finde einen von ihnen. Sie werden sich gegenseitig ausfindig machen.« Pause. »Die Stadt ist noch verwundbar, das weißt du. Deshalb hat sie ihn weggebracht, zur Sicherheit.«
»Ich weiß.« Paulo steht auf, denn ein Jogger-Pärchen kommt näher. Dahinter ein Radfahrer, obwohl der Weg hier eigentlich nur für Fußgänger ist. Auf der nahe gelegenen Straße fahren drei Autos vorbei, obwohl in diesem Teil des Central Park eigentlich nur Fußgänger und Radfahrer gestattet sind. Die Stadt trotzt sich weiterhin selbst, trotz ihrer selbst. Paulo bemerkt, wie er in den Menschen um sich herum nach Anzeichen für Gefahren sucht: sich verzerrende Haut, Menschen, die etwas zu stillstehen oder zu angespannt umherschauen. Bis jetzt nichts zu sehen.
»Der Feind wurde in die Flucht geschlagen«, sagt er zerstreut ins Handy. »Der Kampf war … eindeutig.«
»Pass trotzdem auf dich auf.« Die Stimme unterbricht kurz für einen rauen Smog-Husten. »Die Stadt ist noch am Leben, sie ist also nicht hilflos. Sie wird dir sicher nicht helfen, aber sie weiß, wer zu ihr gehört. Sie sollen sich beeilen. Ist nie gut, eine Stadt so im Schwebezustand feststecken zu haben.«
»Ich pass auf«, sagt Paulo, während er immer noch die Umgebung scannt. »Ich schätze, es ist gut zu wissen, dass du dich kümmerst.« Als Antwort kommt nur ein zynisches Schnauben, Paulo muss trotzdem lächeln. »Irgendwelche Ideen, wo ich anfangen sollte?«
»Manhattan scheint mir ein guter Startpunkt.«
Paulo kneift sich in die Nasenwurzel. »Das ist ein ganz schön großes Gebiet.«
»Dann solltest du langsam mal loslegen, oder?« Die Verbindung bricht mit einem Klicken ab. Genervt seufzend dreht sich Paulo um, und macht sich erneut auf den Weg.
1. Kapitel
Es beginnt mit Manhattan, und der Schlacht vom FDR Drive
Er vergisst seinen Namen irgendwo in dem Tunnel kurz vor der Pennsylvania Station.
Zuerst bemerkt er es gar nicht. Er ist viel zu beschäftigt mit all dem Kram, den Leute so machen, kurz bevor sie aus dem Zug aussteigen müssen: die Brezeltüten und Plastikflaschen vom Frühstück einsammeln, das Stromkabel vom Laptop in eine Seitentasche stopfen, sichergehen, dass er seinen Koffer von der Gepäckablage genommen hat, dann eine kurze Panikattacke, bevor ihm einfällt, dass er nur einen Koffer dabeihat. Den anderen hat er schon per Post geschickt und der wartet auf ihn in seiner Wohnung in Inwood, wo sein Mitbewohner schon vor Wochen angekommen ist. Sie werden beide Doktoranden sein an der …
… an der, äh …
… hm. Er hat den Namen der Uni vergessen. Wie dem auch sei, die Einführungsveranstaltung ist am Montag, er hat also noch fünf Tage, um sich in seinem neuen Leben in New York einzurichten.
Wie es scheint, wird er diese Zeit auch wirklich brauchen. Während der Zug langsamer wird, murmeln und flüstern die Menschen um ihn herum, starren mit besorgten Gesichtern gebannt auf ihre Handys und Tablets. Irgendein Brückenunglück, Terrorismus, so wie am 11. September? Er wird in Uptown leben und arbeiten, er wird also nicht allzu viel davon bemerken – aber ist vielleicht trotzdem nicht der beste Zeitpunkt, herzuziehen.
Aber wann ist denn je ein guter Zeitpunkt, ein neues Leben in New York anzufangen? Er wird schon klarkommen.
Mehr als klarkommen wird er. Der Zug hält an und er ist der Erste auf dem Bahnsteig. Er ist aufgeregt, versucht aber, dabei entspannt rüberzukommen. In der Stadt wird er ganz auf sich allein gestellt sein, entweder schwimmt er oben oder er geht unter. Er hat Kollegen und Familienmitglieder, für die das hier eine Art Exil ist, Abwendung …
– allerdings kann er sich in der ganzen Aufregung weder an Namen noch Gesichter dieser Menschen erinnern –
… aber das ist egal, denn sie verstehen das sowieso nicht. Sie kennen ihn als den, der er war, und vielleicht als den, der er jetzt ist. Aber New York ist seine Zukunft.
Es ist heiß auf dem Bahnsteig, die Rolltreppe ist überfüllt, aber es geht ihm gut. Deshalb ist es so komisch, als er oben ankommt und plötzlich – in dem Moment, als sein Fuß den glatten Betonboden berührt – sich die ganze Welt auf den Kopf stellt. Alles, was er sieht, scheint zu kippen, und die hässliche Deckenbeleuchtung wird grell und der Boden … hebt und senkt sich irgendwie? Es passiert alles ganz schnell. Die Welt wird einmal umgestülpt und sein Magen dreht sich und in seinen Ohren breitet sich ein gigantisches, vielstimmiges Brüllen aus. Es ist ein vertrautes Geräusch, irgendwie; jeder, der schon mal während eines wichtigen Spiels im Stadion gewesen ist, hat etwas Ähnliches erlebt. Der Madison Square Garden liegt direkt über der Penn Station, also vielleicht ist es das? Das hier klingt allerdings größer. Millionen von Menschen, anstatt nur Tausende, und all diese Stimmen gedoppelt und anschwellend und sich verschiebend zu vielen Schichten, die schon kein Geräusch mehr sind, sondern Farben und Zittern und Gefühle, bis er seine Hände über die Ohren schlägt und die Augen schließt, aber es wird immer stärker …
Doch durch diese ganze Kakophonie hört er eine Einzelheit heraus, ein sich wiederholendes Motiv, ein Wort, einen Gedanken. Eine rasend schreiende Stimme.
Fick dich, du hast hier nix zu suchen, die Stadt gehört mir, hau ab!
Und der junge Mann fragt sich verwirrt und entsetzt, Ich? Bin … bin ich derjenige, der hier nix zu suchen hat? Es folgt keine Antwort, und der Zweifel in ihm wird zu einem eigenen, nicht mehr ignorierbaren Rhythmus.
Und auf einmal ist das Brüllen verschwunden. Stattdessen ein neues Brüllen, näher und hallend und unbeschreiblich viel kleiner. Ein Teil davon ist eine Aufnahme, die aus den Lautsprechern über ihm plärrt: »Pendelzug nach New Jersey in südlicher Richtung, mit Halt am Flughafen Newark, steht für Sie bereit auf Gleis fünf.« Der Rest ist der Lärm eines riesigen Raumes voller Menschen, die ihren Geschäften nachgehen. Dann, als sich alles um ihn herum dreht, fällt es ihm wieder ein: Penn Station. Er weiß nicht, warum er auf einem Knie hockt, unter der Abfahrtsanzeige, mit einer zitternden Hand über dem Gesicht. War er nicht auf einer Rolltreppe? Er erinnert sich auch nicht, die beiden Leute schon mal gesehen zu haben, die jetzt vor ihm kauern.
Er runzelt die Stirn. »Haben Sie gerade zu mir gesagt, ich soll die Stadt verlassen?«
»Nein. Ich habe gesagt, ›Soll ich die 911 für Sie anrufen‹«, sagt die Frau. Sie bietet ihm Wasser an. Sie sieht eher skeptisch aus als wirklich besorgt, als würde er diese seltsame Ohnmacht oder den Anfall nur vortäuschen, der ihn offensichtlich mitten in der Pennsylvania Station zu Fall gebracht hat.
»Ich … nein.« Er schüttelt den Kopf, versucht, sich zu konzentrieren. Weder Wasser noch die Polizei werden diese komischen Stimmen in seinem Kopf abschalten können, oder die Halluzinationen von den Zug-Abgasen, oder was auch immer er hier gerade erlebt. »Was ist passiert?«
»Sie sind einfach irgendwie zur Seite gekippt«, sagt der über ihn gebeugte Mann.
Es ist ein korpulenter, blasser Latino mittleren Alters. Starker New-York-Akzent, freundliche Stimme. »Wir haben Sie aufgefangen und hier rüber getragen.«
»Oh.« Alles ist noch komisch. Die Welt dreht sich nicht mehr, doch dieses schreckliche, überlagerte Brüllen ist immer noch in seinem Kopf – aber jetzt leise geschaltet und überlagert von der örtlichen immerwährenden Kakophonie namens Penn Station. »Ich … ich glaub, mir geht’s gut?«
»Na ja, Sie klingen da nicht allzu sicher«, sagt der Mann.
Das liegt daran, dass er es nicht ist. Er schüttelt den Kopf, und dann noch einmal, als die Frau ihm abermals die Wasserflasche hinhält. »Ich hab gerade im Zug was getrunken.«
»Niedriger Blutzucker vielleicht?« Sie steckt die Flasche weg und schaut fürsorglich. Neben ihr hockt ein kleines Mädchen, wie ihm jetzt auffällt, und die beiden sind geradezu das genaue Ebenbild voneinander: schwarzhaarige, sommersprossige, aufrichtig schauende Asiatinnen. »Wann haben Sie zuletzt was gegessen?«
»So vor zwanzig Minuten?« Er fühlt sich nicht schwindelig oder schwach. Er fühlt sich … »Neu«, murmelt er, ohne darüber nachzudenken. »Ich fühle mich … neu.«
Der korpulente Mann und die aufrichtig schauende Frau sehen einander an, während das kleine Mädchen ihm einen abschätzigen Blick zuwirft, sogar mit hochgezogener Augenbraue. »Sind Sie denn neu hier?«, fragt der korpulente Mann.
»Schon.« Oh nein. »Meine Taschen!« Aber sie sind da; die Guten Samariter haben sie freundlicherweise mit von der Rolltreppe geholt und etwas zur Seite gestellt, damit sie nicht im Weg sind. Der Augenblick bekommt etwas Surreales, als er letztendlich begreift, dass er diesen Ohnmachtsanfall oder diese Wahnvorstellung oder was auch immer inmitten eines Haufens von Tausenden Menschen hat. Niemand scheint ihn zu bemerken bis auf diese drei Leute hier. Er fühlt sich einsam in dieser Stadt. Man sieht ihn und kümmert sich um ihn in dieser Stadt. Er wird eine Weile brauchen, um sich an diesen Kontrast zu gewöhnen.
»Das muss ja ziemlich gutes Zeug gewesen sein, das Sie sich da eingeworfen haben«, sagt die Frau. Sie grinst aber. Es ist anscheinend okay. Deshalb wird sie nicht die Polizei rufen. Er erinnert sich, irgendwo gelesen zu haben, dass es in New York ein Gesetz zur Zwangseinweisung gibt, mit dem man Menschen über mehrere Wochen festhalten kann, also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, seine Retter und Retterinnen in spe von seiner Zurechnungsfähigkeit zu überzeugen.
»Das hier tut mir leid«, sagt er, während er sich aufrichtet. »Vielleicht habe ich nicht genug gegessen oder so. Ich werde … zu einem Krankenhaus fahren.«
Dann passiert es wieder. Der Bahnhof erzittert unter seinen Füßen – und liegt auf einmal in Trümmern. Außer ihm ist niemand da. Ein Buch-Pappaufsteller vor dem Mini-Markt ist umgefallen, überall liegen Stephen-King-Bücher herum. Er hört die Stahlträger im Gebäude um ihn herum stöhnen, etwas in der Decke platzt auf und Staub und Steinchen fallen zu Boden. Die Neonlampen flackern und zucken, eine der Deckenbefestigungen droht herunterzufallen. Er holt tief Luft, um warnend aufzuschreien.
Ein Wimpernschlag: Alles ist wieder in Ordnung. Keiner der Menschen um ihn herum scheint etwas bemerkt zu haben. Er schaut kurz an die Decke, dann wieder zu dem Mann und der Frau. Sie starren ihn immer noch an. Sie haben seine Reaktion, auf was immer er gesehen hat, bemerkt, aber sie selbst haben den zerstörten Bahnhof nicht gesehen. Der korpulente Typ hat ihm eine Hand auf den Arm gelegt, weil er anscheinend ein bisschen gewankt hat. Psychotische Schübe müssen die Hölle sein für den Gleichgewichtssinn.
»Sie sollten immer Bananen dabeihaben«, schlägt der korpulente Mann vor. »Kalium. Ist gut für Sie.«
»Oder wenigstens irgendwas Richtiges zu essen«, pflichtet die Frau nickend bei. »Sie haben wahrscheinlich nur Chips gegessen, stimmt’s? Ich mag diesen überteuerten Müll aus dem Speisewagen auch nicht, aber davon klappt man wenigstens nicht zusammen.«
»Ich mag die Hot Dogs da«, sagt das Mädchen.
»Die sind Müll, Süße, aber schön, dass du sie magst.« Sie nimmt die Hand des kleinen Mädchens. »Wir müssen los. Ihnen geht’s gut?«
»Ja«, sagt er. »Aber wirklich vielen Dank für Ihre Hilfe. Man hört immer so viel darüber, wie unfreundlich die Menschen in New York sind, aber … danke.«
»Ach, wir sind nur Arschlöcher, wenn jemand zu uns zuerst ein Arschloch ist«, sagt sie, aber sie lächelt dabei wieder. Dann geht sie mit dem kleinen Mädchen davon.
Der korpulente Mann haut ihm auf die Schulter. »Also, Sie sehen nicht aus, als müssten sie kotzen. Soll ich Ihnen was zu essen besorgen oder Saft oder so? Oder eine Banane?«, mit einem eindringlichen Ton bei Letzterem.
»Nein, danke. Mir geht’s wirklich schon besser.«
Der Mann schaut skeptisch, und blinzelt dann, als er einen neuen Gedanken hat. »Wissen Sie, wenn Sie kein Geld haben, das ist schon okay. Ich mach das.«
»Oh. Ach, nein, ist schon in Ordnung.« Er schultert seine, wie ihm gerade einfällt, fast 1600 $ teure Umhängetasche. Der korpulente Mann schaut sie verdutzt an. Hups. »Ähm, da drin ist bestimmt irgendwas mit Zucker …« In der Tasche ist noch ein fast leerer Plastikbecher von Starbucks. Er trinkt daraus, um Mr. Korpulent zu beruhigen. Der Kaffee ist kalt und widerlich. Er erinnert sich im Nachhinein, dass er ihn irgendwann gestern eingegossen hat, bevor er in den Zug gestiegen ist, zu Hause in …
… in …
In diesem Moment geht ihm auf, dass er nicht mehr weiß, wo er herkommt.
Und obwohl er sich anstrengt, erinnert er sich immer noch nicht, auf welche Universität er hier gehen soll.
Und dann wird ihm schlagartig klar, dass er seinen eigenen Namen nicht mehr weiß.
Während er dasteht, erschüttert von dieser dreifachen Epiphanie des Nichts, rümpft der korpulente Typ über seinen Kaffeebecher die Nase. »Wenn Sie schon in New York sind, besorgen Sie sich einen vernünftigen Kaffee«, sagt er. »In einem ordentlichen puerto-ricanischen Laden, ja? Und wenn Sie schon dabei sind, auch etwas frisch Zubereitetes zu essen. Na ja, egal, wie heißen Sie?«
»Oh, äh …« Er reibt sich den Nacken und täuscht vor, sich dringend strecken zu müssen – während er sich gleichzeitig ziemlich panisch umschaut und versucht, sich etwas auszudenken. Er kann nicht glauben, dass das passiert. Wer zur Hölle vergisst denn seinen eigenen Namen? Alle ausgedachten Namen, die ihm einfallen, sind so beliebige wie Bob oder Jimmy. Er ist kurz davor, Jimmy zu sagen, aus reiner Willkür – doch dann verfängt sich sein suchender Blick an etwas.
»Ich bin, äh … Manny«, platzt es aus ihm heraus. »Und Sie?«
»Douglas.« Mr. Korpulent hat seine Hände in den Hüften, offensichtlich überlegt er gerade etwas. Dann holt er sein Portemonnaie hervor und reicht ihm eine Visitenkarte. Douglas Acevedo, Klempner.
»Oh, entschuldigen Sie, ich hab keine Karte, mein neuer Job hat noch nicht angefangen …«
»Ist okay«, sagt Douglas. Er schaut immer noch nachdenklich. »Sehen Sie, viele von uns waren irgendwann mal neu hier. Wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid, okay? Im Ernst, ist kein Problem. Schlafplatz, vernünftiges Essen, eine gute Kirche, was auch immer.«
Er ist unglaublich freundlich. »Manny« kann seine Überraschung nicht verbergen. »Wow. Ich … wow. Sie kennen mich ja überhaupt nicht. Ich könnte ein Serienmörder sein oder so.«
Douglas schmunzelt. »Ja, na ja, irgendwie wirken Sie auf mich nicht besonders gewalttätig. Sie sehen aus …« Er stockt kurz, dann entspannen sich seine Gesichtszüge etwas. »Sie sehen aus wie mein Sohn. Ich tue für Sie nur das, was jemand auch für meinen Sohn tun sollte. Verstehen Sie?«
Irgendwie ist sich Manny sicher: Douglas’ Sohn ist tot.
»Ja, verstehe«, sagt Manny leise. »Danke noch mal.«
»Está bien, mano, no te preocupes.« Er winkt zum Abschied und geht weg in Richtung U-Bahn.
Manny schaut ihm hinterher, steckt die Visitenkarte ein und hat dabei drei Gedanken im Kopf. Der erste ist die späte Erkenntnis, dass der Typ gedacht haben muss, er sei Puerto-Ricaner. Der zweite ist, dass er Douglas vielleicht wirklich um einen Schlafplatz wird bitten müssen, vor allem, wenn er sich nicht in den nächsten paar Minuten an die Adresse seiner neuen Wohnung erinnert.
Der dritte Gedanke lässt ihn zur Ankunft/Abfahrt-Anzeige hochschauen, wo er das Wort gefunden hat, aus dem gerade sein neuer Name entstanden ist. Er hat Douglas nicht den kompletten Namen gesagt, weil heutzutage nur weiße Frauen solche Namen haben können, ohne dafür ausgelacht zu werden. Doch selbst in dieser modifizierten Form fühlt sich dieses Wort – diese Identität – wahrhaftiger an als alles andere, was er jemals in seinem Leben für sich in Anspruch genommen hat. Es ist, was er immer gewesen ist, ohne es gewusst zu haben. Es ist, wer er ist. Es ist alles, was er je hat sein müssen.
Das gesamte Wort lautet Manhattan.
In den Toiletten, im Licht der Natriumdampflampen, begegnet er sich selbst zum ersten Mal.
Ein gutes Gesicht. Er tut so, als würde er seine Hände besonders gewissenhaft waschen – auch nicht verkehrt in einer stinkenden Toilette in der Penn Station – und dreht sein Gesicht hin und her und begutachtet es von allen Seiten. Es ist offensichtlich, wieso der Typ ihn für einen Puerto-Ricaner gehalten hat: Seine Haut ist von einem gelblichen Braun, er hat krause Haare, die aber locker genug sind, dass sie wahrscheinlich herunterhängen würden, wenn er sie wachsen ließe. Er könnte vielleicht als Douglas’ Sohn durchgehen. (Er ist allerdings kein Puerto-Ricaner. So viel weiß er noch.) Er ist adrett gekleidet: Khakihose, weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und über seiner Tasche hängt ein Jackett, falls die Klimaanlage zu hoch eingestellt sein sollte, denn es ist Sommer und draußen sind bestimmt 32 Grad. Er sieht aus wie jemand in dem alterslosen Niemandsland zwischen kein-Kind-mehr und dreißig, allerdings wahrscheinlich eher in Richtung Letzterem, nach den vereinzelten grauen Einsprengseln in seinem Haaransatz zu urteilen. Braune Augen hinter einer dunkelbraun umrandeten Brille. Die Brille gibt ihm ein lehrerhaftes Aussehen. Spitze Wangenknochen, markante, gleichmäßige Gesichtszüge, Ansätze von Lachfalten um den Mund. Er ist ein gut aussehender Kerl. Ein gewöhnlicher, typisch amerikanischer junger Mann (die nichtweiße Version), angenehm unscheinbar.
Zweckmäßig, denkt er. Er hält beim Händewaschen kurz stirnrunzelnd inne und überlegt, weshalb er das denkt.
Okay, nein. Er hat genug seltsame Dinge, mit denen er sich grad beschäftigen muss. Er greift sich seinen Koffer, um die Toiletten zu verlassen. Ein älterer Typ an den Pissoirs starrt ihm beim Hinausgehen hinterher.