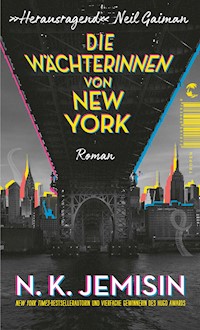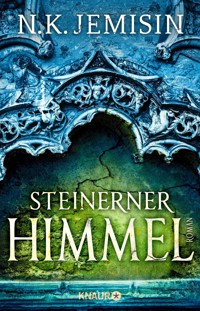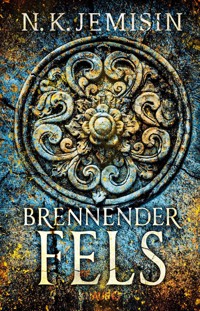12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die große Stille
- Sprache: Deutsch
»Die High Fantasy erreicht die Epoche des Klimawandels.« Die Welt Die spektakuläre Fantasy-Endzeit-Saga von New-York-Times-Bestseller-AutorinN.K. Jemisin - von einer riesigen Fangemeinde geliebt und ausgezeichnet mit dem HUGO Award Inmitten einer sterbenden Welt hat die verzweifelte Essun nur ein Ziel: ihre Tochter aus den Händen eines Mörders zu befreien, den sie nur zu gut kennt. Seit sich im Herzen des Landes Sansia ein gewaltiger Riss voll brodelnder Lava aufgetan hat, dessen Asche den Himmel verdüstert, scheinen immer mehr Menschen dem Wahnsinn zu verfallen. So lässt der Herrscher seine eigenen Bürger ermorden. Doch nicht Soldaten haben Essuns kleinen Sohn erschlagen und ihre Tochter entführt – sondern ihr eigener Ehemann! Essun folgt den beiden durch ein Land, das zur Todesfalle geworden ist. Und der Kampf ums nackte Überleben steht erst noch bevor. »Der elegante Stil und der düster-realistische Weltenentwurf geben die perfekte Kulisse ab für den fesselnden Kampf vom Schicksal gezeichneter Charaktere um eine zum Untergang verdammte Welt.« Publishers Weekly Die preisgekrönte dystopische Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Zerrissene Erde« - »Brennender Fels« - »Steinerner Himmel«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
N. K. Jemisin
Zerrissene Erde
Roman
Übersetzt von Susanne Gerold
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Inmitten einer sterbenden Welt hat die verzweifelte Essun nur ein Ziel: ihre Tochter aus den Händen eines Mörders zu befreien, den sie nur zu gut kennt.
Seit sich im Herzen des Landes Sansia ein gewaltiger Riss voll brodelnder Lava aufgetan hat, dessen Asche den Himmel verdüstert, scheinen immer mehr Menschen dem Wahnsinn zu verfallen. So lässt der Herrscher seine eigenen Bürger ermorden. Doch nicht Soldaten haben Essuns kleinen Sohn erschlagen und ihre Tochter entführt – sondern ihr eigener Ehemann! Essun folgt den beiden durch ein Land, das zur Todesfalle geworden ist. Und der Krieg ums nackte Überleben steht erst noch bevor.
»Der elegante Stil und der düster-realistische Weltenentwurf geben die perfekte Kulisse ab für den fesselnden Kampf vom Schicksal gezeichneter Charaktere um eine zum Untergang verdammte Welt.« Publishers Weekly
Inhaltsübersicht
Karte
Widmung
Vorspiel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Zwischenspiel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Zwischenspiel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Anhang I
Anhang II
Nachwort
Für all jene, die um den Respekt kämpfen müssen, den alle anderen einfach so erhalten.
Vorspiel
Du bist hier
Beginnen wir mit dem Ende der Welt, ja? Bringen wir es hinter uns und wenden wir uns dann interessanteren Dingen zu.
Zunächst: das persönliche Ende.
Es gibt da etwas, über das sie später wieder und wieder nachdenken wird, wenn sie sich vorstellt, wie ihr Sohn gestorben ist. Wenn sie versucht, Sinn in etwas zu finden, das von Natur aus sinnlos ist. Sie wird eine Decke über Uches zerstörten kleinen Körper ausbreiten – nicht über seinem Gesicht, denn er hat Angst im Dunkeln – und betäubt neben ihm sitzen, ohne sich darum zu scheren, dass da draußen gerade die Welt untergeht. Die Welt in ihr ist bereits untergegangen, und weder das eine noch das andere geschieht zum ersten Mal. Es ist ein alter Hut für sie.
Was sie dabei – und danach – denkt, ist: Aber er war frei.
Und es ist ihr verbittertes, müdes Ich, das ihrem verwirrten, schockierten Ich entgegnet: Nein, das war er nicht. Nicht wirklich. Aber jetzt wird er es sein.
Aber dir fehlt der Kontext. Wenden wir uns noch einmal dem Ende zu, diesmal kontinental.
Da ist ein Land.
Es ist ein ganz normales Land, wie alle Länder. Es gibt Berge und Hochebenen und Schluchten und Flussdeltas, das Übliche. Ganz normal ist es, abgesehen von seiner Größe und seiner Dynamik. Es bewegt sich nämlich, dieses Land. Wie ein alter Mann, der ruhelos auf seinem Bett liegt, hebt und senkt es sich, zieht sich zusammen und furzt, gähnt und schluckt. Deshalb haben die Bewohner dieses Landes ihm den Namen Die Stille gegeben. Es ist ein Land der versteckten und verletzenden Ironie.
Die Stille hatte einst andere Namen. Früher einmal bestand das Land aus verschiedenen Ländern. Jetzt ist es ein einziger riesiger, zusammenhängender Kontinent, aber irgendwann in der Zukunft wird es wieder mehr als nur ein Land sein.
Ziemlich bald sogar.
Das Ende beginnt in einer Stadt: der ältesten, größten und herrlichsten lebendigen Stadt der Welt. Die Stadt heißt Yumenes, und sie war einmal das Herz eines Imperiums. Noch immer ist sie das Herz von vielem, allerdings ist das Imperium in den Jahren nach seiner ersten Blüte ein wenig verwelkt, wie das bei Imperien eben so ist.
Es ist nicht die Größe, die Yumenes einzigartig macht. In diesem Teil der Welt gibt es viele große Städte, die wie die Glieder einer Kette entlang des Äquators miteinander verbunden sind und eine Art Kontinentalgürtel bilden. Überall sonst auf der Welt werden nur selten aus Dörfern Städte, und Städte werden selten zu Großstädten, denn all diese Gemeinwesen sind schwer am Leben zu halten, wenn die Erde immer wieder versucht, sie zu verschlingen. Yumenes jedoch ist während der siebenundzwanzig Jahrhunderte, die es existiert, fast immer stabil gewesen.
Yumenes ist einzigartig, weil nur hier die Menschen es gewagt haben, beim Bauen nicht auf Sicherheit zu setzen oder auf Bequemlichkeit, ja nicht einmal auf Schönheit, sondern auf Kühnheit. Die Stadtmauern sind ein Meisterwerk aus filigranen Mosaiken und Prägungen und zeugen ausgiebig von der langen und brutalen Geschichte ihrer Bewohner. Die dicht gedrängten Gebäude werden immer wieder durchbrochen von großen, hohen Türmen, die wie steinerne Finger wirken; von handgeschmiedeten Lampen, die von dem modernen Wunder der Hydroelektrizität mit Energie versorgt werden; von kühnen, gläsernen Brücken und von architektonischen Strukturen, die als Balkone bezeichnet werden und die zugleich so schlicht und tollkühn sind, dass in der gesamten Geschichtsschreibung noch niemand zuvor so etwas gebaut hat. (Aber vergiss nicht, dass in der Geschichtsschreibung das meiste nie erwähnt wird.) Die Straßen bestehen hier nicht aus den üblichen, leicht zu ersetzenden Pflastersteinen, sondern aus einer glatten, lückenlosen und übernatürlichen Substanz, die von den Ortsansässigen als Asphalt bezeichnet wird. In Yumenes haben sogar die Baracken etwas Gewagtes, denn sie sind lediglich dünnwandige Hütten, die aussehen, als würden sie beim nächsten heftigen Wintersturm zusammenbrechen, erst recht bei einem Erdbeben. Und doch stehen sie schon seit Generationen.
Im Herzen der Stadt gibt es viele hohe Gebäude, und es überrascht wohl nicht, dass eines davon besonders groß und gewagter ist als alle anderen zusammen: ein massives Bauwerk, dessen Sockel in Form einer sternenförmigen Pyramide aus präzise behauenen Obsidianziegeln besteht. Pyramiden sind die stabilste architektonische Form überhaupt, und diese Pyramide ist gewissermaßen eine fünffache Pyramide – und warum auch nicht? Und weil das hier Yumenes ist, befindet sich am Scheitelpunkt der Pyramide eine riesige geodätische Kuppel mit facettierten Wänden, die an durchscheinenden Bernstein erinnern. Sie scheint dort zu balancieren, während in Wirklichkeit jeder Teil ihrer Struktur nur dazu dient, sie zu stützen. Das Ganze soll nur verwegen aussehen, weiter nichts.
Im Schwarzen Stern treffen sich die Oberhäupter des Imperiums, um das zu tun, was Oberhäupter so tun. Ihr vollkommener Herrscher wird in der Bernsteinkuppel verwahrt und sorgfältig geschützt. Er schlendert in vornehmer Verzweiflung durch die goldenen Hallen, tut, was man ihm sagt, und fürchtet den Tag, an dem seine Herren beschließen, dass seine Tochter ein besseres Schmuckstück abgibt als er.
All diese Orte und Bewohner spielen übrigens keine Rolle. Ich erwähne sie nur wegen des Kontextes.
Aber dieser Mann jetzt wird sehr wichtig werden.
Vorläufig kannst du dir selbst ausmalen, wie er aussieht. Du kannst dir auch selbst ausdenken, was er gerade denkt. Es mag falsch sein und nur Mutmaßungen, aber wahrscheinlich trifft irgendwas davon zu. In seinem Kopf können in Anbetracht seiner folgenden Taten nur wenige Gedanken sein.
Er steht auf einem Hügel unweit der Obsidianmauern des Schwarzen Sterns. Von hier aus kann er den größten Teil der Stadt überblicken, ihren Rauch riechen, sich in ihrem Geschwätz verlieren. Auf einem der Asphaltwege unterhalb von ihm spazieren ein paar junge Frauen; der Park, in dem sich der Hügel befindet, ist bei den Stadtbewohnern sehr beliebt. (Sorge für Grün innerhalb der Mauern, rät die Steinweisheit, aber in den meisten Gemeinschaften wird brachliegendes Land mit Gemüse und anderen Früchten bepflanzt und nutzbar gemacht. Nur in Yumenes wird das Grün zu Schönheit geformt.) Das Lachen der Frauen weht als Antwort auf etwas, was eine von ihnen gesagt hat, auf einer vorbeistreichenden Brise zu ihm herauf. Er schließt die Augen und genießt das schwache Tremolo ihrer Stimmen und den noch schwächeren Widerhall ihrer Schritte, die sich wie Flügelschläge von Schmetterlingen an seinen Mentastzellen anfühlen. Er kann nicht alle sieben Millionen Einwohner der Stadt mentasten, wirklich nicht. Er ist gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Die meisten allerdings sind da. Hier. Er holt tief Luft und wird zu einem Bestandteil der Erde. Sie schreiten über die Fasern seiner Nerven, und die feinen Härchen auf seiner Haut werden von ihren Stimmen bewegt. Ihr Atem kräuselt die Luft, die er in seine Lungenflügel zieht. Sie sind auf ihm. Sie sind in ihm.
Aber er weiß, dass er keiner von ihnen ist und auch niemals einer von ihnen sein wird.
»Wusstest du«, fragt er im Plauderton, »dass die erste Steinweisheit wirklich in Stein geschrieben wurde? Damit man sie nicht verändern und dem jeweiligen Zeitgeist oder der Politik anpassen konnte. Damit sie nicht verging.«
»Ich weiß«, sagt seine Begleitung.
»Hm. Ja, wahrscheinlich warst du dabei, als sie niedergeschrieben wurde, das hatte ich vergessen.« Er seufzt, während die Frauen sein Sichtfeld verlassen. »Es ist ungefährlich, dich zu lieben. Du wirst mich nicht enttäuschen. Du wirst nicht sterben. Und ich kenne den Preis im Voraus.«
Seine Begleitung erwidert nichts. Er hat eigentlich auch nicht damit gerechnet, selbst wenn ein Teil von ihm es gehofft hat. Er ist so einsam gewesen.
Aber Hoffnung ist irrelevant, wie so viele andere Gefühle auch, die ihn – wie er weiß – nur verzweifeln lassen, wenn er sie beachtet. Er hat sich damit genug beschäftigt. Die Zeit des Zauderns ist vorbei.
»Ein Gebot ist in Stein gemeißelt«, sagt der Mann und breitet die Arme aus.
Stell dir sein Gesicht vor, das ihm vom vielen Lächeln wehtut. Stundenlang lächelt er: mit zusammengebissenen Zähnen, zurückgezogenen Lippen, der Bereich um die Augen in Falten gelegt, sodass die Krähenfüße sichtbar werden. Es ist eine Kunst, auf eine Weise zu lächeln, dass andere es glauben. Es ist immer wichtig, die Augen einzubeziehen; ansonsten merken die Leute, dass du sie hasst.
»Gemeißelte Worte sind absolut.«
Er spricht zu niemand Besonderem, aber neben dem Mann steht eine Frau – oder zumindest so etwas Ähnliches wie eine Frau. Die Merkmale sind nur oberflächlich nachgebildet, als Gefälligkeit. Auch das in lockeren Falten herabhängende Kleid, das sie trägt, ist keine echte Kleidung. Sie hat lediglich einen Teil ihrer steifen Substanz so gestaltet, dass es zu den Vorlieben der zerbrechlichen, sterblichen Kreaturen passt, bei denen sie sich gerade aufhält. Aus der Ferne könnte die Illusion sogar funktionieren und sie könnte als reglos dastehende Frau durchgehen, zumindest für eine Weile. Aus der Nähe allerdings würde jeder hypothetische Betrachter bemerken, dass ihre Haut aus weißem Porzellan besteht – und das ist keine Metapher. Als Skulptur wäre sie wunderschön, wenn auch zu schonungslos realistisch für den Geschmack der Ortsansässigen. Die meisten Bewohner von Yumenes ziehen eine höfliche Abstraktion der vulgären Wirklichkeit vor.
Als sie sich dem Mann zuwendet – langsam, denn Steinesser bewegen sich oberhalb der Erdoberfläche immer langsam, außer wenn sie es nicht tun –, verwandelt sich in der Bewegung ihre künstlerische Schönheit in etwas vollkommen anderes. Der Mann hat sich inzwischen daran gewöhnt, aber trotzdem sieht er sie nicht an. Er will nicht, dass Ekel diesen Augenblick zerstört.
»Was werdet ihr tun?«, fragt er sie. »Wenn es geschehen ist. Wird sich deine Art aus den Trümmern erheben und die Welt an unserer Stelle übernehmen?«
»Nein«, sagt sie.
»Warum nicht?«
»Nur wenige von uns interessieren sich dafür. Außerdem werdet ihr noch hier sein.«
Ihr. Eure Art. Die Menschheit. So oft behandelt sie ihn, als würde er für seine ganze Spezies stehen. Und er macht es mit ihr genauso. »Du klingst sehr bestimmt.«
Sie sagt nichts darauf. Steinesser machen sich nur selten die Mühe, etwas Offensichtliches auszusprechen. Er ist froh darüber, denn ihre Sprechweise ärgert ihn ohnehin; ihre Stimme bringt die Luft nicht so zum Zittern, wie es eine menschliche Stimme tut. Er weiß nicht, wie es funktioniert. Es interessiert ihn auch nicht. Er möchte nur, dass sie jetzt still ist.
Er möchte, dass alles still ist.
»Aufhören«, sagt er. »Bitte.«
Und dann greift er aus – mit all der Kontrolle, die die Welt mittels Gehirnwäsche, Gewalt und Verrat aus ihm hervorgeholt hat, und mit all der Empfindsamkeit, die seine Herren über Generationen der Vergewaltigung und des Zwangs und der höchst unnatürlichen Auslese in ihn hineingezüchtet haben. Seine Finger spreizen sich und zucken, als in seiner Wahrnehmungslandkarte mehrere Punkte widerhallen: seine Sklavenbrüder. Er kann sie nicht befreien, nicht wirklich jedenfalls. Das hat er schon versucht und dabei versagt. Aber er kann dazu beitragen, dass ihr Leiden einer größeren Sache dient als der Hybris einer Stadt und der Furcht eines Imperiums.
Also streckt er sich in die Tiefe und greift nach der summenden, klopfenden, geschäftigen, nachhallenden, wogenden, ungeheuren Weite der Stadt, nach dem ruhigeren Felsgestein darunter und der brodelnden Hitze und dem Druck wiederum darunter. Dann streckt er sich in die Weite, greift nach dem großen, sich verschiebenden Puzzlestück des Erdmantels, auf dem der Kontinent liegt. Und schließlich streckt er sich nach oben. Nach der Macht.
Er nimmt all das, die Gesteinsschichten und das Magma, die Menschen und die Macht, in seine eingebildeten Hände. Alles. Er hält es fest. Er ist nicht allein. Die Erde ist in ihm.
Und dann zerbricht er es.
Dies ist die Stille, die nicht einmal an einem guten Tag still ist.
Jetzt wogt sie, hallt in der Umwälzung nach. Jetzt entsteht eine Linie, verläuft grob ostwestlich und sehr gerade; in ihrer offenkundigen Unnatürlichkkeit ist sie beinahe akkurat und umspannt den Äquator dieses Landes. Der Ausgangspunkt dieser Linie liegt in der Stadt Yumenes.
Die Linie ist tief und grob, ein Schnitt ins Mark des Planeten. Magma quillt heraus, frisch und glühend rot. Die Erde ist gut darin, sich selbst zu heilen. Diese Wunde wird, geologisch gesehen, rasch vernarben, und dann wird der reinigende Ozean der Linie folgen und die Stille halbieren, sie in zwei Länder zerteilen. Vorher allerdings wird die Wunde schwären und nicht nur Hitze, sondern auch Gas und kiesige, dunkle Asche hervorbringen – genug, um über dem größten Teil der Stille in nur wenigen Wochen den Himmel zu ersticken. Überall werden Pflanzen sterben, und die Tiere, die sie fressen, werden verhungern, und die Tiere, die diese Tiere fressen, werden auch verhungern. Es wird einen frühen Wintereinbruch geben, und der Winter wird hart sein und lange währen, sehr lange. Natürlich wird er irgendwann einmal enden, so wie jeder Winter irgendwann endet, und dann wird die Welt zu ihrem alten Zustand zurückkehren. Irgendwann.
Irgendwann.
Die Bewohner der Stille leben in einem Zustand der ständigen Vorbereitung auf eine Katastrophe. Sie haben Mauern errichtet und Brunnen gegraben und Nahrungsmittel gehortet, und sie können locker fünf, zehn oder gar fünfundzwanzig Jahre in einer Welt ohne Sonne leben.
Irgendwann bedeutet in diesem Fall in ein paar tausend Jahren.
Sieh nur, schon breiten sich die Aschewolken aus.
Derweil wir die Dinge aus der Sicht des Kontinents betrachten, aus der Sicht des Planeten, sollten wir die Obelisken inspizieren, die über all dem dahintreiben.
Die Obelisken hatten einmal andere Namen, damals, als sie erbaut und aufgestellt und gebraucht worden waren, aber niemand erinnert sich noch an die Namen oder an den Zweck dieser großen Objekte. In der Stille sind Erinnerungen so zerbrechlich wie Schiefer. Tatsächlich werden diese Dinger heutzutage von niemandem mehr besonders beachtet, obwohl sie riesig und wunderschön und sogar ein bisschen Furcht einflößend sind: gewaltige kristalline Pfeiler, die zwischen den Wolken schweben, sich dabei langsam drehen und unbegreifliche Flugwege entlangtreiben, hin und wieder verschwimmen, als seien sie nicht ganz real – was eine durch das Licht hervorgerufene optische Täuschung sein könnte. (Ist es aber nicht.) Es ist offensichtlich, dass die Obelisken nicht natürlichen Ursprungs sind.
Offensichtlich ist auch, dass sie unbedeutend sind. Ehrfurchtgebietend, aber zweckfrei. Sie sind lediglich ein weiterer Grabstein einer weiteren Zivilisation, die durch die unermüdlichen Bemühungen von Vater Erde erfolgreich zerstört worden ist. Auf der ganzen Welt gibt es solche Steinhaufen: tausend in Trümmern liegende Städte, eine Million Monumente von Helden oder Göttern, an die sich niemand mehr erinnert, mehrere Dutzend Brücken, die ins Nirgendwo führen. Die Steinweisheit sagt, dass solche Dinge nicht bewundert werden dürfen. Die Menschen, die diese alten Objekte gebaut haben, waren schwach und sind gestorben, wie es die Schwachen unweigerlich tun. Noch schlimmer ist, dass sie versagt haben. Und diejenigen, die die Obelisken gebaut haben, haben noch schlimmer versagt als die meisten anderen.
Aber die Obelisken existieren, und sie spielen für das Ende der Welt eine Rolle, und deshalb sind sie es wert, erwähnt zu werden.
Zurück zum Persönlichen. Die Dinge müssen geerdet bleiben, haha.
Diese Frau, die ich erwähnt hatte, deren Sohn tot ist – sie war glücklicherweise nicht in Yumenes, sonst wäre diese Geschichte hier ziemlich kurz. Und dich würde es nicht geben.
Sie befindet sich in einer Stadt namens Tirimo. Im Sprachgebrauch der Stille ist eine Stadt eine Form der Gems, der Gemeinschaften, aber eigentlich ist Tirimo kaum groß genug, um diesen Namen zu verdienen. Tirimo liegt im gleichnamigen Tal am Fuß des Tirimas-Gebirges. Das nächste Gewässer ist ein nur gelegentlich Wasser führendes Flüsschen, dem die Ortsansässigen den Namen Kleine Tirika gegeben haben. In einer Sprache, die nur noch in linguistischen Bruchstücken existiert, bedeutet eatiri »ruhig«. Tirimo liegt weit abseits der glitzernden, robusten Städte der Äquatorialen, weshalb die Menschen beim Bauen ihrer Gebäude auf die unvermeidlichen Erschütterungen Rücksicht nehmen. Es gibt weder kunstvolle Türme noch Gesimse, nur Mauern, errichtet aus Holz und dem hier zu findenden billigen braunen Backstein auf einem Fundament aus behauenem Stein. Keine asphaltierten Straßen, nur grasbewachsene Hänge, die von Wegen aus festgestampfter Erde durchschnitten werden. Nur einige wenige dieser Pfade sind mit Holzbrettern oder Pflastersteinen versehen. Es ist ein friedlicher Ort, auch wenn die Umwälzung, die gerade in Yumenes stattgefunden hat, schon bald seismische Wellen nach Süden schicken wird, die die gesamte Region niederwalzen werden.
In dieser Stadt steht ein Haus wie viele andere. Dieses Haus liegt an einem der Hänge und ist kaum mehr als ein in den Boden gegrabenes Loch, das mit Lehm und Backstein eingefasst wurde, um die Feuchtigkeit abzuhalten, und ein Dach aus Zedern und Grassoden besitzt. Die kultivierten Leute in Yumenes lachen (lachten) über solch primitive Stätten, sofern sie sich überhaupt dazu herablassen (herabließen), sich zu solchen Dingen zu äußern – aber für die Menschen in Tirimo ist es ebenso vernünftig wie praktisch, in der Erde zu leben. Im Sommer bleibt alles kühl und im Winter warm, und es ist sowohl vor Erschütterungen wie auch vor Stürmen geschützt.
Die Frau heißt Essun. Sie ist zweiundvierzig Jahre alt. Sie sieht so aus wie die meisten Frauen der Mittbreiten: groß, wenn sie steht, mit einem geraden Rücken und einem langen Hals. Ihre Hüften haben mühelos zwei Kinder ausgetragen, ihre Brüste haben sie mühelos gestillt. Ihre Hände sind breit und geschmeidig. Sie wirkt kräftig und gut genährt, wie man es in der Stille schätzt. Ihr Gesicht wird von verklebten Locken umrahmt, jede so breit wie ihr kleiner Finger; zu den Haarspitzen hin verblasst das Schwarz zu Braun. Ihre Hautfarbe ist nach manchen Maßstäben unangenehm ockerbraun, nach anderen unangenehm olivblass. Von den Yumenensern werden (wurden) Menschen wie sie als Mittbreiten-Mischlinge bezeichnet – in ihnen ist genug Sansi, dass es sich zeigt, aber nicht genug, dass es auf Anhieb erkennbar ist.
Der Junge war ihr Sohn. Er hieß Uche und war fast drei Jahre alt. Er war klein für sein Alter, hatte große Augen, eine Stupsnase, lächelte süß und war altklug. Es fehlte ihm an keiner jener Eigenschaften, die Menschenkinder benutzen, um die Liebe ihrer Eltern zu gewinnen, seit die Spezies sich auf so etwas wie Vernunft zubewegt. Er war gesund und schlau, und er sollte noch am Leben sein.
Dies war das Familienzimmer ihres Heims. Er war gemütlich und ruhig, ein Raum, in dem sich die ganze Familie treffen konnte, um sich zu unterhalten oder zu essen oder Spiele zu spielen oder zu schmusen oder einander zu kitzeln. Sie hat Uche gern in diesem Zimmer gestillt. Sie glaubt, dass er auch hier empfangen wurde.
Sein Vater hat ihn hier totgeschlagen.
Für das letzte Stück Kontext begeben wir uns zum nächsten Tag ins Tal, das Tirimo umgibt. Zu diesem Zeitpunkt sind die ersten Echos der Katastrophe bereits vorbeigerollt, aber später wird es noch Nachbeben geben.
Am nordöstlichsten Ende des Tals herrscht Verwüstung: zersplitterte Bäume, eingestürzte Felswände, eine schwebende Staubwolke, die sich in der reglosen, nach Schwefel riechenden Luft nicht aufgelöst hat. Dort, wo die ursprüngliche Schockwelle durchgekommen ist, steht nichts mehr; dieses Beben gehört zu jenen, die alles zerschmettern und die Stücke anschließend zu Geröll zermalmen. Auch Tote gibt es: kleine Tiere, die nicht weglaufen konnten, Rotwild und andere größere Tiere, die auf der Flucht ins Straucheln gekommen sind und vom Geröll erdrückt wurden. Zu den Letztgenannten zählen auch Menschen, die das Pech hatten, am falschen Tag auf der Handelsstraße unterwegs zu sein.
Die Kundschafter, die von Tirimo hergekommen sind, um den Schaden abzuschätzen, sind nicht über die Trümmer geklettert; sie haben sich alles von der verbliebenen Straße aus durch Langaugen angesehen und sich gewundert, dass der Rest des Tals – jener Teil um das eigentliche Tirimo herum und von da aus einige Meilen in alle Richtungen in Form eines nahezu perfekten Kreises – unbeschädigt geblieben ist. Nun, genau genommen haben sie sich nicht gewundert. Sie sahen es sich vielmehr in grimmigem Unbehagen an, denn alle wissen, was ein solches offensichtliches Glück bedeutet. Suche das Zentrum des Kreises, rät die Steinweisheit. Irgendwo in Tirimo muss ein Rogga sein.
Ein erschreckender Gedanke. Aber noch erschreckender sind die Zeichen, die aus dem Norden kommen, und die Anweisungen von Tirimos Oberhaupt, so viele frische Tierkadaver wie möglich im hinteren Bereich des Kreises zu sammeln. Fleisch, das nicht schlecht geworden ist, lässt sich trocknen, Felle und Häute können abgezogen und verarbeitet werden. Nur für den Fall.
Die Kundschafter ziehen schließlich wieder ab, in Gedanken ganz bei nur für den Fall. Wären sie nicht so sehr in Gedanken gewesen, hätten sie etwas bemerken können, das sich am Fuß der neu abrasierten Klippe befindet, unauffällig zwischen einer Knorrtanne und zerbrochenen Felsblöcken. Es wäre ihnen aufgrund seiner Größe und Form aufgefallen: ein nierenförmiger Quader aus gesprenkeltem Chalzedon in dunklem Grüngrau, das sich deutlich vom helleren Sandstein abhebt. Hätten sie sich danebengestellt, wäre ihnen aufgefallen, dass dieses Ding ihnen bis zur Brust reicht und beinahe so groß ist wie ein menschlicher Körper. Hätten sie es dann auch noch berührt, wären sie möglicherweise fasziniert gewesen von der Dichte seiner Oberfläche. Der Gegenstand sieht schwer aus und verströmt einen Geruch nach Eisen, erinnert an Rost und Blut. Sie wären überrascht gewesen, dass er sich warm anfühlt.
Aber es ist niemand da, als der Gegenstand erst stöhnt und dann aufplatzt, sich entlang der Mittellinie spaltet, als wäre er zersägt worden. Hitze und unter Druck stehendes Gas entweichen mit einem zischenden Schrei, woraufhin alle überlebenden Waldkreaturen auf der Suche nach Schutz davonhuschen. Fast sofort flackert Licht an den Rändern des Spalts auf, ein bisschen wie eine Flamme und ein bisschen wie Flüssigkeit. Auf dem Boden um den Gegenstand herum bleibt geschmolzenes Glas zurück. Dann kommt er eine lange Weile zur Ruhe. Kühlt ab.
Einige Tage verstreichen.
Nach einer Weile wird der Gegenstand von innen aufgestoßen, und etwas kriecht ein paar Fuß weit hinaus, ehe es zusammenbricht.
Wieder verstreicht ein Tag.
Jetzt, da er abgekühlt und aufgeplatzt ist, überzieht eine Kruste aus ungleichmäßigen Kristallen die innere Oberfläche des Gegenstands; einige von ihnen sind so weiß wie Wolken, andere so rot wie venöses Blut. Dünne, helle Flüssigkeit sammelt sich beim tiefsten Punkt der beiden Hälften, aber der größte Teil der Flüssigkeit, die in dieser Geode enthalten war, ist inzwischen in den Boden darunter gesickert.
Der Körper, der in der Geode gewesen war, liegt nackt mit dem Gesicht nach unten zwischen den Felsen. Seine Haut ist trocken, sein Fleisch hebt sich in offensichtlicher Erschöpfung. Allmählich stemmt er sich in eine aufrechte Position. Jede Bewegung geschieht bedachtsam und sehr, sehr langsam. Es dauert eine ganze Weile. Als er sich schließlich aufgerichtet hat, stolpert er – langsam – zur Geode, lehnt sich gegen sie, um sich an ihr abzustützen. Dann bückt er sich – langsam – und greift hinein. Mit einer plötzlichen, scharfen Bewegung bricht er die Spitze eines roten Kristalls ab. Es ist ein kleines Stück, vielleicht von der Größe einer Traube und gezackt wie zerbrochenes Glas.
Der Junge – denn er sieht aus wie einer – steckt sich das Stück in den Mund und kaut. Das Geräusch dabei ist laut: ein Mahlen und Klappern, das auf der Lichtung widerhallt. Nach einigen Momenten schluckt er. Dann beginnt er heftig zu zittern. Er schlingt seine Arme einen Moment um sich, stößt ein leises Stöhnen aus, als wäre ihm plötzlich bewusst geworden, dass er nackt ist und friert und dies schrecklich ist.
Mit Mühe erlangt der Junge die Kontrolle über sich zurück. Er greift wieder in die Geode – diesmal bewegt er sich schneller – und zieht weitere Kristallstücke heraus. Er stapelt sie auf den Gegenstand, während er neue abbricht. Die dicken, stumpfen Kristallschäfte zerkrümeln zwischen seinen Fingern, als wären sie aus Zucker, auch wenn sie in Wirklichkeit aus etwas sehr, sehr viel Härterem bestehen. Aber er ist auch in Wirklichkeit kein Kind, also ist das für ihn leicht.
Schließlich steht er da, schwankt und hält in seinen Armen jede Menge milchiger, blutroter Steine. Der Wind bläst kurz und heftig, und seine Haut kribbelt als Reaktion darauf. Er zuckt zusammen, schnell und ruckartig wie eine aufgezogene Puppe. Dann sieht er stirnrunzelnd an sich hinunter. Während er sich konzentriert, werden seine Bewegungen geschmeidiger, gleichmäßiger. Menschlicher. Er nickt, wie um dies zu betonen, vielleicht vor Zufriedenheit.
Der Junge dreht sich jetzt um und macht sich auf den Weg nach Tirimo.
Und das darfst du nicht vergessen: Das Ende der einen Geschichte ist nur der Beginn einer anderen. Das ist schließlich schon mal passiert. Menschen sterben. Alte Ordnungen zerfallen. Neue Gesellschaften entstehen. Wenn wir sagen: »Dies ist das Ende der Welt«, ist das für gewöhnlich eine Lüge, denn dem Planeten geht es immer noch gut.
Aber hier geht es darum, wie die Welt endet.
Es geht darum, wie die Welt endet.
Es geht darum, wie die Welt endet.
Zum letzten Mal.
1
Du, am Ende
Du bist sie. Sie ist du. Du bist Essun. Erinnerst du dich? Die Frau mit dem toten Sohn.
Du bist eine Orogene und lebst seit zehn Jahren in der kleinen Niemandsstadt Tirimo. Nur drei Menschen hier wissen, wer du bist, und zweien davon hast du das Leben geschenkt.
Nun ja. Jetzt ist nur noch einer da, der es weiß.
In den letzten zehn Jahren hast du so normal wie möglich gelebt. Du bist von einem anderen Ort nach Tirimo gekommen; die Leute hier interessieren sich aber nicht wirklich dafür, von wo und wieso. Da du offensichtlich gebildet bist, wurdest du Lehrerin an der örtlichen Krippe und hast Kinder im Alter von zehn bis dreizehn Jahren unterrichtet. Du bist weder die beste noch die schlechteste Lehrerin; die Kinder vergessen dich, wenn sie weiterziehen, aber sie lernen was bei dir. Die Metzgerin kennt wahrscheinlich deinen Namen, weil sie gern mit dir flirtet. Der Bäcker kennt ihn eher nicht, weil du still bist und er in dir wie alle anderen in dieser Stadt nur Jijas Frau sieht. Jija ist in Tirimo geboren und aufgewachsen, ein Steinwerkzeugmacher der Resistenten-Nutzkaste; alle kennen und mögen ihn, also mögen sie auch dich ein wenig. Er ist der Vordergund des Gemäldes, das euer gemeinsames Leben darstellt. Du bist der Hintergrund. Es gefällt dir so.
Du bist die Mutter von zwei Kindern, aber jetzt ist eines davon tot, und das andere wird vermisst. Vielleicht ist sie ebenfalls tot. Das alles findest du heraus, als du eines Tages von der Arbeit nach Hause kommst. Das Haus ist leer und ruhig, und der winzige kleine Junge auf dem Boden eures Familienzimmers ist blutverschmiert und voller blauer Flecke.
Und dann … machst du dicht. Du machst das nicht bewusst. Es ist nur ein bisschen viel, nicht wahr? Zu viel. Du hast vieles durchgemacht, du bist sehr stark, aber selbst für dich gibt es Grenzen dessen, was du ertragen kannst.
Zwei Tage vergehen, bevor jemand kommt.
Du hast diese Zeit im Haus bei deinem toten Sohn verbracht. Du bist aufgestanden, hast die Toilette benutzt, dir etwas aus dem Kühlgewölbe geholt und gegessen, die letzten Tropfen Wasser aus dem Hahn getrunken. All das konntest du tun, ohne nachzudenken, rein mechanisch. Danach bist du zu Uche zurückgekehrt.
(Bei einem dieser Gänge hast du eine Decke für ihn geholt. Du hast ihn damit zugedeckt, bis zu seinem zerschlagenen Kinn. Eine Gewohnheit. Die Dampfrohre rumpeln nicht mehr; es ist kalt im Haus. Er könnte sich was einfangen.)
Später am nächsten Tag klopft jemand an die Haustür. Du machst keine Anstalten, zu reagieren. Es hätte bedeutet, dass du dich fragst, wer es sein könnte und ob du die Person reinlassen sollst. Was wiederum dazu geführt hätte, dass du an die Leiche deines Sohnes unter der Decke gedacht hättest, und warum solltest du das wollen? Du ignorierst das Klopfen an der Tür.
Jemand schlägt gegen das Fenster im vorderen Zimmer. Hartnäckig. Auch das ignorierst du.
Schließlich zerbricht jemand das Glas an der Hintertür des Hauses. Du hörst Schritte im Gang zwischen Uches Zimmer und dem von Nassun, deiner Tochter.
(Nassun, deiner Tochter.)
Die Schritte erreichen das Familienzimmer und verharren. »Essun!«
Du kennst diese Stimme. Jung, männlich. Bekannt und auf vertraute Weise beruhigend. Lerna, Makenbas Junge vom Ende der Straße, der ein paar Jahre weg war und als Arzt zurückgekehrt ist. Er ist kein Junge mehr, schon eine ganze Weile nicht mehr, und du erinnerst dich wieder, dass du an ihn als einen Mann denken solltest.
Ups, denken. Besorgt hörst du damit auf.
Er atmet ein, und sein Entsetzen hallt auf deiner Haut nach, als er nahe genug kommt, um Uche sehen zu können. Bemerkenswerterweise stößt er keinen Schrei aus. Er berührt dich auch nicht, aber er geht auf die andere Seite von Uche und mustert dich eingehend. Versucht er herauszufinden, was in dir vorgeht? Nichts, nichts. Dann zieht er die Decke herab, um einen richtigen Blick auf Uche zu werfen. Nichts, nichts. Er zieht die Decke wieder hoch, diesmal auch über das Gesicht deines Sohnes.
»Er mag das nicht«, sagst du. Es ist das erste Mal seit zwei Tagen, dass du etwas sagst. Es fühlt sich seltsam an. »Er hat Angst im Dunkeln.«
Nach einem Moment des Schweigens zieht Lerna die Decke wieder zurück, bis knapp unter Uches Augen.
»Danke«, sagst du.
Lerna nickt. »Hast du geschlafen?«
»Nein.«
Also geht Lerna um die Leiche herum und nimmt deinen Arm, zieht dich hoch. Er ist sanft, aber sein Griff ist fest, und er gibt nicht auf, als du dich zunächst nicht rührst. Er übt nur mehr Druck aus, unerbittlich, bis du die Wahl hast, entweder aufzustehen oder vornüberzufallen. Diese Wahl lässt er dir. Du stehst auf. Dann führt er dich ebenso sanft und fest zur Haustür. »Du kannst dich bei mir ausruhen«, sagt er.
Du willst nicht denken, also hältst du ihm nicht entgegen, dass du dein eigenes Bett hast, das vollkommen in Ordnung ist, danke auch. Und du erklärst ihm auch nicht, dass es dir gut geht und du seine Hilfe nicht benötigst, was nicht stimmt. Er führt dich nach draußen und den Weg entlang, hält die ganze Zeit deinen Ellbogen fest. Ein paar Leute haben sich draußen auf der Straße versammelt. Einige von ihnen kommen näher zu euch, sie sagen etwas, auf das Lerna etwas erwidert; nichts davon hörst du richtig. Ihre Stimmen sind verschwommener Lärm, und dein Kopf macht sich nicht die Mühe, ihn zu interpretieren. Lerna spricht an deiner statt mit ihnen, wofür du dankbar wärst, könntest du dich nur dazu durchringen, dir etwas daraus zu machen.
Er bringt dich zu seinem Haus, in dem es nach Kräutern und Chemikalien und Büchern riecht, und dann steckt er dich in ein langes Bett, auf dem eine graue fette Katze sitzt. Die Katze rückt aus dem Weg, genug, dass du dich hinlegen kannst, und als du still bist, drückt sie sich an deine Seite. Das könnte dir Trost spenden, würden die Wärme und das Gewicht dich nicht ein bisschen daran erinnern, wie es ist, wenn Uche mit dir einschlummert.
Einschlummerte. Nein, die Zeitform zu ändern erfordert denken. Einschlummert.
»Schlaf«, sagt Lerna, und es fällt dir leicht, ihm zu gehorchen.
Du schläfst lange. Irgendwann wachst du auf. Lerna hat dir ein Tablett mit etwas zu essen neben das Bett gestellt: klare Brühe und geschnittene Früchte und eine Tasse Tee, alles hat inzwischen Raumtemperatur. Du isst und trinkst, dann gehst du ins Badezimmer. Die Toilettenspülung funktioniert nicht. Ein Eimer steht daneben, gefüllt mit Wasser; Lerna muss ihn zu diesem Zweck hierhergestellt haben. Während du dieses Rätsel löst, spürst du die Bedrohung des Nachdenkens und musst kämpfen, kämpfen, kämpfen, um in dem weichen, warmen Schweigen der Gedankenlosigkeit zu bleiben. Du schüttest etwas Wasser in die Toilette, schließt den Deckel und gehst zurück ins Bett.
Im Traum bist du in dem Zimmer, während Jija es tut. Er und Uche sehen so aus, wie du sie das letzte Mal gesehen hast: Jija lacht und hält Uche fest, der auf seinem Knie sitzt. Sie spielen »Erdbeben«, während der Junge kichert und seine Oberschenkel hüpfen und er mit den Armen wedelt, um das Gleichgewicht zu halten. Dann hört Jija plötzlich auf zu lachen, steht auf – wirft Uche zu Boden – und beginnt, auf ihn einzutreten. Du weißt, dass es so nicht passiert ist. Du hast den Abdruck von Jijas Faust gesehen, einen Bluterguss mit vier parallelen Malen auf Uches Bauch und in seinem Gesicht. In dem Traum tritt Jija ihn, weil Träume nicht logisch sind.
Uche lacht weiter und wedelt mit den Armen, als wäre es immer noch ein Spiel, auch dann noch, als Blut sein Gesicht bedeckt.
Du wachst von deinen eigenen Schreien auf, die in Schluchzer übergehen, die du nicht aufhalten kannst. Lerna kommt zu dir, versucht etwas zu sagen, versucht, dich zu umarmen, und schließlich bringt er dich dazu, einen starken, übel riechenden Tee zu trinken. Du schläfst wieder.
»Im Norden ist etwas geschehen«, sagt Lerna zu dir.
Du sitzt auf der Bettkante, er auf einem Stuhl dir gegenüber. Du trinkst noch mehr von dem scheußlichen Tee; dein Kopf schmerzt schlimmer als bei einem Kater. Es ist mitten in der Nacht und schummerig in diesem Zimmer. Lerna hat nur die Hälfte der Lampen angemacht. Zum ersten Mal bemerkst du den seltsamen Geruch in der Luft, der nicht ganz im Lampenrauch untergeht: Schwefel, scharf und beißend. Der Geruch war den ganzen Tag da, ist allmählich schlimmer geworden. Am stärksten ist er, wenn Lerna draußen gewesen ist.
»Seit zwei Tagen ist die Straße vor der Stadt verstopft, weil so viele Leute von dort kommen.« Lerna seufzt und reibt sich über das Gesicht. Er ist fünfzehn Jahre jünger als du, aber das sieht man ihm nicht mehr an. Er hat von Geburt an graue Haare wie viele Cebaki; was ihn aber wirklich älter wirken lässt, sind die neuen Linien in seinem Gesicht – sie und die ebenfalls neuen Schatten in seinen Augen. »Es hat eine Art Beben gegeben. Ein großes, vor zwei Tagen. Wir haben hier nichts davon mitbekommen, aber in Sume …« Sume liegt im nächsten Tal, auf dem Pferderücken einen Tagesritt weit weg. »Die ganze Stadt ist …« Er schüttelt den Kopf.
Du nickst, aber du weißt das alles, ohne dass man es dir sagen muss, oder kannst es zumindest erraten. Als du zwei Tage zuvor in deinem Familienzimmer gesessen und auf die zerstörten Reste deines Kindes gestarrt hast, hat sich etwas auf die Stadt zubewegt: eine so gewaltige Erschütterung der Erde, wie du sie noch nie mentastet hast. Das Wort Beben wird dem nicht gerecht. Was-immer-es-war hätte dazu geführt, dass das Haus über Uche einstürzt, deshalb hast du dem etwas in den Weg gestellt – eine Art Wellenbrecher, eine Mischung aus deinem fokussierten Willen und ein bisschen kinetischer Energie, die du diesem Was-immer-es-war selbst entliehen hast. Dazu musstest du nicht denken; so etwas hätte auch ein Neugeborenes tun können, wenn auch nicht so ordentlich. Das Beben teilte sich und strömte um das Tal herum, dann bewegte es sich weiter.
Lerna leckt sich über die Lippen. Er sieht zu dir hoch und wendet den Blick dann ab. Er ist derjenige, der außer deinen Kindern weiß, wer du bist. Er weiß es schon eine ganze Weile, aber jetzt wird er zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert. Auch darüber kannst du nicht richtig nachdenken.
»Rask lässt niemanden raus oder rein.« Rask ist Rask Innovator Tirimo, das gewählte Oberhaupt der Stadt. »Es ist keine richtige Ausgangssperre, sagt er, noch nicht jedenfalls, aber ich hatte vor, nach Sume zu gehen, um nachzusehen, ob ich helfen kann. Rask hat es verboten und die verdammten Bergleute als Verstärkung der Starkrücken auf die Mauer beordert, während wir Kundschafter rausgeschickt haben. Er hat sie ausdrücklich angewiesen, dafür zu sorgen, dass ich innerhalb der Mauern bleibe.« Lerna ballt die Hände zu Fäusten, und seine Miene wird bitter. »Auf der Imperialen Straße sind Menschen, von denen viele krank und verletzt sind. Und dieser rostverdammte Bastard lässt mich nicht helfen!«
»Bewache als Erstes die Tore«, flüsterst du. Es ist nur ein Krächzen. Nach dem Traum von Jija hast du viel geschrien.
»Was?«
Du nippst noch etwas an dem Tee, um den Schmerz zu lindern. »Steinweisheit.«
Lerna starrt dich an. Er kennt das Zitat; alle Kinder lernen diese Stelle in der Krippe. Alle wachsen mit den Lagerfeuergeschichten über weise Erzähler und schlaue Geomesten auf, die die Skeptiker warnen, wenn die Zeichen sich zeigen und nicht beachtet werden. Und die dann die Menschen retten, wenn die überlieferten Weisheiten sich als wahr erweisen.
»Du denkst also, dass es so weit gekommen ist«, sagt er mit schwerer Stimme. »Beim Feuer unter der Erde, Essun. Das kannst du nicht ernst meinen.«
Aber du meinst es ernst. Und es ist so weit gekommen. Aber du weißt auch, dass er dir nicht glauben wird, wenn du versuchst, es zu erklären, also schüttelst du einfach nur den Kopf.
Eine quälende, anhaltende Stille breitet sich aus. Nach einem langen Moment sagt Lerna vorsichtig: »Ich habe Uche hergeholt. Er ist im Krankenhaus, in der, äh, Kühlkammer. Ich werde mich um die, äh … Vorkehrungen kümmern.«
Du nickst langsam.
Er zögert. »War es Jija?«
Du nickst erneut.
»Du … hast du ihn gesehen?«
»Bin von der Krippe nach Hause gekommen.«
»Oh.« Wieder eine unangenehme Pause. »Es heißt, du hättest einen Tag gefehlt. Vor dem Beben. Sie mussten die Kinder wieder nach Hause schicken, weil sie keine Vertretung für dich finden konnten. Niemand wusste, ob du krank geworden warst oder was sonst los war.«
Ja, nun. Wahrscheinlich hat man dich gefeuert.
Lerna holt tief Luft, atmet aus. Mit dieser Vorwarnung bist du fast vorbereitet. »Das Beben hat uns nicht getroffen, Essun. Es ist um die Stadt herumgezogen. Hat ein paar Bäume zerschlagen und am Fluss eine Felswand zerbröselt.« Der Fluss befindet sich am nördlichsten Ende des Tals, wo niemand eine große, dampfende Chalzedon-Geode bemerkt hat. »Im Innern der Stadt und um sie herum ist allerdings alles vollkommen in Ordnung. In einem fast perfekten Kreis um die Stadt ist alles vollkommen in Ordnung.«
Es gab eine Zeit, da hättest du dich verstellt. Damals hattest du Gründe, es zu tun, denn du musstest ein Leben schützen.
»Ich war das«, sagst du jetzt.
Lernas Kiefer mahlen, aber er nickt. »Ich habe es niemandem gesagt.« Er zögert. »Dass du … äh, orogenisch bist.«
Er ist so höflich und korrekt. Du hast all die hässlicheren Begriffe für das gehört, was du bist. Er auch, aber er würde sie niemals sagen. Auch Jija nicht. Wann immer jemand in seiner Gegenwart ein unbekümmertes »Rogga« hingerotzt hatte, sagte er: »Ich will nicht, dass die Kinder diese Sprache hören.«
Der Schlag kommt schnell. Du beugst dich abrupt vornüber und würgst trocken. Lerna zuckt zusammen, springt auf und greift nach etwas in der Nähe – der Bettpfanne, die du nicht gebraucht hast. Aber es kommt nichts aus deinem Magen, und nach einem Moment hört das Würgen auf. Vorsichtig holst du Luft, einmal, zweimal. Wortlos reicht Lerna dir ein Glas Wasser. Du willst schon eine abwehrende Handbewegung machen, dann besinnst du dich anders und nimmst es. In deinem Mund ist der Geschmack von Galle.
»Ich war das nicht«, sagst du schließlich. Er runzelt verwirrt die Stirn, und du begreifst, dass er denkt, du würdest noch über das Beben reden. »Jija. Er hat das mit mir nicht herausgefunden.« Denkst du. Du solltest nicht denken. »Ich weiß nicht, wie oder was, aber Uche – er ist klein, er hat noch nicht viel Kontrolle. Uche muss etwas getan haben, und dann ist Jija klar geworden …«
Dass deine Kinder so sind wie du. Es ist das erste Mal, dass du diesen Gedanken vollständig ausformulierst.
Lerna schließt die Augen und atmet tief aus. »So ist das also.«
Aber so ist es nicht. Niemals reicht dies aus, damit ein Vater sein eigenes Kind umbringt. Nichts hätte dafür ausreichen dürfen.
Er leckt sich die Lippen. »Willst du Uche sehen?«
Wozu? Du hast ihn zwei Tage lang angestarrt. »Nein.«
Mit einem Seufzer steht Lerna auf, fährt sich mit der Hand durch die Haare.
»Wirst du es Rask sagen?«, fragst du.
Bei dem Blick, den Lerna dir zuwirft, fühlst du dich wie ein Trampel. Er ist wütend. Sonst ist er immer so ruhig und nachdenklich; nie hättest du gedacht, dass er wütend werden kann.
»Ich werde Rask gar nichts sagen«, faucht er. »Ich habe die ganze Zeit nie etwas gesagt und fange nicht jetzt damit an.«
»Aber was …«
»Ich werde versuchen, Eran zu finden.« Eran ist die Wortführerin der Resistenten-Nutzkaste.
Lerna ist in der Nutzkaste der Starkrücken geboren worden, aber nachdem er als Arzt nach Tirimo zurückgekommen war, haben die Resistenten ihn adoptiert; die Stadt hatte bereits genug Starkrücken, und die ebenfalls interessierten Innovatoren verloren das Scherbenwerfen. Auch du hattest gefordert, zur Nutzkaste der Resistenten zu gehören.
»Ich lasse Eran wissen, dass es dir gut geht, und sie kann das dann an Rask weitergeben«, sagt Lerna, »während du dich ausruhen wirst.«
»Wenn sie fragt, warum Jija …«
Lerna schüttelt den Kopf. »Es ahnen ohnehin bereits alle, Essun. Die Leute können eine Karte lesen. Es ist diamantenklar, dass dieses Viertel hier das Zentrum des Kreises ist. In dem Wissen, was Jija getan hat, ist es für niemanden schwer, Antworten auf die Frage nach dem Warum zu finden. Selbstverständlich passt das zeitlich alles nicht zusammen, aber so weit denkt niemand.« Während du ihn anschaust und langsam verstehst, kräuseln sich seine Lippen. »Die Hälfte von ihnen ist entsetzt, aber die Übrigen sind froh, dass Jija es getan hat. Denn natürlich hat ein Dreijähriger die Macht, tausend Meilen entfernt in Yumenes ein Erdbeben auszulösen!«
Du schüttelst den Kopf, halb bestürzt über Lernas Wut und halb unfähig, eine Verbindung zwischen deinem strahlenden, kichernden Jungen und Leuten herzustellen, die denken, er würde … er könnte … andererseits, – Jija hat es gedacht.
Du hast wieder ein flaues Gefühl im Magen.
Lerna holt erneut tief Luft. Er hat das während des Gesprächs immer wieder getan; es ist eine Angewohnheit von ihm, und du hast es schon früher bei ihm erlebt. Es ist seine Art, sich zu beruhigen. »Bleib hier und ruh dich aus. Ich bin bald wieder zurück.«
Er verlässt das Zimmer. Du hörst ihn im vorderen Teil des Hauses geräuschvoll und offenbar zielstrebig hantieren. Dann, nach einigen Momenten, verlässt er das Haus und geht zu seiner Besprechung. Du erwägst, dich auszuruhen, entscheidest dich dann aber dagegen. Stattdessen stehst du auf und gehst in Lernas Badezimmer, wo du dir das Gesicht wäschst, bis das heiße Wasser, das aus dem Hahn kommt, spuckt und braunrot wird und zu riechen beginnt, während es zu einem Tröpfeln verkommt. Irgendwo muss eine Leitung zerbrochen sein.
Im Norden ist etwas passiert, hat Lerna gesagt.
»Kinder sind unser Verderben«, hat vor langer Zeit einmal jemand zu dir gesagt.
»Nassun«, flüsterst du deinem Spiegelbild entgegen. Du siehst die Augen, die deine Tochter von dir geerbt hat, grau wie Schiefer und ein bisschen wehmütig. »Uche hat er im Haus zurückgelassen. Wohin hat er dich gebracht?«
Keine Antwort. Du drehst den Wasserhahn zu. Dann flüsterst du zu niemand Bestimmtem: »Ich muss jetzt gehen.« Denn das musst du. Du musst Jija finden, und du bist ohnehin klug genug, um zu wissen, dass du hier nicht länger bleiben solltest. Schon bald werden die Leute dieser Stadt kommen, um dich zu holen.
Das vorbeiziehende Beben wird einen Nachhall erzeugen. Die abebbende Welle wird zurückkehren. Der grollende Berg wird brüllen.
– Erste Tafel, »Über das Überleben«, Vers fünf
2
Damaya, vor vielen Wintern
Das Stroh ist so warm, dass Damaya nicht herauskommen möchte. Wie eine Decke, denkt sie im Halbschlaf. Wie die Steppdecke, die ihre Urgroßmutter einst für sie aus Resten von Uniformen gemacht hat. Muh Dear arbeitete viele Jahre vor ihrem Tod als Näherin für die Brevard-Miliz und sie durfte die Reste behalten, die bei irgendwelchen Flickarbeiten anfielen. Die Decke, die sie für Damaya genäht hat, ist gefleckt und dunkel; Marineblau und Graubraun und Grau und Grün ziehen sich in wogenden Bändern dahin, wie Kolonnen marschierender Männer. Aber weil sie von Muh Dear ist, hat es Damaya nie etwas ausgemacht, dass die Decke hässlich ist. Sie riecht immerzu süß und grau und ein bisschen muffig, und daher fällt es Damaya jetzt leicht, sich vorzustellen, dass das Stroh – das nach Schimmel und altem Dung riecht, mit einer Spur Pilz darin – Muhs Decke ist. Die richtige Decke hat Damaya auf dem Bett in ihrem Zimmer zurückgelassen. Auf dem Bett, in dem sie nie wieder schlafen wird.
Sie hört von draußen Stimmen; Mama unterhält sich mit jemandem, während sie näher kommen. Es knarrt und rattert, als sich die Scheunentür öffnet, dann treten sie ein. Wieder rattert es, als die Tür sich hinter ihnen schließt. Dann erhebt Mutter die Stimme und ruft: »DamaDama?«
Damaya rollt sich zusammen und beißt die Zähne aufeinander. Sie hasst diesen dummen Spitznamen. Sie hasst die Art und Weise, wie Mutter ihn ausspricht, ganz leicht und süß, als wäre er tatsächlich ein Kosewort und keine Lüge.
Als Damaya nicht antwortet, sagt Mutter: »Sie kann unmöglich rausgekommen sein. Mein Mann hat die Schlösser der Scheune selbst überprüft.«
»Leider lässt sich ihre Art durch Schlösser nicht festhalten.« Die Stimme gehört einem Mann. Es ist nicht ihr Vater und auch nicht ihr älterer Bruder oder das Oberhaupt dieser Gem oder sonst jemand, den Damaya kennt. Die Stimme klingt tief, und der Mann hat einen Akzent, den sie noch nie gehört hat: scharf und schwer, mit lang gezogenen Os und As, und die Worte haben alle knappe Anfänge und Enden. Er klingt irgendwie schlau. Es bimmelt, während er geht, so sehr, dass sie sich fragt, ob er einen großen Schlüsselbund mit sich herumträgt. Oder vielleicht hat er viel Geld in den Taschen? Sie hat davon gehört, dass in manchen Teilen der Welt die Menschen Metallgeld benutzen.
Bei dem Gedanken an Schlüssel und Geld macht sich Damaya noch kleiner, denn in der Krippe hat sie mitbekommen, wie andere Kinder über Kindermärkte getuschelt haben, die es in weit entfernten Städten gibt, die nur aus gebrochenen Steinen bestehen. Nicht alle Orte sind so zivilisiert wie die Nordmittbreiten. Sie hat sich damals mit einem Lachen von den getuschelten Worten befreit, aber jetzt ist alles anders.
»Da«, sagt die Männerstimme nicht sehr weit weg von ihr. »Frische Spuren, schätze ich.«
Mutter gibt ein Geräusch von sich, das verrät, wie angewidert sie ist, und Damaya spürt brennende Scham in sich aufsteigen. Sie müssen die Ecke gesehen haben, die sie als Toilette benutzt. Es stinkt schrecklich dort, obwohl sie jedes Mal Stroh darüber geworfen hat. »Hockt sich auf den Boden wie ein Tier. Ich habe sie besser erzogen.«
»Gibt es hier eine Toilette?«, fragt der Kinderkäufer im Ton höflicher Neugier. »Haben Sie ihr einen Eimer gegeben?«
Mutter antwortet mit Schweigen, das sich in die Länge zieht, und erst jetzt begreift Damaya, dass der Mann sie mit seinen ruhigen Fragen gerügt hat. Das ist nicht die Art Rüge, die Damaya gewöhnt ist. Der Mann hat weder seine Stimme erhoben noch irgendwelche Schimpfwörter benutzt. Und doch steht Mutter genauso still und bestürzt da, als hätte er den Worten einen Schlag gegen den Kopf folgen lassen.
Ein Kichern bildet sich in Damayas Kehle, und sofort stopft sie sich die Faust in den Mund, damit es nicht nach draußen dringt. Wenn sie hörten, dass Damaya sich über die Verlegenheit ihrer Mutter amüsiert, würde der Kinderkäufer wissen, was für ein schreckliches Kind sie ist. Aber wäre das so schlimm? Vielleicht bekommen ihre Eltern dann weniger für sie. Die Vorstellung genügt fast, dass sich ihr Kichern doch den Weg ins Freie bahnt, denn Damaya hasst ihre Eltern, sie hasst sie, und was immer ihre Eltern leiden lassen würde, sorgt dafür, dass sie sich besser fühlt.
Dann beißt sie sich auf die Hand, fest, und hasst sich selbst, denn natürlich werden ihre Eltern sie verkaufen, wenn sie fähig ist, so etwas zu denken.
Schritte erklingen in der Nähe. »Es ist kalt hier«, sagt der Mann.
»Wir hätten sie im Haus behalten, wenn es Frost gegeben hätte«, sagt Mutter, und wieder kichert Damaya fast, als sie ihren mürrischen, abwehrenden Ton hört.
Der Kinderkäufer geht nicht darauf ein. Seine Schritte kommen näher, und sie sind … seltsam. Damaya kann Schritte mentasten. Die meisten Leute können das nicht; sie können nur große Dinge erfassen, Erdbeben und so was, aber nicht so etwas Feines wie einen Schritt. (Sie weiß dies schon ihr ganzes Leben lang, aber erst vor Kurzem ist ihr klar geworden, dass diese Fähigkeit eine Vorwarnung ist.) Es ist für sie schwerer, etwas wahrzunehmen, wenn sie keinen direkten Kontakt zum Boden hat und sich alles durch das Holz der Scheune und das Metall der Nägel, die sie zusammenhalten, mitteilt – aber obwohl Damaya ein Stockwerk über ihnen ist, weiß sie, womit sie zu rechnen hat. Bumm bumm, ein Schritt und dann der Nachklang in der Tiefe, bumm bumm, bumm bumm. Die Schritte des Kinderkäufers gehen jedoch nirgendwohin und klingen nicht nach. Sie kann sie nur hören, aber nicht mentasten. So etwas ist ihr noch nie passiert.
Und jetzt kommt er die Leiter zum Dachboden hoch, wo sie unter dem Stroh liegt.
»Ah«, sagt er, oben angekommen. »Hier oben ist es wärmer.«
»DamaDama!« Mutter klingt jetzt wütend. »Komm sofort runter!«
Damaya kauert sich unter dem Stroh zusammen und sagt nichts. Die Schritte des Kinderkäufers kommen näher.
»Hab keine Angst«, sagt er mit seiner schwingenden Stimme. Noch näher. Sie spürt den Nachhall seiner Stimme durch das Holz und hinunter zum Boden und in den Felsen und wieder zurück. Näher. »Ich bin gekommen, um dir zu helfen, Damaya Starkrücken.«
Noch etwas, was sie hasst: ihren Nutznamen. Sie hat gar keinen starken Rücken und Mutter auch nicht. »Starkrücken« bedeutet nur, dass ihre weiblichen Vorfahren das Glück gehabt hatten, einer Gem beitreten zu dürfen, aber zu mittelmäßig gewesen waren, um einen sichereren Platz darin zu verdienen. Starkrücken werden genauso fallen gelassen wie Gemlose, wenn die Zeiten hart sind, hatte ihr Bruder Chaga einmal zu ihr gesagt, um sie aufzuziehen. Dann hatte er gelacht, als wäre es witzig. Als wäre es nicht wahr. Natürlich ist Chaga ein Resistenter, wie Vater. Und alle Gems haben solche Leute gern bei sich, ganz egal, wie schwer die Zeiten auch werden, für den Fall, dass es Krankheiten und Hungersnöte gibt oder so.
Die Schritte des Mannes verklingen genau da, wo das Stroh anfängt. »Hab keine Angst«, sagt er noch einmal, diesmal weicher. Mutter ist noch unten und kann ihn wahrscheinlich nicht hören. »Ich werde nicht zulassen, dass deine Mutter dir wehtut.«
Damaya atmet heftig ein.
Sie ist nicht dumm. Der Mann ist ein Kinderkäufer, und Kinderkäufer tun schreckliche Dinge. Aber weil er diese Worte gesagt hat und weil ein Teil von Damaya es leid ist, Angst zu haben und wütend zu sein, streckt sie sich. Sie schiebt sich durch den weichen warmen Strohhaufen und setzt sich auf, blickt den Mann durch ihre Locken und das schmutzige Stroh hindurch an.
Er sieht genauso seltsam aus, wie er klingt, und er kann nicht aus der Nähe von Palela stammen. Seine Haut ist fast weiß, er wirkt papierbleich; wenn die Sonne brennt, wird er bestimmt qualmen und sich zusammenkringeln. Er hat lange, glatte Haare, was zusammen mit seiner Haut darauf hindeutet, dass er ein Arktiker ist, auch wenn die Haarfarbe nicht passt, denn sie ist tiefschwarz wie die Erde in der Nähe eines alten Vulkans. Ostküstenbewohner haben so schwarze Haare, allerdings sind deren Haare flauschig und nicht glatt, und sie haben die passende schwarze Haut dazu. Der Kinderkäufer ist groß – größer als Vater, und er hat breitere Schultern als er. Aber während Vaters Schultern mit einer großen Brust und einem großen Bauch einhergehen, verjüngt sich dieser Mann nach unten hin. Alles an dem Fremden wirkt hager und abgeschwächt. Nichts davon ergibt im Hinblick auf seine Rasse irgendeinen Sinn.
Aber was Damaya am meisten verblüfft, sind die Augen des Kinderkäufers. Sie sind weiß, oder zumindest fast weiß. In dem normalen Weiß seiner Augen ist eine silbergraue Scheibe, deren Farbe Damaya kaum von dem umgebenden Weiß unterscheiden kann, nicht einmal aus der Nähe. Die Pupillen sind im schummerigen Licht der Scheune weit geöffnet und wirken in der farblosen Einöde verblüffend. Sie hat von solchen Augen, die als eisweiß bezeichnet werden, in Geschichten und Steinweisheiten gehört: Sie kommen selten vor, und sie sind immer ein schlechtes Omen.
Aber dann lächelt der Kinderkäufer Damaya an, und sie lächelt zurück, ohne nachzudenken. Sie vertraut ihm sofort. Sie weiß, dass sie es nicht tun sollte, aber sie tut es.
»Da bist du also«, sagt er so leise, dass Mutter es nicht hören kann. »DamaDama Starkrücken, vermute ich?«
»Nur Damaya«, sagt sie automatisch.
Er neigt würdevoll den Kopf und reicht ihr eine Hand. »Schon vermerkt. Wirst du dich uns anschließen, Damaya?«
Damaya rührt sich nicht, und er packt sie auch nicht. Er bleibt da, wo er ist, geduldig wie Stein, reicht ihr nur die Hand, ohne nach ihrer zu greifen. Zehn Atemzüge verstreichen. Zwanzig. Damaya weiß, dass sie mit ihm gehen muss, aber es gefällt ihr, dass er es so aussehen lässt, als hätte sie eine Wahl. Und so nimmt sie schließlich seine Hand und lässt sich von ihm hochziehen. Er hält ihre Hand fest, während sie sich so viel wie möglich von dem Stroh abstreift, dann zieht er sie ein kleines bisschen näher zu sich heran. »Einen Moment.«
»Was?« Aber da ist die andere Hand des Kinderkäufers bereits hinter ihrem Kopf, und zwei Finger drücken so schnell und geschickt unten gegen ihre Schädelbasis, dass sie nicht einmal zusammenzuckt. Er schließt die Augen, zittert kurz und lässt sie dann los, während er ausatmet.
»Zuerst die Pflicht«, sagt er kryptisch. Sie fasst sich verwirrt an den Hinterkopf; noch immer kann sie den Druck seiner Finger dort spüren. »Gehen wir jetzt nach unten.«
»Was hast du gemacht?«
»Nur so was wie ein kleines Ritual. Dadurch wird es mir leichter fallen, dich zu finden, solltest du einmal verloren gehen.« Sie hat keine Ahnung, was er damit meint. »Komm jetzt. Ich muss deiner Mutter sagen, dass du mit mir weggehen wirst.«
Also stimmt es wirklich. Damaya beißt sich auf die Lippe, und als der Mann sich umdreht und zur Leiter zurückgeht, folgt sie ihm im Abstand von ein oder zwei Schritten.
»So, das wäre also erledigt«, sagt der Kinderkäufer, als sie den Boden erreichen und zu Mutter treten. (Mutter seufzt bei ihrem Anblick, vielleicht, weil sie genervt ist.) »Wir machen uns auf den Weg, sobald Sie ein paar Sachen für sie zusammengepackt haben – ein oder zwei Sätze Kleidung zum Wechseln, Reiseproviant, sofern das möglich ist, und einen Mantel.«
Mutter strafft sich überrascht. »Wir haben ihren Mantel weggegeben.«
»Weggegeben? Im Winter?«
Er spricht sanft, aber Mutter scheint sich schlagartig unbehaglich zu fühlen.
»Eine Kusine von ihr hat ihn gebraucht. Nicht alle von uns haben volle Kleiderschränke. Und …« Mutter zögert und sieht Damaya an, die dem Blick ausweicht. Sie will nicht sehen, ob es Mutter leidtut, dass sie den Mantel weggegeben hat. Erst recht will sie nicht sehen, dass es Mutter nicht leidtut.
»Und Sie haben gehört, dass Orogenen Kälte nicht so empfinden wie andere Menschen«, sagt der Mann und seufzt müde. »Es ist ein Mythos. Und vermutlich haben Sie auch schon erlebt, dass Ihre Tochter sich erkältet hat.«
»Oh.« Mutter wirkt nervös. »Sicher, aber ich dachte …«
Dass Damaya vielleicht nur so getan hat, als wäre sie erkältet. Das hat sie zu ihr gesagt, als Damaya gerade von der Krippe nach Hause gekommen war und sie sie in die Scheune gesteckt haben. Mutter war wütend gewesen, ihr Gesicht tränenverschmiert, aber Vater hatte einfach nur dagesessen, stumm und mit weißen Lippen. Damaya habe es vor ihnen verborgen, hatte Mutter gesagt, habe alles verborgen und so getan, als wäre sie ein Kind, während sie doch in Wirklichkeit ein Monster sei, denn genau so machten es Monster, und sie habe immer gewusst, dass mit Damaya etwas nicht stimme, sie sei schon immer eine richtige kleine Lügnerin gewesen …
Der Mann schüttelt den Kopf. »Trotzdem wird sie irgendeinen Schutz gegen die Kälte brauchen. Wenn wir uns den Äquatorialen nähern, wird es zwar wärmer, aber wir werden wochenlang unterwegs sein, bis wir dort ankommen.«
Mutters Kiefermuskeln mahlen. »Dann bringen Sie sie also wirklich nach Yumenes.«
»Natürlich bringe ich sie …« Der Mann starrt sie an. »Oh.« Er sieht Damaya an. Beide sehen Damaya an, und ihre Blicke sind wie ein Juckreiz. Sie windet sich. »Sie haben mich also vom Gem-Oberhaupt herholen lassen, obwohl Sie dachten, dass ich kommen würde, um Ihre Tochter zu töten.«
Mutter strafft sich. »Nein. Ich meine, es war nicht … ich habe nicht …« Sie ballt kurz die Hände, die bislang reglos herunterhingen. Dann neigt sie den Kopf, als würde sie sich schämen, was eine Lüge ist, wie Damaya weiß. Mutter schämt sich niemals für das, was sie getan hat. Denn wenn sie sich schämen würde, warum hätte sie es dann getan?
»Normale Menschen können sich nicht um Kinder kümmern, die … so wie sie sind«, sagt Mutter sehr leise. Ihr Blick fliegt nur einmal kurz zu Damaya. »Fast hätte sie in der Krippe einen Jungen getötet. Wir haben noch ein anderes Kind und Nachbarn und …« Sie drückt abrupt die Schultern durch und hebt das Kinn. »Es ist außerdem die Pflicht eines Bürgers, oder nicht?«
»Ja, das stimmt alles. Ihr Opfer wird die Welt für alle besser machen.« Die Worte, das Lob, sind eine Floskel. Der Ton ist es nicht. Damaya sieht den Mann an, verwirrt darüber, dass Kinderkäufer keine Kinder töten. Das widerspricht allem, was sie weiß. Und was war das mit den Äquatorialen? Diese Länder liegen weit, weit im Süden.
Der Kinderkäufer sieht Damaya an und begreift, dass sie nichts versteht. Sein Gesicht wird weicher, was bei seinen furchterregenden Augen eigentlich gar nicht möglich sein dürfte.
»Ja, ich bringe sie nach Yumenes«, sagt der Mann zu Damaya und zu Mutter. »Sie ist jung genug, deshalb bringe ich sie zum Fulcrum. Dort wird sie ausgebildet werden und lernen, mit ihrem Fluch umzugehen. Auch ihr Opfer wird die Welt besser machen.«
Damaya starrt ihn an und fängt an zu begreifen, wie sehr sie sich geirrt hat. Mutter hat Damaya nicht verkauft. Sie und Vater geben sie weg. Und Mutter hasst sie nicht; sie hat vielmehr Angst vor ihr. Ist das ein Unterschied? Vielleicht. Damaya weiß nicht, wie sie sich bei diesen Enthüllungen fühlen soll.
Und dieser Mann … dieser Mann ist gar kein Kinderkäufer. Er ist …
»Bist du ein Wächter?«, fragt sie, obwohl sie es bereits weiß. Er lächelt wieder. So hat sie sich Wächter nicht ausgemalt. In ihrer Vorstellung sind sie groß, kaltgesichtig und strotzen nur so vor Waffen und geheimem Wissen. Zumindest ist der Fremde groß.
»Das bin ich«, sagt er und nimmt ihre Hand. Er berührt Menschen gern, denkt sie. »Ich bin dein Wächter.«
Mutter seufzt. »Ich kann ihr eine Decke mitgeben.«
»Das wird genügen, danke.«
Dann schweigt der Mann. Ein paar Atemzüge vergehen, bis Mutter begreift, dass sie gehen und die Decke holen soll. Sie nickt ruckartig, dann verlässt sie die Scheune mit steifem Rücken. Jetzt ist Damaya allein mit dem Mann.
»Hier«, sagt er und fasst an seine Schultern. Das, was er trägt, muss eine Uniform sein: Die Schulterpartie ist kantig, die langen Ärmel und Hosenbeine sind aus einem steifen, burgunderroten Stoff, der robust, aber auch kratzig wirkt. Wie die Flickendecke von Muh. Ein Umhang ist daran befestigt, der mehr zur Dekoration zu dienen scheint, als nützlich zu sein. Er nimmt ihn ab und legt ihn Damaya über die Schultern. Der Umhang ist lang genug, dass er bei ihr wie ein Kleid aussieht, und er ist noch warm von seinem Körper.
»Danke«, sagt sie. »Wer bist du?«
»Ich bin Schaffa Wächter Vollmacht.«
Sie hat noch nie von einem Ort namens Vollmacht gehört, aber er muss existieren, denn welchen Nutzen hat ein Gem-Name sonst? »Ist Wächter ein Nutzname?«