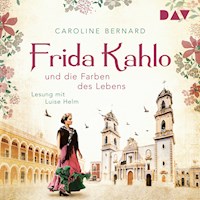13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Lisa Fittko war unbeugsam und couragiert. Ihr Mut soll niemals vergessen werden.“ Caroline Bernard.
Frankreich 1940: Seit die Nazis an der Macht sind, ist Lisa im Widerstand. Als feindliche Ausländerin wird sie in Südfrankreich interniert. Um den vorrückenden Deutschen nicht in die Hände zu fallen, flieht sie in letzter Minute. In Marseille versucht Lisa mit ihrem Mann Hans verzweifelt, an Ausreise-Visa zu kommen. Dabei trifft sie den Amerikaner Louis. Sie verlieben sich Hals über Kopf. Louis steht für alles, wonach sie sich sehnt: Sicherheit, Verlässlichkeit, Zärtlichkeit. Dann bekommt sie den Auftrag, in den Pyrenäen eine geheime Fluchtroute für deutsche Exilanten zu finden und plötzlich muss sie sich entscheiden: Folgt sie Louis und ihrem Wunsch nach Liebe oder kämpft sie weiter für Gerechtigkeit und Freiheit? Und für das Leben so vieler Menschen?
Der neue Roman der Autorin von „Frida Kahlo und die Farben des Lebens“ – die Schicksalsgeschichte einer Frau zwischen politischem Widerstand und dem Wunsch nach persönlichem Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Caroline Bernard
Die Wagemutige
Sie ist im Widerstand, sie kämpft für die Freiheit – und für die Liebe
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog — Berlin, 2. April 1933
Kapitel 1 — Camp de Gurs, Pyrenäen, Ende Mai 1940
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14 — Marseille, Sommer 1940
Kapitel 15 — Bahnhof von Toulouse, Sommer 1940
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25 — Banyuls, August 1940
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Berlin, 2. April 1933
Schon seit einer halben Stunde wartete Lisa in der nächtlichen Kälte. Als sie bei ihrer letzten Zusammenkunft überlegt hatten, wer zu der Übergabe gehen sollte, hatte sie sich gemeldet. »Du? Aber das ist gefährlich«, hatte Willi gesagt. Auch jetzt noch spürte Lisa Ärger in sich aufsteigen. Wie jedes Mal, wenn sie das Gefühl hatte, dass man ihr etwas nicht zutraute, nur, weil sie eine Frau war. »Ich finde, es reicht, wenn die Nazis glauben, dass Frauen zu schwach sind, um sich ihnen zu widersetzen. Ihr solltet mir mehr zutrauen. Gib mir das Material.« Sie hatte den Arm nach dem Umschlag ausgestreckt, und damit war die Sache entschieden.
Bei der Erinnerung lächelte sie grimmig und zog den viel zu dünnen Mantel enger um sich. In den Nylonstrümpfen und den geliehenen hochhackigen Schuhen fror sie entsetzlich. Warum hatte sie sich keine andere Tarnung ausgesucht als die einer Frau auf dem Heimweg vom Theater? Sie rieb ihre kalten Hände aneinander und strich das geblümte Seidentuch, das ebenfalls nicht ihr gehörte, an den Schläfen glatt.
Wo blieb ihr Kontaktmann denn nur? Unauffällig schielte sie auf ihre Armbanduhr. Fast Mitternacht. Noch fünf Minuten, dann würde sie die Aktion abbrechen. Zu ihrem eigenen Schutz. Das war die Regel. Wenn jemand sich mehr als zehn Minuten verspätete, war meistens etwas schiefgegangen, und man sah zu, dass man wegkam.
Lisa trat einen Schritt zurück in den Hauseingang, um sich vor dem unangenehmen Wind zu schützen. Ihr Blick fiel auf die zerbrochenen Fensterscheiben eines Geschäfts für Schirme und Spazierstöcke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Trotz der Dunkelheit konnte sie den Aufruf, den jemand in dicken weißen Lettern auf die Tür geschrieben hatte, gut lesen: Deutsche, kauft nicht bei Juden. Gestern hatten die Nazis einen Boykott jüdischer Läden und Unternehmen ausgerufen.
Wieder sah Lisa die SA-Männer vor sich, die breitbeinig vor den Geschäften standen und feixten, während ihre Kameraden Scheiben einwarfen und Türen und Wände beschmierten. Direkt vor ihr war ein Mann auf die Straße gezerrt und verprügelt worden, während man seinen Milchladen verwüstete. Unter dem Gejohle der Schaulustigen färbte sich die Straße weiß, als ein Uniformierter Milchkanne um Milchkanne auf den Fußweg leerte. Allein bei der Erinnerung flammten Wut und Ekel in ihr auf. So viele hatten einfach nur dabeigestanden und Beifall geklatscht. Anderen war anzusehen, dass sie genauso fassungslos wie sie waren und sich schämten. Eine junge Frau machte Anstalten, dem Mann aufzuhelfen, aber die drohenden Gebärden der SA-Männer ließ sie zurückweichen. Lisa sah Tränen in ihren Augen. Dann hatte ihre eigene Wut überhandgenommen. Sie konnte das nicht einfach so geschehen lassen. Ohne weiter nachzudenken, zwängte sie sich durch die Gruppe der SA-Männer, die sich vor dem benachbarten kleinen Schuhladen postiert hatten, um Kunden am Eintreten zu hindern. Sie waren zu verblüfft, um sie aufzuhalten. Da sieht man mal wieder, wie dumm diese Leute sind, dachte sie voller Abscheu. Sobald man nicht das tut, was sie erwarten, sind sie machtlos. Ihr Blick fiel auf das Schaufenster, auf dem jüdisches Geschäft stand, dann betrat sie den Verkaufsraum.
»Das sollten Sie nicht tun, meine Dame«, sagte der Besitzer zu ihr, der hinter seinem Tresen stand und ängstlich das Treiben auf der Straße verfolgte, wo die SA-Männer inzwischen lärmend weiterzogen.
»Die da draußen sollten das nicht tun«, entgegnete Lisa und betrachtete demonstrativ die Auslage, bis auch der letzte Uniformierte abgezogen war.
»Ich danke Ihnen«, sagte der Mann mit zitternder Stimme. »Wenn Sie nicht hier gewesen wären, hätten sie auch mein Geschäft verwüstet, und wer weiß …« Er schenkte ihr ein dünnes Lächeln.
Als Lisa wieder auf der Straße stand, atmete sie tief durch. Ein Gefühl des Triumphs überkam sie, das jedoch schnell dem Schrecken über die Gefahr, der sie sich gerade ausgesetzt hatte, wich. Was wäre gewesen, wenn die Nazis sie nach ihren Papieren gefragt hätten? Sie war selbst Jüdin und zudem eine Illegale. Im Februar hatte sie ihre Arbeit bei einer Bank verloren, weil man dort ihre linke Gesinnung kannte. Ein befreundeter Polizist hatte sie gewarnt. Sie solle sofort untertauchen, die Gestapo hatte ihren Namen und wusste, wo sie wohnte. Nachdem sie ein paar sehr ungemütliche Nächte auf Friedhöfen zugebracht hatte, hatte sie Unterschlupf bei zwei Schwestern gefunden, die ihr nachts das Hinterzimmer ihres Bonbongeschäfts zur Verfügung stellten. Tagsüber irrte sie durch Kaufhäuser, Cafés und U-Bahnstationen, nachts tippte sie auf ihrer Schreibmaschine Flugblätter und versuchte Schlaf zu finden.
Sie trat von einem Fuß auf den anderen und spähte die Straße hinunter. Wo blieb ihr Kontaktmann nur? Unwillkürlich tastete sie nach dem Umschlag mit den Berichten und den Fotos, der unter ihrem Mantel im Bund ihres Rockes klemmte. Eine Ecke drückte unangenehm in ihre Rippen. Berichte von Genossen, die es lebend aus den Folterkellern der Nazis geschafft hatten. Lisa wurde übel, wenn sie an die Methoden dachte, mit denen sie gequält worden waren: Schläge auf die nackten Fußsohlen, brutale Prügel mit Stöcken, Schlafentzug … In den Aufzeichnungen standen auch die Namen von Männern und Frauen, die den Aufenthalt in den Gestapokellern nicht überlebt hatten. Siebenundzwanzig Namen. Lisa hatte sie auswendig gelernt und flüsterte sie vor sich hin. »Hermann Müller, Elfriede Temming, Rudi Wolterstein …« Diese mutigen Menschen durften niemals vergessen werden. Indem sie ihre Namen aufsagte, fühlte sie sich ihnen zugehörig. Und es gab ihr die nötige Kraft, ihre Angst zu besiegen.
Sie machte einen Schritt nach vorn und trat aus dem Windschatten des Hauseingangs. In diesem Augenblick fuhr ein Auto vorüber. Wasser spritzte an ihre Beine. Die Nässe drang durch die Strümpfe bis auf ihre Haut. Sie spürte ihre Zehen kaum noch. Nervös sah sie auf die Uhr. Ihr Kontaktmann war jetzt sieben Minuten zu spät. Irgendetwas musste passiert sein.
Dann sah sie aus den Augenwinkeln, wie sich ein großer schlaksiger Mann in einem Wollmantel, um den Lisa ihn glühend beneidete, auf der anderen Straßenseite in ihre Richtung bewegte. Er hielt einen Schirm über dem Kopf. Als er eine Straßenlaterne passierte, konnte sie die runde Hornbrille sehen, die sein Gesicht dominierte. Er blieb kurz stehen und blickte sich um. Dabei zog er die Hand aus der Manteltasche und schob die Brille mit dem Zeigefinger die Nase hinauf.
Das könnte er sein, dachte Lisa und zog die Zigarettenschachtel aus der Handtasche.
Der Mann kam weiter auf sie zu und fing an zu lächeln. Jetzt erkannte Lisa den kleinen Stars-and-Stripes-Anstecker an seinem Mantelkragen. Er war so viel schöner als die verdammten Hakenkreuze, die jetzt alle stolz vor sich hertrugen. Aber sie musste vorsichtig sein. Auch ein SA-Mann konnte sich so einen Anstecker besorgen, es konnte auch ein Hinterhalt sein.
Sie trat einen Schritt auf den Fremden zu. »Haben Sie Feuer?«
»Oh, aber sicher.« Er sprach Deutsch, aber der amerikanische Akzent war herauszuhören.
Lisa ließ sich Feuer geben, nahm einen tiefen Zug und sah ihn auffordernd an.
Ihr Gegenüber entspannte sich sichtlich. »Mein Name ist Valerian«, sagte er und zündete sich ebenfalls eine Zigarette an.
Lisa atmete erleichtert aus. Das war der Codename. Er war es. Sie nahm ihr Seidentuch ab, von dem die Tropfen ihr in die Stirn rannen. Auch das war Teil der Verabredung.
»Sie sind spät. Fast wäre ich gegangen.«
Sofort verhärtete sich sein Gesicht. »Es hat einen Zwischenfall gegeben. In dem Café, in dem ich war. Zwei SA-Männer und ein Jude.« Mehr musste er nicht sagen.
»Deshalb machen wir das hier«, sagte Lisa, »damit die Welt erfährt, was in Deutschland passiert.«
Der Mann, der sich Valerian nannte und dessen richtigen Namen sie wohl niemals erfahren würde, nahm sie am Arm, und sie gingen rasch die Straße hinunter. Ein Paar, das auf dem Heimweg war und sich beeilte, dem scheußlichen Wetter zu entkommen.
Während sie gingen, knöpfte Lisa ihren Mantel auf und zog den Umschlag hervor. Sie reichte ihn dicht vor ihrem Körper weiter, Valerian nahm ihn und ließ ihn geschickt in seiner großen Manteltasche verschwinden. Die Bewegungen waren beiläufig und unauffällig, niemand, der zufällig hinter ihnen ging, hätte sie bemerkt.
»Passen Sie auf sich auf«, sagte er, bevor sie sich an der nächsten Straßenecke trennten. Lisa nickte, dann ging sie in die entgegengesetzte Richtung davon. Sie griff nach der Wollmütze in ihrer Tasche und setzte sie auf. Da vorn war die Haltestelle für den Bus. Sie freute sich schon, ins Warme zu kommen, als sie hinter sich plötzlich eilige Schritte hörte, die immer näher kamen. Ihr Herz fing an zu wummern. Für einen Moment war sie unaufmerksam gewesen. Seit wann waren diese Schritte da?
»Hallo, bleiben Sie stehen«, hörte sie eine männliche Stimme rufen.
Kalter Schweiß brach ihr aus. Sie wagte nicht sich umzusehen. Die Schritte hinter ihr wurden schneller. Sie könnte versuchen wegzulaufen, aber in diesen Schuhen wäre sie niemals schnell genug. Sie saß in der Falle. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals.
»Gnädige Frau, jetzt warten Sie doch. Ihr Tuch!«
Langsam drehte sie sich um. Ein Mann kam auf sie zu und trug ihr Seidentuch am langen Arm vor sich her. »Ich glaube, das haben Sie verloren.«
Lisa hatte sich sofort wieder unter Kontrolle. »Ach, das ist aber nett. Ich hänge sehr an diesem Tuch, wissen Sie? Es ist ein Geschenk meines Mannes zum Hochzeitstag.«
»Dann sollten Sie besser darauf achtgeben.« Der Mann reichte es ihr und tippte sich zum Abschied an den Hut, bevor er weiterging.
Lisa schloss kurz die Augen, dann hielt sie sich die Hand vor den Mund und atmete heftig ein und aus. Doch gerade, als sie sich einigermaßen wieder beruhig hatte, hörte sie einen Tumult, Männer brüllten durcheinander, ein Schrei gellte durch die Nacht. Hektisch blickte sie sich um. Am Ende der Straße glaubte sie Uniformen zu erkennen. Den Umriss einer Person, die am Boden lag. War das etwa der Amerikaner? Ihr Herzschlag setzte aus. Er würde als Ausländer vielleicht davonkommen, wenn die Polizei aber die Dokumente in seiner Tasche fand … Sie konnte nichts für ihn tun. Sie stopfte das Tuch in die Manteltasche und eilte weiter.
Kapitel 1
Camp de Gurs, Pyrenäen, Ende Mai 1940
Lisa erwachte mit einem Lächeln. Sie und Hans hatten nach einem Picknick im sonnenwarmen Gras gelegen. Als sie die Augen aufschlug, spürte sie noch seinen Kuss auf ihren Lippen und wusste nicht gleich, wo sie sich befand. Verwirrt sah sie sich um. Lag sie in dem schmalen Klappbett, das in der Küche in Prag eingezwängt zwischen Herd und Fenster stand? Oder war sie in dem billigen Hotelzimmer mit der geblümten Tapete und dem zweiflammigen Gasherd in Paris, zusammen mit Hans und in Sicherheit? Staub kitzelte in ihrer Nase, sie musste niesen.
»Willkommen im Grand Hotel«, hörte sie Paulettes Stimme.
Schlagartig wusste Lisa, wo sie sich befand. Auf ihrem Strohsack in einer Baracke des riesigen Internierungslagers für Frauen am Rand der französischen Pyrenäen. Nachdem Hitlers Armee in Frankreich einmarschiert war, hatte man hier Deutsche, die vor Hitler geflohen waren, als sogenannte »feindliche Ausländer« eingesperrt.
»Haben Madame wohl geruht?«, frage Paulette, und Lisa musste unwillkürlich lachen.
Paulettes richtiger Name war Paula, aber das klang zu deutsch. Paulas Vater hatte für die Kommunisten im Reichstag gesessen und gegen die U-Boot-Kredite gestimmt. Als Hitler an die Macht kam, mussten er und seine Tochter sofort aus Deutschland verschwinden. Das war das Erste, was ihr Paulette erzählte, als sie sich in Paris auf der Polizeipräfektur getroffen und stundenlang für die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnisse angestanden hatten. Vor zwei Wochen waren sie sich im Pariser Sportstadion Vélodrome d’Hiver wieder über den Weg gelaufen. Nach dem deutschen Einmarsch mussten sich alle Frauen, die einen deutschen Pass besaßen, hier einfinden. Zusammen mit Tausenden anderen campierten sie unter primitivsten Bedingungen auf den Tribünen. Paulettes direkte Art hatte Lisa von Anfang an gefallen. Sie hatte Humor und sie war ein Dickkopf. Mit ihrem flammend roten Haar fiel sie überall auf. Sie war das Gegenteil von konspirativ, aber bisher war sie damit überall durchgekommen. Für Lisa war es ein Segen, Paulette an ihrer Seite zu haben. In diesen Tagen fiel es schwer, jemanden zu finden, dem man nicht nur vertrauen, sondern mit dem man auch lachen konnte. Seit verkündet worden war, dass man sie alle in den Süden transportieren werde, hatten sie beschlossen, um jeden Preis zusammenzubleiben. Jetzt war es wichtiger denn je, zusammenzuhalten.
Heute war ihr dritter Morgen im Lager. Davor waren sie tagelang in einem völlig überfüllten Zugabteil eingesperrt gewesen, dessen Fenster geschwärzt waren, so dass sie weder wussten, ob es draußen hell oder dunkel war, noch wo sie sich befanden. Zweimal am Tag wurde die Tür geöffnet, sie bekamen etwas zu essen und zu trinken und durften auf die Toilette. Ihre flehentlichen Fragen, wohin man sie brachte, wurden nicht beantwortet. Wenn sie in einem Bahnhof hielten, versuchten sie die Namen der Orte zu lesen, manchmal flogen Steine gegen die Fenster. Die Franzosen hielten sie für Spione, für die fünfte Kolonne, für Nazis. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt der Zug, und sie wurden aus den Waggons gescheucht. Auf einem Schild an der schneeweißen Bahnhofsmauer stand in azurblauer Schrift: Oloron-Sainte-Marie. Lisa stockte der Atem. Sie kannte den Namen nur zu gut. Im letzten Jahr hatte sie Pakete hierhergeschickt, an Freunde, die in Spanien in den Internationalen Brigaden gekämpft hatten und dann in einem Lager ganz in der Nähe interniert worden waren. »Die Hölle von Gurs«, so nannten sie es in ihren Briefen.
»Das sieht doch nett aus hier … so schlimm wird es nicht werden«, hörte sie die Frauen aus ihrem Abteil sagen.
Paulette warf Lisa einen alarmierten Blick zu, doch sie ließen die anderen in ihrem Glauben. Sie würden früh genug erfahren, was ihnen bevorstand. Lisa kritzelte in aller Hast eine kurze Nachricht über ihren Aufenthaltsort an ihre Eltern, die noch in Paris waren. Sie würde die Postkarte gleich irgendjemandem zustecken, der sie hoffentlich beförderte. Mehr als Bin in Gurs. Mir geht es gut. konnte sie nicht schreiben, dann wurde sie in einem Strudel von Frauen mitgerissen. Schnell fasste sie nach Paulettes Hand. Am Bahnhof waren noch weitere Züge angekommen, aus denen ebenfalls Frauen stiegen. Es mussten Hunderte, vielleicht Tausende sein. Bewaffnete Männer trieben sie Richtung Vorplatz, dann die Hauptstraße hinunter, die Fachwerkbauten mit bunt bemalten Holzbalkonen säumten. Auf den Trottoirs standen einheimische Frauen, die sie lauthals beschimpften. Einige spuckten in ihre Richtung.
»Was rufen sie?«, hörte Lisa eine Frau ängstlich hinter sich fragen.
»Sie glauben, wir sind Nazis. Oder Kommunisten. Beide mögen sie nicht. Sie haben Angst vor uns.«
Aus den Augenwinkeln nahm Lisa wahr, wie eine Frau eine Tomate in ihre Richtung warf. Reflexhaft fing sie sie auf und biss hinein. Der warme Saft lief ihr über das Kinn, sie schmeckte herrlich süß. Dankbar lächelte sie der Frau zu, die ihr Lächeln erwiderte. Eine kleine Geste der Menschlichkeit, wie gut das tat, dachte Lisa und schloss zu den anderen auf.
Auf einem Platz warteten mehrere Busse auf sie, in die sie hineingeschoben wurden. Nachdem sie das Städtchen hinter sich gelassen und einen Fluss überquert hatten, fuhren sie durch eine hügelige Landschaft, am Horizont erhoben sich die Gipfel der Pyrenäen. Lisa hörte das Bimmeln von Kuhglocken.
»Vielleicht wird es hier gar nicht so schlimm«, wagte eine Frau neben ihr zu hoffen.
»Bei der letzten Internierung im September haben sie uns auch nach ein paar Tagen wieder nach Hause geschickt«, sagte eine andere.
»Und du glaubst tatsächlich, sie kutschieren uns durch halb Frankreich, nur um uns dann den ganzen Weg wieder nach Hause zu schicken?«
»Wir müssen ihnen schon wichtig sein, wenn sie für uns Züge und Busse besorgen, obwohl sämtliche Straßen mit Flüchtlingen verstopft sind.«
»Wir sind doch auch Flüchtlinge!«
»Wir haben doch nichts getan. Wir sind gegen Hitler, genau wie sie!«
Die Stimmen der Frauen gingen durcheinander, jede hatte eine andere Erklärung für das Vorgehen der Franzosen, aber die meisten glaubten, dass sie bald wieder zu Hause wären.
Lisa schwieg. Sie hatte schon davon gehört, dass Inhaftierte aus Gurs entlassen worden waren. Aber das war gewesen, bevor die Deutschen in Frankreich einmarschiert waren.
»Da kommt ein Ortsschild. Da steht Gurs drauf«, rief eine der Frauen, die am Fenster saß. »Kennt das jemand?«
Lisas Magen zog sich zusammen. Sie waren tatsächlich in dem berüchtigten Lager angekommen. Für einen Moment verließ sie aller Mut, doch dann setzte sie sich energisch auf und schaute aus dem Fenster. Als die Busse auf einem großen Platz vor einem Schlagbaum hielten, wo rechts Häuser aus Stein standen, hatte sie sich schon wieder gefasst. Sie wollte sich alles möglichst genau einprägen. Es war immer wichtig zu wissen, wo man sich befand. Das da vorne mussten die Verwaltungsgebäude sein. Ein untersetzter Mann in Uniform trat gerade aus der Tür, vor der eine Trikolore schlaff am Mast hing, und sah den Ankommenden entgegen. Lisa machte Paulette auf ihn aufmerksam. »Bestimmt der Kommandant«, wisperte sie.
Als sie aus dem Bus stiegen, schlug ihnen eine feuchte Hitze entgegen. Mücken stürzten sich in Schwärmen auf ihre bloßen Arme und Nacken. Doch das alles nahmen sie nicht richtig wahr, weil der Anblick, der sich ihnen bot, noch viel schlimmer war. Obwohl Lisa vorbereitet gewesen war, hielt sie entsetzt den Atem an. Einige Frauen schluchzten auf. Jede, die bisher noch gehofft hatte, irgendwie glimpflich davonzukommen, merkte spätestens jetzt, dass sie sich bitter getäuscht hatte.
Während sie langsam einen Fuß vor den anderen setzte, versuchte sie sich damit zu beruhigen, zu erkennen, was diesen Ort so entsetzlich wirken ließ. Dann wusste sie es. Hier gab es kein Vogelzwitschern, keinen Baum, keinen Strauch, absolut nichts Tröstliches. Hinter dem Schlagbaum reihten sich nur in einer schrecklichen Eintönigkeit graue Holzbaracken auf nackter Erde. Und dazwischen überall Stacheldraht.
Immer zu zweit nebeneinander liefen sie auf die Baracken zu, während eine Aufseherin sie antrieb: »Un – deux, un – deux. Los! Schneller!« Eine lange Straße teilte das Lager in zwei Hälften. Die Aufseherinnen zählten die Frauen ab und wiesen sie in die Hütten ein, barsch und willkürlich, ohne Rücksicht auf Familien oder Gruppen. Ein Tumult brach aus, einige Frauen schrien und wehrten sich, flehten und weinten. Vor ihnen stolperte eine ältere Dame und fiel auf den harten Boden. Sie schrie auf. Bevor die Aufseherin ihr einen Schlag versetzen konnte, packten Lisa und Paulette sie an den Ellenbogen und halfen ihr wieder auf die Füße.
Lisa und Paulette wurden bis fast ans Ende der Lagerstraße getrieben. Ein großer Wasserturm kam in ihren Blick, dann bogen sie rechts ab und passierten einen Stacheldraht, der mehrere Baracken umzäunte.
»Ihr zwei, hier«, bellte die Aufseherin und scheuchte Lisa und Paulette in eins der Gebäude. Lisa konnte nur mit Mühe ihre Augen an das dunkle Innere gewöhnen, im Zwielicht machte sie exakt ausgerichtete Reihen von Strohsäcken aus, die sich an den Längswänden des Gebäudes befanden. Sie waren mit einem groben weißen Stoff bezogen, und der Gedanke an lange Reihen von Leichensäcken drängte sich ihr auf. Dicht an dicht lagen sie, es gab kaum einen Fußbreit Raum zwischen ihnen.
Lisa steuerte einen Strohsack in der Ecke neben der Tür am anderen Ende der Baracke an, eine Ecke war immer gut, um wenigstens ein bisschen Privatsphäre zu haben, doch wie aus dem Nichts stürzte sich eine Frau auf sie: »Weg da! Das ist mein Bett!«
»Lisa, komm hierher!« Paulette wies auf zwei nebeneinanderliegende Säcke unter einer der wenigen Dachluken. Vielleicht würden sie hier wenigstens ein bisschen frische Luft abbekommen. Lisa sah sich nach bekannten Gesichtern um, aber niemand aus ihrem Zugabteil schien hier zu sein. Rasch füllte sich die Baracke, bis alle Strohsäcke belegt waren. Einige Frauen weinten und schimpften, andere waren wie betäubt, hockten auf ihren Plätzen und starrten ins Leere. Eine Frau stand auf und fing an, mit dem Kopf gegen einen der Balken zu schlagen, die das Dach stützten. Lisa sprang auf und gemeinsam mit Paulette hielt sie sie fest und es gelang ihnen, sie zu beruhigen.
Am Abend bekamen sie eine Suppe, dann wurden die Türen geschlossen, eine tiefe Dunkelheit überkam sie, die das Stöhnen, Schimpfen, Weinen und Tuscheln der Frauen nur noch verstärkte. Nachts schrien einige im Schlaf und weckten die anderen auf. Lisa döste immer nur kurz ein. An richtigen Schlaf war nicht zu denken, dafür war diese Baracke zu unwirtlich und sie selbst zu aufgewühlt.
Aus den Blicken der Frauen sprachen Verlorenheit und Angst. Auf der Pritsche gegenüber lag ein junges Mädchen und rieb sich die tränenverschmierten Augen. Sie tat Lisa unendlich leid, und gleichzeitig fühlte sie, wie Wut in ihr aufstieg. Was hatte dieses halbe Kind den Franzosen getan? Oder die alte Frau, die den Strohsack neben ihr hatte? Sie kam ja kaum vom Boden hoch, wie sollte sie eine Gefahr für die französische Sicherheit sein?
Mit einem Ruck setzte sich Lisa auf. Sie wollte nicht zulassen, dass die Verzweiflung sie übermannte. Sie mussten versuchen, den Tagen hier einen Sinn zu geben und ihre Lage einigermaßen erträglich machen. Sie brauchten etwas, das ihnen durch den Tag half, etwas zu essen und das Gefühl von Solidarität. Wer aufgab, der hatte schon verloren.
Eine der Frauen hatte die Baracke verlassen, kam aber gleich darauf weinend wieder.
»Hier ist überall nur Stacheldraht. Und es gibt keine Möglichkeit, sich zu waschen. Da können wir uns ja gleich umbringen.«
Lisa sah die Hoffnungslosigkeit in dem grauen Gesicht und erschrak.
»Niemand wird sich hier umbringen!« Mühsam, weil sie so müde war und ihr die Knochen wehtaten, erhob sie sich. Dann klatschte sie in die Hände. »Alle mal herhören. Wie es aussieht, wird das unser Zuhause für die nächste Zeit sein. Ich will, dass es uns in unserer Baracke gut geht. So gut wie möglich. Wir werden zusammenhalten.«
Die Frauen verstummten. Einige winkten wütend ab, aber die meisten sahen sie erwartungsvoll an. Lisa räusperte sich. Sie würde diese Verantwortung auf sich nehmen. Eine musste es tun.
»Also gut. Wer von euch ist Krankenschwester, Köchin, Lehrerin oder sonst etwas, das uns helfen kann? Kann jemand Schuhe flicken? Einige von uns haben nur noch Fetzen an den Füßen. Wer hat etwas bei sich, das wir alle dringend nötig haben und das wir gemeinsam benutzen können? Seht in eure Taschen. Alles kann hilfreich sein.«
»Ich war Boxlehrerin in Hamburg. Ich mache mit euch Gymnastik«, sagte eine Frau mit kurzem Haar und einer Brille. Dabei machte sie ein paar tänzelnde Schritte und ließ ihre Rechte schwingen.
Einige der Frauen lachten auf. Na also, dachte Lisa.
»Vielleicht hat eine von uns eine Idee, was wir gegen die Läuse tun können?«, rief Paulette. Sie war ebenfalls aufgestanden und stellte sich dicht neben Lisa.
»Ich brauche Binden, ich bekomme meine Tage«, sagte eine andere.
Das junge Mädchen meldete sich schüchtern. »Ich bin Schneiderlehrling. Wenn ich Stoffreste habe, kann ich Binden nähen.«
»Wie heißt du?«, fragte Lisa sie.
»Alina.«
Lisa lächelte sie aufmunternd an. Dann sagte sie: »Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir müssen uns selbst helfen, wenn wir hier überleben wollen.« Sie ging den engen Gang zwischen den Strohsäcken hinunter, um das Innere der Baracke zu inspizieren. Dabei fing sie die Blicke einiger Frauen auf, die ihr zaghaft zulächelten. Die ältere Dame, die den Schlafsack auf der anderen Seite neben ihr hatte, hielt ihr eine Bluse hin. »Die ist zerrissen, aber für Binden taugt sie noch.«
Das Vélodrome in Paris war schon schlimm gewesen, aber dort waren wenigstens ihre Familien und die Hilfsorganisationen in der Nähe, die sich für die internierten Frauen einsetzten und Pakete schicken konnten. Hier dagegen schienen sie vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand wusste, wo sie war. Lisa konnte nur hoffen, dass ihre Postkarte ihre Eltern erreichte. Am schlimmsten war die Unsicherheit. Was würde aus ihnen werden? Würden man sie irgendwann wieder laufen lassen? Oder würde man sie ausweisen und den Deutschen übergeben?
* * *
Lisa war jetzt richtig wach. Sie sah zu Erna Goldmann hinüber, die ihr am ersten Tag die Bluse gegeben hatte. Lisa mochte sie sehr. Erna war um die sechzig und kam aus Frankfurt. Sie kam aus einem großbürgerlichen Haushalt mit Dienstboten und Chauffeur. Ihr Mann war Anwalt, und sie waren erst kurz vor Kriegsbeginn nach Paris gezogen, da ihr Sohn mit einer Französin verheiratet war. Voller Zuversicht hatte sie Lisa erzählt, dass ihr Mann sie bestimmt aus dem Lager holen würde. Aber nach ein paar Tagen hatte sie kaum mehr ein Wort gesagt und viel geweint. Lisa begann sich Sorgen um sie zu machen. Das Lager musste für Erna ein noch viel größerer Schock sein als für viele andere.
»Ihr Mann wird kommen und Sie hier rausholen. Das braucht nur Zeit. Sie kennen doch die französische Bürokratie«, versuchte Lisa sie aufzumuntern. »Sie müssen durchhalten und dürfen sich nicht aufgeben. Ihre Familie braucht Sie doch. Und wir hier brauchen Sie auch.«
Obwohl sie das Gefühl hatte, mit ihren Worten zu Erna durchgedrungen zu sein, und Erna sich alle Mühe gab, tapfer zu wirken, schien es sie jeden Morgen große Überwindung zu kosten, sich aus dem Schlaf zu reißen und den Tag zu beginnen.
»Guten Morgen, Erna«, sagte Lisa jetzt zu ihr. »Zeit zum Aufstehen.«
Erna setzte sich schwerfällig auf und schlug ihre Decke zurück.
»Los, ihr Faulpelze. Steht auf. Bevor die Schlange zu lang ist«, rief Paulette und ging zur Tür der Baracke.
Mit einem Seufzer stand Lisa auf und folgte ihr nach draußen.
»Ich komme gleich«, sagte Erna.
Vor den Latrinen warteten bereits um die fünfzig Frauen. Lisa und Paulette stellten sich an, wobei sie darauf achteten, auf dem schmalen festgetretenen Weg zu bleiben, denn rechts und links versank man im Matsch. Die Schlange rückte elend langsam vor und wurde immer länger. Während sie wartete, achtete Lisa darauf, was die Frauen um sie herum erzählten. Gab es Neuigkeiten aus den Nachbarbaracken? Gerüchte? Über dem Lager hing eine nicht verstummende Geräuschkulisse, die sich aus den Gesprächen und Geräuschen Hunderter Frauen zusammensetzte, die hier lebten oder leben mussten, und die nie verstummte. Selbst in der Nacht stöhnten, redeten, summten die Frauen vor sich hin. Bei ihrer Ankunft war ihr eine merkwürdige Stille aufgefallen, die über dem Lager lag. Erst später hatte sie diese vermeintliche Stille als stetes Grundrauschen von Frauenstimmen entziffert. Lisa versuchte sich wieder in ihren Traum zu versetzen. Wie schön war das gewesen: die hohen Bäume, in denen die Vögel zwitscherten, das Blau des Sees, sie und Hans waren allein gewesen und er hatte zärtlich ihren Oberschenkel gestreichelt.
Plötzlich fasste sie jemand grob am Ellenbogen, eine Frau war im Matsch ausgerutscht und suchte Halt. Und die Illusion war vorüber. Hier gab es kein Grün und vor allem war man hier niemals allein. Lisa ließ ihren Blick über die Frauen um sich herum wandern, die schon erschöpft waren, obwohl der Tag noch nicht einmal richtig begonnen hatte. Es gab zu wenig zu essen, alles war schmutzig und über allem lagen Hoffnungslosigkeit und Stumpfsinn.
Gleich am Tag ihrer Ankunft hatte Lisa begonnen, gegen die größten Missstände im Lager anzugehen. Als sie gesehen hatte, dass die Wachleute die Kinder, die durch die Zäune geklettert waren und auf der Lagerstraße Fangen spielten, grob zurückgeschickt hatten, war sie wütend geworden, denn nun spielten die Kinder in der Nähe der Latrinengruben. Das war gesundheitsschädlich und sehr gefährlich, vor allem für die Kleinsten. Lisa versammelte einige Frauen um sich und sie erzwangen sich den Zugang zum Kommandanten und schilderten ihm die Situation in sachlichen, aber deutlichen Worten. »Wollen Sie verantwortlich sein, wenn eins der Kinder hineinfällt und ertrinkt?«, rief Lisa. Am nächsten Tag erlaubte der Kommandant, dass Kinder unter zehn jenseits des Stacheldrahts spielen durften, sogar außerhalb des Lagers. Dort gab es ein Feld mit Sonnenblumen, und die Kinder pflückten die großen Blüten und schmuggelten sie unter ihren Jacken ins Lager. Außerdem organisierten sie eine Art Leihbücherei. Lisa sammelte die wenigen Bücher ein, die die Frauen bei sich hatten, und bat eine junge Polin, die ganz allein war und den ganzen Tag weinte, darum, sie auszugeben und wieder einzusammeln. Viele schätzten sie für ihr Engagement, aber es gab auch Frauen, die ihr vorwarfen, sich aufzuspielen. Lisa war das egal.
»Warum machst du das? Warum reibst du dich auf? Du kannst hier ja doch nichts ausrichten«, bekam sie immer wieder zu hören. Und auch Paulette mahnte sie manchmal, es ruhiger angehen zu lassen und ihre Kräfte zu sparen. Aber Lisa schüttelte energisch den Kopf. »Natürlich macht es etwas aus. Wenn ich anderen helfen kann, dann wird das Leben für uns alle erträglicher. Und außerdem tue ich es auch für mich selbst. Ich werde verrückt, wenn ich den ganzen Tag auf diesem Strohsack sitze. Alles ist besser als aufzugeben oder sich gehen zu lassen. Da habe ich lieber eine Beschäftigung.« Und zu Paulette sagte sie etwas leiser: »Sonst muss ich die ganze Zeit an Hans denken.«
Lisa war aufgerückt und stand inzwischen oben auf dem Podest, vor ihr waren noch vier Frauen an der Reihe. Von hier aus hatte sie einen guten Überblick über das Lager, wieder versuchte sie, sich alles möglichst genau einzuprägen. Vor ihr erstreckte sich die Lagerstraße, die ungefähr zwei Kilometer schnurgerade verlief. Sie war die einzige asphaltierte Straße im ganzen Komplex. Rechts und links davon befanden sich in sechs Reihen hintereinander die flachen hölzernen Baracken, in denen jeweils fünfundzwanzig Frauen wohnten. Das Gelände vor ihr war beinahe farblos. Überall war nur das schmutzige Grau des Sands und die hölzernen Baracken zu sehen. Einzige Farbtupfer waren um die Mittagszeit die bunten Kleider der Frauen, wenn sie über dem Stacheldraht in der Sonne trockneten. Lisa vermisste am meisten das Grün. Wenn es doch nur einen einzigen Baum in Gurs geben würde, oder ein Stückchen dürren Rasen! Jenseits des Lagers am Horizont konnte sie die Hügel der Pyrenäen ausmachen. Scharf umrissen und dunkel erhoben sie sich vor dem Himmel. Auf den höchsten Gipfeln lag Schnee. An manchen Tagen, wenn die Sonne schien, glänzten sie wie Gold, aber heute hatten sie eher eine graubraune Farbe. Und hinter den Bergen lag Spanien. Lisa seufzte. Spanien war das Paradies für deutsche Flüchtlinge, die Angst vor der vorrückenden Wehrmacht hatten. Hinter Spanien lag Portugal, und von dort fuhren Schiffe nach Amerika, in die Freiheit. Nur leider brauchte man ein Visum, um nach Amerika zu kommen. Ein Visum … fast jede hier wollte unbedingt weg aus Frankreich, wo die Deutschen ihnen auf den Fersen waren. Aber es gab kaum noch Länder, die die Flüchtlinge aufnehmen wollten. Mit einem Seufzen wandte Lisa sich ab. Jetzt sah sie in westliche Richtung, dort lag, keine hundert Kilometer entfernt, das Meer. Sie atmete tief ein und fragte Paulette, ob sie auch das Meer riechen könnte. Paulette lachte sie aus. »Was du riechst, ist die Latrine. Jetzt mach schon, du bist dran.« Paulette stupste sie an und grinste. Dann wurde sie ernst. »Träum nicht so viel, das tut nicht gut.«
Obwohl es noch kühl war, gingen sie anschließend zu den zwei Waschgelegenheiten, die sich am Rand des Lagers befanden. Schmale lange Rinnen, in die das muffig riechende Wasser floss. Mochte es hier auch viel und ausgiebig regnen, für die Wäsche, den Abwasch und die Körperreinigung von Tausenden von Frauen konnte der Wasserturm am Ende des Lagers nie genug Wasser speichern. Seife hatten nur die wenigsten.
Zwei Wärter kamen auf ihrer Runde vorüber. Feixend wiesen sie auf die halb nackten Frauen und starrten sie unverhohlen an.
»Die Spanner sind wieder da!«, zischte Lisa wütend und schlang die Arme um ihren Oberkörper, um sich vor den gierigen Blicken der Männer zu schützen. Wie auf Kommando stellten sich die hinter ihr wartenden Frauen in einer Reihe, Schulter an Schulter, vor die Waschtröge. Mit erhobenen Köpfen und in eisiges Schweigen gehüllt, sahen sie die Männer an, in ihren Blicken die allergrößte Verachtung.
»Jeden Morgen dasselbe«, brummte Lisa, während sie ihre Bluse wieder anzog und sich vor die anderen Frauen stellte, die sich nach ihr wuschen. Sie hüpfte leicht auf und ab, weil ihr kalt war. Sie wollte schnell wieder in die Baracke, das Frühstück müsste inzwischen gekommen sein, und sie hatte Hunger. Sie wohnte in Baracke Nummer 21 von Ilôt I, Ilôt bedeutete kleine Insel, und als Paulette den Ausdruck zum ersten Mal gehört hatte, wollte sie es nicht glauben. »Diese mit Stacheldraht umzäunte Ansammlung von elenden Hütten nennen die Franzosen Inseln? Inseln des Glücks oder was?«
Als sie zurück in die Baracke kamen, schlug Lisa muffige Wärme entgegen, die ihr nach der frischen Luft draußen noch unangenehmer erschien. Sofort war die dumpfige Müdigkeit wieder da, die sie nicht mehr losließ, seit sie hier war. Ein Strahl Helligkeit fiel in den fensterlosen Raum, als sie die Tür aufmachten, dann schlug die Dunkelheit wieder über ihnen zusammen. Die Gebäude hatten keine Fenster, sondern lediglich Luken im Dach, und die waren bei Regen und Kälte von außen mit hölzernen Klappen geschlossen. Möbel gab es auch nicht, auch kein Licht. Während sie in die Ecke ging, wo das Frühstück verteilt wurde, dachte sie sehnsüchtig an Kaffee. An eine Tasse starken Kaffee mit einem Schuss frischer Milch. Damit hatte sie immer ihren Tag gestartet, dafür hatte sie immer Geld aufgespart. Mit einer ordentlichen Tasse Kaffee fing jeder Tag gut an. Aber hier gab es nur Plörre aus Zichorien oder was immer sie hier als Ersatz nahmen. Und wenn es mal Milch gab, dann war sie für die Kinder.
Resigniert hielt Lisa ihren Becher hin, und Auguste Broders, die Barackenchefin, eine stämmige Frau aus Bremen, goss aus einer Kanne eine hellbraune Flüssigkeit hinein. Neben Auguste stand Erna und gab jeder eine Scheibe graues, matschiges Brot. Am Tag zuvor hatte es Streit gegeben, weil die Scheiben mal dicker, mal dünner waren. »Ich schneide das Brot. Ich kann das«, hatte Erna gesagt. Lisa hatte sie verwundert angesehen. Erna, die bis vor Kurzem noch eine Köchin gehabt hatte und eine ganze Schar von Dienstmädchen? Aber Erna hatte das Messer genommen und das Brot in exakt gleich dicke Scheiben geschnitten. Die Frauen waren dicht an sie herangerückt, um zu beobachten, wie sie das machte. Und alle mussten zugeben, dass jede Scheibe wie die andere war. Den Knust teilte sie geschickt in Würfel und gab sie den Frauen, die die kleineren Scheiben zum Ende des Brotes bekamen.
»Woher kannst du das?«, fragte Lisa.
»Ich war nicht immer wohlhabend. Und bei uns zu Hause waren wir acht Geschwister. Da lernt man, gerecht zu teilen«, gab Erna mit einem Lächeln zurück.
Seitdem gab es wenigstens um das Frühstück keinen Grund mehr für Streit, aber sonst gab es oft Zwistigkeiten zwischen den Frauen. Wie sollte es auch anders sein, wenn man zwei Dutzend Frauen, die sich vorher nie gesehen hatten und aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen kamen, in einer Baracke zusammenpferchte? Manche weigerten sich immer noch, ihre Internierung zu akzeptieren, und hielten das alles für einen Irrtum. Für sie war es am schwersten, sich zurechtzufinden.
Ich weiß wenigstens, warum ich hier bin, dachte Lisa, während sie an ihrem Ersatzkaffee nippte. Ihre Gedanken wanderten nach Berlin, wie sie in einem Café am Kurfürstendamm gesessen hatte, in ihrer Handtasche die Zeugenaussagen von Inhaftierten aus Plötzensee, die sie einem Kontaktmann übergeben sollte. Während sie den beiden SA-Männern am Nebentisch schöne Augen machte, hatte sie den Umschlag unter dem Tisch in dessen Manteltasche gleiten lassen. Auf dem Bahnhof in Basel hatte sie eine Aktentasche durch ein Geländer auf die deutsche Seite geschoben und eine andere Tasche aus Deutschland wieder mitgenommen. In Holland hatte sie Kuriere über die grüne Grenze nach Deutschland und zurück gebracht. Bei so vielen Gelegenheiten hatte sie sich in Gefahr begeben, aber es war immer gut gegangen. Ihre Unverfrorenheit kam ihr heute naiv vor, seitdem hatten die Nazis so viel gelernt, waren so viel grausamer und effizienter geworden. Aber zu wissen, dass sie von Anfang an gegen Hitler gekämpft hatte, machte die Situation hier in Gurs tatsächlich ein bisschen leichter für sie. Kein Wunder, dass ich hier eingesperrt bin, dachte sie mit einem Anflug von Stolz. Dass sie jüdische Eltern hatte, war nicht der Grund gewesen, sich dem Widerstand anzuschließen. Ihr Herz schlug links, und die aufstrebenden Nazis hatte sie von Anfang an verachtet. Als junge Frau hatte sie ihre prägenden Jahre in Berlin verbracht, sie gehörte zum Sozialistischen Schülerbund, sie ging ins Kabarett und ins Kino, sie hatte die Premiere der Dreigroschenoper gesehen und kannte die Journalisten der linken Zeitungen. Als die Nazis angefangen hatten, gegen all das vorzugehen, was ihr wichtig war, als sie Vorführungen störten und ihre Freunde verprügelten, da konnte sie gar nicht anders, als sich gegen sie zu stellen. Nachdem Hitler im Januar 1933 Reichskanzler geworden war und die Verfolgungen staatlich organisiert wurden, als viele ihrer Freunde und Mitstreiter verhaftet wurden und sie hörte, was sie in den Gefängnissen und Konzentrationslagern erleiden mussten, da hatte sie umso entschlossener weitergemacht. Mit ein paar anderen begann sie, Berichte und Fotos von Folterungen und Morden zu sammeln und sie ins Ausland zu schmuggeln. Dann organisierten sie eine Druckerpresse und tippten Flugblätter, die sie heimlich verteilten. Als ein paar Jungs mit den Flugblättern geschnappt worden waren, hatten sie alles auf Lisa geschoben, weil sie dachten, sie wäre bereits im Ausland. Zum Glück war sie rechtzeitig gewarnt worden und am nächsten Tag nach Prag geflohen, wo ihre Eltern bereits auf sie warteten. Nach Prag war die Schweiz gekommen, dann Holland, dann Paris.
Und nun saß sie hier auf einem harten Strohsack. Sie nahm noch einen Bissen von ihrem Brot. Obwohl sie sehr langsam gekaut hatte, um möglichst lange etwas davon zu haben, war sie noch hungrig. Sollte sie auch den Rest jetzt essen oder ihn lieber aufbewahren bis vor dem Schlafengehen, wenn ihr Hunger immer am größten war?
Kapitel 2
Lisa zuckte zusammen, als die Tür mit einem Krachen, das die hölzernen Wände erzittern ließ, an die Wand flog. Alina stürzte herein, marschierte zu ihrem Strohsack und ließ sich darauf fallen. Lisa sah, dass ihr Gesicht tränenverschmiert war. Alina war mit ihren fünfzehn Jahren eigentlich zu jung für ein Lager, die Internierungen galten erst für Frauen ab siebzehn, aber weil sie niemanden mehr hatte, war sie mit ihrer älteren Freundin ins Vélodrome gegangen, sie hatte einfach nicht gewusst, was sie sonst hätte tun sollen. Doch man hatte sie getrennt und ihre Freundin in ein anderes Lager gebracht.
»Was ist los?«, fragte Lisa.
Alina schluchzte auf und blickte verstohlen in die Ecke, in der drei Frauen an der Wand lehnten und rauchten. Sie hatten sich von Anfang an abgesondert und verfügten über Zigaretten und andere Dinge, die im Lager nur schwer zu bekommen waren und von denen sie nichts abgaben. Lisa hatte sie im Verdacht, für die Lagerleitung zu spionieren und bewusst Unfrieden zu stiften.
Sie schikanierten und beleidigten Alina, wo sie nur konnten.
»Was haben sie dir gestohlen? Los, sag schon. Damit dürfen sie nicht durchkommen, sonst haben wir hier alle keine ruhige Minute mehr.«
»Meine Schere und ein Unterhemd«, stammelte Alina. »Das hat meine Mutter mir geschenkt.«
Lisa ahnte, was das Hemd Alina bedeuten musste. Auch sie hing an dem Taschentuch, das ihre Mutter ihr in Paris zugesteckt hatte, kurz bevor sie ins Vélodrome musste. Doch die Schere war ein unersetzliches Gut im Lager. Aber es ging hier nicht nur um den praktischen Nutzen, es ging um Solidarität. Wenn sie nicht zusammenhielten, dann hätten die anderen gewonnen. Wenn jede nur noch an sich dachte, dann würde ihre Gemeinschaft zerbrechen. Nur gemeinsam konnten sie hier überleben. Nur indem sie teilten, sich Mut zusprachen, sich halfen. Und sich nicht das wenige, was ihnen geblieben war und das oft unter das Kopfkissen oder an einen Nagel an der Wand passte, wegnahmen. Reflexhaft sah Lisa zu ihrer Tasche aus grobem Leinen, in der sich ihr ganzer Besitz befand, das, was nach den Jahren auf der Flucht noch übrig war: ihre Bluse und Unterwäsche zum Wechseln, eine Hose für kühlere Tage, dazu ein paar Briefe von Hans und ihrer Familie, ein Stift, ein Buch. Schränke gab es in Gurs nicht. Ständig wurde etwas gestohlen, aber in ihrer Baracke war so etwas bisher nicht vorgekommen. Und so sollte es auch bleiben. Lisa holte tief Luft, dann stand sie auf und zog Alina an der Hand hinter sich her zu den drei Frauen, die sie herausfordernd ansahen.
»Gebt ihr die Schere wieder. Und das Unterhemd auch«, sagte sie so laut, dass alle es hören konnte. Einige Frauen hatten sich bereits hinter sie gestellt. Auguste Broders kam ebenfalls dazu. »Was ist hier los?«, fragte sie.
»Ach, nichts weiter. Diese Damen haben sich Alinas Schere ausgeliehen und wollten sie gerade zurückgeben«, antwortete Lisa und ließ die drei nicht aus den Augen.
Maxine Wunderlich, die Anführerin der drei, war eine große Frau, die ihr Haar zu einem Zopf geflochten um den Kopf trug. Typische Nazifrisur, dachte Lisa. Jede Nacht verschwand sie mit einem der Wachmänner. Mit gelangweiltem Gesicht zog sie jetzt die Schere aus ihrer Rocktasche.
»Und das Hemd«, sagte Lisa und reichte beides an Alina weiter.
»Jetzt habt euch nicht so. War doch nur Spaß«, sagte Maxine.
»Such dir für deine Späße das nächste Mal jemanden, der dir gewachsen ist«, sagte Lisa, und die anderen nickten dazu. Sie hielt Maxine die Faust vors Gesicht. »Sonst bekommst du vielleicht die hier zu spüren. Ich meine es ernst.«
* * *
Wie jeden zweiten Tag waren Lisa und Paulette damit beschäftigt, ihre wenigen Kleider zu waschen, was ohne Seife nicht ganz einfach war. Es gab zwar eine Kantine im Lager, wo man Hygieneartikel und auch Lebensmittel kaufen konnte, aber weder Lisa noch Paulette hatte Geld dafür.
Auf dem Rückweg kam ihnen Hannah Arendt entgegen, eine schmale junge Frau, die in einer Nachbarbaracke wohnte. In Paris hatte sie zu einer Gruppe von Philosophen gehört, die in einem Hotel am Montparnasse zusammenwohnten. Lisas Vater war ein paar Mal dort gewesen, weil er wollte, dass sie einen Artikel für die Exilzeitschrift schrieb, bei der er als Redakteur arbeitete. Ab und an hatte Lisa ihn begleitet und hatte zugesehen, wie sie mit Walter Benjamin Schach gespielt hatte. Auch damals hatte sie diesen Häkelpullover angehabt, der am Ausschnitt durch einen Knopf zusammengehalten wurde. Manche Menschen erkennt man zuerst an ihrer Kleidung, die sie über Jahre tragen, dieser Gedanke ging ihr durch den Kopf.
»Ich kann die Pyreneeeeen nicht mehr seeeehen«, sang Hannah mit ihrer tiefen Stimme und machte dabei einen Tanzschritt. Ihr dunkles Haar lag wie ein Helm um ihren Kopf herum.
Paulette lachte. »Lisa hat gesagt, du bist Philosophin und keine Sängerin?«
»Bin ich auch, aber ich brauche Zigaretten zum Denken, und das Singen lenkt mich ab. Habt ihr welche?« Ihr Blick bekam etwas Verletzliches.
Lisa schüttelte den Kopf. »Leider … Aber eine in unserer Baracke hat ein Schachspiel. Das hilft, die Zeit totzuschlagen.«
Hannah nickte. »Gern. Und morgen Abend halte ich einen Vortrag. Kommt ihr? Man muss ja aufpassen, dass man hier nicht verblödet. Um sieben«, sagte Hannah in ihrer gewohnt knappen Art und bog dann mit einem Kopfnicken zu ihrer Baracke ab.
In diesem Augenblick fing es an, wie aus Eimern zu schütten. Das passierte hier ständig. Die Gewitter kamen oft und aus heiterem Himmel. Weil das Lager auf einem morastigen Grund errichtet war, verwandelten sich die Wege in kürzester Zeit in Schlammwüsten. Lisa hatte Mühe, nicht im Matsch zu versinken, und versuchte, auf einem Bein stehend die Balance zu halten.
»Du siehst aus wie ein Storch im Salat!«, rief Paulette und lacht sich halb tot. Lisa sah sie empört an, dann lachte auch sie los. Man musste hier in Gurs jede Gelegenheit zum Lachen nutzen, um nicht durchzudrehen. Dann gab sie alle Vorsicht auf und rannte los, Paulette hinter ihr her. Kurze Zeit später waren sie von oben bis unten mit Schlamm bespritzt und bis auf die Haut nass. Lachend und außer Atem betraten sie ihre Baracke. Lisa zog sich aus und legte sich im Unterhemd auf ihren Strohsack. Was würde ich jetzt für ein heißes Bad geben, dachte sie. Mit Schaum bis unter die Nasenspitze und Duft und hinterher ein schönes weiches Handtuch … Plötzlich sah sie Hans vor sich, wie er sie abtrocknete und schon traten ihr die Tränen in die Augen. Sie vermisste ihn so sehr. Wäre Hans mit ihr hier, er würde alles tun, um ihr durch kleine Gesten das Leben leichter zu machen. Niemand konnte das so gut wie Hans, und er hatte sie schon in den schlimmsten Stunden zum Lachen gebracht. Bei dem Gedanken, wie er ihr in Paris jeden Abend die enge Stiege hinaufgeholfen hatte, die in das Zimmer unter dem Dach im neunten Stock führte, musste sie lächeln. Wenn sie nicht mehr konnte, hatte er sie von unten geschoben und dabei gemurmelt: »Wieso habe ich mich ausgerechnet in eine störrische Eselin verliebt?«
Wo mochte er jetzt sein? Bestimmt war er in einem anderen Lager irgendwo in Frankreich, Hauptsache weit weg von den vorrückenden Deutschen. Man hörte von Entführungen nach Nazi-Deutschland, und das bedeutete Konzentrationslager oder noch Schlimmeres. Die Nazis hatten ihn in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Man hatte ihm den Mord an einem SA-Mann in die Schuhe geschoben. Ausgerechnet Hans, der genau wie sie selbst Gewalt ablehnte. Aber die Nazis würden kurzen Prozess mit ihm machen.
Seit sieben Jahre waren sie nun schon ein Liebespaar und seitdem hatte sie Angst um ihn. Sie wären längst verheiratet, wenn sie die nötigen Papiere zusammengehabt hätten. Wieder huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie brauchte keinen Trauschein, um zu wissen, dass sie und Hans zusammengehörten. In Prag hatten sie sich bei einer politischen Versammlung kennengelernt, aber nur ein paar Worte gewechselt. Lisa hatte während des Vortrags seinen Blick bemerkt, der einen Moment zu lange auf ihr geruht hatte. Sie hatte ihn fragend angesehen, aber dann war sie von einem ihrer Freunde abgelenkt worden. Bevor sie ging, suchte sie ihn mit den Augen, aber er war in einem Gespräch mit einem Mann und hob nicht den Blick. Sie fand ihn anziehend, mehr aber nicht. Er dagegen hatte sich sofort in ihre Lebhaftigkeit verliebt, wie er ihr später erzählte. »Deine dunklen Locken sind bei jedem Lachen nur so um dein Gesicht geflogen.« Er hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sie wiederzusehen. Sogar den Postboten hatte er bestochen, um dessen Tour zu übernehmen und so an ihre Adresse zu kommen. Die Geschichte rührte sie immer noch. Bei ihrem ersten Rendezvous trug er ein zerlesenes Buch unter dem Arm, das hatte sie angezogen. Er brachte sie zum Lachen, und das war das andere an ihm, das sie so liebte. Ein Mann, der Bücher liebte und der sie mit seiner Fröhlichkeit ansteckte. Wenn es um Politik und Fragen der Gerechtigkeit ging, sprühte Hans nur so vor Lebensfreude und Energie, er riss sie einfach mit. Jeden Abend schleppte er sie ins Kino oder in ein Konzert, in dem Punkt war er genauso unermüdlich wie unerbittlich. Gerade in Zeiten, in denen sie ohne feste Wohnung war und immer in Angst, aufzufliegen, waren diese Ablenkungen ein Segen.
Als sie ihn besser kennenlernte, merkte sie, wie wichtig ihm seine politische Arbeit war. Der Kampf gegen die Nazis kam für ihn an erster Stelle. Anfangs war sie mit Hans einer Meinung gewesen, noch immer wäre es für sie unmöglich, einen Mann zu lieben, der nicht ihre politischen Ansichten und ihr Engagement teilte. Aber es gab immer häufiger Momente, in denen sie sich wünschte, Hans würde auch mal romantisch sein, mehr an sie denken als an die nächste Versammlung, die nächste Aktion. Seufzend tastete sie mit den Fingern nach der silbernen Kette mit dem kleinen Anhänger in Form eines Ls an ihrem Hals. Hans hatte sie ihr zum ersten Jahrestag geschenkt, »L wie Lisa, wie Liebe und wie liberté, der schönste Buchstabe, den es im Alphabet gibt«, hatte er gesagt und ihr die Kette umgelegt. Er hatte ihr mit Absicht keinen Ring geschenkt. »Ich will dich nicht an mich fesseln. Ich liebe dich für deine Unabhängigkeit. Sonst wärst du ja auch nicht hier, sondern in Berlin und eine brave Ehefrau. Ich schenke dir diese Kette, damit du weißt, dass ich dich liebe.« Seitdem hatte Lisa die Kette nie wieder abgenommen. Es erfüllte sie mit Stolz, dass sie in ihr ein Zeichen ihrer Freiheit und gleichzeitig einen Liebespfand sehen konnte.
Sie stöhnte und drehte sich auf die andere Seite, um die Gedanken zu vertreiben, aber stattdessen sah sie wieder ihre Mutter vor sich, wie sie mit ihr an der Haltestelle auf den Bus wartete, der sie ins Vélodrome d’Hiver bringen sollte, und ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Ihre Mutter hatte auf einmal so klein und alt ausgesehen. Wann war das geschehen? Wann hatte sie ihre Jugendlichkeit verloren? Als Lisa in den Bus gestiegen war, konnte sie deutlich in den Augen ihrer Mutter lesen, was sie von ihr erwartete. Aber sie brachte es einfach nicht über sich, die Worte zu sagen: »Bis bald. Ich bin bald wieder da.« Weil sie nicht wusste, ob sie dieses Versprechen würde halten können. Jetzt bedauerte sie, dass sie es nicht trotzdem gesagt hatte, nur um ihrer Mutter einen Moment der Hoffnung zu geben. Sie konnte nur hoffen, dass es ihren Eltern gut ging. Sie waren nicht interniert, weil sie zu alt waren. Ob sie noch in der Wohnung in der Butte Rouge, einer südlichen Vorstadt von Paris, waren? Ob sie die Miete noch zahlen konnten? Wie kamen sie zurecht? Ihr Vater gab Privatstunden, ihre Mutter nähte für die Nachbarschaft, das reichte knapp zum Leben. Lisa hatte im Lager immerhin die Gemeinschaft der anderen, ihre Eltern waren die, die ohne Gasmaske in die Luftschutzräume mussten und die dadurch jeder als Ausländer erkannte.
Lisa spürte, wie ihr die Tränen kamen. Paulette hatte recht, es war gefährlich zu träumen. Man musste sich genau überlegen, wovon man träumte. Ein heißes Bad war in Ordnung, aber an die Menschen zu denken, die man liebte, brachte alles durcheinander und kostete zu viel Kraft. Wenn Hans sich von ihr verabschiedete, dann hatte er die Angewohnheit, im Gehen den Hut aufzusetzen, und ihr dann, ohne sich umzudrehen, mit der Hand über dem Kopf zuzuwinken. Mit diesem Bild im Kopf schlief sie ein.
Kapitel 3
Am nächsten Abend hielt Hannah Arendt ihren Vortrag über die Dichterin Rahel Varnhagen. Es dämmerte bereits, als Lisa mit Erna und Paulette frierend in die Baracke eilte, in der Hannah wohnte. Sie war den ganzen Tag über niedergeschlagen gewesen. Es hatte wieder geregnet, und sie mussten drinnen bleiben. Die Stunden hatten sich endlos gezogen, weil es nichts zu tun gab. Sie hatte versucht zu lesen, aber draußen war es zu kalt gewesen und in der Baracke zu dunkel und zu laut. Die vielen Stunden des erzwungenen Nichtstuns, die man mit Hoffnungslosigkeit, dumpfem Brüten oder frustriertem Zank füllen konnte, waren mit das Schlimmste in Gurs. Da taten diese Abende, an denen die Frauen Theater spielten, Vorträge hielten oder sangen, so unendlich gut. Es lenkte vom bohrenden Hunger ab und es schuf ein Gefühl der Gemeinschaft und Solidarität. Die Lagerleitung duldete diese Veranstaltungen, aber nur die Frauen aus demselben Ilôt durften daran teilnehmen. Gleich als Lisa die halbdunkle Baracke betrat, spürte sie die erwartungsvolle Stimmung der anderen, denen es offensichtlich ähnlich ging. Einige der Frauen kannte sie schon aus Paris, andere hatte sie hier kennengelernt. Mit Lili Andrieux, die in einer Ecke saß und ihnen zuwinkte, hatte sie erst gestern überlegt, dass sie eine Einführung in Kunstgeschichte geben könnte. Und wenn sie tatsächlich genügend Papier und Stifte hätten, wollte sie die Frauen im Malen unterrichten.
»Hierher, ich habe euch einen Platz freigehalten«, rief Lili. Lisa, Erna und Paulette schoben sich durch die Menge der Frauen, die auf zusammengerückten Strohsäcken saßen oder an der Barackenwand lehnten. Als sie bei ihr ankamen und sich neben sie gesetzt hatten, überreichte Lili Lisa ein winziges Porträt, das sie auf die unbedruckte Fläche einer Zeitungsanzeige für Pomade gezeichnet hatte.
»Hast du das gerade eben gemacht?«, fragte Lisa perplex, während sie sich betrachtete. Lili hatte in wenigen Strichen ihr Gesicht gezeichnet und dabei ihren Mund und den offenen Blick sehr gut getroffen. »In der kurzen Zeit, als ich mich zu dir durchgeschlängelt habe?«
»Gekonnt ist gekonnt«, gab Lili mit einem Achselzucken zurück. »Immerhin habe ich in Berlin und Paris Kunst studiert. Darfst du behalten.«
»Danke«, sagte Lisa aufrichtig erfreut und schob das kleine Bild vorsichtig in ihre Hosentasche. »Das werde ich Hans schenken, wenn wir uns wiedersehen.«
Lili zog ein neues Stück Papier aus dem Schaft ihrer derben Männerstiefel. Sie kniff die Augen zusammen und sah abwechselnd zu Erna und auf das Blatt vor sich. Lisa konnte ihr dabei zusehen, wie eine Skizze von Erna entstand.
»Ist Lou nicht hier?«, fragte Lisa und sah sich suchend um.
Lili und Lou Albert-Lazard steckten immer zusammen und streiften auf der Suche nach Motiven durch das Lager. Dabei war Lou das ganze Gegenteil der bodenständigen Lili. Auch hier, unter den widrigen Bedingungen des Lagers, wirkte sie noch extravagant und mondän. Früher einmal war sie die Geliebte von Rilke gewesen. Lisa hatte sie ein paar Mal in Paris gesehen, wo sie durch rote Fuchspelze und Hutkreationen aus Moos und Hahnenfedern aufgefallen war. Die Pelze hatte sie längst verkaufen müssen, hier in Gurs trug sie wallende weiße Gewänder und einen riesigen Strohhut auf dem Kopf. Jeder hier kannte Lou und Lili, viele hatten schon Modell für sie gestanden, manche sogar nackt an den Waschtrögen.
Nach ihnen kamen immer noch mehr Frauen in die Baracke, und Lisa bemerkte unter ihnen die winzige Frau Krüger, die sich mit vorsichtigen, tastenden Schritten näherte. Alle im Ilôt kannten und mochten die alte Frau mit dem schlohweißen Haar und dem zerschlissenen Mantel, die für jede von ihnen ein Lächeln hatte. Heute Abend trug sie über ihrem dunklen Mantel ein buntes Seidentuch zu einer perfekten Schleife gebunden. Das war ihre Art des Kampfes gegen die allgegenwärtige Verwahrlosung. Sie stellte sich zu den anderen, hatte aber offensichtlich Mühe, sich aufrecht zu halten. Wie lange sollte die arme alte Frau noch hier hausen müssen, unter unwürdigen Bedingungen? Würde sie womöglich hier sterben? Der Gedanke trieb Lisa Tränen in die Augen. Sie mussten etwas unternehmen. Sie mussten so schnell wie möglich raus aus diesem Lager. Und bis dahin würde sie dafür sorgen, dass sich die Bedingungen verbesserten und Frau Krüger ein einigermaßen erträgliches Leben hatte.
»Hat hier jemand irgendetwas, das als Hocker dienen könnte?«, fragte sie in die Runde. Eine Hand hob sich, und sie trugen einen Koffer herbei, auf den Frau Krüger sich mit einem dankbaren Lächeln setzte.
Lisa freute sich über diese kleine Geste der Menschlichkeit. Nicht nur ihr, sondern auch den anderen tat sie gut. Die Stimmung wurde angeregter, fast ein wenig fröhlich, als Hannah Arendt anfing zu sprechen.
»Rahel träumte davon dazuzugehören, aber drei Dinge sprachen dagegen«, sagte sie mit ihrer dunklen, klaren Stimme und stieß dabei den Rauch ihrer Zigarette aus. Offensichtlich hatte sie irgendwo welche auftreiben können. »Sie stand vielfach am Rand der Gesellschaft: als Künstlerin, als Frau und als Jüdin …« Frau Krüger seufzte vernehmlich. »Das machte sie überall zu einer Außenseiterin. Sie versuchte dazuzugehören, aber dabei verlor sie sich beinahe. Der Konflikt zwischen den Erwartungen der anderen und ihren eigenen Wünschen hat sie aufgefressen. Sie hat viel von ihrer Kraft dafür verbraucht, einen Platz in der Gesellschaft zu finden und ihn zu behaupten. Sie hat einen Adligen geheiratet, aber selbst das führte nicht automatisch zu einer gesellschaftlichen Anerkennung.«
Hannah machte eine Pause und sah die anderen an.
»Wie viel leichter wäre ihr Leben gewesen, wenn sie eine Rolle angenommen hätte? Stellen wir uns für einen Augenblick vor, sie wäre Hausfrau und treusorgende Ehefrau geworden. Sie hätte aufgehört zu schreiben …«
»Wie gern wäre ich das. Nur Hausfrau und treusorgende Ehefrau, das Schreiben und Malen und Denken können gern andere übernehmen. Aber man lässt mich leider nicht«, rief eine Frau aus dem Publikum dazwischen, und einige andere stimmten ihr zu.
Lisa nahm das nur am Rande wahr, sie war völlig gefesselt von Hannahs Worten. Es schien, als würde die Philosophin über sie selbst reden. Auch sie gehörte nirgendwo dazu. Man grenzte sie aus, als Frau, als Jüdin, als Antifaschistin. Man hatte sie sogar aus Deutschland ausgebürgert, sie war nicht länger Teil dessen, was die Nazis »Volksgemeinschaft« nannten. Aus ihrer Heimat hatte man sie vertrieben. In Frankreich wollte man sie auch nicht und sperrte sie ein. Aber wo sollte sie denn hin? Würde man sie jemals irgendwo wollen? Selbst wenn sie ein Visum für ein anderes Land bekäme, würde sie dort dazugehören, irgendwann? Würde man ihr erlauben, ein Leben zu führen, wie sie es sich erträumte? Oder würde man sie erneut einsperren, weil man sie für gefährlich hielt? Weil man meinte, sie würde anderen den Platz zum Leben und zum Arbeiten wegnehmen?
»… es ist nicht gut, sich nur auf diese Nicht-Zugehörigkeit zu berufen, seinen Platz im Leben nur über eine Negation zu finden.« Hannah Arendt unterbrach sich und nahm einen letzten tiefen Zug aus ihrer Zigarette, die so weit aufgeraucht war, dass sie sich die Finger verbrannte. Sie schnippte die Glut ab und steckte die Kippe in ihre Tasche. Aus den Tabakresten würde sie neue Zigaretten drehen. Alle machten das hier so. »Was ist es garstig, sich immer erst legitimieren zu müssen. Passt auf euch auf.« Mit diesen Worten drehte sich Hannah um und lehnte sich an die Seitenwand der Baracke. Die Frauen klatschten, einige gaben ihr etwas, das sie entbehren konnten. Lisa ging zu ihr hinüber und hielt ihr eine Zigarette hin.
»Danke«, sagte Hannah.
»Ich sage danke.« Lisa lehnte sich neben sie an die Wand. Sie hätte Hannah gern all die Fragen gestellt, die sie sich selbst gerade gestellt hatte. Wo sie hingehörte und was ein geglücktes Leben war. Ob es von Bedeutung war, dass sie gegen Hitler, auf der Seite der Gerechtigkeit gekämpft hatte, auch wenn es gerade so aussah, als hätte sie diesen Kampf verloren. Und woran bemaß sich das, ob man gewann oder verlor? Lag es in einem selbst, in dem Sinne, dass man wusste, dass man richtig handelte, oder entschieden andere darüber, und lag es nur am Ergebnis?
»Weißt du, es ist nicht unsere Schuld, wenn sie uns nicht haben wollen. Sie sind die Verbrecher, die Unmenschen, vergiss das nie.« Hannahs Stimme klang brüsk, so wie es ihre ganze Art war. Sie lebte, wie sie dachte. Genau und präzise, keine Geste, kein Wort zu viel. Sie zündete sich die Zigarette an und wandte sie sich zum Gehen.
Aber vielleicht war es auch besser, diese trüben Gedanken nicht zu vertiefen, dachte Lisa auf dem Weg zurück in ihre Baracke. Sie hatte sich schon am Vorabend in düsteren Ideen verstrickt, das tat ihr nicht gut. Es raubte ihr Kraft und Mut für den täglichen Kampf.
»Findest du auch, dass wir anders sind als andere Frauen?«, fragte Paulette, die neben ihr ging. Offensichtlich machte sie sich ganz ähnliche Gedanken.
»Du bist immerhin ordentlich verheiratet«, gab Lisa lachend zurück.
»Du doch auch. Mit Hans Fittko.«
Lisa schüttelte den Kopf. »Ich habe 1932 Gabo Lewin geheiratet, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es hat mir nichts genützt. 1938 sind wir beide ausgebürgert worden. Hans und ich hatten nie die richtigen Papiere, um zu heiraten.«