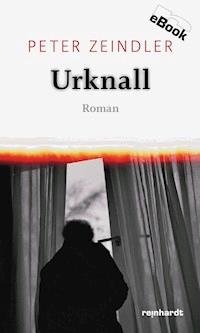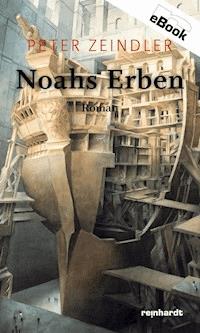Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reinhardt, Friedrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Konrad Sembritzki
- Sprache: Deutsch
Konrad Sembritzki, der Antiquar und ehemalige Agent in Diensten des deutschen Bundesnachrichtendienstes BND, erhält zu nächtlicher Stunde den mysteriösen Anruf eines Unbekannten, der sich mit ihm in der Nähe von Einsiedeln treffen möchte, um ihm brisante Informationen weiterzugeben. Allerdings wird der Mittelsmann ermordet aufgefunden, bevor es zum Treffen kommt. In der Folge erhält Sembritzki bei seinen Recherchen in Bern, Konstanz und Berlin immer mehr Hinweise, die auf einen Anschlag von Neonazis hindeuten, eine Aktion, die im mutmasslichen Zusammenhang mit dem Prozess gegen die Terroristin Beate Zschäpe steht. Und welche Rolle spielt in diesem Umfeld die mysteriöse Frau mit den makellosen Gesichtszügen, der Sembritzki an verschiedenen Schauplätzen immer wieder begegnet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Zeindler
Die weisse Madonna
Roman
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten© 2014 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel© eBook 2014 Friedrich Reinhardt Verlag, BaselLektorat: Beatrice RubinUmschlaggestaltung: h.o.pinxitFoto: Arman Zhenikeyev /©corbisISBN 978-3-7245-2015-3
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-1991-1
www.reinhardt.ch
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Seit Tagen zum ersten Mal wieder. Sembritzki griff zum Hörer, hob ab und legte auch gleich wieder auf. Er hatte keine Lust, jetzt mit einer fremden Person zu sprechen.
Die Melancholie, seit Langem seine treue Begleiterin, umarmte ihn an diesem letzten Februarabend des Jahres 2013 so fest, dass er zu ersticken glaubte. Er tastete nach dem Fenstergriff, um sich frische Luft zu verschaffen, doch als seine Finger das kalte Metall berührten, schreckten sie zurück. Seine Hand fiel herab und baumelte kraftlos an seiner Seite. Der Winter machte keine Anstalten, sich endlich davonzumachen und auch der Gedanke an den nahen Frühling vermochte seine Lebensgeister nicht positiv zu beeinflussen. Seit er vor einem halben Jahr seine vertraute Umgebung unten an der Aare unfreiwillig und endgültig verlassen hatte, wartete er umsonst auf einen Energieschub, der seinem Leben eine neue Richtung geben würde. Vorbei die Zeit, als er noch auf seinem Pferd Welf über die Berner Allmend ritt, sich vom Rauschen der Aare in den Schlaf schmeicheln liess. Immer wieder zu neuen Missionen in fremde Territorien aufbrach. Er hatte seine Miete nicht mehr bezahlen können und sich deshalb gezwungen gesehen, sich nach einer andern, preiswerteren Wohnung umzuschauen. Nach langem Suchen war er vor einem halben Jahr in diese etwas trostlose Umgebung in einem Aussenquartier umgezogen. Doch war er hier noch nicht wirklich angekommen. Die Kartonschachteln, vollgepackt mit vielen Büchern, waren noch immer unangetastet. Und jedes Mal, wenn er von seinem täglichen Erinnerungsparcours in der vertrauten ursprünglichen Umgebung am Ufer der Aare in seine neue Behausung zurückkehrte, absolvierte er eine Art Spiessrutenlauf, quälte sich im düsteren Flur durch die enge Gasse, gebildet von der Phalanx verschnürter und zugeklebter Schachteln und atmete erst auf, wenn er vor seinem Schreibtisch stand und auf den kleinen Stapel von Büchern blickte, die er kürzlich in der Universitätsbibliothek aufgestöbert und leihweise mit nach Hause genommen hatte. Zwar übte er den Beruf als Antiquar nicht mehr aktiv aus, doch seit vor bald dreissig Jahren das «Geburtstundebuch» des Martin Pegius Anlass zu einer schicksalhaften Mission nach Prag gewesen war, hatte ihn dieser Wissensbereich endgültig geprägt.
Es war dies das Ende einer unglückseligen Geschichte gewesen. Dass er sich damals gezwungen gesehen hatte, dieses kostbare Original zu verbrennen, erfüllte ihn noch heute mit Trauer und war wohl einer der Gründe, warum er im übertragenen Sinn ein Sternenhöriger geblieben war, hatte es doch in seinem Alltag immer wieder Momente gegeben, in denen er den Boden unter den Füssen verloren und sich deshalb an den Gestirnen und deren Konstellationen zu orientieren versuchte. Ein Faksimile dieses ersten astrologischen Lehrbuchs in deutscher Sprache, in dem der Arzt und Jurist Pegius im 16. Jahrhundert den Menschen, die kein Latein verstanden, einen wissenschaftlichen Zugang zu vielen Aspekten der Sternkunde ermöglichte, bildete noch immer das Herzstück seiner Bibliothek. Dass er sich jetzt seit seinem Umzug besonders mit Person und Werk eines Zeitgenossen des Martin Pegius, Paracelsus, intensiv befasste, der unter dem Namen Theophratus von Hohenheim vermutlich 1493, also noch ein halbes Jahrhundert vor Pegius in der Nähe von Einsiedeln geboren wurde, war auch darauf zurückzuführen, dass in der Biografie dieses Arztes und Alchimisten die Astrologie ebenfalls eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Paracelsus hatte die These vertreten, dass der von Gott erschaffene Mensch letztlich eine Art Zusammenfassung aller Dinge und Wesen im gesamten Kosmos sei. Seit Sembritzki sich jetzt aufs Altenteil zurückgezogen hatte, als Antiquar nur noch in beratender Funktion tätig war und auch die Kontakte mit seinen alten Kameraden vom Bundesnachrichtendienst gekappt waren, fühlte er sich manchmal etwas einsam und desorientiert. Besonders dann, wenn er auf seinen nostalgischen Spaziergängen am Ufer der Aare alten Bekannten begegnete, die sich nur beiläufig nach seinem Befinden erkundigten und ihn dann auch gleich mit einem Schwall von Informationen überfielen, in denen sie voller Enthusiasmus ihre neuen Interessensgebiete bis in jede Einzelheit darlegten und ihm so vermittelten, wie sinnvoll man doch das Rentenalter gestalten konnte. Und wenn diese Menschen endlich ihr Mitteilungs- und Selbstdarstellungsbedürfnis befriedigt hatten, setzten sie ihren Spaziergang auch schon beschwingt fort, während er etwas ratlos und traurig zurückblieb und sich fragte, ob diese mannigfaltigen Versuche dieser Rentner, der Leere des Alters und des Kontaktverlustes mit immer neuen Lernprozessen zu begegnen, wirklich einen Aufbruch zu neuen Horizonten darstellte, auf echtem Interesse beruhten oder nicht vielmehr eine Art von Überlebensaktivität waren. Weshalb sollte er in dieser Lebensphase noch einmal Cäsars «Commentarii de bello Gallico» in der toten Originalsprache lesen, warum sollte er sich jeden Tag mit Immanuel Kants «Kritik der reinen Vernunft» herumschlagen, warum sollte er alte Uhren sammeln, Heinrich Heines Balladen auswendig lernen oder Klavierunterricht nehmen? Um sich und seiner Umgebung zu beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehörte, dass er noch funktionierte, noch immer voller Zukunftspläne war?
Das einzige neue Element in seinem Leben war die Kochkunst, der er sich vermehrt zuwandte: Er kaufte Kochbücher, probierte Rezepte aus verschiedenen Ländern aus, holte sich so den Duft der Ferne ersatzweise in seine Küche und variierte die Rezepte nach eigenem Gusto und all das auch deshalb, um sich am Abend noch einmal kreativ zu betätigen, sich am Ende eines langen Tages etwas Gutes zu tun, sich zu verwöhnen und sich mit dem vergangenen, oft ereignislosen Tag zu versöhnen.
Um die einseitigen Begegnungen tagsüber mit seinen lästigen Bekannten zu vermeiden, rief er immer wieder einmal eine alte Freundin an. Sophie war Schauspielerin, mehr als zwanzig Jahre jünger als er, und kam für ihn als Geliebte schon deshalb nicht infrage. Manchmal besuchte er Theateraufführungen, an denen sie auf verschiedenen Kleinbühnen in der Umgebung mitwirkte. Als Entschädigung für seine Präsenz im Zuschauerraum erbarmte sie sich seiner und begleitete ihn oft auf seinen Spaziergängen an der Aare und hörte sich dann, vor Sembritzkis ehemaligem Wohnhaus angekommen, immer wieder geduldig die Geschichten um die historische Figur Casanovas an, der hier seine erste und einzige Berner Liebesnacht verbracht haben soll. Dass sich Sembritzki seit langer Zeit, abgesehen von Sophie, immer seltener in Frauengesellschaft bewegte und auch keine Gefühle in sich keimen spürte, die etwas mit Liebe zu tun hatten, überraschte ihn eigentlich nicht. All seine Frauenbekanntschaften hatte er auf seinen geheimen Missionen gemacht, und wenn er diese Frauen dann aus den Augen verloren hatte, der Faden gerissen, waren diese Begegnungen in seinem Gedächtnis zur Episode geschrumpft, als ob sie Teil einer ihm letztlich fremden Biografie gewesen wären. Und so trauerte er diesen versunkenen oder gestorbenen Liebschaften auch nie nach, hatte die Zuneigung dieser Frauen ja ohnehin nur der Person gegolten, die er gespielt hatte und nicht seinem wahren Ich. Seine vielen Identitätswechsel, die in seinem Leben bestimmend gewesen waren, hatten ihn zum distanzierten Beobachter gemacht, zu einem Eigenbrötler, der immer weniger zu spontanen Gefühlsausbrüchen fähig war, wenn sie nicht von Nebensächlichkeiten im Alltagsleben ausgelöst wurden.
Für den mittelalterlichen Heiler und Magier Paracelsus war das Wanderleben der einzige Weg gewesen, Weisheit zu erlangen. Für Sembritzki jedoch gab es keine verbindliche Definition von Weisheit, und wahrscheinlich vertiefte er sich deshalb immer wieder in die mystische Welt eines Pegius oder Paracelsus, weil er in dessen Leben und Werk Hinweise zu finden hoffte, die ihm dabei halfen, seine eigenen, oft rätselhaften Verhaltensweisen verstehen zu lernen.
Der einzige vertraute Partner und auch Gegenüber in seiner selbst gewählten Einsamkeit war letztlich die Spiegelung seines eigenen Ich, dieses rätselhafte Individuum, dem er immer wieder verwundert begegnete, das still vor sich hin alterte und bei dem er, wenn er es beim Rasieren anschaute, immer wieder schmerzlich die Symptome dieses Prozesses registrierte: Zuerst einmal wenn er dieses Gesicht betrachtete, sich dann aber auch die skurrilen Eigenheiten dieses Mannes im Spiegel in Erinnerung rief, die ihn immer mehr besetzten, wie zum Beispiel die Anzeichen von Geiz, die ihn daran hinderten, sich neue Hemden oder Pullover zu kaufen, die Gereiztheit, mit der diese Person auf das penetrante Gurren der Tauben vor seinem Fenster oder auf das Geschrei kleiner Kinder auf der Gasse reagierte oder das Unverständnis, mit dem sie jungen Leuten begegnete, die den Blick starr auf ihr Handy gerichtet ihre Bahn zogen. Immer wieder ging er zu diesem kauzigen Doppelgänger, zu diesem ihm letztlich fremden übellaunigen Alten, auf kritische Distanz und beobachtete dann wie ein Zuschauer, mit einem Gefühl der Befremdung, seine eigenen Verhaltensweisen. Er war Psychoanalytiker und Klient in Personalunion.
Paracelsus war der Meinung gewesen, dass ein hasserfüllter Mensch kaum dazu neige, sich selbst zu lieben und so die Harmonie seiner Lebenskräfte zerstöre. Das mochte auch der Grund sein, warum Sembritzki, letztlich ein harmoniesüchtiger Mensch, sich zwar nach Liebe sehnte, doch nie auf Dauer mit einer Frau hatte zusammenleben können, weil sich sein Alter Ego immer wieder in diese Beziehung eingemischt und sie letztlich zerstört hatte. Es war ihm in seinem bisherigen Leben nie gelungen, die Vorgabe des Paracelsus zu einem glücklichen Leben zu erfüllen. Er hatte besessen seine Doppelrolle gespielt, hatte immer wieder seine Identität gewechselt: Es war dies ein ewiges Hin- und Her zwischen dem Part des Observanten und dem des Beobachteten, das sein Leben ausgemacht hatte, ein Wechselspiel zwischen seinen beiden Identitäten, um sich vor Verletzungen zu schützen, um nicht demaskiert zu werden. Die Verstellung war sein Überlebenskonzept geblieben, auch wenn sie in dieser letzten Lebensphase eigentlich nur seine eigene in sich gespaltene Person betraf. Er war davon überzeugt, dass im Augenblick, wenn er wusste, warum er der war, der er geworden war, wenn er nicht mehr verhindern konnte, dass die beiden auseinanderklaffenden Teile seines Selbst zur Deckung kamen, er dem Tod den Zugriff erleichterte.
Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte erneut. Er zögerte, bevor er wieder zum Hörer griff. Der Fonduekäse schmolz bereits im Caquelon – es war jetzt nicht der Augenblick, sich auf ein längeres Telefongespräch einzulassen. Er ging in die Küche und nahm schnell das Caquelon mit dem Käsefondue vom Herd, bevor er sich meldete: «Hallo? – wer . . . ?»
Er hatte den ganzen Tag mit niemandem gesprochen; seine Stimme war ohne Kraft, versackte schon nach dem ersten Anlauf.
«Spreche ich mit Herrn Konrad Sembritzki?»
Der Anrufer war ein Mann, ein Deutscher, der mit kaum wahrnehmbarem sächsischem Akzent sprach.
«Ja.»
«Sie beschäftigen sich zurzeit mit Paracelsus?»
«Woher wissen Sie das?»
«Sie sind auf der Suche nach seinen verschollenen Werken. Das hat sich in meinen Kreisen herumgesprochen.»
«In welchen Kreisen verkehren Sie denn?»
«In Ihren Kreisen, Herr Sembritzki.»
Sembritzki versuchte sich in einem amüsierten Lachen.
«Was wissen Sie denn über mich?»
Die Antwort des Anrufers hörte sich an, als ob sie von einer Karteikarte abgelesen würde: «Konrad Sembritzki, geboren in Lyck, aufgewachsen in Mirow, in Ostpreussen. Beruf Antiquar. Seit 1960 Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes BND. Einsätze in Jordanien, Syrien, der Tschechoslowakei, der DDR, in Polen, Estland und Nordafrika. Jetzt im Ruhestand. Wollen Sie noch mehr hören über sich, Herr Sembritzki?»
Sembritzki holte tief Atem. Die Vergangenheit hatte ihn eingeholt und plötzlich wieder an die Oberfläche gespült. Es kam ihm alles so fremd vor, was er da gehört hatte, wie die Biografie einer andern Person. Er erinnerte sich an ein weit zurückliegendes Gespräch mit dem deutschen Sachbuchautor Jürgen Thorwald, Verfasser eines Buches über die grosse Flucht aus Ostpreussen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem Sembritzki viele Aspekte seines eigenen Schicksals wiedererkannte und ihm trotzdem all das wie ein Stück Fiktion vorkam. Seine Kindheit war eine einzige grosse Flucht gewesen, die sich später im übertragenen Sinn durch sein ganzes Leben hindurch fortgesetzt hatte. Und auch heute, scheinbar endlich zur Ruhe gekommen, war er noch immer ein Flüchtling geblieben: einer auf der Flucht vor sich selbst. Der Begriff Vaterland hatte sich ihm im Lauf der Jahre entfremdet. Und seit er in Bern wohnte, versuchte er immer wieder umsonst, sich einer Nation zuzuordnen. Vaterland? Land der Väter wäre wohl zutreffender.
«Sie sind . . . Antiquar?», fragte Sembritzki und versuchte, seine Stimme fest klingen zu lassen. Umsonst.
Das Lachen des andern klang künstlich, und entsprechend fiel auch seine Antwort aus: «Ich habe Freunde in Ihren Kreisen. Ich möchte Sie treffen, Herr Sembritzki. Ich kann Ihnen ein interessantes Angebot machen. Es gibt da eine scheinbar verschollene Schrift des Paracelsus, in der er sich mit der Schwarzen Pest befasst hat.»
Sembritzki atmete tief durch. Irgendwie wirkte die Situation vertraut. Konspirativ. Ein wenig inszeniert, künstlich, von gestern. Antiquiert. Doch er war ja Antiquar von Beruf. Und der Anrufer war möglicherweise ein Berufsgenosse, dem Sembritzkis frühere Agententätigkeit bekannt war. Oder war der Mann etwa selbst ein Agent? In wessen Auftrag?
«Ihr Name?», fragte Sembritzki nach einer langen Pause.
«Der Name tut nichts zur Sache. Sie kennen mich nicht persönlich. Doch wenn Sie darauf bestehen . . . ?»
«Ich bestehe darauf!»
Sembritzkis Antwort hatte sich autoritär angehört, wie ein Befehl. Und die Antwort kam denn auch umgehend.
«Vivaldi!»
Machte sich der Anrufer über ihn lustig?
«Ist das Ihr Familienname oder ist Vivaldi Ihr Lieblingskomponist?
«Wie Sie wollen.»
«Oder ist es Ihr Deckname?»
Der andere schwieg.
«Sie möchten mich besuchen?»
«Nein. Ich möchte Sie gern treffen. In der Nähe von Einsiedeln. In der Nähe der Teufelsbrücke.»
«Und warum ausgerechnet bei der Teufelsbrücke? Warum nicht hier in Bern? Sind Sie denn zurzeit nicht in meiner Nähe?»
«Doch. Ich rufe Sie von einer Telefonzelle aus an. Wenn ich mein Handy brauchen würde, könnte man mich orten. Ich werde observiert.»
«Von wem?»
«Das sage ich Ihnen, wenn wir uns morgen sehen. Ich will Sie jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen.»
«Also morgen bei der Teufelsbrücke?»
«Ja, bitte! In der Nähe der Teufelsbrücke wurde Paracelsus geboren. Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Ich warte dort auf Sie, auf dem Weg zwischen Egg und der Teufelsbrücke, ganz oben am Abhang, vor einer Nische mit einer Marienfigur. Sie können mich nicht verfehlen.»
Sembritzki zog die Schublade seines Schreibtischs heraus und tastete nach der Schachtel mit den Zigarillos. Seit er in dieser Wohnung lebte, hatte er seine skurrile Gewohnheit aufgegeben, sich in Augenblicken der Anspannung und des Nachdenkens einen Zigarillo zwischen die Lippen zu stecken und so lange darauf herumzukauen, bis das anstehende Problem gelöst war und der Zigarillo sich in seine Bestandteile aufgelöst hatte. Befreite ihn dieser Anruf aus seiner quälenden Gefangenschaft, die er in einer engen Zelle zusammen mit seinem andern Ich, seinem Alter Ego zu verbringen gezwungen war? Er steckte den Zigarillo zwischen die Lippen. Er fühlte sich fremd an. In seiner Wohnung roch es plötzlich nach Käse.
«Sind Sie noch dran?»
Sembritzki nickte verwirrt, bevor er seine Stimme wieder fand.
«Und um wie viel Uhr treffen wir uns?»
«Zwischen zehn und elf Uhr. Und dann werde ich Ihnen mehr erzählen: Von warmen oder Wildbädern. Und von der Schwarzen Pest.»
Sembritzki zögerte. Wenn er sich den Wünschen des Anrufers verweigerte, würde er es vielleicht im Nachhinein bereuen, und er wäre weiterhin Opfer seiner Einsamkeit. Er musste zusagen, auch wenn er letztlich dem Anrufer nicht traute.
«Ich komme!»
«Danke! Bis morgen!»
Der Mann hatte aufgelegt, bevor Sembritzki eine weitere Frage stellen konnte. Zum ersten Mal ärgerte er sich, dass er kein modernes Telefon gekauft hatte, auf dem man die Nummer des Anrufers identifizieren konnte, auch wenn es die Nummer einer öffentlichen Sprechanlage war. Doch hätte ihm diese Information wohl ohnehin nichts genützt, denn es war nicht anzunehmen, dass er so den Fremden hätte identifizieren können. Absender unbekannt!
Sembritzki wurde plötzlich von einer unerklärlichen Euphorie gepackt. Er setzte sich auf den Drehstuhl am Schreibtisch, nahm Anlauf, liess ihn rotieren, kam sich dabei vor wie ein Kind und stoppte die wilde Fahrt erst wieder, als er das penetrante Schrillen seiner Türglocke vernahm.
Er sprang auf und eilte zum Fenster, das bis zur Hälfte aus einer Milchglasscheibe bestand, um den Passanten den Einblick in seine Wohnung zu erschweren. Doch als er hinausschaute, sah er nur noch einen flüchtigen Schatten hinter der Hausecke verschwinden und hörte hastige Schritte, die sich in der Nacht verloren. Und bald darauf startete in der Nähe ein Auto. Hatte der Anrufer von vorhin Sembritzki heimlich beobachtet, vielleicht im Umweg über einen Spiegel, den er an einem Stab befestigt, in die Höhe gehalten hatte, bevor er ihn anrief?
Warum hatte er die Vorhänge nicht gezogen?
Sembritzki löschte die Tischlampe in seinem Arbeitszimmer, öffnete vorsichtig die Wohnungstür, tastete nach dem Lichtschalter im Treppenhaus, und als der Hausflur endlich in ein trübes flackerndes Licht getaucht war, schob er den Riegel der Haustür zurück, trat auf die Strasse, schaute sich noch einmal um und klappte dann das Paketfach seines Briefkastens auf. Er zögerte, bevor er die kleine gelbe Schachtel, die in der Mitte auf einem dünnen Bündel von Werbebotschaften und alten Zeitungen lag, mit dem Zeigefinger berührte. Wie lange war es her, seit er den Briefkasten zum letzten Mal geöffnet hatte? Als ob er sich allen Signalen der Aussenwelt verweigern wollte! Er hatte sich in seiner eigenen kleinen Welt eingeigelt, ein rückwärts gewandter Mann, ein Beschwörer der Vergangenheit. So sahen ihn wohl auch seine Nachbarn. Einmal mehr versuchte er, seine Situation zu umschreiben, sie in sein Bewusstsein zu rücken, in der vagen Hoffnung, etwas daran ändern zu können.
Vorsichtig tastete er die Umrisse des kleinen Pakets ab, bevor er es in die Hand nahm, dann ans Ohr hielt, schüttelte. Endlich ging er zurück in seine Wohnung, wo er wieder Licht machte und sich auf seinen Drehstuhl setzte und behutsam das gelbe Umschlagpapier von der Schachtel löste, das endlich den Inhalt preisgab. Sembritzki hielt eine weisse Kerze in der Hand, auf der in einem golden gerahmten Oval das Bild der Schwarzen Madonna von Einsiedeln zu sehen war.
Eine Art «Flashback» liess ihn erstarren und manövrierte ihn einmal mehr in die Rolle des passiven Zuschauers. Es war auf einer Mission in seine ursprüngliche Heimat Polen gewesen, in der eine Schwarze Madonna eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Die Madonna von Tschenstochau. Die Frau, die ihn an diese Heiligenfigur erinnerte, hielt ihn noch heute besetzt. Ihr Vorname? Helena! Er sah sie vor sich: ihre mandelförmigen Augen, hörte ihre Stimme, diesen flehentlichen Unterton, mit der sie seinen Vornamen auf Polnisch ausgesprochen hatte: Konradzie! Doch ihre körperliche Nähe, das Gefühl, ausgelöst durch die Heftigkeit, mit dem sie ihn umarmt hatte, vermochte er nicht mehr zu beschwören. Sie hatte damals Saiten in ihm berührt, die zuvor niemand zum Klingen gebracht hatte: Eine sehnsüchtige Liebesmelodie, die sowohl seiner versunkenen Heimat Masuren als auch diesem geheimnisvollen weiblichen Wesen gegolten hatte, der Reinkarnation seiner eigenen Mutter!
Sembritzki tastete die Konturen der Marienminiatur von Einsiedeln ab, betrachtete aufmerksam deren Gesichtszüge, in der Hoffnung, dass so weitere Erinnerungsfragmente freigesetzt würden. Umsonst. Dass das schwarze Gesicht dieser wächsernen Madonna von dünnen goldfarbenen und weissen Streifen durchzogen war, störte den positiv besetzten Gesamteindruck und weckte vielleicht deshalb in seinem Gedächtnis keine weiteren Bilder zu neuem Leben.
Das helle Glöcklein seiner Standuhr, ein Erbstück seiner verstorbenen Tante aus Polen, schlug zehn Mal. War es zu spät, seinen alten Freund Anton Bremer anzurufen, der ihm immer wieder einmal sein Auto zum privaten Gebrauch angeboten hatte? Bremer war ein ehemaliger Mitarbeiter der Botschaft der Bundesrepublik mit Sitz in Bern, heute in Rente, und der Stadt Bern und seiner Frau Dora, ebenfalls einer in der Schweizer Bundesstadt wohnhaften Deutschen, die er auf auf einem Botschaftsempfang kennengelernt hatte, treu geblieben. Dora war eine schlanke, energische Frau, die sich offenbar mit dem Gedanken ans Altern schwertat und wohl deshalb immer wieder die Gesellschaft jüngerer Frauen suchte und immer wieder einmal Vorlesungen an der Universität Bern besuchte, obwohl sie vor Jahren ein Studium der Geologie abgeschlossen hatte.
Die Vorstellung, am nächsten Tag mit der Bahn nach Einsiedeln zu fahren, Auge in Auge und Seite an Seite mit anderen Menschen, war Sembritzki zuwider. Er war zwar kein geübter Autofahrer, und er hatte auch schon seit Langem nicht mehr am Steuer gesessen, seit er seinen alten Volkswagen, diesen legendären Käfer mit geteiltem Rückfenster und Zwischengasschaltung zu Schrott gefahren hatte: über zwanzig Jahre her!
Mit Anton traf er sich in unregelmässigen Abständen immer wieder einmal, um bei einem Glas Weisswein die vergangenen Zeiten zu beschwören oder dann, wenn Sembritzki sich an seinem Computer unvermittelt mit einem unlösbaren Problem konfrontiert sah. Denn Anton war trotz seines Jahrgangs ein Fachmann in Sachen Computer und beschämte Sembritzki, der seinen PC vorwiegend als Schreibmaschine benutzte, immer wieder mit seinem Fachwissen. Er war also auf der Höhe seiner Zeit, und dennoch fuhr er noch immer dasselbe alte VW-Modell wie früher Sembritzki. Doch würde er heute mit der Zwischengasschaltung nicht mehr klarkommen. Und zudem würde ein alter Volkswagen die Aufmerksamkeit vieler Leute wecken. Auffälligkeit wollte er in diesem Fall um jeden Preis vermeiden. Er hoffte deshalb, dass sich Anton getrauen würde, ihm den BMW seiner Frau Dora zur Verfügung zu stellen.
Er griff zum Hörer und wählte Bremers Nummer. Es dauerte, bis dieser sich meldete.
«Habe ich dich geweckt?»
«Geweckt? Ich bin doch kein Schläfer wie du!»
Sembritzki hörte das schallende Lachen seines alten Freundes. Anton spielte also auf seine Vergangenheit in Diensten des deutschen Bundesnachrichtendienstes an.
Als er vor Jahren im Auftrag des BND auf Missionen in der ehemaligen Tschechoslowakei, der DDR, in Polen und Estland unterwegs gewesen war, hatte er immer wieder auf Antons Rückendeckung zählen können. Dieser war zwar als Pressereferent der Botschaft tätig gewesen, zusätzlich aber hatte er auch inoffiziell immer wieder mit dem BND zusammengearbeitet und hatte deshalb über Sembritzkis diesbezügliche Aktivitäten Bescheid gewusst. Seit seinem letzten Einsatz waren jedoch Jahre vergangen.
«Kannst du mir ein Auto ausleihen?»
«Ein Auto? Du meinst meinen alten Käfer? Wozu?»
«Ich möchte nach Einsiedeln fahren. Du weisst schon: Recherchen in Sachen Paracelsus.»
«Warum fährst du nicht mit der Bahn?»
Sembritzki hätte seinen alten Freund über den mysteriösen Anruf des Unbekannten informieren können, doch vielleicht hätte er so nur Antons spöttische Bemerkungen zu hören bekommen: Ob er denn nie loslassen könne? Immer noch auf Abenteuer aus? Entzugserscheinungen? Tempi passati!
«Du weisst: Paracelsus wurde in Egg bei der Teufelsbrücke geboren. Und Egg liegt leider etwas abseits.»
Sembritzki redete um den Brei herum, bis er seinem Freund endlich verständlich machen konnte, dass er gern mit dem BMW seiner Frau Dora nach Einsiedeln fahren möchte, schon deshalb, weil er mittlerweile etwas aus der Übung gekommen ist und mit einer Automatikschaltung besser zurechtkommen würde. Dora würde ja zurzeit ihr Auto ohnehin nicht benötigen, hatte sie sich doch, wie Anton ihm erzählt hatte, für einen ganzen Monat nach Indien abgesetzt, um sich dort einer Ayurvedakur zu unterziehen. Dass Anton unter ihrer Abwesenheit leiden würde, war nicht anzunehmen. Er litt ja auch nicht darunter, dass sie ihn aus der Ferne weder anrief noch sich per Internet oder SMS meldete. Im Gegensatz zu seiner Frau, die zehn Jahre jünger war als er und die kein Sitzleder hatte und deshalb immer wieder neue ferne Feriendestinationen auswählte, war Anton eher ein häuslicher Typ, der sich lieber im Umfeld von Bern bewegte, einen grossen Teil des Tages auch damit verbrachte, seiner verpassten Karriere als Seefahrer zu frönen und am Computer aus verschiedenen Versatzstücken alte Segelschiffe nachzubauen.
«Doras Auto?», fragte er zögernd. «Wenn sie es wüsste . . .!»
Sembritzki hatte nie ganz durchschaut, wie die Beziehung zwischen Anton und seiner Frau Dora funktionierte. Er wusste nur, dass es mindestens zu Anfang seine grosse Liebe gewesen zu sein schien, dass er sie vorbehaltlos bewunderte, und erst, als sie ihn heiraten wollte, war er etwas auf Distanz gegangen. Doch als er realisierte, dass sie nicht beabsichtigte, ihn zum Vater zu machen, dass ihr Heiratswunsch nichts mit einer Familiengründung zu tun hatte, willigte er dennoch ohne grosse Begeisterung ein. Er hatte wohl befürchtet, dass die Heirat auch das Ende der Leidenschaft bedeutete. Und letztlich hatte er recht behalten.
«Du musst ihr ja nicht sagen, dass du mir ihr Auto ausleihst, wenn sie ohnehin nicht zu Hause ist.»
«Ich habe verstanden», sagte Bremer emotionslos. «Das Auto steht morgen Vormittag gegen neun Uhr bereit. Bis dann!»
Er hatte aufgelegt, bevor sich Sembritzki hatte bedanken können. Das Käsefondue mochte er jetzt nicht mehr aufwärmen. Und es würde ihm ohnehin schwer im Magen liegen. Wie konnte er jetzt diesen Abend ausklingen lassen? Er war aufgeregt, wanderte in seiner Wohnung auf und ab, bis er sich wieder etwas beruhigt hatte, sich wieder an den Schreibtisch setzte, versunken in den Anblick der Schwarzen Madonna, die auf der Kerze abgebildet war.
Paracelsus hatte von Menschen berichtet, die den sogenannten «Schadzauber» praktizierten, indem sie ihre Feinde in Wachs nachbildeten, sie dann vergruben, mit Steinen beschwerten und sie so stellvertretend aus dieser Welt beförderten. Wie sollte er jetzt das Geschenk des unbekannten Anrufers interpretieren, der offenbar über Werk und Person des Paracelsus gut informiert war? Die Madonna eignete sich ja nicht als Feindbild. Sie war ein Objekt der Anbetung. Und Paracelsus hat den Ruf, einer der grössten Marienverehrer in der Geschichte der Christenheit gewesen zu sein.
Sembritzki suchte in der Schreibtischschublade nach einem Streichholz, um damit den Docht der Kerze anzuzünden. Doch das Streichholz zerbrach, bevor es Feuer gefangen hatte. War das ein Wink des Schicksals?
Er stellte die Kerze wieder auf den Schreibtisch zurück, trank sein Glas Veltliner wie jeden Abend und ging dann ins Bett. Doch es dauerte, bis er endlich einschlafen konnte.
2. Kapitel
Am Tag darauf sass er schon um acht Uhr in der Früh am Küchentisch reisefertig vor einer Tasse Kaffee. Langsam blätterten die Krümel eines knusprigen Croissants in seinen Jackenärmel. Andere fanden den Weg in die Tasse, wo sie sich gefügig der Kreisbewegung, ausgelöst durch den rotierenden Löffel, anpassten. Angewidert starrte Sembritzki auf sein blondes Butterhörnchen, das sich unter dem Zugriff von Daumen und Zeigefinger langsam in seine Bestandteile auflöste. Er starrte auf seinen kleinen Finger, der steil gegen die Decke zeigte. Dann wanderte sein Blick auf seine übereinandergeschlagenen Beine: eine sogenannte Viererposition. Typisch amerikanisch. Von oben sieht diese Beinhaltung aus wie eine Vier: Der Knöchel des rechten Fusses ruht auf dem Knie des linken Beines. Im Zweiten Weltkrieg soll man amerikanische Spione an dieser Beinhaltung erkannt haben. Was solls! Er war nicht Amerikaner. Was war er? Deutscher? Schweizer? Pole? Er war ein Spion a. D. Ausser Dienst!
Er schob die Tasse zurück, wischte die Krümel mit dem Jackenärmel vom Tisch und stand entschlossen auf. Als er kurz nach neun Uhr bei seinem Freund eintraf, der nur fünf Minuten entfernt wohnte, wurde er dort bereits erwartet. Der kleine schwarze BMW stand auf dem Vorplatz zur Garage. Bremer sass am Steuer und blätterte in der neuen Tageszeitung. Wie immer trug er ein weisses Hemd und eine dunkelblaue Krawatte. Dieses Outfit war schon früher sein Markenzeichen gewesen, und er war dabei geblieben, auch nach seiner Pensionierung. Als Sembritzki auftauchte, machte Anton Bremer keine Anstalten auszusteigen, und so setzte sich Sembritzki neben ihn auf den Beifahrersitz und wurde auch gleich von einer Parfumwolke eingehüllt, Doras unverwechselbarer Duftmarke, die sie vielleicht deshalb zurückgelassen hatte, um ihrem Mann ihre Omnipräsenz in Erinnerung zu rufen.
«Ich nehme nicht an, dass du mit dem Navi klarkommst. Ich habe deshalb deine Fahrt bereits programmiert.»
Sembritzki war irritiert. Diese distanzierte Begrüssung passte nicht zu ihrer Beziehung, die eigentlich freundschaftlich, unproblematisch war. Er kam sich vor wie ein Befehlsempfänger. Doch bevor er seinen Unmut äussern konnte, war Anton schon ausgestiegen, hatte wie ein Taxifahrer die Tür auf der Beifahrerseite geöffnet und Sembritzki bedeutet, auszusteigen, und sich ans Steuer zu setzen. Und schon war er winkend im Haus verschwunden, bevor sich Sembritzki auf der Fahrerseite eingerichtet hatte.
Endlich startete er den Motor und fuhr los. Und schon meldete sich eine ihm fremde Frauenstimme und dirigierte ihn in Richtung Autobahn. Er folgte ihren Anweisungen, auch wenn er sich dabei schlecht fühlte. Schulerinnerungen holten ihn ein: Damals in der Volksschule hatte die Lehrerin auf Klassenausflügen die Gruppe nicht angeführt, sondern hatte von ganz hinten mit lauter Stimme die Richtung vorgegeben. Und auch seine Mutter hatte ihm jeden Morgen, wenn er zur Schule ging, vom Fenster aus noch Anweisungen gegeben, wie er sich auf der Strasse zu verhalten habe und dass er sich auf die Fragen der Lehrerin immer als Erster melden solle. Dass einen alternden Menschen vieles wieder einholt, was er in der Jugend erlebt hat, davon war schon Paracelsus überzeugt gewesen.
Auf der Autobahn angekommen, entspannte Sembritzki sich endlich etwas. Die Dame in Anton Bremers Diensten würde ihn jetzt wohl eine Weile in Ruhe lassen. Doch schon bald fordert sie ihn überraschend auf, die nächste Ausfahrt zu nehmen: Er sollte durch das Emmental und anschliessend durch das Entlebuch die Stadt Luzern ansteuern. Sembritzki gehorchte widerwillig, schon deshalb, weil er ihr keine Alternativen entgegensetzen konnte. Auf der Fahrt durch die verschneite Landschaft versuchte er, sich die Frau vorzustellen, deren Befehlen er sich unterwarf. Sie hatte braunes, kurzgeschnittenes Haar, ein ovales Gesicht und trug eine Brille mit getönten Gläsern, hinter denen sie ihre wässrigen blaugrauen Augen verbarg. Sie war nicht modisch gekleidet, bevorzugte sogenannte Deuxpièces in gedeckten Farben. Und sie war noch zu haben. Nur – wer wollte denn mit dieser dominanten Frau, die unbeirrt die Richtung vorgab, sein Leben teilen?
Als sie ihn kurz vor Luzern in Richtung Küssnacht dirigieren wollte, verweigerte er ihr die Gefolgschaft, schaltete entschlossen und trotzig wie ein Kind das Navigationsgerät aus und wechselte auf die Autobahn in Richtung Zug. Er wusste, dass er jetzt einen Umweg in Kauf nehmen musste, doch ihr Vorschlag, bei diesen winterlichen Verhältnissen die direkte Linie über eine Passhöhe anzupeilen, verstand er als Mutprobe, wie früher, als der Turnlehrer ihm einen Kopfsprung rückwärts vom Dreimeterbrett befohlen hatte.
Die Fahrt zog sich hin, und immer wieder geriet Sembritzki, von einem Gefühl der Einsamkeit befallen, in Versuchung, das Navi erneut einzuschalten, um wenigstens eine Stimme zu hören, die fiktive Nähe signalisierte. Da die Frau jedoch bestimmt auf ihrer Richtungsvorgabe beharrte, würde es nur zum Streit kommen, und letztlich würde sie sich ihm verweigern und ihn endgültig verlassen, wie manche Frau, die Sembritzki auf seinen Missionen kennengelernt hatte. Immer war er allein nach Bern zurückgekehrt, ohne Begleiterin, aber um eine Illusion ärmer, als er ausgezogen war.
Endlich hatte er das Ufer des Zürichsees erreicht und atmete auf, als er bald einmal auf dem Hinweisschild den Ortsnamen Einsiedeln las. Die Unterstützung seiner Reisebegleiterin war jetzt endgültig nicht mehr gefragt. Er fuhr flott dahin und bemerkte deshalb erst im letzten Augenblick den unscheinbaren Wegweiser, der die Richtung nach Egg anzeigte, und er stellte sich auch gleich den schadenfreudigen Gesichtsausdruck seiner Reisebegleiterin vor, als er diese Ausfahrt verpasste und zu einem U-Turn gezwungen wurde:
«Hättest du auf mich gehört!»
Das Dorf Egg wirkte menschenleer. Er begegnete nur einem einzigen Menschen, der ihm auf der Dorfstrasse breitbeinig entgegenkam, die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen, das halbe Gesicht mit einem roten Wollschal zugedeckt, das Handy am Ohr, was bei dieser Erscheinung etwas asynchron wirkte und Sembritzki misstrauisch stimmte. Wurde er etwa hier schon erwartet?
Es dauerte, bis er gegenüber einer Holzbaufirma einen kaum belegten Parkplatz entdeckte, wo er seinen BMW neben zwei hellblauen Firmenautos einparkte. Das erste Geräusch, das er beim Aussteigen hörte, war der penetrante Schrei einer Kreissäge. Und dann entdeckte er den kleinen gelben Wegweiser, der ihm die schmale Strasse anzeigte, die zur «Tüfelsbrugg» führte, vorbei an einem einsam dastehenden Haus, das wohl erst kürzlich von einer Feuersbrunst heimgesucht worden war. Ein verkohlter Dachstuhl und der geborstene Kamin im verwilderten Garten zeugten noch von der Katastrophe. Ein einsamer Gartenzwerg mit vergnügtem Gesichtsausdruck stand am Wegrand und spielte auf seiner Handharmonika eine Abschiedsmelodie auf sein verlorenes Glück. Weit und breit keine Menschenseele. Nur in der Ferne war plötzlich eine Polizeisirene zu hören, die aber auch gleich wieder verstummte. Sembritzkis Weg führte weiter an einem scheinbar verlassenen stattlichen Gebäude vorbei, vor dem eine grosse Tafel aufgestellt war: «Achtung Kinder!» Ihm war, als ob er seinen eigenen Lebensweg noch einmal abschreite, diesmal ohne den Anweisungen einer anonymen Frau zu gehorchen. Verbrannte, zerstörte Häuser hatten damals seinen Schulweg gesäumt, und Vater war er ja selbst nie geworden. Freiwillig oder unfreiwillig. Er hatte ja ohnehin nur immer Frauen kennengelernt, die sich der Mutterschaft verweigerten.
Endlich entdeckte er an der Wegbiegung die aus groben Felsbrocken zusammengebaute Nische mit der Statue der Madonna. Sie trug ein weisses Kleid und einen blauen Umhang, stand einsam da inmitten von Blumen, den Blick himmelwärts gerichtet. Sembritzki schaute sich umsonst nach dem Mann um, mit dem er sich hier hätte treffen sollen. Auf den ersten Blick entdeckte er auch keine Hinweise, die auf die kürzliche Anwesenheit des Unbekannten hindeuteten. Die Blumensträusse schienen nicht mehr ganz frisch zu sein, einzig eine weisse Rose, die mitten in einem Strauss gelber Tulpen steckte, wirkte makellos. Sie war aus Plastik.
Sembritzki schaute auf die Uhr und setzte sich dann auf die Bank. Es war halb zwölf Uhr. In diesem Augenblick sah er unten bei einem Gehöft, das den Blick auf die Teufelsbrücke verwehrte, ein Sanitätsauto auftauchen. Es fuhr mit träge rotierendem Blaulicht, doch ohne eingeschaltetes Signalhorn den Hügel hinauf, dann an Sembritzki vorbei in Richtung Egg, gefolgt von einem Streifenwagen der Polizei, auch dieser ohne Blaulicht und Sirene. Sembritzki rappelte sich hoch und stellte sich mit gebeugtem Kopf und gefalteten Händen vor die Nische mit der Madonna. Doch sein Ablenkungsmanöver schien nicht zu funktionieren. Er hörte, wie das Polizeiauto seine Fahrt verlangsamte und dann in seinem Rücken anhielt. Noch regte er sich nicht, doch dann spürte er eine Hand auf seiner Schulter, und er drehte sich langsam, scheinbar verwirrt um. Ein junger Polizeibeamter in Uniform stand mit verlegenem Lächeln vor ihm und fragte, ob er denn schon länger hier unterwegs sei und ob er nicht zufällig ein Auto, einen Motorrad- oder Radfahrer habe vorbeifahren sehen? Sembritzki schüttelte wortlos den Kopf.
«Ich bin als Tourist hier.»
«Können Sie sich ausweisen?»
Sembritzki zögerte, überlegte kurz, ob er seinen alten Pass, der ihn als Stanislaw Klabund auswies, hinstrecken sollte, entschied sich dann jedoch, dem Beamten seine korrekte Identitätskarte zu zeigen. Er sah, wie der Polizeimann die Lippen bewegte, als er den Namen Sembritzki stumm buchstabierte. Täuschte er sich oder hatte ihn in diesem Augenblick der Fahrer des Streifenwagens mit seinem Handy fotografiert?
Der junge Beamte gab ihm das Ausweispapier zurück, salutierte andeutungsweise und wandte sich ab. Sembritzki schaute dem Auto, dessen Blaulicht jetzt hastig zu rotieren begann, nach, bis es in der Kurve verschwand. Er warf der Madonna einen letzten verzweifelten Blick zu und machte sich enttäuscht auf den Rückweg. Er beschloss, nach Einsiedeln zu fahren, dort in der Klosterkirche der Schwarzen Madonna seine Referenz zu erweisen, in der Hoffnung, dass die Kerze, die ihm der Unbekannte in den Briefkasten gelegt hatte, als Hinweis zu verstehen war, sich im Zweifelsfall neu zu orientieren, den Ersatztreffpunkt in der Klosterkirche anzusteuern. Er fuhr emotionslos durch eine verschneite, von Bergen umringte Landschaft. Er hatte nichts übrig für verschneite Landschaften, und auch die Berge faszinierten ihn nicht. Als ob seine Sehnsüchte an den steilen Felswänden abprallten, daran gehindert würden, abzuheben, einen fernen Horizont anzusteuern, wo er zwar in diesem Leben nicht ankommen würde. Berge waren für Sembritzki nur aus der Ferne, als Dekoration, als Postkartenerlebnis auszuhalten. Zwar wohnte er seit Jahren in Bern, in einer Stadt, in der die vielen markanten Berge mehr als nur Teil des Panoramas waren. Warum er sich in Bern zu Hause fühlte, hatte jedoch vor allem mit der Atmosphäre der Stadt zu tun, mit dem Gefühl von Geborgenheit, das sie auslöste, wenn er unter den Lauben flanierte oder an der Aare, im vertrauten Mattenquartier spazieren ging. Zwar weckte der dahingleitende Fluss seine Sehnsucht nach der Ferne, nach andern Welten, nach einem undefinierten Ziel, doch gleichzeitig beschwor das Rauschen des Wassers auch Heimatgefühle. Heimatgefühle hatte er auch dann, wenn er den gemütlichen, so wenig aggressiven Berner Dialekt hörte, den er zwar verstehen, aber selbst nicht sprechen konnte.
Sembritzki warf einen kritischen Blick auf die nahen Schwyzer Vorzeigeberge, den grossen und den kleinen Mythen, und er erinnerte sich an eine Textpassage aus einem Werk des Paracelsus, der wusste, dass zu seiner Zeit Menschen Zuflucht in den Bergen gesucht hatten, weil sie davon überzeugt waren, dass die lebenserfahrenen Bergbewohner den Zugang zu naturnahen Arzneien hatten, die sie im Kampf gegen Seuchen einsetzen konnten.
In Einsiedeln angekommen, parkte er sein Auto auf dem grossen Platz vor der Klosterkirche. In der nahe gelegenen Bäckerei kaufte er sich ein Sandwich und stand dann kauend und nachdenklich eine Weile vor dem Gnadenbrunnen, der den Aufgang zur Klosterkirche dominierte. Als er den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, und weil er jetzt durstig war, trank er vom heiligen Wasser, das aus einer der vierzehn Röhren des Brunnens sprudelte, zögerte, als er sich bewusst wurde, dass ihn wohl jemand dabei beobachten und realisieren könnte, dass er nur auf profane Weise seinen Durst löschen wollte und nicht aus religiöser Überzeugung heraus seine Lippen befeuchtete. Deshalb beschloss er, das ganze Ritual zu absolvieren, das auch die Pilger auf dem Jakobsweg, unterwegs nach Santiago de Compostela, vor dem Betreten der Klosterkirche andächtig begingen: Er umrundete den Marienbrunnen und nahm von jeder der vierzehn Röhren einen Schluck. Dann ging er hinüber zu den Arkaden, wo die Devotionalien verkauft wurden und wo er im Vorbeigehen unter den vielen feil gebotenen Andenken dieselbe Kerze mit der Schwarzen Madonna entdeckte, die seit gestern bei ihm zu Hause auf dem Schreibtisch stand. Er zögerte, ob er ein Double der Gnadenfigur kaufen sollte, verwarf jedoch den absurden Gedanken und betrat dann durch die rechte seitliche Eingangstür endlich die Klosterkirche.
Sein Blick wurde auch gleich vom Original der auf der Kerze abgebildeten Frau, der Schwarzen Madonna in der Gnadenkapelle, angezogen, die allerdings an diesem Tag das lila Fastenkleid trug und nicht das Osterkleid wie auf der Kerze. Die Bankreihen vor dem Gnadenbild waren nur spärlich besetzt. Zuhinterst knieten zwei Nonnen, und ein Grossvater mit seinem Enkel hatte sich in der dritten Reihe niedergelassen. Sembritzki setzte sich ganz aussen in die zweitvorderste Reihe und richtete seinen Blick scheinbar erwartungsvoll auf die hinter Gittern eingeschlossene Madonna. Worauf wartete er denn? Auf ein Zeichen der Muttergottes?
Die schnellen Schritte einer Frau in seiner unmittelbaren Nähe schreckten ihn auf. Als er den Kopf nach rechts drehte, streifte der Pelz einer Jacke seine Nase. Die Frau, der die Jacke gehörte, setzte sich etwas versetzt in die vorderste Reihe, sodass Sembritzki sie im Profil hätte sehen können, wenn nicht ihre rechte Gesichtshälfte von ihren braunen, von dünnen blonden Streifen durchzogenen Haare abgedeckt gewesen wäre. Sie richtete sich auf, hob ihren rechten Arm, streckte den Zeigefinger in die Höhe, drehte die Hand im Gelenk, sodass deren Innenfläche in Sembritzkis Richtung wies und in dieser Stellung eine Weile verharrte. Dann liess sie ihren Arm wieder sinken. Der ganze Bewegungsablauf hatte inszeniert gewirkt, und trotzdem fühlte sich Sembritzki direkt angesprochen. Hatte sie ihn gemeint? Wie wohl die Frau von vorn aussah? Langsam setzte er ihre Züge zu einem Ganzen zusammen: Sie hatte ein ovales Gesicht, ihre schmale Nase teilte ihr faltenloses strahlend weisses Gesicht in zwei symmetrische Hälften, ihre schweren Lider deckten die Hälfte ihrer Augen zu, ihr Mund war klein, die Lippen leicht geschürzt. Es dauerte eine Weile, bis ihm bewusst wurde, dass er in der Fantasie der fremden Frau die Gesichtszüge der Schwarzen Madonna verpasst hatte. Oder war es das imaginäre Antlitz seiner Weggenossin im Auto, deren Anweisungen er sich verweigert hatte? Doch hatte diese Frau in seiner Fantasie nicht eine Brille mit getönten Gläsern getragen?